Es ist kein Witz, daß die Ostfriesen das Watt bei Ebbe gelegentlich als Bauland anbieten – an ahnungslose Festland-Bayern z.B.. Selbst der große nordische Künstler Emil Nolde, dessen Vater einst friesischer Bauer war, hat einmal – beim Kauf des Hofes Utenwarf in Nordfriesland – nicht bedacht, daß das „ganze Land“ im Winter unter Wasser stand, „ja sogar im Sommer überschwemmte“. Gerade als er sich damit abgefunden hatte, „wurden die Grenzen direkt vor unser Haus und Land gelegt und wir an Dänemark abgetreten“. Schon bald rückten dänische Ingenieure an, die eine künstliche Entwässerung des Gebietes vorbereiteten. Als früher Ökologe erstellte Emil Nolde daraufhin einen landschaftsschonenderen Gegenentwurf. „Als ich durch Zufall erfuhr, daß der Entwässerungsplan politisch sei – da war es mir klar, daß meine Arbeit in dieser Sache verlorene Mühe war“.
Man sagt, die Friesen kommen bereits mit einem Bausparvertrag auf die Welt. Tatsächlich könnte die „Blut und Boden“-Formel eine ursprünglich friesische Parole gewesen sein, obwohl die Nazis dann die „nordische Kunst“ doch vorsichtshalber ächteten – und u.a. Emil Nolde mit Malverbot belegten.
Wiewohl Bauern und Seefahrer, besteht die eigentliche Kulturleistung der Friesen in der Landgewinnung. Das Husumer Nissenmuseum – einst von einem friesischen Auswanderer, der in Amerika reich wurde, gestiftet – ist deswegen auch und vor allem der friesischen Deichbau-Kunst gewidmet. Ein anderer Auswanderer – nach Deutsch-Südwest-Afrika, Sönke Nissen, finanzierte sogar die Eindeichung eines ganzen nach ihm dann benannten Koogs, inklusive der darin errichteten riesigen Bauernhöfe. Und der Husumer Dichter Theodor Storm wurde nach seinem Tod vor allem mit seinem Deich-Drama „Der Schimmelreiter“ bekannt. Umgekehrt benannte man einen nach dem Zweiten Weltkrieg eingedeichten Koog nach seinem Novellen-Held, den Deichgrafen „Hauke Haien“. Einen zuvor eingedeichten Koog hatte man nach „Adolf Hitler“ benannt und das Letzte Aufgebot des Krieges mußte dann – zusammen mit den Insassen des KZ Husum – einen „Friesenwall“ aufschütten – gegen eine ziemlich unmögliche zweite alliierte Invasion vom Wattenmeer her.
Durch das selbstgeschaffene Land entsteht eine ganz eigene Bindung daran. Schon den römischen Gelehrten Gajus Plinius Secundus hatten einst die Friesen ins Grübeln gebracht: dieses „armselige Volk“, das auf „hohen Erdhügeln“ in Schilfhütten lebt und mit „getrocknetem Kot“ seine kärglichen Speisen kocht, damit sich „ihre vom Nordwind erstarrten Eingeweide erwärmen“. Bei Flut, „wenn die Gewässer die Umgebung bedecken, gleichen sie mit ihren Hütten den Seefahrern, Schiffbrüchigen aber, wenn die Fluten zurückgetreten sind“. Dennoch wollten die Friesen sich partout nicht den reichen, zivilisierten Römern unterwerfen: „wahrlich,“ seufzte Plinius, „viele verschont das Schicksal zu ihrer Strafe“.
Verzweifelt wehrten sich die Friesen – in Sonderheit die sich selbst regierenden Kirchspiele der „Bauernrepublik Dithmarschen“ – auch noch im Jahre 1500, als der holsteinische Herzog, zugleich dänischer König, sie mit einem starken Ritter- und Landsknecht-Heer zu unterwerfen suchte. Die von den Bauern aufgrund ihrer Hartnäckigkeit und der winterlichen Wegelosigkeit auf dem von ihnen selbst geschaffenen Land gewonnene „Schlacht bei Hemmingstedt“, schuf endlich – im Verein mit ihrer Bearbeitung zum Mythos – eine markante Eigensinnigkeit, an der bis heute herumgerätselt wird.
So fragte sich z.B. 1977 der einst aus Helgoland ausgewanderte Redakteur der New Yorker Zeitung „Frisian Roundtable“, ob wenigstens „unser inneres Friesland überleben wird?“. Ihm antwortete ein Vorstandsmitglied der niederländischen „Fryske Akademy“ in Leeuwarden: „Wenn das Eigene ausschließlich auf die Sphäre der privaten Liebhaberei beschränkt bleibt, ist es eine verlorene Sache“.
In einem Vortrag über „Die große und die kleine Welt“ – gehalten auf dem 15. Friesenkongreß in Aurich – bezeichnete der Philosoph Hermann Lübbe den „Regionalismus“ als das „Ringen um Heimat“, dem eine wichtige kompensatorische Funktion angesichts der sich beschleunigenden „zivilisatorischen Innovation“ zukomme. In der Zeitschrift „Nordfriesland“ widersprach ihm daraufhin der Kieler Soziologiestudent Harm-Peer Zimmermann, der eine „Analyse des Wesens des Heimatgefühls“ sowie eine „historische Ableitung der gesellschaftlichen und politischen Bedeutung“ des von Lübbe konstatierten „Vertrauensschwunds“ und „Identitätsverlusts“ vermißte.
„Wie in Gorleben,“ behauptete der Student demgegenüber, „so entsteht Identität überall in der Auseinandersetzung mit dem Alltag. Das Glück stellt sich nicht durch einfache Erinnerung der Vergangenheit ein“. Das war – 1982/83 – durchaus noch klassenkämpferisch gemeint – und vor allem gegen „Musealisierungen“ gerichtet.
Desungeachtet sind z.B. die einst armen Krabbenfischer, die es dann mit sozialdemokratischer Hilfe langsam zu Schiffseignern brachten – heute alle in der CDU beheimatet, ebenso die letzten vier noch existierenden Miesmuschelfischer, deren Tätigkeit von einem „Miesmuschel-Management-Plan (MMP) durchgeregelt wird. 1999 fanden sie sich zu einer Aktionseinheit mit den Kleinbauern, die die Salzwiesen im Vorland der Deiche mit Schafe beweiden, zusammen: auf der Deichlinie zündeten sie Mahnfeuer an. Damit wollte ihre „Allianz für die Westküste“ einen schleswig-holsteinischen Kabinettsbeschluß zur Erweiterung des Nationalparks Wattenmeer abwehren. Die US-Journalistin A. Shrivastava sah darin das „Potential eines umgekehrten Gorlebens“ – also einen reaktionären, antiökologischen Widerstands.
Tatsächlich ging es aber bei beiden Bauernprotesten – im wendtländischen Gorleben wie an der schleswig-holsteinischen Westküste – um die Gefährdung ihrer landwirtschaftlichen Existenz, gegen die sich sich zur Wehr setzten. Dort ist es der immer noch geplante Bau eines Nuklearen Entsorgungszentrums (NEZ) und hier die ebenfalls von oben verfügte Ausweitung von Naturschutzgebieten – zu Ungunsten der landwirtschaftlichen Nutzfläche. Die Anfänge dieses bäuerlichen Widerstands reichen bis nach Whyl im Dreyländereck, wo die bundesdeutsche Anti-AKW-Bewegung ihren Anfang nahm. Weitere Orte, in denen diese Bewegung kulminierte, waren dann Wackersdorf in Oberbayern und Mutlangen nahe Schwäbisch-Gemünd.
Es scheint fast, dass die nachkriegsdeutsche Linke im Westen, wiewohl marxistisch-proletarisch orientiert, eher bei den Bauern auf dem Land als bei den Arbeitern in der Fabrik ein Echo auf ihre eigenen Kämpfe fand und findet. Man kann es auch so sagen: Der bäuerliche Widerstand bot den intellektuellen Linken in der BRD immer wieder Möglichkeiten für eine Massenbasis – zur Ausweitung ihrer Kämpfe, wobei die Bewegung sich jedoch auch immer wieder spaltete – in militante und weniger militante bzw. in legale und illegale.
Im Gorlebener „Stiftung Unruhe Info“ heißt es 2001: „Die Bürgerinitiative Lüchow-Dannenberg und die Bäuerliche Notgemeinschaft könnten den ‚Autonomen‘ wenigstens klammheimlich dankbar sein, dass gerade wir und nicht sie die zentrale Zielscheibe dieses gesellschaftlichen Ausgrenzungsbemühens sind“. Oft genug gerieten jedoch auch die unvermummten Bauern ins Visier von Polizei und Staatsschutz. In Gorleben war das insbesondere der Bauer Adi Lambke, der darüber inzwischen auch auf einer eigenen Webpage regelmäßig berichtet. „Mein Trecker und ich“ heißt es dort z.B. an einer Stelle. Es gibt in diesen Protestbewegungen mittlerweile einen eigenen Traktorwortschatz: Treckerdemo, Demotrecker, Treckerblockade usw.. Gelegentlich operiert man sogar mit Spielzeugtreckern. 1979 veranstalteten die Gorlebener einen Trecker-Zug nach Hannover und im Jahr 2000 einen nach Berlin durchs Brandenburger Tor. Die Polizei reagiert darauf mit Treckerzerstörungen, Treckerstillegungen und Führerscheinentzügen.
Rückblickend meinte 2005 der SPD-Landrat Hans Schuierer des Landkreises Schwandorf, wo man sich jahrelang gegen den Bau der Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf wehrte: „Für unsere Region war das eine furchtbare Zeit. Wenn man sich vorstellt, wie viele Strafverfahren gegen friedliche Demonstranten liefen. Wie sich die Polizeiführung verhielt, dann kommt einem der Zorn hoch. Die Polizeihunde, die Schlägertrupps aus Berlin, wie die gewütet haben. Doch der fünfjährige Kampf hat sich gelohnt. Wir haben an dem Standort, wo die WAA errichtet werden sollte, inzwischen ein Industriegebiet und somit einen guten Tausch gemacht. Anfangs versprach die Betreibergesellschaft DWK 3200 Arbeitsplätze in der WAA, später 1600, dann 1200. Im Industriegebiet haben wir heute 4000 Arbeitsplätze…Ich muss ganz ehrlich sagen: Wir haben diese Autonomen gebraucht. Denn die Regierung hätte uns noch zehn Jahre um den Zaun rumtanzen lassen.“
Wenn mich nicht alles täuscht, begann dieser bäuerliche Widerstand schon vor dem Zweiten Weltkrieg – mit der „Landvolkbewegung“ in den späten Zwanzigerjahre – von der schleswig-holsteinischen Westküste aus, damals noch ohne Trecker.
Diese Bauernkämpfe hatten zum Hintergrund eine massive Agrarkrise – im Zusammenhang der Weltwirtschaftskrise, von der vor allem die dortigen Mittelbauern betroffen waren, insofern sie als Viehmäster (Gräser) eine spekulative Landwirtschaft betrieben, d.h. sie nahmen Kredite auf, um im Frühjahr Mastvieh zu kaufen, dass sie anschließend mit Gewinn wieder zu verkaufen hofften. Weil aber immer mehr Billigimporte aus dem Ausland auf die Preise drückten, mußten viele Bauern Konkurs anmelden, zumal sie auch noch mit jede Menge Steuern belastet wurden. Bis 1932 wurden 800.000 Hektar Land zwangsversteigert und über 30.000 Bauern mußten ihre Höfe aufgeben.
„Keine Steuern aus der Substanz!“ das war dann auch die Parole, unter der am 28. Januar 1928 140.000 Bauern in Heide, der Kreisstadt von Dithmarschen, demonstrierten. Ihre Sprecher wurden der Landwirt und Jurist Wilhelm Hamkens aus Tetenbüll im Eiderstedtischen und der Bauer Claus Heim aus St.Annen in Oesterfeld. Die beiden suchten sich ihre intellektuellen Bündnispartner sowohl in rechten als auch in linken Kreisen. Um die Landvolkbewegung voranzubringen, verkaufte der „Bauerngeneral“ genannte Claus Heim dann 20 Hektar seines Landes und gründete eine Tageszeitung, außerdem wurden von dem Geld zwei Autos angeschafft. Als Redakteure gewann er den später kommunistischen Bauernorganisator und Spanienkämpfer Bruno von Salomon sowie dessen Bruder Ernst von Salomon, der zu den Rathenau-Mördern gehörte und in antikommunistischen Freikorps gekämpft hatte. Während die Kopfarbeiter fast alle aus der seit dem Kapp-Putsch berüchtigten „Brigade Ehrhardt“ kamen, waren die Handarbeiter der Zeitung Kommunisten. Da man ihnen aus Geldmangel keine Überstunden vergüten konnte, durften sie gelegentlich auch eigene marxistisch inspirierte Artikel im „Landvolk“ veröffentlichen.
Als Heims „Adjudant“ fungierte jedoch bald der antisemitische Haudegen Herbert Volck, der wie folgt für die schleswig-holsteinische Bewegung gewonnen wurde: „Kommen Sie, organisieren Sie uns!“ bat ihn ein Bauer in Berlin, „setzen Sie ihre Parole ‚Blut und Boden‘ in die Tat um“. Volck gab ihm gegenüber zu bedenken, „ihr müßt euer Blut dazu geben“, nur für bessere „Preise von Schweinen, Korn und Butter kämpfe ich nicht“. Die Ursache für die wachsende Not der Bauern sah er darin, daß „plötzlich auf den jüdischen Vieh- und Getreidenhöfen die Preise herunterspekuliert“ wurden. Und als wahre Kämpfer anerkannte er dann nur ganz wenige: „Claus Heim, der Schlesien- und Ruhrkämpfer Polizeihauptmann a.D. Nickels und ich,…keine Organisation, aber selbst bereit, in die Gefängnisse zu gehen, wollen wir dem Volke ein Naturgesetz nachweisen – das Gesetz des Opfers“.
Tatsächlich mußten die Aktivisten später alle unterschiedlich lange im Gefängnis sitzen. Die Landvolkbewegung radikalisierte sich schnell, zugleich spaltete sich ein eher legalistischer Flügel um Wilhelm Hamkens ab – und die schleswig-holsteinische NSDAP ging ebenfalls auf Distanz zur Landvolkbewegung. Es kam zu Bombenattentaten, Landrats- und Finanzämter wurden in die Luft gesprengt, und Polizei und Beamte daran gehindert, Vieh zu pfänden. Ein Landvolk-Lied ging so: „Herr Landrat, keine Bange, Sie leben nicht mehr lange…/Heute nacht um Zwei, da besuchen wir Sie,/ Mit dem Wecker, dem Sprengstoff und der Taschenbatterie!“ Bei den Bombenattentaten wurde jedoch nie jemand verletzt. Einmal sprachen die Bauern sogar ein Stadtboykott – gegen Neumünster – aus, nachdem auf einer Bauerndemo ihr Fahnenträger, der Diplomlandwirt Walther Muthmann, schwer verletzt worden war. Er mußte dann nach Schweden emigrieren, später kehrte er jedoch wieder nach Deutschland zurück, wo man ihn für einige Wochen inhaftierte.
In Neumünster war 1928/29 der ehemalige Gutshofhilfsinspektor Hans Fallada Annoncenaquisiteur einer kleinen Regionalzeitung. Als ihr Gerichtsreporter saß er dann auch im Landvolk-Prozeß. Sein 1931 erschienener Roman „Bauern, Bonzen und Bomben“ ist allerdings mehr ein Buch über das Elend des Lokaljournalismus als über die Not der Bauern. Von dieser handelte dann sein Roman aus dem Jahr 1938 „Wolf unter Wölfen“, in dem es um drei ehemalige Offiziere des Ersten Weltkriegs geht, die auf einem Gutshof bei Küstrin untergekommen sind. Auch Fallada arbeitete lange Zeit als Gutshilfsinspektor. Mit den Landvolkaktivisten teilte er dagegen mehrfache Knasterfahrungen. Während der „Bauerngeneral“ Claus Heim bei seinem Prozeß und auch danach jede Aussage verweigerte, begannen seine Mitangeklagten schon in U-Haft mit ihren Aufzeichnungen.
Herbert Volck nennt seine abenteuerlichen Erinnerungen „Landvolk und Bomben“, Ernst von Salomons Erfahrungsbericht heißt „Die Stadt“. Erwähnt seien ferner die Aufsätze der Kampfjournalisten Friedrich Wilhelm Heinz und Bodo Uhse. Heinz arbeitete später im Range eines Majors mit antisowjetischen Partisanen in der Ukraine zusammen und machte dann eine kurze Karriere in Adenauers „Amt Blank“. Uhse brachte es zu einem anerkannten Schriftsteller in der DDR und war dort kurzzeitig Präsident der Akademie der Künste; seine frühere Frau Beate Uhse machte derweil in Schleswig-Holstein Karriere – mit einem Sexartikel-Versandhaus. Nach dem Krieg kamen vor allem Richard Scheringer und Ernst von Salomon noch einmal auf die Landvolkbewegung zu sprechen – Salomon in seinem berühmten Buch „Der Fragebogen“ und der bayrische Bauer und DKP-Funktionär Scheringer mit seiner Biographie „Das große Los – unter Soldaten, Bauern und Rebellen“.
Noch später – nämlich nach der Wiedervereinigung – fühlte die FAZ sich im Sommer an Hans Falladas Neumünsterroman erinnert und übertitelte einen langen Kampfartikel gegen das unerwünschte Fortbestehen vieler LPGen in den fünf neuen Ländern mit: „Bauern, Bonzen und Betrüger“, ihm folgte der noch schärfere Spiegel-Aufmacher „Belogen und betrogen“. Vorausgegangen waren diesen West-Schmähschriften eine Reihe von Ost-Straßenblockaden und Demonstrationen – u.a. auf dem Alexanderplatz – von LPG-Bauern, die gegen den Boykott ihrer Waren – durch westdeutsche Lebensmittelkonzerne und von Westlern privatisierte Schlachthöfe sowie Molkereien – protestierten. Für die FAZ waren sie bloß gepresstes Fußvolk der „Roten Bonzen“, die sich noch immer an der Spitze der LPGen hielten, inzwischen jedoch Geschäftsführer von GmbHs, Genossenschaften oder sogar Aktiengesellschaften geworden waren.
Diese Protestbewegung kanalisierte sich relativ schnell in Gremien- und Verbandspolitiken, wobei es meist nur noch juristisch darum ging, ob das Vermögen bei den LPG-Umwandlungen zu Ungunsten der Beschäftigten allzu niedrig angesetzt worden war, wie die FAZ und andere Anti-LPG-Kämpfer behaupteten, oder zu hoch, wie die LPG-Vorsitzenden und ihre Verbandssprecher nachzuweisen versuchten. Unter den mit der Anti-LPG-Politik der Wessis unzufriedenen Betroffenen gab es auch etliche LPG-Bauern – z.B. Emil Kort aus Kampehl, die zuvor schon einmal – bei der Kollektivierung der Landwirtschaft in der DDR – Widerstand geleistet hatten. Damals noch als Einzelbauern. Emil Kort mußte wegen Sabotage und Boykotthetze sogar ins Gefängnis – und anschließend in den Untertagebau der Wismut. Nun fühlte er sich erneut – diesmal von Westlern – „angeschissen“. Er bleibt jedoch optimistisch – und meint, der Bauer ist als Unternehmer und Arbeiter zugleich Individualist, wenn auch meistens ganz unintellektuell, was eine Stärke und Schwäche zugleich sei, aber das mache ihn kämpferischer und ausdauernder als ein Arbeiter, dessen Identifikation mit „seinem“ Betrieb eigentlich nur ein frommer Selbstbetrug sei.
An die Bauernunruhen, die mit der Kollektivierung der Landwirtschaft in der DDR einsetzten, erinnert das frühe Stück „Die Bauern“ von Heiner Müller, das dem Autor jedoch zunächst bloß ein mehrjähriges Schreibverbot einbrachte und über eine einmalige Aufführung in der DDR nicht hinauskam. Es gibt darin nebenbei bemerkt ebenfalls schon einen ganzen Treckerwortschatz, denn: „Das Dorf wird motorisiert…Traktoren kriegen wir und der Bürgermeister wird verhaftet – wenn das kein Feiertag ist“.
Neuerdings machte auf dem Territorium der DDR nur noch das vom Braunkohleabbau bedrohte sorbische Dorf Horno in der Niederlausitz mit seinen Widerstandsaktionen von sich reden, aber auch dort wird inzwischen nicht mehr gekämpft. Neben den sorbischen Verbänden und Gebietskörperschaften waren hier vor allem die Umweltschützer solidarisch, deren Unterstützer-Netz inzwischen bis nach Indien und Nicaragua reicht, aber vor allem bis ins Umweltmusterland Schweden, wo die Spitze des Staatskonzerns Vattenfall sitzt, dem neuerdings die Lausitzer Braunkohle gehört.
Der inzwischen verstorbene Braunkohlen-Baggerführer Gundermann brachte es hier als regional verbundener Sänger zu einiger Berühmtheit. Auf der anderen Seite – vom Kampf der Bauern und Winzer in Wyhl aus – hub einst der „Barde der Anti-AKW-Bewegung“ Walter Moßmann an. Auch an intellektuellen Sympathisanten fehlt es hier wie dort nicht. In Gorleben war das z.B. der Berliner Schriftsteller Hans-Christoph Buch, der mit seiner Frau ein Landhaus im Wendland besaß, in dem er dann sein „Gorlebener Tagebuch“ schrieb, während er sich zugleich in eine junge Anti-AKW-Aktivistin vor Ort verliebte, wobei diese ihm dann mit der Widerstandsbewegung identisch wurde – und umgekehrt. Später veröffentlichte der März-Verlag Buchs „Bericht aus dem Inneren der Unruhe“. Der Autor arbeitet darin u.a. heraus, wie die lokale Bürgerinitiative zunächst die linken Sympathisanten aus den Städten mehr fürchtete als die Polizei. Einer der Aktivisten berichtete sogar regelmäßig dem Verfassungsschutz, und einem Sägewerksbesitzer wurde anonym gedroht, man werde sein Holzlager in Flammen aufgehen lassen, „wenn er sich weiter mit Kommunisten gemein mache“. Den ortsansässigen Künstlern und Intellektuellen sowie der immer wieder anreisenden linken „Politprominenz“ gelang es jedoch bald, das Verhältnis der Einheimischen zu den kommunistischen Gruppen, den „Chaoten, zu entspannen.
Im brandenburgischen Horno war der intellektuelle Sympathisant und Vorkämpfer ein englischer Schriftsteller, Michael Gromm. Den laut dpa „verhasstesten Ausländer Brandenburgs“ erkannte das Cottbusser Verwaltungsgericht vor einiger Zeit wegen seines Engagements in Horno sogar als Wahlsorbe an. Seine Kampfschriften werden von der grünen „Heinrich-Böll-Stiftung“ finanziert, zuletzt veröffentlichte er auf eigene Kosten ein Buch über „Horno – eine verkohlte Insel des Widerstands“. Kürzlich gab das Bundesverwaltungsgericht den widerständigen Hornoern übrigens recht – im Zusammenhang der Klage eines vom Braunkohletagebau im Westen – Garzweiler II – Betroffenen. Für das Dorf Horno kam dieser „Sieg“ ihres Rechtsanwalts Dirk Teßmer jedoch zu spät.
In der Lausitz gingt es – ebenso wie in Gorleben, wo die Einlagerung von Castor-Behältern in einen Salzstock verhindert werden soll – um eine staatlich durchgesetzte unterirdische Nutzung, bei der die Bauern der Region eine Bedrohung ihrer Existenz befürchten. In Wyhl, am Weinberg Kaiserstuhl, ging es hingegen um die Verhinderung einer oberirdischen Bebauung – durch ein AKW, ebenso in Wackersdorf, wo eine Wiederaufbereitungsanlage errichtet werden sollte, und in Mutlangen, wo die Amerikaner ihre Pershing II-Raketen aufstellten.
Ähnlich sah es auch bei der Entstehung der überhaupt ersten bundesdeutschen Bürgerinitiative in den Fünfzigerjahren – im niedersächsischen Künstlerdorf Worpswede – aus: Hier kämpften die Dörfler unter der Führung des Kommunisten und Kunstsammlers Friedrich Netzel dagegen, dass ein Kalksandsteinwerk im Rausch des allgemeinen Wiederaufbaus den für das Dorf zentralen Weyerberg einfach abbaggerte. Damals entstand aus dieser spontanen Protestbewegung bereits eine so genannte Unabhängige Wählergemeinschaft, die es bis ins Rathaus hinein schaffte – Und sich dann erfolgreich erst gegen den Plan von SPD und Bundeswehr wehrte, aus dem vor Worpswede liegenden Teufelsmoor einen „Nato-Bombenabwurfplatz“ zu machen, ebenso konnte sie dann auch verhindern, dass aus den Hamme-Niederungen ein großes „Freizeit-Seen-Paradies“ wurde. Die Worpsweder Intellektuellen und Künstler warfen jedoch den Bauern nach der Gebietsreform, durch die der Ort zur Großgemeinde wurde, vor, im Verein mit der CDU sowie mit etlichen kunstgewerblichen „Trittbrettfahrern“ die Mehrheit an sich gerissen zu haben und eine „reaktionäre Politik“ zu verfolgen. Ihre in den Achtzigerjahren als Alternative dazu gegründete „Künstlerpartei“ kam allerdings über Absichtserklärungen nicht mehr hinaus.
Um sowohl unterirdische wie oberirdische Eingriffe in die Landschaft zu verhindern, entstand – ebenfalls in den Achtzigerjahren – im hessischen Vogelsberg eine Bewegung aus Bauern und aufs Land gezogenen Intellektuellen bzw. Künstlern: Dort sollten einerseits immer mehr US-Atomminen und chemische Waffen stationiert werden und andererseits begannen die umliegenden Großstädte das Grundwasser aus dieser Region für sich abzupumpen. Die Vogelsberger wehrten sich gegen diese ober- wie unterirdische Verwüstung – z.T. ebenfalls mit Bombenattentaten (gegen Baufahrzeuge). Ihr Anführer, der Speckenmüller, war in den Dreißigerjahren noch mit dem Bauernkampf in der nahen Rhön in Berührung gekommen. Dorthin hatte es Bruno von Salomon und Bodo Uhse verschlagen, nachdem die Landvolkbewegung in Schleswig-Holstein zusammengebrochen war. Diese war jedoch nicht ganz erfolglos: viele Höfe konnten gerettet werden und es kam zu Steuererleichterungen für die Bauern.
Wie so oft in sozialen Bewegungen verschwinden die betroffenen Aktivisten anschließend aus der Geschichte, während die intellektuellen Unterstützer sich in die nächsten Aufstände reindrängeln. Bei den Frankfurter Linken und ihrer putschistischen Übernahme der hessischen Grünen habe ich das Anfang der Achtzigerjahre am Rande noch selbst miterlebt, ebenso in den Neunzigerjahren dann, als süddeutsche Maoisten die ostdeutsche Betriebsräteinitiative zu dominieren versuchten. Im Gegensatz zur Arbeiterbewegung, in der die Gewerkschaften nur allzu gerne die „Rädelsführer“ aufsaugen, gelingt es im bäuerlichen Widerstand immer nur ganz wenigen, sich anschließend als Berufsrevolutionär oder deutscher Professor durchzuschlagen.
Allgemein bekannt wurde inzwischen der Bauer Onno Poppinga – aus Ostfriesland. Er gründete die immer noch wichtige linke Zeitung „Bauernstimme“ mit und ist heute Professor in Kassel. Eine seiner ersten Publikationen in den Siebzigerjahren war ein Vorwort zu einer französischen Studie und hieß im Untertitel „Power to the Bauer“, außerdem verfaßte er ein Buch über Biographien widerständischer Bauern in Ostfriesland sowie eins über „Bauern und Politik“, in dem er auch kurz auf die schleswig-holsteinsiche Landvolkbewegung einging, denn die bange Frage nach ihrer Zerschlagung 1933 lautete – nicht zuletzt für die Gestapo: „Wird Florian Geyers Fahne noch einmal über das Hakenkreuz siegen?“ Für Poppinga bestand da keine Gefahr, denn die Landvolkbewegung „hatte keine antikapitalistische und sozialistische Perspektive: Sie wurde getragen von Großbauern, die ihre privilegierte soziale Stellung bedroht sahen. Das wird nirgends deutlicher als daran, daß nur sehr wenige Landarbeiter daran teilnahmen. Vor allem die klassenbewußten Landarbeiter der Marsch lehnten die Teilnahme an einer Bewegung, in der die Großbauern den Ton angaben, ab; es finden sich Hinweise, daß Landarbeiter von ihren Bauern nur durch ‚mittelbaren Zwang‘ zur Teilnahme an den Demonstrationen veranlaßt werden konnten“.
Poppingas Einschätzung trifft sich mit der von DDR-Historikern, für die die „Einheitlichkeit“ der Landvolkbewegung ebenfalls „nur in ihrer großbäuerlichen Klassenbasis, also in ihrem Konservativismus“ bestand. Ganz anders schätzten das zur selben Zeit, Mitte der Siebzigerjahre, die eher anarchistisch-autonomistisch inspirierten Autoren der Göttinger Zeitschrift „Politikon“ ein, die Poppinga darin vorwarfen, daß er einem „klassischen Bewertungsschema verfallen“ sei. Sie entdeckten demgegenüber rückblickend in der Landvolkbewegung, besonders in den Aktivitäten von Claus Heim und seinem Nachbarn Bur Hennings, den sie interviewten, eine „Qualität“, die weit über das hinausgging, „was wir an ‚linken‘ Aktionen auch nur zu träumen wagen“.
Für Onno Poppinga ist dagegen das Wesentliche am Bauerntum nicht, wie noch bei Michail Bakunin, die spontane Fähigkeit zum Widerstand, zum Bruch – auch und gerade heute noch – sondern im Gegenteil die „Dauerhaftigkeit der sozialen und betrieblichen Organisation“, wobei jeder „politische Eingriff“ nur schädlich sein kann. Bei einem Rückzug des Staates – wie bei den Rechtsnachfolgern der LPGen – bemerkt er denn auch, daß dabei wieder „immer deutlicher bäuerliche Strukturen sichtbar werden“. Bei seinem anhaltenden Engagement geht es ihm um eine Stärkung des bäuerlichen Eigensinns. Genau dieser führte aber dazu, daß die Aktivisten der Landvolkbewegung sich weder von links noch von rechts vereinnahmen ließen, sondern nach der Zerschlagung ihrer Selbsthilfe-Organisationen da weiter machten, wo sie angefangen hatten – auf kleiner Flamme, weswegen die dann auch nicht mehr in der ganzen Literatur danach auftauchen.
Erst einige Vorort-Recherchen ergaben: Der Bauernsprecher und Jurist Hamkens, der es über die NSDAP bis zum Landrat in Schleswig-Holstein gebracht hatte, sprach sich nach dem Krieg überraschenderweise für einen Wiederanschluß Schleswig-Holstein an Dänemark aus. Er starb erst Ende der Siebzigerjahre, war aber angeblich lange vorher schon altersdebil geworden.
Nachdem Claus Heim und andere politische Gefangene auf Initiative von NSDAP und KPD amnestiert worden waren, wurde dem „Bauerngeneral“ sowohl von der KPD als auch der NSDAP eine Parteikarriere angeboten. Er lehnte ab, der Nazi-Partei gelang es dann jedoch auch ohne ihn, die Bauern hinter sich und ihren „Reichsnährstand“ zu bringen, nachdem die Landvolkbewegung von der SPD-Regierung zerschlagen war. Im Endeffekt verloren sie dadurch gänzlich ihre Selbständigkeit, indem sie durch Festsetzung der Preise und Quotierung der Anbauflächen sowie mit dem Pfändungsverbot auf Erbhöfen gleichsam zu ideologisch veredelten Staatsbauern wurden (was die EU-Agrarpolitik nach dem Krieg in gewisser Weise fortsetzte).
Claus Heim zog sich derweil still auf seinen Hof zurück. Neben der Landwirtschaft gab er zusammen mit seinem Nachbarn Bur Hennings noch einmal in der Woche ein kleines, fast privates Kampfblatt heraus: „Die Dusendüwelswarf“. In den Fünfzigerjahren zog er sich auf sein Altenteil zurück und kümmerte sich fortan nur noch um seine Obstwiesen und die Hühner. Der Leiter des Heimatmuseums Lunden Henning Peters kann sich noch erinnern, dass Claus Heim die Landvolk-Heimschule regelmäßig mit Eiern belieferte.
Und seine Enkelin, die heute in Berlin lebende Faschismusforscherin Susanne Heim, erinnert sich, dass die Bauern 1963 an der Westküste, „als sie wieder mal wegen einer Rationalisierungskrise demonstrierten“, ihren Opa noch einmal als „Gallionsfigur“ hervorholten. Sie schrieb später ihre Diplomarbeit über ihn, und kürzlich besuchte sie eine Finka in Paraguay, die ihr Großvater einst als Auswanderer bewirtschaftet hatte, bevor er in den Zwanzigerjahren wieder nach Dithmarschen zurückkehrte, um sich der Landvolkbewegung zu widmen. Claus Heim starb im Januar 1968. Und jetzt ist es der alte Leiter des Lundener Heimatmuseums, der meint, „es wird Zeit, mal wieder an ihn zu erinnern“.
Zuletzt gab es in Schleswig-Holstein, aktuell vor allem auf der Eiderstedter Halbinsel, nicht nur einen Widerstand gegen die meist grünen Naturschützer, die hier laut Aussage des Kehdinger Bauern Schmoldt gegenüber dem Spiegel „das Land beherrschen wie einst die Gutsherren“, sondern auch einen wachsenden Unmut gegen die staatlichen grünen BSE-Maßnahmen – vor allem um die existenzzerstörenden Massentötungen von Rindern zu verhindern.
Als 2003 die Kälber des Landwirts Bernd Voß in Nordhastedt abtransportiert werden sollten, blockierten 350 Bauern den Hof. Sie fordern eine „Kohortenlösung“, d.h. im BSE-Fall nicht eine „Keulung“ der gesamten Herde, sondern nur des betroffenen Tieres, seiner Familie und seines Jahrgangs. Den protestierenden Bauern gelang es, ein gerade geborenes Kalb beim herbeigeeilten Staatssekretär Rüdiger von Plüskow wieder loszueisen. Das Tier nahm die Nindorfer Bäuerin Michaela Timm in Pflege. Es wurde auf den Namen „Jeanne d’Arc“ getauft und – nachdem in den nächsten Tagen alle Verhandlungen zwischen der Landesregierung und Michaela Timm gescheitert waren – auf einem anderen Hof versteckt.
Es kam daraufhin zu einem Streit zwischen der grünen Landwirtschaftsministerin, dem Land und dem Kreis Dithmarschen, wobei es zuerst einmal um die Frage ging: „Wer hat welche Ansprüche, und wie will er sie durchsetzen?“ Gleichzeitig wurden von den Bauern überall im Land „Mahnfeuer“ angezündet. Mit dem Kalb will die bäuerliche Notgemeinschaft nun einen eigenen Betrieb gründen, um einer drohenden Bestandssperre des Hofes der Familie Timm zuvorzukommen.
Der bäuerliche Widerstand – der von 1928/29 ebenso wie der in den Jahren 2000/2005 – ist zwar nicht auf die Westküste beschränkt, aber man ist sich einig, dass er durchaus mit der zähen friesischen bzw. dithmarschener Selbstbehauptung zusammenhängt – darin liegen sozusagen seine Wurzeln. Oder anders ausgedrückt – mit den Worten des Vorstandsmitglieds der Friesischen Akademie in Lieuwarden: „Nur wenn das Eigene nicht auf die Sphäre der privaten Liebhaberei beschränkt bleibt, ist es keine verlorene Sache.“
Und dementsprechend wurde auch der Friesenkongreß inzwischen aktiv. Er beauftragte den Friesenrat, in Ahnlehnung an die 15 Mio DM, die jährlich von Bund und Ländern an die sorbische Stiftung gezahlt werden, nun auch eine finanzielle Förderung für die friesische Minderheit zu verlangen – 100.000 DM wurden ihnen daraufhin sofort bewilligt, umgekehrt gründeten die ostdeutschen Sorben neulich, inspiriert von den Aktivitäten der dänischen Minderheit in Schleswig-Holstein, ebenfalls eine eigene Partei.
Die Sorben in der Lausitz sollten während der Nazizeit als „führerloses Arbeitsvolk“ zum Straßenbau in den Osten deportiert werden, ihre Organisation, die Domowina, wurde verboten. Sie gehörte dann mit zu den ersten, die nach dem Einmarsch der Roten Armee wieder zugelassen wurden, später unterstützte die SED „ihre“ Sorben großzügig. Diese Minderheiten-Politik wurde – mit Abstrichen – nach der Wende vom Westen fortgesetzt, außerdem wurde ein Siedlungs-Schutz für die slawischen Sorben in die Landesverfassungen von Brandenburg und Sachsen aufgenommen.
Das hinderte die Sozialdemokraten bis hin zum Kanzler Schröder jedoch nicht, gleichzeitig die zügige Abbaggerung des sorbischen Dorfes Horno zu verlangen, dessen Bewohner sich in toto weigerten, der Braunkohleverstromung zum Opfer zu fallen – d.h. den Baggern zu weichen. Gegen ihren Widerstand gab es bereits ein von der westdeutschen Energiegewerkschaft organisiertes „umgekehrtes Horno“ in Form einer proletarischen „Mahnwache“, damit die Bagger das Dorf endlich plattmachen konnten – 4000 Arbeitsplätze seien sonst angeblich gefährdet. In der strukturschwachen Region Südbrandenburgs war die Politik der Landesregierung zusammen mit dem Oberbergamt und den Verwaltungsgerichten erfolgreich, denn inzwischen ist Horno bereits vollständig zerstört; nur ein altes Gärtnerehepaar und ihr englischer Mieter, Michael Gromm, wehrten sich bis zum Frühjahr 2006 noch juristisch gegen ihre Enteignung.
Aber so wie sich die extrem umweltschädliche Braunkohleförderung – also der Landabbau – seit der Liberalisierung des Strommarktes nicht mehr rechnet – und damit den in der Braunkohle arbeitenden Sorben in der Lausitz langsam die Existenzgrundlage entzogen wird, ist es auch mit der Landgewinnung an der friesischen Küste vorbei.
Hier wie dort zerfällt jetzt eine bäuerliche bzw. proletarische Kollektiv-Identität. In dieser Situation setzen beide Minderheiten auf staatliche Alimentierung – wenigstens ihrer Körperschaften. Im Gegensatz zu den Sorben sind die Friesen jedoch „kein Volk und auch kein Stamm, sondern eine Rechtsgemeinschaft“ – der Schweizer Eidgenossenschaft ähnlich, wie Professor Ernst Schubert vom Göttinger Institut für historische Landesforschung kürzlich – auf dem 21.Friesenkongreß in Jever – ausführte. Deren zukünftiges Heil sieht man in einer wachsenden „Vernetzung“ – hin zu einer eigengeprägten Identität als „Euroregion Frisia“. Wobei die Grenze der friesischen Sprache, die an immer mehr Hochschulen gelehrt wird, „leider mit der Landesgrenze nach Dänemark identisch ist“, wie man mir im Nordfriisk Instituut in Bredstedt erklärte. Das sei deswegen bedauerlich, „weil die EU besonders gerne grenzüberschreitende Aktivitäten fördert“.
Umgekehrt – von unten – übrigens auch: So wurde z.B. der Anti-AKW-Widerstand in Wyhl, im Dreyländereck, von vielen Schweizern und insbesondere Elsässern unterstützt, die sich bis heute auf Allemanisch untereinander verständigen, und zum Kampf in Wackersdorf rückten jedesmal so viele österreichische Sympathisanten aus dem nahen Salzburger Land an, dass die Regierungen ihnen schließlich den Grenzübertritt verweigerten. In Gorleben bemerkt man seit der Wende eine ansteigende Solidarität aus dem Osten, umgekehrt reisen viele Aktivisten aus Lüchow-Dannenberg regelmäßig zu Protestveranstaltungen nach Wittstock in die brandenburgische Region Prignitz, wo eine Bürgerinitiative gegen einen Bombenabwurfplatz der sowjetischen Streitkräfte und nunmehr der Bundeswehr kämpft.
Auch in Nordfriesland registriert man mit Genugtuung ein gestiegenes Interesse des Auslands an den bisher hier erkämpften Errungenschaften: Nachdem die Kurverwaltungen schon angefangen hatten, die ersten Strandkörbe reinzuholen, resümierte die „Dithmarscher Landeszeitung“ die Urlaubs-Saison 2003. Unter der Überschrift „Welt trifft sich im Nationalpark“ hieß es da: „Umweltminister aus Süd- und Mittelamerika und der Mongolei, Lehrer und ein Filmteam aus Korea, ein Nationalparkdirektor aus Madagaskar und viele andere internationale Umweltexperten bereisten allein in diesem Jahr das Wattenmeer“. Hinzu kamen noch „1700 meist jugendliche Spielleute aus 6 Nationen“ – zum internationalen Musikfestival nach Husum, sowie erneut etliche Prominente und Cineasten – zum erfolgreich über ganz Ostfriesland ausgedehnten Filmfestival von Emden. Touristen ließen sich jedoch heuer – wetterbedingt – nicht so viele blicken wie im Vorjahr. Meine Zimmervermieterin in Ockholm hatte sich gar nicht erst einen Quittungsblock angeschafft. Dafür kamen in diesem Jahr mehr Ringelgänse als sonst – aus dem sibirischen Partner-„Naturreservat Taymirski“. Die Bauern dürfen den gesammelten Kot der Gänse hernach bei der EU als Flurschaden in Rechnung stellen: Kleinvieh macht auch Mist – die dabei anfallende Menge pro Fläche zählt!
Daneben wird der „Küstenschutz“ zunehmend von einem Arbeit-Nehmer zu einem Arbeit-Geber, d.h. der Einzelne wird immer weniger zu freiwilligen Deicharbeiten und Noteinsätzen herangezogen, das übernehmen Hauptberufler in den diversen Verbänden und Subunternehmen mit schwerstem Gerät, wo Landwirte höchstens noch als Ehrenamtliche in den Vorständen sitzen. Das Geld kommt vom Bund und vom Land, außerdem zahlen über 50.000 Grundeigentümer eine jährliche Deichsteuer. Auseinandersetzungen gibt es heute meistens zwischen den Deichverbänden und den Naturschützern. Im Endeffekt kommt es dabei im Küstenschutz zu immer neuen Arbeitsplätzen, mindestens Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Diesbezügliche Einbrüche gab es dagegen seit der Wiedervereinigung beim Nationalschutz – d.h. bei der Bundeswehr, die aber noch immer ein großer Arbeitsplatz-Beschaffer ist: Marine, Luftwaffe und Heer. Letzteres benannte sogar seine Kaserne in Heide nach der einzig historisch belegten Heldenfigur aus der Schlacht bei Hemmingstedt: „Wulf Isebrand“ – ein Niederländer, dem mit seinem Schanzenplan und seinem vorbildhaften Verhalten im Kampf „der größte Anteil am Sieg der Dithmarscher Bauern zukommt“, wie das Landesmuseum in Meldorf meint. Ja, Freesenbloud is keene Bottermelk!
Das mußte auch der Hamburger Senat erfahren, als er analog zum Horno-Gesetz eine mit Arbeitsplatzargumenten hinterfütterte „Lex Airbus“ verabschiedete, um eine Landebahnverlängerung des in Finkenwerder ansässigen Airbus-Konzerns mitten durch das „Alte Land“ durchzusetzen – dem größten norddeutschen Obstanbaugebiet, das einst von Friesen aus Holland und Schleswig-Holstein trockengelegt wurde: Das hanseatische Oberverwaltungsgericht stoppte jedoch diesen Enteignungsvorstoß, woraufhin die Stadt ihre Kaufangebote erhöhte und die Hamburger Presse sich jeden einzelnen Kaufunwilligen persönlich vornahm. Derart unter Druck gesetzt verkauften zwar einige Obstbauern ihre Grundstücke, aber die Mehrzahl der zu einer Klägergemeinschaft zusammengeschlossenen gibt noch nicht auf. Hierzu erschien kürzlich eine Studie im Hamburger Verlag Nautilus.
_____________________________________________________________________________________
Weitere Literatur: Die eingangs erwähnte Debatte über privatwirtschaftlichen und politischen „Regionalismus“ hat zuletzt der friesenfeindliche Heidelberger Hans Peter Duerr in seiner Forschungsarbeit „Rungholt“ sowie der friesische Germanist Olaf Schmidt mit seinem Roman „Friesenblut“ wieder aufgenommen.
Man sagt, die Friesen sind den Künsten eher abgeneigt, der Mathematik aber nicht, was von ihrer händlerischen Lebensweise seit dem Megalithikum komme, die zudem immer wieder ins Piratische lappte. Man könnte sie aber auch als seefahrende Viehhirten bezeichnen, die übrigens keinen Volksstamm, sondern wie die Schweizer eine Art Eidgenossenschaft bilden. Aber anders als diese waren sie immer frei (jedenfalls bis die verdammten Preußen kamen).
Zu Zeiten Karls des Großen erledigten sie den Handel für das Reich – bis nach Bagdad hin. Um 1230 wird ihnen quasioffiziell bescheinigt: „omni jugo servitutis exuti“ – sie haben das Joch der Knechtschaft verlassen. „Seltsam nahm sich Friesland unter den deutschen Territorien aus“, schreibt der westfriesische Historiker I. H. Gosses: „Kein Graf, keine Lehnsleute, fast keine Ritter, keine Unfreien, keine ummauerten Städte; ein Land freier Bauern.“
Auch in dem in der Gegenwart spielenden Roman von Olaf Schmidt, der heute als Redakteur beim Leipziger Stadtmagazin Kreuzer arbeitet, spielt die friesische Geschichte eine große Rolle. Nicht nur in Nebenbemerkungen wie etwa der über das Tourismusgeschäft der Föhrer: „Das kleine Volk der Inselfriesen hatte weiß Gott seinen Beitrag zur Ausplünderung der Welt geleistet. Jetzt fuhr man eben nicht mehr auf Beute hinaus, der Reichtum kam von selbst. Was hatte sich schon wirklich geändert?“
Die Hauptfigur des Buchs ist ein auf die Insel Föhr zurückkehrender junger Kunsthistoriker namens Anselm, der dort Material für seine Doktorarbeit über den 1839 gestorbenen und von der Kunstwelt eher gering geschätzten Föhrer Maler Oluf Braren sammeln will. Er knüpft dabei an den Forschungen eines jüdischen Kunsthistorikers an, der 1936 auf die Insel gekommen war und dann von den Nazis umgebracht wurde.
Anselm verbindet eine alte Freundschaft mit dem Inselpfarrer, der einmal Anti-AKW-Aktivist war. Er hat von einem bisher unbekannten Bild des Malers erfahren, das sich im Besitz einer Föhrerin befindet, die es erst jüngst von ihrer in den Dreißigerjahren nach Amerika ausgewanderten älteren Schwester erbte. Auch der Föhringer Verein ist an dem Bild interessiert, denn Oluf Braren wird vom Vereinsvorsitzenden „für den einzigen Künstler von Rang“ gehalten, „den unsere Heimatinsel je hervorgebracht hat“. Aber noch bevor er oder Anselm sich über das Bild hermachen können, ist es verschwunden. Gestohlen. Das verleiht dem Roman den Schwung eines Krimis. Dieser wird jedoch immer wieder ausgebremst dadurch, dass parallel zur Aufklärung des Gemäldediebstahls die Lebensgeschichte des Malers ausführlichst erzählt wird.
An der Bildspurensuche beteiligt sich bald auch noch der Inselreporter, der gewissermaßen auf die Nazizeit in der Föhrer Geschichte spezialisiert ist. Genauso wie der Pfarrer hält er den Heimatverein für eine „reaktionäre Bagage“. Ein Buch – vom Vater des Vereinsvorsitzenden verfasst – hieß bereits „Friesenblut“. Olaf Schmidts Roman ist eine ironische Antifa-Antwort darauf und gleichzeitig eine Erinnerung an die Juden einst auf der Insel, die zumeist Touristen waren: „Wyk [auf Föhr] war kein antisemitisches Seebad. Aber als die Nazis dann hier das Sagen hatten, war man sofort tausendprozentig.“
Eine Ausnahme bildete jene Inselminderheit, die 1920 beim Volksentscheid für den Anschluss Föhrs an Dänemark stimmte. Einer von ihnen lebt noch heute. Er ist immer noch davon überzeugt, „dass damals nicht alles mit rechten Dingen zugegangen sei“ und dass „die Friesen weder deutsch noch dänisch sind, sie sind etwas Eigenes für sich. Doch von alters her haben sie zu Dänemark gehört und sind damit immer zufrieden gewesen“. Selbst der Festlandfriese Theodor Storm konnte sich 1864 nicht recht über die „Befreiung“ seiner „Husumerei“ durch die Preußen freuen – obwohl ihn die Dänen zuvor ins (preußische) Exil getrieben hatten. Der erste „Friesenblut“-Roman – „Ein Nordseebuch von Schutz und Trutz“ – war unter anderem dem neuerlichen Kampf gegen die „frechen Dänen“ nach 1918 gewidmet.
Diese ganzen Geschichten wirken bis heute nach unter der neobanalen Ferienoberfläche der Insel, wobei die vor 15.000 Jahren existierende Hochkultur noch ganz frisch in Erinnerung ist, während die Nazizeit schon „sehr lange her“ ist. All diese Widersprüche zerren nun die drei nach dem verschwundenen Bild fahndenden Protagonisten in Schmidts Roman nach und nach ans Licht. Olaf Schmidt hat einem Kapitel das Motto eines Heimatforschers vom Festland aus dem Jahre 1865 vorangestellt: „Wollte und dürfte ich die Geheimnisse der Föhrer und namentlich der Föhrer Nachtschwärmer und Finsterlinge aufdecken, so müßte ich lange Kapitel schreiben.“
Olaf Schmidt hat das getan. In einer Rezension seines Inselkrimiromans verbietet es sich jedoch aufzudecken, wie er ausgeht. Ein Kritiker nannte sein Werk „ein sprachmächtiges Epos über ein Provinzgenie“. Dem möchte ich zuletzt aber widersprechen, denn ein Schriftsteller ist im Gegenteil jemand, der Probleme mit dem Schreiben hat – und Olaf Schmidt hat sich mit „Friesenblut“ jede Menge Schreibprobleme gemacht. Als küstennaher Heimatforscher hat er dabei zugleich gekonnt die Dialektik von Erden (bzw. In-See-Stechen) und Abheben berücksichtigt.
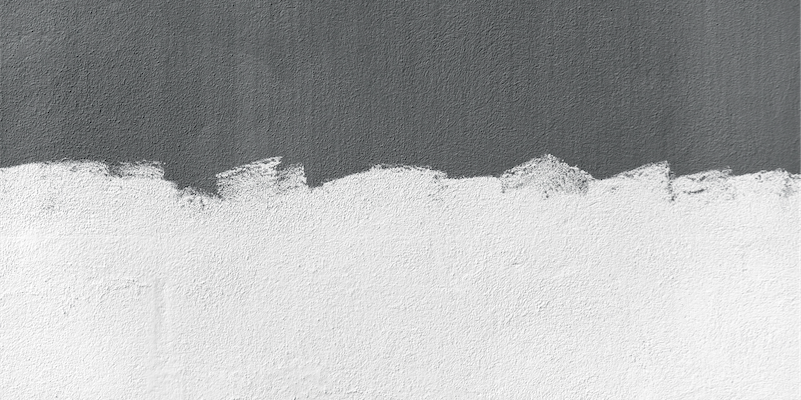



Auf Hans Peter Duerrs süddeutsche Friesenverachtung „Rungholt – Die Suche nach einer versunkenen Stadt“, in der es um Ausgrabungs-Fundstücke im Zusammenhang seiner „Rungholt“-Forschung im Wattenmeer ging, antwortete der Friese Jan Christophersen mit einem Roman, „Schneetage“, in dem es ebenfalls um Wattenmeer-Expeditionen auf der Suche nach Rungholt geht, allerdings weniger verkniffen als die Streitereien des Landesamtes für Vor- und Frühgeschichte, das für das Wattenmeer gewissermaßen zuständig ist, und den aus Heidelberg stammenden Bremer Professor Duerr und seine Studenten, die dort mit einem Schiff hinfuhren und verschiedene Gegenstände ausbuddelten…
Hier eine Zusammenfassung ihrer Auseinandersetzung – aus dem „WestküsteNet“:
Wir sind über Rungholt gefahren
Losgetreten wurde der Streit um Rungholt durch einen Spiegel-Artikel vom 21. Nov. 1994. Danach setzten auch andere Publikationsorgane wie „Die Zeit“ und „taz-Hamburg“ nach und hielten dieses Thema noch bis ins neue Jahr hinein fast zwei Monate am Kochen. Auch die heimische Lokalpresse, die „Husumer Nachrichten“ und insbesondere die „Flensborg Avis“ nahmen sich dankbar des Streites um das friesische „Atlantis“ an. Was hat der Rungholt-Ausgräber und -Forscher denn nun eigentlich entdeckt, daß es ein solches Rauschen im bundesdeutschen Blätterwald veranlaßte?
Es sind denn auch weniger die Scherben und Holz-, Mauer-, Stein- und Brunnenreste, die die Gemüter an diesem Streit beteiligten Wissenschaftler und Museumsfachleute eregten. Es ist mehr die Lage des Ortes „Rungholt“, die angeblich nicht südlich, sondern nördlich der Hallig Südfall zu suchen sei. Eine C-14-Analyse am im Nissenhaus ausgestellten Schleusentor oder Thermoluminezenz-Analysen an Keramik-Resten könnten es beweisen. Doch, oh Wunder, einige Ergebnisse der duchgeführten Untersuchungen sind bei beiden Parteien nicht mehr aufzufinden oder nicht mehr zugänglich.
Der Leiter des Landesamtes für Vor- und Frühgeschichte, Prof. Joachim Reichstein spricht von Raubgrabung und überzieht dem Ethnologen und Prof. Hans Peter Duerr aus Bremen mit einem Rechtsverfahren. Dieser wiederum wirft dem Schleswiger Archäologen vor, daß wichtige Erkenntnisse zurückgehalten würden. Bei allem Streit geraten viele Positionen durcheinander und verwischen sich derartig, daß sich fast keiner mehr auskennt. Der Spiegel sieht im zweiten Artikel (19. Dez. 1994) die Nordseeküste bereits als „Bermuda-Dreieck“ an und zitiert einen nicht genannten Kenner: „Die ganze Rungholt-Forschung ist in einem Sumpf von subjektiven Ansichten und persönlichen Eitelkeiten gefangen.“ So soll dieser Beitrag soll wenigstens etwas Licht auf diesen absurden Streit werfen und aufzeigen, daß mehr Gelassenheit der Sache Rungholt dienlicher gewesen wäre.
Duerr hält Rungholt, welches er im übrigen nie mit Atlantis verglichen haben will, höchstens für ein „Bauern-Städtchen“ mit „maximal zweitausend Einwohnern“ oder „eine größere Siedlung mit ein paar tausend Einwohnern“. Diese Angaben decken sich mit denen denen des Landesamtes für Vor- und Frühgeschichte, wonach es sich laut Reichstein bei der Besiedelung um Südfall herum um „einzelne Warfgruppen“ gehandelt haben müsse, deren „Bewohner“ am „Fernhandel teilgehabt“ hätten. Rungholt könne aber nicht 4000 Einwohner gehabt haben (wie im ersten Spiegel-Artikel behauptet worden ist). Das damalige Leben habe sich auf Warfgruppen abgespielt, die kaum Platz für eine so große Stadt geboten haben könne.
Das Gebiet, wo Duerr sein Rungholt vermutet, heißt im Volksmund bis heute tatsächlich Rungholt oder vielmehr Rungholt-Sand. Auf einer alten Landkarte steht dort „silva rungholtina“. Der Name drückt aus, daß an der Stelle damals ein Waldgebiet minderer Qualität (rung = wrong (engl.) = gering; holt = Wald), also ein Niederwald oder Krattgebiet vorhanden war. Später gab es dort ein Dünengebiet wie bei St. Peter-Ording, danach eine Sandfläche. Neben diesem Wald lag das sogenannte „Fedderingman-Gebiet“, ein Warfen-Gelände mit neun verstreut liegende Brunnenringen. Hier war ein Herrensitz mit einer eigenen Kapelle ansässig. Hier wohnte eine Geschlechtersippe, die sich „Fedderingmannen“ nannten. Der Zusatz „vel Rip“ (oder Rip) hinter dem Ortsnamen „Fedderingman Capell“ könnte bedeuten, daß der Ort auch „Fedderingmanrip“ genannt wurde. Wird wieder die englische Bezeichnung genommen, bedeutet Rip „Uferrand“. Es könnte also sein, daß die Ansiedlung ursprünglich am Uferrand eines Priels lag, die aber später zur Zeit der Sturmflut 1362 verlandet war. Die Warfen wurden errichtet, als das umliegende Land noch seinen alten Halligcharakter besaß. Erst nach Schutz durch Deiche entstanden die Wege, Gräben, Dammstellen und Sielzugbrücken.
Das sagenumwobende Rungholt wird vor der Sturmflut von 1362 überhaupt nur ein einziges Mal urkundlich erwähnt als Adresse auf der Rückseite eines Testaments aus dem Jahre 1345. Albert Panten, der dieses Dokument vor einigen Jahren im Hamburger Staatsarchiv in einem Urkundenbuch entdeckt hatte, entziffert es als: „Edemisherde parrochia Rungheholte judices consiliarij iurati Thedo bonisß cum heredibus“ und übersetzt mit: „Edomsharde Kirchspiel Rungholt Richter, Ratsleute, Geschworene Thedo Bonisson samt Erben“. Erst im 17. Jahrhundert sind die zahlreichen Karten, Chroniken und Sagen über Rungholt und Umgebung entstanden. Auch wurde in diesen schon von ähnlichen Ereignissen berichtet, die auch Dürrs Entdeckerdurst angeregt haben könnten. So berichtete Peter Sax im Jahre 1637 von Warfen im Watt zwischen Nordstrand und Eiderstedt, die gezeigt werden könnten, „da Häuser gestanden… Wege, Äckern …, Gruften und Graben. Man kann finden Kessel, Grapen, Kröge, Schüssell…“.
Die Phantasie beflügelte im 19. Jahrhundert auch den Dichter Detlev von Liliencron, der einige Zeit auf der Insel Pellworm ansässig gewesen war, mit seiner Ballade „Trutz Blanke Hans“. Nach dieser Darstellung war Rungholt eine „mittelalterliche Stadt mit großen Kornspeichern am Hafen, mit einem kunstvoll gebauten Stadttor und mit einem gepflasterten Marktplatz sowie einer wuchtigen, aus Backsteinen erbauten Domkirche“. Nach der Sage ist Rungholt an einem Tage untergegangen und mit ihm 4000 Menschen ertrunken. Nach der Legende soll der Alkolhol schuld gewesen sein. „Gottlose Trunkenbolde wollten einem Priester eine Sau als angeblichen Todkranken unterschieben, der er das Abendmahl reichen sollte. Der Trug flog auf, der Priester floh, doch die Bösewichte entwendeten ihm die Büchse mit den heiligen Sakramenten und soffen daraus munter weiter.“ Die Folgen blieben nicht aus. Der Gottesmann betete um die Bestrafung der Frevler und die folgte denn auch prompt mit der „Großen Mandränke“ im Jahre 1362.
Nach Angaben des Spiegel soll der legendäre Ort Rungholt die „größte Hafenstadt an der sumpfig-mäandernden nordfriesischen Küste“ gewesen sein. „Vergleichbar einem tropischen Mangrovensumpf“ ragte die „flußreiche Küstenzone weit in die Nordsee“ hinein. „Entwässerungskanäle durchzogen das flache Grasland. Über Bohlenwege und kleine Holzbrücken bahnten sich die Friesen trockenen Fußes den Weg.“
Dieses Bild ist nur teilweise richtig. Vor 1200 hatten die Einwohner flach gesiedelt. Die gesamte Küste war durch einen Sandwall geschützt. Die drei Außensände sowie die Sandbänke vor Amrum und Sylt zeugen heute noch von der einstigen Nehrung. Das Binnenland war bis zum Geestrand und auf einige Geestinseln und Uferstreifen überhaupt nicht oder schwach besiedelt. Erst ab etwa 1000 setzte eine größere Kolonisation der Friesen ein. Das Gebiet bestand ansonsten aus umfangreichen Moorflächen, unter denen eine alte fruchtbare Kleischicht lag, die den späteren siedelnden Bewohnern aus zwei Gründen zum Verhängnis wurde:
Zum einen wurde, wie im Spiegel richtig angegeben, der vom Meer überspülte Torf getrocknet und verbrannt; aus der Asche ließ sich das kostbare Salz heraussieden. In den nicht überschwemmten Gebieten wurde die Torfschicht zu Feuerungszwecken weggenommen und die darunterliegende alte Marsch als fruchtbaren Ackerboden gewonnen. Dadurch geriet das Land unter dem Meeresspiegel und Eindeichungen bewirkten nun, daß „Entwässerungskanäle“, also Sielzüge mit ihren Schleusentoren das „flache Grasland“ durchzogen und über die natürlich auch Holzbrücken gelegt werden mußten.
Diese Maßnahmen waren erforderlich, weil vermutlich um etwa 1180 eine der zahlreichen Stürme den Strandwall an mehreren Stellen durchstoßen hatte und damit auch die Hever, die damals wohl noch ein Fluß war und von Nord nach Süd in die Eider floß, als Wasserstraße (an der auch Ansiedlung Rungholt lag) beeinflußte. Der Flußlauf verlandete wohl schnell und die Einwohner mußten sich an anderer Stelle weiter südlich einen Zugang zum nun von Ost nach West verlaufenden Heverstrom verschaffen. Die Bewohner konnten jetzt auch nicht mehr flach siedeln, sondern sie mußten Warfen aufschütten und wegen des Salzwassers (vorher war es ja Süßwasser) Brunnen graben oder sie mit Soden aufsetzen. Bald darauf wurden auch Deiche gebaut, weil das Land besonders nach Abbau des Torfes in der Regel niedriger als der Meerwasserspiegel lag und vor allem weil Ackerflächen Meeresüberschwemmungen nicht vertrugen. Daß Menschen geschützt werden sollten, war nie Absicht beim Bau der ersten Deiche gewesen. Dazu waren ja die aufzuschichtenden Warfen da.
Auf alten Karten (die zwei aufgefundenen Karten des Husumer Johannes Mejer gehen auf die Clades Rungholtina von Peter Sax aus Koldenbüttel zurück) ist Hallig Südfall nicht eingezeichnet. Auf den Karten von Mejer ist Rungholt gleich zweimal eingezeichnet, als Ort und als Wald (in den Ausrissen im Spiegel merkwürdigerweise die obere Bezeichnung durch den Hinweis auf den unteren Kirchort Rungholt überdeckt und in der „Zeit“ vom 13. Jan. 1995 ist im Ausriß der Wald Rungholt eingezeichnet, der untere Ort aber abgeschnitten worden). In der älteren Vorlage von Sax, die erst nach der großen Sturmflut von 1634 erstellt wurde und die Gegebenheiten dieser Zeit berücksichtigte, stimmt mit den bisherigen Grabungsergebnissen sogar weitgehend Überein. Die damalige Schleuse war zwar noch kein Raub des Meeres gewesen, aber sie verlor durch die vorherige Sturmflut weitgehend ihre Funktion, weil das Gebiet später nicht wieder bedeicht wurde.
Deswegen ist auch durch die Altersbestimmung nach der C-14-Methode eigentlich nicht unbedingt zu befürchten, daß sich Duerrs These, die Schleuse sei nach 1362 erbaut, sich bestätigen sollte. Darum ist eigentlich nicht zu verstehen, weshalb Ergebnisse einer solchen Überprüfung zurückgehalten werden sollten. Tatsächlich tut sich ein Widerspruch auf, wenn auf der einen Seite Lengsfeld bestätigt, daß mehrere Alterbestimmungen von den Schleusenbalken gemacht worden sind (die Ergebnisse mögen ja tatsächlich verschludert worden sein) oder, wie Reichstein auf einer Pressekonferenz im Januar behauptet, (vielleicht auch zu Recht) vom Landesamt bisher solche Altersbestimmungstest nicht vorgenommen wurden. Ob der damalige Museumsleiter Wohlenberg die wissenschaftlichen Ergebnisse verschwieg, „aus Angst, eines seiner attraktivsten Ausstellungsstücke zu verlieren“, mag dahingestellt sein lassen. Ich denke, daß für die Faszination des Museum-Besuchers es reichlich egal sein dürfte, ob der Schleusenbalken aus der Zeit vor 1362 oder vor 1634 stammt. Bedeutend dürfte die Jahreszahl eigentlich nur für die damit befaßten Fachleute sein, weil mit ihr auch bestimmte Erkenntnisse und Konsequenzen für die Lebensweise der damaligen Bewohner gewinnen ließen.
Was fand der Bremer Ethnologe Duerr nun eigentlich auf der „Wallfahrt im Watt“ im Sommer 1994, auf der er sich selbst vom „Gemauschel“ der Museums-Leitung zu überzeugen wollte. In einem Priel fand er Pferdeschädel „in großer Zahl“ und Keramikscherben. Aus dem nassen Grund ragten „Pfosten und aufrecht stehende Flechtwände“. Duerr: „Wir waren auf ein mittelalterliches Langhaus gestoßen, auf der Feuerstelle lagen noch Fischgräten.“ Etwas abseits, „in 2000 Schritten Entfernung hob sich ein Fundament aus behauenen Findlingen aus dem Schlamm – typisch für mittelalterliche Kirchen.“ In einem späteren Spiegel-Artikel wurden daraus die Ruinen eines „riesigen Steinhauses“ mit „Findlingsfundament und Ziegelsteinstümpfen“. Wenn Duerr die Phantasie nicht durchgegangen sein dürfte (hoffentlich hatte er ein Photoapparat dabei), dürfte es sich hiernach wohl um die „Fedderingman Capell“ handeln.
Rheinische Krüge (wie konnte Duerr eigentlich innerhalb eines Tages es beurteilen, daß es sich um solche handelte?), Reste von Holzfässern (die auch schon früher an dieser Stelle gefunden worden waren) und Kuhschädel nahm Duerr (als Notbergung) mit, um sie einige Tage später beim zuständigen Landesamt im Schleswig abzugeben. Dafür wurde „der glückliche Finder“ hart gestraft mit einer Anzeige wegen Raubgrabens unter Androhung eines Bußgelds bis zu 50.000 Mark.
Duerr vermutete, daß die „Fischköppe“ – (seine Gegner konterten ebenfalls unter die Gürtellinie, er sei ein langhaariger, gebürtiger Kurpfälzer und „Hexenforscher“) – von ihren eigenen Versäumnissen ablenken wollten und daher mit Watt-Zutrittsverbot reagierten und ihm einen Sammelausweis verweigerten. Die neuen „Rungholt-Artefakte“ seien zu gewichtig, daß ihnen nicht weiter nachgegangen werden dürften. Noch nie sei ein komplettes mittelalterliches Haus im Watt aufgespürt worden. Eine ganze mittelalterliche Stadt, „bestehend aus bis zu 50 Meter messenden friesischen Langhäusern“ liege womöglich unter dem Schlick. Reichstein hält dem jedoch entgegen: „Wo ein Laie die Reste von Häusern, Kirchen und Feuerstellen zu sehen glaubt, kann der Fachmann dank langjähriger Kenntnis derartiger Siedelreste durchaus zu einem anderen Ergebnis kommen.“
Die Flachbodensiedlung Rungholt müsse durch die Schlammlawine der Sturmflut von 1362 nahezu luftdicht abgeschlossen sein, behauptet Dürr weiter. So seien seine Studenten auf ein Holzfaß gestoßen, „daß noch unverrückt auf einem Podest stand – gleichsam im Matsch erstarrt und gut konserviert“ war. Aber auch Andreas Busch berichtete von einem Holzfaß, als er im Jahre 1963 als über 80jähriger zusammen mit Wohlenberg und dem Pächter der Hallig Südfall seine letzte Rungholt-Expedition unternahm. Der Bauer und Pächter Brauer fand an einer Wattrinne, die zwanzig Jahre zuvor entstanden war, auf festem, altem Kleiboden ein Stück Leder, das Nahtlöcher aufwies. Im Boden steckten mehrfach Tierknochen. Beim Weitergehen in südwestlicher Richtung sah er drei Brunnen. Aus dem zweiten Brunnen ragten die Dauben eines Holzfasses heraus. „Beim Hineinstecken eines Stockes stieß er auf den Faßboden, den er mit einem kräftigen Ruck durchstoßen konnte. Das Holz war mürbe.“
Für die dem Spiegel erzählte „abenteuerliche Story“ des Bremer Forschers hat der wissenschaftliche Mitarbeiter und Experte des Landesamtes, Hans-Joachim Kühn nur ein „müdes Lächeln“ übrig. Seit Jahren schon führt er Ausgrabungen im Wattenmeer durcht. Die angeblichen „Neuentdeckungen“ Duerrs kenne man schon seit etwa zwanzig Jahren und diese seien zudem gut kartiert (Diese Aussage mag Duerr kaum glauben, denn Kühn habe ihm im vergangenen Dezember selbst noch geschrieben, daß das Gebiet nördlich von Südfall noch nicht näher untersucht worden sei. Vielleicht ist dieses Mißverständnis dadurch zu klären, daß wohl zwischen Bekanntwerden von Funden und genaueren wissenschaftlichen Untersuchungen Unterschiede bestehen). Es gäbe überall zahlreiche Plätze und vergleichbare Artefakte, es sei daher nicht verwunderlich, wie Kühn in den „Husumer Nachrichten“ vom 23. 11. 1994 äußert, daß die Pferde noch so dalägen, wie sie damals in den Stallungen ertrunken seien. „Draußen gibt es Hunderte alter Siedlungen, zum Teil älter als Rungholt“. Rungholt kann auch deswegen nicht an der von Duerr untersuchten Stelle gelegen haben, weil der Ort einen Zugang zum Meer gehabt haben muß. Die Funstellen müßten zudem Funde aufweisen, die auf weite Handelsverbindungen hindeuteten, so wird in der „Zeit“ vom 9. 12. 1994 geschlußfolgert. Südwestlich von Südfall seien tatsächlich rheinische Krüge entdeckt worden. An dieser Stelle verlief auch vor 1362 ein Priel, da das Wattenmeer sonst rundherum festes Land war und geradezu flächig besiedelt gewesen sei, ließe sich nur hier ein Handelshafen anlegen lassen. Das Kirchspiel Rungholt, mutmaßt Kühn vom Landesamt, könne nur dort gewesen sein.
Zur Erforschung der Siedlungshöhen, um weitere Hinweise auf Meerespiegel-Schwankungen zu bekommen, bedürfe es eigentlich flächenhafter Grabungen, so Kühn weiter. Dies sei aber unmöglich, da es nur „mit gewaltigem technischen Aufwand“ und ebenso gewaltigen Finanzmitteln zu bewerkstelligen sei. Was die Datierung der Schleusenreste angeht, seien sie für ihn bis heute nicht datiert (Duerr will die Aussage, daß der Kernstück der Rungholt-Forschung, der Schleusenbalken, aus der Zeit um 1700 stammt, von einem früheren Mitarbeiter Wohlenbergs erhalten haben wie es zweiten Spiegel-Artikel heißt. Auf die Frage von Lengsfeld, wer der Informand gewesen sein könne, weicht Duerr in einem Leserbrief am 4. 1. 1995 in der Flensborg Avis wieder aus und bemerkt nur: „Dem Manne kann geholfen werden“). „Wer solle denn ein Interesse gehabt haben, in jüngerer Zeit da zwei Schleusen mitten ins Wasser zu setzen.“ Er werde immerhin in Kürze einen neuen Datierungsversuch durchführen lassen. Für Lengsfeld dagegen, dem derzeitigen Leiter des Nissenhaus-Museums, besteht kein Zweifel daran, daß der Schleusenbalken tatsächlich aus dem 13. oder 14. Jahrhundert stammt. Der Schleusenbalken sei wie andere Fundstücke auch wiederholt zwischen 1977 und 1985 von verschiedenen Wissenschaftlern auf ihr Alter hin untersucht worden. Er selbst habe, obwohl es noch in der Amtszeit seines Vorgängers Wohlenbergs geschehen sei, die Untersuchungsberichte selbst in den Hände gehalten. Es hätte sich keine Passage gefunden, die ein jüngeres Alter ergeben hätte. Gerne hätte er gewußt, von wem Duerr sein Information erhalten habe. Lengsfeld versprach jedoch ebenso, daß der Balken noch einmal untersucht werden solle, wenn neue wissenschaftliche Methoden einer exaktere Bestimmung erlaubten und finanzielle Möglichkeiten dafür beständen. Die neue Expertise sollte dann vom Schleswiger Landesamt für Bodendenkmalpflege und Archäologie hergestellt werden.
Daß die von Duerr geborgenen Scherben nachweislich vor 1362 gebrannt wurden, wird ihm wohl kaum einer abstreiten, nur eben, daß es Scherben aus Rungholt gewesen sein können, denn es sagt ja auch niemand, daß Nordfriesland nicht vorher weitflächig besiedelt worden ist. Auch daß die Nachbarorte, das Kirchspiel Riep („Fedderingmanriep“!), das bis 1532 bestand und die Nachbarorte Niedamm („neuer Damm“) und Halgenes („Hallignase“?) nach der Jahrhundertflut wiederbesiedelt wurden, bestreitet niemand. In der Auflistung der Einnahmen des Domkapitel zu Schleswig 1437 ist das Kirchspiel Rungholt nur lapidar als „submersa“ (untergegangen) wie viele andere Kirchspiele von Nordstrand auch vermerkt. Demnach könnte tatsächlich theoretisch die (jetzt wohl unbrauchbare) Schleuse dem Ort Nydam und die „Kirchwarf“ von Rungholt dem „Dörfchen“ Halgenes zugeordnet worden sein.
Für Kühn ist die Sache klar. Er schildert, was ihn am Vorgehen Duerrs eigentlich stört: „Da holt einer ohne Konsultation der Fachwelt und ohne die üblichen archäologischen Sicherungs-Maßnahmen Fundstücke aus dem Watt. Die Landesarchäologen hätten in diesem Falle mit Kollegen anderer Forschungsbereiche zusammen Fundort-Sicherung und Fund-Entzifferung betrieben. So sei das herausgeholte Material ‚kaum verwertbar‘. So ist nicht einmal ein Laie vorgegangen wie damals 1921, Andreas Busch, der die Rungholt-Spuren entdeckte.“
Duerr hält dagegen, daß er das Landesamt für Vor- und Frühgeschichte bereits im vergangenen Jahr von der geplanten Suche nach Kulturspuren im Rungholt-Watt unterrichtet habe. Kühn habe ihm sogar Ratschläge mit auf den Weg gegeben, die zum Gelingen der Sache beitragen sollte. Umso erstaunter sei er gewesen, daß Kühn ihn erst eiskalt abblitzen ließ, als Duerr ihn schließlich einige Zeit nach der Expedition privat anrief, „um mit dem Kollegen“, wie er hoffte, „die Fundstücke zu interpretieren und fachzusimpeln“. Sechs Wochen später hätte er dann aufgrund seiner Fundmeldung im Juni ein Einschreiben vom Landesamt mit der Mitteilung erhalten, daß gegen ihn ein Ermittlungsverfahren bei der zuständigen Behörde des Kreises Nordfriesland eingeleitet sei, weil er eine „Ordnungswidrigkeit“ wegen „Grabens nach Kulturdenkmalen“ begangen habe. Dies hätte ihm unter Umständen eine Strafe bis zu 50 000 Mark eingebracht.
Für Kühn ist jedoch die Anzeige wegen der Raubgrabung berechtigt und er kritisiert den Kreis Nordfriesland, der sie wegen „Geringfügigkeit“ nicht weiter verfolgen wolle. Damit ermuntere der Kreis geradezu zu archäologische Raubgrabungen und sei eine deutliche Aufforderung, da weiterzugraben und noch mehr kaputtzumachen. Das gesamte Wattenmeer sei Grabungsschutzgebiet. Jede Suche nach Relikten der Vergangenheit müsse durch Schleswig genehmigt werden. Wer dagegen als Wattspaziergänger zufällig auf Hinterlassenschaften früherer menschlicher Besiedlung stoße, dürfe diese in der Regel behalten. Es bestehe in Schleswig-Holstein eine Melde-, jedoch keine Abgabepflicht. Im Bedarfsfalle würde der Fund auf Anforderung begutachtet werden, das Landesmuseum würde in manchen Fällen dem Finder sogar den Ankauf des Exponats anbieten.
Auch nicht auf sich sitzen lassen will Kühn den Vorwurf, daß das Landesamt die kostbaren Siedlungsreste im Watt sich selbst überlasse. Es würde regelmäßig im Watt gearbeitet, nicht nur beim plötzlichen Auftauchen von Siedlungsresten würde das Landesamt tätig, sondern die Archäologen gingen in Zusammenarbeit mit dem Husumer Amt für Land- und Wasserwirtschaft auch systematisch vor. Mit dem Hinweis auf das vor einigen Jahren durchgeführte Norderhever-Projekt wies der Schleswiger Wissenschaftler darauf hin, nur durch akribische Arbeit habe man feststellen können, daß vor rund 1000 Jahren das heutige Wattenmeer bis zu den heutigen Außensänden eine fast zusammenhängende und von Friesen bewohnte Siedlungsfläche gewesen sei.
Erstellt am 1. Februar 1994
Hans-Jürgen Hansen