Auch das gehört mit zu den Aufgaben eines Aushilfshausmeisters bei der taz
– where people come/people go/and talk of Michelangelo.
1. Günter Schinske
Er gehörte, zusammen mit Max, Uschi und Gabi, zum harten Kern der Pritzwalker Qualifizierungsmaßnahme für langzeitarbeitslose Landarbeiter. Man versprach ihnen anschließend ABM- Stellen, als daraus nichts wurde, zogen sie sich in ihre Wohnungen zurück, tranken und verfolgten die Welt quasi nur noch über dürftige Fernseh-Features und billige US-Serien. Uschi bekam ein Hüftleiden, ihr Freund kam ins Gefängnis, dann auch ihr großer Sohn, dann sogar ihr neuer Freund, und schließlich nahm man ihr den kleinen Sohn weg. Max bewarb sich – vergeblich – bei einigen niedersächsischen Molkereien und mußte dann wegen eines Herzleidens ins Krankenhaus. Dann wurde er mit 1.200 Mark Frührentner. Günter und Gabi wohnten in einem Einzimmerhaus auf dem Dorf, wo – am anderen Ende – auch Gabis früherer Ehemann mit ihren vier Kindern lebte. Jedesmal wenn er einen Alkoholentzug abgebrochen hatte, ließ er seinen Frust an seinen Töchtern, aber auch an Gabi aus. Regelmäßig trafen sich die 17 Pritzwalker Neonazis bei ihm. Im Suff überredete er sie, Gabis und Günters Vorgarten zu verwüsten. Diese trauten sich manchmal im Dunkeln nicht mehr auf die Straße. Auch die reißerischen Sat.1-Reportagen machten sie paranoid. Aber Günter verlor seine gute Laune und seinen Witz nicht. Er war ein Pferdenarr, jedes Jahr fuhr er nach Neustadt auf den Pferdemarkt. Und Pferderennen im Fernsehen – das war wie Reichsparteitag für ihn. Einmal holte er sich ein Pony, kam aber nicht klar mit dem wilden Hengst. Gabi machte derweil ihren Führerschein und kaufte sich ein altes Auto. Und ein Telefon schafften sie sich auch noch an.
Ich dachte bereits, sie würden es langsam schaffen – und es sich mit zusammen 2.000 Mark im Monat (bei 250 Mark Miete) gemütlich machen. Aber dann aß Günter plötzlich nichts mehr, und bald konnte er auch keine Flüssigkeit mehr bei sich behalten – zum Arzt wollte er auch nicht. 14 Tage später war er tot: auf dem Weg zur Toilette zusammengebrochen. Seine Mutter, die im selben Dorf wohnte, und Gabi nahmen während der Vorbereitung seiner Beerdigung über 10 Kilo ab. Die genaue Todesursache wußten sie nicht und wollten sie auch nicht wissen: „Er hat einfach keinen Sinn mehr im Leben gesehen – keine Hoffnung!“ Und das war wahrscheinlich die Wahrheit.
Am letzten Samstag fuhren wir alle auf den Dorffriedhof, um ihm das letzte Geleit zu geben, wie man so sagt. Cirka 60 Leute hatten sich mit Blumen um die kleine Kapelle versammelt – viele weinten. Auf Gabis Wunsch spielte eine gemietete Beerdigungsrednerin „Ave Maria“ und ließ dann in ihrer Trauerrede noch einmal Günters Leben Revue passieren – ein bißchen zu kritisch für meinen Geschmack, aber besser als verlogen: Ausführlich kam sie dabei auf Arbeitslosigkeit, Alkohol, Fernsehkucken und seine Pferdeleidenschaft zu sprechen. Der Friedhof lag inmitten eines blühenden Rapsfeldes. Von irgendwoher blökten Schafe. Flieder, Schneeball, Rotdorn und Kastanie blühten. Gelegentlich überflog ein Storch oder ein Bussard die Kapelle.
Später erzählte mir sein Schwager, daß die LPG ihn 1987 als Fahrer beschäftigte, ohne daß er einen Führerschein besaß. Es kam deswegen zu einem Gerichtsverfahren gegen Günter, das man als Schauprozeß aufzog – und deswegen live im Radio übertrug. Aufgrund Günters witziger Antworten sei das Ganze aber nach hinten losgegangen: Günter war anschließend ein Held in der Region. So sagte er z.B. auf die Frage das Richters, ob er ein Konto besäße: „Ja, ein Fallskonto!“ – „Was ist das denn?“ – „Falls was drauf ist!“ Zuletzt hatte er übrigens am liebsten über den Euro geschimpft. Und seine letzten Worte zu mir am Telefon lauteten: „Der Sozialismus hat uns schon ruiniert, aber der Kapitalismus wird uns endgültig fertigmachen!“ Es war trotz alledem eine schöne Beerdigung. Nur mit Mühe konnte ich meine Tränen zurückhalten. Schwalben schossen durch die Luft, und Lerchen jubilierten über den Feldern. Mit der alten Goetheschen Weisheit „Es gibt nichts Schöneres auf Erden, als morgens eine Lerche zu hören und abends eine zu essen“, gewann ich beim Leichenschmaus im Haus seiner Mutter langsam meine Fassung wieder. Es war meine erste Beerdigung im Leben.
2. Lothar Feix
„So wie ich gelebt habe, will ich auch bestattet werden,“ warb das End-Up-Unternehmen Grieneisen. Und der Bezirksbürgermeister Kleinert meinte am Mittwoch: „Wir sehen uns auch nur noch auf Beerdigungen!“ Gegeben wurde die Urnenbestattung von Lothar Feix, der mit 48 Jahren an Kehlkopfkrebs gestorben war. Der Punk-Philosoph war zuletzt Gelegenheitskellner in der Prenzlauer Berg Tagesbar Torpedokäfer sowie Mitbegründer des „Arbeiter- und Literatenrats“ und Autor des auf poetische Nekrologe spezialisierten Periodikums „Gegner“ gewesen.
Seine Abschlussveranstaltung hatte der Exbetriebsrat Uwe Radlof ausgerichtet, der dann auch die Trauerrrede in der überfüllten Kapelle des Georgenparochialfriedhofs an der Greifswalder Straße hielt. Aber so richtig traurig war niemand – während der anschließenden Feier im Torpedokäfer tanzten sogar einige norwegische Künstlerinnen auf dem Tisch. Einzig ein noch jugendlicher Freund des Verstorbenen schien bedröppelt.
Er hatte denn auch eine zweite Trauerrede verfasst, die seine Mutter hernach leicht überarbeitet im „Torpedokäfer“ aushängte. Neben dem Hinweis, dass Lothar Feix sich schon seit mindestens zehn Jahren mit seinem Tod beschäftigte, wurden darin noch einmal die Verdienste des vermeintlich Zufrühverstorbenen gewürdigt – u.a. sein Engagement für die Freilassung von Angela Davis. Davor hatte der Sohn des ehemaligen Polizisten und Kriminalromanschreibers Gerhard Feix bereits persönlich der Prenzlauer-Berg-Dokumentaristin Annett Gröschner seine Sicht der Dinge diktiert: „Ich selbst würde mich als langzeitarbeitslosen Gelegenheitsautor bezeichnen“.
1981 hatte er eine kleine bei den Behörden durchgesetzte Anarcho-Demonstration zu Ehren von Erich Mühsam organisiert, schon damals war er Gelegenheitsarbeiter – Tellerwäscher, Straßenfeger, Telegrammbote, Heizer, wie es gerade kam, wobei sich Neugier und Disziplin die Waage hielten.
Nach der Wende kämpfte er dennoch einmal ein ganzes Jahr mit diversen Behörden, um nicht zum Gärtner umgeschult zu werden. Zuvor hatte man ihn auf ABM zur Erfassung der Vertikalbegrünung nach Weißensee verdonnert. Lothar Feix verließ höchst ungerne den Prenzlauer Berg: „Gelegentlich treffe ich hier noch Leute, mit denen ich zur Schule gegangen bin … Ich staune manchmal,die sehen alle viel reifer aus als ich“.
Wenn er nicht gestorben wäre, hätte er sich wahrscheinlich im Aussehen immer mehr Erich Mühsam anverwandelt. „Was bleibt“, schreibt sein jugendlicher Freund, „ist die Verpflichtung zur Tat, zur Erfolgslosigkeit. Klar hat er genuschelt, klar hat er sich oft genug zum Idioten gemacht, aber jeder, der ihn genauer kannte, hat seinen Witz, Verstand und das große Wissen geschätzt. Eines Morgens in der blauen Stunde jagten wir, genaugenommen eher äußerst langsam, von der Lychener kommend über die Stargarder nach Hause: ,Ich schlag den Mond zur Sonne!‘, brüllte Lothar zwischen den Laternen, aber irgendwie kam er nicht richtig ran …“
Der Friedhof, auf dem wir ihn nun beerdigten, war verwildert und mit umgefallenen Grabsteinen übersät: „Das wird Lothar gefallen, hier sieht’s aus wie in seiner Wohnung“, meinte die Gelegenheitsjuristin Cornelia Köster, bei der er einige Monate lebte, weil man dem Schwerkranken sein Dreckloch nicht mehr zumuten mochte, zum Schluss fand sich aber doch noch eine schöne neue Wohnung für ihn. Uwe Radlof sprach in diesem Zusammenhang von „Ironie“, denn kurz vor seinem Tod war er „zum ersten Mal seit Jahren materiell halbwegs abgesichert“. Allerdings konnte er wegen seiner Krankheit diese letzte Möglichkeit, gut zu essen, gar nicht mehr nutzen.
Das Geld kam von der Organisation „Schriftsteller in Not“, die ihm kurz nach der Wende schon einmal – mit 5000 DM – auf die Sprünge geholfen hatte. Dafür saß er die letzten Wochen ununterbrochen am Computer – und hinterließ schließlich eine dicke Diskette: einen Krebsroman, der bereits vom Basisdruck-Verlag, dem auch schon die Kneipe Torpedokäfer gehört, wohlwollend geprüft wird. Außerdem hinterließ Feix noch jede Menge Punkplatten bzw. -CDs. Der Punk verband ihn mit den Assis bzw. Obdachlosen, wie man im Westen sagt, vom Helmholtzplatz. Und aus dieser Sichtweise argumentierte er auch stets. Seine konsequente Spießerfeindlichkeit galt vielen als Volksverachtung, zunehmend gar als kundenvergraulend. Er selbst hat dazu einmal ausgeführt: „Ich war so ziemlich bei allen Sachen dabei, auch bei dieser ominösen, bescheuerten Demonstration am 4. November 1989 … Ich habe mit den Leuten von der Vorbereitungsgruppe wirklich viel geredet, doch die tönten, in Leipzig sind soundsovieltausend, da müssen wir in Berlin noch mehr werden. Das fand ich bescheuert und habe gesagt, auf der einen Seite beklagt ihr das Bildungswesen, durch das die Leute immer mehr verblödet sind, und dann wolt ihr mit dieser Masse von Blödmännern auf die Straße gehen, was soll denn dabei rauskommen? Und so war dann ja auch. Aber mir wurde vorgeworfen, ich hätte das Volk missachtet.“ In aller Freundschaft würde ich diesen Vorwurf auch heute noch aufrecht erhalten.
3. Ilona
Am 15. Januar beerdigten wir Ilona, die Frau des Satanisten-Galeristen Jes Petersen, der gerade wegen Rauschgift im Knast sitzt, aber dort – immerhin – schlank, gesund und schön geworden ist. Jes ist – Jahrgang 1936 – 25 Jahre jünger als die 1910 geborene Ilona. Sie war bereits zweimal verheiratet gewesen, als sie ihn 1961 in Flensburg kennenlernte. Damals hatte der schleswig-holsteinische Landwirtssohn gerade mit Franz Jung zusammen den Sex-Pol-Verlag Petersenpress gegründet. Und Ilona hatte angefangen, bei der Grotesktänzerin Valeska Gert – in deren Berliner „Hexenküche“ sowie im Sylter „Ziegenstall“ – Tanz zu studieren. Sie war ihrem „Hang zur leichten Muse“ gefolgt, wie ihr Beerdigungsredner, der Theologe und Antiquar Bernd Gärtner, das auf dem Friedhof am Südstern ausdrückte. Er sehe seine Aufgabe – bei diesem letzten Freundschaftsdienst – im übrigen nicht darin, die Trauer (der Verwandten und Freunde) zu verstärken, so sagte er. Zumal die Verstorbene „in der Summe ein gutes Leben“ hatte. Ilona „war immer von strahlender Eleganz, eine Dame, meist ganz hell oder in leuchtendem Grün bzw. Rot angezogen“. In den fast fünfzig Jahren ihrer Ehe hatte Jes ihr täglich frische Blumen hingestellt, und wenn sie ihn drängte, etwas zu erledigen, hatte er – im Chor seiner Freunde, mit denen er meist im Vorderzimmer seiner Galerie zusammensaß – geantwortet: „Ja, Ilona!“
Während er mit Schröder-Sonnenstern und später Oskar Huth herumzog, arbeitete Ilona mit Wolfgang Neuss: im Keller des Hauses am Lützowplatz. Eine Zeitlang konnten sie es sich mit Jes‘ Gutshoferbschaft leisten zu verreisen – und tourten durch Südamerika. Zwar mischte Ilona sich nicht in den „chaotischen Galeriebetrieb“ ein, aber „sie war stets dabei, wenn es abends was zu feiern galt“. Das Bemerkenswerte daran war, daß „auch die wildesten Künstlergestalten ihr gegenüber immer die Contenance bewahrten“. So gesehen, lebte das Ehepaar Petersen relativ ausbalanciert durch die Zeitläufte: „Sie gingen zusammen durch dick und dünn – allen Unkenrufen zum Trotz!“ Die Petersenpress wurde inzwischen wiederbelebt: Mit der Zeitschrift Sklavenaufstand des Schriftstellers Wolfram Kempe, der dann auch – als Abordnung Ost quasi – bei der Beerdigung und der anschließenden Trauerfeier im „Zwiebelfisch“ am Savignyplatz – der letzten Stammkneipe von Oskar Huth, über den dort auch ein Buch verkauft wird – dabei war.
Etliche Trauergäste waren eine Woche später erneut auf dem Friedhof am Südstern versammelt. Diesmal galt es, die ehemalige taz- Kulturredakteurin Regine Walther-Lehmann zu beerdigen. Wieder war die halbe Gemeinde verschnupft – und überhaupt nicht in Trauerstimmung, aber es mußte sein. Krankheit und Tod verschonen niemanden, wie Bernd Gärtner sich ausgedrückt hätte. Diesmal hielt jedoch jemand anders die Trauerrede. Das ist aber eine andere Geschichte.
In dieser hier sei nur noch erwähnt, daß ich nach Ilonas Beerdigung meinen 85jährigen Vater anrief und von ihm erfuhr, daß soeben wieder zwei nahe Verwandte von uns gestorben waren. Er stöhnte, weil er sich für ihre Beerdigung einen Anzug leihen und in die Stadt fahren mußte – beides tat er nicht gerne. Wir fanden es beide seltsam, daß wir uns jetzt öfter am Telefon über Beerdigungserlebnisse austauschten. „Aber das ist eben so mit zunehmendem Alter“, meinte er. Vor gut zehn Jahren hatte ich es noch ziemlich bescheuert gefunden, daß die Alten im Vogelsberg-Dorf, in dem ich damals wohnte, sich fast täglich auf dem Friedhof trafen, um sich schon mal an den Platz zu gewöhnen.
4. Oskar Huth
In Berlin hat Solidarität immer eine große Rolle im Kampf gegen die herrschenden Reaktionäre gespielt, und das nicht nur in der Arbeiterklasse, sondern auch unter den Ostjuden und russischen Exilanten. Nach dem Krieg war Solidarität ein Thema vor allem in der Berliner Studentenbewegung. Ich denke dabei vor allem an die zwei SDS-Aktivisten Peter Rambauseck und Rüdiger Stuckart, die in den Siebzigerjahren eine Werkschule für Heimjugendliche mitbegründeten und sich seitdem eigentlich nur noch um andere gekümmert haben. Aber nicht von ihnen soll hier die Rede sein, sondern von unserem großen Vorbild Oskar Huth.
Der 1991 gestorbene Klavierstimmer Oskar Huth hat drei Fankreise hinterlassen: Zunächst in der Ku’damm-Kneipe „Lusiada“, wo man ihn 1978 mit dem Buch „Für den Fall der Nüchternheit“ ehrte. Dann im „Zwiebelfisch“ am Savignyplatz, wo der Maler Alf Trenk 1994 die „Ansichten und Erinnerungen“ von Oskar Huth unter dem Titel „Überlebenslauf“ zusammentrug. Das Buch ist auch nur in dieser Kneipe käuflich zu erwerben. Und dann gibt es noch einen Fankreis im „Hoek“ in der Wilmersdorferstraße, zu dem unter anderem Thomas Kapielski und Jes Petersen gehören. Am Rande dieses Kreises entstand 1992 auch der kleine Film „In Memoriam Oskar“.
Die Amerikaner trugen Oskar Huth nach dem Krieg eine Stelle im Kultursenat an, er zog es jedoch vor, „freischaffender Trinker“ zu bleiben. Bis zuletzt lebte er in der Wohnung seines Vaters im Wedding. Ich traf ihn in seinen letzten fünf Jahren meist in der Galerie Petersen in der Goethestraße. Er besaß die Fähigkeit, auch noch sturzbetrunken fast druckreife Prosa zu reden. Leider weiß ich erst jetzt, da ich mich mit den jüdischen Ghettos in Warschau, Krakau, Lodz, Wilna und anderswo beschäftige, was ich ihn alles hätte fragen können. Die jüdischen Solidaritäts- bzw. Widerstandsbewegungen in den Ghettos schufen sich draußen – „auf der arischen Seite“ – ein Netz von illegalen Wohnungen, von wo aus sie Waffen, falsche Papiere und weitere Verstecke besorgten.
Absurderweise war es in Berlin für Juden leichter unterzutauchen als in Polen, weil die Deutschen nur ein Klischeebild vom Juden hatten, während es unter den Polen viele gab, die sich darauf spezialisierten, Juden zu erkennen und zu denunzieren bzw. zu erpressen. Viele geflüchtete Juden kehrten von der arischen Seite oder aus den Wäldern wieder zurück ins Ghetto und in den sicheren Deportationstod, weil sie es nicht schafften, dem „Szmalcownicy“ zu entkommen. Und dann kosteten auch die Unterschlupfmöglichkeiten bei christlichen Polen oft sehr viel Geld: Solidarität als Dienstleistung. Oskar Huth bekam 1939 im Botanischen Garten pro forma eine Stelle als Zeichner, 1941 tauchte er mit falschen Papieren unter.
Er besorgte sich eine Druckmaschine, die er in einem Keller am Breitscheidplatz versteckte. Damit fälschte er fortan Pässe und Lebensmittelkarten. Fast 60 Menschen, überwiegend Juden, die sich in Wohnungen, auf Dachböden und in Kellern versteckt hielten, konnten damit überleben. Ihre Unterkünfte waren über ganz Berlin verstreut, Oskar Huth versorgte sie mit Lebensmitteln – in einem jahrelangen „monsterhaften Latsch durch die Stadt“, wie er einmal erzählte: „Alles hing natürlich an einem seidenen Faden. Wer wirklich Leute versteckte, das waren die Proletarier untereinander. Die Ärmsten halfen den Armen. Und die Leute, die wirklich Möglichkeiten hatten – da war nichts, gar nichts.“
Für das schmächtige Männchen – „Hüthchen“ genannt – war Solidarität „eine artistische Balancemeierei – unvorstellbar . . . Aber was mit geholfen haben muss durchzukommen, ist wohl, dass mich die Leute hinsichtlich meiner Nervenfestigkeit, meiner physischen Kraft und, wenn ich’s mal ein bisschen eitel sagen darf, auch, was die Sache eines gewissen Witzes angeht, unterschätzt haben.“
In den letzten Tagen des Krieges brachte er sogar einen „besonders widerwärtigen Nazi und Einpeitscher“ um, indem er und ein zur Zwangsarbeit verpflichteter Franzose den Mann im Rollstuhl in ein brennendes Nebenhaus schoben: „So, da war einer weniger da.“
Gegen Ende seines Lebens meinte Oskar Huth: „Wenn es nach diesem Dasein nichts mehr gibt, dann hab ich versäumt, etliche Kanaillen abzumurksen . . . Aber der Spielraum, aus sich was anderes zu machen, als einem prädestiniert ist, der ist ein lächerlich geringer.“ Immerhin bescheinigten ihm die Amerikaner 1946 die „Evidence of Anti-Nazi-Activities“. Zwei Jahre nach der unseligen Wende begruben ihn seine Fans auf dem Jerusalemer Friedhof, nicht weit entfernt vom Grab E.T.A. Hoffmanns.
Ich will abschließend nur noch erwähnen, dass die von Oskar Huth einst gefälschten Lebensmittelkarten im Gegensatz zu den offiziellen sogar Wasserzeichen hatten – also echter als die echten waren.
5. Bodo Saggel
„Kam’n rin, hoben die Fäuste und schrien: ,Free Bommi Now!‘ “ – Damit war der eingeknastete Bommi Baumann gemeint. „Det war der Blues!“, erklärte Peter Paul Zahl, der zuletzt in Berlin die Anarchozeitung Fizz herausgab.
Der Blues hatte Ende der 60er einen „Zentralrat“ – „der umherschweifenden Haschrebellen“ genannt -, zu dem Bodo Saggel gehörte: „Mit unserer vom Dope erhellten Intelligenz heckten wir so manche Streiche aus“, schrieb der 1998 in einer Neuauflage seines Buchs „Der Antijurist“ über seine Haschrebellenzeit.
Damals propagierten sie unter anderem das „kostenlose Leben“ in Berlin – durch Ladendiebstähle etc. – und riefen in Flugblättern alle ähnlich Gesinnten Europas dazu auf, aus der Frontstadt eine einzige „Subkultur“ zu machen: „Alle Berliner werden Berlin verlassen! Von uns abgeschreckt in die Provinzen ziehen und letztlich uns Berlin überlassen!“ Es kam dann jedoch genau andersrum: Längst haben die letzten Langhaarigen die Stadt verlassen.
Heiligabend raffte es auch den Unbeugsamen Bodo Saggel hinweg. Er wurde 65 Jahre alt. Sein Freund Günter Langer berichtet auf Partisan.Net, dass es Saggel in der Kneipe Puttchen plötzlich vom Barhocker riss.
Bodo Saggel stammte aus Essen, wo er bereits als Jugendlicher Zugang zur kriminellen Szene gefunden und insgesamt 10 Jahre im Gefängnis gesessen hatte. Wieder draußen, besorgte er sich 1968 erst mal den damals noch linksliberalen Spiegel mit einem Foto von Rudi Dutschke auf dem Cover. Innen drin stand dessen Adresse: das SDS-Haus am Kurfürstendamm in Berlin.
Saggel fuhr sofort hin und wurde der „Ersatzproletarier des SDS“. Und dieser Proletarier bei den sozialistischen Studenten war nicht von Pappe: Erst mal verarbeitete er seine langjährigen Justiz- und Knasterfahrungen zu dem bereits erwähnten Buch „Der Antijurist – oder die Kriminalität der schwarzen Roben“, das er dann mit SDS-Hilfe druckte und selbst verkaufte: meist vor Hochschulen, was jedes Mal mit Agitation und „Hasch-ins“ verbunden war. Klaus Eschen vom sozialistischen Anwaltskollektiv hatte ein Vorwort dazu beigesteuert.
1969 warb Saggel für seine Antijuristenkampagne gar mit einem Teach-in im Audimax der TU – und zwar ganz allein. Das war ziemlich beeindruckend. Erst 1996, als er mich bat, wegen des 25 Jahre zuvor von Polizisten erschossenen Georg von Rauch in der taz noch einmal an die Haschrebellen zu erinnern, erfuhr ich, dass er das Teach-in eigentlich zusammen mit Bommi Baumann und Manfred Grashoff bestreiten wollte: „Aber beide erschienen dann nicht, so dass ich alleine über die ,Hure Justiz‘ sprechen musste“. Überhaupt hätte der gesamte „Zentralrat der umherschweifenden Haschrebellen“ in ein Auto reingepasst. Und das gehörte damals dem Vater von Günter Langer.
Dieser wiederum berichtete zusammen mit Bommi Baumann auf der „SDS-Website“ über Bobo Saggel: Er habe damals Freundschaft mit dem alten Genossen Erich Langer geschlossen, „der einen Ein-Mann-Fuhrbetrieb besaß und Hilfe brauchte. Das ungleiche Paar arbeitete jahrelang zusammen: Erich organisierte die Fuhren und Bodo schippte die Kohlen, die Schlacke oder was es sonst gab. Irgendwann hatte Bodo jedoch genug von Berlin. Er zog sich zurück aufs Land, kaufte sich ein Haus in Lüchow-Dannenberg. Jetzt ist er aber wieder in Berlin, in Kreuzberg, quicklebendig wie eh und je.“ Das war 1999. Dazwischen bereiste Saggel auch noch – mit dem Verkaufserlös seines Wendland-Hauses – alle fünf Kontinente.
Günter Langer schrieb einen ersten Nachruf. Darin heißt es, dass Bodo Saggel heute, am 3. Februar, auf dem Alten Luisenstädtischen Friedhof am Südstern 10-12 beerdigt wird, pünktlich um 9.15 Uhr. Ich füge hinzu: Im Anschluss daran findet im Puttchen in der Obentrautstraße 70 noch eine kleine Trauerfeier statt.
6. Jörg Stein
Seit den 60er-Jahren brauche ich morgens bloß die Todesanzeigen in der FAZ zu lesen – und schon habe ich gute Laune. So auch gestern, als ich zwei Todesanzeigen für Jörg Stein entdeckte. Der schwäbische Arbeitsrechtler wurde nach der Wende vom IG-Metall-Chef Steinkühler in die Treuhandanstalt (THA) geholt. Die THA wollte vor der Privatisierung ihrer Ostbetriebe so viele Arbeitsplätze wie möglich abbauen, um die Unternehmen für Käufer interessanter zu machen. Die entlassenen Belegschaften wurden in Beschäftigungsgesellschaften „zwischengeparkt“. Dieses Parkgeschäft übernahm Jörg Stein, indem er die Betriebsräte bearbeitete.
In der Treuhand hieß es schon bald: Ohne Herrn Stein läuft bei uns gar nichts! Bei den ostdeutschen Betriebsräten war der „Totquatscher“ dagegen verhasst. So meinte etwa der Betriebsratsvorsitzende des Motorradwerks Zschopau: „Der Stein, das war die schlimmste Erfahrung meines Lebens!“ Am Ende waren jedoch die meisten DDR-Betriebe von Mitarbeitern entleert – und Stein der größte Arbeitgeber Ostdeutschlands geworden: „Dafür kann ich aber nix“, sagte er mir einmal, „die ganzen Betriebe waren doch übervölkert.“ Die ostdeutsche Betriebsräte-Initiative verglich sein Vorgehen mit einem Pilotenspiel: Jede neue entlassene Belegschaft bringt ihre Sozialplan-Gelder in die steinsche Beschäftigungsgesellschaft ABS ein und dann kann diese eine Weile lang wirtschaften, bis die Belegschaft des nächsten liquidierten Betriebes – mit neuem Geld – an die ABS angekoppelt wird. Für Jörg Stein selbst blieben bei diesem Spiel Millionen hängen. Allein für die „Sozialplanbegleitung“ der liquidierten Mikrotechnologischen Gesellschaft Frankfurt (Oder) kassierte er 500.000 Mark.
In seinen ABS-Gesellschaften verblieben die Mitarbeiter rund ein Jahr, danach gingen sie in Umschulung, ABM oder in die Arbeitslosigkeit. Um sie dahin zu kriegen, bombardierte Stein die Betriebsräte mit Faxen. Dem Betriebsratsvorsitzenden des Ökokühlschrankherstellers Foron schrieb er zum Beispiel: „Ich habe Euch ein Gesamtkunstwerk geliefert [. . .] Ihr wißt nämlich nicht, um was es geht – das ist keine Wessi-Arroganz, sondern hat Sinn und Zweck – nämlich Kompetenz“. In seinen Schriftsätzen zitierte er gerne „den lieben Kollegen B. Brecht: ,Bitter bereut, wer des Weisen Rat scheut'“ – und behauptete von sich selbst: „dass beim lieben Gegner, nämlich der Treuhand, oder westdeutschen Konzernen, in der Regel das ,Zittern‘ anfängt, wenn man meinen Namen hört. Ich bitte Euch aus diesem Grund, mir mit dem Respekt zu begegnen, mit dem mir auch der Klassenfeind gegenübertritt“. Respekt, für einen, der sieben Geschwister hatte und aus kleinen Verhältnissen kam, ein gestandener „68er“ gewesen sein wollte („Friedrich Engels war ebenfalls gut betucht“) und auch ein „Realist“ („Wir leben nun mal in einer Leistungsgesellschaft, wo die Einkommenshöhe Indikator für den Erfolg ist“). Im Eifer des Gefechts und des Geschäfts mit den Riesensummen, die er hin und her schob, kam er immer wieder dem Mandantenverrat nahe. Zwar bezeichnete der Treuhand-Sprecher Schöde ihn schon beizeiten als „Wanderer zwischen den Welten“, aber die THA und Stein selbst stritten ab, dass er sowohl für die Treuhand als auch für die IG Metall und die Belegschaften arbeitete. Doch: Steinkühler bezuschusste sein Büro mit monatlich 50.000 Mark, die THA via Honorarvertrag monatlich mit über 70.000 Mark.
Als alles getan war, gründete Stein im schwäbischen Millionärsstädtchen Reutlingen die Firma „mypegasus“, mit der er fortan auch die überschüssigen und überflüssigen Belegschaften aus westdeutschen Betrieben einsammelte – so die Bremer Vulkanwerft-Arbeiter, einen Teil der Philipp-Holzmann-Belegschaft und Mitarbeiter von SEL, Mannesmann, AEG. Die steinsche Beschäftigungsgesellschaft mypegasus ist fast konkurrenzlos: Zwar gäbe es noch vier oder fünf Firmen ähnlichen Typs, meint deren Geschäftsführer Schwille, sie sind aber nur regional tätig.
Diese lokalen oder nur für und von einem Betrieb gegründeten Beschäftigungsgesellschaften sind jedoch weitaus effektiver, insofern sie die Arbeitsbedürfnisse und Umschulungswünsche der Betroffenen besser berücksichtigen. Über die Todesanzeige hat Schwille ein Credo von Jörg Stein setzen lassen: „Effizienz bedeutet die Suche nach Kooperationsdividenden“.
7. Schorse
Am 15. Oktober starb Georg Höge 91-jährig im Kreiskrankenhaus von Osterholz-Scharmbeck. Der am 14. Juli 1914 in Bremen-Woltmershausen geborene Künstler war mein Vater. Zwei für mich vorbildlich gewordene Eigenschaften zeichneten ihn aus: sein Antifamilialismus und eine konsequente Abkehr vom Kunstbetrieb.
Ersteres hatte er mit meiner im Ostertorviertel geborenen Mutter gemeinsam. Sie stammten beide aus kleinbürgerlichen Verhältnissen, sie war beim BDM, er an der Ostfront gewesen, nach dem Krieg studierten sie an der Bremer Kunstschule, wo sie sich kennen lernten. Die Kunst war für sie ein sozialer Aufstieg, der mit einem Wechsel von Bluts- zu Wahlverwandtschaften einherging, das heißt sie verkehrten fortan vor allem in Künstlerkreisen und suchten den Kontakt zu Architekten, Galeristen usw. Meine Mutter war dabei erfolgreicher als mein Vater, der jedoch durch Vermittlung von Oskar Kokoschka, dessen Salzburger Sommerschule er besuchte, Dozent an der Bremer Kunstschule wurde, was er auch bis zu seiner Pensionierung Mitte der 70er-Jahre blieb.
1959 waren meine Eltern aufs Land gezogen – ins „Radmoor“ zwischen Bremen und Bremerhaven. Ein paar Jahre später fingen sie an, aus der kleinen Datsche dort ein richtiges Haus zu bauen – aus Holz, Flaschen und Reit.
1970 beging meine Mutter Selbstmord – mein Vater und ich gaben uns gegenseitig die Schuld dafür. Fortan ließ er sein ganzes Kunstschaffen in den Hausbau einfließen – und zog sich immer mehr ins Radmoor zurück. Er vereinsamte jedoch nicht, im Gegenteil: Mehr Leute als zuvor, Freunde, Studenten und Nachbarn, besuchten ihn dort.
Ich kam ein- oder zweimal im Jahr vorbei, wir saßen dann meist auf der blumenumrankten Veranda und tranken Tee, in der übrigen Zeit telefonierten wir miteinander oder schrieben uns Briefe. Er unterstützte mich – auch und vor allem finanziell, wobei er meine Abwendung vom Wissenschaftsbetrieb zugunsten einer Beschäftigung in der Landwirtschaft ebenfalls begrüßte. Nicht weil er die (Land)Arbeiter und Bauern für sozialer oder menschlicher als die Künstler und Intellektuellen hielt, sondern wegen des damit zwangsläufig verbundenen Wechsels von der Kopf- zur Handarbeit.
Schorse, wie ich ihn allerdings nie nannte, schätzte das Handwerk hoch ein, das damit einhergehende „Spießertum“ meinte er mit anarchisch-künstlerischen Mitteln vermeiden zu können. Frauke, seine zweite Frau, ebenfalls eine Künstlerin, teilte diese Meinung. Vor dem Krieg hatte er eine Malerlehre absolviert, die er ebenso wie den Militärdienst gehasst hatte. Dennoch bekam er dadurch das Malerhandwerk von Grund auf mit, weitere handwerkliche Fähigkeiten erwarb er an der Kunstschule, wo ihm alle möglichen Werkstätten zur Verfügung standen und der kundige Hausmeister Fiegut half. Später war es der Bildhauer Fritz Stein, der Frauke und Schorse in seinem Atelier das Schweißen beibrachte.
Zuletzt arbeiteten die beiden jedoch vornehmlich mit Beton: Mosaike mit Porträts ihrer Freunde und immer größer werdende Plastiken, die in die wild wuchernde Vegetation des Grundstücks gestellt, und fast ausschließlich mit Fundstücken und nahezu kostenlos besorgten Materialien bestückt waren. Daneben malten und zeichneten sie. Viele Objekte und auch Teile des Hauses zerfielen mit der Zeit durch Nässe und Frost, sie waren also handwerklich wenig solide, aber das störte die beiden nicht, ebenso wenig, dass einige ihrer Werke einfach überwuchert wurden und dadurch quasi verschwanden. Wenn es stimmt, dass das kleinbürgerliche Denken im wesentlichen praktisch ist, dann hat Schorse es schon sehr früh mit unpraktischen Ideen bekämpft.
Anfang der Fünfzigerjahre hatten meine Eltern als SPD-Mitglieder eine Atelierwohnung in einem Neubauviertel am Überseehafen zugewiesen bekommen, in die sie zunächst ihre ganze Kreativität reinsteckten, sodass am Ende ein Fotobericht darüber in der damals gerade herausgekommenen Zeitschrift „Schöner Wohnen“ erschien. Es war auch eine schöne Atelierwohnung – mit schrägen Wänden, aber gänzlich unpraktisch eingerichtet. Man brauchte zum Beispiel bloß ein Buch vom Regal zu nehmen, das mein Vater aus Kupfer und Glas in der Kunstschule konstruiert hatte, schon kippten alle Bücher auf den Fußboden.
Der Hang zum Unpraktischen wurde nicht zuletzt dadurch zu einer Art Arbeitsprinzip, dass man ihn damals zum Hauptverantwortlichen für das jährliche Faschingsfest „Aladin“ in der Kunstschule machte. Unter seiner Leitung wurden die Dekorationen und Umbauten in den Gebäuden am Wandrahm immer aufwendiger. Ich erinnere mich an motorgetriebene bewegliche Tanzflächen und leise murmelnde Spiegelkabinette. Der eigentlich nie fertig gewordene Bau des Hauses auf dem Land war im Grunde eine Fortsetzung der Ausgestaltung des „Aladin“-Festes in Permanenz. Und auch im Radmoor fanden später noch etliche Tanzfeste von Kunststudenten und Künstlern statt.
Die Kunstschule gehörte mit dem Goethetheater zu den Institutionen, die sich ab 1967 an der Studentenbewegung, die in Bremen eine Schülerbewegung war, beteiligte. Während dabei der sozialistische Realismus Einzug in die Kunstschule hielt, gelang es einigen Dozenten, sich an die Spitze der Bewegung zu setzen, damit sich an ihrem distanzierten Lehrerverhältnis zu den Kunstschülern nichts änderte.
Im Gegensatz zu mir durchschaute mein Vater diese Manöver. Er selbst blieb gleich bleibend solidarisch, mit gutem Gewissen eigensinnig und klebte weiter seine abstrakten schwarz-braunen Bilder aus verbrannten Papierschnipseln. Einige wurden zu Entwürfen für Kirchenfenster, in der Neuen Vahr zum Beispiel, wobei er die farbigen Gläser jedoch nicht in Blei, sondern in Beton einfassen ließ. Im Radmoor beteiligte er sich an einer Bürgerinitiative gegen den Bau einer Panzertrasse durch den Wald und in Bremen an einigen Künstleraktionen. Als Otto Muehl während einer Performance in der Aula der Bremer PH einige Hühner schlachten wollte, schlich er sich hinter die Bühne und entführte sie in seinem VW.
Diese Aktion hatte jedoch noch einen anderen Hintergrund, der für alle in unserer Familie galt und gilt: die Tierliebe. Schon in der Bremer Atelierwohnung hatten wir Hund und Katze, Kaninchen und Eidechsen, Vögel und Fische gehalten. Auf dem Land schenkte ich meinem Vater einmal einen Ziegenbock zum Geburtstag, obwohl wir derlei Feiertage an sich nicht groß hervorhoben. Eine Zeit lang war ein Spatz sein Lieblingstier, später zwei Enten, die wir in der Dusche großgezogen hatten, und dann immer wieder Boxer, einige hat er auch gemalt. Zuletzt war es wie am Anfang wieder ein Dackel: Moritz, er lebt immer noch. Auch diese ganzen Tiere trugen zur Entspießerung bei, indem sie viel Lärm und Dreck machten und so ziemlich alles durften beziehungsweise sich selten an irgendwelche Verbote hielten. Meine Mutter hatte in den Fünfzigerjahren gemeint: Die Tiere müssen es warm haben und immer genug zu fressen – bei dieser minimalistischen (Erziehungs)Maxime blieb es im wesentlichen. Für das Essen reichte die Rente, das Holz zum Heizen kam fast umsonst aus dem nahen Wald.
Das ganze Domizil im Radmoor wurde so im Laufe der Zeit mit Mann und Maus ein Gesamtkunstwerk. Aus der Kunstgeschichte kennt man einige Vorläufer. Die Besucher hier, das waren Freunde, Verwandte, Nachbarn, Wandergruppen, Bundeswehrsoldaten, die sich auf ihrem Nachtmarsch im Moor verirrt hatten, ehemalige SDSler aus Westberlin, Behinderte, die auf ihrer Reise einen Zwischenstopp einlegten und neugierige Sonntagsausflügler. Es gab also immer genug Leute, die sich für diese abseits im Moor gelegene Kunst interessierten, damit es nicht noch mehr wurden, wimmelten die beiden sogar alle Journalisten ab.
In seinen letzten Lebensmonaten, da er auf das Krankenbett gezwungen war, überfiel Schorse dennoch gelegentlich der Gedanke an den Nachruhm, das heißt an den Kunstbetrieb, der so etwas institutionalisiert. „Sollte man sich nicht doch noch mal um eine Ausstellung irgendwo in der Stadt kümmern?“, fragte er Frauke, verwarf diesen Gedanken jedoch gleich wieder als albern. Ein anderes Mal beabsichtigte er, alle seine Werke zu signieren. Frauke seufzte und legte ihm erst mal eine kleine Mappe mit etwa 30 Bildern aufs Bett. Er begann sie durchzusehen und meinte dann: „Ach, Quatsch! Ich hab‘ aber auch manchmal blöde Ideen.“ Alle diese Konventionen, das waren erste Ansätze, um aus einer fast utopischen Unmittelbarkeit doch wieder Anschluss an den Geschäftsbetrieb zu finden, der die allgemein gültigen Verkehrs- und Umgangsformen prägt.
Im Frühjahr 2005 wurde er operiert. Als er noch auf der Intensivstation lag, rief mich Frauke vom Telefon des Schwesternzimmers an und sagte, dass ich ihn sprechen könne, sie müsste dazu nur den Apparat nach nebenan tragen. Schorse hörte sich zwar noch etwas benommen an, war aber schon wieder guter Dinge: „Mensch, wenn Du wüsstest, wie viele Leute hier um mein Bett rum stehen und sich um mich kümmern. Gleich kommt auch noch meine SPD-Ortsgruppe, ich bin doch da jetzt das älteste Mitglied, die wollen mir ein Ständchen bringen und dann wird eine Rede gehalten. Aber du weißt ja, solche Reden liebe ich nun gar nicht.“ Nachdem wir das Gespräch beendet hatten, trug Frauke den Telefonapparat wieder nach nebenan, unterwegs sagte sie mir leise und wie mir schien etwas erschüttert: „Das mit der SPD-Ortsgruppe, das stimmt alles gar nicht, das hat er sich ausgedacht.“ Auch in dieser politischen Hinsicht verließ er also zuletzt seine gewohnte Linie der Unmittelbarkeit – jedenfalls in Gedanken, um mit seinem ihm vielleicht zustehenden Teil des Nachruhms oder einem kleinen Zipfel der Unsterblichkeit zu liebäugeln. Aber diese Anfälle von Sentimentalität, auch mir, seinem Sohn gegenüber, waren zum Glück selten und gingen schnell vorüber – dann war er wieder „authentisch“, wie Frauke vielleicht sagen würde.
Dazu gehörte sein lockerer Umgang mit etwaigen familialen Bindungen und Zwängen: Entweder ist es anregend, mit jemandem zusammen zu sein oder nicht – und dann wird es auch nicht dadurch besser, dass man mit ihm verwandt ist. Vor allem Hochzeiten, Beerdigungen und Geburstagsfeier waren ihm ein Gräuel. Manchmal ließen sie sich allerdings nicht vermeiden, dann versuchte er, auch dabei eine andere Linie reinzubringen. So wollte meine Mutter, dass ihre Asche auf dem Grundstück verstreut wurde. Das genehmigte der Staat jedoch nicht. Mein Vater deponierte die Urne mit ihrer Asche deswegen zunächst ohne großes Tamtam im Grab ihrer Eltern. Von dort buddelte er sie aber eines Nachts wieder aus und erfüllte dann ihren letzten Wunsch.
Außerdem lief er immer in alten zerrissenen Klamotten herum und war allein deswegen schon für konventionelle festliche Anlässe kaum zu gebrauchen. Hinzu kam noch, dass Frauke und er wegen der vielen Tiere das Radmoor nicht lange verlassen konnten und wollten. Man musste sich also schon zu ihnen begeben, wenn man sich mit ihnen treffen wollte. Wenn man Glück hatte und am frühen Nachmittag dort eintraf, erwischte man sie noch am Frühstückstisch – einer alten hölzernen Kabeltrommel, die meine Mutter vor 50 Jahren für eine Mark von der Post erworben hatte.
8. Heidemarie Härtl
Die DDR-Dissidenz als nackte bzw. bärtige „Boheme“ westschnullimäßig aufzubereiten war schon eine rechte Sauerei. So richtig klar wurde mir das jedoch erst jetzt – nach Zusendung einer Künstlermappe über Heidemarie Härtl. Eine Kopie davon hatte jemand in der Ausstellung im Deutschen Historischen Museum an die Rückwand der dritten Buchte mit einem Schloß befestigt: um der „politikvergessenmachenwollenden Ausstellungs- Konzeption“ entgegenzuwirken. Der Verbleib dieser Mappe ist unbekannt. „Meine“ Mappe enthält: ein Bleistiftporträt von Härtl, zwei Gedichte von ihr, eine „Gegenwartsvertretung“, das Farbphoto eines Ölbildes, die Geschichte des von ihr mitbegründeten „bergen verlags“ sowie der Zeitschrift „zweite person“, dazu Inhaltsverzeichnisse, einen Lebenslauf der Schriftstellerin und die kurze Notiz: „Heidemarie Härtl wurde 1982 auf dem Weg zur Beerdigung von Robert Havemann auf dem Leipziger Hauptbahnhof zusammen mit ihrem Ehemann Gert Neumann vor dem Zugfahrtantritt nach Berlin von Sicherheitsbeamten in Zivil, Deutscher Volks- und Bahnpolizei festgenommen. Der Abführung verweigerte sich Heidemarie Härtl durch unaufhebbares Setzen auf den Bahnsteig. Sie wurde in einer nicht zu übersehenden Aktion von dort mit einem Gepäckträgerwagen blumenwinkend in Trauerkleidung laut rufend quer durch den Bahnhof zum Bahnpolizeirevier gebracht.“
In ihrem Lebenslauf steht: Die Eltern waren FDJ-Funktionäre; ein Mitschüler denunzierte sie wegen Rias-Musikhörens; ein „Bauwesen“-Studium brach sie ab und arbeitete in einer Druckerei; sie heiratete Neumann, „dem es ähnlich wie mir ergangen war“. Sie bekam ein Kind, arbeitete in einer Kneipe, leitete einen Zirkel „Schreibender Pioniere“, schrieb Gedichte und sollte in den Schriftstellerverband aufgenommen werden.
Ende der Siebziger arbeitete sie in der Blindenbücherei, studierte Freud und Lacan. 1987 fuhr sie mit Neumann in den Westen, dort verließ er sie, „was ich wie ein Trauma erlebte, ich kehrte nach Leipzig zurück“. Mit Iris Brankatschk arbeitete sie sodann an einem Buch über die Französische Revolution.
„1990 zeigten sich unübersehbar die Symptome einer manifesten Psychose, die durch eine medikamentöse Behandlung in einem psychiatrischen Krankenhaus und anschließende Selbstanalyse fast vollkommen geheilt wurde. Im Frühjahr 1991 wurde ich Mitglied der Internationalen Sozialistischen Arbeiterorganisation, las Leo Trotzki. Seit 1991 unterrichte ich in der GmbH Zukunftswerkstatt (kreatives Schreiben).“
Ergänzt sei noch: Wenige Tage vor den März-Wahlen 1990 bot Ibrahim Böhme ihr in seinem Schattenkabinett den Posten der Kulturministerin an, sie lehnte ab – mit der Begründung: „Dafür bin ich zu gut.“ In der „Gegenwartsvertretung“ für sie wird dazu erklärt: „Das eigene literarische Werk leben hieß für sie, neben poetischem Sprachgehalt selbstverständlich immer auch politische Handlung bis ins Privateste… Ein Vivat: Ihr Leben – Curatorin eines literarischen und bewußt politischen Lebens, das in einem Boheme-Katalog nicht vorkommen kann.“ Heidemarie Härtl starb im November 1993 – „fast einsam“.
9. Furrer
„Die deutsche Luft- und Raumfahrt-Industrie erlebt zur Zeit einen Sturzflug“, klagte bereits 1994 der Vorsitzende des Branchenverbandes BDLI, Wolfgang Piller. In diesem Jahr kam es noch dicker: Milliardenaufträge lösten sich in Nichts auf, die Dasa machte 1,5 Milliarden Minus, die Zahl der Beschäftigten schrumpft. Und jetzt zerschellte auch noch der Westberliner Luft- und Raumfahrt-Hoffnungsträger Reinhard Furrer im Sturzflug mit einer der Dasa gehörenden „Me 108“ aus dem Zweiten Weltkrieg – ausgerechnet auf dem Flugfeld der ehemaligen „Deutschen Versuchsanstalt für Luftfahrt e.V.“ (DVL) in Johannisthal.
Die Nationalsozialisten hatten das 4,2 Quadratkilometer große Gelände ab 1933 beiderseits der Rudower Chaussee zu einer gigantischen Waffen-Forschungs- und Erprobungsanstalt ausgebaut. Davon zeugen noch heute Windkanäle und Triebwerksprüfstände. Nachdem speziell für die „Vergeltungswaffen 1 und 2“ – nebenbei bemerkt die ersten, bei deren Herstellung weit mehr Menschen umgebracht wurden als durch ihren Einsatz – ein neuer Erprobungsstandort in Peenemünde aufgebaut worden war, testete man auch Raketen im Johannisthaler Windkanal.
Ein Teil der Anlagen wurde 1945 von der Roten Armee demontiert. Noch heute kann man am Windkanal das russische Graffiti entziffern: „Geprüft – keine Minen!“ Zu DDR-Zeiten wurde das Riesenareal vom MfS-Wachregiment sowie von der Akademie der Wissenschaften und dem DFF- Fernsehfunk genutzt.
Seit der Wende plant dort die BAAG („Berlin-Adlershof-Aufbau-Gesellschaft“) eine ganze „Stadt für Wissenschaft und Wirtschaft“. Entwicklungsträger ist die Wista GmbH, ferner das MEC (Mediencenter) und die Humboldt-Universität. Neben vielen kleineren Firmen und Instituten haben sich dort bereits die 1994 von der Dasa gegründete „Casa Informationstechnik GmbH“ für Raumfahrttechnologie und die 1969 vom Forschungs- und vom Verteidigungsministerium rekonstituierte „Deutsche Forschungsanstalt für Luft- und Raumfahrttechnik e.V.“ (DLR) – mit zwei Instituten – angesiedelt. Letztere wurden aus dem DDR-Institut für Kosmosforschung ausgesiebt. Sie sind durch einen großzügig vom Senat dotierten Kooperationsvertrag mit der TU verbunden. Dort ist man „sehr stolz“ darauf, daß die Technische Universität (TU) in Adlershof mit dabei ist – „und nicht Herr Furrer von der Freien Universität“.
1983 war der ehemalige „Challenger“-Astronaut mit einer Bewerbung als Akademischer Rat bei der TU abgelehnt worden, der CDU-Wissenschaftssenator hatte Furrer daraufhin eine hochdotierte Professur für Weltraumtechnologie an der Freien Universität verschafft, die noch mit einem Kooperationsvertrag für sein zuvor von der Deutschen Bank und der Dasa gegründetes „Weltraum-Institut Berlin GmbH“ (WIB) verbunden wurde.
Die enge Kooperation zwischen der DVL-Johannisthal, der TH Charlottenburg und der Flugzeugindustrie ab 1933 geht auf die nationalsozialistische Rüstungspolitik zurück. In den sechziger Jahren wurde der frühere DVL- Konstrukteur Heinrich Hertel Ordinarius für Luftfahrzeugbau an der Technischen Universität. Der Raumfahrtingenieur Hermann Koelle übernahm an der Technischen Universität den Lehrstuhl des Triebwerkkonstrukteurs Eugen Sänger, der seit 1936 für die DVL gearbeitet hatte. Hermann Koelle hatte einst in Peenemünde gelernt, von wo aus er mit den SS- Offizieren Walter Dornberger, Wernher von Braun, Arthur Rudolph und Kurt Debus nach Amerika auswanderte. Dort war er zuletzt Direktor für Zukunftsprojekte bei der Nasa.
Die dynamischen jungen Mitarbeiter der Raketenbauer, die sich in Amerika um Wernher von Braun geschart hatten und in der UdSSR um Helmut Gröttrup, fanden somit über die neue DLR und die TU bzw. über das Akademie- Institut für Kosmosforschung wieder Raumfahrtforschungsaufgaben im geteilten Deutschland, wobei sie jedoch fortan quasi gegeneinander arbeiteten. Ihre Schüler wurden jetzt nach der Wende in Johannisthal wiedervereinigt: „Unterbewußt werden mit dem Kooperationsvertrag die alten Connections wiederhergestellt“, so sagte es ein junger TU-Wissenschaftler.
Reinhard Furrer, zuletzt mit der Auswertung von Satellitenphotos beschäftigt – wobei seine Leute seit 1990 aus finanziellen Gründen neben Nasa- und Esa-Aufnahmen über das Institut für Kosmosforschung auch sowjetisches Bildmaterial verwendeten – wurde ab 1991 mit einer Cessna 207 auch selbst wieder luftaufklärerisch tätig: Am Himmel über Berlin versuchte er mittels einer Spezialkamera verborgene ökologische Altlasten aufzuspüren.
Ansonsten war der eher zum Film-Haudegen als zum Forschungsmanager geeignete ehemalige Student einer schlagenden Verbindung und bewaffnete „Fluchthelfer“ in den letzten Jahren, wiewohl von CDU und Springerpresse exzellent gefördert, zunehmend unseriöser geworden. Er wirkte auch verbittert – seitdem die großen Spacelab-Programme in Bonn gestrichen wurden und die 1991 gegründete Dasa-Tochter „Deutsche Agentur für Raumfahrtangelegenheiten“ (Dara) mit ihrem Space-Park-Konzept in Peenemünde an internationalen Protesten gescheitert war.
Andererseits klagten Physik- Doktoranden über die schamlose Ausbeutung bei Furrer. Der Bundesrechnungshof rügte zudem dessen Positivgutachten für dubiose bayerische Kleinflugzeugbauer, die zudem noch Gesellschafter seiner WIB waren. Negativ schlug auch eine fahrlässige Bruchlandung als Fluglehrer zu Buche, womit Furrer „sich noch ein Zubrot verdiente“, wie die FAZ im Nachruf schreibt.
Furrers abruptes Ende hatte mehr Stil: Mit einem eleganten Looping verabschiedete er sich am 9. September von der gesamtdeutschen Flug- und Raumfahrtforschung in Johannisthal, die ihn bei ihrer Rekonstruktion abgewiesen hatte. Das neue Adlershofer „Eingangsportal“ wurde übrigens von Albert Speer Junior entworfen, dem Sohn des einst für den deutschen Raketenbau verantwortlichen Rüstungs- und Reichsbauministers. Das war Zufall, Furrers Sturzflug ein Unfall.
10. Andy Warhol
Am Sonntag um 6.30 Uhr (Ortszeit) wurde Andy Warhol für tot erklärt, nachdem Wiederbelebungsversuche scheiterten. Um 18.30 kommt die erste Telex-Meldung (von AP): „Gallionsfigur der Pop-Art starb nach Operation an Herzversagen. Redaktionen: Sie erhalten umgehend einen Nachruf.“ „Sie holten mich von den Toten zurück – im wahrsten Sinne des Wortes, weil, wie man mir später sagte, ich tatsächlich einmal schon klinisch tot war. Endlose Tage danach war ich mir immer noch nicht sicher, ob ich wirklich zurück bin. So ist es also, wenn man tot ist – du denkst, du bist am Leben, aber du bist tot.“ Andy Warhol: „POPism, The Warhol 60s“, New York 1980, im Kapitel über das Attentat von Valerie Solanas auf ihn – 1968.
Die Aktuellen-Redaktion verteilt die eingehenden Nachrichten an die zuständigen Ressorts. Wegen der Berlinale sind an diesem Sonntag abend alle Kultur-Redakteure, bis auf zwei, unterwegs. Sie haben wenig Lust, einen schnellen 100-Zeilen-Nachruf zu schreiben. Ihnen wird bedeutet, daß man eine Tagesthemen-Seite aus Warhols Tod machen könnte, eventuell sogar zwei. „Am Dienstag ist wenig los.“ Das war beim ersten Scheintod Warhols anders: am selben Tag war Bobby Kennedy erschossen worden. Entsetzt kamen die „Factory“-Leute und andere New Yorker Künstler im „Max“ zusammen. „Robert Rauschenberg ließ sich auf den Boden fallen und schluchzte: Ist dies das Medium?“ (Andy Warhol, a.a.O.)
Um 19.20 Uhr kommen die ersten Porträts über die Ticker. „Warhol, einer der einflußreichsten Beweger der Kunstszene, errang zu Beginn der 60er Jahre erste Berühmtheit mit der Wiedergabe von Gegenständen der Alltagskultur, etwa Suppendosen, und mit Serienportraits Marilyn Monroes und Elvis Presleys. Er hat seinen eigenen Lebensstil zum Kunstwerk gemacht, würdigte Richard Oldenburg, Direktor des New Yorker Museums für moderne Kunst, den Verstorbenen.“ (AP) Wie üblich hinkt dpa wieder mal eine Stunde hinter den anderen her, bemerkt der Aktuellen-Redakteur. „USA/Warhol (Eil) Tod eins /Andy Warhol gestorben / Folgt Tod zwei“.(dpa)
Die Nachricht ist mittlerweile von Radio und Fernsehen verbreitet worden. Zwei Mitarbeiter rufen in der Zeitung an: „Da müssen wir was draus machen.“ Wegen des Zeitdrucks (bis Montag 14 Uhr müssen die Tagesthemen-Seiten stehen) verabredet man sich um 22 Uhr im Presse-Cafe am Zoo, um das bis dahin beschaffte Material zu sichten. „Daß dieses Nachdenken überhaupt von einem Produkt ausgelöst wird, das alles verneint, was es als Produkt je sein wollte und war, ist nur eine andere Marginalie der Nachrichten von diesem Produkt…Die andere Marginalie der Nachrichten als memento mori?“ (Heiner Bastian über Andy Warhol in der „Sammlung Marx“, Katalog der Nationalgalerie Berlin, 1982)
Alles was Warhol herstellte, kennt kein Subjekt. Denn was er verarbeitete sind Dinge, die in ihrer Wiederholung keinen Ursprung mehr haben. Seine vergegenständlichte Botschaft lautet: Es ist nichts dahinter. Die berühmten Campbell-Dosen und Geldscheine stellte er 1961 im Siebdruckverfahren her nach der Auf forderung eines Kunsthändlers, das zu malen, was ihm am meisten bedeute. Erstere erbrachten 1962 auf einer Auktion bereits 60.000 Dollar. Es folgen Mitte der Sechziger Jahre weitere Serienbilder von Berühmtheiten. Daneben Unfallphotos aus der Presse, ganze Tageszeitungs-Seiten, die er dadurch zu „sozialen Ikonen“ stilisiert. Genau sechs Jahre nach der Schlagzeile vom 4.Juni 1962 „129 starben beim Absturz eines Jet“, die er als Siebdruck-Vorlage benutzt hatte, passierte ihm das selbe.
„Ich war die Schlagzeile in der New York Daily News Schauspielerin schießt auf Andy Warhol.“ Und heute ist die Schlagzeile „Andy Warhol gestorben“ nur noch ein alter Warhol. „War hole“ singt David Bowie. Im „Zeitgeist“-Katalog findet sich die schöne Anmerkung: „1957 Art Directors Club Medal für Schuhanzeige. Nach Italien- Besuch vollständige Hinwendung zur Kunst.“ Sein Cover für die Rolling Stones Platte „Sticky Fingers“ diente 1967 einer deutschen „Kritik der Warenästhetik“ als Schulbeispiel. „Der Käufer hat die Möglichkeit mitgekauft, die Verpackung zu öffnen, den Reißverschluß aufzuziehen, und er findet dahinter – nichts.“(W.F. Haug) Dasselbe Nichts, das hier noch Haug um Irgendetwas betrog, ist in Warhols Filmen ganz unverpackt Thema: In dem Film „Sleep“ beispielsweise wird sechs Stunden lang aus einer Position heraus ein schlafender Mann gezeigt – sonst nichts. Für diesen „Undergroundfilm“ sowie für „Eat“, „Kiss“, „Haircut“ u.a. bekam Warhol den „Independent Film Award of Film Culture“ – mit der Begründung, daß sie die Welt „transponierten, intensivierten und elektrifizierten“.
An „Flesh“ und „Tresh“, die zu Publikumserfolgen wurden, wirkte die gesamte Belegschaft seiner 1963 gegründeten „Factory“ mit, in der alle echten Warhols produziert wurden. „Ich fände es großartig, wenn mehr Leute Siebdrucke herstellen würden, so daß keiner mehr wüßte, ob mein Bild das Bild eines anderen ist…ich stelle mir vor, daß jedermann gleich denkt. Einer sieht aus wie der andere, und wir machen ja immer mehr Fortschritte in dieser Richtung.“ Konsequenterweise signiert er Ende der Sechziger Jahre Warhol-Imitate der Düsseldorfer Gruppe „Exit“. Die Kopie wird zum Original und die Persönlichkeit, die Identität ist als Klischee in Serie gegangen. „Der kleine Andy soll – nach angeblich häufigen Nervenzusammenbrüchen – oft wochenlang mit Malbüchern im Bett gelegen haben.“(AP-Porträt) Einen Moment lang überlegt man, diesen Satz als Schlagzeile zu nehmen. Der rührende Versuch, das „Markenzeichen“ Warhol zu repersonalisieren, begründet die Ausführlichkeit, mit der sich die Presseagenturen über die fehlenden Geburtsdaten des Künstlers auslassen. Hartnäckig wird am Wunsch nach dem Individuum – das einen Anfang und ein Ende hat – festgehalten.
Warhol scheint es gewußt zu haben: „Die sind noch nicht ganz so weit.“ In seiner 1970 herausgebrachten Zeitschrift „Interview“ werden berühmte Persönlichkeiten vorgestellt, in Gesprächen, die alle gleich – nichtssagend – verlaufen. Die Demontage der Idole geht einher mit Werbung für identitätsstiftende Markenartikel. Der Verlockung, am Original- Schauplatz Spuren zu sichern, also jemanden in New York zu finden, der bis sechs Uhr morgens (Ortszeit) einen Bericht durchgibt, mußten auch wir – Vogel/Höge – erliegen. Die Telefongespräche erbrachten eine Zusage von Gisela Freisinger und eine Theorie: Die Operation Warhols an der Gallenblase sei eine Nachbehandlung der 68er Schußverletzung an der Milz gewesen. Sein Tod mithin eine an Dutschke erinnernde Spätfolge des Attentats der „Society for Cutting Up Men“-Gründerin Valerie Solanas. Damals hatten Feministinnen in New York Flugblätter verteilt, in denen das Opfer als „Number One Plastic Man“ bezeichnet worden war. Seit seiner Milz-Verletzung hatte Warhol auf alle Fälle eine Pigment-Störung, die seine Haare bleichte und ihn immer blasser und durchsichtiger werden ließ. Die Sucht des Schwindens schien ihn körperlich erfaßt zu haben.
„Man kann die Hoffnung auf Wiedergeburt fahrenlassen, wenn man nicht zuvor erkennt, daß man tot ist“, schrieb Leslie Fiedler in einem Aufsatz „Über die Postmoderne“ 1969. In einer „Strategie des Objekts“ (Baudrillard)gibt es allerdings weder Geburt noch Tod, nur den Verlust einer Kopie, deren Original nie existiert hat. Bestenfalls.
11. Eduard Bernstein
Der städtische Friedhof Eisackstraße am Innsbrucker Platz war einmal ein geradezu paradiesischer Fleck. Aber nach und nach wurde es dort immer ungemütlicher. Erst rahmte man ihn mit zwei S-Bahn-Trassen ein, später zerschnitt ihn auch noch die Stadtautobahn. Der heutige Verkehrslärm hindert die Toten an der Ruhe und die Lebenden am Zuhören – wenn hier zum Beispiel Worte des Gedenkens fallen. Zur Erinnerung an den vor 75 Jahren verstorbenen SPD-Theoretiker und Schöneberger Stadtverordneten Eduard Bernstein versammelten sich des ungeachtet am Mittwochmorgen rund zwei Dutzend führende SPD-Genossen und Ortsgruppen-Aktivisten an seinem Ehrengrab auf dem Friedhof.
Die Sozialdemokratie ist auf Sinnsuche und beschäftigt sich wieder mit ihren Vordenkern: „Wir haben keinen Grund, uns von unserer Vergangenheit zu distanzieren“, hatte dazu bereits SPD-Chef Kurt Beck bei der Verabschiedung des neuen Parteiprogramms in Hamburg gesagt. In diesem Geist zog SPD-Generalsekretär Hubertus Heil nun am neuen Grabstein des „Revisionisten“ Eduard Bernstein eine gerade Linie vom Gothaer über das Erfurter bis zum Godesberger und dem Hamburger Programm: Stets sei es darum gegangen, sich von der „naiven Utopie“ zu verabschieden (ohne allerdings das Wort Sozialismus fallen zu lassen) und stattdessen auf die altbewährte „Methode Reform“ zu setzen. Um es mit den Worten von Eduard Bernstein zu sagen, dem auch noch Willy Brandt zugestimmt hätte: „Das Ziel ist nichts, die Bewegung alles!“
„Mein lieber Ede, so etwas sagt man nicht, so etwas tut man“, entrüstete sich seinerzeit der Genosse Ignaz Auer. Eine satte Mehrheit distanzierte sich gar auf dem Dresdner Parteitag 1903 von Bernsteins Marxismus-Revision: Reform statt Revolution. Auch der damalige Juso-Vorsitzende Gerhard Schröder beharrte 1978 noch darauf: „Als Sozialist muss man das Paradies auf Erden für möglich halten.“ Als Kanzler peilte er dann jedoch ähnlich wie Tony Blair pragmatisch die „neue Mitte“ an. Seit dem Hamburger Bundesparteitag im Oktober 2007 ringt man nun aber um eine „solidarische Mehrheit“ und bringt dabei erneut den „demokratischen Sozialismus“ aufs Tapet. Dazu gehört auch eine gute Portion „Geschichtsarbeit“, wie der SPD-Landesvorsitzende Michael Müller an Bernsteins Grab ausführte.
Hubertus Heil verband Eduard Bernstein kurzerhand mit US-Präsident J. F. Kennedy, als er am Ende der Gedenkfeier ausrief: „Ich bin ein Revisionist!“ Applaus von den ums Grab versammelten Genossen, darunter die Berliner Landtagsabgeordnete Dilek Kolat, die in ihrer Begrüßungsrede bereits die Aktualität von Bernstein betont und sich bei den bisherigen Grabpflegern aus dem Ortsverein bedankt hatte. Am Ende der sympathisch bescheidenen und kurzen Veranstaltung an diesem kalten Dezembermorgen richteten einige Genossen noch schnell die rot-weißen Blumengebinde auf dem Grab, dann waren die meisten auch schon wieder verschwunden – unterwegs zu einem weiteren „Termin“.
Zurück blieben zwei Friedhofsbesucher, die sich anhand der Grabinschrift informieren mussten, um wen oder was es bei den Reden überhaupt gegangen war. Einer meinte daraufhin geschichtsbewusst: Er würde in dem alten „Revisionismusstreit“ zwar die Position von Luxemburg, Liebknecht und Kautsky eingenommen haben, aber so antikommunistisch sei der von ihnen angegriffene Eduard Bernstein doch nun auch wieder nicht gewesen, als dass er nicht ein schönes Grab auf dem Sozialistenfriedhof in Lichtenberg verdient hätte, statt hier an der sozialdemokratischen Autobahn zu vermodern.
12. Amechi Ochinanwata
„My voice is wishful thinking“: Im Herbst 2005 fragte der Nigerianer Amechi Ochinanwata die taz-Kulturredaktion, ob er im Rahmen seines Pflicht-Integrationskurses Deutsch ein Praktikum bei ihnen absolvieren könne. Das wurde verneint, weil er noch nicht genug Deutsch konnte. Man bot ihm aber an, stattdessen als Autor für die Kolumne „Berliner Ökonomie“ tätig zu werden, gegebenenfalls auch auf Englisch, was ich dann übersetzen würde – das wollte man ihm auch honorieren und als Praktikum abzeichnen.
Neben Interviews mit dem Kfz-Mechaniker und Schauspieler Augustin Thulla aus Sierra Leone, einer Weddinger Gaststättenbesitzerin aus dem Kamerun, schrieb Amechi auch noch einige „Deklarationen“ mehr allgemeinen Inhalts, die für die taz nicht geeignet waren, wenn sie auch zumeist den deutschen Rassismus gegenüber Afrikanern thematisierten.
Amechi Ochinanwata entstammte einer adligen Familie. Sein Nachname bedeutet „König von Geburt“. Daher erwartete mindestens jeder zweite Nigerianer von ihm, dass er ihn – zumal in der Fremde – unterstütze. Das war ihm aber unmöglich, weil er selbst kaum Geld besaß. Deswegen unterschrieb er seine Text mit dem Pseudonym „Bushdoctor Truthseeker“.
Im Übrigen wollte Ochinanwata bald eine eigene Zeitung herausgeben, zuvor hatte er bereits zwei Bücher geschrieben, wovon das erste „A Bushman speaks – My Voice is Wishful Thinking“ hieß. Das zweite befand sich noch in seinem Computer befand. In beiden Büchern ging es um Gott und die Welt.
Amechi stammte aus einem Ort im nigerianischen Bundesstaat Enugu – dem früheren Biafra, das zwischen 1967 und 1971 mithilfe der an dem Öl dort interessierten Westmächte von Nigeria überfallen wurde – und seine Selbständigkeit verlor. Amechis Familie büßte dabei ihr ganzes Vermögen ein.
Er selbst besuchte zunächst eine Architekturschule, machte sich dann aber mit einer Kfz-Werkstatt selbständig. 1994 heiratete er eine Koblenzerin – Sabine – und zog nach Deutschland. Mit ihr hatte er zwei Kinder: den heute siebenjährigen Ugochukwu (was „Besonderes Geschenk“ heißt) und den jetzt zehnjährigen Tobechukwu („Lob des Herrn“). Amechi war sehr gläubig.
In Berlin arbeitete er zunächst als Bauhelfer, nach einem Arbeitsunfall wurde er jedoch entlassen. Fortan war er als Hausmann tätig, während Sabine das Geld verdiente. In den letzten Jahren hatte sie vor allem 1-Euro-Jobs in Bezirksämtern. Amechi bildete sich währenddessen zu Hause fort, das heißt, er schrieb sich in die Londoner Open University ein, um Free-Lance-Journalist zu werden. Diese Fernuniversität schloss er 2004 ab. Danach war er eine Zeit lang für einen Schweizer Konzern als Verkäufer von Nahrungsergänzungsmitteln und Kosmetika tätig.
2005 begann sein Pflicht-Integrationskurs, zu dem ein Praktikum gehörte. Er bewarb sich bei allen möglichen Zeitungen und Rundfunkstationen, bekam aber nur Absagen – bis die taz eine Lösung fand. Und diese Arbeit ließ sich auch gut an, aber dann wurde Amechi krank. Am 19. Mai starb er – vierzigjährig – in der Charité an Krebs.
Seine letzte Bitte an seine Frau war: „Begrab mich nicht in weißer Erde!“ Sabine erfüllte ihm diesen Wunsch auch – und ließ seine Leiche für 6.000 Euro in einem mit Zink ummantelten Sarg in seinen Heimatort nach Enugu überführen. Aber in seinen Computer reinzukucken („das war neben mir seine zweite intime Beziehung“), um die hinterlassenen Texte zu lesen, das traute sie sich bisher noch nicht.
Sabine organisierte eine Pro-forma-Beerdigung in Berlin, wo unter anderem auch Ochinanwatas hier lebende nigerianische Freunde Abschied von ihm nahmen. Ich ging nicht hin, weil ich in der letzten Zeit auf so vielen Beerdigungen war, dass ich das Gefühl bekam, bald gar nicht mehr vom Friedhof runterzukommen. Außerdem war ich der Meinung, nicht laufend immer nur Nachrufe schreiben zu können. Ein schreckliches Genre im Übrigen, das allerdings vor zwei Wochen zusammen mit dem vor allem im agnostischen Osten aufblühenden Beruf des „Trauerredners“ von der Künstlersozialkasse in Wilhelmshaven offiziell als „künstlerische Tätigkeit“ anerkannt wurde.
13. Deutsche Eliten
Die deutsche Elite findet man vornehmlich auf Friedhöfen. Da gehört sie eigentlich auch hin! Denn wegen der hiesigen Unfähigkeit zur Revolution gibt es leider nur diese primitive biologische Lösung für sie. Die deutsche Selbst-„Auslese der Besten“ wuchert allerdings auch noch mit den verblichenen Knochen ihrer Altvorderen. So wurden zum Beispiel gleich nach der Wende als Erstes die provisorisch in Westdeutschland zwischengelagerten Gebeine des letzten Hohenzollernkaisers nach Potsdam „heimgeführt“.
Bei der Zweit-Bestattung der Reste dieser Meta-Elite war alles, was heute Rang und Namen hat, am Grab versammelt. Anschließend wurde Potsdam zügig zum Zentrum der deutschen und EU-Militärelite ausgebaut. Auf den dortigen Friedhöfen („Was in Sanssouci stirbt, das wird in Potsdam-Bornstedt begraben“, schrieb Fontane) war zuvor bereits ein Teil der preußischen sowie auch der DDR-Militärelite bestattet worden.
Wie ja überhaupt sich die DDR als Nachfolgestaat Preußens begriff. Beider Geisteseliten fanden deswegen auch auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof in Berlin-Mitte zueinander: Hegel und Fichte, Borsig und Schinkel (Letzterer unter einem von ihm selbst gestalteten Grabstein), ferner Becher und Brecht, Heiner Müller und Jürgen Kuczinsky.
Die von Theodor Fontane einst abgeklapperten Landadligen – „Preußens wahre Elite“ – liegen jedoch großenteils auf „Privatfriedhöfen“, ihren Herrensitz im toten Blick. Solche Ruhestätten dürfen aber seit 1934 aufgrund eines von Adolf Hitler unterzeichneten Bestattungsgesetzes nicht mehr neu eingerichtet werden. Seitdem lässt man höchstens noch das Gewohnheitsrecht gelten.
Die Nazi-Elite selbst favorisierte dann den Militärfriedhof am Spandauer Schifffahrtskanal – Invalidenfriedhof genannt. Sie plante dort sogar, die ihnen wichtigsten Grabmäler in einer gigantischen „Soldatenhalle“ mit Gruftgewölbe zu versammeln. Im 19. Jahrhundert waren hier die mit dem Eisernen Kreuz und dem „Pour-le-Mérite“ ausgezeichneten Offiziere beerdigt worden. Dann kamen die im Ersten Weltkrieg gefallenen Ordensträger dazu – vornehmlich adlige Flieger, unter anderem Manfred Freiherr von Richthofen, den man 1925 aus Frankreich überführte.
Vom Invalidenfriedhof wurde er aber nach dem Krieg wieder ausgebuddelt, um schließlich 1976 in Wiesbaden seine letzte Ruhestätte zu finden. 1941 wurde die Leiche seines Kampffliegerkameraden, des Generalluftzeugmeisters Ernst Udet, auf dem Invalidenfriedhof bestattet, im Jahr darauf der „Schlächter von Prag“: SS-Führer Reinhard Tristan Heydrich – und noch so mancher andere Naziführer. Aber auch einige der 1944 hingerichteten adligen Offiziere des gescheiterten Attentats auf Hitler. Die DDR ließ den Heldenfriedhof in Mitte erst schließen und dann – mit dem Mauerbau – einen Teil davon sogar schnöde planieren, um dort einen Todesstreifen anzulegen. Ähnliches passierte zur gleichen Zeit auch mit dem Zivilistenfriedhof St. Hedwig an der Liesenstraße, wo unter anderem Theodor Fontane und die Familie Adlon beerdigt wurden.
Umgekehrt hatten die Nazis zuvor die „Gedenkstätte der Sozialisten“ in Friedrichsfelde geschändet, wobei sie auch das von Mies van der Rohe entworfene Denkmal für die Spartakusführer Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht platt machten. Auf diesem „Zentralfriedhof“ befinden sich bereits seit 1900 die Grab- und Gedenksteine der sozialistischen Elite.
Erwähnt seien Ernst Thälmann, Franz Mehring, Paul Singer, Hugo Haase, Erich Weinert, Friedrich Wolf, Willi Bredel, Käthe Kollwitz, Irmtraud Morgner, Hermann Duncker, Otto Grotewohl und Walter Ulbricht. Dessen Ehefrau, die erst kürzlich verstorbene Lotte Ulbricht, wollte jedoch partout nicht in der Gedenkstätte Friedrichsfelde beerdigt werden: „Unsinn“, meinte sie, „ich bin nicht so wichtig.“ Stattdessen wurde ihre Leiche dann auf dem St.-Georgen-Friedhof in Weißensee beigesetzt.
Die nationalsozialistische Elite wurde – sofern man sie nach dem Krieg hinrichten konnte – verbrannt und ihre Asche hernach in „alle Winde“ verstreut, um eine Pilgerwanderung von Neunazis zu ihren Gräbern zu verunmöglichen. Eine seltsame Häufung von eilig verscharrten Leichen aller politischen Couleur ereignete sich auf dem Gelände des ehemaligen ULAP (Universum Landesausstellungspark) zwischen Lehrter Bahnhof, Invalidenstraße und Alt-Moabit, wo 1916 eine Munitionsfabrik ihre Arbeit aufnahm.
Hier wurden 1919 die ermordeten Spartakisten aus dem Zellengefängnis Lehrter Straße, den Moabiter Kasernen und dem Kriminalgericht verscharrt. 1927 stieß man bei Ausschachtarbeiten anlässlich der Elektrifizierung der Stadtbahn erst auf 7 und dann noch einmal auf 119 chlorkalkbedeckte Leichen. Ab 1933 wurde das ULAP-Restaurant „Messepalast“ Treffpunkt und Folterraum der Sturmabteilungen I, II und VI. Im April 1945 hielt die „Soko 20. Juli“ noch etwa 100 Verdächtige gefangen. Am 23. sollten sie entlassen werden. Man transportierte sie stattdessen auf Lastwagen zum ULAP-Gelände, wo sie erschossen wurden.
Eine Woche danach wurden dann die beiden flüchtigen Naziführer Martin Bormann und der SS-Arzt Stumpfegger tot auf dem ULAP-Gelände gefunden und dort von Sowjetsoldaten eingegraben. Bormanns Leiche konnte man erst 1973 identifizieren. In der Zwischenzeit hatte die Stadt sinnigerweise gerade dort auf dem Trümmerfeld ihre neue Leichenhalle errichtet, wo dann prompt auch die ersten Opfer der Studentenbewegung – Benno Ohnesorg und Georg von Rauch – hinkamen.
Die bürgerliche Elite im Westen, Künstler wie Politiker, ließ und lässt sich am liebsten in den Bezirken der Besten – Zehlendorf, Dahlem, Grunewald – beerdigen. Auf der so genannten Toteninsel, dem Friedhof Grunewald, liegen zum Beispiel der Bankier Bernhard Dernburg, der Jurist Friedrich Dernburg, das Schriftsteller-Ehepaar Sudermann und der Physiker Hans Geiger, nach dem der Geigerzähler benannt ist. Auf dem Zehlendorfer Waldfriedhof ruhen unter anderen der Politiker Julius Leber und der Kabarettist Wolfgang Neuss, auf dem städtischen Zehlendorfer Friedhof der Optiker Carl Ruhnke und auf dem Dahlemer Waldfriedhof der Schauspieler O. E. Hasse. Sie haben meist kostenlose „Ehrengräber“.
Für das Militär gibt es noch ein zweites Endlager in Berlin: den Garnisonsfriedhof. Hier liegt vor allem die Elite aus den napoleonischen Kriegen, den Befreiungskriegen und dem Zweiten Weltkrieg – unter anderem General von dem Knesebeck, ferner Adolph von Lützow, der Baron de la Motte Fouqué und auf dem so genannten Brauchitsch-Hügel der Scharnhorst-Gefährte Generalmajor von Boguslawski. Die letzte Beerdigung auf dem Garnisonsfriedhof fand 1961 statt.
An sich beherbergt jeder Berliner Friedhof mindestens einen toten Angehörigen der deutschen Elite. Von allen europäischen Hauptstädten besitzt Berlin mit 225 die meisten Friedhöfe, zusammen nehmen sie 1,5 Prozent der Gesamtfläche der Stadt ein. All das spricht bereits für die Eingangsthese, dass der elitäre deutsche Volksteil auch noch über den Tod hinaus viel Raum beansprucht.
Die dumpfen Massen bevorzugen dagegen eher platzsparende Urnengräber, das heißt die so genannte Feuerbestattung, die hierzulande allerdings erst seit 1911 erlaubt ist. Heute werden bereits 75 Prozent aller Verstorbenen aus der Nichtelite eingeäschert. Und ihre Angehörigen wollen immer häufiger die Urne mit nach Hause nehmen – denn permanent steigen die Friedhofsgebühren. Ähnlich wie in Nordrhein-Westfalen wird man deswegen wohl auch bald in Berlin den seit 1934 bestehenden „Urnenzwang für Friedhöfe“ (Tina Klopp) aufheben. Allerdings darf man die Asche dann immer noch nicht privat verstreuen, sondern muss sie auf einem öffentlich zugänglichen Gelände – in „Würde“ – unterbringen: in einem extra dafür ausgewiesenen deutschen Wald beispielsweise.
14. Regine Walther-Lehmann
Wie viele taz-Frauen schon an Krebs gestorben sind, weiß ich nicht, aber es hat bereits eine höhere Merkwürdigkeit. Im Januar beerdigten wir auf dem Kreuzberger Südstern-Friedhof Regine Walther-Lehmann. Ende der achtziger Jahre war sie Medien-Redakteurin gewesen. Weil sie es nicht bedauern wollte, eine Disco-Rezension von Thomas Kapielski, in der das Wort „gaskammervoll“ vorkam, abgedruckt zu haben, mußte sie derzeit, zusammen mit Sabine Vogel, die taz verlassen. Regines Redaktions-Vorgängerin, die inzwischen ebenfalls an Krebs gestorbene Ulrike Kowalsky, organisierte daraufhin ein Bühnenprogramm im Kino „Eiszeit“ für sie. Einige der daran mitwirkenden Männer gründeten später die „Höhnende Wochenschau“, aus der etliche Berliner Bühnen-Kollektive hervorgegangen sind.
Von Thomas Kapielski, derzeit mit einer Kunst-Professur gesegnet, erschien soeben der zweite Merve-Band – zum Thema „Gottesbeweise“. Der Autor kommt darin erstmalig auch auf seinen taz- Skandal zu sprechen, der seltsamerweise Wiglaf Droste berühmt machte.
Zurück zu Regines Beerdigung: Weil speziell in der Single-Hochburg Berlin die Bestattungsrituale nicht mehr festliegen, und auch die diesbezüglichen Institute relativ locker geworden sind (Ilona Petersen wurde neulich z.B. von einer lesbischen Camp-Bestatterin „betreut“ und die Sargrede hielt jemand vom Stammtisch ihres Mannes) – ist dem „Anything Goes“ Tür und Tor geöffnet. Regines Mann Achim und Rosa, ihre studierende Tochter, entschieden sich für die ganze Spannbreite: Zuerst lasen sie einige Texte von Regine vor, dann trug ein Freund ein Gedicht von Hilde Domin vor und betete anschließend das Vaterunser, das „wer vermag“ mitbeten konnte. Zum Abschluß erklang eine Orgel – kein Walzer, wie bei Ilona – normale Trauermusik.
Da es meine erste Urnenbeerdigung war, bedrückte mich zunächst die Kleinheit von Regines Grab. Überhaupt war ich die ganze Zeit mit Formproblemen beschäftigt. Schließlich malte ich mir sogar eine ständige Kolumne über Berliner Beerdigungsriten aus – im Stil von Theaterrezensionen. Dazu trug bei, daß ich am Friedhofseingang eine Tafel mit dem täglichen Spielplan dieser Anlage entdeckt hatte. Regines Name stand auch drauf. Wie ich dann aus den Grabreden erfuhr, war sie 1972 Regieassistentin in der Neuen Volksbühne gewesen. Nach der taz arbeitete sie einige Zeit als Redakteurin bei „Radio 100“. Im Osten hatte sie es bis zur Jungpionierin gebracht, seit sie im Westen lebte, forschte sie immer wieder gern über DDR- Themen. 1994 unternahm sie eine umfangreiche Recherche über das Ost-Ampelmännchen. Danach war sie organisatorisch für einen Germanisten-Kongreß im Schloß Rheinsberg tätig. Auf dem Kongreß wurde Ulrike Kowalskys Freund , Wiglaf Droste, der 1989 ebenfalls aus Solidarität mit Sabine Vogel und Regine Walther-Lehmann die taz verlassen hatte, von den anwesenden Germanisten zum kontemporären Tucholsky gekürt. – Im Tagesspiegel berichtete jetzt gleichzeitig ein freiwillig aus der taz ausgeschiedener Redakteur über die Trara-Beerdigung des Berliner „Currywurst- Königs“. Ja, das Leben kann manchmal grausam sein!
15. Die Arbeiterklasse
„Die letzte Schicht gewinnen wir!“ (aus einem alten Kampflied)
An der Ruhr-Universität Bochum hat kürzlich Vinzenz Hediger, der dort zuvor schon über Tierfilme geforscht hatte, die erste Professur für Industrie- und Arbeiterfilme bekommen. Fast gleichzeitig fingen einige öffentliche Institutionen an, ein Archiv für Arbeiterfilme aufzubauen. Daneben schrieb die Bundeskulturstiftung einen Wettbewerb über „Arbeit“ für alle Kunstsparten aus. U.a wird nun dem Regensburger Kommunalkino eine Reihe mit Arbeiterfilmen gefördert. In Hannover lief bereits eine solche – moderiert von Oskar Negt und Christian Ziewer, der 1971 den ersten neudeutschen Arbeiterfilm drehte: „Liebe Mutter, mir geht es gut!“ Zum klassengemäßen Vertrieb dieses Filmes entstand damals in Westberlin der „Basis-Filmverleih“, der sich heute jedesmal sagen lassen muß: „Wen wollt ihr denn damit hinterm Ofern hervorlocken?“ wenn er mal wieder einen Arbeiterfilm in seinen Vertrieb aufnimmt.
Ein 2005 in die Kinos gekommener Arbeiterfilm von Michael Glawogger deutete bereits im Titel an, dass diesem Genre hierzulande ein ähnliches Schicksal wie die DDR blüht – nämlich ein nahezu abgeschlossenes Forschungsgebiet zu sein. Der Film hieß: Workingsman’s Death“ – es geht darin um die elendsten Arbeitsbedingungen weltweit: Er beginnt mit ukrainischen Bergarbeitern, die stillgelegte Kohlegruben auf eigene Faust ausbeuten, und endet in Duisburg, wo man aus einem Stahlwerk ein Event- und Einkaufscenter machte. Der Regisseur wollte damit „den Arbeiter zum Helden machen, ohne dass ich [noch] etwas von ihm will“. Mehr Wirkung hatte dann der in Tansania gedrehte Dokumentarfilm „Darwins Alptraum“ von Hubert Sauper, in dem es um die dortige Fischindustrie geht, die Victoriabarsch-Filets für Europa produziert – und deren Arbeiter nur Gräten zu fressen kriegen. Um die Agrarindustrie weltweit ging es 2006 Erwin Wagenhofer mit seinem Film „We Feed the World“, die Zeit verglich ihn mit dem „Dokumentarfilmklassiker ‚Septemberweizen'“ (1980) von Peter Krieg und erwähnte auch gleich noch einen weiteren: „Unser täglich Brot“ von Nikolaus Geyrhalter. „Je härter die Zeiten, desto mehr haben Dokumentarfilme wieder Konjunktur,“ meinte die Rezensentin dazu. Einer der härtesten Arbeiterfilme war zuletzt jedoch ein Spielfilm: „Blinder Schacht“ von Li Yang, in dem es um chinesische Wanderarbeiter geht, deren Haupteinkommen darin besteht, dass sie als Bergarbeiter eingestellt unter Tage sogleich einen Kumpel erschlagen, um dann vom Minenbesitzer Geld für die Beerdigung zu kassieren. A Workingsclass-Hero was something to be!
Als kürzlich im Kreuzberger Club „Kato“ der Film „Die letzten Feuer“ – über die militanten Arbeitskämpfe 1969/70 im Industrieviertel von Venedig (Porto Marghera) lief, meinte demgegenüber einer der Veranstalter – aus dem „Wildcat“-Kollektiv : „Das war nicht das Ende, sondern der Anfang – von etwas Neuem.“ Damals gingen aus diesen Auseinandersetzungen die „Autonomia“ und der „Operaismus“ hervor – sowie auch die Organisationen Potere Operaio und Lotta Continua. Die Wildcat-Leute touren mit der Doku nun zwischen Palermo und Poznan, gedreht hat ihn die Venezianerin Manuela Pellarin, das Geld kam u.a. vom Oberbürgermeister Venedigs, der selber einst Arbeiter in Porto Marghera war. In der anschließenden Diskussion im „Kato“ wurde festgestellt, dass es zwar hier und heute ebenfalls wieder viele Arbeitskämpfe in Betrieben, von Studenten, Schülern und Ärzten gäbe – mit steigender Tendenz sogar: 2006 immerhin schon so viele wie seit 1992 nicht mehr, „aber die Kämpfe kommen nicht zusammen“. Es sind Abwehrkämpfe – und im Zweifelsfall stirbt „jeder Betrieb für sich allein“, wie sich ein Aktivist des gerade beendeten Streiks beim Spandauer Bosch-Siemens-Haushaltsgerätewerk (BSH) ausdrückte, der gegenüber den Wildcat-Mitarbeitern die mangelnde Solidarität sogar der nächstgelegendsten Betriebe beklagte. Eine Ausnahme bildete allein die Belegschaft des gerade von einem indischen Konzern übernommenen EKO-Stahlwerks in Eisenhüttenstadt, die die BSH-Streikenden per Bus besucht hatten. Auch die Hauptperson in dem italienischen Arbeiterfilm – Augusto Finzi – klagte zuletzt über die zerschlagenen einst von ihnen in Porto Marghera erkämpften „Zusammenhänge“. Dieser Teil wurde im „Kato“ nicht gezeigt, es gibt ihn jedoch auf der Wildcat-DVD. Er wurde erstmalig in Venedig vorgeführt – im dort kürzlich eröffneten „Arbeiterarchiv“, als man es nach dem 2004 an Krebs gestorbenen Augusto Finzi benannte.
P.S.:
Neulich traf ich die Genossin Gisela Richter. „Wir sehen uns auch nur noch auf Beerdigungen, das aber immer öfter,“ sagte ich zu ihr.“ „Ja, schrecklich,“ meinte sie, „immer mehr Leute, die ich kenne, sterben. Ich komm bald gar nicht mehr runter vom Friedhof.“ Ich nahm mir wenig später vor: Jetzt ist Schluß, ich gehe nicht mehr auf Beerdigungen – und Nachrufe schreibe ich auch keine mehr. Wie zum Hohn bot Thömmes mir kurz darauf an, auf der Friedhofseite des Tagesspiegels ab und zu mal einen Nachruf zu veröffentlichen, das lehnte ich jedoch ab. Man kann es auch übertreiben – so wie die bisherigen taz-hausmeister, bis auf die jetzigen – Klempner Wolf und landwirtschaftlicher Betriebshelfer Höge, die alle sozusagen vorzeitig verschieden: der 1. Architekt Peter – starb auf einer griechischen Insel an Herzerschöpfung, der 2. Mathematiker Jens – an Krebs, die 3. Elektrikerin Karin – ebenfalls an Krebs. Diese Krankheit rafft überhaupt ungewöhnlich viele taz-mitarbeiter dahin. Rezeptionist Henry hat mal eine diesbezügliche Liste angelegt. Er will sie mir demnächst mailen, ich weiß jedoch noch nichts damit anzufangen.
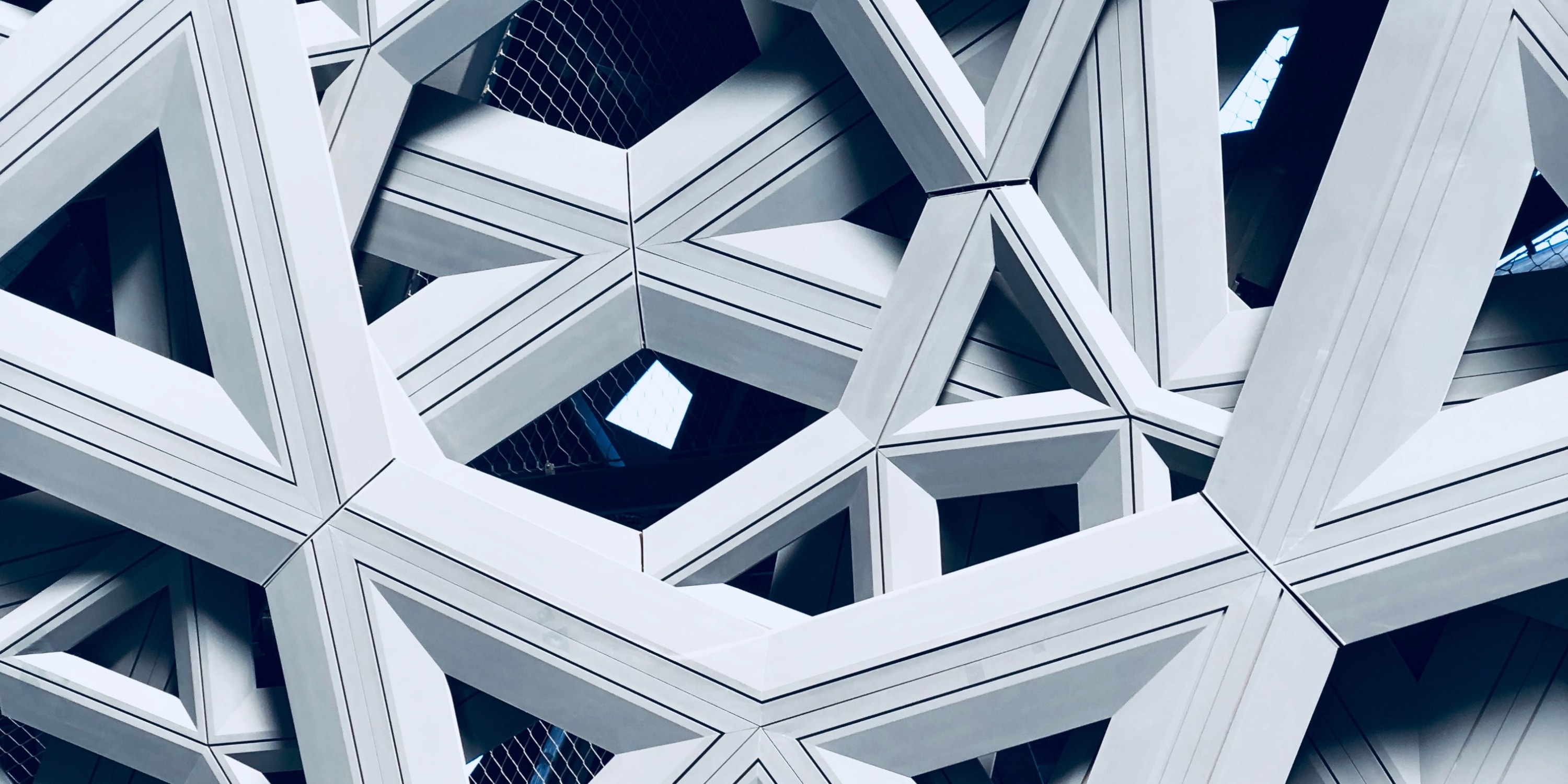



Hallo Herr Höge
Ich, Rolf Banck, habe hier im Internet viel von Ihnen gelesen. Auch habe ich sehr viel über Sie gehört – keine Skepsis- nur Gutes. Georg Höge, mein ehemaliger Nachbar hat mir viel über Sie berichtet. Wenn wir uns gegenseitig besuchten, haben wir immer sehr viel gescherzt und gelacht.
Gruss
Rolf Banck