Die taz hat ein Wander-Reader im Angebot: „Das Glück zu Fuß – Wandern mit der taz“, für schlappe 13 Euro plus Porto. Eigentlich müßte es im Untertitel heißen „Wanderungen von taz-mitarbeitern“. Diese schwärmten aus – im Urlaub meistens, um nahezu überall auf der Welt und in allen Regionen herumzuwandern und wertvolle Erfahrungen zu sammeln. Anschließend schrieben sie darüber einen taz-artikel – und setzten sich dann wieder auf ihren taz-stuhl. Es handelt sich bei diesen Texten also um ein Gehen im Kreis, um eine Kreisbewegung – ohne Aus-Flucht. Diese gibt es für tazler nur noch dort, wo sie von der taz weg zu einer anderen Zeitung GEHEN – die sie dann u.U. besser bezahlt.
Das war einmal ganz anders. Dazu hier ein taz-text vom 8.10. 81 – unter der Überschrift „Moving Targets“ und mit dem Motto „Nur die ergangenen Gedanken haben Wert“ (Friedrich Nietzsche):
Ich beginne, wie abgesprochen, mit der Rezension des Buches »Gehen« von Dietrich Garbrecht (erschienen im Beltz-Verlag). Hierzu genügte es vielleicht bereits, die Personalangaben zum Autordieses Buches auf dem Cover zu zitieren: „D. Garbrecht, Dr.-Ing. und Master in City Planning, 1935 in Berlin geboren, studierte Architektur in Braunschweig, Stadtplanung und Mensch-Umwelt-Beziehungen am Massachusetts Institute ofTechnology (MIT) und an der Harvard Universität Er hat als Projektleiter in Deutschland, der Schweiz und anderen Ländern Pianungs- und Forschungsaufgaben bearbeitet. Heute lebt er als selbständiger Stadtplaner und verhaltenskundlicher Berater in Zürich.“
Soweit der Klappentext über den Autor. Was ist von solch einem Menschen zu erwarten?! Der Fuß-Gänger ist von den motorisierten oder Massen-Verkehrsmitteln an den Rand gedrängt worden. Aus-Gangs-Position! Konzeptionen, Gedanken, Ideen, gestützt auf Forschungsergebnisse, Statistiken, die das wieder rückgängig machen sollen:
„1. Schritt: Das Gehen genauso ernst nehmen wie den Autoverkehr“/ 2. Schritt: Die Umwelt dem Men- schen zu Fuß anpassen./ 3. Schritt: ein Netz ununterbrochener Bürgersteige./ Noch einen Schritt weitergehen: Den Anteil des Autos am Verkehr reduzieren. Jeder Schritt zählt“, usw.
Das Ganze wird dann mit dem Bierernst, dem Eifer und der stilistischen Armut eines engagierten Um- weltschützers aufbereitet. Dazwischen: Zitate von oder über Thoreau (der täglich sechs Stunden lang Spaziergänge unternahm), Döblin (der durch Berlin schlenderte), und Joyce (der die Irrfahrt seines „Ulysses“ in Dublin beginnen und enden ließ)… usw. Fertig ist das Buch. Fehlt nur noch (am Anfang) die Liste der Personen und Institutionen, die am Zustandekommen dieses Werkes maßgeblich beteiligt gewesen waren („ohne die dieses Werk nie zustande gekommen wäre…“). Habe ich was vergessen?
Sicher. Ich meine, ganz sicher ließe sich hier noch dieses oder jenes Brauchbare aus diesem Buch herausnehmen, erwähnen. Aber ich will es hier genug sein lassen. Und das nicht deswegen, weil ich schnelle Wagen liebe (und damit Fußgänger, besonders gebrechliche, gerne über irgendwelche Kreuzungen scheuche). Nein. Abgesehen davon bin ich ein leidenschaftlicher Fuß-Gänger. Diese Art der Fortbewegung nicht als Stadt- bzw. Landschaftsplanerisches Element, als „Chip“ – ähnlich dem „Nichtraucher in der Umweltverschmutzungsdebatte. Das ist nur zu blöde. Noch blöder als die „Dickleibigkeit“ in der Diskussion der Frauenbewegung. Oder das „Veilchen“ in der Naturschutzdebatte.
Wie gesagt, ich bin ein leidenschaftlicher Fuß-Gänger. Mein Pferd und ich. Das Zu-Fuß-Gehen als Fluchtlinie. Ich wiederhole: DasZu-Fuß-Gehen, als das Weg-Gehen, das Abhauen als Flucht-Weg. Ich reite nicht. Mein Pferd läßt niemanden auf sich reiten. Ich will damit sagen: Ich sitze hier jetzt an meinem Schreibtisch, vor der Schreibmaschine, und vielleicht auch noch morgen oder übermorgen, und schreibe dieses oder Ähnliches, korrespondiere mit dieser oder jener Zeitschrift/Zeitung, telefoniere mit diesem oder jenem Verlag, fahre zur Bank, um mir meine Kontoauszüge anzuschauen, etc., überlege mir jedes Wort, bestelle mir Bücher, lese sie durch, lese sie quer, manchmal höre ich dabei „Loving is easy with both eyes closed!“ Etc. Etc. Aber das ist kein Leben. Oder jedenfalls nicht meins. Weniger wäre mehr gewesen sozusagen. Oder anders ausgedrückt: Diese Buchmesse nehme ich noch mit, dann hau ich aber wirklich ab. Mit meinem Pferd. Das trägt die Satteltasche. Für die wenigen Klamot- ten, die ich brauche, und die paar Bücher. Vielleicht „Rimbaud“, ein bißchen „Nietzsche“ oder „Milles Plateaux“. Mehr ist nicht drin. Ein Zentner höchstens. Und die Satteltasche wiegt schon einen halben Zentner.
Soll ich noch mehr ins,Detail gehen? Nein. Das alles ist vielleicht ebenso unwichtig wie die Lektüre des Buches »Gehen« (s.o.). Mein Privatvergnügen eben. Es geht um etwas anderes, Es geht um ein neues Projekt (d.h. so neu ist es auch wieder nicht, aber egal erst einmal). Ich beginne noch einmal. Diesmal mit einem Zitat von Pasolini: „Die ‚unglückselige Generation‘. Die Einsamkeit: Man muß sehr stark sein/ um die Einsamkeit zu lieben; man muß gut zu Fuß sein/ und eine außergewöhnliche Widerstandskraft haben; man darf nicht Räuber oder/ Mörder fürchten; wenn es heißt, den ganzen Nachmittag/ oder vielleicht den ganzen Abend zu laufen/ muß man es tun können, ohne mit der Wimper zu zucken/ hinsetzen kann man sich nicht/ vor allem im Winter, mit dem Wind, der übers nasse Gras streicht/ und den großen Steinen, die feucht und schlammig zwischen Müllhaufen liegen/ es gibt gar keinen Trost, darüber besteht kein Zweifel, als den, daß man einen Tag und eine Nacht ohne irgendwelche Pflichten oder Schranken vor sich hat,/ Der Sex ist ein Vorwand…“ So weit Pasolini dazu. Vielleicht sollte ich hier noch daran erinnern, daß „Pedestre“. also „Fuß-Gänger“ – auf italienisch auch „uninspiriert“ heißt; und nicht „Ein- atmen“.
Aber jetzt zu meiner oder unserer Idee, zu unserem Projekt. Es ist schon einmal eingebracht worden – auf dem Tunix-Kongreß, danach wurde es dann von verschiedenen kleineren Gruppen oder Zirkeln diskutiert, hier und dort wurde auch schon mal was darüber publiziert, einige von uns sind dann vor einem Jahr nach Amerika gefahren, um dort die Idee zu verbreiten, die Idee einer Bewegung von Moving Targets. Zuvor, d.h. vor dem Tunix-Treffen hatten einige es alleine (also in Einsamkeit) auch schon versucht, nach dem Tunix-Treffen dann zu mehreren noch einmal · es waren etwa hundert Leute – und nicht zu Fuß, sondern mit Wohnwagen, Tippis, Treckern, Bussen, das Ding hatten sie „No Haft für Sess Maden“ genannt, sie kamen nicht weit, außerdem beanspruchte die Technik zu viel Auf- merksamkeit. Das alles waren Versuche, die mußten gemacht werden… Alleine und zu mehreren, aber mit einem Riesenaufwand, der natürlich einen gewissen Luxus garantiert (die dabei beteiligten Frauen haben prompt fast alle Kinder bekommen). Aber dieses „No Haft für Sess Ma- den“ hatte wie gesagt mit „Gehen“ sowieso nichts mehr zu tun.
Jetzt aber zum Dritten An-Lauf: Wir stellen uns vor, 10.000 oder 20.000 oder 50.000 Leute treffen sich irgendwo, rauchen ein paar Joints, trinken einige Tassen Kaffee und gehen dann los. Kein Sternmarsch (nach Bonn), keine Friedensdemonstration (nach Paris). Völlig ohne Ziel. Man könnte der Ironie wegen sagen: bis in die äußerste Mongolei (also dorthin, wo es noch mehr Pferde als Men- schen gibt, wo Swifts Yahoo noch nicht triumphiert hat, wo es eine Lust sein muß zu leben – laut Cioran). Aber das Ziel – wie gesagt – ist unwichtig. Musik ist natürlich ganz wichtig dabei. (Ein Vorschlag: „Walking in the Rain“). Über die Verpflegung brauchten wir uns wahrscheinlich dabei keine Sorgen zu ma- chen. Das würden die diversen „Hilfsorganisationen“ übernehmen. Wichtig ist allein: Immer weiter (zu) Gehen. Immer weiter. Dabei macht es wenig, wenn unterwegs immer wieder Einzelne oder größere Gruppen abspringen, es werden immer wieder neue dazu kommen!
Einige von uns haben dieses Projekt „Neuer Kreuzzug“ genannt. Aber abgesehen davon, daß wir das “ Neue Jerusalem“ nicht erobern wollen, sondern höchstens allen neuen „Jerusalems“ aus dem Weg gehen wollen, also abgesehen davon wissen wir doch mittlerweile: Johannes von Patmos kündigte den Löwen von Juda an, aber stattdessen tritt ein Lamm auf… (Gut, wird man sagen, mal was anderes), es ist ein gehörntes Lamm, das brüllt wie ein Löwe und einzigartig heimtückisch geworden ist, umso grausamer und entsetzlicher, als es sich als Opfer ausgibt und nicht mehr als Opferpriester oder Henker. Ein Henker, schlimmer als die anderen. „Johannes insistiert auf dem ‚geschlachteten‘ Lamm: aber wir sehen nie, wie es geschlachtet wird, wir sehen es nur die Menschheit zu Millionen schlachten. Selbst wenn es am Ende in einem blutigen Siegeskleid auftritt, ist das Blut nicht sein eigenes Blut…“ (Lawrence). Zum Teufel mit diesen Lämmern im Löwenpelz. Deleuze nennt sie die „kollektive Seele“: „Die kollektive Seele will nicht einfach die Macht an sich reißen oder den Despoten auswechseln. Zum Teil will sie die Herrschaft vernichten, sie haßt die Herrschaft und die Macht. Johannes von Patmos haßt aus ganzem Herzen den Kaiser des Römischen Reiches. Aber zum Teil will sie auch in alle Poren der Macht eindringen, ihre Zentren vervielfachen, sie über das ganze Universium verbreiten: sie will eine kosmopolitische Macht, aber nicht offen, wie das Imperium, sondern in allen Ecken und Winkeln, in all den dunklen Nischen, in jeder Falte der kollektiven Seele.“
Zum Teufel mit allem Wollen. Wir wollen nur noch weiter Gehen. Immer weiter. Bis ans Ende der Welt. Oder bis wir uns die Füße abgelaufen haben. Immer in Bewegung bleiben. Es muß immer weiter gehen. Und man wird sehen. Xenophon, der sich am Rückzug der Zehntausende beteiligte, sagte an einer Stelle: „Immerhin, jetzt hatten wir Zeit, um miteinander zu reden; vorher war das nicht möglich gewesen, und hinterher wird es nicht mehr möglich sein. Laßt uns also den Weg in Ruhe fortsetzen, Freunde, mit bedächtigem Schritt und wohldurchdachten Worten…“ So soll es sein. Und wenn wir klug vor-gehen, werden wir – beiwegelang – die Speisen- und Getränkefolgen der Welt kennenlernen, und warum wo etwas gemacht wird und warum nicht oder wie man sich auszudrücken beliebt.
——————————————————————————————————————————————————–
Die Zeiten verändern sich, wie oben angedeutet, und in einem zweiten taz-text vom 16.5.2007 wird nun folgendermaßen über das Gehen geredet:
Die Kuratoren des Kunstraums Kreuzberg im Bethanien haben einen Wettbewerb ausgerufen: „Gesucht wird der liebste, der schönste Spaziergang dieser Stadt.“ Die Idee geht auf den Berliner Verleger Martin Schmitz zurück, der kürzlich einen Lehrauftrag für Spaziergangswissenschaft an der Uni Kassel bekam, wo schon der Basler Spaziergangsforscher Lucius Burckhardt seit 1987 „Promenadologie“ lehrte – ein Fach, für das er lange und leidenschaftlich warb.
Burckhardt starb im Sommer 2003. 1984 traf er sich mit mir, der ich gerade von einem langen Marsch zurückgekehrt war. Ich war von der Wesermarsch in die Toskana gegangen, wobei jedoch ein Pferd mein Gepäck getragen hatte. Zuvor, 1978, hatte ich auf dem Tunix-Kongress in Berlin ein Flugblatt verteilt, in dem ich davor warnte, das dort propagierte „Abhauen“ als bloße Metapher zu verwenden. Genau darüber wollte Burckhardt bei unserem Treffen mehr wissen: Wir sprachen über das Gehen als langsame Flucht- oder Absetzbewegung und über das dazu passende Schuhwerk.
Im Gegensatz zu dem Promenadologen ging es mir beim Gehen um das Reinfinden in verschiedene Landwirtschaften (Handarbeiten) und weniger um reine Spaziergangsforschung (Fuß- und Kopfarbeit). Aber Lucius Burckhardt hat mich damals sozusagen unheilbar infiziert: Seit 1984 bin auch ich ein überzeugter Geher – solange ich das Gefühl habe, jederzeit einfach weggehen zu können, bin ich einigermaßen zufrieden. Und um meine Beine und Füße dafür in Form zu halten, gehe ich fast täglich irgendwohin. Inzwischen ist mir schon fast jedes Bleiben ein bloßes Auf-der-Stelle-Treten.
Zu dieser Einstellung trug nicht zuletzt der polnische Schriftsteller Witold Gombrowicz bei, der einmal – in seinem Exil in Buenos Aires – auf einem Empfang Jorge Luis Borges‘ traf und von dessen bourgeoisem Gerede so angewidert war, dass er sich zum Gehen entschloss – und auch tatsächlich ging. Über diesen seinen Weggang berichtete er später ausführlich, das heißt seitenlang, in seinem Buch „Trans-Atlantyk“. Gombrowiczs „Gehen“ unterscheidet sich gewaltig von Walter Benjamins „Flanieren“ und Lucius Burckhardts „Promenieren“. So weit noch meine Füße tragen, versuche ich nun, mich dazwischen auszubalancieren. In puncto Gehgeschwindigkeit und -gewissen aber steht mir Gombrowicz immer noch am nächsten.
Daneben ist der Weddinger Klavierstimmer Oskar Huth ein Vorbild. Kürzlich erschien im Merve-Verlag posthum sein „Überlebenslauf“, herausgegeben von seinem Malerfreund Alf Trenk. Der Begriff der Balance ist darin zentral. Insbesondere gilt dies für die „Nazizeit“ des Einzelgängers Huth, dem die Amerikaner 1946 die „Evidence of Anti-Nazi-Activities“ bescheinigten. Oskar Huth selbst sprach von einer „artistischen Balancemeierei – unvorstellbar!“ Und erklärte sie wie folgt: „Was mir dazu geholfen haben muß, durchzukommen, ist wohl, daß mich die Leute hinsichtlich meiner Nervenfestigkeit, meiner physischen Kraft und (wenn ich’s mal ein bißchen eitel sagen darf) auch, was die Sache eines gewissen Witzes angeht, unterschätzt haben …“ Später werden ihm die Nazis eine Stelle im Kultursenat antragen. Der „freischaffende Kunsttrinker“ zieht es jedoch vor, selbständig zu bleiben. Pro forma war er 1938 als Zeichner im Botanischen Garten angestellt, 1941 tauchte er mit falschen Papieren unter. Am Breitenbachplatz betrieb er daraufhin im Keller eine Druckwerkstatt, in der er falsche Pässe und Lebensmittelkarten herstellte. Damit ermöglichte er fast sechzig Menschen, überwiegend Juden, das Überleben. Tagtäglich war Oskar Huth zu Fuß unterwegs, auf Buttertour zu den Untergetauchten. In den von Trenk notierten Gesprächsmitschriften spricht Huth von seinem täglichen „monsterhaften Latsch durch die Stadt“ – zeitweilig auch bewaffnet, einmal brachte er einen Nazi sogar um, am Ende des Lebens wünschte er sich, er hätte noch mehr „Kanaillen abgemurckst“.
Solch hehre Gehziele haben kaum noch etwas mit „Peripathetik“ – dem klassischen Herumwandeln zwischen Olivenbäumen – zu tun. Aber auch der postmoderne Promenadologe würde nie mit Skistöcken bewaffnet ausgehen, wie sie die Nordic Walker im Grunewald in den Händen halten. Auch ein Walkman oder MP3-Player, wie die Jogger im Tiergarten oder in Prenzlauer Berg sie sich ins Ohr stöpseln, wären tabu. Wenn das schlichte Gehen heute zum „Walking“ aufgesportet wird, dient es nicht mehr dem wirklichen Aufbruch, sondern nur noch der Fitness. „Nur der Zigeuner weiß noch aufzubrechen, er macht daraus so etwas Einfaches wie Geborenwerden oder Sterben“, meinten Gilles Deleuze und Félix Guattari in ihrer „Nomadologie“.
Daneben gibt es – jedenfalls in Berlin – immer mehr Touristen, die das Gehen behindern, indem sie zu langsam schlendern und dabei noch nach oben kucken. Insbesondere gilt dies für die vielen spanischen Touristen. Dabei gehört Madrid eigentlich zu den Städten auf der Welt, wo man am schnellsten geht – zusammen mit Singapur, wo sich das Lauftempo in den vergangenen zehn Jahren um 30 Prozent beschleunigt hat“, wie Urbanisten meinen herausgefunden zu haben. New York und Tokio lägen dagegen nur im Mittelfeld, während sich die Gehgeschwindigkeit auch in Berlin ständig erhöhe: Als Grund werden die sinkenden Reallöhne im Verein mit den steigenden Lebenshaltungskosten hier erwähnt. Und das leuchtet auch ein: Man braucht bloß die Mieten um 20 Prozent zu erhöhen – schon muss jeder mehr verdienen und sich also schneller bewegen. Eine Freundin riet mir neulich schon zu einem Fahrrad. Aber das ist keine Lösung für Weggeher.
Inzwischen gibt es – ausgehend vielleicht von Peripathetikern wie Goethe und Johann Gottfried Seume, der 1802 einen „Spaziergang“ von Deutschland nach Sizilien unternahm – eine wachsende Zahl von Gehern, die nach ihren Gängen anschließend von ihnen berichten. Erwähnt seien der Journalist Wolfgang Büscher, der 2002 von Berlin nach Moskau ging, und der TV-Entertainer Hape Kerkeling, der eine Pilgerreise zu Fuß auf dem Jakobsweg unternahm. Es scheint, dass das Gehen heute drei unterschiedlichen Zwecken dienen kann: der psychischen bzw. der physischen Wellness, dem unerhörten Langstreckenrekord oder der mehr oder weniger durchgeplanten Promenadologie. Für Erstere wird immer mehr teures Equipment angeboten, für Letzteres stehen inzwischen schon Tausende von Guides bereit, die qualifizierte Spaziergänge offerieren – etwa in Tübingen und Heidelberg oder durch irgendwelche Mittelgebirge.
In Berlin machte sich die Künstlerin Ekaterina Beliaeva 2004 mit einer nächtlichen „Führung durch das russische Berlin“ mit Unterstützung des Arbeitsamts selbständig. Für solche oder ähnliche Spaziergänge gibt es inzwischen im Internet 25.700 Werbe-Einträge. Daneben machen sich auch immer mehr Stadtforscher zu Fuß auf – meist in Richtung „sozialer Brennpunkte“. Professor Rolf Lindner von der Humboldt-Universität veröffentlichte zuletzt ein Buch über die Geschichte dieser Art von Stadtforschung, die zunächst aus der Angst des Bürgertums vor den „gefährlichen Klassen“ in den Slums und Ghettos entstand. Lindners Werk trägt den von einer schwarzen US-Sängerin stammenden Titel: „Walk on the wild side“. Demnächst will er sich mit seinen Studenten gehend und Spontaninterviews führend drei heutige Soziotope im Vergleich vornehmen: die Karl-Marx-Straße (West), die Ackerstraße (Ost) und die Adalbertstraße (Ost und West).
Ich dagegen widme mich zusammen mit einer Stadtentwicklungsforscherin gerade der Kreuzberger Waldemarstraße. Während die autonome Szene dort inzwischen nahezu verschwunden ist, hat sich das türkische Leben in dieser Straße fest etabliert, wird aber nun akut von der Gentrification bedroht. Das Weichbild einer Stadt verschiebt sich ständig, aber wir Spaziergangsforscher bleiben ihr hartnäckig auf den Fersen – zu Fuß.
Details:
Vom 1. September bis 14. Oktober findet im Kunstraum Kreuzberg eine Ausstellung statt mit dem Titel „Walk! Spazierengehen als Kunstform – Über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Gehen“. In diesem Zusammenhang sucht der Kunstraum Kreuzberg den schönsten Spaziergang in Berlin. Jeder kann bei diesem Wettbewerb mitmachen, der seinen liebsten bzw. schönsten Stadt-Spaziergang beschreiben und der Ausstellung zur Verfügung stellen möchte. Einzureichende Unterlagen: ein Text (nicht länger als 2 Seiten) und/oder ein Verlaufsplan und/oder Fotos und/oder ein Film (max. 5 Min. auf Mini-DV oder DVD). Einsendeschluss: 15. Juni (Kunstraum Kreuzberg/Bethanien, Mariannenplatz 2, 10997 Berlin). Die Wahl des schönsten Spaziergangs erfolgt durch eine Jury. Der Gewinner-Spaziergang wird im September gemeinsam gegangen und mit einem Honorar in Höhe von 150 Euro belohnt. Der 2. Preis ist ein MP3-Player, der 3. Preis ein Buchpaket zum Thema Spazierengehen. Ausgewählte eingesandte Spaziergänge werden in der Ausstellung und in einer Begleitzeitung vorgestellt.
——————————————————————————————————————————————————-
Wenn man speziell dieses „Detail“ über das Walking-Projekt im Bethanien mit dem Weggeh-Projekt im ersten taz-Text aus dem Jahr 1981 vergleicht, kommt man nicht umhin, Parallelen mit dem aktuellen Konflikt zwischen dem Kunstraum und Künstlerhaus im Nordflügel des Bethanien und dem Soziokulturellen Zentrum „Neu York“ im Südflügel zu sehen. Während diese sagen: „Wir GEHEN hier nicht raus,“ meint der Sprecher des Künstlerhauses: „Wir haben eine vollkommen andere Sicht auf dieses Haus“, das geht einfach nicht zusammen.“ Erstere suchen kollektive Fluchtwege, während letztere im Kreis gehen, der höchstens ebenso spiralistisch wie individualistisch nach oben führt.
Das Aktionszentrum ist am „Köpi“ in Mitte orientiert und das Künstlerhaus sowie der Kunstraum will mit den „Kunstwerken“ in Mitte aufschließen. Das geht fürwahr nicht zusammen, aber das Bethanien-Haus ist für beide WEGE eigentlich sogar zu groß – mindestens groß genug: Wenn man nur wollte, würde man sich dort nie begegnen müssen, man könnte sogar zwischen beiden „Projekten“ eine Wand mauern. Absurderweise wurde das „Künstlerhaus“ einst nach der Besetzung nur dort zugelassen, weil es sich als „Soziokulturelles Zentrum“ im Problembezirk zu etablieren versprach. Auch damals waren schon viele dagegen gewesen. In Summa: taz und Kunstraum/Künstlerhaus Bethanien sind den selben WEG gegangen – von der fast pfeilgeraden Fluchtlinie nach Draußen zum Gehen im Kreis drinne, mit kleinen Ausflügen im Urlaub in Form von Nordic Walking-Touren auf ausgeschilderten Wanderwegen.
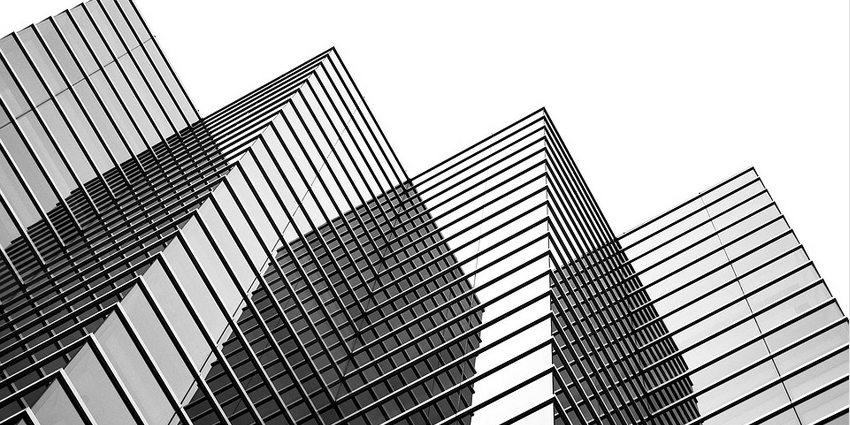



Es gibt darüberhinaus immer mehr Bücher – mit Schilderungen eines Fußwegs/-marsches: Im blog-eintrag über die Rhön finden sich bereits zwei erwähnt.
Einer der Autoren, der Thüringer Landolf Scherzer („Grenz-Gänger“) hat sich bereits ein zweites Buch ergangen: „Immer geradeaus: Zu Fuß durch Europas Osten“. Ein Tagesspiegel-Mitarbeiter ging von Berlin nach Moskau, ein TV-Komiker auf einem berühmten Pilgerpfad, ein konservativer Autor die Donau entlang, ein englischer Reiseschriftsteller durch Patagonien, ein polnischer Exilant aus einem Borges-Salon, ein Konstanzer Drogist durch die Wüste Gobi, ein Petrarca auf den Mont Ventoux usw.. Und alle schrieben anschließend Bücher über diese „Erfahrung“ – diesen mehr oder weniger enormen Gang.