„In neoliberalen Managementkonzepten steht Autonomie für eine möglichst effektive Arbeitsorganisation, in der flache Hierarchien, Teamwork und Selbstkontrolle die Überwachung durch die Vorgesetzten abgelöst haben.“
Das könnte auch das Konzept der taz-Geschäftsführung sein, die sich einst aus der Autonomen- und Alternativbewegung herauspersonalisierte. Der Autor des Zitats, Arndt Neumann, will auch tatsächlich in seinem soeben veröffentlichten Nautilus-Buch „Kleine geile Firmen“ darauf hinaus, dass sich der Neoliberalismus in Westdeutschland aus der 68er- und Alternativ-Bewegung erklären läßt. „Gleichzeitig warfen Hippies in den USA ihre Uhren weg, um ihrem Bruch mit der kapitalistischen Zeit Ausdruck zu verleihen,“ schreibt er und erinnert dabei an einige Graffitis gegen das Wertgesetz aus dem Pariser Mai 68.
In der Folgezeit entstand eine ganze „Bandbreite alternativer Projekte“. Genannt werden „Teestuben, Kneipen, Naturkostläden, Theatergruppen und Kinos, sowie Autowerkstätten, Schreinerbetriebe, Entrümpelungskollektive, freie Schulen, Jugendzentren und Beratungsstellen bis hin zu Druckereien, Buchläden und alternativen Medien“. Gemeinsam war ihnen, dass sie mit ihrer selbstbestimmten Arbeit im Kollektiv der fremdbestimmten Fabrikarbeit und der dort immer drohenden Arbeitslosigkeit etwas entgegensetzen wollten. Dabei gerieten die Autonomiewünsche zunehmend in Konflikt mit den Sach- oder Marktzwängen, es war bald das „Projekt“, das sich verselbständigte – d.h. autonom wurde gegenüber seinem Personal. Und dies war der Punkt, da es für neoliberale Manager und ihre Berater interessant wurde.
Einer, der dabei den Übergang vorbereitete, war laut Arndt Neumann der Landkommunarde und Frankfurter „Pflasterstrand“-Redakteur Mathias Horx – als anerkannter „Trendforscher“, der bereits eine ganze Berliner „Intelligenz-Agentur“ als seine Nachfolger bezeichnen kann.
Arndt Neumann stützt sich bei seiner Darstellung auf die Alternativmedien „Pflasterstrand“, „radikal“, „Kommune“ und „taz“, daneben auf die exemplarischen Großkollektive „Arbeiterselbsthilfe“ (ASH) Frankfurt, „Netzwerk“ Berlin, den Hamburger „Schwarzmarkt“ und die Landkommunenexperimente der Frankfurter Genossen Karl-Ludwig Schibel und Bernd Leineweber.
Seine historische Darstellung läßt der Autor mit den Beatniks, den Hippies, den Diggers und schließlich den Landkommunen, die ab Ende der Sechzigerjahre entstanden, beginnen. Wobei diese für ihn eine besondere Rolle spielten. So wie auch bereits für den sogenannten Utopisten Charles Fourier, der die Möglichkeit und Notwendigkeit, alle Arbeit in Lust zu verwandeln, ebenfalls in der Verbindung von Arbeit und Leben in einer Agrarkommune sah. In mehreren Wellen seit Ende des 19. Jahrhunderts haben die Kibbuzim ein solches alternatives Gesellschaftsmodell geradezu massenhaft in Angriff genommen. Und es dabei zur innovativsten Landwirtschaft überhaupt gebracht – die jetzt allerdings gerade zusammen mit der Lebensgemeinschaft Kibbuz dem Umbau Israels zu einem Hightech-Standort weicht – „in die Krise geraten ist“, wie man so sagt.
Schon werden dort die ersten Landwirtschafts- und Kibbuz-Forschungsinstitute geschlossen. Auch in Deutschland ließ die Münchner TU ihre Genossenschaftsforschung in Weihenstephan auslaufen. Aber 2006, nach der Verabschiedung des neuen Genossenschaftsgesetzes und dem Übergang von der „Ich AG“- zur „Wir eG“-Propaganda, wurde dieses Institut dann doch wieder aufgestockt. Wobei gesagt werden muß, dass die Genossenschaftsforschung sich dort inzwischen nicht mehr groß von der übrigen betriebswirtschaftlichen Unternehmensforschung unterscheidet – ungeachtet dessen, dass in den Genossenschaften laut Gesetz das Interesse ihrer Mitglieder Alpha und Omaga ist. Dieses Interesse begreift die neuere Genossenschaftswissenschaftliche Forschung bloß noch betriebswirtschaftlich, wobei ihre „Designempfehlungen“ dann allein der Geschäftsführung gelten.
Das spricht noch einmal für die Analyse von Arndt Neumann.
Am Anfang dieser Entwicklung stand für ihn der Widerspruch in den Alternativbetrieben „zwischen dem Zwang einer festgelegten Erntezeit, ökologisch/ökonomisch richtigen Anbaumethoden und dem sogenannten Bockprinzip oder dem ’subjektiven Faktor‘. Ein Widerspruch, der weder durch ‚Arbeit ist Arbeit‘ technisch-pragmatisch noch durch die Droge ‚Lust-Unlust‘ gelöst werden kann, sondern sich immer wieder neu stellt und Arbeitsorganisation, Rollenverteilung und Aufgabenbewertung ständig zu modifizieren zwingt.“ So formulierte der Hamburger „Schwarzmarkt“ die Grenze, an die das Konzept des selbstbestimmten Arbeitens damals stieß. Die Frankfurter Schibel und Leineweber, die erst in einer westdeutschen und dann in einer italienischen Landkommune lebten, sahen ebenfalls im Alltag einen „langsamen Schwund der emanzipatorischen Momente“
Immerhin war „mit dem Aufstieg der Gegenkultur vielfach subjektive Autonomie an die Stelle von verinnerlichtem Gehorsam getreten“. In Westdeutschland arbeiteten und lebten um 1980 24.000 Menschen in rund 4000 Kollektiven auf dem Land und in den Städten.
Ihre vier Prinzipien zur Regelung der Alltagsprobleme ähnelten den sieben Prinzipien, die Genossenschaften eigen sind.
Hier die des Internationalen Genossenschaftsbundes (IGB) – zuletzt 1995 überarbeitet und übersetzt von H.-H. Münkner:
1. Freiwillige und offene Mitgliedschaft
2. Demokratische Mitgliederkontrolle
3. Teilnahme der Mitglieder am wirtschaftlichen Erfolg der Genossenschaft
4. Autonomie und Unabhängigkeit
5. Erziehung und Ausbildung der Mitglieder sowie Information der Öffentlichkeit
6. Zusammenarbeit der Genossenschaften
7. Verantwortung für die sie umgebende Gesellschaft
Arndt Neumann schreibt über die Prinzipien der Alternativbetriebe: „Durch das Leben und Arbeiten im Kollektiv sollten die Voraussetzungen für eine sozialistische Gesellschaft geschaffen werden. Als Ziele wurden formuliert:
1. Größtmögliche Autonomie des Einzelnen,
2. Selbstverwirklichung in der Arbeit,
3. Aufhebung der Arbeitsteilung und
4. kollektive Entscheidungsfindung.“
Im Zusammenhang der Forderung nach einer „Aufhebung der Arbeitsteilung“ übersetzte z.B. Joschka Fischer, der damals noch zu den Frankfurter „Spontis“ gehörte, die zunächst bei Opel „Betriebsarbeit“ geleistet hatten, Mitte der Siebzigerjahre eine Harvard-Doktorarbeit über die in der chinesischen Kulturrevolution bis dahin gemachten Erfahrungen mit der „Aufhebung der Trennung von Hand- und Kopfarbeit“. Gleichzeitig besuchte der marxistische Erkenntnistheoretiker Alfred Sohn-Rethel China. Wieder zurück berichtete er in Bremen, dass z.B. der Computer des Güterbahnhofs von Nanking nicht mehr gegen die Interessen der Arbeiter eingesetzt werde, sondern in ihrem Sinne funktioniere. Rätselhafte Worte! Wie hatte man sich das vorzustellen?
Es gab dazu zwei überlieferte Traditionslinien, die dann auch in Form von „Raubdrucken“ wieder allgemein zugänglich gemacht wurden. Die eine war das kommunistische bis ins Libertäre reichende Erbe der Arbeiterbewegung, das mit dem Nationalsozialismus fast zur Gänze verschüttet worden war und seine Hochzeit in Russland von 1917 bis nach dem Ende des Bürgerkriegs hatte. Es reichte jedoch zurück bis in die russische Studentenbewegung von 1868, in der alles schon diskutiert und realisiert worden war: Frauengruppen, Landkommunen, Betriebsagitation, Terrorismus usw. Und das vor dem Hintergrund des in Russland noch weit verbreiteten Dorfgemeinschafts-Eigentums. Die Rezeption der russischen Revolution hörte jedoch in der antiautoritären Bewegung mit der erfolgreichen Zentralisierung der Herrschaft und der Produktion durch die Bolschewiki auf, stattdessen folgte man eher der Kritik der Rätekommunisten u.a. des Holländers Anton Pannekoek: Die „neue Ordnung“, die er anstrebte, sollte von unten wachsen, „aus den Betrieben, aus Arbeit und Kampf zugleich“. Als Pannekoek dies schrieb, war der Zweite Weltkrieg in vollem Gang. „Für ihn formierte sich darin ein weltweiter Block gegen die Arbeiterklasse und ihren Willen zur Autonomie“, schreibt Walter Hanser 2008 und zitiert dazu aus einem Gespräch zwischen Rudi Dutschke, Bernd Rabehl und Christian Semler, das im Kursbuch 14, Sommer 1968, abgedruckt wurde: „Über dem Gespräch schwebten die Ideen Luxemburgs und Pannekoeks. Doch damit folgten die Diskutanten zu sehr der alten Arbeiterbewegung, so daß Hans Magnus Enzensbergers kluge Nachfrage verständlich war: ‚Ich sehe in der Gesellschaftsstruktur, die ihr hier entwerft, mit Kollektiven, die auf die Betriebe hin zentriert sind, einen naiven Fabrikglauben. Könnt ihr euch nicht vorstellen, daß die Menschen eines Tages die Fabrik loswerden wollen, daß ihre Produktivität sozusagen in den Alltag einwandern könnte?'“ In der Tat hieß dann die dann neugegründete linke Zeitschrift „Autonomie“ im Untertitel „Materialien gegen die Fabrikgesellschaft“. Es mehrten sich die „Aussteiger“.
Die zweite Traditionslinie das waren – ebenfalls bis ins 19. Jahrhundert zurückreichend – die „New World Utopias“ in Amerika, d.h. Dörfer, Gemeinden, Landkommunen, die kollektiv wirtschafteten – bis ins Private hinein: sogenannte Totalgenossenschaften.
Erwähnt seien „New Harmony“, gegründet vom englischen Genossenschaftstheoretiker Robert Owen. Ferner die schon 1805 entstandene Kolonie „Harmony“ von ausgewanderten „Rappiten“. Die an Ralph Waldo Emerson orientierte Transzendentalistenkommune „Brook Farm“; die New Yorker Kommune „Oneida“ und die von sexuellem Mystizismus beseelte Kommune „Fountaingrove“. Sie wurde 1928 von Kanaye Nagasawa privatisiert. Ferner die Kolonie Icaria Speranza, in der nur Französisch gesprochen werden durfte. Ihr Erforscher, der Gründer des „Utopian Studies Center“ in Kalifornien – Paul Kagan schreibt: „Die Ikarier unterließen es, ihre Kinder im Sinne der Kommunideale zu erziehen, und daher wuchs keine Nachfolgegeneration heran, die die Traditionen hätte bewahren können.“
In den Kibbuzim, aber auch in der österreichischen AA-Kommune, auf dem schwäbischen Finkhof und in der Kommune Niederkaufungen, wurde das versucht, dennoch wollten auch hier die Kinder später lieber raus aus dem Kollektiv und mindestens vorübergehend ein anderes Leben führen.
Zu den „New World Utopias“ zählt Paul Kagan ferner die „theosophische Bewegung, die einige wichtige Kommunen in Kalifornien hervorbrachte“. Eine in Halycons gibt es noch heute, allerdings sind nur noch die Hälfte aller Bewohner dort Theosophen. Von einer anderen, Krotona, 1912 gegründet, gibt es noch eine Schule. Diese wurde 1946 von Krishnamurti und Aldous Huxley begründet, sie nannten sie „Happy Valley“, ihre Leitung übernahm 1971 der Biologe Alfred Taylor. Die Schule liegt im Ojai-Tal, in den Achtzigerjahren wurde es zu einem der Zentren der kalifornischen „New Age“-Bewegung.
2004 machte sich das Ehepaar Barbara und Gunter Hamburger-Langer aus Konstanz auf, um zu sehen, was von diesen Projekten, ganzen Initiativen und Kommunen übrig geblieben oder neu hinzugekommen war. Anschließend veröffentlichten sie ihre „Weltreise auf der Suche nach Samen für die Zukunft“ als Buch im Selbstverlag. (**)
Merkwürdig viele der oben genannten „New World Utopias“ wurden mit den US-Sittengesetzen zermürbt (in Österreich geschah zuletzt Ähnliches mit der AA-Kommune) – und mußten aufgeben, die Genossenschaften wurden liquidiert und das Land privatisiert. Andere, wie die „Kooperative Commonwealth Kaewahs“, waren den Behörden zu kommunistisch, privatbesitzfeindlich eingestellt – und wurden aufgelöst. „Das Ende Kaweahs als Kolonie leitete im Januar 1892 die Anklage ein, sein Kuratorium hätte gegen die Beförderungsbedingungen der Post verstoßen, indem es Propagandamaterial der Kolonie und Spendenaufrufe verschickt hätte,“ schreibt Paul Kagan.
Von Spenden lebte zuletzt auch die Alternativbewegung“, das „Netzwerk“ diente ihrer Sammlung und Verteilung ebenso wie in Berlin die „Stiftung Umverteilung“ und später die Stiftungen der Grünen. Die taz machte unterdes aus ihren Spendern Mitglieder einer Genossenschaft bzw. Zuwender für eine Stiftung (namens Panter). Für die Genossenschaften gibt es heute einen „Bundesverein zur Förderung des Genossenschaftsgedankens“ sowie die Beratungsorganisation für Genossenschaftsgründungen „innova eG“, die alljährlich Preise an Genossenschaften für „Ideen und Engagement“ verleiht, ähnlich wie auch die „Arbeitsgemeinschaft Genossenschaftswissenschaftlicher Institute“.
Von vornherein auf Aktien angelegt war die 1914 „von einer Handvoll Soziualutopisten“ gegründete „kooperative Kolonie Llano del Rio“ bei Los Angeles. Ihre Gründer wollten laut Kagan den Beweis erbringen, „dass eine Kooperation in der Realität bestehen kann, wenn sie auf den Prinzipien des gleichverteilten Eigentums, des gleichen Lohns und sozialer Chancengleichheit beruhte“. Die Kolonie spaltete sich schon bald – am Problem der Drückeberger und der Frage, wie ihnen beizukommen sei. Auch hier stand dabei wieder Leistung gegen Leidenschaft. Während einer Finanzkrise verkaufte der Kolonie-Sekretär schließlich die Aktien. Die Kolonisten zogen weiter nach Louisiana, 1936 gingen sie auch dort pleite. Ähnliches gilt für die 1914 gegründete Kommune Christlicher Evangelisten „Pisgah Grande“, sie überlebte jedoch als religiöse Bewegung. 1972 kehrte sie zurück nach Los Angeles, wo sie mit der „Jesus-Bewegung“, einem Zweig der Hippies, verschmolz. In den Sechzigerjahren wurde das abseits gelegene Tassajara Zen Bergzentrum bei Montery auf Spendenbasis gebaut. Das es noch immer existiert, führt Paul Kagan darauf zurück, dass es nicht von einem mehr oder weniger charismatischen Führer begründet wurde, sondern aus einer ganzen Tradition (dem Zen-Buddhismus) heraus in einer Gruppe entstand.
Inzwischen gibt es eine ganze Reihe solcher Zentren und „Schulen“, zudem öffneten sich ihnen die Universitäten. Einige besuchten zuletzt die Konstanzer Leiter von „Visionssuchegruppen“, das Ehepaar Hamburger-Langer.
Auch für sie gilt noch, was bereits in den Siebzigerjahren festgestellt wurde: „Wichtig ist, dass Alternativprojekte nicht auf Gedeih und Verderb darauf angewiesen sind, finanziell rentabel, ökonomisch konkurrenzfähig zu sein gegenüber traditionell kapitalistischen Unternehmen“. Dazu wurden Spendenaufrufe, eine Reduzierung der Bedürfnisse auf Wesentliches, Schwarzfahren, Förderanträge stellen etc. empfohlen. Auf diese Weise geriet den Aktivisten jedoch die wirkliche Ökonomie, „die Infragestellung der Eigentumsverhältnisse und die Aneignung des gesellschaftlichen Reichtums“, wie Arndt Neumann es nennt, aus dem Blickfeld.
In dieser Situation unternahmen die beiden Lankommunarden Schibel und Leineweber 1974, ähnlich wie das Ehepaar Hamburger-Langer 2004, eine Reise in die USA. Sie „besuchten Anwaltskollektive, Freie Kliniken, Mietergewerkschaften, Stadtteilgruppen, Lebensmittelkooperativen, Stadt und Landkommunen, um herauszufinden, wie die Genossen die Probleme angehen, die uns selbst beschäftigen.“ Eine generelle Lösung sahen die beiden Autoren „in der Vernetzung einer großen Zahl von Alternativprojekten“.
Das sahen auch bereits die „Lassalleaner“ der alten Sozialdemokraten so – in bezug auf die damals entstehenden Arbeiter-Genossenschaften. Im Gothaer Programm der SPD hieß es dazu: „Die deutsche Arbeiterpartei verlangt, um die Lösung der sozialen Frage anzubahnen, die Errichtung von Produktivgenossenschaften mit Staatshilfe unter der demokratischen Kontrolle des arbeitenden Volks. Sie sind in solchem Umfang ins Leben zu rufen, daß aus ihnen die sozialistische Organisation der Gesamtarbeit entsteht.“ Marx und Engels kritisierten damals dieses Netzwerk-Konzept scharf: Ersterer merkte dazu an: „An die Stelle des existierenden Klassenkampfes tritt eine Zeitungsschreiberphrase – ,die soziale Frage‘, deren ,Lösung‘ man ,anbahnt‘. Statt aus dem revolutionären Umwandlungsprozesse der Gesellschaft ,entsteht‘ die ,sozialistische Organisation der Gesamtarbeit‘ aus der ,Staatshilfe‘, die der Staat Produktivgenossenschaften gibt, die er, nicht der Arbeiter, ,ins Leben ruft‘. Es ist dies würdig der Einbildung Lassalles, daß man mit Staatsanleihen ebensogut eine neue Gesellschaft bauen kann wie eine neue Eisenbahn!“ Engels schrieb rückblickend, dass der Kritik ungeachtet dann doch jede Menge „Gewerksgenossenschaften, Produktivgenossenschaften ins Werk gesetzt – und dabei vergessen wurde, daß es sich vor allem darum handelte, durch politische Siege sich erst das Gebiet zu erobern, worauf allein solche Dinge auf die Dauer durchführbar waren.“
Rosa Luxemburg charakterisierte später die Genossenschaft als ein im Kapitalismus eigentlich nicht-lebensfähiges Oxymoron: „Was die Genossenschaften, und zwar vor allem die Produktivgenossenschaften betrifft, so stellen sie ihrem inneren Wesen nach inmitten der kapitalistischen Wirtschaft ein Zwitterding dar: eine im kleinen sozialisierte Produktion bei kapitalistischem Austausche. In der kapitalistischen Wirtschaft beherrscht aber der Austausch die Produktion und macht, angesichts der Konkurrenz, rücksichtslose ausbeutung, d.h. völlige Beherrschung des Produktionsprozesses durch die Interessen des Kapitals, zur Existenzbedingung der Unternehmung. Praktisch äußert sich das in der Notwendigkeit, die Arbeit möglichst intensiv zu machen, sie zu verkürzen oder zu verlängern, je nach der Marktlage, die Arbeitskraft je nach den Anforderungen des Absatzmarktes heranzuziehen oder sie abzustoßen und aufs Pflaster zu setzen, mit einem Wort, all die bekannten Methoden zu praktizieren, die eine kapitalistische Unternehmung konkurrenzfähig machen. In der Produktivgenossenschaft ergibt sich daraus die widerspruchsvolle Notwendigkeit für die Arbeiter, sich selbst mit dem ganzen erfoderlichen Absolutismus zu regieren, sich selbst gegenüber die Rolle des kapitalistischen Unternehmers zu spielen. An diesem Widerspruche geht die Produktivgenossenschaft auch zugrunde, indem sie entweder zur kapitalistischen Unternehmung sich rückentwickelt, oder, falls die Interessen der Arbeiter stärker sind, sich auflöst…“
Die europäische Genossenschaftswissenschaftliche Forschung tut wie erwähnt heute alles, um diese „Rückentwicklung“ zu fördern – und ein Verschwinden der Genossenschaften zu verhindern, sie sollen „konkurrenzfähig“ sein bzw. werden.
Dem gegenüber ging es bei den Alternativbetrieben laut Arndt Neumann noch primär darum, die „Arbeitsorganisation“ so zu verändern, dass dabei dem „Bedürfnis nach Autonomie“ Rechnung getragen und somit „die Trennung zwischen Freizeit und Arbeit“ überwunden wird. Das war auch der „Plan“ des Genossenschaftsprojektanten Charles Fourier, der dabei die Leidenschaft in seinem Kommunemodell (Phalanstère) an die Stelle des Leistungsdrucks setzte – und zwar so konsequent, dass Marx und Engels seine Werke immer wieder mit großem Vergnügen lasen und André Breton im Exil nichts anderes. „Wünscht sich nicht jeder, die Arbeit in Lust zu transformieren (und nicht etwa die Arbeit zugunsten der Freizeit nur auszusetzen)?“ fragte sich der Semiologe Roland Barthes – in „Sade, Fourier, Loyola“.
In „Kleine geile Firmen“ kommen zwei Mitarbeiter von Alternativbetrieben zu Wort, die auf diesen selbstgestellten Anspruch ganz unterschiedlich reagierten: Einmal ein Redaktionsmitglied der „radikal“ Pius, der ähnlich wie Erwin Strittmatter „der Loaden, der Loaden – geht immer vor,“ auf einen krisenhaften Arbeitsverlauf bei der Blattherstellung reagierte, indem er „Die Zeitung, die Zeitung!“ ausrief – und damit drohte: „Wenn wir keine kollektive repressionsfreie Arbeitssituation schaffen, die im Einklang objektiver Notwendigkeit und subjektivem Erlebnis steht, dann ist mir die Zeitung scheißegal!!!“
Zum anderen ein Mitarbeiter des Kollektivbetriebs „Gegensatz GmbH“, Helmut, nachdem jemand gemeint hatte: „Ich habe schon ein schlechtes Gewissen, wenn der Helmut z.B. oft viel länger als acht Stunden am neuen Fotosatzgerät sitzt, für das die Gewerkschaft maximal sechs Stunden ausgehandelt hat…“ Der Genannte entgegnete darauf: „Aber auf die neue Technik muß man sich einfach einstellen.“ Der Bleisatz sei eben „nicht mehr konkurrenzfähig, aus Kosten- und aus zeitlichen Gründen.“ Arndt Neumann schreibt dazu: „Diese Argumentation zeigt, wie durch die ökonomischen Zwänge die politischen Bezugspunkte durcheinandergerieten. Helmut, der sich zu diesem Zeitpunkt ausdrücklich als Linksradikaler verstand, nahm eine unternehmerische Perspektive ein und rechtfertigte seine eigenen langen Arbeitszeiten. Dieser Bruch, der sich in dem Denken von Helmut und von vielen anderen Mitgliedern von Alternativprojekten vollzog, kann in seiner Bedeutung nicht überschätzt werden.“ Helmut selbst wurde dann noch deutlicher: „Uns macht die Arbeit Spaß, wir machen sie gerne. Wenn ich hier 12 Stunden ohne Pause gearbeitet habe, bin ich nicht so kaputt, wie wenn ich im Betrieb acht Stunden mit Pause gearbeitet hab.“
Entscheidend war in diesem Zusammenhang „die Arbeitsorganisation, die dem Einzelnen Autonomie und Selbständigkeit ermöglichte. Eine Autonomie, die jedoch zunehmend in den Gesetzen des Marktes ihre Grenzen fand,“ meint Arndt Neumann.
Als der Berliner Alternativbetrieb „Oktoberdruck“ in eine Krise geriet, schlug der „radikal“-Mitbegründer und taz-Redakteur Benny Härlin ein Genossenschaftsmodell vor, in dem jeder dort Arbeitende Gesellschafter sein sollte, und darunter „Arbeitsgruppen“, in denen „ein großer Teil dessen, was jetzt ein einzelner ‚Unternehmer‘ koordinierte und organisierte, eigenständig organisiert wird und in denen der persönliche Zusammenhalt, der in der Gesamtgruppe nur beschränkt realisierbar ist, vorhanden ist.“ Durch „Gruppenarbeit“ sollte also die „Voraussetzung für eine größere Leistungsbereitschaft geschaffen werden“, merkt dazu Arndt Neumann an.
Erst einmal schuf der „Deutsche Herbst“ jedoch eine größere Leidensbereitschaft. Die Linke reagierte darauf Anfang 1978 mit dem Tunix-Kongreß, der Gründung der tageszeitung und dem „Netzwerk“. Darauf folgte die bisher größte Gründungswelle von Alternativbetrieben und Landkommunen. In dem jedoch bereits auf dem Tunix-Kongreß der SPD-Linke Peter Glotz reden durfte – „Was können wir tun, um euch das Verweilen in der Gesellschaft [wieder] attraktiv zu machen?“ ging es dabei für Arndt Neumann nicht mehr um eine „revolutionäre Überwindung des Kapitalismus“, sondern um eine „friedliche Koexistenz“ zweier Kulturen.
Nach der Gründung der tageszeitung schrieb ein „radikal“-Mitarbeiter: „Mich erschreckt, dass es eine Hierarchie vom Handverkäufer bis zum Ressortleiter gibt, mich erschreckt, dass es Redakteure und Layouter gibt, dass es so viele Spezialisten gibt, die so schnell nicht austauschbar sind.“ Schon bald ersetzte die taz so gut wie alle lokalen Alternativzeitungen – und professionalisiert sich und expandiert auch seitdem munter weiter. In ihrer diesbezüglichen Power-Point-Präsentation heißt es: „250 MitarbeiterInnen/ 8400 GenossInnen (mit einem Kapital von über 8 Millionen Euro)/ taz – die Marke: Le Monde Diplomatique, taz-shop, taz-reisebüro, die tageszeitung, Atlas der Globalisierung, taz-panterstiftung (mit einem Stiftungskapital von 1 Million Euro), tazpresso, taz-café.“ Wie eine taz-Leserumfrage der Universität Dresden Ende 2008 ergab, haben ihre etwa 45.000 Abonnenten, die durchweg zur „Verantwortungselite“ hierzulande gehören, die engste „Leser-Blatt-Bindung“. Auf der anderen Seite haben die taz-Redakteure im Vergleich zu den Redakteuren von Kapital-Zeitungen immer noch die stärkste „Selbstverwirklichungs“-Motivation.
Zur „Netzwerk“-Gründung meint Arndt Neumann: „Die Grünen und das ‚Netzwerk‘ trugen dazu bei, dass Parlamentarismus und Markt in weiten Teilen der Alternativbewegung zu grundlegenden Bezugspunkten politischen Handelns wurden.“ Dem „Netzwerk“ gelang es, einige tausend Unterstützer als Geldspender zu gewinnen, so dass ihm in den darauffolgenden Jahren mehrere 100.000 DM zur Projektförderung zur Verfügung stand. Das Gremium dafür setzte sich drittelparitätisch aus Prominenten, zahlenden Mitgliedern und Kollektiven zusammen, letztere wollten jedoch allein über die Gelder bestimmen. Immer wieder achtete das Netzwerk nämlich bei seiner Förderung primär auf die „Effizienz“ von Projekten: „Die geringe politische Handlungsfähigkeit der Alternativprojekte wurde von ihm auch als Folge eines Mangels an Arbeitsmoral verstanden,“ so Arndt Neumann.
Karl-Heinz Roth kritisierte dann die Spendenpraxis grundsätzlich: Dadurch „wird den Projekten ihre natürliche Konfrontationsstellung gegenüber dem Staat, dem natürlichen Adressaten aller Kämpfe für garantiertes Einkommen ohne Arbeit, entzogen: die wohlhabende Mittelstandslinke tritt an die Stelle der Sozialämter und agiert als Behördenpuffer.“
Rückblickend kommt Arndt Neumann zu dem Schluß: Der „Tunix-Kongress, die tageszeitung, die Grünen und das ‚Netzwerk‘ trugen wesentlich zu einer neuen Politik der Alternativbewegung bei“. Dazu gehörte u.a. auch, das bald die Geschäftsführer der Alternativbetriebe den Alltag in den Projekten bestimmten und dabei immer betriebswirtschaftlicher dachten bzw. handelten. Karl-Heinz Roth warnte im Frankfurter „Pflasterstrand“: „Die Funktion der Geschäftsführer besteht letzten Endes darin, die Alternativszene schrittweise wieder an den Hauptzyklus kapitalistischer Ausbeutung anzubinden.“
Ihm antwortete Christoph Potting, der selber in einem linken Verlagskollektiv arbeitete, seine Bereitschaft zur Selbstausbeutung müsse vor dem Hintergrund des grundlegenden Widerspruchs von Alternativprojekten gesehen werden: „Alle Beschäftigten sind zugleich Lohnarbeiter und Unternehmer…“ Dadurch „besteht praktisch ein ökonomischer und politischer Zwang zur permanenten Identifikation mit der Arbeit.“
Wie diese dann nach der Wende in den Neunzigerjahren von den Geschäftsführern angegangen und zerstört wurde, habe ich am Beispiel des einstigen Alternativbetriebs „Zweite Hand“ von einigen Betriebsräten erzählt bekommen, nachdem diese ihren Kampf gegen die Geschäftsführung aufgegeben und gekündigt hatten. (***)
Inzwischen hatte sich der Pflasterstrand-Redakteur Horx zu einem „Unternehmensberater“ gewandelt, indem er die Autonomie-Forderung mit unternehmerischem Denken verband: „In der unternehmerischen Freiheit sah Horx nicht länger ein Hindernis, sondern vielmehr eine Chance, das Bedürfnis nach selbstbestimmter Arbeit zu verwirklichen.“ Kurz darauf verkündete er bereits in einem Buch „Das Ende der Alternativen“ – und wandte sich den „postalternativen Projekten“ zu. Dabei warf er noch einmal einen Blick zurück – u.a. auf die 1982 gegründete italienische Landkommune von Schibel und Leineweber „Utopiagga“: „Wie in einem Museum kann man hier noch einmal die Stile und Lebensweisen, die studentischen Mangel-Ökonomien der 70er-Jahre bewundern…Und doch ist das Gefühl der Niederlage deutlich spürbar, unübersehbar die Müdigkeit in den Gesichtern.“ Erst in „den 90ern wird uns endgültig klar werden, dass es keine Entschuldigung [dafür] mehr gibt.“
Die französischen Linken Luc Boltanski und Eve Chiapello schrieben eine ganze Soziologie des „neuen Unternehmensberaters“ à la Horx, die die bisherige „Sozialkritik“ durch eine „Künstlerkritik“ ersetzten – und damit laut Arndt Neumann einen „entscheidenden Anteil an dem Kompetenztransfer von der linken Protestkultur zum Management hatten“. Voraussetzung dafür war der Bruch mit den „zurückliegenden Kontrollformen und die Forderungen nach Autonomie und Eigenverantwortung, die man bis dahin als subversiv betrachtet hatte,“ die nun jedoch „endogenisiert“ wurden, d.h. die Kontrolle wurde durch Selbstkontrolle abgelöst. Das entsprach dem Ideal des Neoliberalismus, dem eine Gesellschaft vorschwebt, in der „alle Bereiche unternehmerischem Denken und Handeln untergeordnet sind.“ Arndt Neumann kann sich dabei auf den Soziologen Ulrich Bröckling berufen, der herausfand, „dass die Übertragung des Marktmodells auf die internen Beziehungen des Unternehmens im Zentrum der neoliberalen Arbeitsorganisation steht.“
Praktisch und zum „Hype“ wurde das dann in den „New Economy“-Betrieben. Zwei der damaligen Start-Upper schreiben: „Der Widerspruch zwischen Arbeit und Leben, geschäftlichem Erfolg und persönlicher Verwirklichung sollte in der New Economy aufgelöst werden.“ Neumann fügt hinzu, dass trotz des Crashs die in den Start-Up-Unternehmen erprobte Unternehmenskultur weiter an Bedeutung gewann.
Horx stellte seinem Buch „Smart Capitalism“ 2001 ein Zitat der Frankfurter Arbeiterselbsthilfe (ASH) voran: „Wir leben anders! Wir arbeiten mehr als zuvor, schaffen bis zu 14 Stunden am Tag und die Arbeit macht uns bei weitem nicht so kaputt wie die ’nur‘ acht Stunden vorher im Betrieb…weil sie weit weniger entfremdet ist.“
Die Landkommunen-Experimente spielten noch einmal eine Rolle als Utopie bei den Weltraum-Plänen der NASA. Hierbei kam es bereits zu einer frühen Transformation von Sozialutopien in Hochtechnologieprojekte. Der Kulturwissenschaftler Claus Pias hat sich mit den Weltraumkolonie-Ideen der Siebzigerjahre und ihrer verblüffenden Übereinstimmung mit den Idealen der Landkommune-Bewegung befaßt. In seinem Aufsatz „Schöner leben“ heißt der damalige „Futorologe“ Horx, der den Anstoß für solche Pläne gab, Herman Kahn. Hintergrund für dessen „Space-Szenarios“ waren die alarmistischen Prophezeiungen des Club of Rome zu Umweltverschmutzung, Hunger, Ressourcenknappheit und Überbevölkerung 1973. Eine erste „Machbarkeitsstudie“ legte dann 1977 Gerard O’Neill, ein Physiker aus Princeton, vor – mit dem Titel: „Human Colonies in Space“. Er kommt darin zu dem Schluß, „daß es weniger Dreck mache, einen Menschen in den Weltraum zu befördern, als ihn auf der Erde zu lassen.“ Dazu müßte jedoch der „amerikanische Kongreß ein besonderes Gesetz verabschieden, das den Kolonieerbauern den Wunschtraum des Amerikaners erfüllt, nämlich ein schuldenloses Eigenheim, ein Haus in der Weltraumkolonie. Diese Maßnahmen werden die Kolonisierung des Weltraums fördern…Neben allerhand unentfremdeter Arbeit und extraterrestrischem Kunsthandwerk, würde es neue, unschuldige Freizeitvergnügen geben, wie 3-D-Fußball, schwebende Schwimmbäder, meditative Weltraumausflüge oder Sex bei zero-gravity. Offener Raum und Toleranz würden es unterschiedlichen Gemeinschaften erlauben, ‚to do their own thing and build small worlds of their own, independent of the rest of the population‘.“
Claus Pias sieht in diesen Weltraumkolonie-„Visionen“ eine direkte Anleihe bei den Landkommunen: „Als berühmtestes Beispiel mag man an ‚The Farm‘ denken, die Steve Gaskin 1971 gründete und mit einer Erstbesetzung von über 300 Leuten den Ausstieg aus der Gesellschaft probte, um in unberührter Gegend als autarke, landwirtschaftliche Gemeinschaft zu leben. Was sich nämlich die sogenannten ‚Ecovillages‘ als Agenda setzen – ‚organic gardening and composting; biological waste management; reuse, recycle, rebuild; renewable power systems; egalitarian and open democratic governance‘ – sollte Punkt für Punkt auch für die Weltraumkolonien gelten.“ Laut Pias verwiesen dabei „Technikapologeten wie Zivilisationskritiker“ gleichermaßen auf eine „Humanität“ – die es dort oben „zu gewinnen und zu entfalten gelte“.
Dabei kam es zu Konversionen zwischen den Lagern – „wie das berühmte Beispiel von Timothy Leary zeigt, der von chemischen zu elektronischen Drogen und von Roadtrips zu Spacetrips wechselte.“ Als er 1976 aus dem Gefängnis entlassen wurde, sagte er in einem Interview, dass es einen „extraterrestrischen Imperativ“ gäbe: Wir seien dazu bestimmt, im Weltraum zu siedeln. Dazu legte er auch sogleich ein Programm vor – namens S.M.I.L.E.: „Space Migration, Intelligence Increase und Lifespan Extension“.. Sympathisanten wie die Ethnologin Margaret Mead sahen darin eine Chance zur Diversität. Hollywood befaßte sich in mehreren Spielfilmen mit den „Space-Colonies“. Ab Mitte der Achtzigerjahre ging auch einer der führenden NASA-Manager, Jesco von Puttkamer, auf Missionsreise – u.a. um Geldgeber für die Weltraum-Siedlungsprojekte zu finden.
Dazu organisierte u.a. die Kölner Universität mit Unterstützung namhafter Sponsoren aus Politik und Wirtschaft 1987 für ihn einen Kongreß zum Thema „Weltraum als Markt – Die zivile Nutzung des Weltalls“. Im Jahr darauf lud ihn die Techische Universität Berlin ein. Die taz schrieb über seinen Auftritt dort: „‚Wir möchten auf die Europäer nicht mehr länger verzichten‘, erklärte der NASA-Projektleiter Jesco von Puttkammer. Der in den USA eingebürgerte Freiherr entwarf mit Hilfe von »Ektas« und Overhead-Projektion eine Vision der ‚Humanisierung des Alls‘, in der altes deutsches Ingenieurdenken, amerikanischer Pioniergeist und New Age-Begrifflichkeit – ‚Netzwerkdenken‘ einen tibetanischen Gebetsmühlen-Charakter annahmen. Den Einwänden der „Ökos“ hielt er entgegen, ihr Denken sei noch im 19. Jahrhundert behaftet, man habe es nunmehr – in der Verbindung von Technik und Gesellschaft im Weltraum, „Natur ist ja schon da“ – mit einer „Super-Ökologie“ zu tun. Den Feministinnen kam er zuvor: Auch deren Interessen seien bei den Space-Missions bestens aufgehoben. Die Gewerkschafter beruhigte er mit dem Hinweis: ‚Für den Bau der Großraumstation seien jetzt schon 12.000 Arbeitsplätze in Kalifornien entstanden‘. Den um ihre Sicherheiten besorgten Investoren kam er mit der US-Regierung, die sich auf Folgendes festgelegt hatte: ‚1. Verpflichtung und nationaler Wille zur Raumstation, 2. Expansion über die Erdorbits hinaus, 3. Schaffung von Opportunitäten für US-Firmen im All‘.“ Einen Monat später hielt Timothy Leary im Westberliner Tempodrom einen Vortrag zum selben Thema – „Space Emigration“. Die Popsängerin Nina Hagen wollte daraufhin sofort die Erde verlassen.
Eine Reihe von NASA-Pannen sowie das Ende des Kalten Krieges nahmen jedoch all diesen US-Plänen erst einmal den Wind aus den Segeln. Außerdem gab es in den Neunzigerjahren durch den „Fall der Mauer“ plötzlich genug neue Investitionsräume auf der Erde. Zwar kooperierte die NASA bald mit der russischen Weltraumforschung, aber auch diese mußte ihre Pläne und Projekte zunächst reduzieren. Der Philosoph des Judentums Emmanuel Lévinas hatte nach dem ersten bemannten Weltraumflug 1961 noch frohlockt: Mit Gagarin wurde endgültig das Privileg „der Verwurzelung und des Exils“ beseitigt. Nach dem Zerfall der Sowjetunion gab jedoch einer der letzten Kosmonauten auf der MIR-Raumstation zu bedenken: „Wir haben unser Hauptproblem dort oben nicht gelöst. Wir können in den Weltraum fliegen, dort arbeiten und wieder zurückkehren, aber wir haben keine natürliche menschliche Betätigung im Weltraum – im Zustand der Schwerelosigkeit – gefunden. Bis jetzt haben wir keine produktive Tätigkeit dort oben entwickeln können. Ich empfinde das als persönliches Versagen“.
Claus Pias schreibt in seinem Artikel über die Landkommune-Utopien der Weltraumbesiedler: Sie würden „schwerlich den Verdacht abweisen können, dass hinter der versprochenen menschenfreundlichen Pluralität immer schon ein (sich selbst ideologiefrei wähnender) Ingenieur herrscht. So oft und unverblümt das Wort ‚humanity‘ im Schrifttum der Kolonisierer fällt, so wenig Vertrauen scheinen sie in dieselbe investieren zu wollen.“ Das trifft jetzt auch auf die Erforscher der ganzen irdischen Genossenschaften zu.
—————————————————————————————————–
* „Der subjektive Traktor“ ist eine Verballhornung des Titels von Helke Sanders Film „Der subjektive Faktor“, in dem es um die Anfänge der Frauenbewegung im SDS geht. Als ihr Film 1981 in die Kinos kam, wurde er von vielen Linken als zu hölzern und statisch empfunden. Als das ZDF jedoch 2008 den Film ausstrahlte, zeigte er nicht das Überholte der 68er-Ideen, sondern im Gegenteil: dass sie immer aktueller werden. Stellenweise bekam man sogar den Eindruck, die Regisseurin hätte extra für das ZDF-68er-Jubiläum einige (Dialog-)Szenen neu gedreht.
——————————————————————————————————
(**) Barbara und Gunter Hamburger-Langer wohnen am Bodensee. Die Diplompsychologin leitet seit 20 Jahren „Visionssuchegruppen“ und ihr Mann, Geschäftsführer des Diakonischen Werks in Konstanz, mindestens ebenso lange „Open Space Konferenzen“. Die beiden wurden von der spirituellen Ökologiebewegung in Amerika, dem „New Age“ der Posthippiezeit, beeinflußt und machten sich 2001 elf Monate lang auf, um zu sehen, was davon übrig geblieben oder neu hinzugekommen war. Anschließend veröffentlichten sie ihre „Weltreise auf der Suche nach Samen für die Zukunft“ als Buch:
Als erstes besuchten sie ein Camp von Regenwaldaktivisten (forest defenders) und die Hippiestadt Nimbim in Australien. Jedes ihrer Reise-Kapitel schließt mit einem Interview ab. Hier ist es eins mit John Seed vom „Rainforest Information Center“. Er hat eine typische New Age-„Karriere“ hinter sich: Tune-In – erst Studium, dann Job bei IBM; Turn-On – mit LSD „die Augen öffnen“, sich für Buddhismus interessieren; Drop-Out – „Meditationsretreats in Indien und Nepal“, sich mit „Ökologie“ befassen, in eine Landkommune ziehen und Biogemüse anbauen.
Als Baumschützer begeistert er sich derzeit für die Gaia-Hypothese. Er nennt das „Hitch your wagon on a star“ – andere Visionen brauche er nicht. Die Gaia-Hypothese des Geophysiologen James Lovelock besagt, dass die Erde und ihre Atmosphäre ein einziger Organismus ist. Anfang November 2008 führte darüber die amerikanische Mikrobiologin und Symbioseforscherin Lynn Margulis im Berliner Zentrum für Literatur- und Kulturforschung Näheres aus. Das Ehepaar Hamburger-Langer nahm bereits bei Brisbane an einem Gaia-Workshop teil. Außerdem besuchte es ein Uni-Seminar von Ureinwohnern Australiens über „Aboriginal Studies“. Das anschließende Interview mit einem der Dozenten drehte sich um die „Bedeutung des Wissens der First People“ und um deren „Zukunftsvisionen“. Dann ging es weiter nach Perth in Westaustralien, wo sie Jo Vallentine interviewten. Von Petra Kelly agitiert hatte diese in Westaustralien eine Grüne Partei gegründet, 1992 beendete sie jedoch ihre Parlamentsarbeit und ist nun wieder als Umweltaktivistin unterwegs. „Mein Engagement kommt direkt aus meinem Herzen,“ sagt sie. So reden „New Age-People“. Es klingt immer ein bißchen wie schwäbischer Protestantismus. Und tatsächlich macht das Ehepaar Hamburger-Langer auch keinen großen Unterschied: zwischen religiösen (Quäker-)Aktivitäten, Friedensgruppen, Öko-Aktivisten, Indigenem Culturalism, Vegetarismus, Universitätsseminaren, Meditationsübungen, Riten des Übergangs für Trauernde und semiöffentlichem „Breast-Feeding“, das sich in Australien als ein „unter jungen Frauen verbreitetes Thema“ erwies.
Auf Hawaii besuchten sie ein „Bildungszentrum für gewaltlosen Widerstand“. Dort organisiert man seit dem 11.9. „Friedensmahnwachen“, an denen sich auch Ureinwohner und Mitglieder einer Bibelrunde beteiligen.
In Kanada traf das Ehepaar sich dann mit einem Psychologen am „Yukon Hospice Center“: Er ist Sterbebegleiter für an unheilbaren Krankheiten leidende Ureinwohner. Anschließend besuchte das Ehepaar das „Yukon College“, eine Ausbildungsstätte für die Ureinwohner und fragten eine als Bibliothekarin tätige Angehörige des „Raven“-Clan der Nacho Nyak Dun First Nations People über die „Mythologie des Yukon“ aus. Daneben nahmen sie an einem Seminar über die schädlichen Folgen von Alkoholgenuss bei schwangeren Müttern teil, das besonders die Ureinwohner aufklären soll.
Weiter ging es nach Kalifornien. Dort trafen sie eine Dozentin, die Seminare über „offene Systeme“ abhält und „Schritte zum holonischen Wandel“ entwirft. In ihrer Arbeit, so sagte diese, gehe es um die „Veränderung vom Ego-Selbst zum Öko-Selbst“. Ansonsten sieht sie seit der Verabschiedung des „Patriot Acts“ die USA langsam faschistisch werden. In Oakland besuchte das Ehepaar die private „Universität für Schöpfungsspiritualität“ von Matthew Fox, wo der anglikanische Bischof ebenso wie der Botaniker Rupert Sheldrake lehren. Letzterer versucht seit 1973 die vom russischen Biologen Alexander Gurwitsch aufgestellte Hypothese der morphischen Felder mit Medienexperimenten zu verifizieren. Laut Sheldrake bestehen die formbildenden Kräfte nicht aus Chromosomen oder Genen, sondern aus einem masselosen Feld – in das wir uns einem Radio ähnlich eintunen, damit ein Mensch, und nicht z.B. ein Esel aus unserem Keim wird. Sheldrake gehört zum Kern der kalifornischen New Age-Scene, die sich in den Achtzigerjahren u.a. in Esalen und in der Ojai-Foundation versammelte.
In San Rafael trafen Hamburger-Langer auf Ralph Gunter Metzner, dessen Bücher der taz-blogwart Mathias Broeckers ins Deutsche übersetzt. Der Harvard-Psychologe unternahm einst mit Timothy Leary und Richard Alpert LSD-Experimente – bis man sie von der Uni schmiß. Heute ist er Dozent am „California Institute for Integral Studies“ (CIIS). Als Gründer der „Green Earth Foundation“ will er „die Beziehungen zwischen Mensch und Natur heilen.“ Die Amis müssen immer gleich die ganze Welt retten – unter dem tun sie es nicht! Dabei ist Metzner z.B. in seinem demnächst auf Deutsch erscheinenden Buch über „Krieg und Herrschaft“ alles andere als optimistisch. In seiner US-anthropologischen Sichtweise zieht er Hoffnung allenfalls noch aus gewissen Affenforschungen: z.B. die des Kaliforniers Robert Zapolsky, der in Uganda Paviane erforschte, die nach dem plötzlichen Tod des ranghöchsten Männchens diesen Rang in ihrer Horde einfach nicht mehr besetzten – und fortan quasi führerlos, dafür aber um so fröhlicher weiterlebten. Als das Naturschutzgebiet und mit ihm die autonome Pavianhorde zerstört wurde, gab er seine Affenforschung auf. Statt weiter positiv zu denken beschäftigt er sich nun u.a. mit Depressionen. In seinem Buch „Warum Zebras keine Magengeschwüre bekommen“ schreibt er: „Vereinfacht dargestellt können Sie sich das Auftreten einer Depression wie folgt vorstellen: Ihr Stammhirn entwickelt einen abstrakten negativen Gedanken und schafft es, den Rest des Gehirns davon zu überzeugen, dass er wirklich ist wie ein realer Stressfaktor.“ Dass es der Zustand der Welt ist, der uns deprimiert, darauf will er sich in seinem Amimaterialismus nicht einlassen. Über nicht von einem ranghöchsten Männchen dominierte Pavianhorden forschte im übrigen auch jahrzehntelang der Zürcher Biologe Hans Kummer – in Äthiopien. Über eine andere Variante herrschaftsfreier Affenhorden referierte 1992 ein US-Biologe auf dem internationalen Primatenkongreß in Torremolinos: Er hatte den Kot einer Gruppe Kapuzineraffen genetisch untersucht – und dabei festgestellt, dass kein einziges Junges vom ranghöchsten Männchen abstammte – obwohl dieser quasi die alleinige Vaterschaft in der Gruppe beanspruchte.
Neben solchen Affenforschungen kann sich Metzner auch noch an einem Radiosender in San Francisco erfreuen, „der jeden Morgen nur gute Nachrichten verbreitet“. Ansonsten hat er jedoch das Gefühl, in einer Zeit „wachsenden Faschismus und Imperialismus“ zu leben. Nach Metzner interviewte das Ehepaar den Afrikaner Mutombo Mpanya, den es bereits 1996 in einem Seminar am „Institute for Deep Ecology“ in Seattle kennenlernte. Er meint, „Afrika ist vollkommen im Privatbesitz der westlichen Welt“ und „die Bekehrung der Menschen zum Christentum in den sogenannten ‚primitiven Gesellschaften‘ schuf ein isoliertes und individualistisches Bewußtsein.“ Dieses macht Mpanya für die meisten, wenn nicht alle Übel der Welt verantwortlich.
In Oakland sprach das Ehepaar mit Marshall Rosenberg, den Gründer des „International Center for Non-violent Communication“. Die im Center gelehrte „mitfühlende Sprache“ lasse sich auch mißbrauchen, meint Rosenberg – und erwähnte einen seiner Studenten, der später sehr erfolgreich selber „gewaltlose Kommunikation“ lehrte – und zwar in einem Unternehmen, das die Mitarbeiter daran hindern wollte, Gewerkschaften zu gründen. Für Visionssuche-Gruppenleiter wie die Hamburger-Langers war ein Besuch im kalifornischen „Vision Valley“ natürlich Pflicht. Anschließend besuchten sie den im Sterben liegenden Weltverbesserer Steven Foster. Mit ihm führten sie ein Interview an der „School of Lost Borders“, wo u.a. „Vision Fast“-Kurse stattfinden. Für Foster ist „eine Vision kein Luftschloss, keine Täuschung – sie ist eher etwas ganz Praktisches – das getan wird.“ Zwischendurch besuchte das Ehepaar noch jemanden, der kirchliche Messen mit Technomusik veranstaltet und Exstacy zu therapeutischen Zwecken verwendet.
Ich fragte mich nach dieser langen Visionssuche, warum die Autoren unbedingt und ständig von „Visionen“ sprechen (müssen) – von Halluzinationen also? Wo wir doch seit Platon, Morus und Fourier das schöne Wort „Utopie“ haben – für einen Ort, den es (noch) nicht gibt. Wobei uns seit Foucault die „Atopie“ sogar noch lieber ist – also etwas, das keinen Ort hat. Und da soll es auch bleiben. Besteht nicht das ganze Elend der Welt derzeit vor allem darin, dass hier permanent irgendwelche US-Super-Visionen in die Wirklichkeit eingebildet werden?
Der Schluß des Buches von Barbara Langer und Gunter Hamburger versöhnte mich wieder etwas mit ihrem dicken Buch: „Ursprünglich hatten wir geplant, zwei Wochen länger im Suskwa Valley zu bleiben, aber der bevorstehende Tod unserer Hündin Ora läßt uns früher abreisen. Der Abschied von liebgewonnenen Freunden fällt schwer. Gemeinsam tanzen wir noch einmal den Ulmentanz – auch für Ora.“
Barbara Hamburger-Langer und Gunter Hamburger: „Ein Stern sei mein Wagenlenker – Eine Weltreise auf der Suche nach Samen für die Zukunft“, Edition Octopus, Münster 2008, 612 Seiten 44 Euro 20.
——————————————————————————————————-
(***) Die Veränderung beim Alternativbetrieb “Zweite Hand” wurde dadurch forciert, dass dieser spätestens mit der Wende immer größer und erfolgreicher wurde. Schon 1990 sah man kaum einen Polen oder Russen auf der Straße bzw. im Café, der nicht die “Zweite Hand” studierte. Aber sechs Jahre später kam eine Gruppe von Ex-Betriebsräten der “Zweiten Hand” in die taz. Sie wollten uns darüber aufklären, wie ihr „Duzkonzern“ gerade umgebaut wurde:
In vielen Westberliner “Alternativ”-Betrieben passieren jetzt solche Geschichten: Erst wurden die Mitarbeiter großzügig behandelt, auch pekuniär, mit der Wende erfolgte dann eine Expansion in den Osten, die scheiterte, und jetzt geht es mittels der gängigen Mobbing-Mechanismen von oben ans Eingemachte.
So rief etwa der Betriebsrat der Kleinanzeigen-Zeitschrift Zweite Hand nach fünfzehnmonatigen Verhandlungen über neue “Lohnstrukturen” eine Einigungsstelle an, die das Arbeitsgericht jedoch abwies. Schließlich trat er am 18. April 1996 zurück: “Das Ganze hat unheimlich viel Kraft gekostet”, resümiert eine ehemalige Betriebsrätin des GmbH-Geflechts “Zweite Hand” ihre vergeblichen „Bemühungen um den Erhalt des Betriebsklimas“.
Das erfolgreiche “Offertenblatt” für kostenlose Kleinanzeigen (Umsatz 1995 zirka 15 Millionen Mark) wurde 1983 unter anderen von dem heutigen Hauptgesellschafter Konrad Börries in der Potsdamer Straße gegründet, zweiter Geschäftsführer ist seit 1988 Herbert Borrmann. Anfangs erschien die Zweite Hand einmal wöchentlich, ab 1986 dreimal. 1993 koppelte man den samstäglichen Autohandelsteil aus. Mit der “Wiedervereinigung” versuchte die Geschäftsführung erfolglos, “die DDR zu erobern” (die fünf ostdeutschen Filialen sind längst wieder abgewickelt).
Seit einiger Zeit gilt der Anzeigenblätter-Markt als “gesättigt”, die ZH-Auflage stagniert seit 1994 bei 162.000. Eine Tochter-GmbH, die Abteilung “WAS” (Werbe- Anzeigen-Service), akquiriert Anzeigen von gewerblichen Kunden, bei der Abteilung “kostenlose Kleinanzeigen” kam 1992 eine zusätzlich geldbringende Daueranzeigenannahme hinzu. Die Beratungsleistung in diesen Abteilungen wurde extra vergütet. Die für alles Neue offene Geschäftsleitung erfand zudem “Nationale”, “Chiffre” und “Blickfang-Anzeigen” sowie über eine “Phone-Box” zu schaltende “Kontakt- und Partyanzeigen” und käufliche “Horoskope”. Dafür wurde eine weitere GmbH kreiert. Für die Entwicklung einer am Treptower Park 75 erworbenen üppigen Ost-Immobilie war es dann eine GbR, die Börries und Borrmann mit einem Bauunternehmen gründeten. Das Richtfest für den dortigen “Zweite Hand”-Neubau fand Ende 1994 statt, im selben Jahr begann auch die erste große Umstrukturierung im Betrieb: “Alle Leute sollten fortan alle Anzeigen aufnehmen können” – und dafür nach Lohngruppe A3 umgeschichtet werden, plus Provision, wenn mehr als 30 Anzeigen pro Stunde aufgenommen würden. “Jetzt verdient ihr euch alle eine goldene Nase!” versprach die Geschäftsleitung. Das Modell “funktionierte jedoch nicht”.
Im Juni 1995 wurde ein neues mit dem Betriebsrat ausgehandelt: mit einem Grundlohn von 19,50 Mark und einer Provision ab der 41. Anzeige von 35 Pfennig für jede weitere, plus Umsatzbeteiligung. Diese Betriebsvereinbarung sollte für die knapp 100 Mitarbeiter der Abteilung “Kleinanzeigen” gelten. Parallel dazu hatte man sich in der oberen Etage ein neues Wirtschaftsmodell ausgedacht – das “Call-Center”: mit gleicher Technologie und gleicher, von der konzernnahen “ISV-GmbH” entwickelten Software. Die Umsetzung übertrug man der betriebsratlosen “Audio-Service-GmbH”, die damit 60 Arbeitsplätze in Treptow, am neuen Firmensitz, schaffen soll: “Das Call-Center bietet Telefondienstleistungen aller Art für Fremdfirmen an.” Erwähnt sei ferner die ebenfalls betriebsratlose “Lloyd Presse GmbH”, in der das Stadtmagazin 030 entwickelt wurde, dem man defizitbedingt zunächst nur eine “Galgenfrist” bis zur Love Parade 96 gab. Auch im Internet surft man mit: “blinx – Zweite Hand Online”. Zudem werden noch monatlich die Biker- Börse und das Single-Sondermagazin date sowie jährlich der Branchenführer “Leihen” herausgegeben. Ein 10prozentiger Anteil an Radio Energy wurde inzwischen wieder abgestoßen.
Das Call-Center in Treptow beschäftigt vor allem Leichtlohnkräfte: für 10 Mark die Stunde werden dort in Konkurrenz zur Potsdamer Straße Kleinanzeigen erfaßt, dazu gibt es 20 Pfennig pro Auftrag. Mitarbeitern, die von Schöneberg in den Osten übersiedeln, stehen 12 Mark Stundenlohn zu, sie können auch im Westen bleiben. Nur, dort müssen sie befürchten, bis Ende 1997 abgewickelt zu werden. “Ihr wollt zurück in die Anfänge der Industrialisierung!” bekam die Geschäftsleitung schon vom Betriebsrat zu hören. Im Westen ist zwar ein mit der IG Medien ausgehandelter Haustarifvertrag gültig, darüber hinaus gibt es eine Jahresleistung und sechs Wochen Urlaub. Aber die dortige Belegschaft hat das Gefühl, auf “einem schon fast abgesägten Ast” zu sitzen: “Es geht seit 94 kontinuierlich bergab.” Seitdem 1995 der Lohn um rund 10 Prozent gekürzt wurde, stieg die Zahl der – erfolglosen – Arbeitsgerichtsklagen, ebenso die der Krankmeldungen und Kündigungen.
Bisher haben fast nur Ostler sich bereit gefunden, nach Treptow rüberzugehen. Ein ehemaliger Betriebsrat beklagt zudem, daß sich die von der WAS angestellten Mitarbeiter sowie die in der Uniset GmbH zusammengefaßten Layouter und Grafikdesigner nie mit den “Tippern”, die das Gros der Belegschaft bilden, solidarisierten, obwohl auch ihre Gehälter schon um bis zu 310 Mark gekürzt wurden. Ihr aller Chef Herbert Borrmann folge allen Moden des Kapitalismus, er eile dabei sogar der CDU voraus – etwa indem er die Jahresleistung von Fehlzeiten abhängig mache. Von seiner Kalifornien- Tour brachte er vor einiger Zeit das “Lean Management” mit, und nach dem Spiegel- Artikel “Deutschland: Weltmeister im Blaumachen” habe der Personalchef den Tippern prompt die Krankenlisten vorgehalten. Das Rollback Richtung “Lohndrückerei” im Call-Center gehe so weit, daß dort erst nach Aufnahme von 50 Anzeigenaufträgen pro Stunde die Mindestleistung erfüllt werde – diese Anzahl sei jedoch mit der ACD-Telefonanlage und der Zweite-Hand-Software “das absolute Maximum”, was überhaupt in der Stunde zu schaffen sei: “Schließlich muß man dabei immer freundlich bleiben.”
Seit der Inbetriebnahme des Call-Centers häufen sich die Kundenbeschwerden: falsche Rufnummern, verstümmelte Texte, patzige Live-Operator. Gerade der “freundliche, schnelle und kompetente Service” (so das hausinterne Dienstleistungscredo) wird der ZH-Belegschaft ob der rücksichtslosen Profitpolitik der Geschäftsleitung zunehmend schwerer gemacht. Dafür schafft diese einen echten Christo fürs Treptower Foyer an… Derart kommt die gute alte Alternativscene bzw. WG-Zeit nun also auch in Schöneberg langsam an ihr Ende – nahezu kampflos.
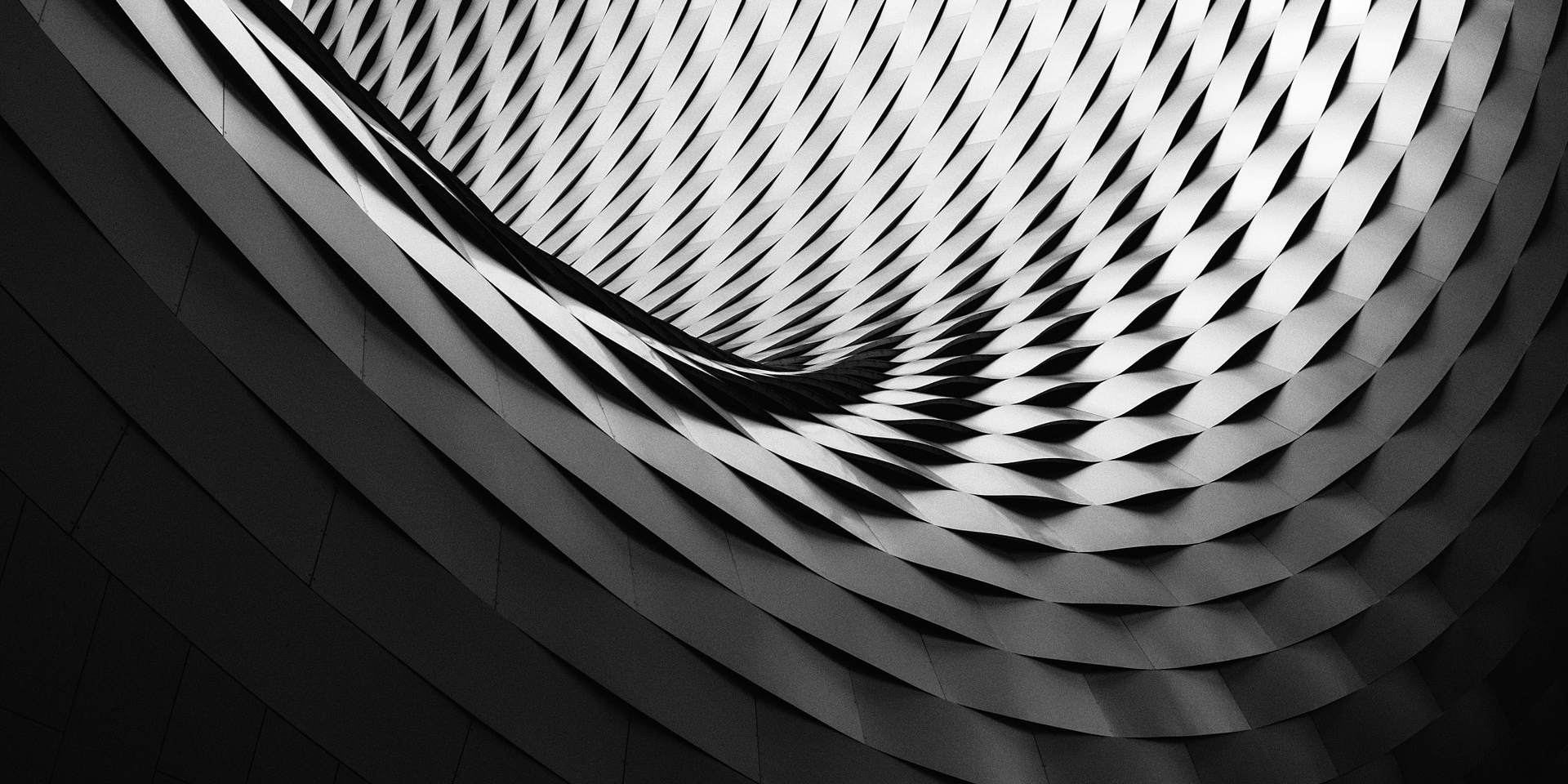



Im Verlag AG Spak veröffentlichte Elisabeth Voß kürzlich ein Buch mit dem Titel „NETZ f. Selbstverwaltung u. Selbstorganisation: Wegweiser Solidarische Ökonomie“.
In ihrer „Einleitung“ schreibt sie:
So lange Menschenrechte nicht überall und unterschiedslos für alle Menschen durchgesetzt sind, kann ich mit dieser Welt nicht einverstanden sein. Die materielle Basis der Verstöße gegen Menschenrechte sehe ich in der kapitalistischen, profitorientierten Ökonomie begründet. Dabei ist mein Blick geprägt von diesem Deutschland mit seiner mörderischen Vergangenheit, von diesem Europa mit seinen tödlichen Außengrenzen und von dieser nördlichen Hemisphäre mit ihrem ausbeuterischen und zerstörerischen Ressourcenfraß.
Heute ist es vor allem der Kapitalismus, der die Verwirklichung der Menschenrechte verhindert und Lebensgrundlagen zerstört, aber auch in nicht-kapitalistischen Gesellschaften gab und gibt es Macht und Gewalt. Die materielle Basis der Herrschaft von Menschen über andere Menschen ist die von Ausbeutungsverhältnissen dominierte Ökonomie. Daher setze ich auf praktische ökonomische Alternativen als Voraussetzung einer emanzipatorischen, solidarischen Gesellschaft.
Diese Ansätze, die konkreten Lebensbedingungen hier und jetzt zu verbessern, beziehen ihre Stärke daraus, dass Menschen nicht in der ihnen zugedachten Rolle als Opfer gewalttätiger Verhältnisse verharren, sondern in diesen Vorhaben mit ihrer Praxis dagegen aufbegehren und eigene materielle Realitäten schaffen.
In diesem Wegweiser habe ich die Bandbreite der benannten Ansätze bewusst sehr weit gehalten. Die LeserInnen mögen selbst beurteilen, ob im Einzelfall wirklich der Mensch im Mittelpunkt des Wirtschaftens steht, ob es sich vielleicht nur um egozentrischen Eskapismus handelt, oder ob sich unter einem sozial-ökologischen Mäntelchen letztlich doch nur profanes Gewinnstreben versteckt. Grundsätzlich möchte ich alle Versuche anderen Wirtschaftens ernst nehmen, die Motive der Akteure respektieren, ihre Praxis mit Interesse befragen und zunächst von ihrer Redlichkeit ausgehen. In der Vielfalt der Ansätze sehe ich einen großen Reichtum, darum erlebe ich es als störend und zutiefst unsolidarisch, wenn VertreterInnen einzelner Richtungen selbstgewiss behaupten, ihr Weg sei der einzig richtige und besser als andere.
Mit diesem Wegweiser möchte ich zum besseren Verständnis und zum Kennenlernen der vielfältigen Ansätze ökonomischer Alternativen beitragen. Solidarische Ökonomien werden oft in kleinen, dissidenten Einheiten erprobt, diese andere Wirtschaftsweise umfasst jedoch letztlich weit mehr als nur kleine, feine Alternativprojekte.
Wer ernsthaft die Gesellschaft von ihrer ökonomischen Basis her verändern möchte, muss die kuschelige Gartenzwergperspektive verlassen und sich zum Beispiel auch mit Alternativen in großen Unternehmensstrukturen oder transnationalen Handelsabkommen befassen.
Die Zusammenstellung der Beispiele konzentriert sich auf Deutschland, mit einigen Blicken über die Grenzen. Neben allem Bemühen um eine große Breite ist sie subjektiv geprägt und etwas Berlin-lastig. Mit unserer Link-Sammlung im Internet kann sich das auswachsen.
Für ihre Beiträge zur Entstehung dieses Wegweisers bedanke ich mich beim AG SPAK Verlag, insbesondere bei Waldemar Schindowski für die Idee zum Buch; bei meinen VorstandskollegInnen vom NETZ für Ermutigung und inhaltliche Anregungen und Ergänzungen; bei Dieter Poschen dafür, dass er als Koordinator und Endredakteur der CONTRASTE seit 25 Jahren zuverlässig den Laden zusammen hält und damit einen wichtigen Beitrag dazu leistet, dass ich mich mit Solidarischen Ökonomien lesend und schreibend auf dem Laufenden halten kann; bei Karl-Heinz Bächstädt für geduldiges Korrekturlesen, umfangreiche Änderungsvorschläge und Kräutertee.
Elisabeth Voß, Berlin, Februar 2010