Es mehren sich Texte über Krieg und Tiere. Gerade erschien das Tagebuch eines US-Soldaten über Vögel im Irak, denen er dort als Birdwatcher nachstellte. Überhaupt scheinen hierzulande den Medien und Verlagen die Tiere im arabischen Strafraum mehr als die Menschen am Herzen zu liegen…
„Der Tod des einäugigen Löwen Marjan im Zoo der afghanischen Hauptstadt Kabul hat Tierfreunde in aller Welt erschüttert. Er hatte die Invasion der Sowjetunion, den Bürgerkrieg, die Taliban und zuletzt die US-Bombenangriffe überlebt. Das Tier kam 1974 mit Hilfe des Kölner Zoos nach Kabul. Als vor einiger Zeit ein Taliban-Kämpfer in den Käfig kletterte, um seine Tapferkeit zu beweisen, fraß Marjan ihn. Der Bruder des Taliban warf daraufhin eine Granate auf ihn, weshalb er am Ende halb blind und lahm sein Dasein fristete. Marjan starb am Montag an Nierenversagen.“ (Spiegel)
„Zu seiner ausgestopften Giraffe auf der documenta , erklärte der österreichische Künstler Peter Friedl, dass sie in Kalkilia, dem einzigen palästinensischen Zoo tot umgefallen sei, als die israelische Armee dort ein Versteck der Hamas angriff.“ (FAZ)
Hier noch eine aktuelle, etwas verzwickte Krieg-Nazi-Tierforscher-Tier-Geschichte – in zwei Teilen:
1. „Gleich kommt Professor Dathe!“
Der Zoologe und Botaniker Heinrich Dathe initiierte 1954 die Gründung des Tierparks Friedrichsfelde, der mit 160 Hektar lange Zeit der größte der Welt war, und deren erster (und letzter) Direktor Dathe dann wurde. Im Gegensatz zum Westberliner Zoo, der eher rohem Volksvergnügen dient, wurde der Ostberliner Tierpark eine „Kultureinrichtung“ und die Tierpflegerausbildung zum ersten Mal wissenschaftlich organisiert. Außerdem halfen tausende von Aufbauhelfern u.a. beim Ausbau der Freigehege. Die Zoos in den sozialistischen Bruderländern „spendeten“ dann die Tiere, ebenso die DDR-Betriebe und -Organe. Die Stasi z.B. Stachelschweine: ein subtiler Hinweis für den Direktor. Er war noch vor den „Märzgefallenen“ der NSDAP beigetreten und hatte sich als Zoologe ab 1933 auf Stachelschweine und verwandte Nagetiere spezialisiert.
Professor Dathe nannte man bald den „Grzimek der DDR“. Nicht weil Bernhard Grzimek auch der NSDAP (als Veterinär im Reichsministerium für Ernährung und als Funktionär im Reichsnährstand) gedient hatte, auch nicht, weil beide im Gegensatz zu dem ebenfalls populären Biologen Konrad Lorenz immerhin keine besonders „lauten Nazis“ gewesen waren, sondern weil beide nach `45 als Tierparkdirektoren das Radio und das Fernsehen auf sympathisch-erzählerische Weise zu nutzen verstanden, um für „ihre“ Tiere und den Tierschutz weltweit zu werben. Später beteiligten beide auch ihre Kinder an diesem großen „Werk“. Dathes Sohn Falk ist heute Tierpark-Kurator bei den Kriechtieren. Grzimeks Sohn Michael starb bei der Tierschutz-Mission „Serengeti darf nicht sterben“ in Tansania. Dort ließ sich 1987 auch sein Vater begraben. Der DDRler Heinrich Dathe starb 1991 – fünf Tage nachdem die eingewestete neue Stadtverwaltung ihn wegen seiner allzu großen Nähe zu den kommunistischen Machthabern rüde aus seinem „Lebenswerk“ entfernt hatte: „Binnen drei Wochen haben Sie Ihre Dienstwohnung zu räumen“. Am Tag, als Dathe starb, feierte man den Geburtstag des Westberliner Zoodirektors: Professor Klös, der dann Aufsichtsratsvorsitzender für beide Tiergärten wurde. Die beiden mochten sich nicht. „Der Dathe ist dem Klös um so vieles überlegen gewesen“, weiß z.B. die Tochter des Großtierhändlers Munro, der mit beiden Zoo-Direktoren (Tausch-)Geschäfte machte. „Klös hätte besser Manager als Zoologe werden sollen“, meint ein ehemaliger Zoo-Tierpfleger.
Zur Verabschiedung Dathes, von der dieser zu dem Zeitpunkt allerdings noch nichts ahnte, hatte Klös im November 1990 eine Rede gehalten. Sie ließ bereits Schlimmes erwarten: „Und wenn ich Ihnen, Herr Kollege, an diesem Ehrentag bekenne, dass vieles im Tierpark Friedrichsfelde mich so begeistert, dass ich es mir auch zwischen Kudamm und Landwehrkanal vorstellen kann, dann werten Sie es bitte als Ausdruck höchsten Respekts“. Professor Dathe verstand ihn sofort. Einer Ost- Journalistin, Gisela Karau, verriet er: „Der Tierpark wird wohl weiterbestehen, aber vielleicht als eine Art Hirschgarten, der keine Konkurrenz für einen Zoo darstellt. Wir waren immer ein Wissenschaftszoo, der Westberliner mehr ein Schauzoo. Und die Wissenschaft muß weg.“
Erst einmal wurden rund 170 Mitarbeiter entlassen, für die verbliebenen 286 schwäbische Stechuhren installiert, die Lehrlingsausbildung in den Westen verlagert, die Menschenaffen in den Zoo verbracht, ein Zookurator als Tierparkdirektor eingesetzt, die Tierpark-Restaurants von der Treuhand geschlossen und dann sollte auch noch die „Schlangenfarm“ in den Westen kommen. Nicht, weil die Kriechtiere dort besser zur Geltung kämen, sondern um sie hinter den Kulissen quasi endzulagern. Dieses „Projekt“ scheiterte jedoch am Widerstand der Ostberliner Tierpark-Freunde und des -Betriebsrats. Und diese werden nun erneut aktiv – nachdem eine Grüne Bezirkspolitikerin entdeckt hatte: „Dathe war mal Blockwart!“ – und seitdem laut verlangt, dass man ein 2005 nach ihm benanntes Gymnasium in Friedrichshain sofort umbenennt. Kurier und BZ machten daraus sogleich eine riesige Sommerlochgurke, wobei der in Ostberlin baggernde Kurier inzwischen schon wieder zurückrudert: „Seine Leistung ist nicht wegzureden“. Nach Dathe hat man 2005 zum 50jährigen Zoojubiläum auch den Platz vor dem U-Bahnhof Tierpark sowie eine Promenade, die von dort abgeht, benannt – und diese wurde 2007 von einer Künstlerin „aufgewertet“ – u.a. mit verhaltensaufklärerischen Informationen über Vögel – in blau-weiß, und einem – allerdings bisher nur geplanten – „Pavillon“, in dem über Leben und Werk von Heinrich Dathe informiert werden soll. Diesen Bau wird man nun wohl auch stoppen wollen.
2. „Das ist doch nicht der Dathe!“
Der Westberliner Biologe Cord Riechelmann hat kürzlich in zwei Intelligenzblättern Dathes Werdegang – „Vom Blockwart zum Tiergärtner“ – thematisiert. Ausgehend von dem Wunsch eines Berliner Lokalhistorikers, der „offen“ über die „politische Nähe Dathes“ zu den Nazis und den Kommunisten „diskutieren“ will, meint Riechelmann: „Das ist mit Sicherheit ein richtiges Anliegen, genauso wie die eventuelle Umbenennung des Gymnasiums“. Obwohl in „der Öffentlichkeit“ Dathe eigentlich als „erledigter Fall“ gilt und von daher „kaum die Gefahr besteht, dass ihm, wie in diesem Jahr Bernhard Grzimek, zu einem runden Geburtstag ausführlich oder auch nur kritisch gedacht werden wird.“ So dachte/verfuhr die FAZ zuvor bereits mit Erwin Strittmatter und dessen angeblich verschwiegene „SS-Vergangenheit“, wo es dann ebenfalls um die Umbenennung eines Gymnasiums (in Spremberg) ging. Die paar Ostler da zählen nicht, es geht um die (deutsche) Meinungshoheit. Riechelmann gibt jedoch gerade in diesem Zusammenhang zu bedenken, dass der DDR-Professor Dathe seine Tier-Forschung viel weniger von politischem „Biorassismus“ durchtränkt hat – als z.B. der Österreicher Konrad Lorenz.
Darüber hatten die beiden Biologen bereits selbst gestritten – in Marcel Beyers 2008 veröffentlichtem Roman „Kaltenburg“. Dathe figuriert darin als „Matzke“ und Lorenz als „Kaltenburg“. Statt „Blockwart“ ist Dathe bei Beyer ein KZ-Aufseher gewesen, dem jedoch statt Häftlinge zu quälen, erlaubt wurde, die Vögel im Lager und drumherum zu beobachten und abzuschießen, um sie zu präparieren. Es gibt einen Matzke, der noch lebt: Dieter Matzke – er ist Chefpräparator des Ostberliner Naturkundemuseums, das in Beyers Buch von Dathe (alias Matzke) geleitet wird. Und es gibt ein Buch über einen SS-Offizier, der tatsächlich in Auschwitz die Vögel erforschte – zusammen mit einem polnischen Häftling, der die Zeichnungen Präparate anfertigen mußte. Der SS-Ornithologe wurde nach dem Krieg von einem polnischen Gericht zu acht Jahren Gefängnis verurteilt. Das Buch „Die Vogelwelt von Auschwitz“ schrieb Arno Surminski. 2002 waren bereits Dathes „Lebenserinnerungen eines leidenschaftlichen Tiergärtners“ erschienen – herausgegeben von Falk Dathe und seinen zwei Geschwistern. Man kann davon ausgehen, dass die Ostler eher diese Biographie interessiert hat als diese ganze Matzke/Matzke/Dathe/Dathe/Lorenz -Westverwirrung. Zu der Frage, „inwiefern nicht ihre [Dathes und Lorenz‘] Biologie schon politisch oder gesellschaftlich angetrieben war“, schreibt Riechelmann: „Man kann sagen, dass in Lorenz‘ Art- und Rasse-Idealismus, der immer auch von der ‚Reinheit‘ biologischer Einheiten träumt, seine Nähe zu den Nazis präadaptiert war. Zumindest hierin hat Dathe dem weltberühmten ‚Gänsevater‘ 1965 deutlich widersprochen“.
Darum geht es aber derzeit gar nicht, sondern um die systematische Austreibung aller Leistungen von DDR-Kulturschaffenden. An ihre Stelle soll finsterster Amimuff treten. So zeichnet die diesbezüglich besonders eilfertige BRD-Kapitalfraktion um die FAZ einen amerikanischen Scientology-Frontman in München mit einem Bambi-„Mut“-preis aus und in Gerbstedt im Mansfeldischen tauft man die nach dem antifaschistischen Bergmann Otto Brosowski benannte Grundschule ausgerechnet auf den Namen Graf Schenk von Stauffenberg um. Schließlich werden die Studenten auf „Bachelor“ bzw. „Master“ verpflichtet – und müssen sich dafür zum Abschied auch noch glücklich lächelnd mit albernen schwarzen Amihütchen auf dem Kopf abphotographieren lassen. Ich weiß aus eigener Erfahrung wie nachhaltig so etwas wirken kann: Im sibirischen Irkutsk zitierte eine Buchhändlerin einmal zwei Zeilen aus dem „Loreley-Lied“ („Ich weiß nicht, was soll es bedeuten…“) – nachdem sie erfahren hatte, dass ich Deutscher bin. „Geinrich Geine“ – fügte sie hinzu. Und ich sagte „Aber das ist doch nicht von Heinrich Heine!“ Sie bewies es mir jedoch sofort in einem ihrer zum Verkauf ausliegenden Bücher. In dem Buch, aus dem ich einst das Loreley-Lied lernte, muß als Autorennamen noch immer die Naziformulierung „unbekannter Volksdichter“ gestanden haben. Und das hielt sich dann bei mir bis Irkutsk 1996. Fast könnte man daraus den Schluß ziehen: Es war nicht alles schlecht an „Sibirien“. Ich erinnere nur an zwei Bücher ehemaliger Lagerhäftlinge, die das bereits in ihrem Titel ausdrücken: Heimito von Doderers „Sibirsche Klarheit“ und Traugott von Stackelbergs „Geliebtes Sibirien“.
Und hier noch einige Zitate aus einem sowjetischen Kriegsbericht, in dem es immer wieder auch um Tiere geht:
…Im Wechsel von den Nachtigallen zu den Flugzeugen…
Der sowjetische Kriegsberichterstatter Wassili Grossman verfaßte fast ausschließlich Kriegsliteratur, dazu die noch während des Zweiten Weltkrieges von ihm mitverantwortete erste umfassende Zusammenstellung von Berichten über die deutschen Lager zur Vernichtung der Juden – das sogenannte Schwarzbuch, das erst vor einigen Jahren veröffentlicht werden konnte. Schnell berühmt wurde sein 928-Seiten-Roman „Wende an der Wolga“, der auf Deutsch 1958 in der DDR erschien, er handelt von der „Schlacht um Stalingrad“, nach der überall in Europa und nicht nur dort die Hoffnung aufkam, das die Deutschen doch besiegt werden könnten. Berühmter noch als dieses Buch wurde dann Grossmans ebenso umfangreicher Roman „Leben und Schicksal“, in dem die „Schlacht um Stalingrad“ gleichsam von innen geschildert wird (während er sie in der „Wende an der Wolga“ noch quasi von außen, vom linken Wolgaufer aus, beschrieb). Der Roman erschien 1984 in der BRD, in der Sowjetunion durfte das Buch erst nach 1990 veröffentlicht werden – nach einer erneuten „Wende“ also.
Der Kriegsberichterstatter Grossman hat sich, ähnlich wie der weißrussische Autor Wassil Bykau Zeit seines Lebens mit dem Krieg und der „Moral des Krieges“ beschäftigt sowie mit dem, was man Tapferkeit, Feigheit, Angst nennt. Bykau schrieb fast ausschließlich über den in Weissrussland besonders entwickelten Partisanenkampf, weil, so sagte er, der Einzelne dabei noch Entscheidungen treffen könne und müsse, wohingegen der Soldat eher ein Rädchen in einer Kriegsmaschinerie sei. Grossman hat es jedoch verstanden, auch hierin nach der Persönlichkeit, dem Schicksal von Einzelnen, zu fragen. Seinen Stalingrad-Roman „Leben und Schicksal“ hat man mit „Krieg und Frieden“, dem Roman über den ersten „Vaterländischen Krieg“ – von Leo Tolstoi, verglichen. Es war auch das einzige Buch, das Grossman im zweiten „Vaterländischen Krieg“ – dem „Großen“ – las und das gleich zwei mal.
Als er 1964 starb, hinterließ er Tagebuchaufzeichnungen, die für eine ganze Reihe weiterer Kriegsbücher gereicht hätten. Der englische Historiker Antony Beevor hat sie zusammen mit der Journalistin Luby Vinogradova übersetzt und ausgewertet. Ihr Buch „Ein Schriftsteller im Krieg“ erschien 2007 auf Deutsch.
Darin wird zum Einen deutlich, wie der Krieg die Menschen und ihre Wahrnehmung verändert und zum Anderen, wie Grossman selbst, der in der Kriegsberichterstattung seine Lebensaufgabe fand, den Krieg mehr und mehr in einer Normalität oder Natürlichkeit wahrnahm, die der im Frieden gleichkommt.
In einem Interview mit dem Infantristen Michail Wassiljewitsch Steklenkow heißt es: „Als wir näher an die Front kamen, habe ich wirklich Angst bekommen. Aber dann im Gefecht wurde es besser. Und jetzt ist es, als ob ich in die Fabrik zur Arbeit gehe.“
Ein anderer Infantrist äußert: „Im Morgengrauen kämpft sich’s gut. Wie wenn man zur Arbeit geht…Im Dorf mußten wir manchmal härter schuften als im Krieg. Im Dorf ist es echt schwerer.“
Grossman bemerkt: „In den Fabriken wird weitergekämpft…Dieser Klang der Zerstörung ähnelt verdächtig dem Geräusch friedlicher Arbeit.“
Die ständige Gefahr, getötet zu werden, bewirkte eine Intensivierung des Lebens und der Wahrnehmung alles Lebendigen. In einem Exposé für eine Erzählung über den Nachrichtenoffizier Jegorow schreibt Grossman: „‚Es stimmt wirklich, Genosse Kommissar‘, sagte er, ‚in diesem Krieg bin ich ein neuer Mensch geworden. Erst jetzt sehe ich Russland, wie es ist. Man geht, und um jedes Flüsschen, jedes Wäldchen tut es einem so bitter leid, dass sich das Herz zusammenkrampft…Soll tatsächlich, so denke ich, auch dieses kleine Bäumchen den Deutschen zufallen?'“
Als die Soldaten nachts über die Wolga gebracht werden, „höre ich, wie ein Rotarmist zum anderen sagt: ‚Kumpel, wir müssen jetzt schneller leben‘.“
Die Dörflerin Njuschka erzählt: “ ‚Ach, jetzt ist Krieg, ich habe bereits 18 Männer bedient, seit mein Mann weg ist. Eine Kuh halten wir zu dritt, aber nur ich darf sie melken, die beiden anderen akzeptiert sie nicht‘. Sie lacht. ‚Ein Weib ist jetzt leichter zu überreden als eine Kuh‘. Sie lächelt. Einfach und gutmütig bietet sie ihre Liebe an.“
Im Kampf scheinen Mensch und Material sich immer mehr anzugleichen: „Obergefreiter Melechin, der Geschützführer, ein lustiger, flinker Virtuose dieses Ringens auf Leben und Tod, in dem eine Zehntelsekunde über den Ausgang des Zweikampfs entscheidet, lag schwer verletzt da und starrte mit trübem Blick auf sein Geschütz, das mit den von Splittern zerfetzten Reifen an einen schwer leidenden Menschen erinnerte…“
Der Richtschütze Trofim Karpowitsch Teplenko meint: „Natürlich ist man froh, wenn man einen Panzer erledigt hat…Das war ein Gefecht Auge in Auge.“
„Nach dem Gefecht ist das Geschütz wie ein Mensch, der schwer gelitten hat – die Reifen sind zerfetzt, überall Beulen und von Splittern durchgeschlagene Teile.“
Als die Deutschen erstmalig die neuen Panzer vom Typ „Tiger“ einsetzten, passierte laut Grossman folgendes: „Ein Richtschütze feuerte mit der 45-Millimeter-Kanone aus unmittelbarer Nähe auf den ‚Tiger‘. Die Geschosse prallten ab. Der Schütze verlor den Verstand und warf sich vor den ‚Tiger‘.“
Die Kriegstechnik wird nach ihrer Zerstörung zu entseelter Natur:
„Die Sonne bescheint hunderte Eisenbahngeleise, wo Tankwaggons mit zerfetztem Bauch wie tote Pferde herumliegen, wo hunderte Güterwaggons, von Druckwellen erfaßt, übereinandergetürmt wurden und sich um kalte Lokomotiven drängen wie eine von Entsetzen gepackte Herde um ihr Leittier.“
„Das Schlachtfeld war übersäht mit ausgebrannten Panzern aller Typen. Beobachter meinten, es hätte ausgesehen wie auf einem Elefantenfriedhof.“
Über sich und seine Kollegen, die Kriegsberichterstatter, die immer wieder vom Hinterland an die Front müssen, äußert Grossman: „Der unangenehmste Augenblick ist genau dieser Wechsel von den Nachtigallen zu den Flugzeugen…“
„Die Rotarmisten sind so sehr an die Zerstörung gewöhnt, dass sie sie gar nicht mehr wahrnehmen.“ Dafür ist ihnen jedoch das wenige Unzerstörte sogleich beseelt: „Inmitten all der Zerstörung ein Holzhäuschen. ‚Seht nur, das Haus ist noch am Leben,‘ sagen sie im Vorübergehen und lächeln.“
Einerseits vertiert der Mensch im Krieg, der Wald wird seine Zuflucht, er verwildert: „Die erbitterten Kämpfe in Kellern, Abwasserkanälen und Ruinen von Wohnhäusern hießen bei den Deutschen bald nur noch ‚Rattenkriege‘.“
Ein Pilot erzählt: „Dieses Jagdfieber, das entsteht, als wäre ich ein Falke und kein Mensch. An Humanität denkt man nicht mehr, überhaupt nicht. Wir machen den Weg frei. Es ist ein gutes Gefühl, wenn der Weg frei ist und alles brennt.“
Während des Rückzugs: „Unheimlich sind solche leeren Straßen, die der letzte Mann unserer Truppen bereits passiert hat und wo jeden Augenblick der erste Feind auftauchen kann. Wüstes Niemandsland zwischen unseren und den deutschen Linien. Wir kommen wohlbehalten durch und fahren in den Brjansker Forst wie in unser Vaterhaus.“
In den Ruinen des Warschauer Ghettos notierte sich Grossman: „Begegnung mit Menschen aus dem Keller Seliaznaja 95c. Menschen, die zu Ratten und Affen wurden.“
Andererseits passen sich die Tiere im Krieg den Menschen an, werden ihm gleich:
Eine Division besaß als Maskottchen ein kasachisches Kamel – namens Kusnetschik (Grashüpfer), das dem Artillerieregiment als Zugtier diente. Es zog den ganzen Weg von Stalingrad bis Berlin mit, wo es an den Reichstag spuckte. „Bei Beschuss sucht es Deckung in einem Granaten- oder Bombentrichter. Es hat sich schon drei Tressen für Verwundungen und die Medaille ‚Für die Verteidigung von Stalingrad‘ verdient“.
Ein Soldat erzählt: „Wir haben Hunde hier, die Flugzeuge sehr gut auseinanderhalten können. Wenn unsere fliegen, und sei es fast über die Köpfe hinweg, reagieren sie überhaupt nicht. Aber wenn es eine deutsche Maschine ist, bellen und heulen sie sofort und suchen Deckung, selbst wenn sie sehr hoch fliegt.“
In einem Dorf erfährt Grossman: „Als die Deutschen in dem Bauernhaus auftauchten, sind die Katzen daraus verschwunden und haben sich drei Monate lang nicht blicken lassen. Das war nicht nur in diesem Ort so, sondern in allen Dörfern, erzählt man.“
Eine ukrainische Partisanin berichtete, dass ihre kleine Schwester sich mit den Hühnern unterm Bett versteckte, wenn Deutsche das Haus betraten. Die Hühner wußten, dass sie in großer Gefahr waren – und gaben keinen Ton von sich so lange die Deutschen da waren.
„Nächtliches Weinen über eine Kuh, die beim blauen Licht des gelben Mondes in einen Panzergraben gestürzt ist. Die Weiber heulen: ‚Sie lässt vier Kinder zurück‘. Als ob sie ihre Mutter verloren hätten.“
Die Mongolei stellte der Roten Armee tausende von Pferde zur Verfügung. Sie waren zwar klein, aber genügsam und kälteunempfindlich. Viele dieser Pferde gelangten bis nach Berlin. Einige Rotarmisten schrieben Briefe in die Mongolei, indem sie sich für die Pferde bedankten und diese lobten: Sie hätten sich besser bewährt als alle Beutepferde.
„Der Kommandeur des Schützenkorps ist General Iwan Rosly. Er hat zwei Dackel, einen Papagei, einen Pfau und ein Perlhuhn, die ihn ständig begleiten.“
Tiere werden aber gleichzeitig auch kriegstechnisch ge- bzw. vernutzt:
„Besonders abgerichtete Hunde werden mit Brandflaschen am Körper auf einen Panzer gehetzt, mit dem sie in Flammen aufgehen.“
„Ein Witz geht um: ‚Wie fängt man einen Deutschen? Man braucht nur irgendwo eine Gans festzubinden, und ein Deutscher wird sie zu greifen versuchen. Die Realität: Rotarmisten haben im Wald Hühner an langen Schnüren festgebunden und sich im Unterholz versteckt. Tatsächlich tauchten Deutsche auf, als sie die Hühner gackern hörten. Sie gingen prompt in die Falle.“
„Ein Erkundungstrupp hat herausgefunden, dass die Deutschen in diesem Frontabschnitt Gänse als Wächter angepflockt hatten, die bei jedem Geräusch Lärm machten.“
In Elista wurde die Stadt von deutschen Motorradfahrern eingenommen, sie „schauten in die Häuser, stahlen dem Popen einen Truthahn, der gerade herausgelaufen war, um im frischen Pferdemist zu scharren.“
Nicht wenige Rotarmisten haben ihre Tiere mit neuer Kriegstechnik vertauscht: „Viele Panzersoldaten kommen aus der Kavallerie. Aber zweitens sind sie auch Artilleristen und drittens müssen sie etwas von Fahrzeugen verstehen. Von der Kavallerie haben sie die Tapferkeit, von der Artillerie die technische Kultur.“
Die noch nicht lange zurückliegenden Klassenkämpfe und die dazugehörige Ideologie tragen im Krieg taktische Früchte. Klassenkampf ist praktizierte Solidarität. Ein Major Fatjanow erzählt: „Unsere Piloten fliegen immer paarweise (sie lassen sogar von einem Opfer ab, um beim Partner zu bleiben). Wichtig ist, dass wir einander vertrauen und uns in der Not helfen… Bei den Deutschen ist der Sinn für Kameradschaft schwach entwickelt. Paare lassen sich leicht trennen und machen sich davon… In der Koordination mit dem Partner liegt der Schlüssel des Erfolgs.“
Der Pilot Boris Nikolajewitsch Jerjomin: „Der wichtigste Grundsatz ist, immer paarweise zu fliegen und Freundschaft zu halten.“
Nicht nur die Kameraden und die Tiere, auch das Wetter kann zum Bündnispartner werden:
„Die Deutschen sind an leichte Siege mithilfe der Technik gewöhnt und geben auf, wenn die Natur nicht mitspielt.“ Sie sprechen dann von „Russenwetter“, das sie fürchten. Während die sowjetische Seite umgekehrt ihre Angriffe mehr und mehr davon abhängig macht: „Der Militärrat der Front sorgt sich vor dem Angriff nur noch um das Wetter. Wie gebannt starrte man auf das Barometer. Ein Meteorologieprofessor wurde hinzugezogen. Dazu ein alter Mann, der sich gut mit den örtlichen Witterungsbedingungen auskannte.“
Während die Deutschen im Laufe des Krieges von der Artillerie auf die Infantrie gewissermaßen runterkamen, verlief die Entwicklung bei der Roten Armee umgekehrt: von der Infantrie zur Artillerie. Ihre Kampfeinstellung blieb dennoch gefühlsbetonter als bei den Deutschen. Generalleutnant Tschuikow befand: „Die Leistung der Deutschen ist nicht gerade glänzend. Aber was die Disziplin betrifft…Ein Befehl ist für sie Gesetz.“
Im befreiten Vernichtungslager Treblinka erfährt Grossman: „Wenn die Männer von den Frauen und Kindern getrennt wurden, kam es zu herzzerreißenden Szenen. Die Psychiater des Todes von der SS wissen, dass man diese Gefühle sofort unterdrücken muss. Sie kennen die einfachen Gesetze, die auf allen Schlachthöfen dieser Welt gelten.“
In Berlin dann war Grossman fasziniert davon, „wie sich die geschlagenen Feinde verhielten, wie bereitwillig sie Befehle der neuen Behörden entgegennahmen und dass es – ganz anders als in der Sowjetunion – kaum Widerstand von Partisanen gab.“
Unterwegs notierte sich Grossman: „Noch nie habe ich so viel Musik gehört. Über diesem aufgewühlten Lehm, vermischt mit Kot und Blut, erklingt Musik aus Radios, Grammophonen, von Sängern in Kompanien und Zügen.“
Der Soldat Michail Wassiljewitsch Steklenkow erzählt: „In einem Bauernhaus fragt mich die Frau: ‚Was singen Sie denn dauernd, wir haben Krieg.‘ Ich zu ihr: ‚Jetzt muß man erst recht singen.'“
Die Schreibkraft Klawa Kopylowa: „An ruhigen Tagen tanzen und singen wir (‚Das blaue Kopftuch‘).“
„Und plötzlich begann eine traurige Stimme feierlich zu singen: ‚Vor den Fenstern tobt ein Schneesturm…‘ Etwa zehnmal wird die gleiche Zeile wiederholt: ‚Lieber Tod, wir bitten dich/noch vor der Tür zu warten.‘ Diese Worte und Beethovens unsterbliche Musik hatten hier eine unbeschreibliche Wirkung. Vielleicht war das eines meiner größten Erlebnisse in diesem Krieg.“
Starobelsk hatten die Italiener eingenommen. Über sie „sagen die Leute, insbesondere die Frauen, nur Gutes. ‚Sie spielen und singen: ‚O mia donna!‘ Abscheu hat nur erregt, dass sie Frösche verspeisen.“
Wohingegen „Aussagen von Gefangenen und Briefe, die bei toten Soldaten gefunden wurden, ergeben, dass sich die Deutschen in der Ukraine als Vertreter einer höheren Rasse sahen, die in den Dörfern von Wilden lebten.“
Auf dem Vormarsch bemerkte Grossman: „Alle haben jetzt deutsche Mundharmonikas. Das ist das Instrument der Soldaten, weil man es sogar auf einem schaukelnden Pferdewagen oder LKW spielen kann.“
Generalleutnant Tschuikow urteilte über seine Soldaten, nachdem sie in Deutschland einmarschiert waren: „Sie plündern ein wenig. Da rollt ein Panzer, und auf seinem Kotflügel sitzt ein Ferkel. Wir verpflegen unsere Leute nicht mehr. Unser Essen schmeckt ihnen nicht. Die Fuhrwerkslenker fahren in Kutschen umher und spielen Akkordeon wie bei Machno.“
Berlin ist ganz anders als Grossman sich die Stadt vorgestellt hatte – nämlich als „eine einzige Kaserne“. Stattdessen: „Unmengen von blühenden Gärten, Flieder, Tulpen und Apfelbäumen. Am Himmel donnert die Artillerie. Wenn sie schweigt, hört man die Vögel zwitschern.“
Er geht durch den Tiergarten: „Alle Bäume waren zerschossen.“
Dann durch den Zoologischen Garten: „Hier hat es Kämpfe gegeben. Zerstörte Käfige. Leichen von Affen, tropischen Vögeln und Bären. Die Insel der Paviane, junge Äffchen, die sich mit winzigen Händchen an ihre Mütter klammern. Gespräch mit einem alten Mann, der die Tiere seit 37 Jahren pflegt. Im Käfig ein toter Gorilla. Ich: ‚War er böse?‘ Er: ‚Nein, er hat nur laut gebrüllt. Die Menschen sind böser‘.“
An einer Ecke zur Leipziger Straße steht ein Kavallerist mit seinen Pferden, Grossman fragt ihn, wie er Berlin findet: „Gestern war hier was los in diesem Berlin. Auf dieser Straße wurde gekämpft. Als eine deutsche Granate direkt neben uns einschlug, scheute ein Pferd und galoppierte los. Der Hengst hier. Er ist jung und ein bisschen wild. Ich bin ihm nachgerannt. Überall hat es geknallt, das Pferd wollte nicht stehenbleiben, und ich immer hinterher. Da habe ich gemerkt, was Berlin ist! Wir sind zwei Stunden lang immer dieselbe Straße entlang gerannt, und sie war noch nicht zu Ende! Da hab ich gedacht: Das also ist Berlin. Aber das Pferd habe ich eingefangen!“

Möve auf Holzpoller

Möve auf Metallpoller
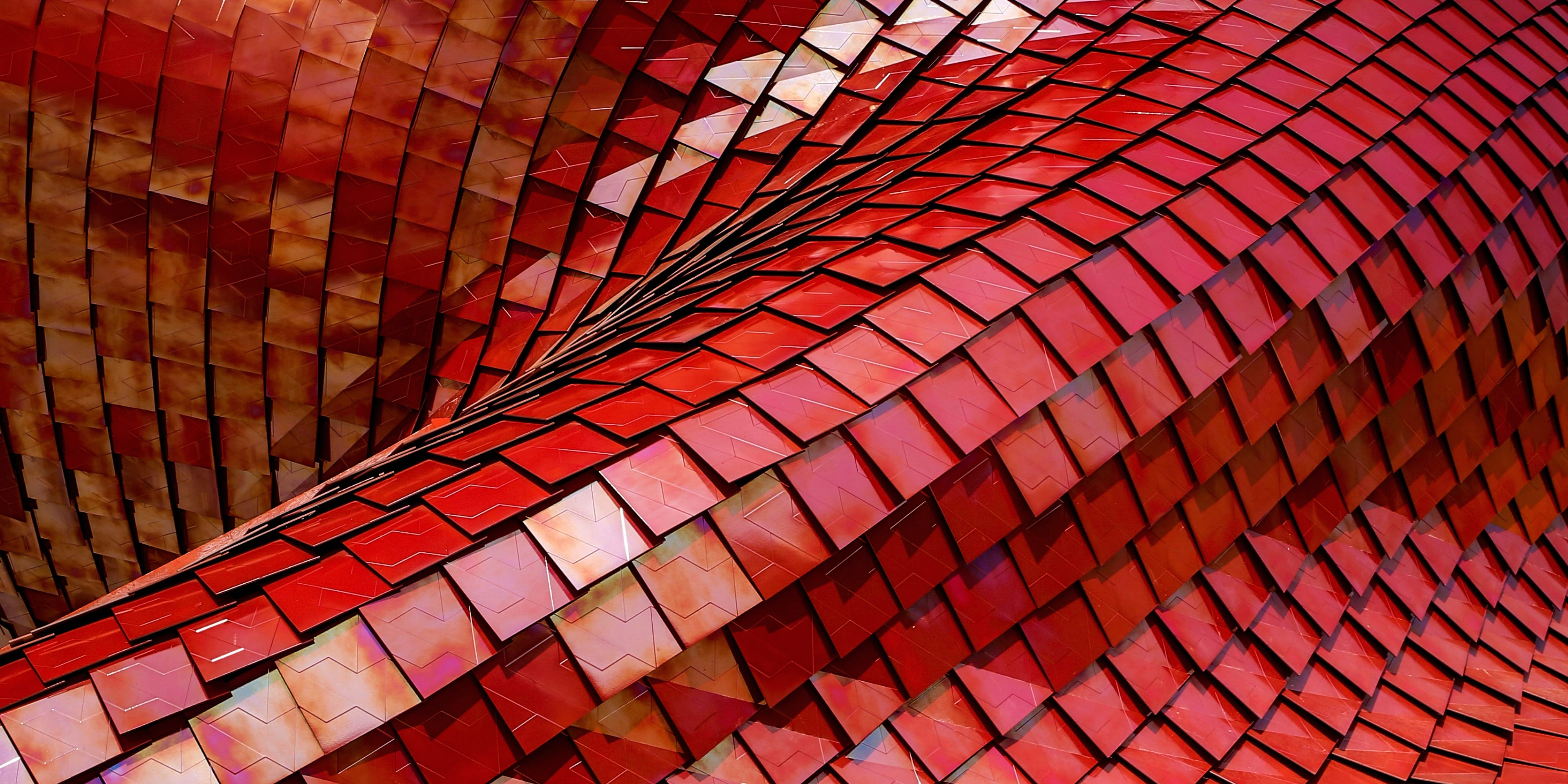



Sybill Weimar (Bochum):
„Mit anderen Worten: Wir beobachten heute eine fortschreitende Vermehrung lokal situierter, universalistischer bzw. pan-humanistischer ethischer Forderungen. Weit davon entfernt, ein Symptom des Relativismus darzustellen, sind diese Forderungen eine produktive Kraft der gegenwärtigen Subjektivität. Sie stellen den Ausgangspunkt eines Netzes von sich überschneidenden Formen situierter Verantwortung, d.h. einer neuen Form der Ethik, dar.“
(Rosi Braidotti, „Zur Transposition des Lebens im Zeitalter des genetischen Biokapitalismus“, in: „Bios und Zoe, Hrsg. von Martin G.Weiß, Suhrkamp 2009)