
Der schwarze Schwan „Petra“. Photo: WN, Matthias Ahlke
Schwanforschung
Fünf Biologen machen Picknick an einem See. Plötzlich erhebt sich vor ihnen ein Schwan und fliegt laut Flügel schlagend übers Wasser davon. Er beschreibt eine Kurve und landet daraufhin wieder in der Mitte des Sees. Die Männer fangen an zu diskutieren, wie der Schwan das gemacht hat und warum. Der Erste, ein Physiologe, beschreibt die starken Flügelmuskeln, ihre besondere Verankerung am Skelett und das Nervensystem des Schwans. Er flog auf, weil Impulse von der Retina ins Gehirn und von dort weiter über die motorischen Nerven an die Flügelmuskeln geleitet wurden. Der Zweite, ein Biochemiker, verweist darauf, dass die Muskeln des Schwans u.a. aus den Proteinen Aktin und Myosin bestehen. Der Schwan kann aufgrund der Beschaffenheit dieser Faserproteine fliegen, die unter Verbrauch von Energie (aus ATP – Adenosintriphosphat, der universellen Form verfügbarer Energie in den Zellen) eine Gleitbewegung vollführen und so den Muskel kontrahieren lassen. Der Dritte, ein Entwicklungsbiologe, beschreibt die ontogenetischen Prozesse, die zunächst ein befruchtetes Ei zur Teilung veranlassen und dann zur rechten Zeit für die Ausbildung von Nervensystem und Muskulatur sorgen. Der Vierte, ein Verhaltensforscher, zeigt auf einen im See schwimmenden Mann: Er hat vielleicht unabsichtlich den in Ufernähe gründelnden Schwan verscheucht, weil er ihm zu nahe gekommen war. Schwäne sind wegen ihrer kurzen weit hinten am Körper angesetzten Beine an Land sehr schwerfällig – und verlassen deswegen das Wasser nur ungerne, wo sie mit ihrem langen Hals die Pflanzen vom Grund abfressen. Der Fünfte, ein Evolutionsbiologe, erklärt die Prozesse der natürlichen Selektion, die sicher stellen, dass nur jene Schwanvorfahren eine Chance hatten, zu überleben und sich fortzupflanzen, die sowohl imstande waren, eine mögliche Gefahr rechtzeitig zu erkennen, als auch schnell genug, sich in die Luft zu erheben. (1)
Fünf Biologen, fünf verschiedene Arten von Erklärung. Der Physiker Steven Rose spricht von einem „epistemologischen Pluralismus“ – den wir aushalten müssen. Der Wissenschaftssoziologe Bruno Latour fragt sich dagegen: „Wann können wir endlich aufhören, die nicht-menschlichen Wesen zu objektivieren, indem wir sie ganz einfach verweltlichen und laizistisch betrachten?“ An anderer Stelle meint er jedoch: „Wer der Faszination für die Natur zu erliegen droht, sollte zur Ernüchterung jedesmal das Netz der entsprechenden wissenschaftlichen Disziplin hinzufügen, durch die wir sie kennenlernen.“ Demnach sind die Wissenschaften für ihn so etwas wie Ausnüchterungszellen für trunkene Seelen.
In diesem Fall wäre das eine Schwanforschung als spezialisierte Ornithologie. Sie ist jedoch anscheinend nicht besonders üppig, obwohl einige Arten ähnlich wie die Störche geradezu „Zivilisationsfolger“ sind – und sich so den entsprechenden Wissenschaftlern fast schon aufdrängen. Die Schwäne (Cygnini) gehören mit den Gänsen zu den Entenvögeln (Anatidae), und die meisten Biologen bzw. Ornithologen konzentrieren sich, wenn nicht auf Enten, dann auf eine oder mehrere Gänsearten – denen sie u.U. bis in den Hohen Norden nachfolgen. Davon erzählt z.B. das Buch der schwedischen Ornithologin Ulla-Lene Lundberg: „Sibirien. Porträt mit Flügeln“. Auf solche Weise wurde z.B. die Ringelgans das Wappentier des Nationalparks Wattenmeer. Ihretwegen war es dort jahrelang zu erbitterten Auseinandersetzungen – zwischen den Gänseforschern bzw. Naturschützern einerseits und den friesischen Bauern andererseits gekommen. Letztere hatten das Land einst dem Meer abgerungen. Im Ergebnis wird die dortige Grenze zwischen Natur und Kultur heute durch eine rotweiße Schranke markiert.
Von Donna Haraway stammt die diesbezüglich schöne Formulierung, dass es zwar keine Natur und keine Kultur gibt, aber viel Verkehr zwischen diesen beiden Größen. Einzelheiten dazu finden sich in dem Aufsatz des Ethnologen Werner Krauss: „Die ‚Goldene Ringelgansfeder‘. Dingpolitik an der Nordseeküste“.
Zur Schwanenforschung im engeren Sinne bekam ich nur einen Tipp: das Buch des Münchner Stadtnaturforschers Josef Reichholf: „Das Comeback der Biber“. Es geht darin u.a. um das kämpferische „Revierverhalten“ der zur Schwarmbildung eher wenig neigenden Schwäne, die dafür gerne lebenslange Paarbindungen eingehen. Das gilt für alle 8 Schwanarten, von denen eine jedoch, die neuseeländische, seit 300 Jahren ausgestorben ist.
Während der sogenannten Vogelgrippe vor drei Jahren starben hunderte von Höckerschwäne – erst an der Ostsee und dann auch am Bodensee. Das Gesundheitsamt Rügen antwortete auf die Fragen besorgter Touristen stereotyp: „Ja ja, das Virus, das man in den Schwänen nachgewiesen hat, ist hochpathogen.“ Die Angst vor Ansteckung trieb einige Leute dazu, u.a. am Urbanhafen in Kreuzberg, nächtens einige Schwäne zu erschlagen. Früher tötete man alljährlich tausende dieser Tiere – ihrer Daunen wegen. Die Ornithologen versuchten nun gegen zu steuern, indem sie der Öffentlichkeit versicherten: Der Vogelgrippevirus H5N1 sei für Menschen nahezu ungefährlich und die Sterblichkeitsrate bei den Schwänen, auf Rügen z.B., nicht höher als in anderen Wintern auch! Im übrigen handele es sich bei den im Fernsehen gezeigten toten Schwänen um lange vor dieser „Medienkampagne“ gestorbene und bereits verweste Vögel.
Wie weit die „Panik“ reichte, erfuhr ich von einem Freund, der auf dem Land lebt und unbeabsichtigt den halben Staatsapparat darüber mobilisiert hatte. Ihm waren vier seiner sechs Gänse von einem Hund totgebissen worden. Traurig packte er sie in sein Auto, als er am nächsten Tag in die Kreisstadt fahren mußte. Unterwegs stieg ihm aber der Gestank der toten Gänse neben sich auf dem Boden unangenehm in die Nase und ihn packte die Wut. Kurzentschlossen hielt er an und schmiß die vier Kadaver in den Straßengraben. Als er Stunden später wieder zurückfuhr, war die Stelle großräumig von der Polizei mit rotweißen Plastikbändern abgesperrt, Seuchenexperten in weißen Kitteln untersuchten den Fundort und alle Autos mußten durch Desinfektionswannen fahren – sein ganzes Dorf hatte man mittlerweile unter Quarantäne gestellt. Mein Freund freute sich: Jahre, ach, jahrzehntelang hatte er versucht, alles Mögliche „anzuschieben“ – betrieblich, sozial, ökologisch, politisch, den Erhalt seiner Firma, die Begrünung seines Mietshauses in der Stadt, die Einrichtung eines Spielplatzes usw.. Aber nie hatte er dabei die Behörden derart schnell und so massiv mobilisieren können – wie mit dieser kleinen, unbeabsichtigten „Panikmache“.
Von meiner Mutter habe ich großen Respekt vor Schwänen eingeflößt bekommen. Sie hatte ihren Arbeitsdienst als BDM-Mädchen auf einem Bauernhof abgeleistet, wo sie die ganze Zeit von einem Ganter verfolgt und gebissen worden war. Seitdem fürchtete sie sich vor allen Gänseartigen. Ich überwand meine Furcht vor Schwäne 1967, mehr noch, aus einer Phobie machte ich damals eine Philie. Und das kam so:
1966 hatte der indische Großtierhändler George Munro in Bremen einen Zoo eröffnet, der gleichzeitig eine Tier-Handelsstation war, daneben besaß er noch eine kleine Station in Kalkutta. Ich fing als Übersetzer bei ihm an – für seine Frau, die Büroleiterin war und nur Englisch und Hindi sprach. Da die beiden jedoch nicht genug Tierpfleger hatten, war ich die meiste Zeit mehr draußen als drinnen beschäftigt. Dadurch konnte ich mich auf den Schwan gewissermaßen vorbereiten. Das begann schon morgens: Als erstes hatte ich vier kleine Kragenbären in ihr Freigehege zu tragen – jeweils zwei auf einmal, die ich am Nackenfell gepackt von mir weghielt, weil sie die ganze Zeit versuchten, in meine Hand zu beißen.
Dann kamen zwei halbwüchsige Orang-Utans dran, die ich mit dem Schlauchboot auf eine kleine Affeninsel in einem See zu bringen hatte. Auf dem Weg zum Boot nahm ich sie an die Hand. Auf der Insel mußte ich erst einmal die Tür eines kleines Häuschens aufsperren, damit sie bei Regen einen trockenen Platz hatten. Einmal sprangen mir währenddessen die beiden Orangs wieder zurück in das Schlauchboot – und ich befand mich allein auf der Insel, während die Affen über den See abtrieben und sich halb totlachten: Vor Freude hüpften sie wie wild auf die Wülste des Bootes und kreischten. Je entsetzter ich kuckte, desto lustiger fanden sie das Ganze. Zum Glück kam gerade Buddha, der kleine Sohn meines Chefs, am See vorbei. Er krempelte sich die Hose hoch, stieg ins kalte Wasser und bekam nach kurzer Zeit das Schlauchboot zu fassen.
Meistens half mir seine Schwester, Jenny – nach der Schule. Sie war mit allen möglichen Tieren groß geworden und kannte sich gut mit ihnen aus, während ich mit vielen zum ersten Mal zu tun hatte. So flößten mir z.B. in den Volieren zunächst die riesigen Schnäbel der Doppelnashornvögel den allergrößten Respekt ein: Sie saßen auf Ästen und man mußte gebückt unter ihnen durchgehen, um einen Eimer voll Obstsalat in ihren Futternäpfe zu verteilen: Was, wenn sie einem dabei in den Kopf hackten? Jenny zeigte mir, wie harmlos sie waren und wie vorsichtig sie ihre Schnäbel einsetzten – man konnte sie mit der Hand füttern. Ähnliches galt für die Flughunde, die trotz ihrer scharfen Zähnen ebenfalls kindlich-freundliche Obstesser waren.
Schwieriger war es mit dem Einfangen von Tieren, was oft vorkam, da der Zoo zugleich wie erwähnt als Handelsplatz diente. Auch hierbei half mir Jenny, mit der ich mich bald immer mehr anfreundete. Am Unangenehmsten war es, Kraniche oder Reiher einfangen zu müssen: Sie wehrten sich mit ihren langen spitzen Schnäbeln sowie mit ihren Flügeln und den scharfen Sporen am Bein – auf all diese fünf Waffen zugleich konnte man unmöglich achten. Mehrmals gelang es diesen Vögeln, mich zu verletzen, mindestens mir die Hosenbeine aufzuschlitzen. Beim Ährenträgerpfau war es schon gefährlich, ihn nur füttern zu wollen. Einmal sprang er dem Pfleger dabei auf den Kopf und brachte ihm eine tiefe Wunde bei, die genäht werden mußte. Ich scheuchte danach den Pfau immer mit einem Besen in seinen Stall, bevor ich mich in seinem Außengehege zu schaffen machte. Einmal flüchtete er vor dem Besen in meine Richtung, ich sprang erschrocken zur Seite, woraufhin er durch die Tür nach draußen ins Freie flog. Obwohl es ein herber Verlust war, etwa 1000 DM, trauerte niemand ihm nach. Am Angenehmsten war es mit einem Elefanten, den sein indischer Tierpfleger und ich im Güterwaggon nach Ostberlin in den dortigen Tierpark bringen sollten. Er machte alles bereitwillig mit. Für den Elefanten hatten wir genug Heu und anderes Futter dabei, aber für uns nur einige Schokoriegel, weil wir davon ausgegangen waren, dass die Zugfahrt höchstens 12 Stunden dauern würde – wir brauchten jedoch drei volle Tage, weil die Waggons alle nasenlang umrangiert wurden und jeder Personenzug Vorrang hatte. Bei jedem Halt stieg ich aus, um für den Elefanten Wasser zu holen. Auf dem Rückweg mußte ich jedesmal unseren Waggon suchen, der inzwischen umrangiert worden war. Der indische Tierpfleger und ich, wir wurden immer nervöser und hungriger, aber der Elefant blieb gelassen. Er vermittelte uns geradezu das Gefühl, dass wir es schon schaffen würden, ihn sicher ans Ziel zu bringen. Anschließend durften wir uns im Gästehaus des Ostberliner Tierparks drei Tage lang erholen, bevor wir wieder, diesmal mit einem Personenzug, nach Hause fuhren.
Als nächstes sollte ich elf Schwäne, die vorübergehend im leeren Freigehege für Geparden untergebracht waren, einfangen und umsetzen. Dieser Auftrag machte mich vollends ratlos. Die elf Schwäne schwammen im Wassergraben des Geheges: Mit dem Schlauchboot trieb ich sie erst einmal an Land und dann in einer Ecke des Geheges zusammen. Weil ich mich nicht traute, mir einfach blitzschnell einen zu packen, gelang es den Vögeln immer wieder, zurück in den Wassergraben zu flüchten, von wo aus ich sie dann wieder mit dem Schlauchbott an Land und in eine Ecke des Geheges scheuchte…Hin und her – bis der Sohn des Chefs, Buddha, kam und mir half: Wir drängten die Schwäne zu zweit erneut in eine Ecke des Geheges – und Buddha schmiß sich einfach auf den erstbesten, packte ihn, nahm ihn hoch und trug ihn über das halbe Zoogelände in das gerade fertiggestellte neue Gehege für Teichvögel, wo er den Schwan ins Wasser gleiten ließ. Es sah ganz einfach aus. Ich tat es ihm nach. Sogleich gelang es mir, einen Schwan zu umfassen, so daß er nicht mehr mit seinen Flügeln um sich schlagen konnte, seine kurzen Beine hielt er von selber still und seinen Schnabel hielt ich mit einer Hand fest. Die andere Hand presste ich an seinen Bauch. Nach ein paar Schritten merkte ich, wie weich dort die Federn waren und wie schön es sich anfasste. Ich ließ seinen Schnabel los und griff mit meiner anderen Hand an seine Brust – die war sogar noch weicher. Und weder versuchte der Schwan mir mit seinem Schnabel ins Gesicht zu hacken oder zu beißen, noch fing er an zu schreien, im Gegenteil: Er kuschelte seinen Kopf leicht an meinen Körper und fiepte nur leise. Ich streichelte ihm den Hals und ging glücklich zum neuen Teich der Wasservögel, wo ich ihn am Rand ins Gras setzte. Mit einem Satz und einem kleinen Schrei sprang er ins Wasser, um sich schnell in der Mitte des Sees in Sicherheit zu bringen.
Ich ging zurück, um den nächsten Schwan zu holen. Alle reagierten ähnlich friedfertig – sobald wir sie erst einmal fest umfaßt hielten. Leider war Buddha so schnell, dass wir schon bald zehn Schwäne gefangen hatten, den letzten, elften, schnappte ich mir – trug ihn aber nicht gleich in sein neues Freigehege, sondern ging mit ihm auf dem Arm noch eine Weile spazieren: Er war nicht schwer und fühlte sich ebenfalls wunderbar an, außerdem roch er gut. Tagelang hätte ich mit ihm so herumlaufen mögen. Ich wanderte mit ihm durch den ganzen Zoo. Als ich mit dem Schwan am Käfig des sibirischen Tigers vorbeikam, sprang dieser auf und fauchte, wobei er sich mit den Vorderpfoten am Gitter aufrichtete. Das tat er auch, wenn ich – was mehrmals täglich geschah – mit dem VW-Bus bei ihm vorbeifuhr. Der schwarze Panther im Käfig nebenan, der einer alten Dame gehört hatte, die in ein Altersheim gekommen war, blieb jedoch ganz ruhig: Er kuckte uns nur traurig oder gelangweilt hinterher. Dahinter arbeiteten unter der Aufsicht eines Wärters 14 Gefangene aus dem Gefängnis Oslebshausen an der Gestaltung eines Bison-Freigeheges. Ich hatte diesen Arbeitseinsatz organisiert und mich anfänglich auch noch darum gekümmert, aber nach und nach war ich dabei zum Laufburschen der Gefangenen geworden, indem ich ihre Briefe zu Verwandten und Freunden austrug bzw. umgekehrt von denen Botschaften an sie übermittelte und ihnen Zigaretten sowie andere Kleinigkeiten besorgte, was jedoch immer mehr wurde. So dass es mich irgendwann überforderte. Ich zog mich zurück und überließ dem uniformierten Wächter die Baustelle, was der mit Genugtuung registrierte: „Hätte ich Ihnen gleich sagen können!“
All das zeigte bzw. erzählte ich nun quasi dem Schwan, während ich ihn herumtrug. Schließlich setzte ich ihn am Wasservogel-Teich ins Gras. Bevor er sich dort ebenfalls ins Wasser flüchtete, schüttelte er noch kurz sein Gefieder aus. Dabei kuckte er mich irgendwie erstaunt an.
„Wenn ich einmal erwachsen werde, oder (wie wir zu sagen pflegten), nach der Revolution,“ schreibt die feministische US-Biologin Donna Haraway, „weiß ich, was ich tun möchte. Ich möchte für die Tiergeschichten in ‚Reader’s Digest‘ zuständig sein. die jeden Monat in über zwölfe Sprachen an die zwanzig Millionen Menschen erreichen. Ich möchte die Geschichten über moralisch versierte Hunde, gefährdete Völker, lehrreiche Käfer, wundersame Mikroben und gemeinsam zu bewohnende Häuser der Differenz schreiben. Mit meinen Freundinnen möchte ich am Ende des zweiten christlichen Jahrtausends Naturgeschichte schreiben, um zu sehen, ob andere Geschichten möglich sind, solche, die nicht auf dem Riß zwischen Natur und Kultur, bewaffneten Cherubim und heroischen Suchaktionen nach den Geheimnissen des Lebens beruhen.“

Zu Zeiten der Vogelgrippen-Hysterie 2006 wurde ein schwarzer Schwan berühmt, der sich im Aassee von Münster zu einem weißen Tretboot in Schwanengestalt gesellt hatte – und ihm nicht von der Seite wich, es sogar mutig gegen jeden Versuch der Wiederinbesitznahme durch die Menschen verteidigte. In Münster machte man aus dieser ungewöhnlichen „Liaison“ mit Hilfe einer Marketingfirma eine Art Wahrzeichen der Stadt. Ich vermutete, dass die weißen Schwäne den schwarzen verscheucht hatten, so wie es bei Schafen vorkommt, die kein schwarzes Schaf in ihren Reihen dulden. Eine „Expertin“ von der Biologischen Station „Rieselfelder Münster“ verneinte dies jedoch: Die weißen Schwäne hätten keine Probleme mit schwarzen Schwänen; es handele sich bei seiner Liebe zum Tretboot mithin nicht um eine Objektverschiebung aus Kommunikationsnot, wie man es von Affenwaisen kennt, sondern um eine „Fehlprägung“. Eine solche kennt man spätestens seit den Aufzucht-Experimenten des Gänseforschers Konrad Lorenz, der sich einst selbst zum Objekt einer solchen „Fehlprägung“ machte, indem er den neugeborenen Gänschen die Mutter ersetzte. (2)
Der schwarze Schwan vom Aasee muß aber doch wohl eine Schwänin zur Mutter gehabt haben, die ihn demzufolge auch sozusagen ganz normal geprägt hat. Jedenfalls tauchte er erst im Yachthafen und bei den Tretbooten im Aasee auf, als er seinen Flaum schon verloren – und ein schwarzes Gefieder bekommen hatte. Und dann schwamm er auch nicht hinter jedem weißen, schwanenförmigen Tretboot hinterher, sondern nur hinter einem bestimmten, das man dann auch – ihm zuliebe – aus dem Verkehr zog. Statt auf eine „Fehlprägung“ tippte Peter Berz deswegen auf einen Fall von „Feteschismus“, als ich ihm davon erzählte.
Im Winter 2006 wurde der schwarze Schwan zusammen mit seinem Tretboot in den dortigen „Allwetterzoo“ umgesetzt. Bei der laut Münstersche Zeitung „mehrtägigen Aktion“ wurde das Boot etappenweise über den Asee und durch einen Kanal immer weiter in Richtung Zoo gezogen. Die Berliner Netzeitung berichtete: In den vergangenen Wochen war der Trauerschwan bereits von einem Teich im Zoo ins Pelikan-Haus gezogen. Im neuen Stall soll der Schwan eine Fußverletzung endgültig auskurieren. „Das Tretboot im Wasserbecken soll den Schwan zum Schwimmen animieren, damit der Fuß entlastet wird‘, erklärte dazu der Zoo-Chef Jörg Adler. Die neue Unterkunft wird durch ein großes Aasee-Bild geschmückt. Zudem hängen im Pelikan-Haus Kopfhörer, mit denen sich Zoo-Besucher eine «Schwanenballade» anhören können. Später versuchte ein Verhaltensbiologe des Zoos den Schwan beziehungsmäßig wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Dazu berichtete der WDR: Im Zoo machte man sich Hoffnung, der Trauerschwan könnte einen lebendigen Artgenossen kennen und lieben lernen. Vor rund zwei Wochen wurde der Versuch der diskreten Kontaktaufnahme gestartet – und vorzeitig abgebrochen. Die im Zoo lebenden Trauerschwäne und die ‚Schwarze Petra‘ hätten sich nicht anfreunden können, hieß es. Keiner der Junggesellen verstand es, das Weibchen für sich zu begeistern. Die „Schwarze Petra“ blieb ihrem Tretboot treu. Petra lebt bereits seit mehr als einer Woche wieder mit ihrem Liebsten allein zusammen. Nach Ansicht des zooeigenen Verhaltensbiologen ist nicht davon auszugehen, dass sich das Tier jemals von seinem Tretboot trennen wird.“
Die Münsteraner hatten den Schwan zunächst „schwarze Petra“ genannt, der Zoodirektor bestand dann jedoch darauf, wahrscheinlich nach Prüfung der Kloake, in der sich beim Männchen der Penis befindet, ihn „Peter“ zu nennen. Wenn er nicht auch noch an einer geschlechtlichen „Fehlprägung“ litt, mußte das Tretboot demzufolge ein weibliches sein: „Wenn man sieht, wie der Peter das Schwanenboot umkreist, ist gar nichts anderes vorstellbar: Das ist sein absoluter Bezugspunkt,“ teilte der Zoo-Direktor der Presse mit. Für hunderte von Münsteraner und Besucher der Stadt war wiederum dieses seltsame Schwanenpärchen ein absoluter Anziehungspunkt. Es wurde von Neugierigen geradezu umlagert.
Ende 2007 war in der Presse jedoch erneut von der schwarzen Petra die Rede: Diese hatte sich plötzlich von ihrem Tretboot ab und einem jungen weißen männlichen Höckerschwan zugewandt. Der Zoodirektor Jörg Adler erklärte daraufhin der Presse: „Er ist Petra wohl vom Aasee gefolgt, tauchte plötzlich auf dem tierparknahen Seitenkanal und kurz darauf an ihrer Seite auf“. Die Ahnungen einiger Jogger am Aasee und vom Tretbootbesitzer und Yachtschulbetreiber Peter Overschmidt schienen sich zu bewahrheiten: Petra war zuletzt immer mal wieder für einige Stunden aus der Nähe des Tretboots verschwunden. Das hartnäckige und intensive Werben des jungen Höckerschwans um die Trauerschwänin hatte also Erfolg – „und das Tretboot ist nun wohl der dumme Dritte“, stellte Zoo-Chef Adler nüchtern fest und fügte hinzu: „Das kann einem fast leid tun.“

Im Frühjahr 2008 fing die schwarze Petra an, im Zooteich ein Nest zu bauen, doch plötzlich verließ der weiße Höckerschwan sie. Petra hörte auf mit dem Nestbau und schwamm unruhig hin und her. Im Zoo wußte man sich schließlich nicht anders zu helfen, als sie wieder auf den Aasee zurückzubringen, wo ihr weißes Trettboot vor Anker lag. „Petra wurde sehr aufmerksam, als sie das Boot erblickte. Sie hat wohl eingesehen, dass nur das Tretboot ihr die Treue hält“, erklärte der Zoo-Direktor anschließend auf einer Pressekonferenz – und fügte erklärend hinzu: Die Beziehung zu ihrem weißen Schwan sei sowieso sehr ungewöhnlich gewesen, da sich Trauer- und Höckerschwäne in der Natur eigentlich nicht begegnen. Auch die vielen an ihrem Leben interessierten Neugierigen aus Münster und Umgebung fanden, dass die inzwischen weltberühmt gewordene schwarze Schwänin bei ihrem Tretboot bleiben sollte, wie eine Umfrage ergab.
In einem Internet-Forum namens „ariva.de“, in dem ihre Beziehungsprobleme ebenfalls diskutiert wurden, bemühte man zum Verständnis eine Standorttheorie. So schrieb z.B. ein gewisser D.B.: „Ich glaube wenn ich dazu verdammt wäre, in Münster zu leben, würde ich auch Tretbooten hinterherschwimmen.“ Ein gewisser A.N. gab daraufhin zu bedenken: „Weiss nicht, was daran schlimm ist. Ich hatte bisher 3 Tretboote in meinem Leben und sooo schlecht ist das nicht. OK – es gibt nur eine Stellung und man muss ständig an der Beziehung arbeiten, aber man kommt als Pärchen auch vorwärts. Einer holt den anderen immer irgendwo ab und nimmt ihn mit.“
Anfang 2009 verteilte der Münsteraner „Freundeskreis ‚Schwarze Petra'“ Flugblätter und hängte Steckbriefe an die Bäume: „Gesucht wird…“ Seit dem 1. Januar war die schwarze Schwänin verschwunden. Es kamen Meldungen aus Lindau am Bodensee und aus Carolinensiel an der Nordsee, wo sie angeblich aufgetaucht war. Eine mit Photographien erhärtete Spur führte nach Xanten an einen Baggersee. Die FAZ schrieb: „Am Aussehen kann man Petra nicht erkennen, nur am Verhalten.“ Mit einer Ausnahme: Rita Thieme. „Die gelernte Tierpflegerin, eines von 58 Mitgliedern des Freundeskreises, hat Petra auf dem Aasee seit zwei Jahren gefüttert, mit Spezialkörnern und Blattsalat. Bloß nicht Brot und Brötchen, denn da ist Salz drin, und Salz können Trauerschwäne – anders als andere Schwäne und Wasservögel – nicht abbauen.“ Wenn Rita Thieme pfeift kommt Petra angeflogen – aus bis zu zwei Kilometern Entfernung. „Wenn wir demnächst feststellen, dass Petra in Xanten ist, dann lassen wir sie da“, sagte ein Sprecher des Freundeskreises. „Rita Thieme könnte sie zwar einfangen, weil sie bei ihr handzahm ist, aber es ist doch ein wildlebendes Tier, so gerne wir sie hier in Münster wieder auf dem Aasee hätten.“ Die FAZ tröstete die Münsteraner: „Für Petra ist Xanten am Niederrhein auch ein treffender Ort. Siegfried! Nibelungen! Parzival! Lohengrin! Elsa! Der Schwan hat eine sagenhafte Wahl getroffen.“
Das Tier wird sich auch hier am Niederrhein wohl fühlen, versicherten daraufhin sofort einige „Experten“ – u.a. vom Naturschutzzentrum im Kreis Kleeve. „Die Region hier bietet ideale Voraussetzungen. Durch seine zahlreichen Gewässer ist sie sehr attraktiv für Wasservögel“, teilte z.B. der Biologe Martin Brühne dem Lokalfernsehen mit. Schon zweimal hatte er in den vergangenen Jahren schwarze Schwäne am Altrhein beobachtet. Einer der prächtigen Vogel war sogar mal im Wasser festgefroren und musste befreit werden.

Weil dies anscheinend trotz Klimaerwärmung immer öfter passiert, werden neuerdings für die Feuerwehren Fortbildungskurse im „Wildvogel-Fangen“ angeboten. Ein Reporter der WAZ war dabei: „Ein fester Griff. Ein kurzes Schnattern. Und bloß nicht die Flügel aus den Augen verlieren. Schon hält der Profi den Schwan auf dem Arm. Thorsten Kestner weiß: ‚Die können einem Erwachsenen durchaus mit ihren kräftigen Flügeln den Oberschenkel brechen.‘ Kursleiter Kestner, der sich schon seit 20 Jahren um verletzte Wildtiere kümmert, fordert die Feuerwehrmänner zum Vormachen auf. Lars Kaluza und Daniel Weir sollen zwei Schwäne fangen. Im strömenden Regen und voller Feuerwehr-Montur stapfen die beiden über die matschige Wiese. Die Schwäne haben das Vorhaben der beiden längst erkannt und traben davon, die Blauröcke hinterher. Schwan eins ist geschickt und schlägt den Weg aufs offene Feld ein. Da kommt niemand mehr hinterher. Schwan zwei flattert am Zaun entlang. Das ist die Gelegenheit für Daniel Weir. Er greift von hinten zu, natürlich ohne die Flügel aus den Augen zu verlieren. Jetzt hat er den Schwan fest im Arm. Und dann? Thorsten Kestner rät, die gefangenen Wildvögel in blaue Müllsäcke zu stecken. Ob die denn darin noch Luft bekommen, fragen die Vogelfang-Lehrlinge. Kestner lacht: ‚Der Kopf muss natürlich rausschauen‘. Der Ausbilder lobt seine Schüler für den Einsatz am Zaun. Jedes Wildtier brauche aber seine eigene Behandlung. ‚Die Reiher hacken nach dem Auge‘, sagt Kaluza. Er hat da schon seine Erfahrungen gemacht. Bei Greifvögeln sollen die Feuerwehrleute besonders vorsichtig sein. Nicht nur wegen der Krallen und Schnäbel. Kestner: ‚Wenn sich ein Bussard im Zaun verfangen hat, schneidet den Zaun mit raus. Sonst bekommen wir später den Flügel nicht mehr hin‘.“
Der Schwanenrettung durch die Feuerwehr sind jedoch Grenzen gesetzt: Als neulich im Berliner Humboldthafen ein älterer Höckerschwan einen jungen, der seiner nestbauenden Schwänin zu nahe gekommen war, am Stauwehr in die Enge getrieben hatte und dort heftig attackierte, holte ein Spaziergänger die Feuerwehr, die ihn dann jedoch nur bat, weiter auf die beiden kämpfenden Schwäne aufzupassen: „Wenn wir den jungen fangen, dann wird der noch mehr verletzt und wir auch – und in der Schwanenstation geben ihm die Tierärzte sofort eine Todesspritze. Die wissen dort vor Schwänen nicht mehr ein und aus. Ständig kommen irgendwelche Leute, die ihnen verletzte Tiere bringen: Schwäne, die von Hunden gebissen wurden, Schwäne, die gegen eine elektrische Leitung flogen usw..“
Solch eine Zurückhaltung bei staatlichen Organe kann jedoch u.U. auch ihre Gutes haben: So beobachteten die DDR-Grenzschützer einmal – ohne einzugreifen, wie eine Gruppe Schwäne auf der Spree unweit vom Osthafen einen einzelnen Schwan angriffen. Dieser wehrte sich nicht, sondern versuchte weiter Kurs zu halten – auf das Westufer zu, was ihm, wenn auch mühsam, gelang. Normalerweise bringen sich Schwäne nicht an Land in Sicherheit, aber hierbei handelte es sich um einen DDR-Bürger, der sich einen hohlen Schwan aus Holz und Plastikmasse gebaut und übergestülpt hatte, um damit in den Westen zu flüchten. Die aufgebrachten Schwäne um ihn herum machten seine etwas steife „Verkleidung“ sogar noch authentischer. Sie gaben ihm gewissermaßen sicheres Geleit. Diese Fluchtgeschichte aus den Siebzigerjahren ist schon oft erzählt worden. Zuletzt erwähnte sie die Schriftstellerin Emine Sevgi Özdamar, die in Westberlin lebte, aber in Ostberlin, am Theater, arbeitete. Sie schrieb: „Die echten Schwäne kamen zu ihm, pickten an seinem künstlichen Schwanenkopf und schwammen mit ihm in den Westen. So hat man es mir erzählt.“
Ende April meldeten die überregionalen Zeitungen: Der in Xanten lebende schwarze Schwan ist nicht die „schwarze Petra“. Ihr Münsteraner „Freundeskreis“ erklärte dazu: Sie ist am Fuß zu erkennen, weil sie dort operiert und ihr ein Teil des Knochens entfernt wurde.“ Für den Freundkreis begann daraufhin die Suche nach dem vermissten Trauerschwan wieder von vorne. Er glaubte jedoch selber nicht mehr an einen Erfolg.

Aber dann tat sich doch wieder was – in Münster selbst. Ende Mai berichtete die Münstersche Zeitung: „In Uganda war gestern Morgen ein Handy im Dauereinsatz. „Ständig klingelt mein Telefon. Was ist denn in Münster los?“ Jörg Adler, Zoodirektor und derzeit in Afrika, gilt als Schwanenexperte Nummer eins in der Stadt. Als gestern ein schwarzer Schwan auf dem Aasee entdeckt wurde, war er ein gefragter Mann.“ Die Aufregung war groß in Münster. „Mit dem roten Motorboot sind wir sofort rausgefahren“, erzählte Segelschulleiter Peter Overschmidt, doch er wurde enttäuscht: „Der Schwan hat sich unserem Boot nicht genähert. Petra kam meistens sofort angeschwommen.“ Außerdem wirkte Petra „körperlich dominanter; dieser Schwan war schlanker. Ich würde sagen, dass es ein jüngerer Schwan ist.“ Vorsichtshalber trieb man dennoch „Petras Geliebten“ – das weiße Schwanentretboot – auf den Aasee. Nichts passierte. Am Abend erklärte Reinhold Wiens vom „Freundeskreis Petra“ der Presse: „Das ist leider nur ein schlechtes Double. Der Schwan ist zu schlank und verhält sich ganz anders. Es handelt sich definitiv nicht um unsere Petra.“ Am darauffolgenden Tag war dann auch ihr „schlechtes Double“ verschwunden.
In der Stadtverwaltung scheint man davon auszugehen, dass Petra nie wiederkehren wird, denn man plant nun, der Verschollenen ein Denkmal am Aasee zu setzen. (3) Gleichzeitig betet man für die „schwarze Petra“, dass sie nicht bis in die Schweiz fliegt, denn dort würde sie „das Schicksal vieler illegaler Einwanderer teilen,“ schrieb „Die Zeit“ Anfang Juni 2009: Die eidgenössischen Behörden wollen die schwarzen Schwäne auf ihren Seen nicht länger dulden – und sie im Notfall sogar abschießen. Nach Meinung der Schweizer Umweltbehörden bedrohen die australischen Schwarzschwäne die Bestände der weißen Schwäne. Große Teile der Bevölkerung sind gegen die Vertreibung der schwarzen. „Die Zeit“ vermutet, dass es in diesem Fall gar nicht um die Ökologie geht. Dahinter stecke vielmehr eine „große Verschwörung: Spätestens seit dem Bestseller ‚The Black Swan‘ steht der Schwarze Schwan in der Wirtschaft für unvorhergesehene Ereignisse, mit denen auf Grundlage bisheriger Erfahrungen niemand gerechnet hat. Sehr wahrscheinlich trachten also gar nicht die Ökologen dem Schwarzen Schwan nach dem Leben, sondern die frustrierten Schweizer Ökonomen. Immerhin ist er das lebende Symbol der Finanzkrise.“
Das Buch des libanesischen Mathematikers Nassim Nicholas Taleb: „Der schwarze Schwan. Die Macht höchst unwahrscheinlicher Ereignisse“, so der deutsche Titel, wird auch hierzulande breit diskutiert. Der einstige Gründer der „Glücklichen Arbeitslosen“ und nunmehrige Philosoph des Leipziger Zentral-Theaters Guillaume Paoli empfiehlt es ebenso wie „financebooks.de“. Dort heißt es: „In seinem Bestseller zeigt Nassim Taleb: Extrem unwahrscheinliche Ereignisse – ‚Schwarze Schwäne‘ – gibt es viel häufiger, als wir denken. Und wir unterschätzen systematisch ihre gewaltigen Folgen. Der erstaunliche Erfolg von Google ist ein Schwarzer Schwan, die Terrorattacken vom 11. September 2001 und globale Finanzkrisen ebenso.“ Weil er die Krise mit seiner Schwarzer-Schwan-Theorie quasi vorausgesagt hatte, ist der Autor derzeit ein weltweit gefragter Referent – beim CIA und der NASA ebenso wie bei Bankern, Unternehmern und Wirtschaftswissenschaftlern. Die „Welt“ schreibt: „Philosophisch betrachtet, nimmt Taleb das uralte Problem der Induktion wieder auf. Der Mensch macht systematisch Fehler, wenn er von der Vergangenheit auf die Zukunft schließt. Angenommen, Sie sind eine Weihnachtsgans, so Taleb. Tag für Tag, über Monate, werden Sie gefüttert. Sie müssen nichts dafür tun, nur fressen, und für Sie ist es offensichtlich, dass die Menschen Ihnen wohl gesonnen sind. Mit jedem Tag festigt sich diese Erkenntnis. Schließlich kommt der Weihnachtsabend, und Sie werden geschlachtet. Aus der Sicht der Gans ist Weihnachten ein „Black Swan“ – ein Ausreißer des normalen Ablaufs mit verheerenden Konsequenzen, der unmöglich aus der Vergangenheit abgeleitet werden konnte.“

Mit dieser Theorie, so mutmaßte ich beim Lesen dieses Artikels, läßt sich vielleicht sogar die Angewohnheit der kommunistischen Partei der Sowjetunion erklären, bei jedem Trauerfall, wenn z.B. einer ihrer Generalsekretäre gestorben war, das Fernseh- und Radioprogramm zu unterbrechen und tagelang nur noch „Schwanensee“ von Peter Tschaikowsky spielen zu lassen. Als „Schwanenlied“ wurden in Russland bereits vor der Revolution die jeweiligen Höhepunkte einer Entwicklung, einer Epoche oder eines Schaffens bezeichnet.
Im Mittelalter galt die Schwanenhaltung auf offenen Gewässern als Hoheitsrecht. In England gehören noch heute alle Schwäne der Krone. Alljährlich findet dort ein „Swan-upping“ genanntes Ritual statt: Der königliche Schwanenaufseher und seine Mannschaft fahren mit Booten herum, um eine Woche lang die Schnäbel der jungen Schwäne zu kennzeichnen, die kraft eines besonderen Vertrages nicht Eigentum des Souveräns, sondern bestimmter Berufsgruppen der City sind. Selbstverständlich werden die Schwäne der Königin niemals gekennzeichnet. Dafür begegnet einem das Schwan-Wappen der Krone überall, auf Gebäuden, Laternenpfosten, Telefonhäuschen und hunderterlei Dingen, vom Kupferschild an einem Pferdezügel bis zum Waffenrock eines Beefeater und eines Wachmanns im Londoner Tower.“
Die selbstbewußten Hamburger Bürger halten es ähnlich: Schon 1664 stellten sie die Belästigung der „Alsterschwäne“ unter Strafe. Sie gehören der Stadt – und es gibt noch heute einen „Schwanenvater“. Der derzeitige heißt Olaf Nieß. Er ist vor allem dafür verantwortlich, die etwa 120 Hamburger Höckerschwäne bei Winterbeginn in den Eppendorfer Mühlenteich umzusetzen, dieses Gewässer für sie eisfrei zu halten und sie dort zu füttern. Die der Krone gehörenden englischen Schwäne wurden früher gerne von Studenten aus Oxford und Cambridge heimlich gefangen, getötet und gegessen. Im Internet-Forum „chefkoch.de“ werden heute wieder Rezepte für die Zubereitung eines Schwans gesucht. In den Sechzigerjahren haben wir einmal, als Pfadfinder unterwegs im Sauerland, einen Schwan geschossen und anschließend versucht zu essen – sein Fleisch war jedoch nahezu ungenießbar.

Dies ist kein schöner Schluß für einen Vortrag über Schwäne. Ich wollte es dennoch damit genug sein lassen, aber dann bekam ich ein Plakat, mit dem eine „Internationale Konferenz“ der Kulturwissenschaftler an der Universität Weimar angekündigt wurde: „Die Macht der Dinge“ – und darauf war ein Photo mit 14 Tretbooten in Schwanengestalt abgebildet. Weiße – so wie das, in den sich die „schwarze Petra“ aus Münster verliebt hatte. Auf der Konferenz, die Ende April in Weimar stattfand, ging es um die „Akteur-Netzwerk-Theorie“ (ANT) von Bruno Latour, John Law, Michel Callon u.a.. Man könnte auch noch Isabelle Stengers, Karin Knorr-Cetina, Shirley Strum, Judith Butler, Lynn Margulis, Donna Haraway und Sandra Harding dazuzählen.
Hierzulande wird die ANT vor allem von Umweltsoziologen und Wissenschaftshistorikern diskutiert, in den USA u.a. von feministischen Anthropologinnen und Biologinnen. Es geht diesen Wissenschaftlerinnen darum, mit Hilfe der „Akteur-Netzwerk-Theorie“ die moderne Dichotomie von Natur und Kultur bzw. Gesellschaft, Objekt und Subjekt, Fakt und Fetisch zu überwinden – indem man Menschen und nicht-menschliche Wesen sowie auch sämtliche Artefakte (Dinge) an einem Runden Tisch gewissermaßen versammelt. Ein „Parlament der Dinge!“
Der Schwan im Arm – das war schon mal ein Anfang dahin. Und die Benamung des Münsteraner Trauerschwans als „schwarze Petra“ zusammen mit der Assoziation ihres „Freundeskreises“ ein weiterer Schritt. Auf diese Weise wird auch aus der Schwanenforschung einmal eine historische Wissenschaft werden. Und, wer weiß? Vielleicht bekommen wir von den Schwänen sogar einmal eine Geschichte der ihnen namentlich bekannten Schwanforscher zurück.

———————————————————————-
(1) Dazu führte kürzlich eine weitere Gruppe von Biologen – der University of Washington aus: „Einmal im Jahr verliert jeder Höckerschwan all seine Schwungfedern. Bis zu acht Wochen dauert es, bis sie wieder vollständig nachgewachsen sind. In dieser Zeit der Mauser können die Tiere nicht fliegen. Der Höckerschwan flüchtet sich während der Mauser schwimmend auf die Mitte seines Sees. Offenbar begrenzt gerade diese Zeitdauer die Körpergröße flugfähiger Vögel. Die Höckerschwäne mit einem Gewicht von bis zu 15 Kilogramm gehören zu den schwersten Tieren, die sich auf ihren Schwingen in die Luft erheben können. Eine Amselfeder braucht drei Wochen, um nachzuwachsen. Dagegen dauert die vollständige Mauser eines Albatrosses bis zu drei Jahre. Große Seevögel sind auf absolut funktionsfähige Flügel angewiesen. Daher fällt bei ihnen stets nur eine Feder zur Zeit aus. Die Reihenfolge, in der sich das Gefieder nach und nach erneuert ist stets die gleiche. Schon eine fehlende Feder beeinträchtigt den Flug. Der Vogel muss demnach genau wissen, wie er seinen Flug während der Mauser anzupassen hat. Je größer und damit schwerer ein Vogel ist, desto länger müssen seine Federn sein, um ihn zu tragen; beim Schwan bis zu 40 Zentimeter. Dennoch wachsen lange Federn pro Zentimeter kaum schneller als kurze. Die Wachstumsrate der Federn kann irgendwann nicht mehr mit deren Länge mithalten. Dies hätte zur Folge, dass Federn kaputt gingen, bevor sie ersetzt werden könnten. Weil Vögel aber ein intaktes Gefieder brauchen, hört der Körper vorher auf zu wachsen.“ So die Vermutung der Schwanforscher aus Washington.
(2) In seinem Provinzlexikon „Am Abend mancher Tage“ erzählt der Theologe Joachim Krause von einem unbeabsichtigten Schwan-Experiment: Er hatte mit seinem Sohn an einem See ein kleines Schiff gebastelt, als sie es mit einem weißen Stück Papier als Segel ausstatteten kam von der anderen Seeseite ein Schwan angerauscht, der dort seine brütende Schwänin bewacht hatte. Er hielt das Papier für einen Nebenbuhler. Erst kurz vor dem kleinen Boot erkannte er seinen Irrtum und schwamm beruhigt zurück zum Nest. Joachim Krause wollte es nicht glauben, dass Schwäne derart auf einen weißen Fleck reagieren – und wiederholte das Experiment am nächsten Tag. Prompt kam der Schwan erneut zum Kampf bereit angerauscht.
(3) Letzte Meldung – aus Münster (v. 12.10.09): Seit Anfang 2009 ist Münsters berühmtester Vogel, der Trauerschwan Petra, nun schon verschwunden. Mögliche Hinweise über ihr Schicksal hat es in den vergangenen Monaten viele gegeben, aber der Vogel bleibt verschwunden. Darum hat der Freundeskreis “Schwarze Petra” jetzt beschlossen, sich wieder aufzulösen.
Aus ganz Deutschland haben sich Leute bei dem seit einem Jahr bestehenden Verein gemeldet, die angeblich díe schwarze Petra gesehen haben – allerdings war jeder dieser Tipps falsch. Eigene Nachforschungen liefen ins Leere.
Die kleine Hütte vor der Gaststätte “Zum Himmelreich” soll vorerst stehen bleiben, das für Petra gekaufte Futter im Winter an die Enten und Schwäne auf dem Aasee verfüttert werden. Die noch nicht verwendeteten Mitgliedsbeiträge von 414 Euro spendet der Verein dem Tierheim.
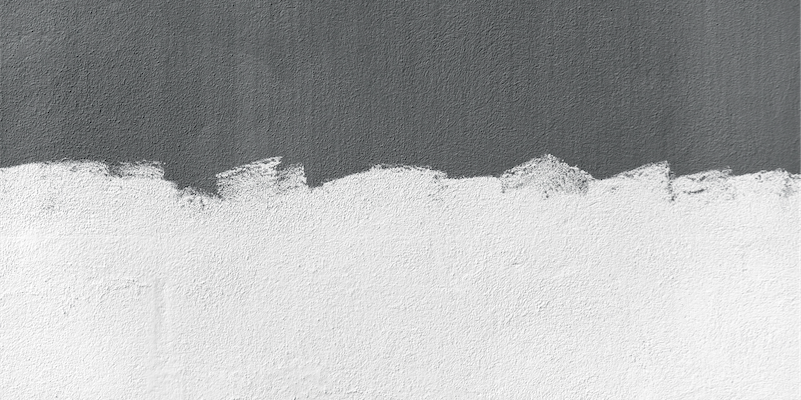



Dass die „Schwarmforschung“ ein Wurmfortsatz des „New Age-Thinking“ ist, erkennt man daran, dass sie jetzt Eingang in den Wissenschaftsbetrieb gefunden hat – als „Soziophysik“. Etwas ganz Reaktionäres.
Statt mit Tarde die ganze Physik, ebenso wie die Chemie, die Astrologie und die Biologie in Soziologie aufgehen zu lassen, machen diese US-Computeridioten genau das Gegenteil: Sie rücken allem Sozialen mit ihren bescheuerten Naturwissenschaften zu Leibe.
Bei Wikipedia und im „Harvard Business Manager“ (sic!) wird bereits lang und breit, d.h. ganz seriös erklärt, was es mit der „Soziophysik“ auf sich hat.