
Sehen-Erkennen-Wissen, wo es lang geht-Poller, photographiert von Peter Grosse
Ein Jahr bevor der Theatererweiterer Christoph Schlingensief an Krebs erkrankte (und darüber dann ein Buch veröffentlichte), drehte Cordula Kablitz-Post einen Dokumentarfilm über das Verhältnis von Leben und Kunst bei Christoph Schlingensief – mit dem Titel „Die Piloten“. In einer Sequenz geht es darum: „Sein Vater liegt ganz real im Sterben. Und auch dies wird in eine mediale Inszenierung überführt: Schlingensieff streichelt in der Talkshow die Hand eines Schauspielers, der seinen Vater darstellt. Nach der Sendung ist er vom Gedanken an den sterbenden Vater, aber auch über den Zynismus seiner Inszenierung zu Tränen erschüttert. Er weint. Ein Moment größter Wahrhaftigkeit. Doch Schlingensief schaut mit verheulten Augen ins Objektiv und sagt: ‚Ja das ist ja jetzt auch Scheiße. Mit der Kamera ist das auch nicht echt‘.“ (Polar, Heft 2/2009 – „Ohne Orte“)
Schlingensief will beides: die Widerspiegelungstheorie sozusagen beim Wort nehmen – bis an ihre Grenze gehen: „Talk to end all talk“ hieß angeblich das „Motto“ des Films. Fast noch „naturalistischer“ (echter) hat das jetzt der schwedische Filmer Patrik Eriksson angepackt – die Trauer. Seine Freundin hat ihn verlassen, er sucht daraufhin krampfhaft – über alle Medien und Möglichkeiten – nach einer neuen – und dabei filmt sich der selbstmitleidige Regisseur seiner selbst mitleidlos: „An Extraordinary Study in Human Degradation“. „Aufrichtig“ nennt die Filmkritik das.

Erst stellte das afro-irische Haus- und Hof-Faktotum (der, der „alles macht“) von „Thompsons Motel“ in Kalifornien einen schwarzen Metallpoller quasi zum Andocken auf und dann noch – zum Anlocken – einen roten Pylon vor die Haustür. Photo: Peter Grosse

So etwas Ähnliches scheint auch dem Wirt dieses Lokals zwischen Düsseldorf, Köln und Wuppertal bei seiner Installation vorgeschwebt zu haben. Photo: Georg Stanitzek
Die Schreiber kennen so etwas auch – wenn sie z.B. in eine sie interessierende Situation geraten sind – und sich dabei ertappen, dass sie bereits mit dem Formulieren, d.h. mit ihrer Verwertung, beschäftigt – und also bereits aus der Situation herausgetreten sind. Dabei hätten die Schreiber das gar nicht nötig, denn anders als beim Film und beim Hörfunk können sie sich auf ihre Erinnerung verlassen, sie müssen keine Bilder oder O-Töne aufnehmen.
Seit den Internet-Foren und der Handy-Photographie bestimmt diese scheinbare Notwendigkeit jedoch immer mehr Situationen, die erst durch den Einsatz dieser Medien zu etwas werden, was wirklich stattgefunden hat. Unweigerlich führt das zu einer „Krise der Wirklichkeit“ – indem die Medien sich an ihre Stelle setzen. Die Illusion ist damit das Reale.
Für Torsten Panne gilt das für den Hochstapler schon lange. Er zitiert dazu „Felix Krull“ aus Thomas Manns gleichnamigen Roman eines Hochstaplers: „Die wirkliche Welt?: ist, in Wahrheit, nur die Karikatur unserer Großn Romane!“ Allerdings ist die allgemeine Medialisierung auch an Pannens Hochstaplern nicht spurlos vorübergegangen. In der neuen zweibändigen Ausgabe von „Kultur & Gespenster“, das dem „Hochstapler“ gewidmet ist, schreibt er: „Der postmoderne Hochstapler ist keiner mehr, weil er sich seiner Täuschung nicht mehr bewusst werden kann. Er ist die Täuschung und sie ist der Kern seiner täglichen Arbeit, sein Material, an dem er sich professionell und verdienstvoll abarbeiten kann.“ Der alte (moderne) Hochstapler nahm – in den bürgerlichen und adligen Kreisen, in die er sich wagte, noch wahr: „Ingeniös beherrschen sie alle relevanten Vokabulare – und ob sich dahinter eine Wirklichkeit verbirgt, ist für sie völlig irrelevant. Sie setzen Realität!“ Für den Hochstapler gilt dagegen: „Die Täuschung muß immer weiter gehen als der Verdacht“ (La Rochefoucauld) – nämlich das Vortäuschen der Zugehörigkeit zu einer höheren sozialen Schicht.
Umgekehrt verfahren die „Tiefstapler“ – eigentlich eine interessantere, aber auch seltenere soziale Spielart, weil sie viel mehr abverlangt: So meinte zum Beispiel der Hochstapler Gert Postel in einem späteren Interview, er „hätte ja nicht die Rolle des Bäckers spielen können,“ weil er dabei sofort aufgeflogen wäre. Aber als falscher Psychiater und Weiterbildungsbeauftragter der Ärztekammer konnte er sich sogar „Krankheitsbegriffe“ ausdenken: „Keiner da traut sich, eine Frage zu stellen.“

Selbst bei so einem „Projekt“ – wie die Möblierung eines Parks – verzichten die modernen Künstler heute nicht mehr auf einen Poller. Photo: Peter Grosse
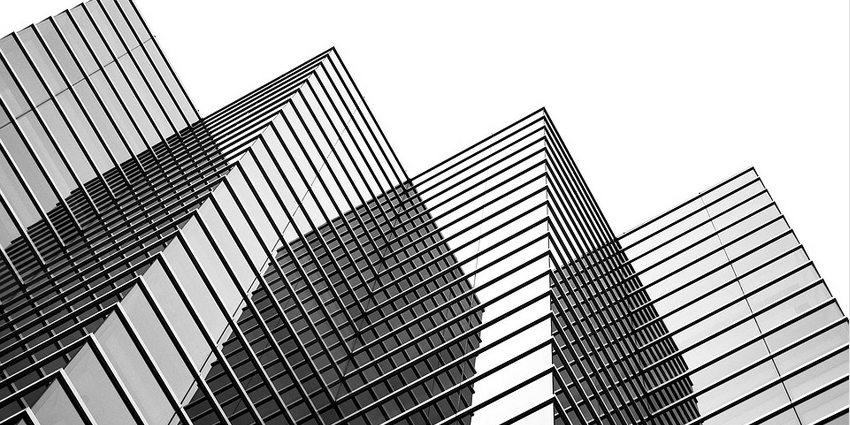



in der taz rezensierte heute David Denk den Arte-Film „So glücklich war ich noch nie“ – über einen Hochstapler:
Für Frank Knöpfel ist die ganze Welt eine Bühne – und er spielt selbst, wenn ihm niemand dabei zuschaut: In der Firma, in der er putzt, setzt er sich eines Abends hinter den Schreibtisch des Chefs, hebt den Telefonhörer ab und ahmt nach, was er beim Chef aufgeschnappt hat. „Da hab ich echt die Hasskappe auf, wenn ich so etwas höre“, ereifert sich Knöpfel gerade, als plötzlich ein Mitarbeiter in der Tür steht. Aus seinen klaren blauen Augen funkelt Knöpfel den Eindringling dermaßen giftig an, dass der sich entschuldigt und kehrtmacht. Er hat die Probe gestört.
Frank Knöpfel ist Trickbetrüger – und in Situationen wie dieser offenbart sich seine Meisterschaft: Die Leute glauben ihm, nehmen ihm einfach alles ab, sogar, dass er der Chef ist, obwohl er nachweislich nur der Putzmann ist. Knöpfel ist ein grandioser Verführer – und ein kranker Mann. Täter und Opfer in Personalunion. Er kann nicht anders. Er ist in seiner Haut gefangen wie in diesem grauen Putzoverall, den er für den Auftritt am Cheftelefon nur bis auf den Hosenbund heruntergezogen hat.
Menschen wie Frank Knöpfel kennt Alexander Adolph gut, 2006 kam sein Dokumentarfilm „Die Hochstapler“ in die Kinos, in dem vier von Knöpfels „Kollegen“ über ihr Leben, ihre Betrügereien und ihre Opfer sprechen. „Die Hochstapler“ war das Debüt des zuvor eher als Drehbuchautor aufgefallenen Adolph als Regisseur, „So glücklich war ich noch nie“ ist sein erster Spielfilm, der Adolph erlaubt zu zeigen, was im Dokumentarfilm nur geschildert werden konnte.
Der Film beginnt mit Knöpfels Entlassung aus dem Gefängnis – und man verrät nicht zu viel, wenn man sagt, dass er dort auch wieder endet. Da er nie gelernt hat, anders zu leben, macht er nach der Haft weiter wie davor, hangelt sich von Rolle zu Rolle wie ein Junkie von Schuss zu Schuss. Wer er wirklich ist, weiß höchstens sein unbedarfter Bruder Peter (Jörg Schüttauf) – und selbst der erinnert sich am liebsten daran, wie Frank ihm mal den Arsch gerettet hat, indem er sich als Schularzt ausgab.
Der Zuschauer ist der Einzige, der Frank Knöpfel nicht auf den Leim geht, Adolph macht ihn von Beginn an zu dessen Komplizen. Schon in der ersten Szene, als er der ihm unbekannten Prostituierten Tanja (Nadja Uhl) ein teures Kleid schenken will, findet man ihn absolut hinreißend und schrecklich seltsam zugleich.
„So glücklich war ich noch nie“ ist ein Schauspielerfilm: Nicht nur wegen der durchweg überzeugenden Leistungen seiner Darsteller, allen voran Nadja Uhl und Devid Striesow, deren Figuren beide in ihrer jeweiligen Welt verhaftet sind, sondern insbesondere weil Striesow sich gewissermaßen selbst spielt oder besser: seinen Beruf. Täuschen, um zu begeistern, ist auch des Schauspielers täglich Brot. Striesow bekommt dafür Preise, Knöpfel geht dafür in den Knast.