
Die Königsfamilie zeigt – sich.
1. Ein „Momentum“ in Moss
Die Salzburger Festspiele, die es seit 1920 gibt und die bis heute immer wieder für Skandale gut sind, gelten als „Mutter aller modernen Sommerspektakel“. Inzwischen gibt es solche „Events“, die Kunst und Tourismus, Sommer und Sonne verbinden, in zigtausend Städten weltweit.
Die am Oslo-Fjord gelegenen Orte um das Hafenstädtchen Moss waren früher Fischerdörfer, dann kamen wohlhabende Bürger aus Oslo zum Baden, von denen immer mehr Sommerhäuser dort erwarben. Zur Unterhaltung luden sie die hauptstädtische Bohème ein, einige blieben, es entstanden hier und da Künstlersiedlungen, wie etwa in Son. Die Fischer verschwanden dagegen langsam, dafür kam aber dann die Mittelschicht und mit ihr der Massentourismus. Heute sind die Yachthäfen alle vollbelegt, in Son eröffnete gerade ein neues Segler-Hotel namens „Quality Spa & Resort“. Dort waren wir – 12 Kunstkritiker aus 13 Ländern – einquartiert. Ein Shuttle brachte uns morgens ins 15 Kilometer entfernte Moss, wo in einer ehemaligen Brauerei im Industriegebiet und in einem ehemaligen Herrenhaus am Meer, der Galerie F15, die 5. Nordische Biennale für zeitgenössische Kunst „Momentum“ in diesem Herbst stattfand. Diesmal unter dem Thema „Favoured Nations“, worunter die Kuratorinnen Lina und Ina zum Einen die vom Schicksal begünstigten skandinavischen Länder begriffen und zum Anderen jene Länder, die ihre Kulturschaffenden besonders begünstigen, einschließlich der aus dem Ausland eingeflogenen Kunstkritiker. Das wußten besonders die aus Island mit ihrer erstmalig abgestürzten Währung und die aus Russland mit ihrem erneut schwächelnden Rubel zu schätzen.
Die nordischen Länder – Dänemark, Faröer, Aland-Inseln, Finnland, Island, Norwegen und Schweden – wollten vor einiger Zeit die Hummel als Hauptelement für ein gemeinsames Wappen wählen. Das hat damit zu tun, wie die Welt die skandinavischen Länder sieht: eine erfolgreiche Wirtschaft, die auf hohen Steuern und hohen Sozialausgaben basiert, so dass es im Ideal weder Reiche noch Arme dort gibt. Einige Biologen haben behauptet, gemäß ihres Gewichts und ihrer Flügelgröße dürfte die Hummel eigentlich nicht so gut fliegen können wie sie es tut. Und einige Ökonomen haben behauptet, die nordischen Staaten dürften mit ihrer sozialen Wirtschaftspolitik eigentlich nicht so erfolgreich sein wie sie es sind. Das hatte diese Staaten bewogen, die Hummel als Wappentier zu wählen. Hinzu kam noch, dass in einigen dieser Länder wegen der langen und kalten Winter die Blüten statt von Bienen fast ausschließlich von Hummeln bestäubt werden.
Zwar hat sich keiner der zur Biennale eingeladenen 31 Künstler direkt mit diesem „Modellorganismus“ beschäftigt, dennoch stand im Mittelpunkt vieler ihrer Arbeiten die „Natur“ – und das entspricht auch der Vorstellung, die man im Ausland von den relativ dünnbesiedelten skandinavischen Ländern hat: Es gibt dort viel Natur, und dazu sogar noch Elfen, Trolle und Nixen… Auch wenn der Sozialstaat im Norden längst nicht mehr das ist, was er einmal war – und die Stiftung „Nordic Institute of Contemporary Art“ (NIFCA), mit der die skandinavischen Künstler derart großzügig gefördert wurden, das man geradezu von einem „Nordic Miracle“ sprach, 2006 aufgelöst wurde. Der Kurator des „Nordischen Pavillons“ auf der Venedig Biennale 2007, René Block, wählte deswegen den Titel „Welfare – Fare Well“.
Hier in Moss ging es nun eher um die „Nordic Region“ – als einen geographischen Raum, den wir jedoch kulturell ins Feld zu führen gewohnt sind. Vom „Licht aus dem Norden“ (mit über 1 Million Interneteintragungen) über das Dankesdenkmal der Berliner Zwingligemeinde für ihren protestantischen Beschützer Gustav Adolf bis zu den „Norwegern“ Kurt Schwitters, Willy Brandt, Hans-Magnus Enzensberger und der „Nordischen Kunst“ der Worpsweder. Die Intelligenz zieht es nach Norden und die Massen in den Süden.
Dieser „Nordismus“ bzw. „Skandinavismus“ ging aus dem „Göthizismus“ hervor: die Goten haben in den nordischen Ländern quasi die Zivilisation erfunden – und von da aus – d.h. von Platons verschwundenem „Atlantis“ aus – bis in den Kaukasus, auf die Krim und nach Italien verbreitet. Die sowjetischen Altertumsforscher hielten dagegen: die Kaukasus- und Krim-Goten, das waren einheimische Stämme – und keine aus Gotland und Göteborg zugewanderten Nordmänner. Nicht so die deutschen Nationalsozialisten, die nach Eroberung des Kaukasus die Krim in „Neugotland“ umbenannten und ganze Suchexpeditionen nach Gotenresten zusammenstellten. Die Nazi-Wissenschaftler waren sich mit Charles Darwin und den skandinavischen Mythomanen einig: Alles Gute bzw. Intelligente kam und kommt aus dem Norden. Erst der norwegische Antifaschist, Anthropologe und Begründer der experimentellen Archäologie Thor Heyerdahl hat dann, gestützt auf Interpretationen gotischer Bibelfragmente, nachzuweisen versucht: Die Goten kamen aus dem Süden.
Ähnlich argumentierte 2004 auch der Bremer Ethnologe Hans Peter Duerr – nach seiner archäologischen Expedition auf der Suche nach dem friesischen „Atlantis“, der untergegangenen reichen Stadt Rungholt: Auch hier – im Wattenmeer – kamen alle zivilisatorischen Scherben aus dem Mittel- bzw. Schwarzen Meer. Weil aber die Friesen, und ebenso die Wikinger, damals schon längst den Handel des fränkischen Reiches bis nach Bagdad erledigten, hat man Duerr – „Heidelberger mit leichter Tendenz zur Toskana“ – wohl zu Recht eine gewisse „Nordland“-Ignoranz vorgeworfen. Neuerdings hat ein Nordfriese, Jan Christophersen, sich des Themas noch einmal, ganz unaufgeregt, angenommen: In seinem Roman „Schneetage“ geht es ebenfalls um Rungholt-Reste im Wattenmeer. Abgesehen von diesen Kulturrelikten und ihren Interpretationen, gibt es auch in der Natur-Erfahrung ein Nord-Süd-Gefälle: „Die kontinentale Beziehung zur Natur kann unerhört intensiv sein, innerlich, schwärmerisch, was man will. Aber man ißt die Natur mit dem Teelöffel, während man es im Norden mit der Kelle tut,“ meinte z.B. Stig Strömholm, Rektor der Universität von Uppsala. Man könnte vielleicht auch sagen: Während man sich im Süden, ab Wien, bei Problemen lärmend auf der Couch wälzt, geht man im Norden schweigend ans Ufer und starrt in das Meer. In einer Erzählung von Torborg Nedreaas, die vom norwegischen Widerstand gegen die deutsche Okkupation handelt, heißt es: „Mitunter kann es den Menschen auch in einer schweren Zeit gut gehen. Der Schmerz ist gut, und der Ernst im Gemüt ist ebenso blank wie der dunkle Fjord“.
Die Kuratoren der Biennale von Moss sprechen heute von „Nordic Brand“ – einem Stil, ein Markenzeichen, einem „problematischen Begriff von nordischer Identität“. Dieser kam bereits dadurch zum Ausdruck, dass sie viele skandinavische Künstler auswählten – die einen Zweitwohnsitz in Berlin haben. Mats Adelman zeigte ein Video über Wälder und dazu handgeschnitzte Vögel, die wie ausgestopft aussehen. Die Natur interessiert ihn als „mythische Kraft,“ heißt es dazu im Katalog. Mit Vögeln beschäftigt sich auch Andreas Eriksson. Der schwedische Künstler bekam vor zehn Jahren eine Elektrosmog-Allergie. Seitdem lebt er auf dem Land – ohne Elektrizität, und geht viel mit seinem Hund spazieren. Die Biennale bestückte er mit einigen „Shots“ von Wäldern, Bäumen und Gestrüpp. Saskia Holmquist filmte eine ruhige Bootsfahrt auf einem kleinen Fluß, und äußerte sich dazu über einige grundsätzliche Fragen. Marthe Thorshaug filmte einen Ausritt mit Islandponies – und tippte dabei die Sage von Ygg an – über eine der überlieferten Erscheinungen von Odin. Salla Tykkä filmte auf der Suche nach Schönheit das nächtliche Erblühen einer Seerose. Die Schönheit in der Eigenwilligkeit suchten dagegen Maja Borg und das Künstlerduo Benjamin Huseby/Lars Laumann mit zwei Filmen über jeweils eine Frau – zwischen Kultur und Natur…
Dazwischen pendelten auch wir – mit Shuttlebus und Fährschiff. Einmal zum Haus von Edvard Munch in Asgardstrand, das heute ein kleines Museum ist. Dann zu zwei üppigen Landvillen, die von reichen Kunstliebhabern zu Hotels ausgebaut wurden, in denen sie ihre Sammlungen – von Munch bis Picasso – auf die Gästezimmer verteilten. Schließlich zu einem Gutshof, auf dem sich eine Reihe von Kunsthandwerkern niedergelassen hat, sowie zum Nationalmuseum für Photographie, das in der ehemaligen Marinekaserne von Horten untergebracht ist. Lauter Umnutzungen. Auch bei einer ehemaligen Zellstofffabrik, wo demnächst das weltweit erste Kraftwerk in Betrieb geht, dessen Turbine von Osmoseprozessen zwischen Süß- und Salzwasser angetrieben wird. Zuletzt schlenderten wir noch über die Fußgängerzone von Moss, in der gerade ein Bürgerfest stattfand und wir von einem Geschäftsführer der staatlichen Alkohol-Handelskette zu einer Aquavit-Verköstigung eingeladen wurden. Die Region ist Norwegens bestes Weizen-Anbaugebiet und der Schnaps schmeckt hervorragend. Abends studierten wir noch rauchenderweise den Mövenflug – von unserer Hotelveranda aus. Vier Tage lang oszillierten wir so quasi ununterbrochen zwischen Kultur und Natur, Festem und Flüssigen, Historischem und Mythischem, Touristischem und Künstlerischem, Überfütterung und Unterforderung, Sonne und Regen. Das aber alles sehr gediegen – norwegisch eben.
Am Anfang und am Ende stand jeweils ein Beitrag des isländischen Künstlers Asmundur Amundsson: In seiner Eröffnungsrede kritisierte er die nordischen Staaten, die Island in diesen schweren Zeit nicht halfen – weil sie dem Land einen Kredit verweigerten. Dabei kam er auch auf die großen nordischen Kulturschaffenden – wie z.B. Knut Hamsun – zu sprechen. Dieser hatte wie Edvard Munch die Bauern und das einfache Leben auf dem Land verherrlicht, dann aber doch auf seinem Hof Hamaröy, der heute ein „Hamsun-Center“ ist, die ganze Arbeit von seiner Frau machen lassen, während er sich in der Osloer Bohème vergnügte. 1940, als die Norweger von den Deutschen überfallen wurden, veröffentlichte Hamsun einen Aufruf: „Norweger! Werft die Gewehre fort und geht wieder nach Hause. Die Deutschen kämpfen für uns.“ Nach dem Krieg erklärte ein Gericht ihn deswegen für geisteskrank. Amundssons letzter Biennale-Beitrag bestand aus ca. 15 blauen Öltonnen, die er im Garten des Herrenhauses (Galerie F15) zu einer 10 Meter hohen Pyramide auftürmte, ähnlich wie man Champagnergläser auf einer Finissage übereinander stellt, um sie dann von oben mit Schaumwein zu füllen. Hier war es jedoch Flüssigbeton, der aus einem dicken Schlauch kam – und dabei den ganzen Rasen versaute. Aber das war beabsichtigt. Er bekam für seine Arbeit, ebenso wie alle anderen Künstler, 10.000 Kronen. Auch wir Kunst- und Kulturkritiker waren nicht billig, außerdem durften wir den blau-weißen Bademantel unseres Spa-Hotels mit nach Hause nehmen.

Nummer 29 zeigt, dass man sich auch auf einem skandinavischen Fährschiff prächtig amüsieren kann.
2. Westschweden
„Erzählen Sie, was Sie gesehen und verstanden haben,“ bat der Dramatiker Heiner Müller vier Schüler des Gymnasiums Bad Freienwalde nach der Aufführung seines Revolutionsstückes „Zement“ 1973. Ich stehe nun vor einer ähnlichen Aufgabe – nach einer Journalistenreise durch Schweden, unter der Führung einer Dame vom westschwedischen Touristenverband, einer weiteren von der deutsch-dänischen Reederei „Scandlines“ und einem jungen Skandinavisten aus einer Lübecker PR-Agentur. Zumal die von ihnen organisierte mehrtägige Überlandtour per Schiff und Kleinbus von Hotspot zu Hotspot durchaus Theaterqualitäten hatte. Nicht selten waren wir, eine Handvoll Journalisten, dabei sogar Teil der Aufführung. Einmal, indem und die Besitzer eines einsamen aber desto vornehmeren Restaurants auf einem Berg und an einem See uns ein besonders gutes Essen, bestehend aus regionalen Zutaten, servierten. Zum anderen, indem z.B. einige leitende Angestellte des Göta-Kanals extra für uns eine Bootsfahrt mit Imbiß auf der „MS Regina“ organisierten, wozu noch ein Kapitän und etliche Studenten gehörten, die, um ihr Stipendium aufzubessern, während der Kanalsaison an den Schleusen Dienst tun – wir aber kamen außerhalb der Saison angeschippert. Vollends Theater wurde uns dann auf der Festung Karlsborg vorgemacht – von einer jungen Führerin in alter Uniform mit echter Schreckschußpistole, deren Schüsse jeweils den nächsten Akt eines Festungsdramas ankündigten, das „live“ nie stattfand: die Abwehr eines russischen Angriffs auf diese Ausweichhauptstadt der Schweden – halben Wegs zwischen Stockholm Göteborg. Als die Festung endlich stand, war sie bereits veraltet, außerdem kamen die Russen nie bis Karlsborg. Wir sahen sie dafür in einem an Statisten reichen Spielfilm des Festungs-Kinos.
Müßte ich diese kurze Reise zusammenfassen, d.h. auf einen Begriff bringen, würde ich von einer spezifisch schwedischen Dialektik zwischen gesellschaftlichem Luxus und privater ABM sprechen. Und dazwischen wie hingemalt lauter reiche Bauernhöfe. Mir schien in Västergötland, Bohuslan und Dalsland, dass die schwedische Reformation, nach der die Bauern mit einer eigenen Interessensvertretung ins Parlament gelangten, der Bevölkerung und des Landes weitaus mehr gebracht hat als die deutsche, die bekanntlich mit einer Niederlage im Bauernkrieg endete. Mit gleich mehreren Schloßbesichtigungen wurden wir auf diesen heroischen Abschnitt der schwedischen Geschichte aufmerksam gemacht. Und all diese prächtigen Barockanlagen waren bis hin zum dazugehörigen Kräutergarten gleichsam staatspädagogisch-ökologisch wertvoll gemacht geworden. Im Endeffekt oder vielmehr im Nebeneffekt kommen dabei dann aktuelle Geschichten wie die heraus, die uns ein Biologielehrer und Hobbylimnologe während eines kurzen Ausflugs mit seiner Yacht über den Vänern – Schwedens größtem See – erzählte: In diesem sensiblen Urlaubsgebiet erschoß kürzlich ein Bauer einen Wolf – und kam dafür sechs Monate ins Gefängnis. Man muß hinzufügen, dass die schwedischen Gefängnisse inzwischen weltweit die „humansten“ sind. Am Marinestandort nahe Karlsborg erzählte mir ein angetrunkener Offizier von seinem lange zurückliegenden geheimen Spionageeinsatz im Raum Leningrad, der fast schief gegangen wäre – und ihn aus der Bahn geworfen habe: Nun genieße er nur noch das Leben. Ich traf ihn nach einem Elchessen vor der Tür des Restaurants „Göta Kanal“ – an einem großen Aschenbecher, dem ungemütlichen Aufenthaltsort der letzten, bedauernswerten schwedischen Raucher. Der Fahrer und Besitzer des Kleinbusses führte ebenfalls eine multiple Existenz – u.a. besaß er als Jazzkritiker eine eigene Webpage. Über einen Berg, an dem wir bei Linköping vorbeifuhren, wußte er zu berichten: „Der ist schon von Linné besungen worden.“ Als wir durch einen Buchenwald fuhren und ein Dorf passierten, bemerkte er: „Hier hat der Großvater von Greta Garbo gelebt.“ In der Porzellanfabrik von Lidköping, der zweitältesten Europas, führte uns eine leicht deprimierte Angestellte durch die 10.000 Stücke umfassende Ausstellung, später erzählte sie, dass man die Produktion nach Malaysia verlegen werde. Die Kanalgesellschaft besitzt eine verlassene Wassermühle, als wir sie passierten, wurde sie gerade von drei einst freien Theatermachern zu einem Hotel mit Minikanal-Erlebnispark umgebaut. Sie bewirtschaften dieses „Norrqvarns Upplevelsland“ quasi auf eigene Rechnung – als eine Art Wir-AG. Ähnlich war auch eine Gruppe von Künstlern beschäftigt, die seit Jahr und Tag das letzte Kanalpostschiff, die „Eric Nordevall“, die 1856 im Vättern-See sank, originalgetreu nachbauen. Eine ganze Holzschiffs-Werft ist daraus inzwischen entstanden – mit Ausbildungsplätzen und Sponsorenvideos. Während die Künstler eher verhalten-optimistisch ihre „Projekte“ präsentierten, gestaltete sich der Auftritt eines deutschstämmigen Volvo-Mitarbeiters und Hobbyhistorikers erneut theatralisch, indem er uns als Mönch verkleidet die alte Quelle zeigte, aus der einst mit einer Königstaufe die schwedische Nation gewissermaßen hervorgesprudelt war. Das Ereignis fand um das Jahr 1000 statt, daneben steht heute eine Kirche – jedoch ohne Dorf drumherum. Dazu erklärte uns der Heimatforscher: Während der Reformator Gustav Vasa 1527 die katholischen Ländereien enteignete und Karl XI. sich 1680 auf die Bauern stützend eine „Adelsreduktion“ durchführte, habe Gustav IV. 1796 das dörfliche Gemeineigentum abgeschafft und das Land neu verteilt, um ökonomisch selbständige Betriebe zu schaffen. Dadurch sei das genossenschaftlich wirtschaftende Dorf aufgelöst und ein Landproletariat geschaffen worden – zugunsten verstreuter Einzelgehöfte. Übrig blieben die Kirchen – und zwischen ihnen heute immer mehr Ferienhäuser von Städtern, die oft und gerne Flagge zeigen, d.h. in ihren Vorgärten die schwedische Fahne hissen und dazu regelmäßig den Rasen mähen. Auch die 120 pro Saison als Schleusenwärter am Göta-Kanal beschäftigten Studenten sind vier Stunden täglich mit dem Mähen des Uferrasens beschäftigt. Aber noch immer seien 75% des schwedischen Territoriums „Blaubeerflächen“, beruhigte mich eine Biologiestudentin.

Der Alte tut wieder so, als würde es da lang gehen.
3. Nils Holgersson nachreisen
Das Schriftstellerehepaar Sabine und Wolfram Schwieder hat ein Reisebuch über Schweden geschrieben, in dem es sich von dem 1906 veröffentlichten Buch Selma Lagerlöfs: „Die wunderbare Reise des kleinen Nils Holgersson“ leiten ließ. Die Nobelpreisträgerin hatte es bereits als eine schwedische Landeskunde für den Schulunterricht verfaßt. Ihre Geschichte beginnt am südlichsten Punkt Schwedens in Schonen, wo ein Junge namens Nils Holgersson auf einem kleinen Bauernhof lebt. Weil er alle Tiere quält, wird er eines Tages in einen Däumling verzaubert. Zusammen mit dem Hausganter Martin gelingt es ihm, sich einer Gruppe von Wildgänsen anzuschließen, die auf dem Weg nach Norden ist. Im Verfolg ihres Fluges lernt der Leser ganz Schweden kennen, mehr noch aber beeindruckt ihn die gegenseitige Hilfe in der Tierwelt, die die Gänseschar unter der Führung der alten erfahrenen Graugans Akka von Kebnekajse unterwegs immer wieder erfährt. Auch Nils Holgersson wird dadurch gewissermaßen geheilt – und zu einem anständigen Menschen umerzogen. Die Reise mit den Gänsen in den Norden ist ein gelungenes sozialpädagogisches Experiment – mit einem schwer erziehbaren Jugendlichen. Ähnlich schickt man heute viele deutsche Neonazis mit dem Flugzeug in Camps nach Sibirien. Als Jugendlicher habe ich dieses Buch wohl zwanzig mal gelesen. Es begründete mein anhaltendes Interesse an Tieren und Pflanzen. Daneben behandelte die feministische Autorin aber in ihrer Reiseerzählung auch soziale Probleme der Menschen. Ich erinnere mich an eine junge bleiche Arbeiterin in der Zündholzfabrik von Jönköpping an den Ufern des Vättern. Als sie die Gänse über die Fabrik fliegen sieht, ruft sie ihnen sehnsüchtig nach: „Nehmt mich mit, nehmt mich mit!“ Jedesmal, wenn ich seitdem Wildgänse am Himmel sehe, muß ich an diese Szene denken. Leider haben die Autoren des Reisebuches auf den Spuren von Nils Holgersson wenig Sinn für Sozialkritik in Schweden entwickelt. Nicht zuletzt deswegen, weil die schwedischen Fremdenverkehrsverbände natürlich nichts Besseres zu tun hatten, als diesen ewigen Weltbestseller der Lagerlöf für sich – und das heißt für den Tourismus – auszuschlachten, um Fakelore daraus zu machen. Nahezu überall, wo die beiden Schriftsteller hinkamen, warteten schon „hervorragende Führer“ in historischen Kostümen und ökologisch aufgeräumten Original-Environments mit weiteren Nils-Holgersson-„Realia“ auf sie. Und es blieb wenig mehr zu tun als festzustellen, dass sich da und dort seit damals nur wenig verändert hat, oder das Selma Lagerlöf sehr genau recherchiert – bzw. sich gut in die Sichtweise der Gänse auf das Land von oben reingedacht hat. Anders als dem Ehepaar Schwieder und dem Regisseur des Films „Nomaden der Lüfte“ z.B. stand ihr dafür kein Flugzeug zur Verfügung.
Die Autoren meinen, dass Selma Lagerlöf „sich nie kritisch über ihr Land äußert – im ‚Nils Holgersson‘,“ der das „Heimatgefühl der jungen Leser stärken“ sollte. Ihr jetziges Reisebuch ist jedoch noch unkritischer – will mir scheinen. So erwähnen sie zwar die Bergbaustadt Kiruna, die wegen der steigenden Stahlpreise immer reicher und größer wird, ebenso auch die Probleme der lappländischen Samen, deren nomadische Lebensweise als Rentierzüchter dadurch gefährdet ist. Aber eigentlich sind diese Samen für sie auch bloß Folklore. Dabei wurde erst kürzlich deren Sprecher Olaf T. Johansson wegen seines Widerstands gegen die Diskriminierung der Samen als „Terrorist“ verhaftet und immer wieder machen Großgrundbesitzer und Jagdpächter den Rentierzüchtern die Weiderechte streitig – weswegen es einen internationalen Aufruf gibt, ein Rentier zu adoptieren, damit die betroffenen Züchter die Gerichtskosten aufbringen können. Nach dem Ersten Weltkrieg bereits hatten die schwedischen Sozialdemokraten ein Gesetz verabschiedet, mit dem den Samen ihre Nationalität aberkannt wurde, sobald sie ihre Rentierherde abschafften. Gerade dazu wurden und werden sie jedoch ständig gedrängt. Im Times Literary Supplement erinnerte Norman Stone gerade daran, dass man die Samen in Schweden noch bis in die Siebzigerjahre sterilisierte, weil sie so kleinwüchsig und immer betrunken waren. Schweden ist entgegen anderslautender Gerüchte alles andere als ein tolerantes Land – für gutbetuchte weiße Mittelschichtstouristen jedoch absolut weltoffen und nahezu perfekt aufgeräumt.

Und hier, da sind Eva und ich am Nordkap.
4. IKEA in Moskau
Unverständlich, warum das Berlinale-„Forum“ diesen Film ablehnte. Obwohl ich zugeben muss, dass er etwas dichter hätte sein können. Egal, die Eröffnung der 153. Ikea-Filiale und dann noch in Moskau – das ist schon eine Dokumentation wert. Dabei hatte Regisseur Michael Chauvistré auch noch ausgesprochenes Glück mit den Mitwirkenden: zwei sehr souveränen Verkäufern aus der alten Spandauer Ikea-Filiale, die einst zur Versorgung Westberlins gebaut worden war. Manuela ist eine Realistin aus dem Osten und Ulf ein sentimentaler Wessi. Bei Ikea-Spandau, Westberlin, lernten sie sich lieben, verließen ihre jeweiligen Partner, setzten ihre Kinder auf E-Mail-Distanz und zogen zusammen. In Chauvistrés Film „Mit Ikea nach Moskau“ bauen sie die Moskauer Filiale mit auf.
Kurz vor dem Eröffnungstag beherrscht die beiden vor allem die bange Frage: Werden genug Kunden kommen? Die deutsch-schwedisch-russische Ikea-Truppe fühlt sich ein wenig wie ein großes Theaterkollektiv vor der Premiere. Die Regale wurden mit Werbegeschenken vollgepackt, eine Tombola organisiert, ein Wachdienst eingerichtet, „Hamburger Reiter“ angemietet usw. Doch die Massen kommen schon Stunden vor der Eröffnung, insgesamt sind es schließlich 37.000 Menschen, die sich da auf dem riesigen Ikea-Parkplatz in klirrender Kälte zu immer neuen Schlangen formieren. Zuletzt hilft sogar der aus Schweden eingeflogene Firmenpatriarch Ingvar Kamprad aus. Auf diese lockere Weise lernt die kleine Kassiererin Manuela den großen Kreator der Ikea-Philosophie persönlich kennen, während Ulf immer noch gekränkt darüber ist, dass man ihn nicht an einer Sitzung teilnehmen ließ, auf der er dem berühmten Mann hätte nahe kommen können.
Das Filmteam folgt einigen Moskauer Ikea-Kunden bis nach Hause, wo sie ihre Schränke, Lampen etc. sofort zusammenbauen und in Gebrauch nehmen. Denn das ist neben allem Gerede vom großartigen Teamgeist der Mitarbeiter, die permanent zusammen Ikea-Lieder singen, der Kern der ganzen Ikea-Philosophie – und ihres Erfolgs. Der US-Wirtschaftsforscher Jeremy Rifkin spricht von einer „schwerelosen Ökonomie“. Gemeint sind damit Firmen, die ihr fixes Kapital, also die Produktionsanlagen, nur pachten bzw. irgendwo und so billig wie möglich produzieren. So ließ Ikea früher viel in der DDR herstellen und jetzt in China. Während seiner Inspektion der Moskauer Ikea-Filiale kommt der Firmengründer Ingvar Kamprad darauf zu sprechen. Vor allem aber liegt ihm die Präsentation seines berühmten Billy-Regals am Herzen, das wahrscheinlich als einziges Ikea-Produkt noch in Schweden gemacht wird: aus handgefällten und dann zerschredderten Fichten.
Eine schwedische Studie über die Zunahme der „schwerelosen Ökonomie“ kommt zu dem Schluss, dass der Anteil des „intellektuellen Kapitals“ der meisten Unternehmen einen fünf- bis 16-mal höheren Börsenwert erreicht als das Sachkapital, von dem Ersteres sich zunehmend abkoppeln. Gleichzeitig werden jedoch auch angehende Intellektuelle bei Ikea als Konsumenten mit der hinterm Horizont verschwundenen Produktion symbolisch wieder versöhnt, indem sie zu Hause ganz alleine, mit einer komischen Gebrauchsanweisung in der Hand, das Halbfertigprodukt zusammenbauen.
Im Grunde hat der alte Schwede das Kunststück fertig gebracht, Leo Tolstoi mit Henry Ford zu vereinen. Dazu kommt nun noch eine Prise Bill Gates, also die verdammte Logistik. Schon am ersten Tag gingen in Moskau die Ikea-Bleistifte aus! Für Momente malte sich bei Dispatcher Ulf das entsetzte Gesicht von General Paulus aus – angesichts der absoluten russischen Weite und Wegelosigkeit. Dabei wurden die deutschen Ikea-Mitarbeiter durchaus komfortabel in Moskau untergebracht, und die schwedischen Mitarbeiter noch komfortabler, etwa mit rundum verspiegeltem Orgien-Bett. Bei Ikea kann man solche Schweinereien zum Zusammenbasteln bis heute noch nicht kaufen!
Das, was die DDR befürchtete zu werden – eine verlängerte Werkbank der Westkonzerne – hat Ikea umgedreht und schon längst realisiert: Der Westkunde wird als Individuum spielerisch zur verlängerten Werkbank des Ostens, von wo die Ikea-Halbfertigprodukte angeliefert werden. Und der halbinformierte Westkunde weiß dies durchaus zu schätzen. Das ist nicht nur eine Frage des Preises. Denn ohnehin werden in der pseudointellektuellen Dienstleistungsgesellschaft von Industrie und Handel immer mehr Reparatur- und Handwerksbetriebe „gelegt“, indem man zunehmend laiengerechtere Halbfertigprodukte anbietet. Bei den Heimwerker- und Baumärkten vergeht kein Tag, an dem nicht ein neues Do-it-yourself-Verfahren angeboten wird. Hierbei kommt Ikea durchaus die Rolle der Avantgarde zu, indem es die Produktionslinie konsequent bis zum Kunden verlängert hat.
Eines der neuen Probleme, die dabei auftreten, besteht in der „Gebrauchsanweisung“. Als Prä-Ikea-Mensch lese ich so etwas nicht: Lieber nehme ich in Kauf, dass zum Beispiel meine Cracker irgendwann lappig oder pappig schmecken, als dass ich bei ihrer Verpackung nach Gebrauch die Laschen A und B wieder mit dem Schlitz C vereinige. Die Push-Button-Generation ist aber bereits anders „programmiert“: Es gibt inzwischen jede Menge junge Konsumenten, die nichts anderes als Gebrauchsanweisungen lesen – und im Internet kommunizieren. Das trägt natürlich zu deren Verbesserung bei, wie andererseits auch die Tendenz, sich mehr Mühe beim Verfassen von Gebrauchanweisungen in den diversen Sprachen zu geben. Die Exportnation BRD zum Beispiel bietet inzwischen in Kooperation mit großen Konzernen (u. a. Siemens) arbeitslosen Journalisten und Akademikern Umschulungen zu „Gebrauchsanweisungs-Redakteuren“ an.
Das führt dazu, dass die Do-it-yourself-Idee längst nicht mehr auf Hausausbau, Kachel- oder Klempnerarbeiten beschränkt ist. Bei den Elektronikgroßmärkten kann man sich bereits mit Hightech-Teilen eindecken, um sich seine eigenen Rechner, CD-Brenner und Drucker zu bauen. Der Tag ist nicht mehr fern, da die meisten Autofabriken, die ja nur noch mit vorgefertigten Teilen produzieren, schließen werden, weil man als Autokäufer sich einfach ein Paket zusammenstellen kann – und sich das Auto dann zu Hause in der Garage in Form wieder „voneinander unabhängig betriebener Privatarbeit“ (Marx) zusammenbaut.
Dass dieses Verfahren dem Holz-Kapital Schwedens einfiel, ist nicht zufällig, denn dort erheischte der proliferierte Sozialstaat geradezu solche „produktiven“ Freizeitbeschäftigungen für seine Bürger. Gesamtgesellschaftlich gesehen finden die von der Arbeit entsetzten Massen damit erneut Anschluss an die gesellschaftlichen Produktionsprozesse. Ikea ist damit eine privatwirtschaftliche AB-Maßnahme von fast schon globalem Ausmaß. Man könnte auch von einem Branchenfaschismus sprechen – wenn man sich noch der Nazi-Arbeitskampfparole „Massenkonjunktur – nicht Lohnkonjunktur!“ erinnert. Wegen der teuren Arbeitskraft sind in Schweden inzwischen auch schon viele Dienstleistungen auf die Kunden übertragen worden: So muß man sich z.B. in vielen Lokalen selbst bedienen.
Bei diesem isländischen Thulebasalt sieht man hier ganz deutlich die Neigung gegen die aktive Riftzone.
5. Hummeln auf Island
Was uns als erstes in Reykjavik auffiel, waren die Hummeln (Bumblebees): die Heckenrosen und andere blühende Sträucher waren voll von Hummeln. Wir sahen weder Bienen noch Wespen noch Schmetterlinge noch irgendwelche Fliegen – nur Hummeln in rauhen Mengen. Es gibt sie hier erst seit den Siebzigerjahren, wurde uns gesagt, eine Blitzrecherche im Internetcafé ergab jedoch: Es gibt drei Arten von Hummeln auf Island, eine – Bombus jonellus – bereits seit den Anfängen der Besiedlung der Insel (durch die Wikinger Anfang des 9. Jhds.). Die anderen beiden Arten – Bombus lucorum und Bombus hortornum – gelangten erst später mit Frachtschiffen nach Island. Es genügt ja bereits eine einzige Hummel, um eine Population zu begründen. Unser einheimischer Informant hatte die Hummel-Besiedlungsgeschichte wahrscheinlich mit der der Wespen verwechselt, deren Vorkommen aus Island in der Tat erst seit den Siebzigerjahren nachgewiesen ist. Von ihnen leben ebenfalls drei Arten auf der Insel, am häufigsten soll Dolichovespula norvegica sein. Wir fanden jedoch keine einzige Wespe in den Parkanlagen von Reykjavik und Umgebung.
“Und wie sieht es mit den Bienen auf Island aus?” fragten wir Kaminers dortigen Lektor Kristjan Bjarki Jonasson, dessen Vater Landwirt ist – er züchtet Pferde und Schafe. “Nicht gut,” meint er, “es gibt sie zwar, aber sie geben eigentlich keinen Honig, sie sind nur zum Bestäuben der Blütenpflanzen da.” Die Bienenexperimente auf Island begannen in den Dreißigerjahren, als man einige Völker aus Norwegen importierte. Sie produzierten zwar 10 kg Honig in einer Saison, überlebten den langen und harten isländischen Winter jedoch nicht. Anfang der Fünfzigerjahre versuchte es eine Australierin in Reykjavik noch einmal – wieder mit norwegischen Bienen. Diesmal waren es ihre Nachbarn, die sie zwangen, die Bienen wieder abzuschaffen. Seit 1975 bis heute wird immer wieder versucht, aus Norwegen und Schweden importierte Völker auf Island heimisch werden zu lassen, wobei man auch mit verschiedenen Standorten experimentiert. Sie produzieren auch Honig, zwischen 10 und 15 kg, aber die meisten Völker überleben den Winter noch immer nicht und sie werden auf Island sehr aggressiv. Wahrscheinlich, weil sie sauer sind, dass man sie an einen Ort verschleppt hat, wo sie mittelfristig keine Überlebenschance haben (Bienen planen sehr langfristig). Aber die Isländische Imkervereinigung (BY) gibt nicht auf, jedes Jahr werden neue Völker eingeführt. Ihnen kommt natürlich die globale Erwärmung entgegen.
Man hat gesagt, England habe seinen Reichtum den Hummeln zu verdanken. Das muß man wohl so verstehen, dass die Hummeln vornehmlich die Kleeblüten bestäuben, und der Klee ist wiederum Nahrungsgrundlage für die Schafe. Bei der Beziehung zwischen Klee und Hummeln kann man geradezu von einer Symbiose sprechen, die französischen Marxisten Gilles Deleuze und Felix Guattari haben daraus ein ganzes Lebens- und Beziehungsmodell gemacht: “Werdet wie die Hummel und der Klee!”.
Die Hummel gehört zu den Stechimmen (Aculeata), bildet jedoch im Gegensatz zu den Bienen nur so genannte Sommerstaaten. Dazu muß die Königin, wenn sie im Frühjahr erwacht ihre ersten Waben selber bauen und auch ihre Brut erst einmal selber füttern – mit Pollen. Dann übernehmen jedoch die von ihr großgezogenen Töchter (Arbeiterinnen) alle weiteren “Pflichten” wie Nestbau, Brutpflege und Nestverteidigung. Je nach Art leben schließlich 50 bis 500 Hummeln in einem Nest. In Deutschland gibt es rund 30 Arten, wobei einige vom Aussterben bedroht sind. Im Sommer fängt die Königin an, unbefruchtete Eier zu legen, aus denen männliche Hummeln (Drohnen) werden, zudem werden aus einigen befruchteten Eiern Königinnen gezogen, indem die Larven eine besondere Nahrung bekommen – so nimmt man jedenfalls in Analogie zu den Bienenköniginnen an.
Diese “Vollweibchen” verpaaren sich auf alle Fälle im Spätsommer und suchen sich dann Erdlöcher, in denen sie überwintern. Das restliche Volk stirbt dagegen ab, inklusive der Männchen und der alten Königin. Es gibt hier also keine (tödlichen) Kämpfe wie bei den Bienen, sondern das kälter werdende Wetter übernimmt diese langsame Auslöschung – je nach Art geschieht das zwischen Ende August und Oktober. Das Nest wird im darauffolgenden Jahr auch nicht wiederbesiedelt, es zerfällt.
“In Island gibt es Jahre, da man nach besonders langen und harten Wintern keine Hummeln mehr sieht, aber dann sind sie plötzlich doch wieder da,” so unser Informant Kristjan Bjarki Jonasson. Hinzugefügt sei, dass die Insel früher stark bewaldet war, aber dem Schiffs- und Hausbau sowie auch den Heiz- und Räucheröfen fielen nach und nach fast alle Bäume zum Opfer, hinzu kam noch eine Überweidung durch zu viele Schafe. Dieser Verwüstungsprozeß ist jedoch seit Jahrzehnten rückläufig: Erst einmal werden jährlich 8 Millionen neue Bäume auf der Insel gepflanzt und zum anderen gibt es auch immer weniger Schafe – wird die Landwirtschaft überhaupt immer weniger wichtig für die isländische Wirtschaft. Beides kommt den Hummeln zugute – und damit auch den Überlebenschancen ihrer Königinnen selbst in langen und harten Wintern. Und dies trägt wiederum entscheidend zur Vermehrung der isländischen Pflanzenwelt bei:
“Hummeln sind ausgezeichnete Bestäuber, die durch ihre lange Zunge und das so genannte Vibrationssammeln besonders gut tiefe Blüten bestäuben können. Sie werden daher inzwischen rund um das Jahr für die Bestäubung im Gewächshaus gezüchtet. Allerdings haben sie auch zahlreiche Gegenspieler. So gibt es Kuckuckshummeln (Gattung Psithyrus) die die Nester ihrer Verwandten übernehmen und ihren Nachwuchs von den Arbeiterinnen aufziehen lassen. Der schlimmste Gegenspieler ist jedoch die moderne Landwirtschaft: Das Abmähen blühender Flächen, Insektizideinsatz und Monokulturen haben gerade im ländlichen Raum zu einem dramatischen Artensterben geführt, so dass sich viele Hummelarten inzwischen auf der Roten Liste der bedrohten Tierarten finden lassen,” schreibt der Bund für Naturschutz (NABU), der die Steinhummel zum “Insekt des Jahres 2005″ erklärte.
Abschließend sei noch die aufgrund eines untermeerischen Vulkanausbruchs 1963 aus dem Atlantik aufgetauchte Insel Surtsey südlich von Island erwähnt. Dort befinden sich heute nur einige Forschungsstationen, die Insel darf nämlich bloß zu wissenschaftlichen Zwecken betreten werden, sie soll in die Liste des UNESCO-Welterbes aufgenommen werden. Bereits zwei Jahre nachdem Surtsey aus dem Wasser aufgetaucht war (der höchste Punkt ist 154 Meter hoch), siedelten sich dort Moose und Flechten an (Flechten sind eine Symbiose aus Pilz und Alge), zunächst vor allem in der Nähe des Austritts von heißem Dampf aus der Erde. Ab 1970 gab es auf Surtsey schon die ersten höher entwickelten Pflanzen wie Meersenf, Strandhafer, Salzmiere und Austernpflanzen. Die Wissenschaftler schätzen, dass 75% der Gefäßpflanzenarten von Vögeln dort hingebracht wurden, 14% durch den Wind und 1% über die Meeresströmung. Aber erst nachdem sich Vögel dort niedergelassen hatten, stieg die Qualität des Bodens und gediehen die höher entwickelten Pflanzen. Umgekehrt ist jedoch auch das Wachstum der Vogelpopulationen auf der Insel von den Pflanzen dort abhängig.
1998 wurde der erste Busch auf der Insel entdeckt – eine Weidenart. Bis jetzt hat man über 60 Pflanzenspezies dort identifizieren können, jedes Jahr erreichen zwei bis fünf neue Arten die Insel. 1966 nisteten die ersten Vögel (der Eissturmvogel und die Trottellumme) auf Surtsey. Seit 1986 gibt es eine Seemöwenkolonie auf Dauer dort. 1999 waren es schon 300 Paare, die aufgrund ihrer Anzahl einen großen Einfluß auf das Pflanzenleben der Insel hatte. 2004 nisteten die ersten Papageientaucher auf der in etwa 100 Jahren wahrscheinlich wieder verschwundenen Vulkaninsel.
Wie der Biologe Cord Riechelmann im selben Jahr an der Nordspitze Irlands herausfand, ist die dortige Papageientaucher-Kolonie auf der Suche nach neuen Lebensräumen. Papageientaucher leben vorwiegend von Sandaalen und diese verschwinden langsam wegen der Meereserwärmung an den Rändern des Atlantiks – in Irland, Schottland und Norwegen. Auf den Brutfelsen von Rathlin Island, so beobachtete Cord Riechelmann, konnten die Papageientaucher schon kaum noch Jungen großziehen. Und nicht nur dort:
“Disaster at sea: global warming hits UK birds” – die globale Erwärmung trifft britische Vögel, titelte z.B. eine englische Zeitung: “Was der Independent berichtet, ist tatsächlich ein Desaster. Auf den Orkney- und Shetland-Inseln im Norden Großbritanniens hat kaum ein Seevogel in diesem Jahr Junge großgezogen. Von den 16.200 Paaren der Dreizehenmöwe, die auf Shetland in Kolonien in den Felsen brüten, war der Bruterfolg nahezu null. Die 1.200 Paare von Trottellummen im Süden Shetlands nahe den Klippen von Sumburgh Head haben nicht ein einziges Küken großgezogen. Während die 6.800 Skua-Pärchen von Shetland gerade einmal zehn Küken zur Flugreife brachten. Die katastrophalen Zahlen für den Nachwuchs sehen für Gryllteisten, Küstenseeschwalben und Tordalke nicht viel anders aus. Unsicher sind nur die Nachwuchswerte für die Papageientaucher, was daran liegt, dass die Vögel in Höhlen brüten, in denen man weder die Eier noch die Jungen zählen kann.
Zum Zeitpunkt des Independent-Artikels waren die Jungen noch nicht ausgeflogen, beziehungsweise hatten sich die ‘Puffins’ noch nicht zum Abflug versammelt, eine Zählung war also noch nicht möglich. Man kann aber davon ausgehen, dass die Werte nicht viel anders ausfallen werden als bei den bereits erwähnten Arten. Denn auch Papageientaucher ernähren sich von kleinen Fischen, in der Hauptsache von den kleinen schlanken Sandaalen. Und damit ist man den Ursachen der Katastrophe schon ziemlich nahe.
Sandaallarven benötigen bestimmte Wassertemperaturen, um zu überleben. Die Population der Fische ist in den letzten Jahren im Meer um die nordbritischen Inseln stetig zurückgegangen, und das in Abhängigkeit von der langsam wärmer werdenden Nordsee. In diesem Jahr sind sie allerdings das erste Mal ganz ausgeblieben. Experten wie der Leiter der Royal Society in Shetland, Peter Ellis, sehen eine direkte Verbindung zwischen der Erwärmung der Nordsee um zwei Grad in den vergangenen zwanzig Jahren und der Vernichtung der Sandaalpopulation. Mit dem wärmer werdenden Wasser verändert sich die Planktonzusammensetzung und damit die Nahrungsgrundlage für die Folgekonsumenten in der ansteigenden Nahrungskette. Seevögel, die sich von Sandaalen ernähren, müssen längere Wege zurücklegen, um die nötige Nahrung zu finden. Reicht es nur noch für die Selbsterhaltung, brüten sie nicht mehr oder lassen ihre Brut verhungern.”
Zurück zur Entwicklung von Flora und Fauna auf der isländischen Vulkaninsel Surtsey: Dort tauchten nach und nach erst einmal immer mehr Zugvögel auf: Singschwäne, Gänse und Raben z.B.. Die Felsen liegen zwar abseits ihrer üblichen Zugrouten, aber wegen der sich dort entfaltenden Vegetation lohnt sich für immer mehr Arten der Umweg. Dies gilt inzwischen für insgesamt 89 verschiedene Arten. Robben wurden schon bald nach der Entstehung von Surtsey entdeckt, 1983 wurden die ersten Kegelrobben und Seehunde mit Nachkommen, zunächst in dem der Erosion weniger ausgesetzten Nordteil der Insel, beobachtet. Die Anwesenheit der Robben zog wiederum ihren Freßfeind, den Großen Schwertwal, in die Gewässer um Surtsey.
Die ersten Insekten, die sich dort niederließen, waren Fluginsekten, später erreichten auch einige Insekten auf Treibholz sowie über lebende und tote Tiere die Insel. 1975 wurden die ersten Springschwänze registriert, 1993 die ersten Regenwürmer bei Bodenproben entdeckt, Schnecken gibt es dort seit 1998, daneben haben sich auch Spinnen und Käfer angesiedelt. Insgesamt gibt es nun rund 133 Fliegenarten, 62 Milbenarten, 19 Schmetterlingsarten, 10 Spinnenarten, 5 Käferarten und 2 Wurmarten auf Surtsey und außerdem – Hummeln!

Kuck, es ist schon elf durch. Hier im Norden wird es nicht so schnell dunkel.
6. Schach auf Island
Man denkt immer, Russland sei das Land der Schachspieler, Island ist es jedoch noch viel mehr. Die Isländer spielen sogar Schach auf einem schwimmenden Brett in der Blauen Lagune, einer Badeanstalt, die von einem Geysir gespeist wird. In dem dazugehörigen Hotel logiert nebenbeibemerkt Milan Kundera oft und gerne. Die Isländer wundern sich darüber, denn ringsherum gibt es dort nur Lavawüste.
Der Literaturwissenschaftler George Steiner schrieb einmal ein Buch über das Weltmeisterschafts-Schachspiel 1972 Bobby Fisher gegen Boris Spasski – in Rejkjavik. Dort beschäftigte er sich auch mit der Schachleidenschaft der Isländer, in deren nordischen Mythen das Spiel sogar schon erwähnt sein soll. Noch heute wird das Schachspielen in der Schule gefördert.
Bobby Fisher trat nach der Wende noch einmal gegen Spasski an – in Belgrad. Damals hatten die Amis gerade ein Handelsembargo gegen Jugoslawien/Serbien verhängt – und Fisher mußte sich deswegen nach dem Spiel vor einem US-Gericht verantworten. Er zog es jedoch vor, erst in Jugoslawien unter zu tauchen und dann nach Japan zu ziehen, wo er seine jetzige Frau kennen lernte und heiratete. Als er ausgelifert werden sollte, bot Island ihm Asyl an. Und dort ist er nun. Er lebt im Zentrum von Rejkjavik, hat einen Bart und ein großes Handy am Gürtel und sitzt fast jeden Tag vor der Tür des größten isländischen Antiquariats an einem kleinen Tisch – und spielt mit jemandem Schach. Vielleicht auch mit sich alleine.
Spasski hatte sich einmal beklagt, dass Fisher ihn gänzlich ignoriert hätte, George Steiner erklärte das damit, dass Bobby Fisher als Vierjähriger bereits ein Schachspiel geschenkt bekam von seiner Mutter, die mit der Erziehung seiner Brüder überfordert war und wollte, dass er sich allein beschäftigte. Anhand der Gebrauchsanweisung brachte Bobby sich die Schachregeln bei. Und erst mit sieben entdeckte er, dass man Schach auch zu zweit spielen kann, als er einmal in einem Park Schachspielern zusah.
P.S.: Bobby Fischer starb am 17.1. 2008

Ich? Ich hab noch nie gegen ihn verloren!
7. Der norwegische Widerstand
Die Kopenhagener Hippiekolonie Christiania wurde Anfang der Neunzigerjahre noch einmal wieder internationalistisch. Im dortigen „Russlandhaus“, wo man oft und gerne zusammen saß, kam es 1994 zu folgendem Streitgespräch, nachdem der Finne Mikko sich gegenüber einem Amerikaner namens Alan abfällig über die US-Mickymauskultur geäußert hatte: „‚Ihr Finnen seid doch alle Nazis gewesen‘, erwiderte Alan, ‚mein Großvater hat im Zweiten Weltkrieg fünfzehn Nazis umgebracht, darunter waren bestimmt ein paar Finnen!‘ ‚Und mein Opa hat zwanzig Amerikaner umgebracht‘, brachte sich die Deutsche Carlotta ins Gespräch. ‚Zwanzig!‘ Dabei zeigte sie ihre zehn Finger. ‚Mein Opa dagegen‘, brüstete sich Laszlo, ‚hat acht Deutsche, zwölf Rumänen, fünf Russen und eine Unzahl Engländer umgebracht‘. ‚War dein Opa etwa ein Massenmörder? Auf welcher Seite hat er denn gekämpft?‘ wunderten sich einige in der Runde. ‚Ungarn hat die Seiten gewechselt, 1943-44, und mein Opa sogar mehrmals,‘ erklärte Laszlo. ‚Mein Großvater war ein Pazifist‘, sagte Detlev aus Deutschland. ‚Er hat niemanden umgebracht, aber er saß nach dem Krieg trotzdem lange Zeit im Knast‘. ‚Und mein Opa hätte einmal beinahe meine Oma umgebracht, das war aber noch vor dem Krieg,‘ erzählte der Finne. ‚Mein Opa hat als Kavallerist auch haufenweise Menschen umgebracht,‘ trug ich das meinige zum Gespräch bei. ‚Meiner doch auch,‘ fügte mein Kumpel Andrej hinzu.“
Diese Passage las Wladimir Kaminer neulich in Oslo, das einstmals Christiania hieß, zwei mal vor – das Publikum lachte und applaudierte: Einmal im Goethe-Institut und dann bei einem Empfang des Verlags Damm & Son, der gerade sein Buch „Die Reise nach Trulala“ auf Norwegisch veröffentlicht hatte.
In vielen Ländern beschäftigen sich derzeit die Enkel mit der Frage, ob Opa wirklich in Ordnung war, was in Italien und Frankreich, vor allem aber in Polen, im Baltikum, in der Ukraine und in den jugoslawischen Nachfolgestaaten fast schon zu einer Umwertung des einstigen Widerstands geführt hat. In Spanien wurde das Buch über einen Falangisten: „Soldaten von Salamis“ von Jaiver Cercas berühmt, in Japan der Landser-Roman „Mister Aufziehvogel“ von Murakami Haruki und in Ostdeutschland schrieb Annette Leo ein Buch über ihren kommunistischen Großvater. In Westdeutschland neuerdings Stephan Wackwitz: „Ein unsichtbares Land“, Thomas Medicus: „In den Augen meines Großvaters“ und „Opa war kein Nazi – Nationalsozialismus und Holocaust im Familiengedächtnis“ von H.Welzer, S. Moller und K. Tschuggnall. Bei all diesen Büchern handelt es sich um Enkel-Recherchen.
In Norwegen erschien gerade ein Roman von Astrid Nordang: „Svart Honning“, in dem es darum geht, dass die Protagonistin, die ihren Großvater bislang immer für einen heroischen Widerstandskämpfer hielt, bereits bei ihren ersten Nachforschungen herausbekommt, dass er doch wohl eher ein übler Kollaborateur der Deutschen gewesen ist. Der Roman „Nattradioen“ von Kjetil Brottveit spielt vornehmlich im Norwegischen Widerstandsmuseum in Oslo, an dessen Außenmauer 1945 Quisling und eine Reihe anderer Kollaborateure erschossen wurden. Eine junge Radioreporterin verschlägt es in dieses für sie nur noch gruftige Museum, dessen Einrichtung seit den Fünfzigerjahren nicht mehr verändert wurde. Zunächst ist sie erstaunt: Warum hat man uns nie was über diese Zeit erzählt?! Dann muß sie sich jedoch eingestehen, dass sie sich auch nie dafür interessiert hat. Und das soll sich nun ändern.
Mir erzählte ein kurz nach dem Krieg geborener norwegischer Historiker, dass fast ihre ganze Vätergeneration sich als Widerstandskämpfer begriff und sie mit derart vielen heroischen Familiengeschichten traktiert wurden, dass sie irgendwann niemand mehr hören konnte und wollte. Obwohl oder weil auch diese norwegische Nachkriegs-Generation dann anfing, sich – ausgehend vom Vietnamkriegsprotest – mit den Befreiungsbewegungen in der Dritten Welt zu solidarisieren und dabei langsam zu eigenen Widerstandsaktionen fand. Im Februar 1969 wurde dazu die maoistische Zeitung „Klassekampen“ gegründet, sie veröffentlichte jetzt ein Porträt von Kaminer. In der „Neuen Rundschau“ wurde andersherum gerade die Erzählung „Vietnam. Donnerstag“ des Norwegers Johan Harstad veröffentlicht („Er“ verbindet mit dem Wort Vietnam „Reisfelder, Dschungel, Hubschrauber“. „Sie sagt: Vietnam steht für alles, was schief gegangen ist“). Ein früherer „Klassekampen“-Autor erzählte mir: „Ich fand das gute Gewissen meiner Elterngeneration, resultierend aus ihrem Antifaschismus, immer selbstgerecht und zum Kotzen.“ Seit etlichen Jahren beschäftigt er sich jedoch nun selbst mit dieser Zeit, wobei es ihm vor allem die „Quislinge“ – Kollaborateure – angetan haben.
Auch von deutscher Seite aus aus lassen sich inzwischen einige norwegische Widerstandsgeschichten zurechtrücken: So setzt sich z.B. trotz aller neuen Willy Brandt-Biographien langsam die Erkenntnis durch, dass der Auf- und Ausbau der norwegischen Exil-Organisationen nicht so sehr ihm, der dort laut Sigrud Evensmo „mehr Norweger als die meisten Norweger“ wurde, sondern seiner damaligen Gefährtin Gertrud Meyer zu verdanken ist. Die junge Lübecker Karstadtverkäuferin war aufgrund ihrer Aktivitäten in der Sozialistischen Arbeiterjugend für fünf Wochen in Gestapo-Haft gekommen – und dann im Juni 1933 nach ihrer Freilassung Willy Brandt ins norwegische Exil gefolgt. Im Gegensatz zu ihm, der dort von Unterstützung lebte, fand sie relativ schnell einen Job als Putzfrau. Wenig später wurde sie schon vom Psychoanalytiker Otto Fenichel als Sekretärin angestellt und wechselte dann in das Institut von Wilhelm Reich über, für den sie im August 1939 die Übersiedlung von Oslo nach New York vorbereitete, wohin sie bei Kriegsausbruch auch Willy Brandt einlud. Nach dem Krieg kehrte sie nach Oslo zurück – man hörte dann aber nie wieder etwas von ihr. Bis zu ihrer Abreise nach New York war sie neben ihrer Sekretärinnenarbeit auch in Norwegen politisch sehr aktiv gewesen. Der Brandt-Biograph Einhart Lorenz meint, dass ihre „Rolle leider stark unterbewertet“ wurde, dazu schreibt er: „Sie führte die Korrespondenz mit der Auslandszentrale der Sozialistischen Arbeiterpartei (SAP) in Paris. Sie wurde Vorsitzende der SAP-Gruppe Oslo und Leiterin der Antifaschistischen Emigrantengemeinschaft in Oslo. Sie leitete Studienkurse und Arbeitsgruppen in der Unterorganisation ‚Frihet‘ der Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF) und im traditionsreichen Osloer Arbeiterverein (Arbeidersamfund). Sie nahm an Konferenzen der skandinavischen SAP-Gruppen teil, an der ‚Kattowitzer Konferenz‘ der SAP zu Beginn des Jahres 1937 und an Sitzungen der erweiterten Auslandszentrale der SAP in Paris. Und die setzte ihr Leben im Kampf gegen den Faschismus ein, als sie mehrere Male mit illegalem Material nach Deutschland reiste“. Das ermöglichte ihr ein norwegischer Paß, den sie nach ihrer Scheinheirat mit Gunnar Gaasland aus der „Mot Dag“-Gruppe bekommen hatte. Gaasland gab seinen eigenen Paß später Willy Brandt, der damit für drei Monate nach Berlin fuhr, wo er klandestin Kontakte knüpfte und in der Staatsbibliothek den Faschismus anhand der Bücher von Rosenberg, Darré u.a. studierte. Außerdem reiste er mit dem falschen Pass – während des spanischen Bürgerkriegs – zur SAP-Bruderpartei, der POUM, nach Barcelona, wo er u.a. für Wilhelm Reich Berichte über die Sexualität und Kampfmoral der spanischen Jugend verfaßte, die bei ihrer Veröffentlichung in Spanien 2002 (!) auf großes Interesse bei der dortigen Enkel-Generation stießen. Gertrud Meyer, die ihn auch zu der Zeit noch „finanziell über Wasser hielt“, wie Christian Semler in einer Vorbemerkung schrieb, hatte ihn dazu beauftragt. Sie war auch die einzige, die mit ihm während seines Aufenthalts in Spanien brieflich in Kontakt blieb. In seinem bereits im schwedischen Exil 1942 veröffentlichten Partisanenhandbuch „Guerilla Krig“, das heute nebenbeibemerkt in der Buchhandlung des Berliner Willy-Brandt-Hauses 800 Euro kostet, hat Brandt u.a. auch die Erfahrungen Gertrud Meyers in der illegalen Organisationstätigkeit eingearbeitet. Viele Freunde hielten die beiden für ein Ehepaar, weil sie den gleichen Nachnamen benutzten.
Der ehemalige Angestellte einer Lübecker Schiffsmaklerei, Brandt, entfaltete im Exil neben seinen politischen Kungeleien eine rege publizistische Aktivität – bis dahin, dass er zuletzt die Pressestelle der NAP in Stockholm leitete. 1935 organisierte er eine regelrechte Pressekampagne für den im KZ inhaftierten Carl von Ossietzky, der als Kandidat für den in Oslo vergebenen Friedensnobelpreis vorgeschlagen worden war. Im Zusammenhang damit legte Willy Brandt sich mit dem norwegischen Nobelpreisträger Knut Hamsun an, der als Nazisympathisant gegen die Verleihung des Preises an Ossietzky polemisierte. In Norwegen geht man heute davon aus, dass Hamsuns Frau eigentlich die viel schlimmere „Nazisse“ war. Dazu hat zuletzt Klaus Theweleit Erhellendes beigesteuert. Nach ihm hatte der alte nordische Dichterkönig die junge Schauspielerin Marie Andersen, die er in einem Theatercafé kennen lernte (sie sollte in einem Hamsunstück die Hauptrolle spielen), dazu gebracht, ihn stattdessen zu heiraten, auf einem einsamen Hof jenseits des Polarkreises auf einer Halbinsel als Bäuerin zu leben und dort seine Kinder groß zu ziehen: „Sie sollte sich also opfern“, schreibt Theweleit, während der Mann – in einer Pension sitzend „Segen der Erde“ schrieb, „die Hymne auf das karge Nordland mit seinen gequälten Leuten, die ihm den Nobelpreis einbringt“. Zwar versprach Hamsun daraufhin seiner Frau, dass sie bald wieder in die Stadt – in „eine Luxusvilla“ gar – ziehen würden, stattdessen kaufte er ihr jedoch einen noch „größeren Hof“, wo er sich noch seltener blicken ließ, weil er in Oslo Anschluß an die „Weltliteratur“ gefunden hatte – und dort im „Gauklermilieu“ – der „Bohème“ verkehrte. Von seiner Frau verlangte er, dass sie weiterhin der „Bühne/Öffentlichkeit“ fern blieb. Nach einer gelungenen Psychoanalyse – wegen einer Schreibblockade 1926, bringt er auch Marie Andersen dazu, sich ebenfalls auf die Couch zu legen, beim selben Analytiker – damit sie „sexuell aufwache“. Dort leistet sie jedoch erfolgreich Widerstand. Schließlich trennen sich die beiden. Sie rächt sich später, in dem sie des deutschen Führers „erste Braut“ in Norwegen wird. Zwar konnte Hamsun dann aufholen, in dem er Goebbels während einer Deutschlandreise seinen Nobelpreis vermachte, aber in der Öffentlichkeit ist sie fortan die dominierende. Zu Ossietzky erklärte Hamsun öffentlich, dass er in einem deutschen Konzentrationslager doch gut aufgehoben sei. Selbiges wünsche er im übrigen auch einigen norwegischen Pazifisten – wie „unseren lieben Kullmann“. Dieser, ein Marineoffizier, wurde dann tatsächlich von den Deutschen verhaftet – und kam in ein KZ, wohin insgesamt 9000 Norweger verschleppt wurden, 1400 von ihnen starben dort, auch Kullmann. 1940 veröffentlicht Hamsun einen „Aufruf“, der ihn acht Jahre später wegen Kollaboration mit dem Feind vor Gericht bringt: „NORWEGER! Werft die Gewehre fort und geht wieder nach Hause. Die Deutschen kämpfen für uns…“ Das Gericht hält ihn, gestützt auf die Aussagen seiner von ihm getrennt lebenden Frau, für „Altersgeistesschwach“ und verurteilt Hamsun nur zu „einem Lebensabend in Armut“. Nach seinem letzten Buch „Auf überwachsenen Pfaden“ schreibt er Marie Andersen einen Brief – und sie kommt zurück, pflegt ihn bis zu seinem Tod. Nach dem Krieg und während seines Prozesses waren viele Norweger zum Stadthaus von Knut Hamsun gepilgert und hatten ihm wütend und enttäuscht seine Bücher in den Vorgarten geworfen. Die Diskussion über Hamsun und die „Landesverräter“ flammte Mitte der Neunzigerjahre noch einmal wieder auf, als der norwegische König den Hof der Hamsuns im Norden, Hamaröy, besuchte. Das Anwesen wurde inzwischen zu einem „Hamsun-Center“ ausgebaut.
Wie in anderen Ländern, in denen es einen starken Widerstand gab, waren in Norwegen aber auch die Reaktionen der ehemaligen Kämpfer auf den Frieden sehr unterschiedlich. Der Anthropologe Thor Heyerdahl z.B., der mit einer Fallschirmjäger-Einheit als Partisan in der nördlichen Finnmark abgesprungen war, wo die Deutschen eine besonders brutale Politik der verbrannten Erde verfolgten, wollte oder konnte sich nach dem Krieg nicht wieder ins bürgerliche Leben zurückziehen – und unternahm stattdessen immer abenteuerlichere See-Forschungsreisen, von denen er nie wieder nach Norwegen zurückkehrte. U.a. ging es ihm um den Nachweis, dass die Wikinger einst vom Schwarzen Meer nach Norwegen gekommen war, nachdem sich die These erhärtet hatte, dass die Goten einst aus dem Süden gekommen waren. Heyerdahl kannte bald alle Häfen am Schwarzen Meer. Darüberhinaus bewies er mit seinem Booten „Kon-Tiki“ und „Ra II“ die Hochseetüchtigkeit von Schilfbooten – und damit die interkontinentalen Kontakte vorkolumbischer Völker. Neben einem Museum für die ausgegrabenen Wikinger-Schiffe gibt es heute auch ein Kon-Tiki-Museum. Zuletzt lebte Heyerdahl mit seiner jungen Frau, einer ehemaligen Miß Frankreich, auf einer Yacht in Süditalien. Er starb 2002. Über die Kämpfe in der Finnmark erschien vor einiger Zeit auf Deutsch ein Buch von Reidrun Mellem „So jagten sie uns aus unseren Häusern“. Der später berühmte „Unterwasser-Partisan“ Max Manus, der mehrere deutsche Großschiffe versenkte, schuf sich dagegen nach dem Krieg ein gemütliches Heim und genoß alle Ehren eines Veteranen. Seine Biographie „Mitt Liv“ erschien 1995, er lebte zuletzt in Spanien, wo er 1996 starb. Derzeit werden seine Memoiren gerade verfilmt. In einem englischen Nachruf auf ihn hieß es: „He was one of the most brilliant saboteurs under World War II“. Man kann ihn geradezu als den Erfinder der Unterwasser-Guerilla bezeichnen.
Ähnliches gilt auch für den „norwegischen Nationalhelden“ Jan Baalsrud, dessen Partisanenerlebnisse Arne Skouen 1957 verfilmte. „So weit die Kräfte reichen“ – wurde 1991 zum besten norwegischen Film aller Zeiten ernannt. Jan Baalsrud war 1945 mit der Kompanie Lingen von einem englischen Fischerboot nördlich von Tromso an Land gesetzt worden, wo sie Sabotageakte verüben sollten. Sie wurden jedoch von einem örtlichen Kontaktmann verraten und alle, bis auf Baalsrud, umgebracht. Er konnte sich trotz einer Verletzung über die schwedische Grenze in Sicherheit bringen. Der Film beruht zu großen Teilen auf den Bericht „We die alone“ des englischen Vizekommandeurs des Kommandounternehmens. Die meisten Sabotageakte wurden von Kommunisten ausgeführt. Ihr Aktionismus wurde anfangs von der übrigen Widerstandsbewegung abgelehnt, die sich ihrerseits der norwegischen Exilregierung und den Kommandos der Westalliierten unterstellt hatte. Anders als etwa in Spanien gingen die Kommunisten in Norwegen jedoch nicht auf Kollisionskurs mit den anderen linken Organisationen, sondern suchten die Zusammenarbeit – z.B. mit der SAP. Darüberhinaus wurden dann immer mehr Aktionen von norwegischen Soldaten, teilweise unter englischer Leitung, ausgeführt. Besonders spektakulär war ihre Sprengung der Schwerwasser-Produktionsanlage der Norsk Hydro bei Rjukan, wobei gleichzeitig ein Schwerwassertransport-Schiff auf dem Weg nach Deutschland versenkt wurde. Dabei ließen zahlreiche Norweger ihr Leben, die Aktion war aber vielleicht kriegsbeeinflussend gewesen, wie Tor Dagre in einer Broschüre des Osloer „Hjemmefrontmuseums“ schreibt, weil damit der Bau einer deutschen Atombombe erfolgreich sabotiert werden konnte. Mit der Verschärfung der deutschen Besatzung und Ausplünderung des Landes beteiligten sich immer mehr Norweger am Widerstand – so dass die Kommunisten langsam in den Hintergrund gerieten. Das erklärt vielleicht, warum es später in der Sowjetunion und auch in der DDR kaum systematische Darstellungen des norwegischen Widerstands gab. Gelegentlich wurden dort jedoch kurze Partisanengeschichten aus Norwegen übersetzt. Erwähnt sei die Erzählung „Drei Pistolen und ein Leben“ von Torfinn Haukas, die in der Partisanen-Anthologie „Der letzte Hügel“ Aufnahme fand. Daneben gibt es auch einige Partisanengeschichten in dem Band „Norwegische Erzähler“ aus der Reihe „Erkundungen“: „In Verdunklungszeiten“ von Torborg Nedreaas z.B.. Hier heißt es an einer Stelle: „Mitunter kann es den Menschen auch in einer schweren Zeit gut gehen. Der Schmerz ist gut, und der Ernst im Gemüt ist ebenso blank wie der dunkle Fjord“. In Johan Borgens Erzählung „Wir Mörder“ geht es um einen jüdischen Verleger und Widerstandskämpfer „von Anfang an“, der plötzlich verschwunden ist. Der ostdeutsche Skandinavist Rudolf Kähler bemerkt dazu, der Autor zeige darin, ebenso auch in einigen späteren Werken, „wie anfällig die humanistische, jedoch politisch indifferente Haltung des liberalen Bürgertums gegenüber der faschistischen Idologie bei einer direkten Konfrontation war“. Nach 1945 hat eine Vielzahl norwegischer Autoren über solche und andere Aspekte des Widerstands geschrieben. Vor allem „würdigten Sie den Heroismus und die moralische Widerstandskraft des Volkes, seiner Leiden und Opfer“. Nicht wenige verarbeiteten dabei ihre eigenen Erlebnisse – z.B. Per Torhaug, der sich dem militärischen Widerstand anschloß, 1942 zu Hochverrat verurteilt wurde und in das KZ Sachsenhausen kam. 1961 erschien darüber sein Buch „Das Waldkommando“, das jedoch kaum Leser fand, weil „in der Geschichtsschreibung die Besatzungszeit allein auf den norwegischen Widerstand reduziert wurde“, wie Anette Storeide im Nachwort des 2004 in Deutschland veröffentlichten Buches schreibt, wo man es nun quasi für die Enkel auf der anderen Seite aufgelegt hat. In Norwegen war Torhaug erst 1967 mit seinem Vietnam-Reisebericht „Das Reisfeld und die Waffen“ bekannt geworden.
Der deutsche Überfall auf Norwegen am 9.April 1940 hieß „Weserübung“. Nach der Kapitulation am 10.Juli brauchten die verschiedenen Volksklassen und -schichten eine Weile, um sich (neu) zu formieren. Zu den ersten „Keimzellen des Widerstands“ zählten die Sportvereine. Aber bald übten sich immer mehr Gruppen in „zivilen Ungehorsam“ – die Lehrer, die Pastoren usw.. Gleichzeitig fingen die jüngeren Leute an, immer militanter zu werden und sich zu bewaffnen. Die Deutschen reagierten auf diesen „Terror“ – mit Folter, Erschießungen und KZ. Von der UDSSR im Norden und von England im Süden aus landeten Kommandounternehmen an den Küsten. Damit bildete sich bald ein komplexer Untergrund heraus – mit eigenen Zeitungen und allein 70 Funkstationen. Aus den Sportvereinen entstand die Geheim-Organisation Milorg – und „Aus Milorg wurde ein Untergrundheer“: Dieser Entwicklung der Widerstandsbewegung ist im Osloer „Hjemmefrontmuseum“ eine ganze Abteilung gewidmet. Eine andere der norwegischen Handelsflotte: Das Land besaß die drittgrößte Handelsflotte der Welt. Sie wurde in den Dienst der Alliierten gestellt – und dementsprechend von den Deutschen verfolgt: 570 Schiffe, die Hälfte der Übersee-Flotte, wurde versenkt, 4500 Seeleute starben. Aber die Einnahmen der norwegischen Handelsflotte verschafften der norwegischen Regierung eine finanziell unabhängige Stellung unter den Alliierten, sie konnte darüberhinaus sogar die Vorkriegskredite damit tilgen.
Der Aufstandsspezialist der Komintern und Reichsleiter der Internationale der Seeleute und Hafenarbeiter, Ernst Wollweber, hatte 1935 in Leningrad eine Sabotage-Truppe aufgebaut. Diese „Wollweber-Organisation“ arbeitete dann mit norwegischen Seeleuten zusammen und führte von Dänemark und Norwegen aus Anschläge auf deutsche und italienische Schiffe durch. 1940 flüchtete Wollweber von Norwegen nach Schweden, wo man ihn verhaftete. Obwohl ihm die UDSSR die Staatsbürgerschaft verlieh, damit er nicht nach Deutschland ausgeliefert wurde, verurteilten ihn die Schweden zu drei Jahren Zwangsarbeit. Ende 1944 wurde er nach Moskau ausgeflogen, von dort aus ging er 1946 nach Ostdeutschland, wo er erst Leiter des Schiffahrtsamtes und dann im DDR-Verkehrsministerium für den Schiffsverkehr zuständig war, wobei er jedoch vor allem die Fäden seiner alten maritimen Verbindungen wieder zusammen zu knüpfen versuchte. Schließlich ernannte man ihn zum Minister – für Staatssicherheit. Er fiel jedoch in Ungnade und wurde 1958 aus dem ZK ausgeschlossen, 1967 starb er in Ostberlin.
Der prominenteste Exilant in Norwegen war Leo Trotzki. Im Nachwort zu seiner Biographie „Mein Leben“ schreiben die amerikanischen Herausgeber: „Norwegen war es, daß Trotzki und seiner Gruppe das nächste Asyl gewährte. Anfangs ging alles gut. Die Trotzkis waren Gäste im Hause Konrad Knudsens, eines sozialistischen Abgeordneten der Storting. In fünfundvierzig Meilen Entfernung von Oslo konnte Trotzki nach den zwei hektischen Jahren in Frankreich den ruhevollen Frieden der norwegischen Landschaft genießen. Er arbeitete jetzt an einem Buch, dem er große Bedeutung beimaß und in dem er das Anwachsen und die inneren Widersprüche der neuen, in der Sowjetunion an der Macht befindlichen Bürokratie umriß. Das Buch war ‚Die verratene Revolution’…Das norwegische Idyll ging jäh zu Ende, als eine Gruppe von Faschisten aus Knudsens Haus Trotzkis Papiere zu entwenden versuchte. Trotzki und die Knudsens befanden sich gerade auf einer Erholungsreise, aber Knudsens Tochter war zu Hause geblieben und in der Lage gewesen, die Faschisten zu verscheuchen. Wenn der Versuch somit auch gescheitert war und der Vorfall an sich nicht viel bedeutete, so rief er doch eine örtliche politische Debatte hervor, die mit der Eröffnung der Moskauer Prozesse zusammenfiel, in denen Stalin eine Anzahl seiner Kremlgenossen einer Verschwörung im Bunde mit Trotzki zum Umsturz des Sowjetregimes anklagte. Sofort wurde die Aufmerksamkeit der ganzen Welt auf Trotzki in diesem kleinen norwegischen Dorf gelenkt, das prompt von Journalisten belagert wurde. Dem ließ, von seinem norwegischen Wohnsitz aus an die Welt gerichtet, Trotzki die emphatische Zurückweisung aller Anklagen Stalins folgen. Im gleichen Atemzug forderte Trotzki Stalin dazu heraus, ihn von Norwegen ausliefern zu lassen. Da Trotzki begriff, daß dies eine Untersuchung seitens der Regierung zur Folge haben würde – mit anderen Worten einen öffentlichen Prozeß -, wußte er auch, daß er in der Lage sein würde, Stalins Gründe für das Auslieferungsbegehren zunichte zu machen und öffentlich als Sieger aus dem Prozeß hervorzugehen. Der Sowjetdiktator nahm jedoch klugerweise die Herausforderung nicht an. Die Moskauer Prozesse endeten natürlich mit der Verurteilung der Angeklagten, die kurz darauf hingerichtet wurden. Stalin hatte inzwischen die Norweger wissen lassen, daß sie seitens der Sowjetunion mit Strafmaßnahmen gegen den norwegischen Handel rechnen müßten, wenn sie Trotzki nicht sofort zum Schweigen brächten. Unter diesem Druck sah sich die norwegische Regierung veranlaßt, Trotzki in einem kleinen Dorf zwanzig Meilen von Oslo entfernt unter Hausarrest zu stellen. Dort blieben Trotzki und seine Frau drei Monate und zwanzig Tage.“ Dann zogen sie weiter nach Mexiko, wo Leo Trotzki 1940 von einem KGB-Agenten ermordet wurde.
In Norwegen hatte er sich auch in die Diskussionen der dortigen linken Gruppen eingemischt. Im August 1933 schrieb er beispielsweise an den Leiter der Exil-SAP in Paris, Jakob Walcher: „Wegen Eurem völlig unüberlegten Bündnis mit der NAP (der Norwegischen Arbeiterpartei) seid ihr dabei, die Mot-Dag-Gruppe zu verlieren. Mot Dag ist jedoch die einzige Gruppe, die Ihr in Norwegen habt. Diese Gruppe ist bei weitem nicht „unnachgiebig“. Sie hat es jedoch nicht geschafft, die NAP „wie sie ist“ zu beeinflussen. Einer der Gründe dafür ist, zumindest meiner Meinung nach die Zugehörigkeit der NAP zur Internationalen Arbeitsgemeinschaft, die Tranmæl und Co zu nichts verpflichtet, aber ihnen einen internationalen Deckmantel und Schutz in den Augen der norwegischen Arbeiter gibt. Glaubst Du, dass Du Erfolg dabei haben kannst, die Art von Einfluss auf Tranmæl von Paris aus auszuüben, den Falk bisher von Oslo aus nicht ausüben konnte? Nein. Es ist bloß einfacher, in Paris Illusionen über Oslo zu hegen als in Oslo selbst.“
Auch die Osloer SAP-Aktivisten Gertrud Meyer und Willy Brandt suchten zunächst den Kontakt zur Gruppe „Mot Dag“ (Dem Morgen entgegen) – „dieser nicht nur eingebildeten sozialistischen Elite“, wie Brandt sie nannte. Ab 1933 ging er jedoch – für Jacob Walcher „allzu schroff“ – auf Distanz zu ihr. Einige seiner Biographen meinen, weil er mit der NAP wegen seiner Mot-Dag-Kontakte in Konflikt geraten war. Die Organisation war – als „Lebensgemeinschaft“ – 1922 aus einer gleichnamigen Zeitschrift hervorgegangen, stand den „International Workers of the World“ (IWW) nahe und bezeichnete die Politik der Komintern als eine „moralische Geschmacklosigkeit“. Dennoch kam Mot Dag „mit der Forderung nach Disziplin und totalem Arbeitseinsatz dem Muster einer Kaderorganisation in Norwegen am nächsten. Die führenden Mitglieder besetzten zudem die Schlüsselpositionen in einer Reihe von Frontorganisationen“, schreibt Einhart Lorenz, dem zufolge Brandts Kontakte mit Mot Dag durch Jacob Walchers zustande gekommen waren. Wenig später riet Brandt der Gruppe, in der er immer mehr Aufgaben übernommen hatte, doch in die Arbeiterpartei einzutreten, wo sie sich „auf Grund ihrer Tüchtigkeit“ bestimmt schnell durchsetzen würde, er selbst ging mit gutem Beispiel – und spalterischen Absichten – voran. Noch später bezeichnete er Mot Dags politische Arbeit als „organisierte Prinzipienlosigkeit“ – stalinistisch nach außen und reformistisch im Land – und verließ die Gruppe, die sich im Juni 1936 auflöste und tatsächlich der Arbeiterpartei beitrat.
Letztere war 1923 in Folge der russischen Oktoberrevolution als revolutionäre Oppositionsgruppe zur Sozialdemokratie in der norwegischen Arbeiterbewegung entstanden – unter der Führung von Martin Tranmael. Während die Zeitung „Mot Dag“ zunächst die Studenten bewegt hatte. Einer ihrer ersten Redakteure, Sigurd Hoel, kam aus dem „Kulturradikalismus“, einer literarischen Bewegung, die darunter in der „Zwischenkriegszeit“ vor allem den „Kampf gegen den Faschismus“ verstand, wobei Hoel, dessen Werke auch nach 1945 diesem Kampf galten, erst marxistisch argumentierte und dann vorwiegend psychoanalytisch. Er stand in engem Kontakt mit Wilhelm Reich, dessen Buch „Massenpsychologie des Faschismus“ 1933 in Norwegen und 1934 in Dänemark erschien. Eine zeitlang war Hoel dann auch Redakteur der Reichschen „Zeitschrift für Politische Psychologie und Sexualökonomie“. Nachdem Reich jedoch sein Buch „Die Bione“ veröffentlicht hatte, das einen Proteststurm in Norwegen auslöste, wurden ihm strenge Auflagen für seinen weiteren Aufenthalt im Land auferlegt, was schließlich 1939 zu seiner Ausreise in die USA führte. Die Mot-Dag-Gruppe hatte sich stark für Reichs Forschungen eingesetzt. 1954 wurde der „Fall Reich“ von Arne Stai als eine der wichtigsten „Kulturdebatten“ im Norwegen der Zwischenkriegsperiode bezeichnet. Hoels „Faschismus-Essays“ nach 1945 erwähnen die Reichschen Schriften allerdings nicht mehr. Sie wurden eigentlich erst Ende der Sechzigerjahre in der norwegischen (sowie auch in der deutschen) Studentenbewegung wieder „entdeckt“. Der Faschismus ist für Hoel in seinen späteren Schriften eine „Mentalität, die jeder mehr oder weniger in sich trägt“, wie der Skandinavist Andreas Schmeling meint. An einer Stelle problematisiert Hoel darin auch das Verhältnis zwischen den Faschisten (der „Nasjonal Samling“ und den norwegischen Widerstandskämpfern: „Hva med vare hjemme-fascister? Vi vet at det var en viss prosent av dem som ble gode nordmenn, fordi deres nasjonalfolelse allikevel var sterkere enn deres sympatier for Hitlers raselaere og tvangsmetoder“. Auch in seinen späteren Romanen kommt Hoel immer wieder auf die Okkupationszeit zurück, wobei er Zweifel an der üblichen Unterteilung der Norweger in „landssviker“ und „gode nordmenn“ anmeldet. Der junge Ostberliner Wissenschaftler Schmeling schreibt – im Vorwort seiner Magisterarbeit über seine Motivation, sich mit dem „Kulturradikalismus“ zu beschäftigen: „Die Lektüre von Sigurd Hoels Roman ‚Mote ved Milepelen“ (1947) bewegte mich stark, da ich in den von ihm geschilderten Schwierigkeiten mit der ‚Vergangenheitsbewältigung‘ im Nachkriegsnorwegen gewisse Parallelen zur Situation im Nach-‚Wende‘-Deutschland zu sehen glaubte“. An den norwegischen Faschismus-Begriff von Reich/Hoel erinnerten vor der Wende auch schon die sieben Thesen zur „Einführung in das nichtfaschistische Leben“ von Michel Foucault:
“ – Befreie die politische Aktion von jeder vereinheitlichenden und totalisierenden Paranoia!
– Entfalte Aktion, Denken und Wünsche durch Proliferation, Juxtaposition und Disjunktion – und nicht durch Unterteilung und pyramidische Hierarchisierung!
– Verweigere den alten Kategorien des Negativen (Gesetz, Grenze, Kastration, Mangel, Lücke), die das westliche Denken so lange als eine Form der Macht und einen Zugang zur Realität geheiligt hat, jede Gefolgschaft! Gib dem den Vorzug, was positiv ist und multipel, der Differenz vor der Uniformität, den Strömen vor den Einheiten, den mobilen Anordnungen vor den Systemen! Glaube daran, daß das Produktive nicht seßhaft ist, sondern nomadisch!
– Denke nicht, daß man traurig sein muß, um militant sein zu können – auch dann nicht, wenn das, wogegen man kämpft, abscheulich ist! Es ist die Konnexion des Wunsches mit der Realität (und nicht sein Rückzug in Repräsentationsformen), die revolutionäre Kraft hat.
– Gebrauche das Denken nicht, um eine politische Praxis auf Wahrheit zu gründen – und ebensowenig die politische Aktion, um eine Denklinie als bloße Spekulation zu diskreditieren! Gebrauche die politische Praxis als Intensivikator des Denkens und die Analyse als Multiplikator der Formen und Bereiche der Intervention der politischen Aktion!
– Verlange von der Politik nicht die Wiederherstellung der ‚Rechte‘ des Individuums, so wie die Philosophie sie definiert hat! Das Individuum ist das Produkt der Macht. Viel nötiger ist es, zu ‚entindividualisieren‘ und zwar mittels Multiplikation und Verschiebung, mittels diverser Kombinationen. Die Gruppe darf kein organisches Band sein, das hierarchisierte Individuen vereinigt, sondern soll ein dauernder Generator der Entindividualisierung sein.
– Verliebe Dich nicht in die Macht!“

Das ist ziemlich nordisch-protestantisch: ein Schloßhotel leisten sie sich, aber den Springbrunnen müssen die Gäste selber sauber machen. Hier, schiebs mir auf die Schüppe.
8. Hamsun in der Weltmeinung
2006 meldete sich ein fünfköpfiges Filmteam des staatlichen norwegischen Fernsehens bei Wladimir Kaminer zu Hause im Prenzlauer Berg. Sie wollten ihn zum norwegischen Nationaldichter Knut Hamsun befragen. Wladimir war einer von vielen Intellektuellen, die sie dazu weltweit – vor allem in den USA und in Europa – interviewten. Es ging ihnen dabei noch einmal um die Frage: „War Hamsun ein Held oder ein Verbrecher? Und sind seine Werke es immer noch wert, gelesen zu werden – obwohl er ein Nazi oder gerade weil er ein Nazi war? Wladimir fungierte in dem Interview-Reigen nicht als deutscher Schriftsteller, sondern als ein russischer: „Gab es Hamsun überhaupt in Russland – und wenn ja, wie wurde und wird er dort eingeschätzt?“ Wladimir hatte sich auf das Interview gut vorbereitet: Seine Frau, Olga, besaß fast alle Bücher von Hamsun sowie auch von einigen anderen norwegischen Schriftstellern. Bis dahin kannte er jedoch nur ein Buch von Hamsun: „Hunger“, in einer russischen Übersetzung aus dem Jahr 1904, das zu den ältesten Büchern in der Bibliothek seiner Eltern gehört hatte. Aus den neueren Vorworten erfuhr er nun auch einiges aus dem bewegten Leben von Hamsun – und konnte sich dazu gegenüber dem norwegischen Fernsehteam in Beziehung setzen: Hamsun und ich – so war z.B. auch der norwegische Schriftsteller zwei Mal emigriert – und dabei gescheitert. Und auch Kaminer hatte es zuerst nach „Christiania“ und in die dortige „Bohème“ verschlagen/gezogen.
Literatur:
Wladimir Kaminer: „Die Reise nach Trulala“, München 2002
Astrid Nordang: „Svart Honning“, Oslo 2003
Kjetil Brottveit: „Nattradioen“, Oslo 2003
Neue Texte aus Skandinavien: Neue Rundschau, Ffm 2004, Heft 3
Erkundungen: 19 Norwegische Erzähler, Berlin 1975
Der letzte Hügel: Berlin 1989
Per Torhaug: „Das Waldkommando“, Berlin 2004
Max Manus: „Mitt liv“, Oslo 1995
Einhart Lorenz: „Willy Brandt in Norwegen“, Kiel 1989
Einhart Lorenz: „Exil in Norwegen, Lebensbedingungen und Arbeit deutschsprachiger Flüchtlinge 1933 – 1943“, Baden-Baden 1992
Klaus Theweleit: „Buch der Könige“, Band 1, 2x, 2y, Ffm 1991
Hermann Weber, Andreas Herbst: „Deutsche Kommunisten, Biographisches Handbuch 1918 – 1945“, Berlin 2004
David Howarth: „We Die Alone“, Guilford 1999
Leo Trotzki: „Mein Leben“, Essen 2001

Henning Brandis, ein Schüler des Island-Exilanten Dieter Roth, stellte den rechten Zeigefinger einer verheirateten Frau in den Mittelpunkt seiner Collage.
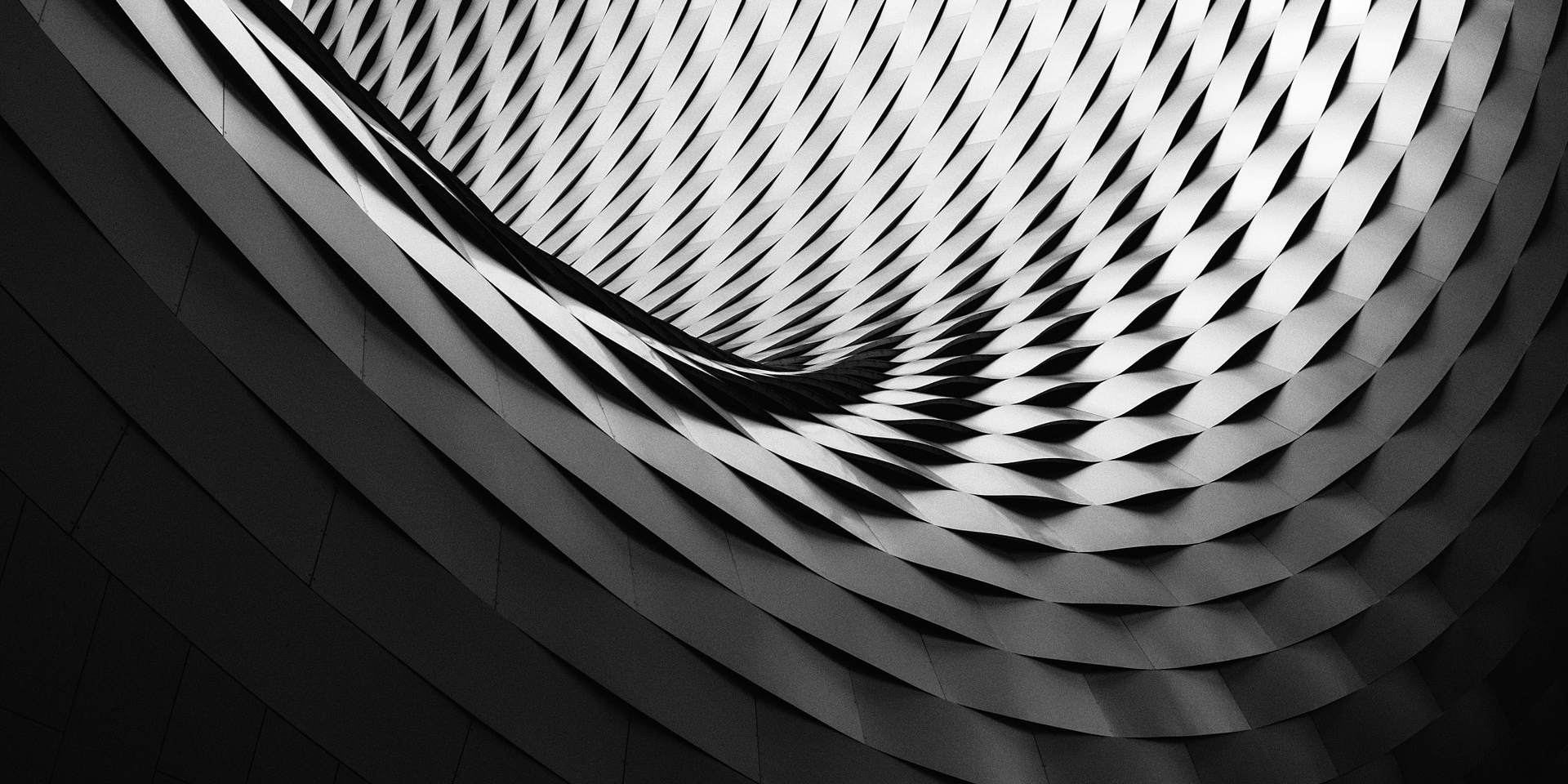




F-G-F+ (die Islandformel)
Wegen der gestiegenen Fischpreise und der Androhung die Fangquoten wieder zu verstaatlichen, hat sich Island erstaunlich schnell wieder von der „Finanzkrise“ erholt, meldet uisono die BRD-Intelligenzpresse im Spätherbst 2009. Ein gutes Beispiel für „Wirtschaft als das Leben selbst“ bietet die isländische Hochseefischerei. Das dachte sich anscheinend auch der Vogel- und Islandforscher Wolfgang Müller, kurz „Island-Müller“ genannt, der regelmäßig in der Schöneberger „Raststätte Gnadenbrot“ öffentliche Gespräche führt – und sich zuletzt mit dem isländischen Hochseefischer Stefan Juliusson unterhielt. Dieser ist in seiner fangfreien Zeit gleichzeitig noch Versicherungsvertreter in Berlin. Juliusson zeigte Dias vom Leben und Arbeiten auf den Trawlern – die alle heil und gesund in ihren Heimathafen zurückkehrten, nur einen estländischen erwischte es: seine Maschine geriet in Brand und er sank. Diese Dia-Sequenz sahen wir mehrmals. Juliusson hatte daneben noch eine Art Deputat von seiner letzten Fangtour mitgebracht, der sich nun auf der „Gnadenbrot-Speisekarte“ wiederfand: Scholle, Heilbutt, Dörrfisch und getrockneten Seetang – „Keine Mindestabnahme, Trennkost möglich“.
Island begann schon während des Zweiten Weltkriegs, als es erst von Engländern und dann von Amerikanern besetzt war (und die Fischerboote deswegen als Feinde von Deutschen angegriffen wurden), seine Fangflotte zu modernisieren. Dazu dehnte es langsam seine Schutzzone von 3 auf 200 Meilen rings um die Insel aus, was schließlich auf eine Wirtschaftszone von 758.000 Quadratkilometern hinauslief. Dabei kam es – insbesondere mit den Engländern – zu zwei „Kabeljau-Kriegen“, ein dritter bahnt sich seit einiger Zeit bereits mit Norwegen – bei Spitzbergen – an. Die isländischen Fischbestände erholten sich trotz der ausgeweiteten Schutzzone nur langsam, so daß weitere Schutzmaßnahmen eingeführt wurden: 1984 ein Quotensystem, nach dem jedem Schiff für die einzelnen Fischarten eine bestimmte Fangmenge zugeteilt wird. Die Quoten können getauscht und verkauft werden. Unter den Schiffseignern mendelten sich dabei schnell einige „Quoten-Barone“ heraus, die in Saus und Braus, z.B. in Spanien, lebten – und so das auf Gleichheit abzielende isländische Sozialgefüge durcheinanderbrachten. Dann litt insbesondere die isländische Fischverarbeitungsindustrie zunehmend darunter, daß immer mehr Trawler ihre Fänge selbst verarbeiteten und dann direkt in Bremerhaven anlandeten, wo sie doppelt so viel dafür bekamen und bekommen wie in Island. Inzwischen stammen schon fast 80% aller in Bremerhaven gelöschten und verauktionierten Fische von isländischen Trawlern. Der deutsche Großhandel hat mit den isländischen Reedereien regelrechte „Fahrpläne“ ausgearbeitet, um eine größere „Versorgungssicherheit“ zu erreichen. Die isländische Fischindustrie verarbeitet rund 1.500.000 Tonnen Fisch jährlich. Seit 1991 können isländische Fischereiprodukte zollfrei in die Europäische Union eingeführt werden. Wegen seiner Fischereipolitik wollte Island bis zur Finanzkrise nicht der EU beitreten, obwohl es Beitragszahler ist, weil es die Kontrolle über seine nationale Hauptressource Fisch, um die das Land so lange gekämpft hat, nicht in die Hände der Gemeinschaft abgeben will. Der Reichtum seiner Meere spiegelt sich auch auf seinen Geldmünzen: Kabeljau, Plattfische, Schellfisch, Krabben…Auf Island gibt es so gut wie keine Arbeitslosigkeit.
Umgekehrt ist in Deutschland Bremerhaven die Stadt mit den meisten Arbeitlosen. Dort war bis 1983 „die größte deutsche Fischereiflotte“ stationiert. Sie befand sich zuletzt im Besitz der Firmen Nordstern (Frosta), Dr.Oetker und Nordsee. Letztere gehörte früher dem US-Konzern Unilever, dann geriet sie in den Besitz der US-Assett-Dealers Apax Partners München, der sie filettierte, zuletzt wurde 2005 die „maritime Restaurantkette“ an den ehemaligen Bäckereibesitzer Kamps und die japanische Bank Nomura verkauft. Das Fischfang-, – verarbeitungs- und -verkaufsunternehmen „Nordsee“ legte allein 70 Schiffe still und entließ 5.000 Mitarbeiter. Die Reste der Flotte – acht Schiffe, die den drei Firmen zuletzt noch gehörten – kauften schließlich die Isländer. Sie erwarben nach der Wende auch noch das, was nach einem für die Treuhandanstalt erstellten „Versenkungsgutachten“ der Roland-Berger Unternehmensberatung von der DDR-Fischfangflotte übrigblieb. In Bremerhaven hingen an der Hochseefischerei außerdem noch zwei Werften sowie etliche Schiffsausrüster und Netzmachereien, die ebenfalls pleite gingen. Einige ehemalige Hochseefischer haben in Bremerhaven ihre einstigen Erlebnisse „vor den Küsten Islands“ veröffentlicht, der Matrose Jens Rösemann schrieb: „Aber so ist das in der Natur, einer frißt den anderen. Und wir lebten nun davon, dass wir Fische fingen. Später sah jeder von uns nicht mehr den einzelnen Kabeljau, der da an Deck lag. Es war Geld! Davon lebten wir und unsere jungen Familien daheim“. Inzwischen hat es auch die deutschen Seehundjäger an der schleswig-holsteinischen Nordseeküste erwischt, sie sind jetzt Seehundschützer im Nationalpark Wattenmeer.
Der auch als „Elfenforscher“ bekannte „Island-Müller“ heißt im übrigen deswegen so, weil er in Island nach Schließung des Goethe-Instituts in Rejkjavik wegen der Osterweiterung dieser staatlichen Kultureinrichtung, dort selbst als Ersatz eine „Walther von Goethe Foundation Reykjavík“ gründete, die dann die Telefonnummer des Goethe-Instituts zugeteilt bekam.
Die Walther von Goethe Foundation veranstaltete 2002 eine „große Stimmgabelshow“ im Haus der Berliner Festwochen und eine täglich durch Berlin führende Busreise mit dem Titel „Isländische Reise“. Der Reisebegleiter Jón Bjarni Atlason erarbeitete damals eine Übersetzung von J. W. von Goethes Werk „Der Versuch die Metamorphose der Pflanzen zu erklären“ (Gotha 1790) ins Isländische. Dieses Buch hatte zuvor Wolfgang Müllers „Foundation“ wiederveröffentlicht. Im Jahr 2004 erschien dort dann noch Hieronymus Megisers Werk „Neue Nordwelt“ (Leipzig 1613), die den ersten deutschen Reisebericht über Island nach eigener Anschauung und die erste Übersetzung der Reise der Brüder Zeni auf die Phantominsel Frisland enthält.
Im selben Jahr bringt Wolfgang Müller im Podewil Berlin die Gesänge der Stare der norwegischen Insel Hjertøya zu Gehör, „die seit den 30er Jahren Kurt Schwitters Ursonate imitieren“, wie er behauptet. Ähnliches hatte 1985 auch schon der Vogelsberger Hobby-Ornithologe Dr. Salm-Schwader über die Nachtigallen in den Revieren der Zürcher Spiegelgasse/Münstergasse behauptet: dass deren Gesang 1916 mit akustischen Elementen des Dadaismus angereichert wurde.
Im Martin-Schmitz-Verlag, bei Suhrkamp und im Hybriden-Verlag veröffentlichte Wolfgang Müller drei Island-Bücher:
„Blue Tit – Das deutsch-isländische Blaumeisenbuch“, 1998
„Die Wahrheit über Island – Neues von der Elfenfront“, 2007
„Hulishjálmsteinn“, 2000
Daneben gibt es noch einige CDs von ihm:
Die „Islandhörspiele“, 2002
„Mit Wittgenstein in Krisuvik“, 2003
„Das Dieter Roth Orchester spielt kleine Wolken, typische Scheiße und nie gehörte Musik“, 2006