„Die homogene Welt aufreißen! Täglich die Kacke des Seins umgraben!“
Als sich Anfang 1978 auf dem „Tunix-Kongreß“ in der TU die bundesdeutsche Linke zu einer letzten Manöverkritik traf, wurde u.a. die Gründung einer „alternativen Tageszeitung“ vorgeschlagen und diskutiert. Damals gab es in fast jeder Stadt eine linke Wochenzeitung und darüberhinaus noch einige maoistische Parteiblätter sowie den „Informationsdienst für unterbliebene Nachrichten“ (ID). Aus diesen Reihen kamen Gegenstimmen zum geplanten „taz-Projekt“: Sie bezweifelten zwar nicht, dass es den Staatsorganen gelungen war, in der durch die RAF ausgelösten Terrorangst und durch Fahndungsdruck die bürgerliche Presse quasi „gleichzuschalten“ (was man dann den „Deutschen Herbst“ nannte), und dass man kollektiv etwas dagegen tun müßte. Aber vor allem die antiautoritäre Linke lehnte ein zentrales „Organ“ zur Gegenversammlung ab. Einige befürchteten – zu Recht, wie sich dann herausstellte, dass all die dezentralen linken Medien dem neuen Zentralorgan zum Opfer fallen würden. Die Projekt-Befürworter ließen sich jedoch von den -Ablehnern nicht bremsen. Gegen die Konzentrierung der reaktionären Kräfte half scheinbar nur eine ebenso konzentrierte „Gegenöffentlichkeit“. Im selben Jahr – 1979, da die taz begann, regelmäßig zu erscheinen, gründeten auch die undogmatischen Linken eine Politikzentrale: die Partei der Grünen. Zu ihren ersten Delegierten zählte Rudi Dutschke. In Kreuzberg ist einer der wichtigsten taz-Gründer, Christian Ströbele, noch heute Abgeordneter dieser Partei, die inzwischen ebensoviele Wandlungen durchgemacht hat wie die taz.
Während die Grünen und Umweltschützer dabei jedoch einen ganz konventionellen Naturbegriff ins Spiel brachten und bringen, ließ sich die taz – nicht zuletzt wegen ihrer publizistischen Orientierung an der linken Pariser Tageszeitung „Libération“ (1973 u.a. von Jean-Paul Sartre gegründet) – immer wieder von französischen Theoretikern beeinflußen und veröffentlichte ihre Texte. Genannt seien Foucault, Deleuze, Guattari (alle drei waren zum „Tunix-Kongreß“ eingeladen worden) sowie Lyotard, Badiou, Baudrillard, Irigaray… Man könnte hierbei fast von einer nietzscheanisch-spinozistischen Verschwörung sprechen, die nach dem Tod der meisten eben Erwähnten einerseits in die pragmatisch-wissenschaftliche „politische Ökologie“ der „Akteur-Netzwerk-Theoretiker“ um Bruno Latour und andererseits in die operaistische italoamerikanische Theorieproduktion von Negri und Hardt übergegangen ist.
Im Kern ging und geht es dabei um die „Multitude“: „In Spinozas Staatslehre gibt es keinen einheitlichen und befriedeten populus, sondern nur eine multitudo, deren Fähigkeit zum autonomen politischen Handeln niemals endgültig stillgestellt werden kann: jede politische Ordnung ist von der ständigen Drohung der Gehorsamsverweigerung überschattet,“ heißt es dazu im Forum „grundrisse.net“. Der holländische Affenforscher Frans de Waal hat dazu jüngst noch Empirisches beigesteuert: „Die Primatenevolution scheint den Schluß zuzulassen: Es gab nie irgendein Chaos“ – wie es angeblich vor dem von Hobbes dagegen verordneten ‚Gesellschaftsvertrag‘ bestand. „Wir begannen“ laut de Waal „mit einer kristallklaren hierarchischen Ordnung und fanden dann Möglichkeiten, sie zu nivellieren. Unsere Spezies hat einen Hang zum Subversiven.“ Als neuester Schrei gelten dabei „Zwischennetzwerke“ unter Gleichen. Die spinozistische „Multitude“ setzt sich aus „Minderheiten“ zusammen.
Das erinnert an Herbert Marcuses „Randgruppenstrategie“, bezieht sich jedoch vor allem auf die „1000 Plateaus“ von Guattari und Deleuze. Letzterer, der Spinoza im Herzen trägt, wie er sagt, ist in seinem TV-Nachlaß „Abécédaire“ 1988/89 noch einmal darauf zurückgekommen: „Nur Minderheiten sind produktiv“ und es geht dabei nicht darum, eine Mehrheit zu werden, sondern eine Differenz zu eröffnen. „Jeder ist eine Minderheit!“ 1977 hatte der Libidoökonom Jean-Francois Lyotard bereits von einem „Patchwork der Minderheiten“ gesprochen. Dieses Bild einer damals im Heraus- und Zusammenkommen begriffenen Bewegung (von Schwulen/Lesben, Indianern, Heimkindern, Behinderten, Nekrophilen, Irren, Pädophilen, Prostituierten, Palästinensern, globalen Banlieues usw.) haben Negri/Hardt jetzt in ihrem „Common Wealth“ wiederverwendet. Auch ihnen geht es dabei noch wie Lyotard um eine „herrenlose Politik“. Diese will der Wissenssoziologe Bruno Latour nun auch noch für Tiere und Pflanzen geltend machen.
So weit ging und geht die taz nicht – dass sie vor die Moderne zurück will, also die Dichotomie von Subjekt und Objekt, Kultur und Natur, Fakt und Fetisch aufzuheben versucht. Obwohl sie die aufbegehrenden Minderheiten weltweit schon fast systematisch „sammelte“ – bis hin zu den Inhaftierten: Es gab mal eine Justizredaktion dafür und bis heute eine „Knacki-Beauftragte“. Dabei fühlte sie sich lange Zeit der „Frankfurter Schule“ (Horkheimer/Adorno) nahe genug, um deren auf Marx und Freud basierende „Dialektik von Mimesis und Ratio“ auch für ihren Journalismus geltend zu machen. Soll heißen: 1. Einfühlung und 2. Aufklärung, wobei die Dialektik darin besteht, sich einerseits vor allzu heißer Sentimentalität zu hüten und andererseits vor kalter Vernunft. Beispiel zu 1: Fake-Interviews von Vera Gaserow mit Strommasten-Absägern und von der Kulturredaktion mit den untergetauchten „Ludditen“ Inge Viett und Thomas Pynchon. Beispiel zu 2: Ute Scheubs tägliche Berichte aus dem „Lesben-Camp“ in Mutlangen. Im übrigen war die taz kurzzeitig auch mal ein „Sprachrohr“ der Pädophilen und sammelte „Waffen für El Salvador“-Spenden – beides gilt heute als schwer verwerflich, auch in der taz. Wie sie ebenso – ausgehend von der Frankfurter Schule über Mao tse tung und Bruno Latour – die Aufhebung der Trennung von Hand- und Kopfarbeit, verbunden mit einem „Einheitslohn“, praktizierte, während es jetzt andersherum – um „Expertentum“ und „Gehaltsspreizung“ geht.
Anfänglich arbeiteten ausschließlich politisch Denkende in der taz – deswegen gab es zunächst auch keine Wirtschaftsredaktion, weil, so wurde gesagt, jeder Artikel dem Marxismus verpflichtet sein müsse. Spätestens seit dem Verschwinden der Volksbefreiungsbewegungen, der Staatssozialismen und der Arbeiterklasse werden jedoch mehr und mehr journalistisch Ausgebildete bzw. Auszubildende eingestellt. Und statt weiter die Produktionsverhältnisse zu kritisieren, fand ein Wechsel zum „kritischen Konsum“ statt (u.a. von Stefan Kuzmany und Peter Unfried forciert), aber auch die „Kultur“ beschäftigt sich fast nur noch mit Waren: Film, Buch, Theater, Musik, Kunst. Ähnlich bei der „Politik“ – unter die nun auch die Parteien Beachtung finden – ein „Verrat“, der bereits mit Rudi Dutschke begann. Dementsprechend wird mitunter auch nicht mehr zwischen Künstlern und „Kreativen“ unterschieden. Bei all dem ging die zunehmend angestrebte „Professionalität“ immer weniger in die Tiefe, d.h. in die „Klassiker“ der Warenanalyse, sondern im Gegenteil: an die Oberfläche – zur „Aktualität“ hin (verbunden mit „Personalisierung“ und „Redundanz“). Manchmal kann man geradezu von einem „Aktualitätswahn“ sprechen, der von den selbst auferlegten „Formatzwängen“ noch forciert wird. Dass die „dreikäsetaz“ hier befreiend wirkt – wäre eine schöner „taz-traum“ (Fritz Teufel – der gerade im Sterben liegt). Ich befürchte jedoch, dass es eher weiter so um Arbeitsplatzerhaltung geht – und das um jeden Preis. Zumal wir immer noch in extrem restaurativen Zeiten leben.

„Abwärts treibt der Sinn!“ (Novalis)
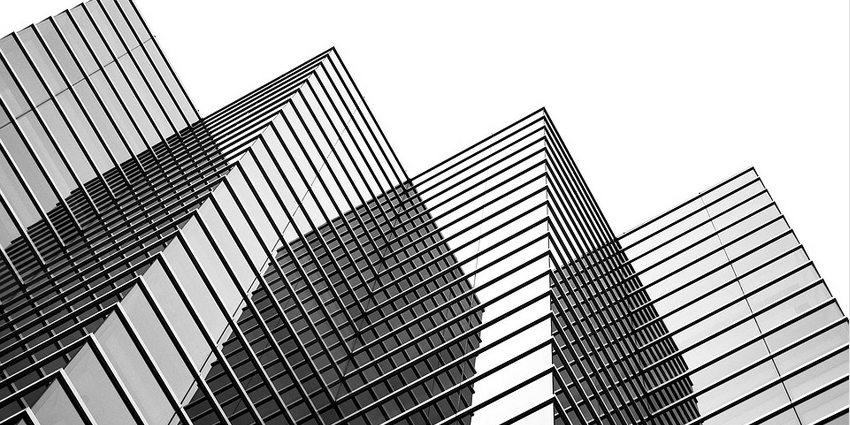



Und nun ist Fritz Teufel doch gestorben – gestern am 6.Juli. Mathias Bröckers schreibt in seinem blog bei 2001:
„Er litt schon seit Jahren schwer an der Parkinson-Krankheit, hatte sie aber noch im Frühjahr so weit unter Kontrolle, dass er sich mit Freunden zum Tischtennis im Tiergarten verabredete. Wie der unlängst verstorbene Dennis Hopper mit „Easy Rider“ war Fritz Teufel für mich als Jugendlicher zum Helden geworden, mit jenem berühmten Satz vor Gericht, als er – angeklagt wegen eine der vielen politischen Aktionen der „Kommune 1“ – sitzen blieb und weiter Zeitung las als die Richter den Verhandlungssaal betraten. Der Aufforderung sich zu erheben, leistete er dann mit dem Kommentar Folge: „Na ja, wenn es der Wahrheitsfindung dient…“. Das war – und ist – ein Statement, das die Haltung der antiautoritären Bewegung auf den Punkt bringt wie kein anderes – und Fritz Teufel zu einer Koryphäe dieser Bewegung und ihres Humors machte, zum ersten Spaßguerillero der Republik. Zu einem freilich, der seine Widerständigkeit nicht als Spaß verstand. Ende der 70er Jahre saß er fünf Jahre in Untersuchungshaft ab, weil er wegen der Entführung des Berliner CDU-Chefs Peter Lorenz angeklagt war. Erst als die Staatsanwaltschaft ihn als Kopf der „Bewegung 2. Juni“ und Entführer abgestempelt und eine hohe Haftstrafe gefordert hatte, präsentierte er sein hieb-und stichfestes „B-Libi“: er hatte zur Tatzeit unter falschem Namen in einer Essener Klodeckeldabrik gearbeitet. Ich kenne niemanden, der der Wahrhheitsfindung und der Entlarvung der Staatsanwaltschaft in politischen Prozessen stoischer gedient hat als Fritz Teufel. Nach seiner Entlassung lernten wir uns kennen, er schrieb Kolumnen für die taz und begleitete mich öfter bei den Besuchen unseres „Chefkolumnisten“ Wolfgang Neuss. Anders als dieser, der seinem Namen stets alle Ehre machte und Noise und Neues heraussprudelte, war Fritz alles andere als ein wilder Teufel: im Auftreten eher zurückhaltend, statt krachender Pointen eher leise Wortspiele, statt diabolischem Lachen eher spöttisches Grinsen….“