
Altes Hotline-Telefon. Photo: dasyalar.huriyet.com.tr
H.H.: Guten Tag, bin ich mit dem Verfassungsschutz verbunden? Ich bin Linksextremer und möchte aussteigen.
VS: Das begrüße ich, aber wir sind nur für Rechtsextreme zuständig. Da müssen Sie sich an die Hotline des Familienministeriums wenden, ich gebe Ihnen mal die Nummer…
H.H.: Hotline? Na so eilig ist es nicht, ich bin jetzt seit 1967 Linksextremer, da kommt es auf eine Woche mehr oder weniger auch nicht mehr an.
VS: Das heißt nur so. Die Nummer ist – 0180-190 70 50.
H.H.: Guten Tag, ist dort die Hotline für linksextreme Aussteiger?
FM.: Ja, Sie sind hier richtig, ich höre…
H.H.: Ich bin immer noch Linksextremist und würde den ganzen Radikalenscheiß gerne hinter mich lassen, zu neuen Ufern gelangen. Alle meine früheren Genossen haben es auch geschafft. Ich erinnere nur an Hans-Christoph Buch, Peter Schneider, Joschka Fischer, Tom Koenigs, Götz Aly, Thomas Schmidt, Gerd Koenen…Was sagen Sie – oder hören Sie nur zu?
FM: Nein, ich gebe zu bedenken, die eben von Ihnen Erwähnten, das sind alles mehr oder weniger prominente Linksextremisten – gewesen. Und die wollten was werden: prominent oder was auch immer. Was versprechen Sie sich von einem Ausstieg Ich frage nach Ihrer Motivation?
H.H.: Erst mal, dass ich nicht immer so beleidigt bin. Das fängt schon morgens beim Zeitungslesen an: mit diesem ganzen angepaßten Seich. Die mangelnde Radikalität ärgert mich manchmal so, das ich mich in Gewaltphantasien reinsteigere.
FM: Ich verstehe. Ja, da sollten wir uns wirklich Gedanken drüber machen, wie man das abstellen kann. Sie würden damit wieder Lebensfreude zurückgewinnen…
H.H.: Sie meinen, wie ich sie hatte, bevor ich lesen lernte?
FM: Nein natürlich nicht, ich meine einen Zustand, in dem man auch den ‚angepasstesten Seich‘, also das oberflächlichste oder verlogenste, gelassen zur Kenntnis nimmt.
H.H.: Genau, und deswegen denke ich, ich muß raus aus dem Linksextremismus. Die Gesellschaft ist spätestens seit der Wende so reaktionär und gemein geworden, dass ich befürchten muß, damit vollends ins Abseits zu geraten…
FM: Ja, darum geht es auch im Aussteigerprogramm für Neonazis von unseren Kollegen beim Verfassungsschutz. Nur die bekommen ihre aussteigewillige Klientel von ihren V-Leuten in den Leitungsgremien rechtsradikaler Organisationen quasi überstellt. Da handelt es sich meistens um Unzuverlässige, die die los sein wollen, ohne dass die sich dann in Wort und Tat gegen sie wenden. Das ist denen früher ein paar Mal passiert. Sie sind uns aber von keiner linken Organisation oder Partei empfohlen worden, oder?
H.H.: Nein, ich habe nie einer angehört.
FM: Aber Linksextremist sein – und allein, ist das nicht ein Widerspruch?
H.H.: Davon rede ich doch, dass meine Einstellung mich da reintreibt. Abgesehen davon gibt es neben einer Organisation oder Partei ja auch noch andere Kollektive, wenn auch kurzlebigere.
FM: Können Sie mir welche nennen?
H.H.: Es geht doch hier nicht um meine Einwanderung in die USA, ich wollte mit dem Aussteigerprogramm verbunden werden.
F.M.: Das sind Sie, aber es macht doch auch in extremistischer Hinsicht einen Unterschied, ob Sie, jetzt nur mal als Beispiel, in einer vergrübelten Trotzki-Studiengruppe mitmachen oder beim eher aktionsorientierten Autonomen-Info „Interim“…
H.H.: Und Sie würden lieber Aktivisten als Grübler zum Ausstieg…raten?
F.M.: Wir haben ja gerade erst damit angefangen. Dies ist auch ein Experiment unserer Ministerin. Also, nein, das würde ich nicht sagen. Es geht uns generell um Leute, die sich nach Links verrannt haben – politisch gesehen.

Neues Hotline-Telefon. Photo: uni-muenster.de
P.S.: „Jesus.de“ meldet: Per Telefon und E-Mail will das Bundesamt für Verfassungsschutz Islamismus-Aussteigern helfen. Dass Maßnahmen notwendig sind, zeigt der aktuelle Verfassungsschutzbericht. Demnach hat sich die Propagandaaktivität extremistischer Netzwerke wie „Al Qaida“ in Deutschland verstärkt. Trotzdem stößt die Telefonseelsorge für radikale Muslime auf Kritik. HATIF ist der Titel einer neuen Taktik gegen islamistischen Extremismus in Deutschland. Die Abkürzung steht für „Heraus aus Terrorismus und Islamistischem Fanatismus“ – und das soll vorrangig via Telefon funktionieren. Gleichzeitig ist HATIF auch das arabische Wort für Telefon.
Lebensberatung mit dem neuen Telefon. Photo: lebensberatung-am-telefon.de
Anhang:
Wie der Linksextremist Leo Trotzki das Telefon nutzte:
„Die Karte ist nicht das Gelände,“ gab Gregory Bateson zu bedenken, aber kann man eine Lage wenigstens „telefonisch beobachten“, wie Trotzki meinte?
„Wir dürfen nicht mehr miteinander reden, wir müssen kommunizieren!“ seufzte Jean Baudrillard in den Achtzigerjahren – noch vor der allgemeinen Verbreitung der schnurlosen Handys, die inzwischen samt SMS abgehört werden dürfen. Gleichzeitig geriet auch den Kulturkritikern die schier manische öffentliche Telefoniererei immer öfter ins Visier – schon aus reiner Notwehr. So befaßte sich Vilém Flusser z.B. mit dem Machtgefälle zwischen dem Anrufer und den Angerufenen. Bereits zu Roland Barthes‘ Zeiten spielte das (damals noch analoge) Telefon eine große Rolle im Leben der Menschen: „Ich versage es mir, auf die Toilette zu gehen, und selbst zu telephonieren, um die Leitung freizuhalten,“ schrieb er in den „Fragmenten einer Sprache der Liebe“ 1984. Jetzt gibt es bald keinen einzigen Spielfilm mehr, in dem die Handlung nicht durch einen oder mehrere Anrufe immer wieder in Schwung gebracht wird. Das Mobiltelefon, das unsere „availability“ revolutioniert hat, ist ein direktes Resultat der Kybernetik und Waffenlenk-Systemforschung – also ein Produkt des Zweiten Weltkriegs, aus der zunächst die Computer- und Gentechnik hervorging. In der US-Army sagen die Unteroffiziere heute nicht mehr: „Ich befehle!“ Sie brüllen: „Do we communicate?!“ Auch in früheren Kriegen trug das Telefon schon das Seinige zum Sieg bei, erst recht in Revolutionen und Bürgerkriegen. Telefon und Telegrafie wurden im so genannten „Imperialen Zeitalter“ (1875-1914) erfunden. Letzteres „ermöglichte nunmehr die Übermittlung von Nachrichten um den gesamten Erdball innerhalb weniger Stunden,“ schreibt Eric Hobsbawm. Vom Telegrafen gelangten die Nachrichten in die damals ebenfalls neuen Publikumszeitungen. Trotzki war ein geradezu fanatischer Zeitungsleser (und -schreiber) – er interessierte sich für jede noch so kleine Nachricht aus jedem Land der Erde – und auch das Telefon wußte er bald virtuos zu nutzen. Laut Hobsbawm breiteten sich die Telefonanschlüsse um 1900 weltweit wie folgt aus: Unter den Großstädten hatte St.Petersburg die wenigsten: dort stiegen sie im Zeitraum zwischen 1895 und 1911 von 0,2 auf 2,2 Anschlüsse je 100 Einwohner; in New York von 0,6 auf 8,3; in Chicago von 0,8 auf 11,0 und in Stockholm von 4,1 auf 19,9. Die meisten Anschlüsse besaß damals Los Angeles, wo sie sich im fraglichen Zeitraum von 2,0 auf 24,0 für je 100 Einwohner exakt verzwölffachten – und zwar wegen der dort 1911 loslegenden Filmindustrie (!).
In Leo Trotzkis Autobiographie „Mein Leben“ kommt das „Telefon“ vor der russischen Revolution nur einmal vor. Es wird aber sogleich in seiner revolutionären Bedeutung von ihm erkannt. Das war, als er und seine Familie aus ihrem französischen Exil ausgewiesen wurden – und Ende 1916 in New York landeten, wo sie in einer Arbeitergegend eine billige Wohnung fanden, die jedoch überraschenderweise mit Bad, elektrischem Licht, Lastenaufzug und sogar mit einem Telefon ausgestattet war. Für Trotzkis zwei Söhne wurde das Telefonieren in New York „eine Weile zum Mittelpunkt ihres Lebens: Dieses kriegerische Instrument hatten wir weder in Wien noch in Paris gehabt.“
Aber dann spielte der Apparat für Trotzki erst wieder im darauffolgenden Jahr in St.Petersburg – während der Machtübernahme der Bolschewiki – eine, zunehmend wichtiger werdende, Rolle. Seine erste Bemerkung über das „kriegerische Instrument“ betraf jedoch erst einmal dessen Nichtfunktionieren (den „Punkt Null“ – mit Roland Barthes zu sprechen): „Auf dem Telefonamt entstanden am 24.10. Schwierigkeiten, dort hatten sich die Fahnenjunker festgesetzt, und unter ihrer Deckung waren die Telefonistinnen in Opposition zum Sowjet getreten. Sie hörten überhaupt auf, uns zu verbinden.“ Das Revolutionskomitee, deren Vorsitzender Trotzki war, schickte eine Abteilung Soldaten mit zwei Geschützen hin, dann „arbeiteten die Telefone wieder. So begann die Eroberung der Verwaltungsorgane.“ In seiner „Geschichte der russischen Revolution“, die Trotzki neben seiner Autobiographie im türkischen Exil (1929-1933) schrieb, heißt es dazu ergänzend: „Es genügt ein nachdrücklicher Besuch des Kommissars des Kexholmer Regiments im Telephonamt, damit die Apparate des Smolny wieder angeschlossen waren. Die Telephonverbindung, die schnellste von allen, verlieh den sich entwickelnden Ereignissen Sicherheit und Planmäßigkeit…Dshershinski händigte dem alten Revolutionär Pestkowski einen Papierfetzen aus, der ein Mandat auf den Posten eines Kommissars des Haupttelegraphenamtes darstellen sollte. – ‚Wie das Telegraphenamt besetzen?‘ fragte nicht ohne Staunen der neue Kommissar. – ‚Dort hält das Kexholmer Regiment Wache, das auf unserer Seite ist!‘ Weiterer Erklärungen bedurfte Pestkowski nicht. Es haben zwei mit Gewehren versehene Kexholmer am Stromschalter genügt, um ein zeitweiliges Kompromiß mit den feindlichen Telegraphenbeamten, unter denen es nicht einen Bolschewik gab, zu erreichen. Um 9 Uhr abends besetzte ein anderer Kommissar des Militärischen Revolutionskomitees, Stark, mit einer kleinen Abteilung Seeleute unter dem Kommando des Matrosen Sawin, eines früheren Emigranten, die amtliche Telegraphenagentur, was nicht nur das Schicksal der Institution selbst, sondern bis zu einem gewissen Grade auch sein eigenes bestimmte: Stark war erster Sowjetdirektor der Agentur, bevor er Sowjetgesandter in Afghanistan wurde. Stellten diese zwei bescheidenen Operationen Akte des Aufstandes dar oder nur Episoden der Doppelherrschaft, allerdings von dem versöhnlerischen auf das bolschewistische Geleise umgeleitet? Die Frage kann begründeterweise kasuistisch erscheinen. Aber für die Tarnung des Aufstandes hatte sie immer noch gewisse Bedeutung. Tatsache ist, daß sogar das Eindringen der bewaffneten Matrosen noch den Charakter der Halbheit trug: formell handelte es sich vorläufig nicht um die Besetzung des Amtes, sondern nur um die Errichtung einer Telegrammzensur. Somit wurde bis zum Abend des 24. die Nabelschnur der ‚Legalität‘ nicht endgültig durchschnitten, die Bewegung deckte sich noch immer mit den Resten der Doppelherrschaftstradition.“ Der nach 1945 im schwedischen Exil gebliebene Schriftsteller Peter Weiss hat diesen bolschewistischen Kampf ums Telefon in sein Stück „Trotzki im Exil“ eingebaut, das er 1969 in der DDR uraufführen lassen wollte, wo man es jedoch als „durch und durch antisowjetisch“ begriff: „Ein Telephon wird bedient“. Dshershinski erklärt: „Am Telegraphenamt haben wir das Kexholmer Regiment. Zwei Mann an die Hauptschalter. Das genügte. Die Beamten begriffen, wer hier bestimmt.“ Ein Matrose ergänzt: „Das war ein Geschrei, als wir mit unserm Trupp kamen. Die Telephonistinnen hysterisch durcheinander. Werfen die Arme hoch. Was ist Frauen, glaubt ihr, wir wollen euch erschießen? Ihr könnt gehn. Wir werden mit den Apparaten schon fertig. Und die raus. Die ganze Morskaja Straße voll von kreischenden Mänteln und Hüten (Gelächter).“ Ähnlich bemächtigte sich die Revolution dann laut Peter Weiss auch der anderen Institutionen. Ein Matrose berichtet: „Wir haben die Staatsbank besetzt“ – die der Bolschewik Rakowski als „die heiligste aller Institutionen“ bezeichnete. Der Matrose schildert ihr Vorgehen: „Am Jekaterinski Kanal ein Zug von Kadetten. Wie die uns sehn, gaffen sie nur. Wir haben den Auftrag, die Bank zu schützen, sagen wir. Die lassen uns vorbei, ohne Widerstand. Wir ins Gebäude rein. Die Türen waren nicht mal verschlossen. Haben gleich an jedem Telefon einen Posten aufgestellt.“
Trotzki hielt sich derweil im Smolny auf, mit Kamenjew belegte er das Eckzimmer, wo Tag und Nacht „Telefonanrufe“ ankamen, wie er schreibt. Das Eckzimmer glich „der Kommandobrücke eines Kapitäns, im Nebenzimmer war eine Telefonzelle – es klingelte ununterbrochen.“ Wegen dieser „Führungsposition“ hat ihn später der Kriegsberichterstatter Curzio Malaparte als Drahtzieher eines „Staatsstreichs“ bezeichnet, den Malaparte jedoch nicht von einem Volksaufstand geschweige denn einer Revolution unterschied. 1932 ging Trotzki in seiner „Kopenhagener Rede“ kurz auf den mit fiktiven Dialogen zwischen ihm und Lenin gestützten „Unsinn“ dieses „faschistischen Theoretikers“ ein.
Im Oktober 1917 war es kalt in Petrograd. „Es fehlte Kohle.“ Die Straßenpatrouillen wärmten sich an offenen Feuern. „An zwei Dutzend Telefonen konzentrierte sich das geistige Leben der Hauptstadt. Man rief mich aus Pawlowsk an,“ heißt es bei Trotzki weiter. Er erteilte den Kommissaren Befehle. Doch war er sich der Macht seiner Befehle „selbst nicht ganz sicher.“ Zudem „werden alle Gespräche telefonisch geführt“ – und sind so den „Agenten der Regierung vollständig zugänglich“. Trotzki beruhigt sich mit dem Gedanken, dass sie wahrscheinlich gar nicht mehr imstande seien, „unsere Gespräche abzuhören“. Alle „wichtigen Punkte der Stadt“ gehen nach und nach „in unsere Hände über; fast ohne Widerstand, ohne Kampf, ohne Opfer. Das Telefon klingelt: ‚Wir sind hier.'“
Vor dem Petrograder Sowjet berichtet er anschließend über die Lage: „Wir haben die Nacht durchwacht und telefonisch beobachtet“ – wie die revolutionären Soldaten und Arbeiter „lautlos ihre Sache durchführten. Der Bürger hat friedlich geschlafen.“ Kamenjew wurde dann von Lenin abgelöst. Einmal lagen er und Trotzki zusammen auf einer Matraze und unterhielten sich noch – müde. Plötzlich schreckte Lenin hoch: „Und das Winterpalais – ist doch bis jetzt noch nicht eingenommen?“ Trotzki wollte schon aufstehen, um sich „telefonisch zu erkundigen“, aber Lenin sagte, „bleiben Sie liegen, ich werde jemand damit beauftragen.“ Ein andern Mal meinte er zu Trotzki: Ob die Bolschewiki an der Macht bleiben würden, das könne man nicht voraussehen. Man müsse aber unter allen Bedingungen möglichst viel Klarheit in die revolutionären Erfahrungen der Menschheit hineibringen: „Es werden andere kommen und, auf das von uns Vorgezeichnete gestützt, einen neuen Schritt vorwärts tun.“ Deswegen arbeitete Lenin laut Trotzki vor allem mit präzise formulierten „Dekreten“, die jedoch „eine mehr propagandistische als administrative Bedeutung“ hatten. Bei ihrer Formulierung stützte er sich vor allem auf seine „Kraft der realistischen Vorstellungsgabe“. Bei Peter Weiss gibt es dazu eine Regieanweisung: „Die meisten ab. Nur Lenin und Trotzki vorn. Im Hintergrund der Telephonist. Hin und wieder Meldegänger ein und aus. Lenin legt sich auf das Feldbett. Trotzki, in seiner Nähe, streckt sich auf ein paar aneinandergestellten Stühlen aus. Eine Arbeiterin legt ihnen ein paar Soldatenmäntel über.“
Als Trotzki dann – lustlos – das Außenministerium übernahm, ordnete er als erstes an, dass die ständig „falsche Meldungen“ aussendenden Franzosen in Petrograd „den Empfangsapparat der drahtlosen Telegraphie aus der Militärmission“ stilllegten. Als Grigori W. Tschitscherin aus dem Gefängnis kam und sein Amt übernahm, war er froh: „Manchmal beriet sich Tschitscherin noch telefonisch mit mir.“ Nach dem Umzug der Revolutionsregierung in den Moskauer Kreml bemühten sich Lenin und Trotzki noch energischer, die Arbeit zu straffen und zu effektivieren, dazu gehörten u.a. telefonische Absprachen: Wenn in einer Sitzung ein wichtiges Problem diskutiert werden sollte, „bestand Lenin telefonisch darauf“, dass Trotzki sich „vorher mit der zu behandelnden Frage vertraut“ machte. Wenn Lenin ernsthafte Opposition befürchtete, „ermahnte“ er ihn „telefonisch: ‚Kommen Sie unbedingt zur Sitzung…“ Nachdem Trotzki Kriegskommissar geworden war, verkehrte er mit Lenin sogar „hauptsächlich telefonisch“. Wenn die Ämter ihm z.B. mit „Beschwerden über die Rote Armee“ zusetzten, „dann klingelte Lenin sofort bei mir an“.
Nachdem Trotzki den Militärarzt Skljansky zu seinem Stellvertreter ernannt hatte, „sprach“ dieser vom Kriegsamt aus „unaufhörlich rauchend über die direkten Telefonleitungen“. Umgekehrt konnte Trotzki ihn noch „in der Nacht um zwei, um drei Uhr anrufen“ – Skljansky war immer im Büro. Wenig später ist irritierenderweise sogar von einer „Autorität der Leitung“ im Text die Rede.
Am 7. November wandte sich Trotzki „radiotelegraphisch an die Staaten der Entente und an die Mittelmächte – mit einem Vorschlag“. In Brest-Litowsk kam es daraufhin zu Friedensverhandlungen: „Sowohl wir als auch unsere Gegner mußten über eine direkte Leitung mit den jeweiligen Regierungen Verbindung unterhalten. Die Leitung versagte nicht selten.“ Ob die „Störungen“ auf Absicht oder technisches Versagen zurückzuführen waren, konnte Trotzkis Delegation nicht klären.
Nachdem die Sowjettruppen Kiew besetzt hatten, stellte „Radek über eine direkte Leitung die Frage nach der Situation“ dort. Woraufhin ihm ein „deutscher Telegraphist von einer Zwischenstation aus“ und ohne zu wissen, wer am anderen Ende der Leitung war, mitteilte: „Kiew ist tot.“ Trotzki telefonierte von Brest-Litowsk aus mit Lenin. Sie waren sich einig: Es ging darum, Zeit zu gewinnen und notfalls, sollten die Deutschen wieder angreifen, zu kapitulieren. „Schon damit allein werden wir die Legende von unserer heimlichen Verbindung mit dem Hohenzollern einen vernichtenden Schlag versetzen,“ meinte Trotzki. Und Lenin war der Meinung: „Die deutsche Revolution ist unermeßlich wichtiger als die unsrige.“ Den beiden hatte man unterstellt, quasi im Auftrag von Ludendorff in Russland die Revolution angezettelt zu haben. Ihre Gespräche über „die Huges-Leitung galten offiziell als gegen Abhören und Auffangen gesichert. Wir hatten jedoch alle Veranlassung, anzunehmen, dass die Deutschen in Brest unsere Korrespondenz über die direkte Leitung lasen: wir hatten genügend Respekt vor ihrer Technik. Die gesamte Korrespondenz zu chiffrieren war unmöglich. Wir konnten uns im übrigen auch auf die Chiffrierung nicht verlassen.“
Erst während des zweiten Weltkriegs wurde ernsthaft an einem abhörsicheren Telefon (für Stalin) mit sofortiger Verschlüsselung der gesprochenen Sprache gearbeitet – u.a. waren der Mathematiker Alexander Solschenizyn, der Sprachwissenschaftler Lew Kopelew und der Ingenieur Dimitri Panin als Häftlinge an diesem „Geheimprojekt“ beschäftigt. Solschenizyn hat ihre intellektuelle Zwangsarbeit in seinem Buch „Der erste Kreis der Hölle“ beschrieben, Kopelew in „Aufbewahren für alle Zeiten“ und Panin in den „Notebooks of Sologdin“.
1918 hatten die Bolschewiki „in manchen Augenblicken das Gefühl, dass alles auseinanderkrieche…Das Eisenbahnwesen war vollständig desorganisiert. Der Staatsapparat kaum im Werden.“ Und die Kommunikation wurde immer schlechter. Als Oberkommandierender begab sich Trotzki an die Südfront – mit einem „Eisenbahnzug“, den er sich jedoch erst einmal mühsam „zusammenstellen“ mußte. Dazu gehörte dann „ein Sekretariat, eine Druckerei, ein Telegraphenamt, eine Telefunken- und eine elektrische Station, eine Bibliothek, ein Badebetrieb“ – und eine eigene „Zugzeitung“ namens „WPuti“ (Unterwegs). Ferner eine schnelle Eingreiftruppe, die dann wie alle im Zug Lederjacken trug. Der Telegraph im Zug arbeitete ununterbrochen. „Wir konnten uns über eine direkte Leitung mit Moskau verbinden, und mein Vertreter Skljanski empfing von mir die Aufstellung der für die Armee notwendigen Ausrüstungsgegenstände.“ Mindestens 105.000 Kilometer legte Trotzkis Zug, der von zwei gepanzerten Loks gezogen wurde, zurück. Und überall, wo er hinkam „nistete Verrat“. Bei einer vorderen Batterie empfing ihn einmal ein Artillerieoffizier. „Er bat um Erlaubnis, abzutreten und telefonisch einen Befehl zu erteilen“. Kurz darauf schlugen „in nächster Nähe“ von Trotzki zwei Granaten ein. Erst lange danach wurde ihm klar, dass „der Artillerist telefonisch über irgendeinen Zwischenpunkt der feindlichen Batterie das Ziel angegeben hatte“. Im Nachhinein ließ sich aber sagen: Dieser „Krieg war eine große Schule.“ Kam noch hinzu: „In jenen Jahren habe ich mich, wie mir scheint, für immer daran gewöhnt, unter Begleitung der Pullmannschen Federn und Räder zu schreiben und zu denken…Die meisten Fahrten entfielen auf das Jahr 1920.“
Trotzki zur Seite stand damals der „Hauptleiter der 5.Armee“ I.N. Smirnow, der „den komplettesten und vollendetsten Typus des Revolutionärs“ verkörperte. Er war danach u.a. „Volkskommissar für Post und Telegraphenwesen“ – und wurde dann als „Trotzkist“ in den Kaukasus verbannt. Im Zug erhielt Trotzki einmal ein „chiffriertes Telegramm von Lenin und Swerdlow“, in dem es um „Verrat an der Saratower Front“ ging. Die Front hatte sich jedoch über 8000 Kilometer ausgedehnt und es war ihm unmöglich, dort schnell hin zu gelangen – oder überhaupt einen Kontakt herzustellen. „Nicht selten reichte das Telefonmaterial nicht einmal zum Aufrechterhalten der Verbindungen“. Dafür war „auf einem besonderen Waggon eine Antenne gezogen, die es ermöglichte, unterwegs Radiotelegramme vom Eifelturm und von Nauen, insgesamt von 13 Stationen, in erster Linie natürlich von Moskau, zu empfangen. Der Zug war stets darüber orientiert, was in der Welt vorging.“ Darüberhinaus waren „die Waggons miteinander durch Innentelefone und Signalvorrichtungen verbunden. Um die Wachsamkeit zu erhöhen, wurde unterwegs oft, am Tage wie in der Nacht, Alarm gemeldet.“
Gegen Ende des Bürgerkriegs wurde „der Zug in seiner Gesamtheit“ mit dem Orden der Roten Fahne ausgezeichnet. Zuvor hatte man einen zweiten Panzerzug zusammengestellt, der nach Lenin benannt worden war. Zwischen beiden gab es eine direkte Verbindung. Als die Weißen Truppen des Generals Judenitsch sich Petrograd näherten, brach Panik unter den Bolschewisten auf. Trotzki bestand im Gegensatz zu Lenin darauf, die Stadt zu verteidigen – und organisierte den Widerstand: „Durch das Telephon im Smolny bestellte ich aus der Militärgarage ein Automobil. Der Wagen kam nicht rechtzeitig. Aus der Stimme des Aufsehers fühlte ich, daß Apathie, Verzagtheit und Kleinmut auch die unteren Schichten des Apparats erfaßt hatten.“ Dennoch gelang es, Judenitschs Truppen zurückzuschlagen. Anschließend bekam Trotzki dafür selbst den Orden der Roten Fahne: „Mich brachte dieser Beschluß in eine schwierige Lage…Als ich den Orden einführte, betrachtete ich ihn als ein ergänzendes Stimulans für jene, die nicht genügend inneres revolutionäres Pflichtbewußtsein besaßen.“
„Einige Monate später ließ Lenin mich ans Telefon rufen. ‚Haben Sie das Buch von Kirdezow gelesen?‘ Dieser Name sagte mir nichts. ‚Das ist ein Weißer, ein Feind, der über den Angriff Judenitschs auf Petrograd schreibt…auch über Sie…'“ Am 22. März 1919 forderte Trotzki „über die direkte Telefonleitung von dem Zentralkomitee einen Beschluß in der Frage der Ernennung einer autoritären Kommission seitens des Zentralexekutivkomitees und des Zentralkomitees der Partei.“ Aufgabe der Kommission sollte es sein, „den Glauben an die Zentralsowjetmacht unter der Bauernschaft des Wolgsgebiets zu stützen…Es ist nicht uninteressant, daß ich dieses Gespräch mit Stalin führte und gerade ihm die Bedeutung der Mittelbauern auseinandersetzte.“ Einer der Vorwürfe gegen Trotzki lautete später: Er habe die Bauernfrage falsch eingeschätzt. Ein anderer Vorwurf betraf die allzu konsequente Umwandlung von autonomen Partisanengruppen und -banden, die über ihre Angriffe abstimmten und ihre Führer wählten – in befehlempfangende Truppenteile der Roten Armee: „Das chaotische Partisanentum war der Ausdruck der bäuerlichen Grundlage der Revolution“. Damit zusammenhängend erregte auch Trotzkis Weiterverwendung von zigtausend zaristischen Offizieren an der Front allgemeinen Unwillen. Aber, so Trotzki, die „Kommunisten fanden sich nicht leicht in die militärische Arbeit hinein…Noch von Kasan telegraphierte ich an Lenin: ‚Nur solche Kommunisten herschicken, die fähig sind, sich unterzuordnen, Entbehrungen zu ertragen und gewillt sind, auch zu sterben. Leichtgewichtige Agitatoren braucht man hier nicht.“
Ein weiteres Problem war Zarizyn, das spätere Stalingrad, wo unter Stalins und Woroschilows Leitung auf andere Weise eine von „Selbständigkeitsbestrebungen“ geprägte „Linie“ verfolgt wurde. „Am 4.Oktober 1918 sagte ich über die direkte Leitung aus Tambow zu Swerdlow und Lenin: „Ich bestehe kategorisch auf der Abberufung Stalins. Die Zarizyner Front ist unsicher. Ich habe sie verpflichtet, zweimal am Tag über die Truppenbewegungen und den Kundschafterdienst zu berichten. Wenn das bis morgen nicht geschehen sollte, übergebe ich Woroschilow dem Gericht…“ Am 10. Januar 1919 „berichtete“ Trotzki dem damaligen Vorsitzenden des Zentralexekutivkomitees Swerdlow „von der Station Grjasi aus“, dass die „Zyrizyner Linie“ in die Katastrophe führe. Am 30.Mai bekam Trotzki von Lenin „über die direkte Leitung nach der Station Kantemirowka“ mitgeteilt, dass man daran denke, eine besondere unkrainische Armeegruppe unter dem Kommando von Woroschilow zu bilden. Trotzki lehnte das entschieden ab. Wenig später teilte ihm Lenin „über die direkte Leitung mit: ‚Dybenko und Woroschilow schleppen das Kriegsgut auseinander'“ – das sie zuvor den Weißen abgenommen hatten. Überhaupt besprach Lenin oft mit Trotzki „telephonisch den Gang einer Sache“.
Aber es wurde März – 1923. „Lenin lag in seinem Zimmer im großen Senatsgebäude. Es nahte der zweite Schlaganfall.“ Trotzki war für einige Wochen durch einen Hexenschuß ans Bett gefesselt: „Weder Lenin noch ich konnten ans Telefon gehen, außerdem waren Lenin von den Ärzten telephonische Gespräche strengstens untersagt.. Zwei Sekretärinnen Lenins, Fotijewa und Glasser, dienten als Verbindung.“ Fünf Seiten weiter heißt es bereits: „Stalin stand am Steuer des Apparates“. Als Trotzki wieder aufstehen konnte, ging er seltsamerweise erst einmal auf die Jagd. Als es Lenin etwas besser ging, wollte er ebenfalls mit auf die Jagd gehen. „‚Dürfen Sie?‘ fragte vorsichtig Muralow. ‚Ich darf, ich darf, man hat es mir erlaubt, also Sie nehmen mich mit?‘ ‚Gewiß…‘ ‚Dann werde ich Sie anrufen…‘ ‚Wir werden warten.‘ Aber Iljitsch hat nicht angerufen. Die Krankheit läutete an. Und dann der Tod.“ (alles am Telefon?!) Am 21. Januar 1924 befand sich Trotzki in Tiflis: „Ich saß mit meiner Frau im Arbeitsabteil meines Waggons.“ Man reichte ihm „ein dechiffriertes Telegramm von Stalin, daß Lenin gestorben sei…Ich ließ mich über eine direkte Telegraphenleitung mit dem Kreml verbinden…Die Tifliser Genossen verlangten, dass ich mich sofort zum Tode Lenins äußere.“ Trotzki setzte sich hin und verfaßte einige Abschiedszeilen. „Den Text…gab ich über die direkte Leitung nach Moskau weiter.“ Dann kam der nächste Schlag: Trotzkis enger Vertrauter Skljanski fuhr nach Amerika – und ertrank beim Bootfahren in einem See. Und die Urne mit seiner Asche wollte das Sekretariat des Zentralkomitees dann nicht auf dem Roten Platz in der Kremlmauer, „die das Pantheon der Revolution geworden“ war, einmauern lassen – sie sollte außerhalb der Stadt beigesetzt werden. „Den Ekel überwindend telephonierte ich Molotow an. Doch der Beschluß blieb unerschüttert. Die Geschichte wird auch diese Frage revidieren.“
Während man im Kreml an seiner Entmachtung arbeitete, wurde Trotzki erneut krank. „Morgens brachte man mir die Zeitungen ans Bett. Ich sah die Telegramme durch.“ Er fuhr in Begleitung seiner Frau nach Berlin, wo ihm die Mandeln rausoperiert wurden. „Wir besuchten das Baumblütenfest in Werder.“ Wieder zurück in Moskau war er immer noch krank. „Ich wohnte in jenen Tagen nicht mehr im Kreml, sondern in der Wohnung meines Freundes Beloborodow“. Dieser hielt sich damals im Ural auf – formal war er noch Volkskommissar des Innern, aber die GPU war ihm schon „auf den Fersen“.
Auch Trotzkis vielleicht engster Freund Joffe war krank – und wurde immer depressiver. „Ich klingelte in Joffes Wohnung an, um mich nach seiner Gesundheit zu erkundigen. Er antwortete selbst: das Telephon stand an seinem Bett…Er bat mich, zu ihm zu kommen…Etwas verhinderte mich, zu kommen.“ Nur ein oder zwei Stunden später klingelte es in Beloborodows Wohnung und „eine mir unbekannte Stimme sagte am Telefon: ‚Adolf Abramowitsch hat sich erschossen‘.“
Im Januar 1928 wird Trotzki mit seiner Frau und seinem Sohn nach Kasachstan verbannt. Der Tag ihres Abtransports hat sich herumgesprochen, sie sitzen zu Hause auf gepackten Koffern: „Wir warten auf die Agenten der GPU, die uns zum Zug begleiten sollen“. Niemand kommt. „Das Telefon klingelt. Aus der GPU teilt man mir mit, die Reise sei verschoben.“ Alle, die noch zu ihm halten, warten bereits auf dem Bahnhof, um ihn zu verabschieden. „Fortwährend erkundigten sich Freunde telephonisch, ob wir zu Hause seien und berichteten über die Ereignisse auf dem Bahnhof.“ Am nächsten Tag schliefen die Trotzkis sich erst einmal aus. „Niemand klingelte.“ Aber dann füllte sich die Wohnung plötzlich mit GPU-Agenten, die auf sofortigen Abtransport drangen. „Das Telefon klingelte ununterbrochen. Aber am Telephon steht ein Agent und verhindert mit gutmütiger Miene das Antworten. Nur durch Zufall gelingt es, Beloborodow zu benachrichtigen, …dass man uns mit Gewalt wegbringen werde.“ Wahrscheinlich hat dies Trotzkis Sohn erledigt. Bei Peter Weiss heißt es: „Ljowa ist schon draußen. Telegraphieren. Aber es wird nichts nützen.“Anschließend verbarrikadierten die Trotzkis sich in einem der Zimmer. Die GPU-Agenten „wußten nicht, was zu tun, schwankten, führten telefonische Unterredungen mit ihren Vorgesetzten, erhielten Weisungen….“ Schließlich brechen sie die Tür auf und tragen ihn aus der Wohnung in ein Auto. Wenig später, als der Zug fuhr, war Trotzki aber schon fast wieder „in guter Stimmung.“ Obwohl gezwungen, „strenge Diät zu halten, aß er alles, was man uns gab,“ wie seine Frau erstaunt in ihr Tagebuch notierte. Sie selbst hatte mit „Schüttelfrost“ zu kämpfen. Das Gepäck war nicht mitgekommen, sie hatten nur ein Buch dabei – über Turkestan. Trotzki las und schrieb Briefe – er „arbeitete un
terwegs stets mit verdoppelter Energie, den Umstand ausnutzend, daß es weder Telefon noch Besucher gab“. Am Ziel – in Alma-Ata – nahmen sie sich erst einmal ein Hotelzimmer. Sein Sohn Ljowa machte sich derweil „mit der Stadt bekannt, zuallererst mit Post und Telegraph, die nun in unserem Leben den Mittelpunkt bilden sollten.“
Die Verbindung mit der Außenwelt lief vor allem über den Sohn. Trotzki nannte ihn „entweder ‚Minister des Äußeren‘ oder ‚Post- und Telegraphenminister‘.“ Tagesüber schrieb er vor allem Briefe und Telegramme, abends ging er oft auf die Jagd. „So verbrachten wir ein Jahr in Alma-Ata.“ Insgesamt schickte Trotzki in dieser Zeit „etwa 800 politische Briefe ab, darunter eine Reihe größerer Arbeiten, und etwa 550 Telegramme. Erhalten haben wir etwa 1000 Briefe, größere und kleinere, und etwa 700 Telegramme, in der Mehrzahl kollektive.“ Dabei erreichte ihn höchstens die Hälfte, „außerdem bekamen wir aus Moskau etwa acht- bis neunmal durch besondere Boten geheime Post, …ebenso viele Male schickten wir solche Post auch nach Moskau. Die Geheimpost unterrichtete uns über alles…“
Ab Oktober 1928 „veränderte sich unsere Lage schroff. Briefe und Telegramme trafen nicht mehr ein…Der Ring um uns schloß sich immer enger.“ Im Januar wurde in Moskau beschlossen, „Den Bürger Trotzki, Lew Dawidowitsch, aus den Grenzen der UDSSR auszuweisen.“ Wieder wird die Familie in einen Zug verfrachtet. Der Vertreter der GPU in Alma-Ata, Bulanow, versucht unterwegs, Trotzki „die Vorzüge Konstantinopels klarzumachen. Ich lehne sie entschieden ab. Bulanow verhandelt über die direkte Leitung mit Moskau.“ In Odessa war der Dampfer „Kalinin“ für den Weitertransport bestimmt. „Der aber ist eingefroren. Alle Bemühungen der Eisbrecher bleiben erfolglos. Moskau steht am Telegraphendraht und treibt zur Beschleunigung.“
Man hatte Trotzki versprochen, dass seine beiden engsten Mitarbeiter Sermux und Posnanski ihm ins Ausland folgen dürfen. In Konstantinopel angekommen, erkundigte Trotzki sich beim Konsulat nach den beiden. Ein Vertreter brachte einige Tage später „die telegraphische Antwort aus Moskau: Sie würden nicht hinausgelassen werden.“ Trotzki telegraphierte sodann mit deutschen sowie auch norwegischen Stellen, um in diesen Ländern politisches Asyl zu bekommen: Er möchte nicht in der Türkei bleiben, aber kein Land will ihn aufnehmen. Schließlich bleibt die Familie erst einmal, wo sie ist: auf Prinkipo – einer Insel vor Konstantinopel. Trotzki findet seinen Arbeitsrythmus wieder: Er schreibt Briefe über Briefe, Broschüren, Flugblätter, Bücher – in seine Autobiographie arbeitete er Teile des Tagebuchs seiner Frau ein. Auch telephoniert und telegraphiert wird weiterhin: das erledigt zum Teil sein „Post- und Telegraphenminister“ Ljowa, vor allem aber die ihm noch immer freundlich gesinnten Genossen – in verschiedenen Ländern. In Deutschland ist es seine Übersetzerin Alexandra Ramm, Ehefrau des Herausgebers der Zeitschrift „Die Aktion“ Franz Pfempfert. Unermüdlich arbeitet sie Trotzki zu, nimmt Verbindung mit Verlegern und Behörden auf, besorgt Bücher und die „Prawda“ für ihn – auf seine Bitte hin sogar eine besonders reißfeste Angelschnur aus England. In Julijana Rancs Biographie über Alexandra Ramm werden nur einige wenige ihrer Telefonate für Trotzki erwähnt. 1933 mußte Alexandra Ramm selbst emigrieren – sie ging mit ihrem Mann über Tschechien und Frankreich in die USA, während Leo Trotzki mit seiner Frau über Norwegen nach Mexiko weiter zog, wo die GPU ihn im Mai 1940 von ihrem Agenten,Ramon Mercader, der sich Trotzkis Vertrauen erschlichen hatte, mit einem Eispickel ermorden ließ. Der Täter wurde dafür von Stalin mit dem „Leninorden“ geehrt. Zunächst kam er jedoch in Mexiko für 20 Jahre ins Gefängnis. Danach emigrierte er erst nach Kuba und schließlich nach Prag, wo er 1978 starb. Seine Leiche wurde in die Sowjetunion überführt und auf dem Moskauer Kuntsewo-Friedhof begraben, gleichzeitig verewigte man seine ruhmreiche Tat im Gedächtniskabinett der GPU- bzw. KGB-Zentrale.
2006 ergab ein Anruf bei einer Berliner Trotzkistin, dass die russischen Kommunisten Trotzki bis heute nicht rehabilitiert haben – mit der Begründung: Er sei dort nie verurteilt worden. Wladimir Kaminer ergänzte wenig später – ebenfalls am Telefon: Es gab mehrere Rehabilitierungsversuche. Der erste – zum 20. Parteitag, adressiert an Chruschtschow – kam aus Mexiko von der Witwe Leo Trotzkis; der 2. von dem langjährigen Straflager-Häftling Warlam Scharlamow, der sich zur Linksopposition zählte und mit Solschenizyn den „Archipel GULag“ zusammenstellte; der 3. kam von Gregor Gysi, der sich dazu 1989 mit dem damaligen ZK-Sekretär Jakowlew in Moskau traf. Dieser lehnte das Ansinnen ab, mit der Begründung, es klebe zu viel Blut an den Händen von Trotzki. Den letzten Rehabilitierungsantrag stellte 1999 der Memorial-Mitarbeiter Benjamin Joffe. Er erreichte es, dass die Verfügung, Trotzki nach Kasachstan zu verbannen, für unrechtmäßig erklärt wurde.

Trotzki nachdenklich am Schreibtisch – auf einen wichtigen Anruf wartend, der Apparat steht rechts hinter ihm. Photo: commander-ikarus.blogspot.com
Literatur:
Vilém Flusser: „Gesten. Versuch einer Phänomenologie“, Köln 1993
Eric Hobsbawm: „Das imperiale Zeitalter 1875-1914“, Frankfurt/Main 2004
Leo Trotzki: „Mein Leben – Versuch einer Autobiographie“, Berlin 1930
Leo Trotzki: „Geschichte der russischen Revolution“, Berlin 1960
Leo Trotzki: „Die russische Revolution. Kopenhagener Rede 1932“, Berlin 1970
Julijana Ranc: „Alexandra Ramm-Pfemfert. Ein Gegenleben“, Hamburg 2004
Peter Weiss: „Trotzki im Exil“, Frankfurt/Main 1970
Curzio Malaparte: „Technik des Staatsstreichs“, Berlin 1988
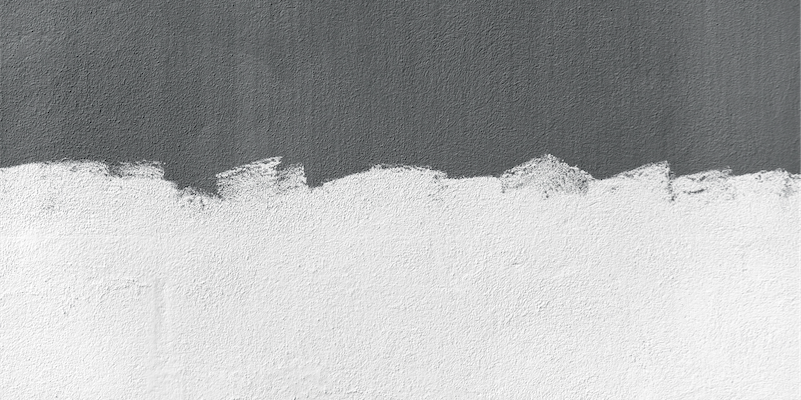




Wie der amerikanische Ex-Terrorist Bill Ayers von der Gruppe „Weathermen“ im Untergrund das Telefon nutzte, davon handelt ein Kapitel seiner Biographie „Flüchtige Tage – Erinnerungen aus dem Weather Underground“, die dieser Tage auf Deutsch erschien.
Zuvor hatte der Autor sich bereits zusammen mit der Weathermen-Genossin Bernardine Dohrn auf Vortragstournee durch Deutschland begeben. Außerdem wurde hier ein Film über den „Weather-Underground“ gezeigt. Für Oktober angekündigt ist das Mediabook 6 in der »Bibliothek des Widerstands« des Laika-Verlags mit den Filmen »The Weather Underground«, USA 2002, 92Minuten, Regie Sam Green und Bill Siegel, sowie »Underground«, USA 1976, 87 Minuten, Regie: Emile de Antonio, Buch und DVD 26,90 Euro.
Der „Weatherman“ Bill Ayers lebt heute in Chicago und ist Professor für Pädagogik. Im US-Wahlkampf 2008 geriet er aufgrund seiner angeblichen Kontakte zu Barack Obama in die Schlagzeilen und wurde u.a. von Sarah Palin als »Obamas Terroristenfreund« medial gebrandmarkt. „In den sechziger Jahren war Ayers einer der Hauptprotagonisten des sagenumwobenen »Weather Underground«, auch Weathermen genannt“, heißt es in der JW..
Über das Telefonieren schreibt Ayers:
Einmal hatte ich eine perfekte Telefonzelle gefunden, um mich anrufen zu lassen. Das Telefon war unser Feind, und ich habe bis heute eine seltsame Abneigung dagegen bewahrt, doch dieses war eine wichtige Entdeckung, denn die Kommunikation zwischen öffentlichen Telefonzellen, für die wir immer entsprechende Münzen bei uns hatten, war das wichtigste Instrument, um in der Diaspora Kontakt zu halten. Es war zu einer Zeit, als Rose und ich uns an verschiedenen Küsten aufhielten und eine regelmäßige Routine entwickelten: Sie rief mich jeden zweiten Abend um sieben Uhr an. Mein Anschluß befand sich zwischen den Toiletten im Kellergeschoß eines geschäftigen Howard-Johnson’s-Restaurants an der Kreuzung von zwei verkehrsreichen Highways, zwanzig Minuten von meiner Unterkunft entfernt. Es waren zwei getrennte Zellen; wenn eine besetzt oder ausgefallen war, hatten wir schnell und problemlos Ersatz. Aus all diesen Gründen war der Ort wie geschaffen für uns, aber es gab noch etwas, was ihn ideal machte – im Gang stand eine mit orange und blau gemustertem Kunstleder bezogene Bank, groß genug für drei.
Ich benutzte das Telefon bereits seit mehreren Wochen, als ich eines Abends ankam und zwei schwere Jungs, so groß wie Panzerschränke, mit verschränkten Armen auf der Bank sitzen sah. Sie nahmen den gesamten Platz in Anspruch. Mir rutschte das Herz in die Hose, aber ich nickte ihnen zu und verschwand ohne anzuhalten in der Herrentoilette. Shoes, dachte ich. Aber langsam. Beide trugen todschicke italienische Halbschuhe und teure Wollanzüge. Einer sah aus wie mein alter Freund von der Highschool mit dem Frankensteinschädel, der andere hatte das Gesicht von einem Profiringer, den man zu oft in den Schwitzkasten genommen hatte. Um kein Risiko einzugehen, beschloß ich, gerade lange genug zum Pinkeln zu bleiben und dann abzuhauen. Es war eine Minute vor sieben.
Plötzlich klingelten beide Telefone gleichzeitig, und ich hörte die Bank ächzen, als die beiden Panzerschränke aufstanden, um dranzugehen. Yo Frankie, sagten sie wie aus einem Mund. Kurzes Schweigen, dann öffnete sich plötzlich die Tür zur Herrentoilette und einer der Typen fragte: Heißt du Joe? Ist für dich, Joe.
Danke, sagte ich, und nahm den Hörer. Während der Kerl mit dem kantigen Schädel sich in einer Art Code, der so klang wie der Wetterbericht – Grade und Himmelsrichtungen, Geschwindigkeit, Hochs und Tiefs –, weiter mit Frankie unterhielt, setzte sich der andere grinsend wieder hin, und ich verabredete hastig ein anderes Gespräch an einem anderen Ort, bevor ich mich aus dem Staub machte.