Berühmte Überkopfmalerei. Photo: pohlig.de
„Wir gehören zum horizontalen Gewerbe,“ behauptete der polnische Deckenmaler Pjotr, „es gehört mit zu den ältesten,“ fügte er hinzu, „schon Michelangelo malte die Decke der Sixtinischen Kapelle auf einem Gerüst liegend aus. Und die Renaissancekünstler waren damals die ersten, die sich neben den Wissenschaftlern zu Gewerben zusammenschlossen. Wenn man weiß, wie Michelangelo gearbeitet hat, dann sieht man sein Deckenbild von der ‚Erschaffung Adams“, die ja eine Erhebung ist – am ausgestreckten Finger Gottes, ganz anders.“
„Auch die Stukkateure haben anfangs die Gipsrosetten und -girlanden an den Decken der adlig-bürgerlichen Wohnungen noch im Liegen angebracht,“ ergänzte sein Kumpel – Zygmund. Dem dritten Restaurateur, Kornel, fielen noch die KFZ-Schlosser ein, die sich, wenn sie keine Hebebühne haben oder benutzen wollen, mit einem Holzbrett auf Rädern behelfen, auf das sie sich mit dem Rücken legen und damit unter das Auto rollen.
Ich saß im sogenannten „Schmugglerzug Berlin-Warschau“, mit mir im Abteil befanden sich drei Künstler aus Tschenstochau, die sich an der Universität Thorn zu Restaurateuren fortgebildet hatten und nun in Berlin die Feinarbeit in den Wohnungen von teuer renovierten Altbauten erledigten. Luxus-Wanderarbeiter quasi. Jetzt waren sie auf dem Weg nach Hause – in die „Weihnachtspause“, wie sie sagten. Mir zu Liebe sprachen sie im Abteil Deutsch, vermissten jedoch ein alkoholisches Erfrischungsgetränk für unsere Runde, um die Völkerfreundschaft perfekt zu machen. Kornel ging schließlich los, um im Zug was aufzutreiben. Er kam schon nach kurzer Zeit zurück – mit einer Flasche ostfriesischem „Moorfeuer“, die er für 10 Euro jemandem abgekauft hatte. Das Zeug schmeckte abscheulich, aber noch weit vor Poznan, wo die drei umsteigen mußten, hatten wir die Flasche bereits geleert. Pjotr fiel zum Thema „horizontales Gewerbe“ noch seine Schwägerin Ewa ein, die sich seit Jahr und Tag zusammen mit ihrem Mann als Erntehelfer auf einem Gemüsehof bei Cottbus verdinge. Sie würden Gurken ernten und das sei eine Tätigkeit, bei der man mit dem Bauch auf einer Vorrichtung liege, die von einem Traktor übers Feld gezogen werde. Von Gurke zu Gurke sozusagen.

Traumberufe: So warb die deutsche Regierung einst Zwangsarbeiter im Ausland an. Man nannte das Verfahren auch „Absauckeln“. Benannt nach dem damaligen Jobcenter-Chef Fritz Sauckel. Er wurde 1946 in Nürnberg wegen dieser „Mobilisierung der Leistungsreserven“ gehängt.

Ausländische Erntehelfer heute: Gurkenpflücker. Photo: download-moviez.de
Mir fielen zu dem horizontalen Gewerbe die arbeitslosen ukrainischen Bergarbeiter ein, wie ich sie in dem Dokumentarfilm „Workingman’s Death“ gesehen hatte: Sie arbeiteten illegal in stillgelegten Bergwerken – und zwar in derart engen Stollen, dass sie darin die Kohlestücke auf dem Rücken liegend mit Hammer und Meißel abschlagen mußten. Anschließend verkauften sie die Kohle sackweise. Ihre Arbeit sah für mich noch schlimmer aus als die der Bergarbeiter in den Kohlezechen an der Ruhr. Während ihres Solidaritätsbesuchs bei den hungerstreikenden Kalibergarbeitern in Bischofferode hatten sie mir erzählt, dass sie unter Tage meist auf Knien in ‚ihren‘ Kohlestollen arbeiten müßten. Deswegen waren sie völlig begeistert, als sie die für sie geradezu paradiesischen Arbeitsbedingungen in der Bischofferöder Kaligrube „Thomas Müntzer“ sahen. Die Kalikumpel fuhren mit ihnen auf einem LKW in 600 Meter Tiefe durch hallenhohe weiße Stollen. Die zig kilometerlangen Strecken war beleuchtet, es gab unter Tage ein Fachwerkhaus als Konferenzsaal, eine Metallwerkstatt, Fische im Aquarium und Vögel in Käfigen, außerdem eine Kapelle, in der man sich bei Sprengungen versammelte.
„Willst Du damit sagen, dass das horizontale Gewerbe etwas Herabwürdigendes, Primitives hat? So wie man im Deutschen umgekehrt sagt ‚Der aufrechte Gang wird zuletzt gelernt‘ – im Klassenkampf?“ fragte mich Pjotr. Bevor ich antworten konnte, gab Zygmund zu bedenken: „Was ist mit den Kurwy – den Huren. Daher kommt der deutsche Begriff ‚horizontales Gewerbe‘ doch – als das angeblich älteste der Welt,“ fügte er hinzu. „Ja“, ergänzte Zygmund, „weil die Prostituierten meistens auf dem Rücken liegend arbeiten. Sich also quasi unterwerfen. Weil diese Frauen aber organisiert waren, deswegen ist die Tempelprostitution das älteste Gewerbe.“ Dieser Gedanke von Zygmund machte uns anderen drei im Abteil erst mal stumm. Und sowieso fiel uns außer den Couponschneidern, die in Kingsize-Betten liegend mit ihren Brokern telefonieren, kein weiteres horizontales Gewerbe mehr ein. Und diese letzteren waren genaugenommen gar kein „Gewerbe“ – womit laut Wikipedia „jede wirtschaftliche Tätigkeit“ bezeichnet wird. Die Couponschneider selbst bestehen jedoch darauf, dass nicht sie, sondern nur ihr Geld „arbeitet“.
2. Schicksalshobel
Partnerlook. Photo: modenews.zalando.de
Die Berliner Feinwerkzeugfirma Dieter Schmid stellt 199 verschiedene Hobel her: Grat-, Grund-, Falz-, Nut-, Putz-, Sims- usw. -Hobel, dazu „japanische“ und „australische Hobel“. Und dann gibt es auch noch jede Menge elektrische Hobel. Allein der Online-Shop Gimahhot bietet 46 verschiedene an – von Black & Decker, Bosch, Metabo etc.. Darüberhinaus kennt man aber auch noch in der Schönheitschirurgie den „Nasenhobel“ und im Bergbau einen „Hobel“ zum Abbau von Kohleflözen. Augenzeugen Untertage berichten: „Ein riesiger Metallblock nähert sich auf der Schiene, es rauscht, es zischt. Dann ist der Hobel direkt vor uns, Wasserdüsen sprühen, damit sich die Staubentwicklung in Grenzen hält. Der Hobel fährt an uns vorbei, überall bröckelt die Kohle herunter. Die Luft färbt sich schwarz.“
Daneben gibt es noch das mindestens ebenso interessante „Schicksal, das den Hobel ansetzt“. Und da es viele Schicksale gibt, aber nicht jedes die jeweilige Physionomie hobelt, also in die Naturgesetze reinpfuscht, braucht es hierbei mindestens einen Hobbysozialforscher. Es geht bei dieser Hobelarbeit des Schicksals nämlich um den Einfluß des „Milieus“, des „Mediums“, wie Lamarck es nannte, auf das Individuum. Berühmtes Beispiel – vom Lamarckisten Arthur Koestler beschrieben: die in den Zwanzigerjahren in einem Kibbuz geborenen Kinder von Ghettojuden. Während die Eltern noch klein, schmächtig und geduckt waren, sahen ihre Kinder schon in der ersten Generation groß, stark und selbstbewußt aus. Der Hobel hieß hier land- und wehrwirtschaftliche Arbeit in Freiheit (siehe dazu den Aufsatz des Koestler-Biographen Christian Buckard: „Der Krötenküsser“ und „Freiheit heilt“ von Sil Schmid).
Im Kleinen entdeckt man diese Arbeit der Umwelt am Einzelnen nicht selten bei alten Ehepaaren oder an Hund-Herrchen-Gespannen, die sich immer ähnlicher werden. Unterstrichen wird das von immer mehr Paaren, die im sogenannten „Partnerlook“ auftreten. Ein hobelndes Schicksal kann aber auch darin bestehen, dass jemand Zeit seines Lebens ein Büroangestellter ist – und mit der Zeit genauso aussieht. Abgesehen davon, dass er sich auch so kleidet, verhält und alle Konsumwünsche erfüllt, die das Büroangestelltenglück perfekt machen. Es geht dabei also um eine äußerliche und innere Prägung des Individuums durch die Lebensumstände. Dies ist auch da der Fall, wo das Schicksal in Form einer Kündigung den „Hobel“ ansetzt – und der Betroffene den Arbeitsplatz oder die Wohnung verliert – wodurch sein Leben eine überraschende Wendung nimmt.
Bei mir als Kolumnist heißt das Schicksal „Redakteur“, der regelmäßig an meinen Texten herumhobelt. Bei einer Freundin spielte ein Liebhaber dieses Schicksal, indem die Beziehung zu ihm ihre ganze Existenz umhobelte. Und dann noch einmal, als er sich von ihr trennte. Bei anderen Freunden bewirkte so etwas ein Kind, ein Lottogewinn, eine Krankheit, ein schwerer Unfall. Letzteres passierte auch noch einem Bekannten mit einem Moped, das er „mein Hobel“ nannte (und wenn er mit einer Freundin vögeln wollte, sprach er von „hobeln“). Kürzlich hörte ich in der Eckkneipe „Uschi und Ich“ in Berlin-Mitte, das ein Gast seine Frau, die neben ihm saß, als sein „Hobel“ bezeichnete. Ich sah sie mir daraufhin genauer an – und entdeckte dann tatsächlich einige sichtbare „Eigenschaften“ an ihr, die etwas Hobelhaftes hatten – in bezug auf ihren Mann, dessen Kleidung sie z.B. für ihn kaufte, wie ich vermutete, und den sie wahrscheinlich auch bekochte.
Wenn man sich als Mann derart umsorgen läßt, dann bleibt das natürlich nicht ohne Folgen für die äußere und innere Erscheinung. Man spricht dabei auch vom gesellschaftsfähig Machen des Mannes durch die Ehe. Von den deutschen Aufklärern – Pockels, Kant, Hegel und Fichte – wurde den frauenlosen Männern (in der Armee z.B.) ersatzweise das Weintrinken in Gesellschaft empfohlen. Sie werden dadurch laut Pockels toleranter und liebenswürdiger: Sie sind „keiner Verstellung und Hinterlist“ mehr fähig, d.h.: sie machen „zur Freude der ganzen Welt“ eine Wandlung zum Guten durch. Hier heißt der Hobel also „Alkohol“.
Andererseits weiß man jedoch auch, dass übermäßiger Ehefrauen- und Alkoholgenuß genau das Gegenteil bewirken kann – nämlich zu viel von einem weghobelt: „Der Mensch wurde abgeschliffen wie ein Stein im Wasser, unfähig zu Widerstand und eigener Meinung“, so beschrieb der Sowjetschriftsteller Juri Tynjanow dieses Problem, das sich bei ihm jedoch auf die „Jahre des großen Terrors“ bezog, also auf die Sowjetmacht während des „Personenkults“, den man mithin auch als „großen Hobel“ bezeichnen könnte. Aus dieser Zeit stammt noch der Witz, dass man aus Rationalitätsgründen vor allen Fabriken Rasierapparate angebracht hat – als eine Art Gesichtshobel: „Man steckt da den Kopf rein – und fertig.“ „Aber jeder Kopf ist doch anders…“ „Nur beim ersten Mal!“
Eine noch tiefergehende Wirkung attestiert die französische Autorengruppe Tiqqun neuerdings – in ihren „Grundbausteinen einer Theorie des Jungen-Mädchens“ – auch der heutigen „totalen Warengesellschaft“: Dabei geht es um eine Kapitalisierung der Begehren beiderlei Geschlechts, die auf Selbstverwertung hinausläuft – und schließlich auf eine durchgehend „moralisch-rosa Hautfarbe“: „Das Junge-Mädchen ist der Endzweck der spektakulären Ökonomie.“
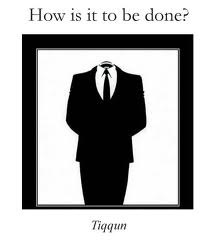
3. Trendberuf: Trickster
Das erste, was mir im neuen Jahr als neu auffiel, war eine Werbung im U-Bahn-Fernsehen: „Beware of Trickster!“ Damit sollen die Leute gewarnt werden, dass niemand mit einem Trick an ihre Daten gelangt, wenn sie auf den U-Bahnhöfen einen Bankautomaten benutzen. In den Monaten zuvor hatte ich mich gerade mit „Trickstern“ befaßt. Der Feministin Donna Haraway galt er geradezu als eine Modellfigur für das Überleben im Widerstand – gegen eine feindliche Umwelt. Die Autorin wurde dafür viel gescholten, weil sie sich dabei auf die Natur in ihrer „Eigengesetzlichkeit“ und auf die „Widerständigkeit des Nicht-Menschlichen“ bzw Nicht-Gesellschaftlichen berief – und das mit dem „Trickster“ illustrierte: eine halbmythische Figur in agrarisch-nomadischen Gesellschaften, mal Schelm mal Tölpel, der sich durch seine „Unberechenbarkeit und permanenten, koyotenhaften Verwandlungen auszeichnet“. Nach ihr veröffentlichte der Ethnologe Alexander Knorr eine Doktorarbeit über ein Halbdutzend „Metatrickster“ – dazu zählt er u.a. den Satanisten Aleister Crowley und den Schamanenschriftsteller Carlos Castaneda. Ihm ging es dabei um deren immer neue Wandlungen, die bisweilen einem Herauswinden gleichen.
Der Soziologe Michel de Certeau hat demgegenüber den anonymen „Man on the Street“ (MOS) als urbanen „Trickster“ zu begreifen versucht. Wobei er einerseits die Totalität der Lebensverhältnisse in unseren heutigen „elektronisierten und informatisierten Riesenstädten“ als eine Besatzungsmacht herausarbeitete (in: „Die Kunst des Handelns“) und andererseits den vereinzelten Konsumenten darin als einen Partisan des Alltags darstellte. Dieser muß nämlich ständig versuchen, die zahlreichen und unendlichen Metamorphosen des Gesetzes der herrschenden Ökonomie in die Ökonomie seiner eigenen Interessen und Regeln ‚umzufrisieren'“. Seine Mittel sind dabei „ortlose Taktiken, Finten, eigensinnige Lesarten, Listen…“ Bereits der Kriegstheoretiker Clausewitz verglich die List mit dem Witz: „Wie der Witz eine Taschenspielerei mit Ideen und Vorstellungen ist, so ist die List eine Taschenspielerei mit Handlungen“. Für Certeau sind nun „die Handlungsweisen der Konsumenten auf der praktischen Ebene Äquivalente für den Witz“. Wobei die intellektuelle Synthese ihrer Alltagspraktiken nicht die Form eines Diskurses annimmt, sondern „in der Entscheidung selbst liegt, d.h. im Akt und in der Weise, wie die Gelegenheit ‚ergriffen wird‘.“ Dennoch lassen sich diese operationalen Leistungen auf sehr alte Kenntnisse zurückführen: „Die Griechen stellten sie in der Gestalt der ‚metis‘ dar. Aber sie reichen noch viel weiter zurück, zu den uralten Intelligenzien, zu den Finten und Verstellungskünsten von Pflanzen und Fischen, Jägern und Landleuten. Vom Grunde der Ozeane bis zu den Straßen der Megapolen sind die Taktiken von großer Kontinuität und Beständigkeit. In unseren Gesellschaften vermehren sie sich mit dem Zerfall von Ortsbeständigkeit.“

Im Kanton Basel-Landschaft treibt dieser „Trickdieb“ sein Unwesen, meint die dortige Polizei. Photo: baselland.ch

Während in Bayern vor diesem Trickdieb gewarnt wird. Photo: polizei.bayer.de

Und in Bremen mit diesem Schild Trickdieben das Leben schwer gemacht wird. Photo: polizei.bremen.de
Und deswegen darf es uns nun nicht wundern, wenn das U-Bahnfernsehen vor „Trickstern“ auf Bahnhöfen warnt. Ohne die Möglichkeit, den immer engmaschigeren Systemen zu entkommen, bleibt dem Individuum laut Certeau „nur noch die Chance, sie immer wieder zu überlisten, auszutricksen -‚Coups zu landen'“. Im Endeffekt geht es dabei um „Lebenskunst“, wobei die partisanischen Tugenden und Taktiken dazu dienen, im Dschungel der Interessen und Informationen individuell zu bestehen und sogar erfolgreich zu sein.
Auch Künstler nehmen sich inzwischen dieses Themas an – z.B. die Gruppe „Bundesverband Schleppen & Schleusen“. Michel Foucault hatte 1988 noch gemeint: „Was mich erstaunt, ist, dass in unserer Gesellschaft die Kunst nur noch eine Beziehung mit den Objekten und nicht mit den Individuen oder mit dem Leben hat, und auch, dass die Kunst ein spezialisierter Bereich ist, der Bereich von Experten, nämlich den Künstlern. Aber könnte nicht das Leben eines jedes Individuums ein Kunstwerk sein?“ Vor einigen Jahren fand auf dem Pfefferberg bereits eine „Messe über Geldbeschaffungsmaßnahmen“ statt, die zwischen „Tricks und „Kunst“ Angebote für das Leben hier und heute machte. Schön, dass sich jetzt auch die BVG Gedanken über den „Trickster“ macht. Vielleicht hat der Populärphilosoph Richart David Precht doch Recht. Im Tagesspiegel meinte er zum Jahresanfang 2011 – etwas naßforsch-optimistisch: „Wir erleben einen Aufbruch wie 1968“ (da war er zwar erst 4, hatte aber schon kommunistische Eltern).

Zwei Trickster in New York: Beuys und Coyote. Photo: esoterikforum.de






In seinem „Grundrisse“-Artikel „Die Sans-Papiers oder die „Tricksters“ des 21. Jahrhunderts“ schreibt Stefan Almer über die illegalen Migranten
(Sans-Papiers):
…So verwandeln sich die Sans-Papiers in wahre Meister der Taktik, in „Trickster“ einer Lebensweise, die es ihnen abverlangt, „das Spiel des Anderen […] zu spielen/zu vereiteln“. Da sie sich auf einem Gebiet bewegen, das größtenteils vom „Feind“ kontrolliert und definiert wird, sind sie auf umfassende Kenntnisse eben dieses Territoriums angewiesen.
Sie müssen nicht nur die Regeln, die administrativen Vorgaben sowie die für sie risikoreichen Orte kennen, sondern auch wissen, wann sie welche Worte oder Sätze sagen müssen bzw. wann es nötig ist, zu schweigen. Damit sie im feindlichen Territorium zurande kommen, bringen die Sans-Papiers als Trickster unablässig Listen und Taktiken zur Anwendung, die an die „griechische Metis“ denken lassen, ja sie werden zu wahren VirtuosInnen der Metis.