
Der Berliner Chr.Links-Verlag veröffentlicht gerade ein Buch über „Die Arabische Revolution“ – u.a. von Thomas Schmidt, der kürzlich für die Berliner Zeitung aus Libyen berichtet hatte.
Der Hamburger Laika-Verlag veröffentlicht eine ganze Reihe Texte der Pariser Gruppe Tiqqun:
„Gewalt“, „Totalitarismus“, „Willkommen in interessanten Zeiten“, „Anleitung zum Bürgerkrieg“ und „Alles ist gescheitert, es lebe der Kommunismus“
Der Frankfurter Suhrkamp-Verlag veröffentlicht ein neues Buch von Eva Illouz: „Warum Liebe weh tut“
Die Kreuzberger Wochenzeitung „Jungle World“ veröffentlichte gerade „Geschichten von der Revolution und dem Leben danach“ – d.h. vier Porträts von Ägypterinnen, die sich am Aufstand auf dem Tahrir-Platz beteiligten von Juliana Schumacher:
1. Menna
Mit ihren alten Freunden hat sie sich gestritten. Denn sie sind gegen die Revolution, aber nicht aus politischen Gründen. »Seit das Militär die Ausgangssperre eingeführt hat, können sie nicht mehr die ganze Nacht ausgehen«, sagt Menna mit ernstem Gesicht. »Sie stammen alle aus unglaublich reichen Familien, sie interessieren sich nur für Partys, sonst nichts.« Menna ist 17 Jahre alt und das jüngste von fünf Geschwistern. Sie stammt ebenfalls aus einer Familie, in der Geld keine Rolle spielt. Ihr Leben unterschied sich bis zur Revolution kaum von dem ihrer Freunde. Sie besucht eine Privatschule, besitzt ein teures Pferd, in ihrem Geldbeutel finden sich Kreditkarten und die Mitgliedsausweise mehrerer Clubs. Anders als bei ihren Freunden hat Politik aber in ihrer Familie immer eine Rolle gespielt. Ihre Mutter ist Archäologin und war immer politisch aktiv. »Seit ich zehn war, hat sie mich auf jede Demo mitgenommen.« So kam sie auch am 25. Januar auf den Tahrir-Platz, mit ihrer Mutter, einigen Tanten und mehreren Cousins. Am nächsten Tag flog sie nach Boston, um an einer Jugendkonferenz in Harvard teilzunehmen. »Es war schrecklich, dort zu sitzen und nicht zu wissen, was passiert, ob es meiner Familie gut geht«, erinnert sie sich. Als sie am 4. Februar zurückkehrte, kaufte sie sich ein Zelt und fuhr direkt zum Platz. Dort erlebte sie die letzten Tage der großen Proteste. »Es waren die besten Tage meines Lebens. Die Zeit auf dem Platz hat mich für immer verändert«, sagt sie. »In der Stadt hatte ich oft Angst, als Frau unterwegs zu sein.« Während der Revolution lief sie nachts um zwei allein über den Platz, mit offenem Haar, und fühlte sich vollkommen sicher. Sie wusste, dass nichts passieren würde. »Es war ein Gefühl von Freiheit, das ich nie wieder vergessen werde.« Sie hat viel Mut aus diesen Tagen mitgenommen, und den Glauben, dass eine bessere Zukunft und ein anderes Zusammenleben möglich sind. »Die konservativen, die religiösen Männer hätten mich, eine Frau ohne Kopftuch, bis zur Revolution nicht einmal angeschaut. Und auf einmal saßen wir zusammen und diskutierten, sie nahmen mich ernst und hörten mir zu.« In den Tagen auf dem Tahrir-Platz hat sie vor allem der Umgang der Menschen miteinander beeindruckt: »Da kam ein Friseur, ein armer Mann, der jeden Tag über den Platz ging, den Leuten die Bärte schnitt und keinen Pfennig dafür haben wollte. Wenn das Essen ausgegeben wurde, das bisschen Essen, das wir hatten, dann ging das zweimal, dreimal im Kreis rum, weil niemand etwas nehmen wollte, obwohl wir alle so hungrig waren. Weil jeder wollte, dass die anderen genug bekommen.« Die Revolution, meint Menna, sei noch nicht vorbei. »Wir müssen dafür kämpfen, dass das Militär die Macht an eine zivile Regierung abgibt.« Aber sie ist optimistisch. »Ich habe viel Hoffnung für das Land.«
Jetzt geht sie wieder zur Schule, sie hat viel nachzuarbeiten. Wenn sie sich abends und nachts mit den neuen Freunden und ihren losen politischen Gruppen trifft, hat sie ihre Mathe- und Englischbücher dabei. Sie will einen guten Abschluss machen, um danach Politik zu studieren. »Ich möchte mehr lernen«, sagt sie. »Ich möchte den Hintergrund, das Wissen haben, um eine wirklich gute Aktivistin zu sein.«
2. Misho
Manchmal, in den Monaten vor der Revolution, ging er zu Demonstrationen. Aber wenn er ankam, zögerte er, blieb am Rand stehen und sah nur zu, wie die Menschen vorübergingen.
Misho ist 23 Jahre alt und ein stiller Mensch, der viel denkt und wenig spricht. Für Politik interessiert er sich schon immer, den Schritt auf die Straße wagte er jedoch erst, als die Revolution kam. Auf Facebook hatte er von den Protesten gelesen, am 28. Januar rief er seinen Freund Ramy an, der auf dem Tahrir-Platz war. Die Entschlossenheit und die Euphorie der dort anwesenden Menschenmassen packten Misho durchs Telefon, ebenso wie das Entsetzen über die Gewalt der Polizei. »Ich stieg in die nächste Metro und fuhr hin«, erzählt er. Es war die Fahrt in ein anderes Leben, das Eintauchen in einen Strudel, der seinen Alltag, seine Überzeugungen wegwischen würde.
Zehn Tage Ausnahmezustand folgten. Misho verbrachte die Nächte auf dem Platz, fuhr zurück in den Kairoer Vorort, wo er mit seinen Eltern und seiner Schwester wohnte, um mit den Nachbarn in selbstorganisierten Schichten die Häuser zu bewachen, dann fuhr er zurück auf den Platz. Manchmal nahm er nicht die Metro, sondern ging zu Fuß. »Ich wollte das alles in mich aufnehmen, diese Stadt in einem Zustand sehen, in dem sie nie wieder sein wird«, sagt er. Das Schlafen hat er irgendwann verlernt in jenen Tagen. Noch jetzt, drei Monate später, beginnt manchmal sein Bein oder seine Hand zu zittern, wenn er an diese Tage denkt. »Immer sind diese Bilder da.« Er hat sehr intensive Momente erlebt, »unglaublich schöne und unglaublich grausame«, wie er sagt. Die schönen Momente waren die, in denen alle zusammenhielten. Es war das berauschende Gefühl, stark zu sein, etwas erreichen und verändern zu können. Die grausamen Erlebnisse kamen später, als die erste Phase der Revolution schon vorüber und Mubarak geflüchtet war. »Dass das Militär tatsächlich gegen uns vorgegangen ist, die Soldaten, denen wir vertraut haben, das war ein solcher Schock, eine solche Enttäuschung.« Er stockt, findet keine Worte, schüttelt den Kopf.
Er war dabei, als das Militär den Tahrir-Platz am 9. März stürmte. Er sah, wie die Soldaten die Zelte zerrissen und auf die Protestierenden einschlugen. »Dieser Tag war der schlimmste«, sagt Misho. Die Soldaten eröffneten das Feuer auf die Menge der Protestierenden, die sich auf dem Platz versammelt hatten. »Ich habe gesehen, wie Menschen neben mir erschossen wurden, überall sanken Menschen zu Boden. Und da war einer, der verfing sich, als er davonrannte, in einer Rolle Stacheldraht, ein gepanzertes Militärfahrzeug fuhr darauf zu, der Stacheldraht verfing sich in den Reifen, er versuchte rauszukommen, aber er hatte keine Chance, die gaben einfach Gas und schleiften ihn mit. Ich weiß nicht, ob er noch lebt. Ich weiß nichts über ihn. Aber diese Szene geht mir nicht aus dem Kopf.« Misho kam davon, aber sein Freund Ramy wurde verhaftet. Als er zurückkam, konnte er tagelang nicht aufstehen, so sehr hatten ihn die Soldaten mit Schlägen und Elektroschocks gequält.
In sein früheres Leben hat Misho nicht zurückgefunden, es scheint ihm wie eine »sinnlose, leere Hülle«. Es ist sein letztes Jahr an der Universität, aber er geht nicht mehr hin, er kann sich nicht aufs Lernen konzentrieren. Er hat Angst um die Revolution, »die noch nicht fertig ist«. Er hat das Gefühl, keinen Moment weg sein zu dürfen, alle Kraft in die politischen Aktivitäten stecken zu müssen, damit nicht alles Gewonnene wieder verloren geht. »Ich mache mir Sorgen«, sagt er. »So wie es jetzt ist, darf es nicht bleiben, es ist nicht besser als zuvor.« Mit seinen Freunden aus der Zeit vor der Revolution hat er keinen Kontakt mehr. Sie lästern, lassen abschätzige Bemerkungen fallen. Seine Eltern wissen so gut wie nichts über seine politischen Aktivitäten, von seinen Erlebnissen während der Revolution hat er ihnen auch nichts erzählt.
Entspannen kann er sich nur mit den Freunden, die er während der Proteste kennengelernt hat. Ihnen braucht er nichts zu erklären. Sie sitzen bis in die Nächte unter den bunten Lampions der Straßencafés in der Innenstadt. Sie schlafen zusammengedrängt in irgendwelchen Wohnzimmern bei Freunden, sie ziehen während der Ausgangssperre durch die verlassenen Straßen der Innenstadt. Manchmal, frühmorgens, gehen sie nach schlaflosen Nächten zum Tahrir-Platz und setzen sich ins noch kühle Gras.
3. Salwa
Salwas Geschichte ist eine Geschichte von Liebe und Gewalt. Die Gewalt begann für sie nicht erst mit der Revolution. Anders als viele Ägypterinnen und Ägypter, die Ende Januar auf den Tahrir-Platz zogen, hatte Salwa nichts zu verlieren, als sie sich den Protesten anschloss. Sie ist in Oberägypten aufgewachsen, in einer Familie, die so arm war, dass sie auf die Straße betteln ging. Ihr Vater dealte mit Drogen. Er versuchte sie zu vergewaltigen, einmal schlug er sie halbtot. Sie floh, schlug sich allein durchs Leben und wechselte oft ihren Wohnsitz. Als ihr Vater sie aufspürte, versuchte er, sie zu erstechen. Mittlerweile hat sie herausgefunden, dass auch er in Kairo lebt. Er gehört zu den baltagiya, den berüchtigten Schlägertrupps des ehemaligen Präsidenten Mubarak, die in dem Ruf stehen, für eine Handvoll Geld jeden umzubringen. Das Regime heuerte diese Gruppen während der Revolution mehrmals an, um die Protestierenden anzugreifen.
Als die Revolution ihren Lauf nahm, war Salwa in Alexandria. »Ich habe mich nicht getraut, nach Kairo zu fahren. Das war zu gefährlich ohne Ausweis in dieser Zeit«, sagt sie. Sie hat keine Papiere, offiziell existiert sie nicht, sie ist illegal im eigenen Land. Ihre Eltern haben nie eine Geburtsurkunde für sie ausstellen lassen, jetzt weigert sich ihr Vater, sie als Tochter anzuerkennen. Erst nach dem Rücktritt Mubaraks brach Salwa auf, zwei Tage später kam sie im Camp auf dem Tahrir-Platz an. Sie fand nach langer Zeit einen Ort, wo sie sich willkommen und sicher fühlte, sie wurde herzlich aufgenommen und bekam einen Schlafplatz in einem Zelt.
Dort traf sie Mustafa. Er war eigentlich mit einer anderen Frau verlobt, aber die beiden verliebten sich bereits nach wenigen Tagen ineinander. »Wir haben es beide gewusst, doch wir sprachen nicht darüber.« Sie organisierten die Proteste, halfen dabei, das Camp zu verwalten. In einem ruhigen Moment schrieben sie ihre beiden Namen auf einen Baum am Rande des Platzes, nahe der Moschee, mit Kajal und Lippenstift. Das Camp war ihre kleine Welt, in der sie sich sicher fühlten und zusammen sein konnten.
Bis zum 9. März, als die Armee, zusammen mit einem Trupp baltagiya, das Camp stürmte. Ein Trupp Soldaten griff Salwa am Rande des Platzes auf und zerrte sie mit sich. Ein Offizier schlug ihr ins Gesicht. Mustafa sah das, er kam zurück und sagte: »Lasst sie los, sie ist meine Verlobte.« »Okay«, sagten die Soldaten, »dann behalten wir dich.« Sie hatten während der Räumung des Platzes Mustafas Bein verletzt und seinen Arm gebrochen. Vor Salwas Augen brachen sie ihm auch den anderen. Sie wurde ins Ägyptische Museum gebracht. »Die Soldaten schlugen mich. Sie quälten mich mit Elektroschocks. Vollkommen nackt saßen wir vor ihnen in einem Raum, dessen Fenster und Türen offen standen, während sie uns der Prostitution bezichtigten«, erzählt sie. Als sie sagte, sie sei noch Jungfrau, brachten die Soldaten sie in einen anderen Raum und ein Mann, den sie nicht kannte, »überprüfte« ihre Aussage.
Nachdem sie freigelassen worden war, wartete sie auf Mustafa, doch er kam nicht. Nach einigen Tagen begann sie, in den Gefängnissen der Stadt zu suchen. »Ich fragte überall nach ihm. Nach 20 Tagen fand ich ihn.« Er war in Tora inhaftiert, dem größten Gefängnis Ägyptens, das am Rande Kairos gelegen ist. Als sie Mustafa das erste Mal wieder gegenüberstand, brach er zusammen. Sie war die erste Person, die ihn besuchte. »Seine Familie und seine Verlobte haben den Kontakt abgebrochen, als er verhaftet wurde, sie waren immer gegen sein politisches Engagement und gegen die Revolution.«
Salwa und Mustafa haben sich verlobt, obwohl er immer noch im Gefängnis sitzt. Alle zwei Wochen darf er für 30 Minuten Besuch bekommen. Salwa musste lernen, wie man ein Telefon ins Gefängnis schmuggelt, sie bringt Mustafa Zigaretten und Tomatenpüree. Ansonsten streunt sie durch die Straßen der Stadt, verbringt viele Nächte wach und schläft tagsüber dort, wo sie einen Unterschlupf findet. Wenn Leute auf dem Tahrir-Platz sind, geht sie dorthin und wartet.
Mustafa wurde in einem Schnellverfahren von einem Militärgericht zu drei Jahren Haft verurteilt. Nachdem eine Kampagne gegen die Militärgerichte großen öffentlichen Druck erzeugt hatte, verkündete das Militär Anfang Mai, es werde alle Verfahren gegen Protestierende noch einmal überprüfen. Alle, die nichts Spezifisches verbrochen hätten, könnten freikommen, in wenigen Tagen schon. Mustafa jubelte am Telefon, Salwa jubelte mit. Die ersten Tage sind verstrichen, aber der Anruf, der all dem Warten ein Ende setzen soll, ist noch nicht gekommen.
4. Ahmed
Saudi-Arabien. Oder die USA. Bis zur Revolution war sein Plan klar. Ahmed studiert Ingenieurwesen in Suez und pendelt jeden Tag. Eineinhalb Stunden dauert der Weg von Nasr City in Kairo, wo er mit seinen Eltern und zwei Brüdern lebt, bis zur Universität. Wenn er sein Diplom in der Tasche habe, dachte er früher, wolle er weg, raus aus Ägypten, aus dem Land, in dem sich nie etwas ändert, in dem man ohne gute Kontakte in die Partei oder den Geheimdienst ständig der Willkür der Polizei ausgesetzt ist.
Die Revolution hat für ihn alles verändert. Sein überschaubares Leben in Wartestellung, ein Leben auf den Moment hin, in dem ein anderes Leben beginnen könnte, brodelt nun vor Aktivität. Der schüchterne, nachdenkliche Ahmed hat auf einmal viele enge Freunde und ist immer unterwegs. Er hat begonnen zu bloggen und zu twittern. Wenn er nach Hause kommt, sitzt er oft noch lange am Computer, macht die Nächte durch und fällt gegen Morgen todmüde ins Bett. »Die Dinge sind jetzt noch nicht besser geworden, aber zumindest ist die Hoffnung da, für mein Leben und für dieses Land«, sagt er.
Dabei hat er sich langsam an die Revolution herangetastet. Über Facebook hatte er von der Demonstration am 25. Januar erfahren. Er ging auf die Straße, blieb zunächst aber in Nasr City und kam dann jeden Tag mit jeder Demonstration näher ans Zentrum des Protests. Am 28. Januar stand er mit einem Freund zum ersten Mal auf dem Tahrir-Platz. Er kehrte heim und kam wieder. Er sah, wie Menschen neben ihm erschossen wurden, immer wieder: »Überall sackten Menschen zusammen und blieben am Boden liegen.« Er sah aber auch den unglaublichen Zusammenhalt, den Mut der Menschen, ihre Entschlossenheit. »Da war ein Junge, den ich kannte, der fünfmal schwer verletzt wurde, als die Schläger angriffen. Er wurde zum Krankenzelt gebracht und behandelt. Aber er hat jedes Mal darauf bestanden, zu den Barrikaden zurückzugehen, um den Platz zu verteidigen. Er hat wie durch ein Wunder überlebt.« Die Revolution war mit Mubaraks Rücktritt nicht zu Ende. Als Anfang April das Semester begann, besetzten Studenten fast alle Universitäten des Landes. Ahmed gehörte zu jenen, die die Universität in Suez besetzten, um den Rücktritt der Universitätsleitung zu fordern, die vom alten Regime eingesetzt worden war. Erfolg hatten sie nicht mit der Forderung – aber darin, einen großen Teil der Studenten zu politisieren und den Zusammenhalt an der Universität vollkommen zu verändern.
»Die ersten Wochen nach der Revolution waren hart«, sagt Ahmed. Er konnte nicht schlafen, die Eindrücke, die Gedanken, die heftigen Gefühle waren noch zu präsent, und er war zu erschüttert, um sich sicher zu fühlen. Einige seiner alten Freunde haben sich der Revolution angeschlossen, mit den meisten jedoch konnte er nichts mehr anfangen. Die Leute, die er auf dem Platz kennengelernt hat, waren ihm näher, aber viele von ihnen wohnen in anderen Teilen der Stadt. Durch das Pendeln zur Uni hatte er nicht die Zeit, ständig in der Innenstadt, an den üblichen Treffpunkten zu sein. Es dauerte einige Wochen, bis sich sein neues Leben sortierte. Nun ist er Mitglied einer Gruppe, die sich regelmäßig trifft. Das Semester ist fast vorbei und ihm bleibt Zeit, sich seinen politischen Aktivitäten zu widmen. Er arbeitet in der Kampagne gegen Militärgerichte, er hilft, Flyer zu erstellen für den 27. Mai, den Tag der »Zweiten Revolution«. »Die Revolution war das Beste, was diesem Land passieren konnte«, sagt Ahmed. Aber was in letzter Zeit geschieht und wie das Militär sich verhält, macht ihm große Sorgen. »Wir müssen zurück auf den Platz, wir müssen weiter um unsere Rechte kämpfen. Sonst werden wir die Revolution im Nachhinein doch noch verlieren.«
Aus Kairo meldet AP heute:
Tausende Demonstranten sind am Freitag auf dem Tahrir-Platz in Kairos Innenstadt zusammengekommen. Die ägyptische Protestbewegung rief zu der Kundgebung auf, die sie als „zweite Revolution“ bezeichnete, um den Militärrat zu einem rascheren Wandel hin zur Demokratie zu drängen.
Friedensnobelpreisträger und Oppositionsführer Mohammed ElBaradei sagte am Freitag, er sei sehr besorgt über die Abwesenheit der Sicherheitskräfte. Der Militärrat hatte zuvor gewarnt, fragwürdige Elemente könnten versuchen, Chaos während der Proteste am Freitag zu schüren. Die Streitkräfte wollten zudem nicht präsent sein, um Zwischenfälle zu vermeiden.
Die taz veröffentlicht morgen ein „syrisches Tagebuch“ von Leila Djamila („als die Aufstände in Syrien gegen das Regime von Baschar al-Assad begannen, reiste sie für die taz undercover nach Damaskus, wo sie sechs Wochen lang als eine der letzten ausländischen Journalisten berichtete„):
hätte ich gedacht, dass der Alltag im Syrischen Frühling derart angespannt ist? Dass er sich in meinen Damaszener Freundes- und Bekanntenkreis hineinzieht, Gräben aufreißt, wo es vorher Verständnis, bedingungslose Hilfsbereitschaft und Gastfreundschaft gab? Dass niemand die Spannung gewohnt ist und alle so ausflippen, wie ich es nur aus dem Tel Aviver Nachtleben bei der Intifada kannte?
Vorhin ging ich zu meiner Freundin Asisa, natürlich in farblosen, unauffälligen Studentenklamotten, schlabberig und ausgewaschen, sah also aus wie alle ausländischen Studenten in Syrien. War schon ein bisschen komisch: An jeder Ecke standen Geheimagenten, zu fünft oder zu zehnt, trotz der untergehenden Sonne alle mit Sonnenbrillen, Schnurrbart und dem Erkennungsmerkmal Lederimitat-Blouson. Gab jetzt ja die ersten Demoaufrufe auch in Damaskus. Wenn ich Lieferwagen sah, wechselte ich die Straßenseite, es gibt einfach zu viele Geschichten, wie „verdächtige Ausländer“, vermeintliche Spione, einfach in diese Wagen gezerrt werden und erst mal verschwinden.
Als ich bei meiner Freundin klopfte, schrie sie panisch hinter der Tür, in ihrer Stimme die Angst vor dem Geheimdienst. Erleichterung, als sie mich sah. „Deine Klamotten sind gut“, kommentierte sie trocken. „Aber deine Tasche … bist du wahnsinnig, hier mit deiner Reportertasche anzukommen?“, kreischte sie mir entgegen. Ja, ich hatte Gemüse und Fleisch für die anstehende Party in eine Kameratasche gepackt, aber keine Kamera dabei, kein Aufnahmegerät, nichts, das mich als Journalistin entlarven hätte können. Mit strengem Blick befahl sie mir, nicht noch einmal mit der verräterischen Tasche aufzukreuzen.
Obwohl wir Essen zubereiten wollten und in einer Stunde die ersten Gäste kommen sollten, setzte sie sich, ungeduscht und in schmuddeligem Hausanzug, sofort wieder vor den Fernseher, ihren Laptop auf den Knien, Festnetz- und Mobiltelefon in Reichweite. „Fuck shit, ich kann nicht glauben, was hier los sein soll!“, rief sie, eine Zigarette nach der anderen rauchend. Ständig schaltete sie zwischen al-Dschasira und al-Arabia hin und her, die verwackelte Handybilder aus der Unruhestadt Daraa zeigten, in der auf friedliche Demonstranten geschossen wurde. Dann Wechsel zum Staats-TV, das immer weiter ruhige Bilder von blühenden Landschaften und glücklichen Bauern zu nationalistischer Musik zeigte und von Aufständen nichts meldete.
Seit über vier Wochen sitzt Asisa nun schon zu Hause, geht nur raus, um das Nötigste einzukaufen. Zu groß ist ihre Angst, wegen ihrer zahlreichen Kontakte zu Ausländern, besonders zu Journalisten und NGO-Mitarbeitern, auch einfach mal weggeschnappt zu werden. Freunde von ihr, Bekannte von mir, sind verprügelt und verhaftet worden, weil sie zur falschen Zeit – freitags nach dem Gebet – am falschen Ort, da wo Demos angekündigt waren, in Cafés saßen oder telefonierten. Asisa davon zu überzeugen, dass eine Party in dieser Situation das Beste sei, um sich von den Ängsten ablenken zu lassen, war mir nicht leicht gefallen. Aber ich konnte nicht mehr mit ansehen, wie sie stundenlang mit Verstopfung auf dem Klo hockte, sich nicht mehr aus dem Haus traute, kaum noch E-Mail-Kontakt zu ihren Freunden hielt und Anrufe aus Angst vor Überwachung wegdrückte. Dabei Kette rauchte und Unmengen von Brot mit Hummus oder kiloweise ölige Kartoffeln verschlang, die sie sich von mir einkaufen ließ.
Als die ersten Gäste kamen, saß Asisa immer noch im Hausanzug vor der Glotze. „Ich kenne diese Frauen nicht, sag besser nichts!“, zischte sie mir zu. Die beiden packten sofort ihre Laptops aus, fragten nach dem Passwort für Asisas W-Lan – normal auf Studentenparties, auch in Syrien – und begannen auf Facebook die einschlägigen Seiten „Syrian Youth for Revolution“ und „Syrian News Network“ zu checken. Asisa herrschte die Mittzwanzigerinnen an, dass sie das sofort zu lassen hätten, wenn die Dienste sie überwachen würden, dann würde der Aufruf über ihre IP-Adresse ja reichen, um sie als Oppositionelle in den Knast zu stecken! „Und das, wo ich den Präsidenten liebe!“, fügte sie zur Sicherheit hinzu.
Die nächsten Gäste kamen, fröhlich ausgelassene Sprachstudenten aus Japan, Frankreich, Australien. Da nichts gekocht war, bestellten wir Pizza. Alle sollten leise sprechen, wies Asisa an. Sie trug immer noch Hausanzug und vermutete hinter jedem Gast einen Spion, bis ein irakisches Flüchtlingspaar kam, das ebenfalls seit Tagen das Haus nicht verlassen hatte. Auch sie hatten eine Heidenangst, zwar nicht vor den Agenten, aber vor der Entwicklung der beginnenden Revolution. Falls der Staat zerfallen sollte, falls Hass zwischen den Religionen aufflammen würde, wären sie dann noch sicher im Exil? Würde dann in Syrien nicht das beginnen, wovor sie mit ihren drei Kindern vor Kurzem erst aus dem Irak geflüchtet waren? Er Schiit, sie Sunnitin, eine Verbindung, die dann angefeindet werden würde? Seine Frau hatte ihre sonst so sorgsam gelackten roten Fingernägel abgeknabbert, er sah aus, als hätte er Tage nicht geschlafen.
Ein Engländer, der mit seiner syrischen Verlobten kam, hatte gute Laune und Gin und Tonic dabei. Bis dahin hatten wir noch keinen Tropfen Alkohol angerührt, obwohl alle Rotwein oder Bier mitgebracht hatten. Als er fragte, ob jemand einen Drink wolle, wurde das Gespräch erstmals politisch: „In dieser Situation willst du Alkohol trinken?“, wollte der Iraker wissen, „was, wenn sie kommen und du nicht nüchtern bist und dich in schlimme Situationen hineinredest?“ Ach Quatsch, meinte er. Die Agenten hätten doch jetzt anderes zu tun, als uns harmlose Devisenbringer zu überwachen. Alle seien Studenten, könnten das nachweisen, wir machten hier Kulturaustausch! „Also“, rief er „ihr stolzen jungen Syrer aller Religionen, wollt ihr einen Drink? Für solch angespannte Situationen wie diese hier haben wir Briten nämlich Gin & Tonic erfunden! Lasst uns auf den Präsidenten trinken!“
Alle mussten lachen, die Pizzen kamen und wurden mit G & T, Wein und Bier hinuntergespült. Klar, das Thema war jetzt nur noch „die Situation“, und ich kam mir vor wie in Beirut, wenn die Hisbollah mal wieder ihre militärische Kraft gezeigt hat. Jeder hatte eine Geschichte zu erzählen, und Asisa staunte, wie viele Bekannte aktiv an der Cyber-Revolution beteiligt waren. Ohne dass die Agenten sie gleich einkassiert hätten.
Allerdings hörten wir auch andere Storys: von Sprachstudenten, die bei den Demos fotografiert hatten und dann so lange festgehalten wurden, bis sie ihre E-Mail-, Skype- und Facebook-Passwörter verraten hatten. Und jeder kannte jemanden, der verschwunden war. Asisa hörte gebannt zu und zischte, dass im Hause nur geflüstert werden dürfe.
Es ging auf Mitternacht zu, alle waren mehr oder weniger betrunken, als eine junge Irakerin plötzlich aufstand, die Faust reckte und schrie: „Verdammt, wovor habt ihr alle Angst, ich komme aus dem Irak und weiß, was Angst ist! Hier sind keine Amis, hier ist nur ein beschissener Präsident, yalla, morgen gehen wir auf die Straße und stürzen ihn! Revolution!“ Noch nie hatte ich Asisas Augen so weit aufgerissen gesehen – todernst. „Party is over“, zischte sie in das betrunkene Studentengelächter. Nur ich durfte bleiben, hinter ihr liegen und sie die ganze Nacht lang halten. Größer noch als die Angst, von Agenten geschnappt zu werden, war in dieser Nacht nur ihre Angst, allein zu sein, wenn sie denn käme.
Aus Syrien meldet AFP heute:
Beim gewaltsamen Vorgehen gegen regierungskritische Demonstranten in Syrien haben Sicherheitskräfte am Freitag mindestens drei Menschen getötet. Die Sicherheitskräfte hätten in der Ortschaft Dael im Süden des Landes das Feuer auf Demonstranten eröffnet, die auf Hausdächer gestiegen seien, erklärte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte in London. In der Hauptstadt Damaskus und in Deir Essor im Nordosten des Landes lösten die Sicherheitskräfte nach Angaben der Syrischen Liga für Menschenrechte gewaltsam Demonstrationen auf.
In Deir Essor hätten sich rund 5000 Menschen nach dem Freitagsgebet zu Protesten versammelt, die Polizei habe Warnschüsse in die Luft abgegeben, teilten die Menschenrechtler mit. Im Stadtteil Rokn-Eddin im Norden von Damaskus gingen die Sicherheitskräfte demnach mit Schlagstöcken gegen hunderte Protestierende vor. Seit dem Beginn der Proteste gegen Staatschef Baschar el Assad wurden nach Angaben von Menschenrechtlern mehr als 1000 Menschen getötet und rund 10.000 weitere festgenommen.
In „Die Zeit“ schreibt die in Syrien untergetauchte Anwältin Razan Zeitouneh:
Aber meine Träume gebe ich nicht auf.
Das Regime glaubt offenbar immer noch, dass es sich retten kann, indem es einfach immer mehr Leute verhaftet und weiter auf Demonstranten schießt. Der vergangene Freitag war der beste Gegenbeweis: Fast überall gab es Proteste, und diesmal waren auch die Minderheiten dabei, Christen an vielen Orten, die Drusen in Swaida, die Ismailiten in Al-Salamia, Alawiten, Assyrer, die Kurden sowieso. Das ganze Volk. Nicht nur eine kleine Clique oder Randgruppe oder gar Terroristen, wie das Regime immer noch behauptet.
Die FAZ berichtet heute, dass der Hizbullah-Generalsekretär Nasrallah in Jordanien „alle Syrer aufgerufen hat, ihr Land ebenso zu bewahren wie das herrschende Regime, ein Regime des Widerstands“. Die FAZ bezeichnet diesen Blindfisch als Chef des „Islamischen Widerstands im Libanon“.
Aus dem Jemen melden Reuters und dpa:
1. Die jemenitische Luftwaffe hat am Freitag einem Fernsehbericht zufolge Angriffe gegen aufständische Stammeskämpfer geflogen. Wie der Sender Al-Arabija berichtete, wurden die Rebellen in einem Gebiet bei Sanaa bombardiert. Nähere Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt. Zuvor hatte eine Rebellengruppe erklärt, sie habe aus einem Gebiet rund 100 Kilometer von der Hauptstadt entfernt die Republikanischen Garden von Präsident Ali Abdullah Saleh vertrieben.
Die jüngsten Kämpfe entbrannten, als Kämpfer des Al-Ahmar-Clans im Norden Sanaas versuchten, Regierungsgebäude zu stürmen. Präsident Saleh hatte sich zuvor erneut geweigert, ein Abkommen zu unterzeichnen, das seinen Rücktritt binnen eines Monats vorsieht. Am Donnerstag kamen bei Zusammenstößen in Sanaa kamen mehr als 40 Menschen ums Leben.
2. Trotz der andauernden blutigen Zusammenstöße zwischen Regierungstruppen und aufständischen Stammeskämpfern im Zentrum von Sanaa hat die Opposition im Jemen für den heutigen Freitag zu neuen Massenprotesten gegen den Präsidenten Ali Abdullah Salih aufgerufen. Zugleich bekräftigten Salihs Gegner ihre Entschlossenheit, den Rahmen friedlicher Demonstrationen nicht zu verlassen. Auch Salih mobilisierte seine Anhänger zu einer Kundgebung beim Präsidentenpalast. Bei den Kämpfen zwischen regierungstreuen Truppen und Kämpfern des Stammesscheichs Sadik al-Ahmar im Stadtviertel Hasaba wurden seit Montag an die 100 Menschen getötet. Zahlreiche Bewohner flohen vor den Kämpfen.
In der Jungen Welt berichtet Heike Schrader heute aus Griechenland:
Nach spanischem Vorbild protestierten am Mittwoch Zehntausende Menschen in fast allen großen Städten. Der berühmte Tropfen, der das Faß zum Überlaufen brachte, war wahrscheinlich eine Falschmeldung: »Indignados« in Madrid hätten ironisch zur Stille aufgerufen, »um die Griechen nicht aufzuwecken«. Diese sich wie ein Lauffeuer auf diversen griechischen Blogs verbreitende Nachricht schaffte, was gleichlautende Aufrufe nach Beginn der Aufstände in Tunesien oder Ägypten nicht geschafft hatten: Überall im Land trafen sich am Mittwoch abend Tausende und Abertausende »Empörte« auf den zentralen Plätzen der Städte. Allein in Athen versammelten sich mehrere zehntausend Menschen auf dem Syntagma-Platz, zu deutsch Platz der Verfassung, direkt vor dem griechischen Parlament. Spontan und friedlich gaben sie ihrer Empörung über die Verhältnisse im Lande Ausdruck. Bis tief in die Nacht hinein – die letzten wenigen hundert Teilnehmer verließen den Platz erst am Donnerstag morgen – protestierten sie gegen die brutalsten Sparmaßnahmen, die sie je erlebt haben, und deren Verursacher. »Diebe, Diebe« wurde wie schon bei anderen Gelegenheiten den »Volksvertretern« im Parlament zugerufen. »Wir sind wach, für euch ist es ist Zeit zu gehen«, stand in spanischer Sprache auf einem der wenigen Transparente. »Alles für alle« lautete die griechische Botschaft auf einem zweiten. Für Donnerstag abend (nach Redaktionsschluß) wurde zu einer Fortsetzung der Proteste aufgerufen.
In der organisierten Linken wird der Aufbruch der »Empörten« zwiespältig diskutiert. Niemand dürfe daran zweifeln, daß es »bei einem verschlissenen bürgerlichen System« viele gäbe, die »einen Ausweg aus dem Druck suchten, den die Verschlechterung ihrer Lebensbedingungen« ausübe, kommentierte die Parteizeitung der KKE, Rizospastis, die Proteste. »Von dort bis zur Entdeckung, dem Verständnis und letztendlich dem Angriff auf die tatsächlichen Verursacher dieser Verschlechterungen aber hat das Bewußtsein einen langen und schwierigen Weg vor sich.« Im alternativen Internetportal athens.indymedia.org schwanken die Meinungen zwischen dem Aufruf, sich mit eigenen anarchistischen und autonomen Vorstellungen einzubringen, und der Einschätzung, daß der Protest ebenso schnell wieder in sich zusammenfallen werde, wie er entstanden sei. Als verdächtig wurde von allen die außergewöhnlich positive und umfassende Berichterstattung über die Aktionen in den Abendnachrichten gesehen.
Über Algerien weiß die Financial Times Deutschland:
Präsident Abdelaziz Bouteflika hat den Ausnahmezustand aufgehoben und politische Reformen versprochen. Mit einem neuen Wahlrecht und größerer Freiheit für Parteien hofft er, die Unruhen im Land unter Kontrolle zu bekommen. Auch in Algerien demonstrieren die Menschen seit Monaten gegen ihre schlechte wirtschaftliche Lage und die grassierende Korruption. Zudem regt sich der islamistische Terror wieder, der das Land in den 80er und 90er-Jahren heimgesucht hatte. Mit blutigen Anschlägen versuchen sie das Regime Bouteflikas zusätzlich zu destabilisieren. Algerien gilt als Hochburg der Al-Kaida-Filiale im Maghreb.
Ihrem Roman „Oran – Algerische Nacht“ stellte die Autorin Assia Djebar ein Zitat von Gérard de Nerval voran:
„Bald weiß ich nicht mehr, wohin ich meine Träume flüchten soll.“
Photo: freunde-des-orients.de
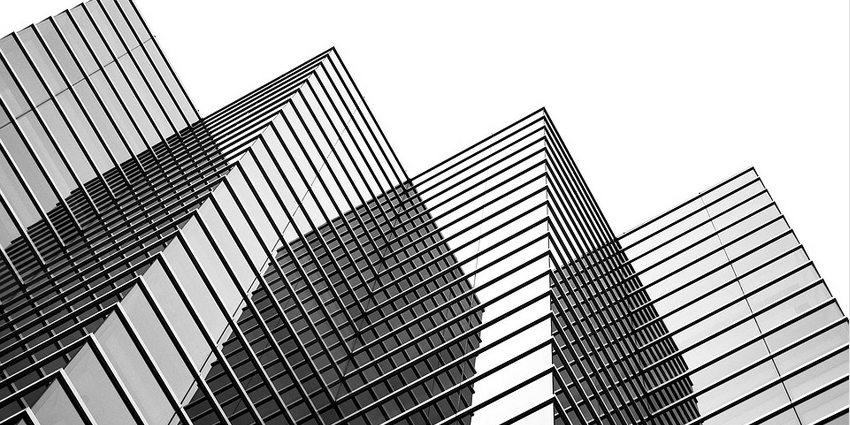




Einige weitere taz-Artikel von der Arabistin Leila Djamila:
1. Wie hoch ist der Preis? (2008)
Ob ich denn wohl aus Russland käme? Diese von einem süffisanten Lächeln begleitete Frage wurde mir in Damaskus recht oft von Passanten gestellt. So oft, bis ich einfach wissen wollte, was es denn mit diesen Russinnen auf sich hat. Ich fand heraus: Es gibt ganz schön viele russische Prostituierte in Syrien – wie überhaupt in sämtlichen sogenannten islamischen Staaten.
In Damaskus, der ältesten ununterbrochen bewohnten Stadt der Welt, ist das älteste Gewerbe der Welt offiziell verboten. Doch zugleich fallen die zig Clubs, Super Night Club genannt, nach Einbruch der Dunkelheit auf. Und keiner der vielen Soldaten, Polizisten und Sittenpolizisten, die nachts patrouillieren, kann sagen, er wüsste nicht, welch absurdes Spiel in diesen Clubs gespielt wird. Etwa dass dort irakische Kinder und Teenies anschaffen gehen, die vor dem Krieg aus ihrem Heimatland nach Syrien geflüchtet sind. Doch wie hätte ich dies ahnen können, wo doch offiziell alles, was mit käuflicher Liebe in Zusammenhang steht, sei es Anbahnung, sei es der Akt selbst, unter Strafe steht und mit mindestens drei Jahren Gefängnis bestraft wird. Umso verwunderlicher, dass es ein paar tausend junge Frauen aus dem ehemaligen Ostblock nach Syrien geschafft haben. Weniger erstaunlich wird diese Tatsache nur, wenn man begreift, welche Rolle die Korruption in dieser Region spielt.
Meine Freunde von der serbischen Botschaft in Damaskus nahmen mich also eines Abends mit in einen Super Night Club, in dem man „Russennutten“ treffen kann. Viele Girls waren im original Achtzigerjahre-„Sexy-Style“ gekleidet, und ihnen schien es egal zu sein, ob ihre Figuren in den engen Miniröcken und den billigen Glitzertops gut aussahen. Alle trugen viel Make-up, dazu Big Hair. Ich trug ein recht kurzes, schwarzes Kleid und schwarze Stiefel, meine blonden Haare einfach verstrubbelt im „Berliner Style“. Ich setzte mich zu den Russinnen, erklärte, ich sei eine Kollegin aus Ostdeutschland, und sie erzählten mir von ihrem Leben. Sie dürfen ihre schäbigen Hotels nicht verlassen, abends müssen sie um zwanzig Uhr das Haus verlassen und alle zusammen zur Arbeit gehen.
Der Manager kam und klatschte in die Hände, die Girls mussten wieder tanzen, und ich sprang ebenso wie sie auf und tanzte einfach mit. Da ich immer schon gerne an Stangen tanze, nahm ich die Gelegenheit wahr und versuchte, mich, so sexy es ging, um die Stange zu schlängeln. Irgendwie mochte ich die verwirrten Blicke der Gäste und die anheizenden Rufe meiner mittlerweile recht angetrunkenen Serben. Wir hatten vorher schon getrunken und deshalb schien mir der Plan, einfach einmal auszuloten, wie viel ich denn wohl wert sei, absurd lustig. Während ich tanzte, kam der Manager an unseren Tisch und wollte wissen, wer ich sei und ob ich ab jetzt immer hier arbeiten könne, es schien ihm und seinen Gästen zu gefallen, dass ich Spaß am Tanz hatte. Wie hoch mein Preis in Damaskus sei?
Am nächsten Tag also trafen mein serbischer Kumpel und ich den Clubchef, und die Herren diskutierten über meine Fähigkeiten und beschlossen, dass ich eher etwas für reiche Saudis mit gehobenen Ansprüchen sei als für den normalen Syrer, der lediglich einen außerehelichen Fick sucht. Die Herren wurden sich einig, dass ich für besondere Gäste ab vierhundert Dollar die Stunde zu haben sein sollte, der Manager, der sich um die Kundenvermittlung kümmern sollte, wollte fünfzehn Prozent Vermittlungsgebühr.
Wir gingen nie wieder in den Club, und ich ging nicht mehr ans Telefon, wenn der Chef anrief. Doch am kommenden Freitagabend ging ich wieder aus, diesmal mit einem arabischen Freund und einem Fotografen: in die Disco des Hotels Meridien. Dort ein hemmungsloser Schaulauf von älteren Prostituierten, aufgedonnert wie alternde Hollywood-Diven, viele mit operierten Nasen, Lippen und Brüsten, alle grell bemalt, die riesigen Brüste und die opulenten Hinterteile in knallenger Kleidung. Wie mein arabischer Freund, der viele Frauen ansprach, bestätigte, kamen alle aus dem Irak. Viele waren angetrunken und torkelten bereits auf ihren hohen Absätzen. Manche von ihnen hatten schon im Irak des Saddam Hussein in dieser Branche gearbeitet und waren dann ins benachbarte Ausland gegangen, um dort genauso illegal wie unter Saddam zu arbeiten. Die Portiers und das Sicherheitspersonal des Hotels werden einfach mit ein paar Dollars bestochen, und schon kann man ungeachtet der strengen staatlichen Anweisungen im Hotel arbeiten.
Im Meridien waren viele Saudis unter den Gästen. Sie kamen alle im langen, weißen traditionellen Gewand, der Dschalabija, und ihren rot-weißen Kopftüchern, den Kufijas, und schienen sich nicht im Geringsten dafür zu schämen, sich Sex zu kaufen – wofür sie in ihrem eigenen Land mit dem Tod bestraft würden. Gegen drei Uhr morgens hatte ich schließlich mehrere Verehrer am Wickel, ich konnte mir aber keinen Preis ausdenken, für den ich bereit gewesen wäre, mit einem dieser älteren Männer mitzugehen.
An Fotografieren war, wie auch in dem eher russisch dominierten Club zuvor, nicht zu denken. Kaum holten wir die Kameras raus, kamen aufgeregte Nutten, Kunden und Security-Mitarbeiter auf uns zu und drohten, uns rauszuschmeißen. Dazu grabschten ständig irgendwelche Männer in Kleidern an meinen Armen oder meinem Arsch herum, alle waren betrunken und ich die Attraktion des Abends. Mein arabischer Freund erklärte den Herren dann, dass er mich für heute Nacht gebucht habe, und fragte, wo man denn noch hingehen könne. Voller Begeisterung erzählten ein paar Saudis, dass es jetzt ja diese ganze Vorstadt von Nuttenclubs gebe, wir sollten einfach in ein Taxi steigen und uns in Richtung einer nördlichen Vorstadt, Sednaja, bringen lassen.
Wir fuhren im Taxi durch das dunkle Damaskus, passierten palästinensische Flüchtlingslager und wähnten uns schon am Ende der Stadt, als plötzlich gleißend helle, bunte Lichter am Horizont erstrahlten. Es sah aus wie Las Vegas, rechts und links der Straße war alles voll mit „Touristischen Clubs und Restaurants“, wie die Läden offiziell heißen. Wir schauten uns bestimmt zehn der über hundert Clubs an. In jedem Club gibt es eine erhöhte kreisrunde Zirkusbühne. Auf diesen Zirkusbühnen laufen blutjunge Mädchen – oft auch Kinder – sexy zurechtgemacht, die ganze Nacht im Kreis. Auf Nachfragen sagen die Zehnjährigen, sie seien zwölf und die Zwölfjährigen geben an, vierzehn zu sein. Auf den hohen Plateauschuhen können die wenigsten richtig laufen, aber ohne die hohen Schuhe würde man noch deutlicher erkennen, wie klein und kindlich viele von ihnen noch sind.
Die jungen Nutten sind herausgeputzt wie Prinzessinnen aus orientalischen Märchen, alle tragen dickes, dramatisches Make-up, das ihre Mütter ihnen hinter der Bühne aufmalen, alle haben ausgestopfte Push-up-Büstenhalter, darüber tragen sie hautenge Polyesterkleider mit viel Gold, Silber und Glitzer. Die Mütter sitzen in dunklen Ecken des Clubs und beobachten die Gäste, Männergruppen aus Saudi-Arabien, Kuwait oder anderen Golfstaaten. Wenn die Mütter, die allesamt Kopftuch tragen, einen potenziellen Freier für ihre Töchter entdeckt haben, zielen sie mit einem Laserpointer auf ihre kleinen Goldstücke und schicken sie zu den Herren an den Tisch.
Dort dürfen die Mädchen ein wenig Wasserpfeife rauchen, werden meist an den Oberarmen begrabscht, dann werden Telefonnummern ausgetauscht, denn offene Prostitution ist nicht geduldet. Hier darf nur offen angebahnt werden. Erst später, nach Feierabend oder am nächsten Tag, dürfen die Kinder beschlafen werden. Offiziell muss alles sauber bleiben, schließlich hängen Fotos des Präsidenten Baschar al-Assad an jeder Clubeingangstür. Auch an dieser.
Mein arabischer Freund, der Fotograf und ich nehmen uns einen Tisch, handeln ein wenig und dürfen für zwanzig Dollar sitzen bleiben. Aus unerklärlichen Gründen winken mich die Mädchen plötzlich auf die Tanzfläche und sind dann trotz Make-ups und hoher Schuhe einfach nur kleine irakische Flüchtlingsmädchen, die noch nie eine blonde Europäerin aus der Nähe gesehen haben. Sie wollen mich anfassen, mit mir tanzen und mit mir an der Hand die Runden in der Manege drehen. Ob sie sich davon bessere Chancen bei der Kundschaft erhoffen oder ob sie es einfach spannend finden, weiß ich nicht. Ein schneller arabischer Tanz ertönt, und ein Mädchen mit schrecklichen Verletzungen, Brandwunden und Schnitten an den Armen, will, dass ich sie beim Tanz drehe. Als ich sie gut führe, sie sich voll Freude immer wieder von meinem rechten Arm um die eigene Achse drehen lässt, steht plötzlich die Hälfte der Mädchen, fünfzehn oder zwanzig Teenagerkinder, um mich herum und bettelt mich mit großen Kinderaugen an: Auch sie wollen gedreht werden! Nun bewegen sich zwei Flüchtlingskinder auf einmal unter meiner Führung – sie rotieren, was das Zeug hält, rotieren, bis ihnen schwindlig ist. Sie kichern, wie Teenager überall auf der Welt kichern, und hüpfen eine nach der anderen in meine Hände. Der Drehwurm als einzige Freude in einem trostlosen Leben.
Diese Mädchen bieten sie sich hier nicht an, um Drogen oder Luxusgüter mit ihrem Körper zu verdienen, es geht um das nackte Überleben. Ein irakisches Mädchen bekommt rund fünfhundert syrische Pfund, also etwa zehn Dollar pro Nacht. Doch allein die Miete kostet sechshundertsechzig Dollar, wie mir später eine verschleierte Mutter aus Bagdad erklärt. Sie hat zum Glück zwei Töchter, die sie hier anschaffen schicken kann, eine zwölf- und eine vierzehnjährige. In Bagdad waren sie stolze Leute, doch nun, klagt sie, könne jeder sehen, was die Amerikaner aus ihren Töchtern gemacht hätten. Irakische Flüchtlinge dürfen zwar in Syrien leben, bekommen aber keine Arbeitserlaubnis. Der Arbeitsmarkt dort ist mehr als gesättigt, die Einheimischen haben schon seit geraumer Zeit mit der Arbeitslosigkeit zu kämpfen.
Die Kunden aus den reichen arabischen Nachbarländern, in denen es weder Alkohol noch unverschleierte Frauen gibt, zahlen dreißig bis fünfzig Dollar für einen Tisch. Für diese Summe muss ein Mädchen, wenn es schlecht läuft, die ganze Woche arbeiten. Doch für den Moment können die Kleinen, von denen fast alle schlimme Verletzungen oder Narben an den Armen tragen, ihre „Habibis“, ihre „Lieblinge“, wie Freier hier genannt werden, für einen Moment vergessen. Für den kleinen Moment, in dem ich sie herumwirbele.
Doch während ich noch das tröstende Gefühl genieße, ihnen eine kleine Freude machen zu können, bemerke ich das rote Flackern eines Laserpointers auf mir. „Noch zwei Sekunden“, denke ich und will mich auf den Boden werfen, dann erkenne ich, dass eine aufmerksame Mutter erkannt hat, welche der Gäste ein Auge auf mich geworfen haben. „Wie nett“ denke ich, „sie will mir bei meinem Business helfen!“ Ich sage den Kleinen, dass ich sie später noch weiter drehen werde, habe schon Angst, wegen Störung des Betriebs und sowieso als einziger weiblicher Gast hier zu sehr aufzufallen. Ich gehe also zu der Gruppe von acht jungen Kuwaitern, die die Mutter mir mir dem Laserpointer gezeigt hat. Ich soll mich setzen, sagt Abdullah, 21, Angestellter in Kuwait. Ich soll Wasserpfeife rauchen und Alkohol trinken, wenn ich wolle, die anderen Mädchen trinken ja nie was, ich sei ja sicherlich aus Russland, da würde ich ja gerne trinken. Er selbst ist Muslim, trinkt nicht und ist verlobt, mit einem „anständigen Mädchen“, weshalb er auf den ersten Sex mit ihr bis zur Hochzeit in ein paar Jahren warten müsse. Schließlich muss seine Braut Jungfrau bleiben! Er aber liebe es, im einmonatigen Urlaub in Damaskus richtig aufzudrehen, „jede Nacht“, wirklich „jede“, kämen er und seine Freunde in eine dieser Bars, um sich die billigen Mädchen mitzunehmen. Er und seine Kumpels lachen und brüsten sich in schlechtem Englisch damit, dass sie eine Partyvilla hätten, in der es seit einem Monat jede Nacht richtig abgehe. Jeder der Jungs nehme sich jede Nacht ein, zwei Mädchen mit nach Hause, manchmal würden sie die Mädchen auch tauschen, Angst vor Aids hätten sie keine, denn die Mädchen seien ja noch viel zu jung, um Aids zu haben, außerdem sehe man es ihnen ja auch an, wenn sie krank seien.
Während ich noch mit den Kuwaitern plaudere, kommen immer wieder ältere Saudis an den Tisch und begutachten mich, fordern mich auf, bei ihnen zu sitzen, fragen, wie viel ich koste. Später komme ich an ihren Tisch und erkläre, ich würde es nur für Dollar oder Euros machen, dann erst sehe ich die diamantenbesetzten Uhren und Manschettenknöpfe der Herren und beginne das erste Mal ernsthaft zu überlegen, was denn mein Preis wäre. Vor dem schäbigen Club stehen dicke neue Mercedes, SUVs, Limousinen mit saudischen Kennzeichen, die Männer haben tatsächlich Geld und wollen mich wirklich, denn nun fangen sie an, mich fest an den Armen zu greifen, sodass ich mich hilfesuchend nach meinem arabischen Freund umdrehe. Genau in dem Moment, in dem die drei älteren Saudis „How much?! How much?!“ auf mich einschreien, kommt er und teilt mir mit, er habe den Besitzer kennengelernt, dem ich gefalle und der uns gerne in seinen zweiten, exklusiveren Club einladen würde.
Mein Freund war in der Zwischenzeit mit dem Besitzer in dessen Büro, in dem auf Überwachungsmonitoren das Geschehen im Club zu sehen war. Mich habe der Chef die ganze Zeit beobachtet und meinen Freund ausgefragt, wer ich sei. Ich sei zu jung für eine Journalistin, also eine Nutte? Natürlich hatte mein Freund sofort zugestimmt, dass ich eine verrückte Nutte sei, denn die Wahrheit, Journalistin, hätte uns sofort ins Gefängnis gebracht. In Syrien muss man offiziell angemeldet sein, wenn man journalistisch arbeiten will, sogar jede einzelne Geschichte beim Informationsminister anmelden – und wird dann permanent vom Geheimdienst beobachtet.
Der andere Club ist nur wenige Schritte entfernt, hier kostet ein Tisch schon hundert Dollar. Wir sind eingeladen, bekommen einen Vorzugstisch. Der große, kräftige Clubchef ergreift meine Hand und zieht sie an sich. Plötzlich kommt mein ansonsten unerschrockener Freund angelaufen. Er hat sich über meinen neuen Verehrer erkundigt, er sei ein hohes Tier bei einem der zwölf syrischen Geheimdienste und wir täten besser, jetzt abzuhauen, da, bei aller Liebe, auch mein Freund nichts mehr für mich tun könne, wenn ein Geheimdienstboss mich haben wolle.
Als mein Araber dann aber sah, wie der Geheimdienstboss meine Hand festhielt, wies er ihn freundlich darauf hin, dass es doch ein wenig früh sei und wir morgen wiederkommen könnten. Der Geheimdienstboss bestand jedoch darauf, uns hinauszubegleiten. Ein Taxifahrer, der vor dem Laden wartete und nicht gleich anfuhr, als mein Verehrer ihm Kommandos zurief, wurde einfach aus dem Auto gezerrt und von den Security-Mitarbeitern in die nächtliche Wüste gezerrt. Wir wissen nicht, was mit ihm geschah. Wir nahmen ein anderes Taxi. Und bedankten uns brav für den schönen Abend.
In dieser Nacht erklärte ich die Recherche zum Thema „Was ich in Damaskus wert bin“ für abgeschlossen, denn für den Geheimdienstboss hätte ich durchaus auch die Leben oder zumindest die körperliche Unversehrtheit meiner Begleiter wert sein können.
2. Zerrissene Zedernrepublik (2008)
Jounieh, libanesischer Urlaubsort, sonntags im späten August. Aus den Boxen dröhnen die Hits der Siebziger-, Achtziger- und Neunzigerjahre. Das kleine Schwimmbecken ist überfüllt. Viele dicke Kinder plantschen mit allerlei Gummigetier. Zur Linken erstreckt sich das Panorama von Beiruts Cargo- und Militärhafen, in der Luft schwebt der Doppelmayr-Teléferique, die Hochseilbahn, die Ausflügler auf den 600 Meter hohen Harissa-Gebirgszug über Jounieh bringt. An diesem Abschnitt der Levanthe duftet es nicht nach Jasmin und Kardamon, es riecht nach Pommes frites und Autos ohne Kat. Über dem betonierten Strand liegen die Abgase zahlreicher Motorboote und Jetskis. Im Hotel Bel Azur in Jounieh, dem Urlaubsort nördlich von Beirut, entspannen sich Familien bei Whiskey und Wasserpfeife auf Plastikliegen.
Das Mittelmeer am kleinen Sandstrand des angeblichen Vier-Sterne-Hotels ist keineswegs schön blau, sondern bräunlich, der Ölfilm auf der Oberfläche schimmert in Regenbogenfarben. Dutzende Kinder plantschen in der fischfreien dreißig Grad warmen Brühe, stets unter Aufsicht der philippinischen oder äthiopischen Kindermädchen, die nicht schwimmen können. Ihre „Madames“, libanesische Christinnen, beharren darauf, „Phönizierinnen“ und keine Araberinnen zu sein. Sie aalen sich in viel zu engen Designerbikinis. Der Fitnesswahn der westlichen Welt hat den Libanon noch nicht erreicht. Kosmetische Operationen und Fettabsaugungen sind billig und gesellschaftlich anerkannt. Öl ohne Lichtschutzfaktor ist der Dernièr Cri und die Meinung der anderen so wichtig wie der ausgiebige, wöchentliche Termin im Beauty-Salon.
Auch die „letzten Kreuzritter des Nahen Ostens“, wie sich die ehemaligen Soldaten der christlichen Milizen gern nennen, treffen sich sonntags im im Bel Azur, zum Tauchen nach versunkenen Panzern und U-Booten. Um etwas unter Wasser entdecken zu können, muss durch eine schleimige Schicht getaucht werden, da Müll und Bootsöl gern vor der Küste entsorgt werden. Auch wenn die Unterwasserjagd mit Pressluftflaschen und Harpune international verboten und geächtet ist, kümmert das hier keinen. „Everything illegal is legal in Lebanon!“, lacht ein mit kostspieliger Hightech-Ausrüstung ausgestattete Jäger, der auf seinem 45-minütigem Tauchgang dann doch keinem einzigen Fisch begegnete.
Die Palästinenser aus den Flüchtlingslagern treten im Strand- und Nachtleben ausschließlich als Security-Leute und Türsteher auf, Universitäten zu besuchen, ist ihnen im Libanon verwehrt. Im ebenfalls christlich geprägten „Bain Militaire“, dem exklusiven Beachclub der Armeeangehörigen an Beiruts neuem Leuchtturm, ist vor allem eines erkennbar: Auswüchse einstigen Steroidmissbrauchs. Bei fast jedem Mann. Was ihnen der Apotheker anscheinend nicht verriet oder was die Verwender vielleicht auch nicht wahrhaben wollen: Männer bekommen Brüste, wenn die Wachstumshormone aus dem Körper schwinden. Und nicht wenige ehemaligen Soldaten tragen nun Körbchengröße C.
Die Jungs und Teenager der Hisbollah aus dem zerstörten Beiruter Süden haben kein Geld für die zwanzig bis vierzig Dollar Eintritt für die diversen Strand- oder gar Jachtclubs. Sie springen an der Corniche, der Strandpromenade von Beirut, einfach von rostigen, mit Stacheldraht umgebenen Stahlträgern aus acht Meter Höhe in das Meer. Der permanente Luftverkehr, zu Helikoptern der UN und der libanesischen Armee kommen Verkehrs- und Privatflugzeuge sowie einzelne Überwachungsflugzeuge der israelischen Armee, geben dem Szenario einen letzten kuriosen Schliff. Die Teenager tragen alte Baumwollunterhosen. Ihre Mütter und Schwestern plantschen derweil zwischen den Felsen in voller islamischer Montur. Kommen sie aus dem Wasser, so zeigt die lange, weite, nun aber nass und eng anliegende islamisch korrekte Kleidung alle Rundungen ihrer Figuren. Doch die Hauptsache ist: Arme, Rumpf, Beine und Kopf müssen bedeckt sein, egal ob durch trockenen oder nassen Stoff. Auf der Corniche, treffen sich Männer aller Konfessionen zum Angeln, ärmere Familien picknicken ebenerdig neben parkenden Autos, während die Reichen Staus mit ihren überdimensionierten Autos und gepanzerten Sports Utility Vehicles an der Hauptverkehrsstraße neben der Promenade verursachen.
Riviera Hotel an der Corniche hat gerade die exklusivste neue „Beachlounge“ direkt neben dem Strand der Armen eröffnet. Für zehn Dollar kann der Normalsterbliche hier seine Bräune an zwei kleinen Pools und einer großen Bar zur Schau tragen, wer aber etwas auf sich hält, kann durch die bis zu 1.200 US-Dollar teure Miete eines privaten Strandzelts mit Whirlpool mit Massagefunktion, beeindrucken. Im Riviera steigen vor allem reiche Saudis und Golfstaatler, gern auch ohne ihre zahlreichen Frauen und Kinder ab. Denn für schöne und auch leichte Mädchen war Beirut schon in den Sechzigern bekannt, als ein Vergleich mit Paris noch möglich war. Die Jeunesse dorée, die ihr geerbtes Geld gern und leicht verschwendet, zieht Clubs wie das „Oceana“, eine halbe Stunde südlich von Beirut, vor. Für zwanzig US-Dollar werden hier immerhin fünf Pools geboten, einer davon in einem Areal, das nur für Erwachsene reserviert ist, selbstverständlich mit Poolbar und privaten Strandzelten, unbehelligt vom Nachwuchs; die Kinder können den ganzen Tag lang betreut in der „Kids Area“ spielen. Sonntags übernehmen die zwanzig- bis dreißigjährigen Partypeople die Pools, sie kommen direkt nach ihren langen Diskonächten, um zu ohrenbetäubender Progressive House, Trance und Techno-Musik an und in den Pools weiterzufeiern. Die traditionelle Kost des Libanons ist hier im „Oceana“ nicht angesagt. Kulinarisches aus den USA wird vorgezogen. Die verschiedenen Poolbereiche sind nach den US-Ketten, die die Poolabschnitte gepachtet haben. Die Sorge um den Stil der Pediküre, die Frisur und die Sonnenbrillenmarke scheinen wichtiger als die omnipräsenten und gewöhnungsbedürftigen Körperformen, die US-Food-Kultur erwachsen lassen.
Doch da der Libanon ein Land voller Gegensätze ist, gibt es auch einen Gegenentwurf zu der kommerziellen Ausbeutung der hedonistischen Sehnsüchte der reichen christlich und sunnitisch geprägten Bevölkerung. Tief im Süden, einen Kilometer vor dem Hauptquartier der Vereinten Nationen, drei Kilometer vor der israelischen Grenze, wo das Hinterland noch voller Minen ist, bauten zwei engagierte Tierschützerinnen ihren Familiensitz in einer am Strand gelegenen Bananen- und Zitronenplantage zu einem kleinen Gästehaus, dem „Orange House“, aus. Eine Übernachtung inklusive einem unter Mimosen und Hibiskusbäumen servierten Frühstück aus organischen, selbst angebauten Zutaten kostet 50 US-Dollar, so viel wie eine Viertel Flasche Champagner in einer Beachlounge in der Hauptstadt. Dazu bekommt man die Aussicht auf die fein gestriegelten Ziegen, die die Milch für den Frühstückskäse geben, schauen zu, ebenso wie die zahlreichen herumflirrenden Kolibris und der freilebende Papagei.
Von Juni bis September beobachten Mona Khalil und Habiba Fayad an einem der letzten naturbelassenen Strände des Landes Karett- und Suppenschildkröten. Sie führen Buch über die Eiablage, zählen die Weibchen, die hier seit Millionen von Jahren, lange vor der Erfindung von Religionen und Landesgrenzen und Beachclubs in einem Land, dessen Wasservorräte noch für zehn Jahre reichen, ihre Eier ablegen, schützen die Nester im Sand durch Gitter vor Füchsen und Hunden. Und für zehn Dollar Gebühr, die dem Schutz der vom Aussterben bedrohten Tiere zu Gute kommen, kann der meist ausländische Öko-Tourist hier von Mitte August bis Mitte September helfen, die Eier vorsichtig auszugraben und das einmalige Erlebnis genießen, hunderte von herzallerliebst tapsigen Mini-Dinosauriern in das Mittelmeer krabbeln zu sehen. Und wenn, wie die Statistik besagt, auch nur eine von hundert Babyschildkröten zwanzig Jahre überlebt, zur Geschlechtsreife kommt und ihre Eier dann wieder am Orange Beach ablegen will, muss sie es nur noch schaffen, den Müll, den die UN-Soldaten ins Meer schmeißen, zu umschiffen. Sie darf keine einzige schwimmende Plastiktüte mit ihrer Lieblingsspeise, Quallen, verwechseln, da das ihren Tod bedeuten würde. Da wegen der Erwärmung des Mittelmeers die Quallenpopulationen stark zunehmen, ebenso wie von Kugelfischen und Barrakudas, die ihren Weg durch den Suezkanal aus dem Roten Meer finden, besteht doch noch ein wenig Hoffnung, die Reptilienarten trotz aller Widrigkeiten zu erhalten. Denn ab einer Nesttemperatur von über 30 Grad wachsen mehr Weibchen in den Eiern heran. Hier duftet die Luft endlich wieder nach Jasmin und Kardamon.
3. Beirut – the place to see in 2009?
Was haben wir gefeiert!“, schwärmt Ruth Abcarius, 75. Seit 50 Jahren lebt die Wahllibanesin im einst schicken Beiruter Vorort Baabda in den heute willkürlich und stark besiedelten Bergen, die die libanesische Hauptstadt umschließen. Die Liebe zog sie 1958 aus dem tristen Nachkriegsdeutschland in die damals mondäne Stadt an der Levante. In den noblen Hotels an der Corniche, der Strandpromenade von Beirut, traf die junge Journalistin damals den internationalen Jetset.
Man ging oft aus, frühstückte danach in einem der kleinen Restaurants, die die ganze Nacht geöffnet waren. Viele dieser kleinen Restaurants sind nun von allgegenwärtigen US-Fastfood- und Coffeeshop-Ketten verdrängt worden. Doch natürlich gibt es sie auch noch, die gute libanesische Küche in allen Preisklassen. Ein Grund, weshalb die New York Times Beirut unlängst auf Platz eins ihrer Reiseempfehlungen setzte. Frau Abcarius kann diese Wertung nicht nachvollziehen. „Was ist nur aus diesem Land geworden!“, empört sie sich. „Die Korruption, der tägliche Verkehrsinfarkt, die Umweltverschmutzung und das wilde Bauen haben überhandgenommen. Und das bisschen, was glänzt und wiederaufgebaut ist“ – sie meint die Fußgängerzone im Herzen Beiruts -, „ist künstlich, überteuert, amerikanisiert.“ Es ist der einzige Ort der Stadt, an dem man nicht über Schlaglöcher stolpert und entlang teurer internationaler Designerboutiquen flanieren kann. Der 2005 ermordete Ministerpräsident Rafiq Hariri baute das Stadtzentrum mit Geld aus dem panarabischen Immobilienfonds „Solidere“ wieder auf. Es wirkt ein wenig wie Disneyland. Wer das geleckte, sandsteinfarbene Geschäftsviertel betreten möchte, muss seine Taschen von Soldaten kontrollieren lassen.
Ruth Abcarius kennt Beirut aus der Zeit, als es eine nach Jasmin, Oleander und Orangenbäumen duftende Villenstadt war. Die Häuser aus osmanischer und französischer Mandatszeit standen in Schönheitskonkurrenz miteinander. Davon ist nicht mehr viel übrig. Nur wenige Ecken in Beirut sind als „Viertel mit traditionellem Charakter“ ausgewiesen. Ruth Abcarius fragt sich beim Spaziergang im christlichen Viertel Ashrafiye, ob der „traditionelle Charakter“ nicht eher durch die Bürgerkriege als durch die vergangene goldene Zeit geprägt ist. Denn die wenigen erhaltenen Häuser mit den großen Veranden und den osmanischen Elementen sind, wie so viele Gebäude, deutlich von den Spuren des Bürgerkriegs und des Verfalls gezeichnet: Einschusslöcher, abgeblätterte Fassaden, Risse in den Wänden, halb verfallene Häuser, klaffende Wunden aus der Zeit, als Morde und Bomben an der Tagesordnung waren.
Anonyme Hochhäuser
Neben architektonischen Relikten wachsen anonyme Hochhäuser mit Glasfassaden in den Himmel. Beiruts Stadtbild ist eine Mischung aus den schmutzigsten Ecken Tel Avivs und Istanbuls mit einem Schuss Potsdamer Platz. Wer Abenteuer sucht, für den steht Beirut ganz oben auf der Liste zu bereisender Ziele. Doch das Auswärtige Amt rät bei Reisen in den Libanon zu erhöhter Vorsicht und spricht Warnungen für viele Regionen des Landes aus. Wie kommt die kriegsversehrte levantinische Metropole zu der Ehre, Washington, D. C. und die Galapagosinseln auf die Plätze zwei und drei der „Must-Sees“ zu verweisen?
Das kulturelle Leben beschränkt sich fast ausschließlich auf die Veranstaltungen des Institut Français und des Goethe-Instituts, einige wenige private Galerien und einige Festivals im Sommer. Zwar wird mehr geboten als in anderen arabischen Ländern, doch nicht viel mehr als in einer deutschen Kleinstadt. Legendär ist nur das Nachtleben. Der Libanon ist das einzige arabische Land, in dem Prostitution legal ist. Beirut hat die einzige schwul-lesbische Disco der Arabischen Welt. Im Sommer tummeln sich in den Nachtclubs viele Touristen aus Saudi-Arabien und den Golfstaaten, die den Restriktionen ihrer Länder entfliehen wollen.
Naji Gebran, 47, ist ein angesehener Mann. Er besitzt zwei Diskotheken, das BO18 und das BO18 Classic, in dem donnerstags die angesagten 80er-Jahre-Partys steigen. Drinks kosten hier so viel oder sogar ein bisschen mehr als in vergleichbaren Clubs in Deutschland. Harte Türkontrolle sorgt dafür, dass nur wohlhabende Männer und schöne, freizügige Frauen reingelassen werden. Der Mindestlohn im Libanon beträgt 250 US-Dollar pro Monat, so viel kostet der preiswertere Champagner im BO18. Man fährt mit dem Auto in die Disco, auf dem Parkplatz stehen ausschließlich Luxusschlitten. Trotz seines Alters und „gerade wegen der angespannten Lage“ in seinem Land liebt Naji das Nachtleben.
Die große Politik ist dem verheirateten sunnitischen Muslim, der mit Alkohol und Mädchen so hedonistisch wie ein deutscher Clubbesitzer lebt, zuwider. „Jeder kümmert sich in dieser Bananenrepublik nur um seins, warum soll ich mich nicht auch nur um meins kümmern?“, sagt er. Als im letzten Krieg die Polizei plötzlich in seinem Club anrückte, schmissen die Discogänger ihre Drogen einfach auf den Boden. Nach herrschendem Recht ist er als Clubbetreiber für das gefundene Kokain und Ecstasy verantwortlich. Also musste er sich ein wenig mit den Behörden ärgern, ein anständiges Schmiergeld zahlen und war fortan der Ansprechpartner der Behörden, wenn es um Regulationen, Verbote oder neue Genehmigungen der Beiruter Clubbetreiber geht. „Ich bin der Minister des Beiruter Nachtlebens!“, lacht er mit seiner rauchigen Stimme. „Ich liebe das Leben!“ Frau Abcarius kommentiert trocken: „Ja, feiern können sie, die Libanesen. Das ist auch alles.“
Im Ausgehviertel
Gemmayze liegt im christlichen Ostteil von Beirut: Luxuriöse Autos, viele gepanzert, stauen sich um Mitternacht in den schmalen Gassen. Aus den Boxen der Mercedesse, BMWs und Ferraris schallen Technomusik oder traditionelle arabische Klänge, die Lautstärke aufgedreht bis zum Anschlag. Grüppchen wohlfrisierter Frauen stöckeln mit ihren eleganten Begleitern in tief aufgeknöpften, gestärkten Hemden über die kaputten Straßen. Die in Beirut allgegenwärtigen Schlaglöcher stammen noch aus der Zeit, als die israelische Armee 1982 Jagd auf Jassir Arafat und seine PLO machte und die Straßen mit Panzern demolierte. Auch hier zeugen Einschusslöcher von der Gewalt, die Beirut und den Libanon jahrzehntelang beherrschte. Doch das scheint niemanden zu interessieren. In Gemmayze beherbergt fast jedes Haus eine Bar oder ein Restaurant, in dem Alkohol auch unter der Woche bis frühmorgens in Strömen fließt. Zumindest in der fünfmonatigen Sommersaison, die von Mai bis September hunderttausende Auslandslibanesen zurück ins Land lockt. Dann wird der Himmel über Beirut allabendlich von mehreren Feuerwerken erleuchtet, denn viele der rund acht bis zehn Millionen Auslandslibanesen heiraten im Sommer in der Heimat, und pompöse Zeremonien gehören in diesem Land einfach dazu.
„Die Atmosphäre ist schon eine ganz besondere“, sagt Hans K., deutscher Ingenieur, der für eine internationale Firma Wiederaufbauprojekte im ganzen Land betreut. „Man merkt den Menschen an, dass sie leben wollen, sie feiern, als gäbe es kein Morgen. Die jungen Frauen betonen ihre Jungfräulichkeit und fragen schon beim ersten Rendezvous, ob man heiraten will. Kaum merken sie, dass man harte Euros verdient, gehen sie aufs Ganze.“ Aber auch für die modernen, freizügigen Christinnen spielt die Jungfräulichkeit in der oftmals arrangierten Ehe eine Rolle: In den zahlreichen Privatkliniken Beiruts boomt neben der plastischen auch die rekonstruktive Chirurgie. Die Jungfernhäutchen der jungen, reichen Schönen werden vor der Hochzeit wiederhergestellt.
Verlässt man die Teile des neuen, glitzernden Beirut der meist christlichen und reichen sunnitischen Einwohner, beginnt das schmutzig-staubige Arabien. Ein normaler New Yorker Tourist wäre spätestens hier irritiert über die Reiseempfehlung der größten US-amerikanischen Zeitung. Im Libanon 2009 gilt, wie der Deutsche nach einschlägigen Erfahrungen mit den lokalen Damen durchschaut: „Ganz klar: Mehr Schein als Sein.“ Vielleicht sind sich Beiruter und New Yorker doch näher, als man denkt.
4. Grenzerfahrung (2007)
Die Grenzanlage der Türkei zwischen dem bulgarischen Svilengrad und dem türkischen Städtchen Edirne ist massiv, monumental und beeindruckend. Im nächtlichen Flutlicht auch Angst einflößend. Unsere erste Nacht in der islamischen Welt begrüßt uns in gleißend weißem, kaltem Strahlerschein.
Zum ersten Mal merke ich hier, bei unserem sechsten Grenzübertritt, wie in unserem Fahrer die Unruhe wächst. Nach einem kurzen Blick in unsere Pässe voll arabischer Stempel bedeutet uns der strenge Grenzer, nach einigen Metern rechts ranzufahren. Wir folgen dem Kommando. „Au, au, das wird schwierig – ihr bleibt hier, das kann dauern“, ruft Sharif beim eleganten Sprung von seinem stilecht mit weißem Schaffell bezogenen Fahrerthron. Rico und ich warten im Bus.
Die Kontrollhäuschenprozedur dauert mir mit einer Dreiviertelstunde zu lange. Ich beschließe, zur umlagerten Station zu laufen. „Hau ab, was willst du hier?“, zischt Sharif mich böse an, als er mich hinter sich bemerkt, „das hier ist Männersache, bring du nicht alles durcheinander! Ich habe dir doch gesagt, dass du im Bus bleiben sollst, jetzt tu doch einmal, was ich dir sage, du sollst nicht selber denken!“ Auf dem Absatz mache ich kehrt, stapfe in den Bus zurück und ärgere mich maßlos über Sharifs aggressiven und anmaßenden Ton. Wäre ich mit diesem Ton aufgewachsen, hätte ich jemals die Kraft und den Willen gefunden, mich zu emanzipieren? Womöglich nicht nur gegen den Vater, sondern auch gegen die Brüder und Onkel zu protestieren? Um Ricos ersten Kontakt mit dem islamischen Geschlechterverhältnis nicht noch komplizierter zu machen, als er ohnehin schon ist, beschließe ich, mich nur im Stillen zu ärgern und die Namen unserer möglichen morgigen Badeorte mit ihm durchzugehen. Wir entscheiden uns für die schon bei Herodes erwähnte Küstenstadt Tekirdag mit etwas über hunderttausend Einwohnern, direkt am Marmarameer gelegen.
Als wir weiterfahren dürfen, hat Sharif schon wieder vergessen, wie er mich zuvor angeschnauzt hat. „Ist doch gar nicht so schlecht, dich dabeizuhaben“, wendet er sich an mich. „Du hast dem Grenzer bestimmt auf Anhieb gefallen, und auch ich bin in seiner Achtung gestiegen, als er dich gesehen hat. So eine Frau wie du veredelt einen Typen wie mich“, scherzt er fröhlich, ohne ein Wort der Entschuldigung. Da ich keine Lust auf Diskussionen habe, die Nervosität des Grenzübertritts von uns abgefallen ist und uns morgen ein Urlaubstag bevorsteht, beschließe ich, den Vorfall bis auf Weiteres zu vergessen.
Wir fahren im Dunkeln durch die erste türkische Stadt, Edirne. Wir sind in der historischen Grenzstadt, die das Osmanische Reich von seinen westlichen Provinzen, den Milet, trennte. Rico ist ganz aufgeregt und freut sich über die vielen Moscheen, die nachts mit grünen Lichtern oder, besonders jetzt im Ramadan, mit bunten Lichterketten im Las-Vegas-Stil dekoriert sind. Nach hundert Kilometern schlagen wir unser Nachtlager auf dem Parkplatz einer riesigen, blitzsauberen Raststelle auf. Jetzt, da wir in einem islamischen Land angekommen sind, ist es an Rico, sein Zelt aufzubauen, damit ich mir den Schlafplatz nicht mit Sharif teilen muss.
Am nächsten Morgen, wir sind noch dabei, die unendliche Weite der wüstenartigen Landschaft in der Morgenhitze zu begreifen, bringt uns ein Angestellter ungefragt Tee an den Bus. Rico und ich sitzen unter einer riesigen türkischen Flagge an der Raststätte in der menschenleeren Ödnis und schlürfen unseren ersten türkischen Tee mit einem Einheimischen. Der junge Mann spricht Englisch und auch etwas Deutsch und will alles über unsere „crazy“ Tour mit dem Bus wissen. Rico probiert sein sächsisch gefärbtes Englisch im Smalltalk. Natürlich dürften wir die Waschräume benutzen, doch warum Sharif den Tee ablehnt, sich so ausführlich wäscht, sogar fastet und betet, versteht der junge Türke nicht. Es sei doch gerade das Gute am Reisen im Ramadan, dass man nicht fasten und nur dreimal täglich beten müsse! Warum sich unser Fahrer dieser Strapaze freiwillig unterzieht, kann der Tankstellenangestellte nicht verstehen. Ich entgegne, dass man als guter Muslim doch die Gebete und die Fastentage nachholen müsse – woraufhin mich der Mittdreißiger treuherzig anschaut, einen Schluck Tee nimmt und die Hand auf sein Herz legt. „Allah ist sowieso in dir – es ist nicht so wichtig, zu fasten und immer zu beten, du musst nur an ihn glauben! Oder denkst du, ihr Christen, die ihr an den gleichen Gott glaubt, kommt in die Hölle, weil ihr im Ramadan nicht fastet?“, fragt er mich belustigt. „Ich weiß noch nicht, was ich glaube“, antworte ich wahrheitsgemäß, woraufhin der Türke wieder nickt. „Du musst Gott suchen und ihn in dir finden, nicht in den alten Büchern. Dann wirst du ein guter Mensch, egal ob Muslim, Christ oder Jude.“
Voll Vorfreude auf den Tag am Meer starten wir in Richtung Süden. Die Landschaft ist mediterran, hügelig und die Vegetation bis auf die Nadelhölzer nun, Anfang Oktober, schon recht ausgedörrt. Als Gegensatz zum satten, dichten Grün des Balkans erleben wir jetzt ein ockergelbes Panorama, durchbrochen von spärlichem Gestrüpp, weiß getünchten Häuschen und Minaretten unter strahlend blauem Mittelmeerhimmel. Kein Wunder, dass auch die Türken an das Heilige Buch glauben, in dem das Paradies als ein Land voller Flüsse und üppiger Vegetation beschrieben wird, denke ich mir.
Wir erreichen Tekirdag am frühen Nachmittag und fahren sofort an den Strand. Auch wenn das Städtchen im Sommer Badetouristen beherbergt, ist nun, außerhalb der Saison, trotz dreißig Grad und Sonnenschein nichts mehr davon zu merken. Rico, der auf Ausschau nach Mädchen stets den Kopf aus dem Fenster streckt, klassifiziert die Frauen ihrer Kleidung nach. Auf der Fahrt durch Tekirdag bemerkt er ausnahmslos unmodisch gekleidete Frauen mit Kopftuch. Leider ist es auch an der schönen, sauberen Strandpromenade nicht anders, sodass in mir weder Urlaubs- noch Strandstimmung aufkommen kann. Hier flanieren Familien, Männer in Gruppen und Frauen mit ihren Kindern direkt am Meeresrand. Meine beiden Reisebegleiter entledigen sich ihrer Kleidung.
Als Sharif sich auszieht, scherze ich mit Blick auf seinen kräftigen behaarten Oberkörper, ob er sich sicher sei, die religiösen Gefühle der vorbeispazierenden Mädchen nicht zu verletzen. Rico ist schon ins Wasser gesprungen und tollt herum. Sharif blickt an sich herab, gibt mir recht und zieht sich wieder an. Ich überlege, was ich tun soll, und verlasse den Bus nur zögerlich, gehe ans Wasser. Da ich ein schulterfreies, sportliches Top trage, Rico im Wasser und Sharif außer Sichtweite ist, errege ich die Aufmerksamkeit aller Männer um mich herum. Sie starren mich unverhohlen an, scheinen über mich zu sprechen und zu lachen. Ob sie sich freuen oder mich verfluchen, weil ich ihre Gedanken mit meinem Sporthemdchen von Gott ablenke, überlege ich kurz, dann überwiegt aber ein diffuses Gefühl des Unwohlseins in mir. Ich gehe in den Bus, und statt mich für das Meer auszuziehen, ziehe ich ein weites, langes Hemd über meine weite, lange Hose. Um mich an den Strand zu setzen, ohne die religiösen Gefühle der trotzdem starrenden Männer zu verletzen.
Sharif kommt aus dem Bus und schaut mich verwirrt an, da er von mir weiß, dass ich normalerweise die Erste im Wasser bin. „Was soll ich hier schwimmen, ich bin verboten, mein Körper ist des Teufels, ich hab keine Lust, den Hass des ganzen Ortes auf mich zu ziehen. Ich geh hier nicht schwimmen!“, nehme ich seine Frage vorweg. Sharif erwidert trocken, dass das eine gute Entscheidung sei. Er will in die Moschee zum Beten. Rico planscht noch im Wasser herum und ruft mir zu, wie herrlich es sei und was ich denn noch an Land mache.
Innerlich koche ich. Doch wir sind gerade erst am Anfang der Reise im neuen Kulturkreis, ein wenig werde ich mich noch anpassen können. Ich nehme mir unseren letzten Abwasch vor, da ich in wenigen Stunden ja schon wieder kochen muss. Zwar habe ich tagsüber Wasser und Tee getrunken, aber nichts gegessen – längst kein ernst zu nehmender Ramadan-Versuch, aber doch eine Annäherung an den Fastenmonat. Sharif schnappt sich mein Fahrrad und verabschiedet sich.
Ich sitze immer noch in voller Montur in der Spätsommerhitze am Meer und wasche ab, schon jetzt wütend auf die Unfreiheit, die ich mir selbst zu verdanken habe. Männer schlendern vorbei, rufen mir Sätze zu, die ich nicht verstehe, fragen mich auf Englisch nach der Uhrzeit. Ist es mein Haar, meine einfache Pony-Pferdeschwanz-Frisur, die trotz meiner schlabberigen Kleidung noch provozierend wirkt? Soll ich mir auch noch ein Kopftuch aufsetzen?
Als ich so am Schrubben und Grübeln bin, kommt Rico aus dem Wasser, setzt sich strahlend neben mich und schmatzt ein wenig. „Mensch, jetzt hätte ich gern ein Bier, aber das ist hier bestimmt verboten, oder?“ Die Region Tekirdag ist für ihre Raki- und Weinproduktion bekannt, doch gab es auch schon einen Bürgermeister der AKP, der Partei von Staatschef Erdogan, der Gerechtigkeits- und Entwicklungspartei, der in Festzelten der Stadt den Alkoholausschank verbot. Auch behauptete er, die Dämpfe der Schnapsfabrik der Stadt würden die Kinder vergiften. Trotzdem wird in Tekirdag weiter gebraut, gebrannt und getrunken. Rico springt auf, zieht sich an und will einen Laden suchen, der Bier verkauft. Ich wünsche ihm viel Erfolg und schaue aufs Meer.
Als immer mehr Männer vorbeikommen und wirklich jeder mir irgendetwas mitteilen oder etwas von mir wissen will, gehe ich in den Bus, nehme mir mein großes Tuch und bastele es mir halbwegs vorschriftsgemäß auf den Kopf. Endlich kann ich ungestört am Ufer des Marmarameeres sitzen und meinen Gedanken bzw. Empfindungen nachhängen. Rico kommt zurück, er hat vier Halbliterdosen des türkischen Starkbiers Efes Xtra diskret in zwei blickdichten, fest verknoteten Plastiktüten erworben. „Wie siehst du denn aus?!“, begrüßt er mich, die er seit zwei Wochen nur in Caprihose, Rock und Top gesehen hat. „Machste hier einen auf Türkin? Musste nicht! Die Frau, die mir Bier verkauft hat, hatte auch kein Kopftuch auf und nur ein T-Shirt an. Aber sie meinte, wir sollten das Bier nicht öffentlich trinken.“
Der Tag geht zur Neige, und ich habe überhaupt keine Lust, für Sharif zu kochen. Aber gleich Bier trinken, an meinem ersten Probe-Ramadan-Tag im islamischen Land? Als die Sonne nach zehn Minuten im Meer versinkt und Sharif es weder für nötig hält, einen Sonnenuntergang mit mir am Strand zu erleben, noch, mir eine Nachricht zu schicken, dass er zum Essen bei seinen Brüdern in der Moschee bleibt, nehme ich mein Kopfgebinde ab und stattdessen ein Bier und proste Rico zu.
Sharif kommt eine Stunde später, satt, spirituell befriedigt und voll Energie. Er hat sich köstliches Lahmacun, türkische Pizza mit Rinderhack, gekauft, scheint also gar nicht darüber nachgedacht zu haben, ob ich vielleicht schon gekocht haben könnte. „Na, wie war dein erster Tag im Ramadan?“, fragt er mich freundlich, doch ich kann nicht einfach so tun, als ob nichts wäre. Er soll merken, dass er etwas falsch gemacht hat, dass ich unglücklich bin, er soll sich entschuldigen.
Mir fällt nicht auf Anhieb ein, wofür. Aber ich will eine Entschuldigung, für meine Lebensumstände hier in seinem Kulturkreis und dafür, dass er sich mir gegenüber einen Ton erlaubt hat, den er sich von der Roma-Familie am bulgarischen Grenzübergang abgeschaut zu haben scheint. Ich entsorge die Bierbüchsen, will nicht, dass er merkt, dass ich getrunken habe. Fühle mich denkbar schlecht in dieser merkwürdigen Situation, die ich mir selbst zuzuschreiben habe. Als europäische Frau, die hier etwas zu spüren – oder ist es eher spielen? – versucht, was nicht das Ihre ist.
5. Checkpoint Palästina (2006)
Weinend sitzt eine blonde Frau am Grenzübergang Eres, dem Betonungetüm, das den Menschen- und Warenfluss zwischen Gaza und Israel regeln soll. Ein kleines Lächeln, als ich sie auf Deutsch anspreche. Ihr zweiter Versuch, nach Gaza zu reisen, um dort ihre Schwiegermutter kennen zu lernen, ist gescheitert. Es ist Feiertag, jüdisches Neujahr und Beginn des Ramadan, höchste Wachsamkeit bei allen Grenzern der Israeli Defense Force (IDF), die ohnehin immer gefordert ist. Das Auswärtige Amt rät von der Einreise ohnehin ab: Wenn hier geschossen und entführt wird, kann keine Botschaft helfen. Auch angemeldeten Journalisten könne jederzeit spontan die Einreise in den offiziell freien Gaza-Streifen verweigert werden, wurde schon vorher von den israelischen Behörden gewarnt.
Wir sind etwas nervös: Die Kollegen und ich haben die Maximalmenge von je einer Flasche Whiskey im Gepäck, das hatten sich zwei unserer Interviewpartner, Geschäftsleute aus Gaza-Stadt, gewünscht – gegen Bargeld. Daneben habe ich zum persönlichen Schutz immer CS-Gas dabei und fotografiere prinzipiell militärische Anlagen stets bis zu dem Punkt, an dem Ärger droht.
Lässig herumlungernde Teenagersoldaten führen kurze Interviews und telefonieren irgendwohin, warten in der Hitze, in einem mit jüdischem Neujahrsschmuck dekorierten Container-Checkpoint. Wir werden durchgewinkt. Die traurige Schwiegertochter muss draußen bleiben. Durch Drehtür und Metalldetektor geht es in die riesige Abfertigungshalle – gebaut, um tausende palästinensische Tagelöhner auf ihrem Weg nach Israel und zurück zu kontrollieren. Doch jetzt dürfen sie schon lange nicht mehr raus. Befremdlich: Jetzt, da Gaza „frei“ ist – die jüdischen Siedler sind erst ein paar Wochen weg -, sind keine Grenzgänger in Sicht, nicht einmal Grenzer, auch keine Soldaten.
Eine anonyme Grenzübergangsfabrik. Im grellen Scheinwerferlicht stehend, kommandieren mich Lautsprecher aus acht Meter Höhe. „Turn around!“ Tasche aufs Fließband, in den Apparat legen, CS-Gas und Whiskey kommen durch, es scheppert aus Lautsprechern, nach Begutachtung: „Have a nice day!“ Noch 800 Meter zu Fuß, durch einen breiten, abstrakt wirkenden Korridor aus Rohbeton, eine Passkontrolle durch drei uniformierte Damen mit Kopftuch, dann bin ich in einem der am dichtesten besiedelten Trümmerhaufen der Erde. Eine Autostunde und 45 Minuten Grenzüberschreitung vom glitzernden Tel Aviv entfernt, zuckeln hier Eselskarren über lädierte Straßen, die von Wellblechhütten und tonnenweise unentsorgtem Müll flankiert werden.
In der Ferne, über dem Meer, schwebt gleißend ein Zeppelin, perfekt getarnt, nicht fotografierbar; die Abzüge meiner Fotos werden später nur blauen Himmel mit einem leichten weißen Schatten zeigen. Der Fahrer, Ahmad, erklärt ohne Groll, dass die Israelis weiterhin alles überwachen. Trotzdem freue er sich, denn seit die Siedler abgezogen sind, könne er die große Nord-Süd-Straße des Streifens endlich wieder uneingeschränkt nutzen. Zuvor war sie teilweise und oft auch im Ganzen für Palästinenser gesperrt, auch die Umgehungsstraßen. Für ihn als Fahrer ist das Leben deutlich besser geworden, auch wenn er fast keine Kunden hat und so gut wie nichts verdient. Ahmad und seine Familie können nur mit der Hilfe seiner vier in Deutschland lebenden Brüder überleben. Seit Jahrzehnten sei dies der normale Weg für Palästinenser, im Westjordanland und in Gaza zu überleben.
Wir rumpeln nach Gaza-Stadt, ins dicht gedrängte Häusermeer, viele Häuser, fast alle, sind verfallen. Keine bürgerkriegsartigen Zustände, das Chaos sollte erst einige Wochen später ausbrechen, alles wirkt friedlich, hunderte Kinder laufen aus der UNO-blauen Schule nach Hause, und die Jungs lärmen aus voller Kehle. In Uniform winken die Kleinen aufgeregt in meine Kamera, die Mädchen mit den weißen Kopftüchern laufen hier, im – verglichen mit dem Westjordanland – konservativen Gaza, brav auf der anderen Straßenseite. Obwohl laut Unicef die Kindersterblichkeit hier sechsmal höher als in Deutschland ist und Mangelernährung herrscht, erzieht jede Frau hier fünf bis sechs Kinder. Mit weniger als einem Dollar pro Kopf und Tag. Rund 80 Prozent der Kinder in Gaza sind laut Unicef-Bericht 2004 durch die ständigen Luftangriffe und Vergeltungsaktionen der IDF traumatisiert.
Gaza unterscheidet sich optisch in drei Punkten von anderen arabischen Städten und Ortschaften: Alle Häuser sind mit Graffiti beschrieben, dabei mit verschiedenen Flaggen und Fahnen geschmückt. Meist weht die grüne Flagge der Hamas, aber auch die gelbe der Fatah, die rote der PFLP und die schwarze des Islamischen Dschihad. Statt der sonst üblichen Präsidenten- oder Königsbilder hängen hier Poster und Wandgemälde der Schaheeds, der Selbstmordattentäter. Und es türmt sich noch mehr Müll als anderswo, in den Hinterhöfen, auf den Straßen. Wenn ihn die Esel nicht fressen, holt niemand ihn ab.
Die Zukunft? Nur Gott allein weiß, was die Zukunft bringen wird. Vielleicht wird es irgendwann mal ein Palästina geben. Ein Palästina mit Industrie und einer funktionierenden Wirtschaft. Wir warten auf Gottes Rettung.“ Mai Khalil ist eine wunderschöne Frau, die ihr Kopftuch locker trägt. Sie ist Mitte zwanzig und lebt im Flüchtlingslager von Khan Yunis, im Süden des Gaza-Streifens, fast direkt am leeren, nicht ganz so schmutzigen Strand, der das Lager zum Meer hin begrenzt. Doch für Beach & Fun ist hier der falsche Ort, hier wird der Koran gelehrt, nicht schwimmen. Die junge Frau hatte mich von der Straße in ihre Behausung gezogen, als mir ihr etwa achtjähriger Sohn, im Geröll spielend, erklärte, wie sehr er die Widerstandskämpfer auf den Plakaten verehre. Irgendwie passt ihre Anmut nicht hierhin, wo israelische Vergeltungsaktionen viele Häuser bis auf die Grundmauern zerstört haben und jedes Haus durch Maschinengewehrsalven durchlöchert ist.
Die junge Palästinenserin lebt mit zwanzig Personen in etwas, das vielleicht als Trümmer mit Grundmauern, aber schon lange nicht mehr als Haus durchgehen könnte. „Wir haben vier Zimmer. In jedem Zimmer gibt es etwa vier bis sechs Personen. Im Winter ist es sehr kalt hier.“ Die dünnen Matratzen, die ärmliche Kochnische – alles, was die hier hausende Familie mit Ehemann, Onkel, Tante und Kindern besitzt, ist mit dem feinen Sand des nahen Strandes überzogen. „Seit die Juden weg sind, sind wir sehr glücklich; wir hoffen auch, dass die Gefangenen freigelassen werden. Und dass unsere Kinder Bildung bekommen und die Wirtschaft funktioniert“, erklärt mir die sechsfache Mutter, doch ihr Optimismus scheint ihr selbst unbegründet.
Ein paar Kilometer weiter liegt die von den abziehenden jüdischen Siedlern selbst zerstörte Siedlung Gusch Katif. Hier gingen 220 israelische Kinder in eine schöne, saubere Schule, deren Überreste die sich siegreich fühlenden Palästinenser nach dem israelischen Abzug komplett verwüsteten und in Brand steckten. Ein paar Männer suchen im Schutt nach Brauchbarem.
Ahmad fährt voll Stolz zum Yassir Arafat International Airport, der bis auf die von der IDF zerbombte Landebahn komplett intakt wirkt. Gebaut wurde der Flughafen 1996, von der deutschen Bundesregierung mit 150 Millionen Mark bezuschusst: damit die Palästinenser, auch während der schon damals häufigen Grenzschließungen, ihre wichtigsten Exportgüter wie Gemüse und Blumen exportieren konnten. Man kann die Abfertigungshalle einfach betreten, alles ist offen, luftig gebaut, sauber, arabische und englische Tafeln leiten den Weg für Gäste, die niemals kommen. Vielleicht besser so – sie wären vermutlich sehr irritiert von den auch hier überall hängenden Märtyrerplakaten. Oder von der hier wieder sichtbaren Mauer, die Gaza abriegelt, und dem – im Vergleich DDR-Anlagen – überdimensionierten massiven israelischen Überwachungsturm.
Hoffnung besteht trotzdem; eine palästinensische Investorengruppe hält sie kostspielig aufrecht: Sie baut in Gaza-Stadt seit fünf Jahren mit Unterbrechungen an einem Mövenpick-Hotel am Strand. Einige andere Hotels sind ebenfalls in Bau, direkt neben Flüchtlingslagern, neben im Gestrüpp grasenden Ziegen und Abfall. Wer hier wohl einmal Urlaub machen soll, falls irgendjemand Geld dazu hat und Gaza jemals ohne israelische Sondererlaubnis betreten werden darf? Die Geschäftsführerin eines neuen, sehr schicken Restaurants wagt noch nicht, auf Touristen zu hoffen, immerhin kämen aber schon viele NGO-Mitarbeiter zu ihr, obwohl erst seit einem Monat geöffnet sei. Sollten das Westjordanland und Gaza irgendwann durch einen langen, tief in die Straße eingelassenen Korridor nur für Palästinenser verbunden sein – ein vages israelisches Bauvorhaben -, könnten hier Gäste aus dem Westjordanland Tage am Meer verbringen.
Die charmanten, weltgewandten Empfänger der Whiskeyflaschen treffen wir hier. Sami Abdel Shafi hat in Amerika Wirtschaft studiert und freiwillig seinen US-Pass gegen einen Gaza-Ausweis getauscht. Er berät NGOs, die Gaza unterstützen oder aufbauen wollen, auf westlichem Niveau. „Korruption und das Versickern der Gelder ist das zweitgrößte Problem hier. Das größte ist, dass nur die Hamas als nicht korrupt gilt.“
Als es zu dämmern beginnt, wird Ahmad, der Fahrer, hektisch und erklärt, dass er mich jetzt verlassen werde, da er zu seiner Familie zum Iftar, zum Fastenbrechen, müsse, dass er mich danach nicht zum Übergang nach Eres zurückfahren könne. Das Essen werde sehr lange dauern. Restaurants gebe es keine, alle Geschäfte seien geschlossen, jeder sei bei seiner Familie. Da Gaza sich anfühlt als einer der letzten Orte der Welt, an denen man in der Abenddämmerung allein gelassen werden möchte, schenke ich ihm sofort all meinen Proviant und mein Wasser und treibe Zigaretten auf. Er erbarmt sich, erklärt sich bereit, auch nach Einbruch der Dunkelheit weiterzuchauffieren. Ein Glück, zumal jetzt nicht nur die wilde Kakophonie der Gebetsrufe aus Moschee-Lautsprechern und voll aufgedrehten Autoradios beginnt, sondern auch Gewehrsalven durch die kühle Nachtluft knallen – abgefeuert aus Freude, dass das Hungern und Dursten des Tages ein Ende hat. Wenige Nächte später schossen die Palästinenser wieder selbst gebaute Kassam-Raketen aus Nordgaza gen Israel, als Antwort kam die IDF mit Bulldozern, Apache-Helikoptern und tief fliegenden F-16-Kampfflugzeugen, deren Überschall Fensterscheiben splittern ließ.
Zurück am Übergang: Schüsse und Leuchtraketen, mit kleinen Schirmchen, als wir uns der Grenzmaschine nähern. Die palästinensischen Grenzer freuen sich über Besuch, drei locker Uniformierte hocken und liegen mit einigen Freunden in T-Shirts und Jogginghosen auf alten Matratzen beim Tee, zu dem sie sofort einladen. Nachdem ich von ihnen beim Dienst habenden Israeli am anderen Ende des Tunnels angemeldet worden bin und auf Genehmigung warte, den Gang zu passieren, hocken wir, trinken Tee und scherzen.
Israel fühlt sich besser an. Eine Stunde später, nach Fahrt entlang der neuen Mauer, beim Bier am Strand von Tel Aviv, rieseln trotzdem noch Schauer durch meinen Körper. Wie dankbar bin ich für meinen EU-Pass. Am Abend wollen schwule Freunde, Einheimische, ausgehen, in einen heißen neuen Club, das Powder. Anstehen für den Security-Check: Metalldetektor und Taschenkontrolle. Nach Drogen, wie in manch einschlägiger Disko in Europa, wird hier nicht gesucht. Hysterische Stimmung, der allnächtliche Tanz auf dem Vulkan. Um drei Uhr morgens hat kaum noch ein Mann sein T-Shirt an, recht innovative elektronische Musik peitscht die dampfende, sich eitel gebende Crowd. Joints machen die Runde, die Toilettenkabinen sind überfüllt mit hektischen, verschwitzten Menschen. Draußen, im Open-Air-Gelände, auf großen, weißen Sofas, stürzen Leiber begierig übereinander. Es soll ein schwuler Club sein, stellt sich im Lauf der Nacht aber als ein Zirkus des allgemeinen hedonistischen Wahnsinns heraus. Zwei junge Männer wollen nach Plausch und Drink zu mir ins Hotel. „First I am going to watch how you fuck him, then I am going to fuck you.“ Dabei war das Gespräch gar nicht in diese Richtung gegangen.
Die beiden sehen sehr arabisch aus. Der große Schöne, Guy, 26, ist Taxifahrer, seine Eltern sind aus Marokko, der andere, Roy, 23, ist ein aus Algerien stammender Koch-Azubi. Sie sind stolze Juden und hassen die Araber. „Warum? Wegen der Araber musste ich mir drei Jahre meines Lebens von der Armee stehlen lassen.“ Ein deutscher Freund, bi, verabredet sich zum Chillen mit einer neuen Bekanntschaft, sagt dann aber doch ab: Die Freundin des Typs sollte auch mit dabei sein und eventuell noch andere Jungs. Sie mag es gerne mit „as many boys as possible“. Wir beenden den Tag lieber in der levantinischen Morgendämmerung, schwimmend.
Am nächsten Tag nimmt mich Arvid Weinlich mit nach Jerusalem. Weinlich ist der Leiter des Deutschen Vereins zum Heiligen Lande, der seit 150 Jahren in Jerusalem ansässig ist und katholische Pilger aus dem Bistum Köln betreut. Auf der Fahrt erklärt er mir, dass die arabischen Christen Palästina verlassen, wann immer sie es sich leisten können. Auch seine christlich-arabischen Mitarbeiterinnen könnten es kaum mehr ertragen, ihre Familien nur zu Passierscheinzeiten zu sehen, willkürlich nicht mehr zu ihrem Arbeitsplatz gelassen oder festgenommen zu werden, wenn sie nach Verrichtung ihres christlichen Tagewerks, eine halbe Stunde nach Ablauf ihrer offiziell genehmigten Aufenthaltszeit im falschen Teil der Heiligen Stadt erwischt würden.
An der Hebrew University in Jerusalem treffe ich Rafael Mechoulam. Der über 80-jährige Professor empfängt mich in seinem Labor. Er ist Pionier auf dem Gebiet der therapeutischen Cannabisforschung, 1964 gelang es ihm erstmals, THC (Delta-9-Tetra-Hydro-Cannabinol) aus der Cannabispflanze zu isolieren. Seitdem forscht und kämpft er für die therapeutische Anwendung von THC, das gut gegen Appetitlosigkeit, Traumata und Angststörungen wirkt. Seine Forschungen wurden international argwöhnisch beäugt – bis die US-Soldaten aus Vietnam zurückkamen und jede Menge Probleme mitbrachten. Plötzlich flossen Fördergelder aus den USA. Mechoulams Forschungen rund um das Gute in Cannabis brachten ihm viele Urkunden renommierter Institutionen ein, auch eine Ehrung als „Wissenschaftler des Jahres“ des deutschen Hanf-Magazins. Der Professor liebt seine Arbeit und seine Studenten, derzeit hilft er Trauma- und Schmerzpatienten, auch aus der Armee, mit kontrollierter Abgabe von THC. Je stärker jedoch die Rechte in Israel sei, sagt er, desto schwieriger werde seine Arbeitssituation.
Nach unserem Gespräch fährt mich der Professor durch den Teil Jerusalems, der nach seinen Worten von „Pinguinen“ beherrscht wird, das heißt: von orthodoxen Juden. Religion findet Mechoulam einfach überbewertet. Als Kind war er, ein Verwandter von Elias Canetti, aus Osteuropa geflüchtet. Ethnisch und staatsbürgerlich sei er Jude und Israeli, begreife sich aber als europäischer Naturwissenschaftler. Zusammen suchen wir einen Shop, der Wodka führt, für die Rapper aus Ramallah, zu denen ich jetzt noch will. Es gibt überraschend viele Spirituosengeschäfte neben all den Reinigungen, in denen nur schwarze Mäntel hängen und in denen nur Männer in schwarzen Mänteln schwarze Mäntel abgeben oder abholen. Der Professor schüttelt den Kopf: Zu viel Inzest und zu viele unverständliche Besonderheiten, die er selbst nicht verstehe – aber nur durch die Besonderheiten habe sich das Volk durch die Jahrtausende erhalten können. Der feine alte Herr drückt mich beim Abschied am Damaskustor herzlich und entschuldigt sich für die Umstände, in denen ich das Weltkulturerbe finden muss.
Es soll Rapper in Ramallah geben, ein Freund aus Norwegen hatte von ihnen gehört. Die Crew von „Ramallah Underground“ fand ich im Internet. Jetzt haben sie mich zu einer Jam-Session eingeladen. Der erste Kontakt vor zwei Monaten lief über das Internet, dann über das schlechte Funknetz im Westjordanland. Ich bin glücklich, die HipHop-Jungs ans Telefon bekommen zu haben, hoffentlich erwische ich sie wieder, wenn ich in ihrer Stadt bin. Man kann sich in dieser Region nicht für eine exakte Uhrzeit verabreden, Checkpointzeiten sind ein stetiger Faktor X.
Am Damaskustor, von dem aus man den arabischen Teil der Heiligen Stadt betreten kann, knallen wieder Schüsse in der Abenddämmerung, wahrscheinlich nur aus Freude, trotzdem gehe ich einen kleinen Umweg. Ab der Busstation für Palästinenser fährt man für 45 Cent zum Kontrollpunkt Kalandia, wo der Ostjerusalemer Bus wieder umkehren muss. Kalandia wirkt in der Finsternis wie eine surreale Inszenierung, irgendwo zwischen Mad Max und der Bronx der 70er. Flutlichtlampen, monströse Kontrolltürme und die von hier an allgegenwärtige Mauer. Ich darf trotz EU-Pass und dem Argument, allein reisende Frau zu sein, kein Pfefferspray zur Selbstverteidigung bei mir tragen, die anderen – 18-jährige Soldaten – aber dürfen scharfe Knarren mit sich führen, wo immer sie auch hingehen.
Für die Pendler ist Kalandia, dieser auf mich absurd wirkende Ausnahmeort, so normal wie für mich die tägliche Fahrradfahrt durchs Brandenburger Tor. Datteln werden neben einer brennenden Tonne verkauft, schnell eine Hand voll für diejenigen, die es nicht pünktlich zum Iftar zu ihren Lieben in den „Gebieten“, den Mauerkantonen, geschafft haben.
Behinderte betteln, auf dem Boden kauernd. Taxis und Busse kurven laut hupend um den kleinen Vorplatz des Checkpoints, ein Hydrant spritzt Wasser, trotz der nächtlichen Kälte erfreuen sich ein paar kleine arabische Jungs am Wasserstrahl und plantschen vor den israelischen Kontrolltürmen im Flutlicht herum. Wer ins Westjordanland will, stellt sich an, in einem verschlungenen Gatter, überdacht immerhin, muss durch insgesamt zehn Schranken, gibt sein Gepäck ab und wartet, bis die blutjungen SoldatInnen durch den Metalldetektor winken. Die Angst vor Anschlägen scheint alles zu legitimieren. Seit es die Mauer und hunderte, auch „fliegende“ spontane Checkpoints im Westjordanland gibt, kann sich Israel statistisch tatsächlich sicherer fühlen. Ich werde als Europäerin erkannt, man winkt mich vor, die kleine Soldatin hat ein fast entschuldigendes Lächeln auf dem Gesicht, als sie meine Tasche durchwühlt und mir mein CS-Gas wegnimmt. Durch den zweiten Teil des Gatters geht es in einen rund hundert Meter langen Betonschlauch, der auf einem Parkplatz direkt neben der hier acht Meter hohen Mauer endet.
„RamallahRamallahRamallah“, rufen die Sammeltaxifahrer in die Nacht, für 45 Cent geht es weiter in die schickste Stadt Palästinas – auch für sie gilt eine Reisewarnung des AA. Wo die israelischen Flutlichter nicht mehr hinstrahlen, herrscht finsterste Nacht. Nur am Horizont funkeln die Lichter der immer schneller wachsenden jüdischen Siedlungen, Retortenstädte mit jungen israelischen Staatsbürgern, russische Enklaven auf international als palästinensisch markiertem Gebiet.
Nach wenigen Minuten: Einfahrt in das lebendige Städtchen in den Bergen, einst die Sommerfrische für reiche Jordanier, die das angenehme Klima und die schöne Aussicht über die hügelige Landschaft und die Olivenhaine genossen. Die Internetcafés sind voll mit jungen Menschen; Mädchen mit und ohne Kopftuch treffen Jungs in Chatrooms. Im Kaffeehaus nebenan, live und direkt, ist das nicht möglich, da sitzen nur die Männer. Familien flanieren auf den Straßen, jeder zweite Laden entlang der Hauptstraßen ist eine Bäckerei oder ein Süßwarenladen.
Nach einigen Versuchen erreiche ich Jad alias MC Boikutt über das Mobilnetz, er holt mich mit einem Kumpel im großen Cruiser seines Vaters ab, aus den Boxen dröhnen die Beats des Wu-Tang-Clans, für einen der zahlreichen Verwandten der US-Rapper habe er schon Beats gemacht und übers Internet verschickt, erklärt er mit derselben Lässigkeit, mit der auch alle anderen Rapper der Welt über ihre Arbeit reden.
Zum Kennenlernen gehen wir ins In-Restaurant Stones, eines der wenigen im Ramadan geöffneten Restaurants; hier sitzen westlich gestylte Mädchen mit ihren Freunden gemeinsam an Tischen und rauchen Wasserpfeife. Außerhalb des Ramadan wird hier auch Alkohol ausgeschenkt. Jad ist gerade 20 Jahre alt, ein Zarter, Schmaler, hat sehr schöne, große schwarze Augen und zeigt bei seinem seltenen Lächeln strahlend weiße Zähne. Er spricht perfektes amerikanisches Englisch, lebte die letzten zwei Jahre in Washington, D. C. und studierte Musik. Wie auch sein Kumpel besitzt er den amerikanischen Pass, der aber von den Israelis nicht anerkannt wird. „Als ich einmal versuchte, ohne israelischen Passierschein, nur mit meinem US-Pass, über Kalandia nach Jerusalem zu reisen, schmissen die Grenzer den Pass auf den Boden und traten drauf. Ob ich sie verarschen wollte, fragten sie mich, ich müsse doch genau wissen, dass der Pass für einen wie mich hier nichts bedeuten würde.“
Ich habe noch keinen Schlafplatz für die Nacht und zweifle, ob ich eine Einladung von dem kühlen Künstler bekommen werde. Kurz verabschiede ich