
Youth-Bulg-Logo. Photo: commerce.madbutcher.de
Für die heutige taz interviewte Stefan Reinecke den Islamwissenschaftler Reinhard Schulze über die derzeitige Situation im Morgenland:
taz: Herr Schulze, welche Rolle spielen Frauen in den arabischen Aufständen?
Reinhard Schulze: Ohne sie hätten diese Revolten gar nicht diese Durchschlagkraft. Das gilt für Ägypten, auch für den Jemen. Das hängt damit zusammen, dass Frauen in diesen Gesellschaften, anders als noch in den siebziger Jahren, in erheblichem Maße am öffentlichen Leben teilnehmen. Deshalb sind sie heute auch Teil der Aufstände.
Was hat sich Ihrer Beobachtung nach seitdem verändert?
Der Schlüssel ist die Berufstätigkeit der Frauen. Laut Internationaler Arbeitsorganisation (ILO) sind etwa 40 Prozent der Frauen in den arabischen Gesellschaften erwerbstätig. In den siebziger Jahren waren es unter sechs Prozent. Das ist eine massive Veränderung. Viel höher ist das Erwerbsniveau in den westlichen Industriestaaten auch nicht.
Wie kam es zu dieser Veränderung?
Teilweise wegen der Migration. Die Frauen haben Arbeitsplätze eingenommen von Männern, die ausgewandert sind. Interessant ist, dass Frauen sehr stark bei den leitenden Angestellten vertreten sind. Dass Frauen höhere Positionen bekleiden, ist in Ägypten und Tunesien sehr ausgeprägt, aber auch im Iran. Die Revolutionen, von Tunesien bis zum Jemen, sind städtisch, jung und weiblich. Die Bewegungen sind, was die Geschlechter betrifft, sehr ausgeglichen.
Ist das Bild von der unterdrückten, ins Private verbannten arabischen Frau eine europäische Projektion?
Wer arbeitet, hat andere Lebenspläne. Heirat und Kinderkriegen reichen nicht. Mit der Erwerbsarbeit wird eine soziale Identität jenseits der klassischen Familienrolle möglich. Das ist der Hintergrund, warum sich so viele Frauen in diesen Ländern an den Aufständen beteiligen, die ja soziale Revolten sind.
Sind die Bewegungen so wenig religiös gefärbt, weil so viele Frauen dabei sind?
Ja und nein. Die islamistischen Bewegungen, etwa die Muslimbrüder in Ägypten, haben versucht, die wachsende Präsenz der Frauen in der Öffentlichkeit zurückzudrängen. Doch viele Frauen nutzen den Islam ihrerseits heute als Legitimation, um an der Öffentlichkeit teilzunehmen. Darin steckt das Motiv, sich nicht mehr den Männern, sondern nur dem Islam unterzuordnen.
Gehen Sie so weit zu sagen: Die Frauen fühlen sich dort nicht vom Islam unterdrückt?
Religiös drangsaliert fühlen sich häufig Migrantinnen in Europa, aber auch Frauen in der Türkei. Wer mit Frauen in den arabischen Ländern redet, bekommt jedoch oft anderes zu hören: Unterdrückt fühlen sie sich nicht vom Islam, sondern vom Militär, den Parteien, der Männergesellschaft, die sie ausschließt.
Der Islamforscher Olivier Roy sagt, dass die Protestbewegungen „de facto in einem säkularen politischen Raum“ stattfinden.
Die Islamisten waren der Konterpart der autokratischen Regime. Beide haben sich gegenseitig gebraucht. In dem Moment, in dem plurale Ordnungen entstehen, ist dieses Spiel zu Ende. Den Islamisten fehlt das Feindbild – und damit auch Legitimität. In den Augen der jungen Generation, der Akteure der Revolte, sind die Islamistenverbände Teil der alten Ordnung, von der sie sich befreien wollen.
Hat Sie die gleichzeitige Eruption von Aufständen nach Jahrzehnten der Stabilität überrascht?
Es war klar, dass es in diesen Gesellschaften viele Widersprüche gibt, die irgendwann zum Ausdruck kommen mussten – aber wann, das war nicht vorhersehbar. Es gibt in diesen Staaten einen scharfen Generationskonflikt – zwischen der privilegierten Großvätergeneration und den vielen Jungen, die ihre Chance haben wollen.
Warum wurde der Siedepunkt gerade jetzt erreicht?
Das hat meiner Ansicht nach zwei Gründe oder Anlässe: Die Explosion der Nahrungsmittelpreise, dazu die Selbstverbrennung von Mohammed Buazizi in Tunesien, die medial eine ungeheure Wirkung entfaltete. Beides hat einen Stimmungsumschwung bewirkt – von passivem Erleiden zu dem Gefühl: So geht es nicht mehr weiter.
Die Revolten in Tunesien und Ägypten haben kein klares politisches Konzept, es sind eher Aufstände von Individuen, von Bürgern. Was ist ihr Projekt?
Der Staat soll nicht mehr, wie bisher, die gesellschaftliche Ordnung definieren, sondern umgekehrt: Die Zivilgesellschaft versucht die staatliche Ordnung zu definieren. Der Staat soll Rechtssicherheit und eine Friedensordnung garantieren, aber nicht mehr die Privilegien einzelner Gruppen schützen. Es gibt noch keine kollektive Vorstellung, wie die neue soziale Ordnung aussehen muss. Dies sind eben keine ideologischen Revolten. Was sie antreibt, ist der Wunsch, frei über das eigene Leben zu verfügen – und: Chancengleichheit. Das ist das entscheidende Motiv.
Das Offene ist der Charme dieser Bewegungen. Besteht aber nicht die Gefahr, dass sich die alten Cliquen und Strukturen dagegen wieder durchsetzen?
Die Gefahr besteht, gerade in Ägypten. Aber das hat zwei Seiten. Es ist ja eine bewusste Entscheidung, keine neuen privilegierten Machtinstitutionen zu bilden, sondern die offenen, etwas anarchischen Formen zu behalten. Weil die Bewegung eben nicht Avantgarde sein oder feste Institutionen will. Davon hat man ja gerade die Nase voll. Man kann das mit den Jugendbewegungen vergleichen, die sich gegen die Adenauer Republik richteten. Auch da ging es, wie jetzt in der arabischen Welt, um individuelle Freiheit. Man wollte sich von den Älteren einfach nicht mehr vorschreiben lassen, wie man leben soll.
Also ein arabisches 1968?
Ja, aber es gibt Unterschiede. 1968 waren es Kulturrevolten in Demokratien. Was jetzt in der arabischen Welt passiert, ist anders, weiter gespannt. Man kann es eher mit dem politischen Umbrüchen vergleichen, die 1974 und 1975 in Griechenland, Spanien und Portugal passierten – also der Transformation von faschistisch-autoritären Systemen in liberale Demokratien.
In Spanien konnte man an die Zeit vor Franco, an eine verschüttete, erstickte demokratische Tradition anknüpfen. Und in Ägypten, geht es da nicht um eine Neuerfindung?
Es gibt bei Intellektuellen in Ägypten einen Rückbezug auf die 1930er und 1940er Jahre, wo es eine relativ plurale Ordnung gab. Das ist nicht so verschieden, von dem, was in Spanien in den 70ern nach Franco geschah. Ein Unterschied ist, dass sich die Intellektuellen in den arabischen Ländern mit dem Vorurteil auseinandersetzen müssen, dass islamische Gesellschaften unfähig zur Demokratie seien.
Das ist eine Projektion des Westens?
Ja, sicher. Wenn jemand in Kairo Freiheit und Gleichheit fordert, ist das nicht weniger legitim als wenn jemand das in Paris tut – nur weil es in der ägyptischen Geschichte kein 1789 gab. Menschenrechte und Demokratie sind kein Privileg des Westens – und Araber, die sich darauf berufen, werden hierdurch eben nicht verwestlicht.
Wie groß ist die Gefahr eines Rollbacks in Ägypten?
50 zu 50. Das Militär hat sich, als es sich gegen Mubarak stellte, gegen das Regime positioniert, das es hervorgebracht hatte. Diese Ambivalenz gibt es auch heute noch. Die Gefahr, dass das Militär auf Privilegien beharrt, ist real.
Und was, wenn die Revolten doch scheitern?
Dann bleiben die Widersprüche. Dann werden die Geltungsansprüche der Jungen anders zum Ausdruck kommen.
Es gibt Prognosen, dass in zehn Jahren in der Region nicht 15 Millionen Menschen unter 30 Jahren arbeitslos sein werden, sondern 100 Millionen.
Das ist wegen der Bevölkerungsentwicklung ein realistisches Szenario. Schon heute machen die 15- bis 35-Jährigen fast 40 Prozent der Gesellschaft aus. Tendenz steigend. Das verdeutlicht, wie entscheidend diese Phase jetzt ist. Gelingt es jetzt, den Millionen, die auf den Arbeitsmarkt drängen, durch Revolte und Reformen eine Perspektive zu geben, ihnen die Selbsttätigkeit zu ermöglichen? Wenn nicht, wird der soziale Druck enorm wachsen. Dann wird es Rebellionen und Verteilungskämpfe geben, von denen wir uns heute noch keine Vorstellung machen.
Der Islamwissenschaftler argumentiert hier genauso wie der deutsche Bevölkerungsforscher Gunnar Heinsohn. Der schrieb bereits am 4.Februar in der FAZ über die Revolten der arabischen „Facebook-Generation“:
Selbst bei Annahme einer Komplettbeseitigung der aktuellen Elite werden für jeden frei werdenden Posten mindestens drei junge Männer bereitstehen. Da es Posten nicht für alle geben kann, versuchen sie sich gegenseitig zu delegitimieren. „Du bist nicht fromm genug für dieses Amt“ oder „Du hast nicht genug Hass auf Israel“ für die Stelle im Außenministerium soll dann das eigene Hochkommen rechtfertigen und ein „Du bist nicht demokratisch genug“ oder „Wir wollten doch unblutig reformieren“ aus dem Felde schlagen. Zur Abwehr von Verratsvorwürfen und damit für die Verteidigung des eigenen Lebens müssen dann auch die milder Gestimmten wildere Parolen verbreiten. All das aber schafft keine zusätzlichen Karrieren, sondern kann lediglich den Anspruch untermauern, auch weiterhin beim Ringen um den Aufstieg dabei sein zu dürfen.
Bei youthbulge-, also von Jugendüberhang getriebenen Revolutionen setzt das große Töten erst nach dem Sieg der Bewegung ein, weil die frei werdenden Pfründe nur für einen Bruchteil der Revolutionäre ausreichen. Die Älteren sind nicht zahlreich genug für die Abwehr der Jüngeren.(…)
Zwischen den beiden jüngsten Kohorten Ägyptens kann die Wachablösung mithin friedlicher verlaufen als zwischen den aktuellen Rebellen und den gestandenen Männern, die ihren Status verteidigen. Gleichwohl werden jährlich über 900 000 ägyptische Jungen fünfzehn Jahre alt – gegenüber nur 380 000 in Deutschland, das wie Ägypten achtzig Millionen Einwohner hat. Viele dieser knappen Million werden beim Kampf gegen die Fünfzig- bis Sechzigjährigen die erbarmungslose Konkurrenz unter den Fünfzehn- bis Neunundzwanzigjährigen noch verschärfen. (…)
Heinsohn argumentiert wie Sarrazin streng populations-biologisch, darauf hat sich seit einigen Jahren sein früherer Vulgär-Marxismus reduziert. Sein Text endet mit einer politischen Einschätzung der arabischen Aufstände:
„In beiden Gebieten [Gaza und Jemen] hinterlässt seit 1950 jeder Vater sieben bis acht Kinder, und selbst 2010 gibt es immer noch fünf pro Frauenleben. Obwohl diese beiden Länder im arabischen Raum schon jetzt auf die längste Kette bewaffneter Konflikte zurückschauen können, dürften ihnen die ganz großen Auseinandersetzungen erst bevorstehen. Jordanien und Syrien wiederum mit einem Durchschnittsalter von 22 Jahren werden mögliche Umwälzungen weniger heftig austragen als diese demographischen Spitzen der arabischen Welt, haben aber entschieden mehr Dampf als Ägypten.“
Über „Libyens Jungrevolutionäre“ schrieb Heinsohn am 25.Februar in der FAZ, wobei er erneut den „Youth-Bulg“ ins Feld führte:
Die fünfzehn- bis neunundzwanzigjährigen Libyer, die jetzt im Aufstand stehen, kommen aus einer Gesamtgruppe von 980 000 jungen Männern. Die ihnen nachfolgende Alterskohorte der bis fünfzehnjährigen Knaben zählt mit rund einer Million kaum mehr. Zwischen beiden Kohorten steht es mithin fast eins zu eins – ein demographisch ideales Maß. Wenn die Kinder von heute ihren Weg nach oben antreten, ist in der direkten vertikalen Konkurrenz nur einer über ihnen. Das könnte ein friedlicher Übergang werden.
Die fünfzehn- bis neunundzwanzigjährigen Kämpfer von 2011 aber stehen nicht gegen Kinder, sondern rebellieren gegen die Elite der fünfzig- bis fünfundsechzigjährigen Männer. Diese Gruppe zählt nur 350 000 Köpfe. Gegen sie halten die jüngeren Männer also eine Übermacht von fast drei zu eins. Damit stecken sie demographisch in einer ähnlich explosiven Lage wie die jungen Offiziere um Gaddafi im Jahre 1969. Als die den König Idris (1890 bis 1983) wegputschen, ist ihr Anführer gerade 27 Jahre alt und gehört zu den empörten Fünfzehn- bis Neunundzwanzigjährigen von damals.
Seine Altersgruppe umfasst seinerzeit 275 000 Mann, während die Fünfzig bis Fünfundsechzigjährigen von 1969 rund 71 000 Köpfe zählen.(…)
Am 22. März schrieb Heinsohn, Autor der ersten Genozid-Enzyklopädie „Lexikon der Völkermorde“, noch einmal in der FAZ über den Volksaufstand in Libyen:
(…) Gegen die blutig ihre Macht Verteidigenden werden alle Register des internationalen Strafrechts gezogen. Die einzuziehenden Vermögen werden penibel aufgelistet. Doch weder im Resolutionstext noch in den Reden der amerikanischen Außenministerin Clinton oder des französischen Präsidenten Sarkozy gibt es Mahnungen und Gerichtsdrohungen an die Aufständischen.
Ausdrücklich wird der Einsatz „von Söldnern durch die libysche Führung“ verurteilt. Doch womöglich unter solchem Vorwand erfolgte Völkermordakte bleiben unerwähnt. Im Ungefähren und ganz allgemein wird zwar der „Sorge um die Sicherheit von Ausländern“ Ausdruck gegeben. Aber sie steht im Kontext von Verbrechen des Regimes, dem auch hier gewiss vieles zuzutrauen ist. Über Taten seiner Gegner wird geradezu eisern geschwiegen.
Doch spätestens bei Exhumierung der Opfer der Revolutionäre wird sich einmal mehr erweisen, dass beim bewaffneten Aufstand derselbe Menschenschlag am Werke ist wie beim hochgerüsteten Machterhalt.
Diese Sicht auf Libyen durch die Brille eines sarrazynischen Realvernünftlers ähnelt seltsamerweise der postleninistischen Wahrnehmung von Karin Leukefeld. Die Journalistin ist Nahost-Reporterin u.a. der Jungen Welt, in der sie fast täglich über die arabischen Aufstände berichtet. Gestern widmete sie sich den Hintergründen der „Ami go home“-Demonstranten im Morgenland:
Besser, Sie distanzieren sich von Präsident Assad, die Zeit arbeitet gegen ihn« – das soll US-Staatssekretär Jeffrey D. Feltman Medienberichten zufolge seinen politischen Gesprächspartnern in der libanesischen Hauptstadt Beirut gesagt haben, wo er sich kürzlich bei seinem Streifzug durch die Region aufhielt. Feltman, der im US-Außenministerium für den Nahen Osten zuständig ist, ist in Beirut gut bekannt. Der ehemalige US-Botschafter im Libanon verhindert seit Monaten durch Druck auf Ministerpräsident Nadschib Mikati die Bildung einer neuen Regierung. Mikati riskiere Sanktionen gegen das Land und gegen sein privates Vermögen, sollte er eine Regierung bilden, die nicht nur die US-Politik in der Region kritisch sehen, sondern auch das UN-Sondertribunal zur Aufklärung des Mordes an Rafik Hariri in Frage stellen könnte, berichten libanesische Zeitungen. Nun also eine weitere Warnung. Libanon werde »isoliert wie Syrien«, sollte das Land Präsident Assad unterstützen, so Feltman, der Syrien als das »potentielle Nordkorea im Mittleren Osten« bezeichnete.
Westlichen Diplomaten zufolge übt Feltman auch Druck auf die Vereinigten Arabischen Emirate und Kuwait aus, sich von Syrien fernzuhalten. Die US-Regierung verfügt über ein großes Arsenal an entsprechenden Mitteln, die ihre Diplomaten und Geheimdienstler je nach Situation einsetzen. Von politischer oder wirtschaftlicher Erpressung, über Unterstützung von Regierungsgegnern, Sanktionen, UN-Sicherheitsratsresolutionen bis hin zu verdeckter Sabotage und völkerrechtswidrigen Angriffskriegen. Als selbsternannter »Weltpolizist« kennt man in Washington keine Skrupel.
Jeffrey D. Feltman (Jg. 1959) hat eine steile Karriere hinter sich. Den Posten als Staatssekretär für den Nahen Osten im US-Außenministerium übernahm er 2008. Davor war er vier Jahre lang US-Botschafter im Libanon, davor leitete er von 2003 bis 2004 das Büro der Provisorischen Koalitionsbehörde (CPA) in Erbil, im nordirakischen Kurdengebiet. Die CPA bescherte dem Land nach dem Sturz von Saddam Hussein 2003, neben der religiösen Spaltung und bürgerkriegsähnlichen Zuständen, eine gigantische Korruption. Von 2001 bis 2003 war Feltman an der US-Botschaft in Israel, dessen zionistischer Führungselite er seit seiner ersten Mission in Tel Aviv (1995–1998) stets als treuer Freund zur Seite stand. Feltman sammelte Erfahrungen in Haiti, wo er von 1986 bis 1988 US-Vizekonsul war. Er war in Tunesien und Osteuropa. Die dortigen »bunten Revolutionen«, die bekanntlich von US-finanzierten »Nichtregierungsorganisationen« und PR-Firmen beraten worden waren, empfiehlt heute nicht nur Feltman den arabischen Ländern als Beispiel für einen gelungenen Demokratisierungsprozeß.
Ein besonders enger Freund von Jeffrey D. Feltman ist der frühere saudische Botschafter in den USA, Bandar bin Sultan. Wikileaks veröffentlichte diplomatische US-Notizen, wonach Feltman und Bandar einen Plan ausheckten, mit dem die Widerspenstigen unter den Arabern entweder eingekauft oder gestürzt werden sollten. Ziel ist ein »Neuer/Größerer Mittlerer Osten«, in dem ethnische und religiöse Gruppen gegen nationale arabische Politik gestärkt werden sollen. Der Plan stammt aus den Denkfabriken diverser Geheimdienste in den USA und Saudi-Arabien und wurde 2006 von der damaligen US-Außenministerin Condoleezza Rice öffentlich gemacht. Den Krieg Israels gegen den Libanon bezeichnete sie als unvermeidbare »Geburtswehen« eines »Neuen Mittleren Ostens«, die Lage im Irak als »kreatives Chaos«.
Als Feltman am 25. Januar 2011, wenige Tage nach dem Abgang von Ben Ali, in Tunis einflog, protestierten wütende Demonstranten mit Parolen wie »Go home, Feltman«, »USA, laßt uns unsere Freiheit« und »Halt dich fern von Tunesien, Jeffrey D. Feltman«. Per Facebook wurde »Gegen die Einmischung von Feltman in die tunesische Revolution« gewettert: »Wir wollen euer kreatives Chaos nicht, wir sind nicht der Irak!!! Und wir haben kein Öl, was, verdammt noch mal, wollt ihr hier«. In einer anderen Stellungnahme hieß es: »Wir haben das hier ohne eure Hilfe geschafft (…) wir wollen unsere Demokratie, nicht eure Demokratie. Wir haben die Demokratie gesehen, die ihr dem Irak gebracht habt …. das wollen wir hier nicht.«
Seit Monaten zieht Feltman durch die Region und lotet aus, wie die USA ihre verlorenen Kontakte neu knüpfen und zuverlässige Verbündete ausmachten können. Er trifft sich mit Medienvertretern, Politikern, Diplomaten und Aktivisten, wirbt um Vertrauen, bietet Unterstützung beim Aus- und Aufbau »sozialer Medien und Netzwerke«, Hilfe bei Neuwahlen durch US-amerikanische Nichtregierungsorganisationen, Bildung und Ausbildung potentieller Entscheidungsträger an. Militärs, Polizisten, Richter, Anwälte, alle sollen die westliche Demokratieschule durchlaufen, die EU hilft mit.
Karin Leukefeld ist ebenfalls eine Realvernünftlerin, nur dass sie im Gegensatz zu Heinsohn nach wie vor antiimperialistisch motiviert ist. Beide Autoren sind nicht daran interessiert, das Entstehen einer Gegenmacht zu verstehen. Die JW-Autorin steht dabei in einer Linie mit Chavez und 1000 anderen Parteikommunisten alter Schule – d.h. aus der Zeit, als es noch die Holzklasse bei der Eisenbahn gab – und ihre Lokomotiven die Revolution nicht nur symbolisierten, sondern auch verkörperten. Völlig aus deren Gleis gesprungen ist daneben das Monatsmagazin „konkret“ – was die arabische Freiheitsbewegung betrifft, indem es in diesem Zusammenhang nur noch ein Anwachsen antizionistischer Islamismen befürchtet.
In einem Kasten neben dem obigen JW-Artikel legt Karin Leukefeld nahe, dass Feltman auch hinter den derzeitigen syrischen Volksaufständen steckt:
Anfang 2011 fielen drei Säulen des Westens und Israels innerhalb weniger Wochen: die westlich orientierte Regierung von Saad Hariri im Libanon, Zine El Abidine Ben Ali in Tunesien und Hosni Mubarak in Ägypten. Die Demonstrationen hatten einen nationalen, arabischen Charakter und nutzten denjenigen, die den Widerstand gegen westliche Einmischung in der Region und die israelische Besatzung anführten: Syrien, Hisbollah und Hamas. Der frühere US-Präsident George W. Bush verortete diese – zusammen mit Iran und Nordkorea – auf einer »Achse des Bösen«. In der arabischen Welt aber nennt man sie »Achse des Widerstandes«.
Auch wenn der Westen die »jungen Demokratiebewegungen« lobt, wird die Entwicklung als Gefahr für Israel angesehen, die Gegenrevolution marschiert. Die USA, Israel und ihre europäischen Verbündeten erhalten in der arabischen Welt Unterstützung von Saudi-Arabien, genauer gesagt vom Sudairi-Clan, der Königsfamilie des Ibn Saud. Die Sudairis beherrschen Saudi-Arabien seit Generationen, heißt es in einer Analyse von Thierry Meyssan über die Konterrevolution im Nahen Osten (www.globalresearch.ca). Sie leiten die Geheimdienste und zählen Neokonservative und Zionisten in den USA zu ihren strategischen Freunden. Die Sudairis finanzieren radikale religiöse Gruppen wie die Salafisten oder Dschihadisten, die in vielen Ländern der Region, auch in Afghanistan, agieren. Sie sorgen für Unruhe, schüchtern die Bevölkerung ein, forcieren einen radikalen religiösen Diskurs und destabilisieren die Länder als bezahlte und bewaffnete Söldner. Einer der Chefplaner ist Bandar bin Sultan, Neffe des saudischen Königs Abdullah, ehemaliger Botschafter in den USA und saudischer Geheimdienstchef. Wikileaks enthüllte ein Konzept zum Sturz des syrischen Regimes, das aus der Feder von Bandar bin Sultan und Jeffrey Feltman stammt. Früher, so Meyssan, kämpften Bandars Söldner mit der CIA in Afghanistan und Irak. Heute sind sie Partner der NATO.
Unterm Strich kommt bei Karin Leukefelds fast täglichen Berichten aus dem Morgenland heraus, dass die ganzen „Schurkenstaaten“ dort unten nun im Inneren von wahren „Schurken“ bekämpft werden. (Heute hat der JW-Bericht über Libyen z.B. folgende Überschrift: „Bengasi blockiert Friedenslösung – Gaddafi zu Waffenstillstand bereit. Afrikanische Vermittlung scheitert an Rebellen“). Über das Problem mit den „Schurken“ hat der französische Philosoph Jacques Derrida einmal Folgendes gesagt:
Für die US-Regierung war die Sowjetunion der größte „Schurkenstaat“: die Nummer 1. Mit der Auflösung der Sowjetunion ist dieser Begriff jedoch laut Derrida überflüssig geworden: „künftig werden wir es nicht mehr mit dem klassischen Krieg zwischen Nationen zu tun haben, weil kein Staat der übrig gebliebenen Großmacht USA den Krieg erklärt hat oder als Staat gegen sie zu Felde zieht; wo aber kein Nationalstaat beteiligt ist, kann auch nicht mehr von Bürgerkrieg die Rede sein, ja nicht einmal mehr von ‚Partisanenkrieg‘, da es nicht mehr um Widerstand gegen eine Besatzungsmacht, um einen revolutionären oder Unabhängigkeitskrieg zur Befreiung eines kolonisierten Staates und zur Gründung eines anderen geht. Aus denselben Gründen verliert der Begriff ‚Terrorismus‘ seine Triftigkeit, weil er stets und zu Recht mit ‚revolutionären Kriegen‘, ‚Unabhängigkeitskriegen‘ oder ‚Partisanenkriegen‘ verbunden war: mit Auseinandersetzungen, die immer um einen Staat, in dessen Horizont und auf dessen Boden geführt werden. Es gibt also nur noch Schurkenstaaten und gleichzeitig keine Schurkenstaaten mehr. Der Begriff ist an seine Grenze gestoßen, seine Zeit ist zu Ende.“
Bereits am 19.Juni 2000 habe Madeleine Albright der Öffentlichkeit mitgeteilt, das ‚State Department‘ halte diese Bezeichnung nicht mehr für angebracht, man werde künftig neutraler und zurückhaltender von ‚States of concern‘ sprechen. Derrida übersetzt dies mit „‚Sorgenstaaten‘ (Etats préoccupants), Staaten, die uns viele Sorgen bereiten, aber auch Staaten, um die wir uns ernsthaft besorgen und kümmern müssen – behandlungsbedürftige Fälle, im medizinischen wie im juristischen Sinn.“
Das geschieht derzeit mit Libyen, während man sich bei Syrien noch um die Diagnose streitet. Eine Verurteilung des syrischen Regimes als „Schurkenherrschaft“ scheiterte im UN-Sicherheitsrat am Veto Russlands.
AFP meldet heute aus Syrien:
Mit einem Gipfeltreffen in der Türkei will die syrische Opposition ihre Entschlossenheit zu einem demokratischen Wandel in ihrer Heimat demonstrieren. Während die rund 300 Teilnehmer am Mittwoch ihre Beratungen über Wege zu einem Machtwechsel aufnahmen, warf Human Rights Watch der Führung in Damaskus vor, in der südlichen Stadt Daraa Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen zu haben. UNICEF verurteilte die Gewalt gegen Kinder.
Zu der „Konferenz für einen Wandel in Syrien“ versammelten sich rund 300 zumeist im Exil lebende Dissidenten im türkischen Badeort Antalya. Laut Organisatoren wollen sie bis Freitag einen Fahrplan zu einem friedlichen und demokratischen Übergang in ihrer Heimat aufstellen. Das Treffen fand unter hohen Sicherheitsvorkehrungen statt, nachdem Anhänger des syrischen Präsidenten Baschar el Assad in Antalya gegen die Oppositionellen demonstriert hatten.
Zum Auftakt der Konferenz sangen die Regierungsgegner die syrische Nationalhymne und legten eine Schweigeminute für die „Märtyrer“ ein, die bei der gewaltsamen Niederschlagung der Proteste durch Sicherheitskräfte getötet wurden. Die Teilnehmer, darunter auch Mitglieder der Muslimbrüder, riefen „Freiheit, Freiheit“ und „Das Volk ist vereint“. Die Opposition fordert den Rücktritt Assads und eine Strafverfolgung des Präsidenten.
Nach Angaben von Aktivisten wurden seit Beginn der Protestbewegung Mitte März mehr als 1100 Zivilisten getötet. Sicherheitskräfte hätten mindestens 30 Kinder bei Demonstrationen erschossen, teilte das UN-Kinderhilfswerk UNICEF mit. Zwar könnten die genauen Umstände nicht überprüft werden. Es gebe aber Information über eine steigende Zahl von Kindern, die festgenommen, gefoltert und getötet würden.
Syrische Aktivisten hatten am Wochenende eine Facebook-Seite im Gedenken an einen 13-jährigen Jungen ins Leben gerufen, der ihren Angaben zufolge von Sicherheitskräften im südlichen Daraa gefoltert und getötet wurde. Syrische Medien wiesen die Foltervorwürfe als „erfundene Lügen“ zurück. Sie vermeldeten am Mittwoch, Präsident Assad habe die Eltern des Kindes empfangen.
In Daraa hatte die Protestwelle gegen den autoritär herrschenden Staatschef ihren Anfang genommen. Bei der Unterdrückung der Bewegung wurden dort nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen. Es gebe Hinweise auf „systematische Massaker und Folterakte durch syrische Sicherheitskräfte“, hieß es in einem Bericht, dem mehr als 50 Interviews mit Opfern und Zeugen zugrunde lagen.
„Seit mehr als zwei Monaten töten und foltern die syrischen Behörden ihr eigenes Volk“, sagte Sarah Leah Whitson, HRW-Beauftragte für den Nahen Osten. „Wenn das nicht aufhört, muss der UN-Sicherheitsrat dafür sorgen, dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden.“
Die Position der syrischen Regierung werde mit jedem Tag „weniger tragbar“, sagte Außenministerin Hillary Clinton. Assad habe bislang keine ernsthaften Reformanstrengungen unternommen. Zu der angekündigten Generalamnestie für alle politischen Gefangenen sagte ihr Sprecher Mark Toner, Assad habe in der Vergangenheit „viel gesagt“, aber wenig getan. Auch Frankreichs Außenminister Alain Juppé zeigte sich skeptisch. Sein türkischer Kollege Ahmet Davutoglu rief Damaskus auf, dem Straferlass politische Reformen folgen zu lassen.
Aus Libyen meldet Reuters:
Der Chef der libyschen Öl-Gesellschaft hat Machthaber Muammar Gaddafi die Gefolgschaft aufgekündigt. Schokri Ghanem erschien am Mittwoch überraschend in Rom und erklärte, er schließe sich dem Kampf der libyschen Jugend für einen Verfassungsstaat an. Ghanmen erschien zusammen mit dem ebenfalls übergelaufenen libyschen Botschafter auf einer Pressekonferenz. Der Chef der Öl-Gesellschaft ist einer der ranghöchsten Libyer, die Gaddafi im Machtkampf mit den Rebellen den Rücken gekehrt haben.
Aus dem Jemen meldet dpa:
Gewalt und Chaos breiten sich im Jemen immer weiter aus. Am Mittwoch wurde die kuwaitische Botschaft in Sanaa geschlossen. Auch die italienischen Diplomaten haben inzwischen die jemenitische Hauptstadt verlassen, in der am Mittwoch nach Angaben von Augenzeugen erneut Schüsse und Explosionen zu hören waren. Die deutsche Botschaft in Sanaa ist derzeit noch mit einer Kernmannschaft besetzt.
Die Regierungstruppen, die loyal zu Präsident Ali Abdullah Salih stehen, lieferten sich weiter Gefechte mit den Kämpfern von Scheich Sadik al-Ahmar, dem Führer des Haschid-Stammes, zu dem auch der Präsident gehört. Augenzeugen berichteten, am Mittwoch seien auch Granaten im Al-Dschamaa-Viertel gelandet.
Beobachter vor Ort deuteten dies als Versuch des Präsidenten, die Einheit von General Ali Mohsen al-Ahmar in den Konflikt zu verwickeln. Der General, der zu Salihs Familie gehört und früher zum Kreis seiner Vertrauten zählte, hatte sich auf die Seite der Demonstranten gestellt, die seit vier Monaten einen Regimewechsel fordern.
In der Stadt Tais waren bei Auseinandersetzungen zwischen Regierungstruppen und Anti-Salih-Demonstranten in den vergangenen Tagen Dutzende von Zivilisten getötet worden. Nach Angaben der Oppositionsmedien ging das Blutvergießen auch am Mittwoch weiter. In der südlichen Stadt Aden leben inzwischen nach Informationen der Nachrichtenwebsite „News Yemen“ 3000 Vertriebene aus der Provinz Abijan in Schulen. Sie waren vor den Kämpfen zwischen Regierungstruppen und Al-Kaida-Terroristen geflohen.
Die Opposition behauptet, Salih habe die Provinzhauptstadt Sindschibar den Terroristen überlassen. Sein Ziel sei es, überall im Land Chaos zu stiften. Das Oppositionsbündnis JMP zog unterdessen seine Zustimmung zu einem von den arabischen Golfstaaten vorgeschlagenen Plan zurück, der einen Rücktritt Salihs vorsieht, ihm gleichzeitig aber Straffreiheit garantiert. Salih hatte die Vereinbarung nicht unterzeichnet.
Eher harmlose Anti-Gentrifizierungsaktionen, die sich u.a. gegen Touristen richten, meldet dpa dagegen aus Ägypten:
Weil Demonstranten die Zugänge zum Tal der Königinnen und zu den Sehenswürdigkeiten von Deir al-Madina blockiert hatten, mussten Touristen im ägyptischen Luxor ihr Besichtigungsprogramm ändern. Die Menschen protestierten am Mittwoch dagegen, dass sie ihre Häuser in dem Dorf Kurna verlassen müssen, weil diese in einem bedeutenden archäologischen Gebiet liegen. Die vom Staat versprochene Entschädigung lasse jedoch auf sich warten.
Auch die Memnonkolosse konnten nach Angaben von Augenzeugen am Mittwoch nicht besichtigt werden. Die am Morgen ebenfalls besetzte Straße, die Assuan im Süden mit der Hauptstadt Kairo verbindet, wurde von den Demonstranten wieder geräumt, nachdem sich Vermittler eingeschaltet hatten.
Die taz meldet aus Berlin:
Nach der Räumung eines besetzten Hauses im Wrangelkiez will der Kreuzberger Grünen-Bürgermeister über Einzug der Besetzer verhandeln. Das Haus war 1993 vom Land an die GSW verschenkt worden. Die hat es nun verkauft.
In der Schweizer Wochenzeitung WOZ berichtet Dorothea Wurer aus Sevilla über die dortigen Platzbesetzer:
«No nos vamos!» Nein, sie gehen nicht, jetzt erst recht nicht. Seit die Polizei am Freitag versucht hat, zwei Protestlager in Barcelona und Lleida gewaltsam zu räumen (es gab weit über hundert Verletzte) ist die Zahl der Indignados, der Empörten, in Spanien noch ein bisschen grösser geworden. Auch in Sevilla. Hier hatten sich am Freitagabend Hunderte auf der zentralen Plaza de la Encarnación versammelt und Blumen in die Höhe gestreckt. Es war eine friedliche Antwort auf die staatliche Gewalt und erinnerte an die Hippiezeit – zu der es ja wegen der Franco-Diktatur in Spanien nie gekommen war. Mit dem Pariser Mai 1968 hat die «Echte-Demokratie-Jetzt!»-Bewegung (siehe unten: «Für totalen Umbau») dagegen wenig gemein: Die Indignados wollen den bürgerlichen Staat nicht zerschlagen. Er soll nur endlich mal auch als Rechts- und Sozialstaat funktionieren.
Sie stehen mit den Beinen «auf dem Boden», wie die Medien erleichtert feststellten. Statt zu randalieren, campieren die Empörten seit fast drei Wochen friedlich auf den Plätzen, halten die Plazas sauber und sind gut organisiert. Aber pflegeleicht sind sie deswegen nicht: Als Reaktion auf die polizeiliche Gewalt in Barcelona haben die Protestierenden von Sevilla und Madrid am Sonntag an ihren offenen Versammlungen beschlossen, ihre Camps bis auf weiteres aufrechtzuerhalten.
Über einen längeren Zeitraum hinweg werden sie ihr Dauercampen kaum durchhalten. Das weiss auch der 23-jährige Geschichtsstudent Jesús Romero, der von Anfang an im Internet mitdiskutierte und mitorganisierte. «Keiner von uns hat mit diesem Erfolg gerechnet», sagt er auf der Plaza de la Encarnación. «Wir wussten zwar, dass wir nicht allein sind und dass es viele gibt, die die Nase voll haben.» Aber dass daraus eine solche Bewegung entsteht? Er selbst hat fünf Nächte auf der Plaza geschlafen, ist jetzt aber anderswo unterwegs, in Alcalá de Guadaíra zum Beispiel. Zu einem ersten Treffen, das er dort mit zwei Freunden anberaumt hatte, waren 400 Leute gekommen. Das ist nicht schlecht für die 70 000 EinwohnerInnen zählende Schlafstadt zwanzig Kilometer östlich von Sevilla.
«Es gibt viele, denen es so geht wie mir», sagt Romero, «wir haben nichts zu verlieren.» Er kann sein Studium nicht abschliessen, weil er durch eine Prüfung gerasselt ist und eine Wiederholung 200 Euro kostet – zusätzlich zu den 950 Euro, die er ohnehin pro Studienjahr bezahlen muss. Seit dem 16. Lebensjahr hat Romero gearbeitet, erst neben der Schule, dann zur Finanzierung des Studiums: «Anders hätte ich mir meine Ausbildung gar nicht leisten können.» Nun sucht er schon seit sechs Monaten einen Job. 180 Briefe hat er allein in den letzten sechs Wochen abgeschickt, Internetbewerbungen nicht mitgezählt. «Ich bin nicht wählerisch», sagt er, «inzwischen bewerbe ich mich auf jede Stelle in ganz Spanien.» Für seinen letzten Halbtagesjob als Verkäufer bekam er 400 Euro im Monat. «Und dafür musste ich meist fünf oder sechs Stunden arbeiten.» Romero braucht eine Stelle, wenn er sein Studium beenden will. Seine Eltern, bei denen er wohnt, können ihn zwar ernähren, aber nicht das Studium finanzieren.
Dem 27 Jahre alten Diplom-Geisteswissenschaftler Raúl Sánchez* geht es ähnlich. Auch er kann sich keine eigene Wohnung leisten, auch er ist arbeitslos. Vor vier Jahren war er mit seinem Hochschulabschluss in der Tasche nach Irland ausgewandert, wo er drei Jahre in einem Callcenter arbeitete. Kein Traumjob, aber zumindest konnte er vom Lohn leben. «Hier kommst du mit derselben Arbeit kaum über die Runden.» Doch dann verschied der keltische Tiger, wie Irlands Boomökonomie genannt wurde, und Raúl kehrte zurück. Anfänglich bekam er ein paar Monate lang Arbeitslosengeld; doch damit ist jetzt Schluss. Selbst wenn er eine bezahlte Tätigkeit finden sollte, bleiben die Aussichten düster: «In Andalusien liegt der Durchschnittslohn bei 600 Euro im Monat, mit Hochschulabschluss bekommst du vielleicht 800 Euro. Eine Einzimmerwohnung oder ein WG-Zimmer kostet aber mindestens 300 Euro, dazu kommen Strom, Wasser, Gas, Internet. Und essen muss ich ja auch noch.»
Raúl Sánchez sucht nicht nur eine Stelle, er bewirbt sich auch um ein Stipendium. Wie er würden sich gerne viele weiterqualifizieren – trotz der hohen Studiengebühren. Mit dem Abschluss hat es derzeit jedenfalls niemand eilig; der Arbeitsmarkt gibt ja nichts her. Und ist das Erststudium absolviert, würden viele gern den Master machen oder promovieren. Oder sie beginnen gleich ein neues Studium.
Dafür hat sich Zita Márquez entschieden. Die 25-jährige Diplomchemikerin lebt seit knapp drei Wochen auf der Plaza de la Encarnación. Sie spricht Spanisch, Englisch und Französisch, lernt jetzt noch Italienisch und Deutsch und will ab September Soziologie studieren. «Die Regierung fördert die Grundlagenforschung nicht, und in der freien Wirtschaft will ich als Chemikerin nicht arbeiten. Also muss ich mir etwas anderes überlegen.» Im Vergleich zu Jesús und Raúl geht es ihr passabel: Sie arbeitet halbtags in einem Fitnessstudio. Der Lohn reicht zwar nicht für eine eigene Wohnung, aber erstens ist das «ein Luxus, den sich ohnehin kaum jemand leisten kann», wie sie sagt, und zweitens kann sie damit zumindest ihr Studium und ihre privaten Ausgaben finanzieren. Und warum campiert sie auf der Plaza? «Wo sollte ich denn sonst sein?», antwortet Zita verwundert. «Schliesslich geht es um meine Zukunft!»
Ruben Triana (18) sieht das auch so. Vormittags geht der Journalistikstudent zur Uni, den Rest des Tages und die Nächte verbringt er auf dem Platz, dessen Neugestaltung gerade rechtzeitig fertig wurde für die ungewöhnlichen Dauergäste. Er will «so lange wie nötig» hier bleiben und nennt als Hauptforderung die Änderung des geltenden Wahlsystems. Es basiert auf dem sogenannten D’Hondt-Verfahren, das angesichts der Zersplitterung des Landes in viele Wahlbezirke die kleinen Parteien benachteilige, sagt Triana. «Die Zweiparteienpolitik geht inzwischen so weit, dass die Leute gar nicht wissen, dass es Alternativen zur sozialdemokratischen PSOE und zur konservativen Volkspartei gibt.»
Alejandro Garrido* hingegen geht es vor allem um eine Änderung des Bildungssystems. «Der Bolognaprozess hat den Unterricht verschult und das Studium verteuert», sagt der 23-jährige Kunststudent, der kurz vor dem Abschluss seines Masters steht und jeweils von Juli bis September in einer Tomatenfabrik seiner Heimatstadt Badajoz das Geld für die Ausbildung verdient. Garrido will Lehrer werden – und muss dafür die absurd umfangreichen Auswahlprüfungen für den öffentlichen Dienst bestehen, auf die man sich normalerweise in einer privaten Akademie vorbereitet. Einen Job aber garantiert selbst ein erfolgreiches Bestehen nicht: Die Regierung hat die Zahl der Neueinstellungen um rund zwei Drittel gekürzt. Trotzdem ist die Beamtenlaufbahn derzeit beliebter denn je – auf eine freie Stelle kommen durchschnittlich hundert BewerberInnen.
Miguel Velázquez* war bisher noch nicht auf dem besetzten Platz. Und doch kann der gelernte Autoelektriker (35) die Proteste gut verstehen. Seit zweieinhalb Jahren sucht er eine Stelle. Im ersten Jahr bezog er monatlich 600 Euro Arbeitslosengeld, seither bekommt die Familie 426 Euro Unterstützung im Monat. Da die Velázquez eine Tochter haben, wird ihnen diese Hilfe 21 Monate lang gezahlt. Kinderlose erhalten sie nur noch für maximal 6 Monate – und auch das nicht mehr lange: Die sozialdemokratische Regierung hat die Hilfe ganz gestrichen.
Wie lebt man von 426 Euro? «Ich arbeite schwarz nebenher – mal hier ein kleiner Auftrag, mal dort», sagt Velázquez, der nur 250 Euro Hypothek bezahlen muss; das rettet ihn. Wie viele Bewerbungen er verschickt hat, weiss er nicht. Er geht lieber direkt zu potenziellen Chefs und hat schon bei allen Autohändlern und Werkstätten in der Provinz angeklopft. Aber nichts, nicht einmal für ein paar Wochen. Und in neun Monaten bekommt er auch vom Staat nichts mehr. Wegziehen geht auch nicht: «Hier habe ich meine Familie, die mir hilft, wenn es hart kommt», sagt er. «Es müsste schon ein verdammt gut bezahlter Job sein, damit sich der Umzug lohnt. So einen gibt es aber derzeit in ganz Spanien nicht.»
Das weiss auch Rocío Pérez*. Die arbeitslose 36-jährige Bürokauffrau (sie erhält keine Unterstützung, weil sie bisher als Freiberuflerin angemeldet war) bewirbt sich auf jede Stellenausschreibung. Angeboten wurde ihr bisher aber nur ein Job bei einer Reinigungsfirma – für einen Stundenlohn von vier Euro. Damit würde sie das verdienen, was die Regierung als Mindestlohn festgesetzt hat, 640 Euro monatlich. Eigentlich könnte sie sich diese Stelle nicht leisten: Schon die monatliche Hypothek für ihre Fünfzig-Quadratmeter-Wohnung liegt 200 Euro über dem, was ihr da angeboten wird. Und doch überlegt sie: «Lieber das als gar nichts.»
Auch Rocío Pérez hat bisher nicht an den täglichen Vollversammlungen auf der Plaza von Sevilla teilgenommen haben. Aber sie freut sich wie Miguel Velázquez, dass sich etwas bewegt: «Endlich wehrt sich jemand und sagt, was Sache ist. Wie Idioten haben wir bisher alles geschluckt.»
Im Labournet findet man weitere Artikel mit „links“ über die Situation in Spanien: http://www.labournet.de/internationales/es/index.html. Das gleiche gilt für die Situation in Griechenland – dazu heißt es bei labournet:
Auch in Griechenland sind in dieser Woche Platzbesetzungen explodiert. „Griechenland geht ab“ ist die Übersetzung einer Meldung (von occupiedlondon, wo laufend aktualisiert wird) am 25. Mai 2011 bei indymedia und gibt einen wirklichen knappen ersten Überblick. Nicht nur die Camps, auch die Losung ist spanisch inspiriert: „Sie sollen alle gehen“. Alle sind diejenigen, die jetzt alles ausverkaufen…

Athener Demohund. Photo: kleinezeitung.at
Die Aufständischen Jugendlichen in Arabien, Spanien, Griechenland, Kroatien und Frankreich könnten von Gaddafis Ideen profitieren, wie der „libysche Staatschef“ sie ab 1975 in seinem „Grünen Buch“ (al-Kitab al-achdar) niedergelegt hat. Im Ostberliner „telegraph“, dessen neueste Ausgabe soeben ausgeliefert wurde, hat der korsische Philosoph am Leipziger Theater, Guillaume Paoli, dies jedenfalls nahegelegt. Hier einige Auszüge aus seinem Text:
Gaddafis „Grünes Buch“ enthält alle Elemente, um radikale Staatskritiker und Anhänger des “dritten Wegs“ zu begeistern. Der Gedankenrahmen schwebt zwischen zwei vertrauten Polen: der Rousseau’schen Beschwörung eines „Naturzustands“, als es noch keine Ausbeutung und kein Eigentum gab (hier das nomadische Leben in der Wüste), und zugleich der Vervollkommnung der modernen Zivilisation, welche eine Beseitigung „überholter“ Gesellschaftsstrukturen voraussetzt. Die Vorstellung ist universalistisch, sie gibt keiner Nation, Klasse oder Kultur den Vorrang. Die Gleichberechtigung der Frauen und Minderheiten wird hervorgehoben. Die politische Auffassung erinnert an die der Rätekommunisten von 1918: Abschaffung der Parteien und Parlamente, Einführung der direkten Demokratie auf allen Ebenen. Die ganze Macht wird von den Volkskomitees ausgeübt, das Gewaltmonopol durch die Volksbewaffnung ersetzt. Ökonomisch wird die „Lohnsklaverei“ zugunsten der freien Assoziation freier Produzenten abgeschafft.
Hier wird nicht wie bei Lenin oder Mao die (vorübergehende) Notwendigkeit des omnipotenten Staates behauptet, sondern dessen absolute Abwesenheit. Es ist die alte anarcho-kommunistische Utopie wie sie in allen revolutionären Bewegungen des 20. Jahrhunderts mit Gewalt unterdrückt wurde.
„Das grüne Buch“ zeichnet sich von antiquierten Machtergreifungsfibeln dadurch aus, dass es sich nicht nur auf Politik und Wirtschaft konzentriert. Im dritten Teil wird eine fundamentale Kulturkritik erläutert, die durchaus auf der Höhe ihrer Zeit ist, eine Kritik der Trennung zwischen Akteuren und Zuschauern wie sie archetypisch in Theatern herrscht:
„Menschen, die kein heroisches Leben führen können, Menschen, die von der Geschichte nichts wissen und der Zukunft nicht entgegensehen, Menschen, die die eigene Existenz nicht ernst genug nehmen, solche Menschen sitzen in Theater- und Kinosälen, um Ereignisse zu beschauen in der Hoffnung, daraus etwas lernen zu können. Sie sind wie noch unwissende Schulkinder im Klassenzimmer.
Wer ein wirklich selbstbestimmtes Leben führt, der hat kein Bedürfnis, zuzuschauen, wie Schauspieler auf Bühnen oder Leinwänden das Leben vorführen. So wenig hat der Reiter, der den Zügel des eigenen Pferdes hält, das Bedürfnis, auf Pferderennbahntribünen zu sitzen. Hätte jeder Mensch ein Pferd, würde keiner zuschauen und klatschen. Sitzende Zuschauer sind einfach zu hilflos, um selbst aktiv werden zu können. Man geht auch nicht in ein Restaurant, einfach um Essende zu beschauen. Beduinen haben kein Interesse an Theater oder Shows, dafür sind sie zu ernst und arbeitsam. Weil sie das Leben ernst nehmen, verpönen sie die Schauspielerei. Sie sind keine Zuschauer, sie spielen selbst und nehmen an fröhlichen Feste teil, weil sie die natürliche Notwendigkeit solcher spontanen Aktivitäten anerkennen.“
Das erinnert stark an ein Kultbuch der 68er Generation, Guy Debords „Gesellschaft des Spektakels“ in dem behauptet wird: „Alles, was unmittelbar erlebt wurde, hat sich in einer Repräsentation entfernt“ – da spielt Debord auf die Polysemie des Wortes „Repräsentation“, das auf französisch sowohl (politische) Vertretung, als auch (Theater) Vorstellung und (künstlerische) Abbildung bedeutet. Parlamentarische Demokratie, Konsumgesellschaft, entfremdete Arbeit, das sind bloß Phänomene. Grundlegend ist das allgemeine passive Verhältnis, das die Zuschauer von der Macht über das eigene Leben trennt. Diese Kritik der Entfremdung stammt aus den künstlerischen Avantgarden. Demnach geht es nicht nur darum, die Politik demokratischer und die Arbeit gerechter zu gestalten. Das Leben soll zum Kunstwerk und alle Menschen zu Künstlern werden. Es gibt nur ein revolutionäres Ziel: die Selbstabschaffung des Zuschauers.
Zweifelsohne ist Gaddafi ein Aktionskünstler gewesen. Jahrelang kursierten unter schmunzelnden Arabern die jüngsten Einfälle des Politprovokateurs. Einmal kommt die algerische Fußballmannschaft nach Tripolis für ein Freundschaftsspiel. Vor dem Anpfiff steht Gaddafi auf und erklärt „aus Freundschaft zu unseren algerischen Brüdern“ diese kurzerhand zum Sieger. Die von dem Spiel frustrierten Fans randalieren im Stadion (stand doch in seinem „grünen Buch“: „nur Idioten sitzen im Stadion um Sportlern zu applaudieren anstatt selber Sport zu praktizieren“). Ein anderes Mal bestellt er Journalisten vor das Tor eines Gefängnisses, wo politische Opponenten (natürlich ohne Urteil) sitzen. Dann erscheint der Revolutionsführer höchst persönlich am Steuer eines Baggers, rammt die Mauer ein und lässt großzügig die Insassen durch die zerstörte Umwallung fliehen – ein klarer Fall der stellvertretenden Befriedigung unser aller Zerstörungsphantasien…
Schlingensief hat es nicht besser gemacht. Der Unterschied ist nur: In der Regel wird man Künstler, um das tun zu dürfen, was sonst nur Diktatoren können. Umgekehrt wurde Gaddafi Diktator, um Dinge zu tun, die sich sonst nur Künstler gönnen.
Aber dann kommt die unerwartete Wendung. Auf einmal hören die Araber auf, Zuschauer von Palastrevolutionen zu sein und übernehmen die Regie. Die Rebellion fängt bei den Westnachbarn an, geht bei den Ostnachbarn weiter, schließlich steckt sie die Massen in Bengazi und Tripolis perkolativ an. Diese fangen an, das zu werden, was von ihnen immer behauptet wurde. Es werden tatsächliche Volkskomitees gegründet, Entscheidungen werden basisdemokratisch getroffen, Waffen zu Selbstverteidigungszwecken ergattert. Jetzt wird Gaddafis Vision real umgesetzt, aber gegen Gaddafi selbst. Somit wird die als-ob-Inszenierung abrupt abgebrochen. Die Fiktion platzt wie eine Thermoskanne. In der Logik des „Revolutionsführers“ kann dieser Einbruch der Wirklichkeit nur einer kollektiven Halluzination zugeschrieben werden, wahrscheinlich unter Drogeneinfluss der Teilnehmer. Die Störer der fortdauernden Komödie werden als „Komödianten“ beschimpft, sie seien Statisten einer Inszenierung unter der gemeinsamen Regie von Al Qaida und Al Jazeera.
Plötzlich gibt es keine Zuschauermasse mehr, sondern ein Volk. Im Alltag existiert das Volk nicht, nirgends. Das Volk gibt es nur dann, wenn (und solange) es sich auf der Straße sichtbar macht und sich als solche behauptet. Sobald es „Wir sind das Volk“ sagt, ist es eine reale Kraft. Und dieser Moment ist gewöhnlich kurz.
In dem Moment, als die libysche Menge das „grüne Buch“ öffentlich verbrennt, realisiert sie das Programm des „grünen Buches“.
Photo: deutsch-tuerkische-nachrichten.de
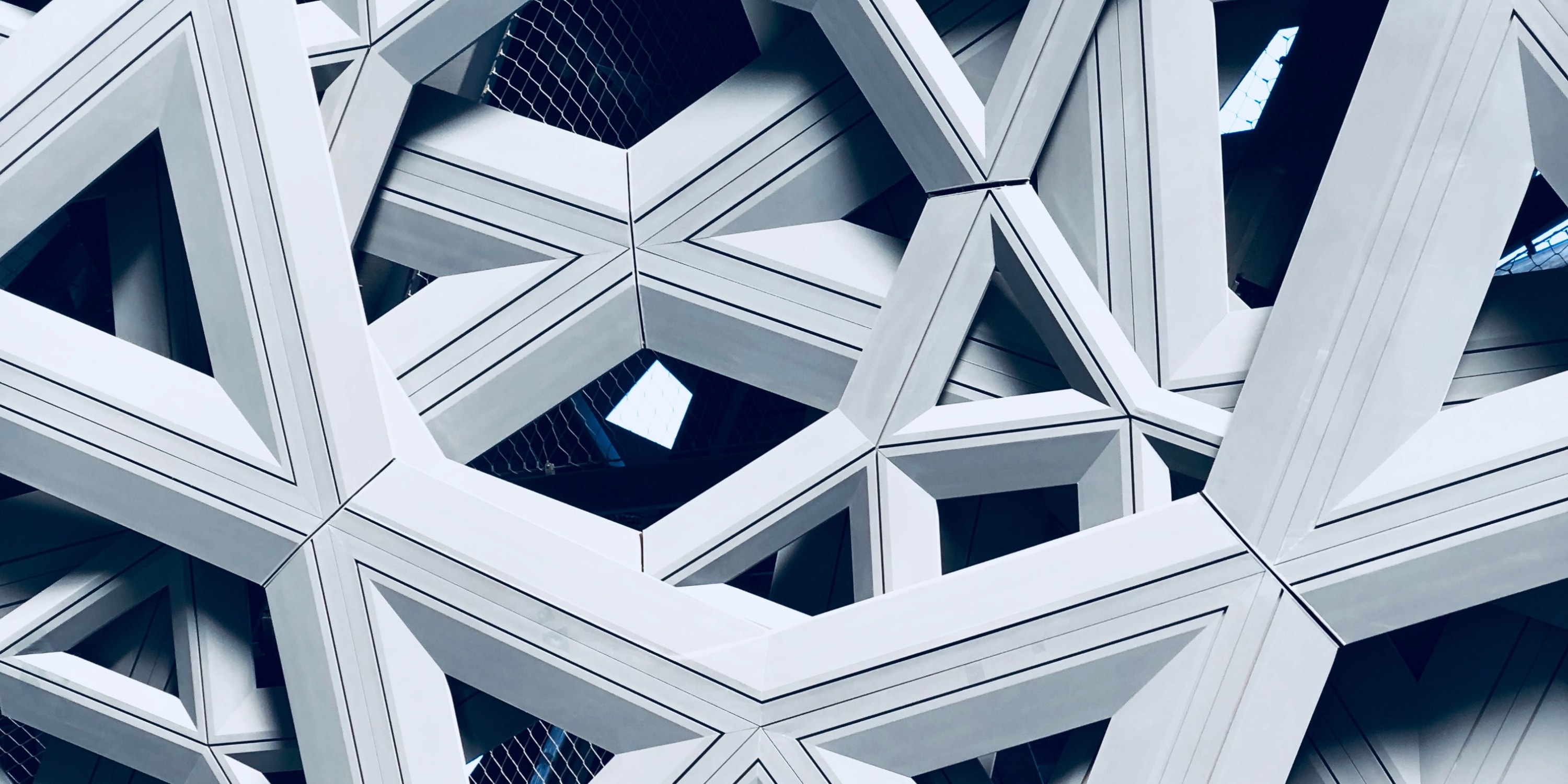




taz-Hamburg vermeldet:
„Plötzlich wieder Aufstand
Künstler besetzen ein Altbauquartier, Anwohner kämpfen gegen eine Ikea-Ansiedlung. Städtischer Protest hat in Hamburg seit zwei Jahren an Fahrt gewonnen.
An diesem Himmelfahrtswochenende findet wieder so ein Kongress statt, jedoch in einem deutlich größeren Rahmen. Mobilisiert wurde bundesweit. Die Debatten docken an den internationalen Diskurs an und an eine im ganzen Land verbreitete Renitenz, die weit ins Bürgertum hinein reicht.
In Hamburg haben fast alle Debatten, die im Zusammenhang mit dem „Recht auf Stadt“ eine Rolle spielen, in den vergangenen zwei Jahren ihren Ausdruck gefunden. Entsprechend breit ist das Spektrum der Initiativen, die sich an der Elbe unter dem Dach der Bewegung versammelt haben: von Kleingärtnern über Klimaschützer bis hin zu Mieteraktivisten und Künstlern. Den richtigen Drive und die bundesweite Aufmerksamkeit freilich brachten letztere.
Neben dem Kampf um Freiräume, dem Denkmal- und dem Milieuschutz spielt der Umweltschutz bei den städtischen Konflikten eine große Rolle. In Hamburg verdichtete er sich in dem Konflikt um eine Fernwärmeleitung für das in Bau befindliche Kohlekraftwerk Moorburg. Anwohner und Umweltverbände probten den Aufstand als ruchbar wurde, die Leitungstrasse sollte durch einen Park aus der Wiederaufbauphase in den 50er Jahren führen.
Die Anwohner demonstrierten, veranstalteten Pressekonferenzen und besetzten Bäume. Der Unwille, eine Baustelle vor dem eigenen Haus zu tolerieren und Bäume zu verlieren, verband sich mit dem großen Kampf gegen den Klimawandel, verkörpert in dem Großkraftwerk der Firma Vattenfall. Jetzt wird über eine andere Trassenvariante nachgedacht.
Weil an allen Ecken und Enden mit gut organisiertem Protest zu rechnen ist, hat die Politik reagiert. In einem sehr mobilisierungsfähigen Viertel wie Altona kommt die verfasste Politik nicht um eine frühzeitige Bürgerbeteiligung herum. Stadtteilkonferenzen und Planungswerkstätten sollen dem verbreiteten Misstrauen der Bürger begegnen. Die in den vergangenen Jahren sukzessive eingeführte Volksgesetzgebung zwingt sie nachgerade dazu. Die Gesellschaft lernt dazu – nicht nur technologisch sondern auch politisch.