Falling Apart – Six Pieces:
1. Das Lebenspartnerschaftsergänzungsgesetz
Auf dem Kairoer Tahrirplatz diskutierte eine Arbeitsgruppe (unter gelber Zeltplane), ob man nicht die Vielehe wiederbeleben – und sie auf homosexuelle Beziehungen erweitern solle. Die Teilnehmer begriffen diese Gemeinschaftsform als eine zeitgemäße Anwort sowohl auf den Übergang von Bluts- zu Wahlverwandtschaften als auch von privatem zu kollektivem Wirtschaften – d.h. zu Genossenschaften, die derzeit unter den Kleinbauern am Nil geradezu massenhaft zur Verbesserung ihrer Einkaufs- und Vertriebs-Möglichkeiten gegründet werden. Bei den Diskutanten handelte sich jedoch überwiegend um junge Städter beiderlei Geschlechts.
In Deutschland hat man vor einigen Jahren bereits die christlich-bürgerliche Einehe erweitert – indem man sie auch auf gleichgeschlechtliche Partner anwendete. Diese müssen nicht einmal auf Kinder verzichten: In den gleichgeschlechtlichen Ehen können die Männer Kinder adoptieren und die Frauen die Ehe mit einer Insemination quasi ausdehnen. Zu all dem hat die Regierung der BRD 2001 ein Gesetz über „eingetragene Lebenspartnerschaft“ verabschiedet. „Die Rechtsfolgen dieses Rechtsinstituts der Lebenspartnerschaft sind den Rechtsfolgen der Ehe in bürgerlich-rechtlichen Angelegenheiten zum größten Teil nachgebildet,“ heißt es dazu bei Wikipedia. Nach einiger Zeit sollte es nachgebessert werden – und zwar mit einem „Lebenspartnerschaftsergänzungsgesetz“ (LPartGErgG). Dies betraf vor allem beamten- und steuerrechtliche Vorteile, den Verheiratete gegenüber Unverheirateten genießen. Sie sollten auch für gleichgeschlechtliche Ehepartner gelten. Wenn schon denn schon. Das hatte „der Gesetzgeber“ bloß vergessen – ausdrücklich hinzuzufügen: So dachte man. Und war dann baff, als dieses Ergänzungsgesetz im Bundesrat (am Widerstand der CDU/CSU) scheiterte: Eine Zusammenveranlagung beim Finanzamt komme nicht in Frage, so wurde kurzerhand argumentiert, weil der Gesetzgeber dies nicht vorgesehen habe. Punkt. Der Gesetzgeber hatte also ausdrücklich die Homosexuellen-Ehe anerkannt, ihr gleichzeitig jedoch ebenso ausdrücklich den einzigen materiellen Vorteil verweigert, die der Staat der Ehe – als der Basisinstitution zur Förderung einer allgemeinen Moral – gewährt.
Hier könnte die postislamische Vielehe, wie oben diskutiert, einen Ausweg bieten: Indem sie sich als Wirtschaftseinheit „Genossenschaft“ einträgt, um deren Steuervorteile zu genießen. Diese bestehen – speziell in Berlin – darin, dass Genossenschaftsgründungen hier mit EU-Geldern gefördert werden. Nach dem neuen Genossenschaftsgesetz (GenG), das zur selben Zeit wie die Ablehnung des Ergänzungsgesetzes zur „Homo-Ehe“ novelliert wurde, reichen schon drei „Genossen“ für eine Gründung aus (was in etwa der traditionellen arabischen Vielehe entspricht), außerdem ist die Gründung von – bisher unerlaubten – „Kulturgenossenschaften“ möglich. Hinter diesem Vorstoß stand nicht der neoschwul-liberale Berliner Bürgermeister („arm aber sexy“), sondern der US-Ökonom Richard Florida und sein Bestseller: „Der Aufstieg der Kreativen Klasse“, in dem er von einem „Schwulen-Index“ ausgeht: Je mehr Homosexuelle eine Region hat, desto kreativer geht es in ihr zu – und desto prosperierender ist sie damit auch – im weltweiten Vergleich. Diese Argumentation setzt auf das Coming-Out und damit – in den USA – auf das Heiraten der Schwulen (erst dann kann man sie für den „Index“ heranziehen). Mit Floridas Theorie, mehr Schwule bringen mehr Kreativität in eine Population, wird zugleich das Argument der christlich-jüdisch-islamischen Traditionalisten – mehr Schwule bringen weniger Kinder und gefährden damit unseren Staat, unsere Nation, die immer mehr schrumpft, so wie es z.B. bei den Parsen in Bombay der Fall ist – dieser Gedankengang wird in sein Gegenteil verkehrt, indem nun gerade die Schwulen – wegen des „Kreativen Klimas“, das sie um sich verbreiten – junge Leute von nah und fern in ihre „Hotspots“ ziehen (siehe dazu auch: „homonauten.de).
In Kairo nahm man jedoch bald Abstand von dieser Idee der „Kreativ-Vielehe“, denn dort gilt die Unterscheidung zwischen Homo- und Heterosexuell als fatale „Errungenschaft“ der okzidentalen Kolonisierung des Orients. Zwar heißt es auch schon im Koran – Sure sieben, leicht vorwurfsvoll: „Ihr nähert euch den Männern lieber als den Frauen, um Eure Leidenschaften zu stillen“, d.h. die arabischen Männer können in der Mehrzahl mehr mit anderen Männern als mit ihren weggesperrten Frauen was anfangen, sie sind also tendenziell alle (auf klassisch griechische Weise) schwul, dennoch oder gerade deswegen wird im islamischen Kulturraum jede homosexuelle Identitätspolitik – zu Recht – abgelehnt und bekämpft. Es ist auch zu ärmlich und peinlich, als Schwuler oder Heterosexueller durch die Welt zu gehen. Sein Selbstbewußtsein als Künstler, Programmierer oder Ingenieur zu fixieren – ist schon dämlich genug – heute, da wir alle Generalisten und Maximalisten sein müssen – mindestens. Für die Arbeitsgruppe auf dem Tahrirplatz kam noch hinzu, dass es um sie herum gerade um eine Aufhebung aller Trennungen ging. Die polyamante Vielehe setzt diese jedoch in puncto Sexualität voraus, um sie danach erst aufzuheben (d.h. einzutragen).
2. Neue religiöse Bewegungen in der globalen Stadt
Neue religiöse Bewegungen und Organisationen spielen in den Städten der Welt eine immer wichtigere Rolle. Sie verändern Räume und Ökonomien, sie treten als politische Akteure auf und ersetzen häufig sogar die Rolle des Staates – quer durch alle Regionen und Religionen. In Lagos fasst die größte Pfingstkirche fünfmal mehr Gläubige als das weltgrößte Fußballstadion; am Rande der Metropole wird sogar eine eigene »City of God« errichtet. In Beirut übernehmen Islamisten den Wiederaufbau der kriegszerstörten Stadt und kontrollieren die Wohnungsversorgung. In den Favelas von Rio sind die Evangelikalen in der Drogenprävention aktiv, während in Mumbai Hindu-Nationalisten ganz offiziell an der Stadtregierung beteiligt sind. Umso erstaunlicher, dass die Stadtforschung diesem Phänomen bislang kaum Beachtung geschenkt hat.
metroZones ermöglicht mit der vorliegenden Textsammlung internationaler Autor/innen einen differenzierten Blick auf die Zusammenhänge zwischen urbaner Entwicklung und städtischen Glaubenspraktiken, zwischen dem Versprechen der religiösen Erlösung und dem der politischen Befreiung. Jenseits ideologischer Debatten um das »Wiedererstarken des Religiösen« wird deutlich, dass die Städte zugleich Orte religiöser Innovation sind. Und sie bringen beileibe nicht nur anti-moderne, intolerante Fundamentalismen hervor.
Mit Beiträgen von Yasmeen Arif, Asef Bayat, Patrícia Birman, Enrique Dussel, Julia Eckert, Delwar Hussain, Leo Penta, Werner Schiffauer, Pablo Semán, Klaus Teschner und Asonzeh Ukah
metroZones 10, Verlag Assoziation A, Berlin/Hamburg, ISBN 978-3-935936-78-1
3. Kommunisten-Bashing und Kaiser-Trashing
Gibt es einen Zusammenhang zwischen der öffentlichen Kritik an den Ostlinken und der im Fernsehen übertragenen Hohenzollern-Hochzeit in Potsdam? fragten sich einige Ostler in der Boheme-Kneipe „Rumbalotte continua“. Als Anarchisten waren sie eigentlich von beidem wenig berührt. Aber sie erinnerten sich: Die Kritik an der Partei „Die Linke“, die ihre Demontage, d.h. ihr Herabdrücken unter die 5%-Hürde, bezweckte, begann mit der Verwendung des Wortes „Kommunismus“ durch die Parteivorsitzende. Das Echo in der Westpresse war derart, dass ein Riß durch ihre „Scene“ ging: von kleinlautem Abschwächen bis zu trotzigem Beharren. Auf dem Rosa-Luxemburg-Kongreß z.B..
Es folgten einige IM-Enttarnungen im näheren und weiteren Umfeld – durch die entsprechenden West-Kanäle bzw. -Organe. Am 13.August erregte dann die Junge Welt die antikommunistische Wacht: Sie gedachte mit einem großen, roten „Danke“ der 1961 errichteten „Mauer“, zeigte Photos von damals an der Grenze aufmarschierten Betriebskampfgruppen und erinnerte daran, dass dieses Bollwerk immerhin 28 Jahre Leute wie Hubertus Knabe von der Stasijagd abgehalten habe. Auch in der „Rumbalotte“ war ein JW-Autor dabei, dem das zu weit gegangen war, der sogar einen Text verfaßt hatte, in dem er das „Danke“ kritisierte. Ähnliches hatte zuvor ein anderer Autor getextet, seine Entgegnung hatte die JW-Redaktion bereits abgedruckt. In der Vergangenheit war es bereits mehrmals vorgekommen, dass sich JW-Autoren von ihrer Zeitung distanziert hatten – und das in der JW veröffentlichen wollten. Man kann hierbei von einem „Autonomen“-Flügel sprechen, der sich vor allem um das Feuilleton scharrt, das deswegen auch als Einfallstor der Westler in die einst größte DDR-Zeitung bezeichnet wurde.
„Die Linke“ brachte sich etwa zur gleichen Zeit wie das JW-„Danke“ wieder in die öffentliche Aufmerksamkeit, indem ein Dankesbrief des Parteivorstands an Fidel Castro – für 100 Jahre kubanischen Sozialismus – zu den Westmedien gelangte. Einige Zeitungen zitierten daraufhin eine Meldung aus der kubanischen Parteizeitung „Granma“ vom Tag, als die „Rebellen“ Tripolis einnahmen: „Die libyschen Behörden befürchten eine Zunahme der militärischen Aggressionen gegen die Nation im Vorfeld des 42. Jahrestages der von Gaddafi angeführten Grünen Revolution am 1. September.“ Ein ehemaliger JW-Autor fragte sich (und uns) in der „Rumbalotte“-Runde, ob es nicht einen Zusammenhang gäbe zwischen diesen ganzen medialen Phänomenen und der Tatsache, dass man im einstigen Bonzenghetto Wandlitz, wo sich nun die „Preußen-Klinik“ befinde, alle depressiven Patienten aus dem Osten im „Honecker-Bungalow“ konzentriere. Er, Honecker, sei damals dort ebenfalls depressiv geworden. Im übrigen wisse er, dass die „Danke“-JW in vielen DDR-Städten sofort ausverkauft war, in Magdeburg hätten seine „Hooligan-Kumpel“ sogar Kopien davon verteilt.
Und dann wollte er wissen, was die Hohenzollernhochzeit, die er kurz zuvor im Fernsehen „selbst“ gesehen hatte, damit zu tun habe. Die öffentlich-rechtliche Moderatorin des Events hatte die Berliner Zeitung sopgar auf ihrer Seite 1 porträtiert. Zu dieser Sauerei konnte ich ein paar Anekdoten beisteuern: Mit dem jüngsten Hohenzollern war ich einst im Internat gewesen. Er war so zurückhaltend, dass er uns, um in „Kontakt“ zu kommen, Geld lieh. Wenn wir es ihm zurückgeben wollten, stritt er ab, uns jemals was gegeben zu haben. Sein älterer Bruder war militärisch überengagiert: bei einer Übung in Schwanewede wurde er von seiner eigenen Panzereinheit überfahren. Ein weiterer Hohenzollern mußte seine Doktorarbeit in Geschichte zurückgeben, weil er sie in Teilen plagiiert hatte. Und dieser Sproß nun, der in Potsdam wieder zelebrierende zukünftige deutsche Kaiser heiratet eine Isenburg-Prinzessin. Sie stammt aus dem Birsteiner Geschlecht derer zu Isenburg (daneben gibt es noch die Büdinger Linie, die sich mit „Y“ schreibt). Fast berühmt wurden die Birsteiner durch die Prinzessin Helene von Isenburg, als diese nach dem Krieg mit prominenter Beteiligung, u.a. hochrangiger SS-Offiziere, den gemeinnützigen Verein „Stille Hilfe“ gründete, mit dem deutsche Kriegsverbrecher ins sichere Ausland gebracht wurden.
Wir haben es hier also, bei der Potsdamer Hochzeit, qua Blutsverbindung („Das Geheimnis des Adels ist die Zoologie,“ Karl Marx) mit einer üblen, reaktionären Verschwörung zu tun. Diese erhellt sich aus der wachsenden „Empörung“ der Ostler gegenüber dem Westen – und umgekehrt aus der Dreistigkeit der Westler, mit der sie dem „Kommunistisch-Werden“ drüben entgegentreten. Ungeklärt blieb die Frage: War dieser konzertierte Rechtsruck der auf amerikanische Weltsicht geeichten Kapital- und Staatsmedien ein Ausdruck von Nervosität und Schwäche – angesichts der weltweit auflodernden Aufstände oder – im Gegenteil: von Stärke, indem auch noch das letzte Stasi-Schwein und kommunistische Artikulieren ans Licht gezerrt wird, um es auszumerzen – mit Öko, Menschenrechten und „sozialen Medien“ – der früheren „Sozialhilfe“.
4. Die Pfade der Tränen (von Hannes Stein)
Wenn man Porträtfotos von Cherokee aus dem 19. Jahrhundert betrachtet, so sieht man keine Indianer, die dem Klischee vom (edlen oder unedlen) Wilden entsprechen, sondern Gentlemen im Bratenrock mit Vatermörder. Genauer: Man sieht Gentlemen aus den Südstaaten. Die Cherokee gehörten zu den „sieben zivilisierten Indianervölkern“. Sie hatten um 1830 längst eine demokratische Verfassung, sie hatten Zeitungen, die in einem Silbenalphabet gedruckt wurden, das eigens hierfür erfunden worden war, und die meisten von ihnen bekannten sich zum Christentum.
Der endgültige Beweis, dass die Cherokee zivilisiert waren, bestand aber darin, dass sie schwarze Sklaven hielten. Die Cherokee lebten auf einem Territorium zwischen Georgia und Tennessee, und ihr Traum war es, als weiterer Stern auf dem Sternenbanner aufzutauchen. Daraus wurde nichts: 1829 wurde Andrew Jackson Präsident der USA, ein Populist und Demokrat, der das tat, was den verarmten Massen gefiel, die aus Europa ins Land stürmten. Die Massen wollten Land, sie wollten Bodenschätze, und als auf dem Territorium der Cherokee Gold gefunden wurde, gab es kein Halten mehr. Jackson befahl, die Cherokee in das heutige Oklahoma umzusiedeln. Dieser Gewaltmarsch von 1838, der ungefähr 4000 Cherokee das Leben kostete, ist als „Pfad der Tränen“ in die Geschichte eingegangen.
Die meisten Cherokee leben heute immer noch in Oklahoma. 2006 beschlossen sie in einer Volksabstimmung, die Nachkommen ihrer schwarzen Sklaven – die „freedmen“ – kurzerhand aus dem Stamm zu kegeln. Es geht dabei ums Geld. Wie alle 300 Indianervölker in Amerika haben auch die Cherokee das Recht, Casinos zu betreiben und Tabak ohne Steuernzu verkaufen. Ein Cherokee hat Anspruch auf eine gesetzliche Krankenversicherung (die es für normale Amerikaner nicht gibt); die Nachkommen der Sklaven sollen diesen Luxus künftig nicht mehr genießen. Der Oberste Gerichtshof der Cherokees in Oklahoma hat diesen schändlichen Beschluss jetzt gerade bestätigt. Marilyn Vann, eine Anwältin der „freedmen“, erklärte in einem Interview im Rückblick auf den „Pfad der Tränen“: „Unsere Vorfahren haben dabei das Gepäck getragen.“ Offenbar sind die anderen Cherokee ihnen dafür nicht besonders dankbar. Allerdings ist nicht klar, welcher Rechtsweg den „freedmen“ jetzt eigentlich noch offen steht. Der Oberste Gerichtshof in Washington würde den diskriminierenden Beschluss ohne Zweifel sofort rückgängig machen. Aber der hat in dieser Angelegenheit nichts zu melden. Die Cherokee sind eigenständig, sie gelten völkerrechtlich als souveräne Nation. Sie können tun, was sie wollen; sie dürfen sogar ganz gemeine Rassisten sein.
5. Sensible Sammlungen
»Sensible Objekte« in musealen Sammlungen werden seit den achtziger Jahren als »menschliche Überreste« und »Gegenstände von religiöser Bedeutung« definiert. Dabei sind nicht nur die Gegenstände selbst »sensibel«, sondern auch und vor allem die Umstände ihrer Herstellung und Beschaffung. Im 19. und frühen 20. Jahrhundert reisten europäische Forscher in die kolonialisierten Teile der Welt. Sie sammelten Anthropologica – Knochen, Haarproben und Präparate – und Ethnografica – Gegenstände aus der materiellen Kultur – von Angehörigen der dort lebenden sogenannten »aussterbenden Völker« und brachten sie in wissenschaftliche Sammlungen und Museen in Europa. Unter ähnlichen ethnografischen Fragstellungen und Sammlungsinteressen richtete sich der Blick aber auch auf in Europa lebende Bevölkerungsgruppen. Bei ihren Forschungen innerhalb und außerhalb Europas produzierten Wissenschaftler und Sammler Messdaten, Körperbeschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Gipsabgüsse, Filme und Tonaufnahmen von lebenden Menschen. Diese Zeugnisse wurden mithilfe handwerklicher und technischer Verfahren von ihren Körpern abgenommen. Sie entstanden oftmals in für die Erforschten prekären Situationen wie in Gefängnissen, Polizeistationen oder militärischen Einrichtungen und sind von kolonialen Herrschaftsstrukturen und der Definitionsmacht von Wissenschaftlern und Behörden geprägt.
In dem Buch „Sensible Sammlungen“ wird die Geschichte solcher Sammlungsbestände in ihrem spezifischen kulturhistorischen Kontext an einer Reihe von Beispielen entlang erzählt. Mit Gipsabdrücken und Tondokumenten geraten dabei vor allem bisher weniger untersuchte Objekte als Bestandteile »sensibler Sammlungen« in den Blick.
Margit Berner, Anette Hoffmann, Britta Lange: „Sensible Sammlungen. Aus dem anthropologischen Depot“ – herausgegeben von der Redaktion ilinx, FUNDUS Band 210, ISBN: 978-3-86572-677-3. Kontakt: Anke Wenzel: wenzel(at)philo-fine-arts.de, Nora Sdun: sdun(at)philo-fine-arts.de
6. Wohlgerüche und Stinkstiefel
„Ich erst erkannte die Wahrheit – indem ich sie roch. Mein Genie liegt in meinen Nüstern,“ schrieb Friedrich Nietzsche. Aber kann es nicht sein, dass im Orient das Genie schon immer in den Nüstern lag? „In ästhetischer Hinsicht hat sich der islamische Purismus, indem er darauf verzichtete, die Sinnlichkeit zu beseitigen, damit begnügt, sie auf ihre gemeinen Formen zu reduzieren: Wohlgerüche, Spitzen, Stickereien und Gärten,“ schreibt Claude Lévi-Strauss in seinem Buch „Traurige Tropen“. Und in der Tat gibt es kaum einen Roman aus dem Orient (Arabien oder Iran), in dem nicht in Gerüchen geschwelgt wird. Anders dagegen die Berichte von Frauen aus dem Westen, die den Orient bereisten – das Buch „Sandmeere“ von Isabelle Eberhard z.B.: In ihrem Algerien gibt es keine Gerüche – sie ist ganz Augen und Ohren. Auch in anderen Reiseberichten von Frauen aus dem Westen, von Ella Maillart z.B., die den sowjetischen Orient und den Iran bereiste, ist so gut wie gar nicht von Düften bzw. Gerüchen die Rede – höchstens von unangenehmen. Haben die Westfrauen kein „Genie“?
2010 veröffentlichte der Wiener Soziologe Otto Penz eine empirische Studie über „Die klassen- und geschlechtsspezifische Körperlichkeit – Schönheit als Praxis“ (in Mitteleuropa), in der er feststellte, dass mit der ökonomischen und sozialen Macht von Frauen die Bedeutung männlichen Schönheitshandelns zunimmt, ohne dass dabei die Klassenunterschiede verschwinden. Dazu erklärte die Rezensentin Nina Degele: „Während bei Arbeitern die aufgrund körperlicher Arbeit erforderliche Geruchsbekämpfung dominiert, praktizieren Männer der oberen Klasse eine facettenreiche Körperpflege und ein intensives Fitnesstraining.“ Indem die Männer der Unterklasse „sich gegen Schweiß und Körpergeruch zur Wehr setzen“ gelten sie dem Soziologen als „Verlierer im Schönheitsspiel“. Überhaupt gibt es hier viele Männer wie Frauen, die am Liebsten gar keine künstlichen Geruchsstoffe an sich dulden, höchstens, dass sie ihren Körper-Eigengeruch mittels (unparfümierter) Seife dämpfen. Alles andere, so sagen sie: stinkt.
Umgekehrt nehmen viele in künstlichen Lebensräumen sich aufhaltende Menschen die natürlichen Körpergerüche von anderen nur noch als stinkend wahr. In vielen Ländern des Orients sind die Frauen verschleiert und es gilt zudem als unschicklich, sie anzustarren. Wir haben uns dagegen der Okulartyrannis unterworfen: unsere Augen dominieren alle anderen Sinnesorgane. Speziell der Geruchssinn gilt als das „Stiefkind der Sinnesorgane“. Schon Platon und Aristoteles hielten die „niederen Sinne“ (Schmecken und Riechen) für ungeeignet zur Erlangung von Erkenntnissen, da sie im Unterschied zum Sehen und Hören nicht auf Distanz funktionieren, sondern den direkten Kontakt zwischen Objekt und Körper erfordern.
Im Orient liebt man schwere Düfte, die auch ohne den direkten Kontakt „funktionieren“. „Parfum ist Mode für Blinde,“ meinte Karl Lagerfeld, als er 2008 ein Parfum – „Liquid Karl“- für H&M kreierte. Demnächst will er ein Parfüm auf den Markt bringen, das nach Büchern riecht – und „Paper Passion“ heißen wird. Als Hypothese soll hier erst einmal gelten: Während man im Okzident „Geruchsprobleme“ hat und „Geruchsbekämpfung“ betreibt, wird im Orient eher nach „Düften“ und neuen Duftstoffen gesucht. Schon die „Heiligen Drei Könige“ brachten aus dem Morgenland „Weihrauch, Myrrhe und Gold“ als Geschenke mit. Bei den ersten beiden handelte es sich um Baumharze, die verbrannt als Duftspender dienen – und sonst nichts. Sie scheinen dennoch ebenso wertvoll wie Gold gewesen zu sein.
Auch das heute teuerste Parfum der Welt – die „Nr.1 – Imperial Majesty Edition“ von Clive Christian – besteht vorwiegend aus orientalischen Ingredienzien: Zedernholz, Kardamon, persisches Moschus, Benjion-Balsam etc..500 Milliliter kosten 195.000 Euro. Das angeblich berühmteste Parfum des Orients heißt „Amouage“ (arabisch für Welle), wird in Oman hergestellt und besteht u.a. aus Rosenwasser, Weihrauch, Myrrhe und Patschuli. Es ist eine Mischung aus 120 Ölen und Essenzen. Hergestellt hat sie der Franzose Guy Robert im Auftrag des Sultans von Oman. Einige Jahre lang war „Amouage Gold“ das teuerste Parfum der Welt, heute kann man zwischen neun verschiedenen Amouage-Düften wählen. 50 Milliliter kosten zwischen 130 und 358 Euro. In Paris werden neue Duftkreationen noch immer auf „Parfüm-Premieren“ vorgestellt.
Zunächst mußten sich die dortigen Parfümeure mit ihren Produkten gegen die Wohlgerüche aus dem Orient durchsetzen. „All the perfumes of Arabia will not sweeten this little hand,“ seufzte Lady Mcbeth in Shakespeares Stück „Macbeth“ angesichts der vielen Morde, die um sie herum geschahen. Das Land der arabischen Düfte, das die Römer „Arabia felix“ nannten, war der Jemen und Saudi-Arabien. Dort wuchs auch der Weihrauchbaum. Spätestens seit den Siebzigerjahren des 20.Jahrhunderts kämpfen die französischen Parfumhersteller zunehmend gegen die US-Konkurrenz. „Amerikas Duft war indes immer etwas süßlicher und stärker als der französische,“ schrieb der Spiegel damals: „,Ein amerikanisches Parfum wirkt wie ein K.-o-Schlag'“, spottete das Sunday Times Magazine, „man kann es 50 Schritt gegen den Wind riechen“. Der Kampf mit künstlichen Gerüchen zwischen Mann und Frau, Orient und Okzident, aber auch zwischen den versprühten Aromen in Hotels z.B. wird immer heftiger. Die „Desodorierung“ erfaßt immer mehr Bereiche. In Heidelberg z.B. die Einkaufsstraße, die jeden Tag mit einem anderen Duftstoff besprüht wird. Es mehren sich jedoch gleichzeitig auch die Duftstoffallergiker.

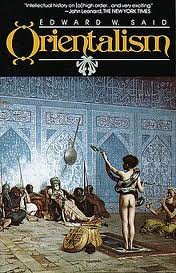



Im August-Heft des Netzwerks „bordermonitoring.eu“: „Tunesien – zwischen Revolution und Migration“ heißt es an zwei Stellen über die Beteiligung der Frauen an den arabischen Aufständen:
„Auf unsere Frage, ob auch Frauen an den Aktionen beteiligt waren (waren!), erklären die Jungs: ‚Ja, auf jeden Fall. Sie haben das Essen zubereitet. Und Steine gesammelt und vorbereitet…“
Dabei handelt es sich um Wurfgeschosse, die gegen die Polizisten eingesetzt wurden. In der ostdeutschen Zeitschrift für Philosophie wurde vor einiger Zeit berichtet, dass und warum Frauen aufgrund ihres Raumgefühls, geprägt durch ihrer Rolle im Haus, im Gegensatz zu den Männern nicht werfen können. Hierzulande hat sich dieses Manko mit der Erweiterung der weiblichen Spielräume in der Gesellschaft langsam gegeben.