Fait Divers

Autist. Photo: ub.fu-berlin.de
L’Etat sans Moi
Der Antipsychiater Fernand Deligny war während und nach dem Zweiten Weltkrieg Leiter einer Anstalt für Schwererziehbare. In seinem Buch „Provokateure des Glücks“ schreibt er: Meine Erzieherkollegen wissen, „wieviel an einem Besuchstag ein ,gut geführter‘ Bereich an Feigheit, Heuchelei, an mehr oder weniger freiwilliger Verblendung, an schmerzlicher Abweichung von propagierten Prinzipien, an geschickter Tarnung, an zweifelhaften Versprechungen, künstlicher Ermutigung, an Taktieren und profihaftem Können voraussetzt.“ Wenn man mit dem Staat, einer Behörde, einer „Einrichtung“ zu tun hat oder bekommt, dann ist man ebenfalls Heimkind bzw. Besucher, bzw. wie man heute sagt: „Kunde“ oder „Klient“.
Das weiß man, trotzdem gibt es noch Überraschungen: Kürzlich zeigte die Volksbühne Thomas Heises Dokumentarfilm über das Rathaus in Mitte „Das Haus“ (1984), in einer Szene wird eine Hochzeit gezeigt: ein junges Arbeiterpärchen sitzt vor einer ausgewachsenen Standesbeamtin und wird vermählt. Die Prozedur besteht im Wesentlichen darin, dass sie den beiden einen staatsbürgerlichen Vortrag hält – der kein Ende findet. Aus den dadurch Verheirateten werden währenddessen zwei gepeinigte Vorschulkinder. Mir ging bei dieser Szene auf, dass sich standesamtlich oder kirchlich zu verheiraten eine absolute Infantilisierung bedeutet. Dieser entmündigende Vorgang ist nicht auf die Staatsorgane beschränkt: Man kucke sich nur all die Arbeiter-Streiks, -Demos und -Proteste an, die von der Gewerkschaft unterstützt, d.h. organisiert werden: Da kriegen die Teilnehmer erst einmal alle rote Regenwesten mit dem Logo der Gewerkschaft drauf, dazu Trillerpfeifen und Fahnen sowie vorgedruckte Parolen – ebenfalls mit dem Gewerkschaftsemblem versehen. Und dann geht es los. Meistens mit zwei Mann vorne, die ein Transparant tragen, das nicht selten ebenfalls von der Gewerkschaft hergestellt wurde. Die Ansammlung von Arbeitern vor ihrem bestreikten Betrieb sieht damit aus als würde sich eine Kindergartentruppe auf Ausflug befinden. Weil es sich dabei aber durchweg um mehr als kräftige Erwachsene handelt, stellt sich beim Zuschauer sofort Fremdschämen ein – statt Solidarität zu zeigen, macht er eher einen großen Bogen um sie.
Das gleiche dumme Gefühl stellt sich ein, wenn man Gast auf Parteitagen oder bei den Ortsgruppen irgendwelcher Parteien ist: Es sind alles Infantilisierte, die da angestrengt und völlig humorlos Demokratie spielen – sich vor versammelter Presse wichtig machen. Aber das alles verschwindet derzeit quasi vor unseren Augen. Die ganzen jetzigen Protestierer – die sich über die neuen „sozialen Medien“ versammelnden Jungmenschen – wollen diesen Scheiß nicht mehr länger mitmachen. Einem Journalisten nach dem anderen (auch so ein Wichtigtuerberuf, der abgeschafft gehört) erklären sie nun geduldig: „Die Occupy Wall Street Bewegung legt besonderen Wert darauf, nicht von Organisationen, sondern allein von Individuen getragen zu werden. Auch werden Führungspersonen und offizielle Vertreter bislang strikt abgelehnt. ,Es ist sehr einfach für die Presse, einen klaren Ansprechpartner zu haben,, erbost sich ein Aktivist, ,aber das ist eine neue Bewegung! Man muss sich daran gewöhnen, dass Bewegungen heute anders strukturiert sind als die Verbände der letzten Jahrzehnte‘,“ so sagte es Jannis Hagmann, der zu den „Zeltern“ in Frankfurt gehört. Ähnlich äußern sich aber auch die Aktivisten in Tunis und Kairo.
Sogar die unselige Folterung der Gutwilligen mit getexteten Reden – über Megaphon oder Mikrophon und Lautsprecher wird bald der Vergangenheit angehören: Beim Auftritt von Slavoj Zizek vor den New Yorker Aktivisten entwickelte man wegen des Lautsprecherverbots ein „Human Microphone“, dergestalt dass die ihm Nächststehenden jeden Satz im Chor wiederholten. Dabei entsteht nicht nur eine Art Gemeinde-Déja-vu, man kann auch jeden Schwätzer sofort zum Schweigen bringen, indem man selbst schweigt. Daneben legten die Aktivisten noch fünf oder sechs Handzeichen fest – u.a. mit der Bedeutung „lauter“, „wiederholen“ „aufhören“, „zustimmen“ etc..Diese Bewegung ist ein Angriff auf die repräsentative Demokratie und die Bevölkerungsstatistik. Während die Schulmediziner inzwischen zugeben – nicht zuletzt dank der Selbstorganisationen von Kranken: „Mit den randomisierten kontrollierten Studien finden wir nicht zwangsläufig das Richtige für unsere individuellen Patienten, wir mitteln damit nur ihre individuellen Differenzen“, sind die staatlichen Organe noch lange nicht bereit, sich einzugestehen, dass jedes Individuum, das ihre Fragebögen und Formulare ausfüllt oder Auskünfte gibt, sich entsetzlich verstellen (lügen) muß. Die Sprache der Allgemeinheit steht zunehmend in Widerspruch zu der des Einzelnen.

Hermann der Cherusker. Photo: focus.de
.Von der Hermann- zur Varus-Schlacht
Ein typisches Feuilletonthema! Nachdem das Kleistsche Drama „Herrmannsschlacht“ (1860 uraufgeführt) lange Zeit als bürgerliches Erbauungsstück mit patriotischem Unterton begriffen worden war – und dann schier vergessen wurde, kam es im Zusammenhang der antikolonialen Befreiungskämpfe in der Dritten Welt nach dem Krieg zu einer Umwertung seiner Werte: Der Germanist Wolf Kittler interpretierte es 1987 im Sinne von Carl Schmitt als ein Guerilla-Handbuch für Teutsche: „Der Krieg, der hier gemeint ist, spielt nicht mehr in der Phantasie, sondern in einer projektierten Wirklichkeit. Das Drama ist eine klare und eindeutige Aufforderung zur Aktion“. Quasi ein RAF-Text avant la RAF. Kittlers Kleiststudie hieß: „Die Geburt des Partisanen aus dem Geist der Poesie“.
Andere teutsche Dichter wechselten real zum Partisanenkampf: Theodor Körner und Ernst Moritz Arndt z.B. Nun, 2011 gibt es eine neue Interpretation der Kleistschen „Herrmannsschlacht“ – diesmal von einer Frau vorgelegt: von Barbara Vinken – der „glamourösesten Professorin Deutschlands“ (monopol). Sie liest laut Südddeutsche Zeitung das „Hassdrama als Anklage gegen den heillosen Krieg“. Diese feministisch-pazifistische Lesart, unterfüttert von „Hannah Arendts Totalitarismus-Buch“, inspiriert jetzt den antiterroristischen „Zeitgeist“ des Feuilletons, der sich laut Jean Baudrillard durch „weiche Ideologien“ auszeichnet – wie sie Frank Castorf z.B. täglich am Helmholtzplatz im Prenzlauer Berg zur materiellen Gewalt geworden entgegentritt: „Da siehst du nur noch Ich-AGs mit ihren kleinen Ich-Kindern, ihren Ich-Computern und ihrem Ich-Öko-Terror. Und wehe du kaufst nicht die richtige Apfelsine!“ Worum geht es bei diesen ganzen Interpretationen?
Um die Schlacht am Teutoburger Wald im Jahr 9 nach Christi, in der einige germanische Stämme unter der Führung von Hermann dem Cherusker drei Legionen des römischen Feldherren Varus partisanisch aufrieben. Die Schlacht jährte sich 2009 zum 2000. Mal. Die Nachkommen der Sieger von damals wollten das ganz groß feiern – unter der Schirmherrschaft von Angela Merkel. „Die Kanzlerin wagt sich damit auf sumpfiges Gelände, erklärte dazu Gustav Seibt in der Süddeutschen Zeitung vorab. Damit war nicht das einst moorige Schlachtfeld gemeint, dass sich im übrigen neuesten englischen Erkenntnissen zufolge gar nicht mehr dort befindet – bei Detmold in Westfalen, wo Kaiser Wilhelm I. ab 1838 das die „Freiheitskriege“ besiegelnde Hermannsdenkmal errichten ließ, sondern im niedersächsischen Kalkriese – bei Osnabrück, wo man 2001 ein Museum errichtete – auf den Resten der erschlagenen Römer sozusagen. Es war der wohl letzte große deutsche Museumsbau. Er bündelt nun die archäologische Erforschung der einzigen deutschen Freiheitsbewegung, die nachhaltig siegreich war – im Gegensatz zu allen nachfolgenden: Bauernkrieg, Befreiungskriege, 1848, 1918, 1953 und 1989. Und hält die Erinnerung daran wach – mit Kostüm- und Volksfesten aller Art. Desungeachtet wirbt der „Teutoburger Wald“ nach wie vor für sich als „Land des Herrmann“.
Die Schlacht bei Kalkriese, die endgültig die römische Besatzungsmacht vertrieb, ist nun nicht mehr nach dem Germanenführer Arminius (vulgo: Hermann) benannt, sondern nach dem von ihm einst besiegten römischen Heerführer Varus. Bis hin zur linksalternativen „tageszeitung“ hat sich inzwischen die politisch korrekte Meinung durchgesetzt, dass der einzige deutsche Sieg im Partisanenkrieg auf heimischem Territoritorium – „im sumpfigen Germanien“, wie Gustav Seibt schreibt, ein großer Fehler war: Uns entgingen dadurch nämlich mindestens 500 Jahre Zivilisation: Wenn Rom die Germanen ebenso wie zuvor die Gallier, die eher soldatisch als partisanisch kämpften, besiegt hätte, dann sähe hier jetzt alles noch viel kultivierter aus. Der Altertumsforscher Rudolf Borchardt sprach 1942 von einer „verfehlten Romanisierung der deutschen Nation“. Der amerikanische Herrmannschlacht-Fan und -Forscher Phil Hill meinte dagegen 2010: „Das mit den 500 Jahren Kulturausfall ist Unsinn. Nach dem platten Schema müssten die Schweden heute die schlimmsten Wüstlinge sein, und die Osteuropäer wären ein hoffnungsloser Fall. Es ist richtig, dass es im Falle einer Niederlage der Germanen 9 n.Chr. kein Deutschland und somit auch kein Auschwitz gegeben hätte, aber es hätte auch nichts anderes gegeben, was wir heute kennen…“
Über den gallischen Umweg haben die „Römer“ es unter Napoleon Anfang des 19. Jahrhunderts noch einmal mit den Deutschen versucht. Aber auch hierbei waren die an sich überlegenen französischen Truppen schließlich wieder „in den germanischen Sumpf“ – und in partisanischen Hinterhalt – geraten. Zwar gelang der deutsche Sieg diesmal nur dank des entschlossenen Widerstands der verbündeten Slawen (des russischen Heeres), aber die Ehre, dafür 1808 eine erste partisanische Kampfanleitung gedichtet zu haben, kommt Heinrich von Kleist zu. An einer Stelle heiße es in seinem Drama: „Das ist der klassische Morast/ Wo Varus steckengeblieben./ Hier schlug ihn der Cheruskerfürst./Der Hermann, der edle Recke;/ Die deutsche Nationalität,/Die siegte in diesem Drecke“.
Die antinapoleonischen Insurrgenten in Preußen hatten inzwischen Probleme mit einem solchen Kampf: Immer wieder ermahnte der damals ins Exil nach Moskau ausgewichene Freiherr vom Stein die meist unter der Führung von Offizieren gegen Napoleon antretenden deutschen Freikorps, keine schneidigen Attacken zu reiten und sich auch nicht soldatisch zu verschanzen, sondern nach überfallartigen Angriffen rasch den Rückzug – z.B. in die „Emsländischen Moore“ – anzutreten. Umsonst. Erst als die napoleonische Armee bei Moskau ins Leere gesiegt hatte, wendete sich das Blatt. Dennoch waren es schließlich doch die Kosaken, die Berlin von der Franzosenherrschaft befreiten, die Bürger jubelten ihnen bloß zu. Ähnlich reagierten dann die Berliner Arbeiter, als die Russen sie 1945 noch einmal befreiten.

Nasser Spatz. Photo: oldskoolman.de
Das Spatzenwunder
Schon Aphrodite, die Göttin der Liebe, Titanin in der Familie des Zeus, hatte es mit den Spatzen. In einem Liebesgedicht von Sappho, in dem sie Aphrodite anruft, heißt es: „Aus deines Vaters Haus kamst du auf goldenem Wagen angeschirrt, flink zogen dich die schönen Spatzen über schwarze Erde mit raschem Flügelschlag vom Himmel durch die Luft…“ Der Kulturwissenschaftler Friedrich Kittler erklärte dazu: „Die Spatzen ziehen deshalb den Wagen der Aphrodite, weil Spatzen so fruchtbar sind…Spatzen ruckeln und hecken die ganze Zeit, und deshalb sind sie ihre Tiere. Und daran ist nichts Schmähliches. Spatzen werden nicht von der Polizei gejagt.“
In Homers „Ilias“ wird berichtet, dass es in Aulis, bevor es in den Kampf gegen Troja geht, zu einem „Spatzenwunder“ kam. Der Zoologe Adolf Portmann hat es ausgedeutet – in seinem Nachwort: „Vom Spatzenwunder zum Wunderspatzen“ zu dem englischen Kinderbuch „Clarence der Wunderspatz“.
Neben der griechischen Verherrlichung des Spatzen als Göttervogel gibt es noch eine russische bzw. sowjetische – als „proletartischer Vogel“. Bei Andrej Platonow, der einen Band mit Erzählungen „Die Reise des Spatzen“ betitelte, heißt es in seinem Roman „Tschewengur“ aus den Jahren 1926-1929 : „Die Spatzen spektakelten auf den Höfen wie vertrautes Hausgeflügel, und wie schön die Schwalben auch sind, sie fliegen im Herbst in üppige Länder, die Spatzen aber bleiben hier, um Kälte und menschliche Not zu teilen. Das ist ein wahrhaft proletarischer Vogel, der sein bitteres Korn pickt. Auf der Erde können durch lange bedrückende Unbilden alle zarten Geschöpfe umkommen, aber solche unverwüstlichen Wesen wie Bauer und Spatz bleiben und halten aus bis zum warmen Tag. Kopjonkin lächelte dem Spatzen zu, der es in seinem mühseligen winzigen Leben vermocht hatte, ein großes Versprechen zu finden. Es war klar, daß ihn am kühlen Morgen kein Getreidekorn erwärmte, sondern ein den Menschen unbekannter Traum. Kopjonkin lebte auch nicht vom Brot und nicht vom Wohlergehen, sondern von unbewußter Hoffnung. ,So ist es besser,‘ sagte er, ohne den Blick von dem arbeitenden Spatzen zu lassen. ,Sieh an, so klein, aber wie zäh…Wenn der Mensch so wär, dann wär die ganze Welt längst erblüht.“ Nicht nur Kopjonkin, auch Tschepurny lobt die Spatzen: „Er ging zum Ziegelhaus, wo die zehn Genossen lagen, aber ihn empfingen vier Spatzen und flogen aus dem Vorurteil der Vorsicht auf den Zaun. ,Auf euch hab ich gehofft!‘ sagte Tschepurny zu den Spatzen. ,Ihr seid uns blutsverwandt, bloß Angst braucht ihr nicht mehr zu haben – die Bourgeoisie gibt’s nicht mehr, lebt bitte!'“ Und Dwanow freute sich, als er sah, dass ein „abgemagerter, Not leidender Spatz“ endlich Futter gefunden hatte – und „mit dem Schnabel im sättigenden Pferdekot arbeitete.“
Gibt es noch ein Land, wo man sich so viel Gedanken über die Spatzen gemacht hat? Schon bei Puschkin heißt es: „Ich sitze hinter Gittern / im feuchten Knast / unfrei geborener / junger Spatz …“ Iwan Turgenjew schrieb eine Geschichte mit dem Titel „Der Spatz“. In Fjodor Dostojewskis „Aufzeichnungen aus dem Kellerloch“ heißt es: „daß ich tatsächlich ohne irgendwelchen Nutzen nur die Spatzen schreckte…“ Der sowjetische Dichter Samuil Marschak, Begründer der „Pionierhäuser“, gab eine Kinderzeitschrift namens „Worobej“ – der Spatz – heraus und Maxim Gorki veröffentlichte eine Erzählung mit dem Titel „Der kleine Spatz“. Der Dichter Ossip Mandelstam beschrieb in einem Kinderbuch 1925 einige Spatzen, die vor dem geschlossenen Fenster sitzen, einige Leckereien auf dem Tisch sehen und klagen: „Leider nicht für uns das Fest!“ In Michail Bulgakows Roman „Der Meister und Margarita“ war das Fenster dagegen anscheinend offen, denn „hinter ihm ein Tschilpen…Es war ein garstiger Spatz…, Kusmin tanzte zu den Klängen eines Grammophons einen Foxtrott wie ein Betrunkener an der Theke. Währenddessen setzte sich das Spätzchen auf das Tintenfaß,…dann flog es mit Schwung gegen das Glas der Gruppenaufnahme,…zerschlug es mit seinem harten Schnabel und flog dann zum Fenster hinaus.“ Marina Swetajewa dichtete für Alexander Blok: „Dein Name ist der Spatz in meiner Hand“. „Der Spiegel“ bezeichnete hingegen DichterInnen wie sie als „Spatzen in Stalins Hand“.
Mit der Perestroika und der anschließenden Auflösung der Sowjetunion änderte sich auch die russische Spatzenverherrlichung: Tatja Tolstaja schreibt 1987 in ihrem ersten Erzählband „Sassen auf goldenen Stufen“: „Im schwülen Purpurdickicht des persischen Flieders reisst die Katze Spatzen.“ Der tote Spatz wird feierlich bestattet. „Das Leben ist ewig. Sterben tun nur die Vögel“. Und 1994 heißt es in dem Roman „Wettlauf.Lauf“ von Valeria Narbikova: Während „am Himmel die letzten Individuen fliegen – superexotische Spatzenvögel, weil alle übrigen Spatzen ausgestorben sind“, reisen Petja und Gleb durch ein zunehmend irrealeres Land. 2010 meldet der Russischübersetzer Leon Weissmann von den Sperlingsbergen bei Moskau (die bis 1999 Leninberge hießen): „Weit und breit keine Spatzen mehr zu sehen!“ Ähnliches hatte der Literaturwissenschaftler Dimitrij Lichatschow schon während der deutschen Blockade Leningrads 1942 erlebt: „Es gab in der Stadt keinen einzigen Hund mehr, keine einzige Katze, keine Tauben und keine Spatzen.“

Knieschmerzen. Photo: lifeline.de
Die Kniewipper
Wer kennt sie nicht, die jungen Männer, die in der U-Bahn, im Kino, in der Kneipe, kurz: überall, wo sie sitzen, mit dem Knie wippen. Zwar macht jeder Mann in seiner Jugend eine Kniewipp-Phase durch, aber nur jeder dritte bleibt dabei. Von denen wippen 64 Prozent mit dem rechten und 36 Prozent mit dem linken Knie. Bei diesen Männern mit chronisch gewordenem Kniewippen kommt ein großer Teil aus der Unterschicht beziehungsweise ist sozial abgestiegen oder hat sich dem Bodybuilding verschrieben. Nur 0,6% aller Frauen wippen mit dem KnieIm – und das auch nur in nervösen Situationen. Das Kniewippen der Männer ist jedoch heilbar – und als solches eine „Krankheit“, was natürlich ein riesiger Markt für die Pharmaindustrie ist.
Deswegen gibt es in den USA gleich drei Konzerne, die in den letzten Jahren Mittel gegen das Kniewippen entwickelt haben. Deren Marktdurchdringung wird nicht zuletzt über eine wachsende Zahl von Selbsthilfegruppen forciert. 2010 gründeten diese „knee nodder“, wie sie sich nennen, sogar einen nationalen Verband: Es geht darum, das Kniewippen offiziell als Leiden anerkannt zu bekommen. Rückendeckung liefert dem Verband dabei die Pharmaindustrie. Aber auch mehr und mehr Ärzte behandeln das früher von ihnen als „entwicklungsbedingte Macke“ abgetane „knee nodding“ inzwischen mit mehr Respekt. So kam es kürzlich auf einem Ärztekongress in Florida bereits zu einem ernsthaften wissenschaftlichen Disput über die tieferen Ursachen des Kniewippens: Während die einen psychologisch argumentierten – und von einem nervösen Zucken aufgrund sich stauender Sexualhormone sprachen, gingen andere von einem Gendefekt und wieder andere von einem Epigeneffekt aus. Wieder andere waren sich sicher, dass das chronische Kniewippen auf beginnenden Autismus bzw. Hospitalismus hinweise. Von den letzteren waren mehrere zuvor an der Herstellung eines Anti-Kniewipp-Medikaments namens „Kneeease“ beteiligt. Einig waren sich die Kontrahenten darin, dass dieses vermehrte „Fear of Falling“-Leiden, wie die US-Soziologin Barbara Ehrenreich es nennt, dank der aufklärerischen Tätigkeit der Selfhelp-Groups kein „tic“ mehr ist, den man schamhaft unter dem Tisch versteckt oder schmerzhaft unterdrückt. Auf Youtube gibt es einen 45-minütigen Film – unter dem Stammtisch einer zehnköpfigen Männerrunde aufgenommen -, der zeigt, dass und wie alle Anwesenden ununterbrochen mit den Knien wippen. Er heißt „the suburb knee nodder“ – die Kniewipper aus der Vorstadt.
Hierzulande gründete sich die erste Selbsthilfegruppe im Ruhrgebiet. In dieser von schweren sozialen Umbrüchen gekennzeichneten Region gibt es die meisten Kniewipper. Einige der alteingesessenen Ärzte dort behaupten, dass dies eine Spätfolge der sogenannten „Staublunge“ im Kohlenpott sei. Während lokale Sozialkulturforscher – unabhängig von dieser möglichen Ursache – davon ausgehen, dass das Kniewippen schon sehr lange im Ruhrgebiet verbreitet ist, nur sei es bis zum Niedergang der Montanindustrie niemandem aufgefallen, weil die jungen Männer ihr Bier meist im Stehen – an den „Trinkhallen“ – zu sich nahmen. Seitdem es diese Kioske, die oft vor den Fabrik- und Zechentoren standen, nicht mehr gibt, müssen sie in regulären Kneipen sitzen, wo das Kniewippen selbstverständlich auffällt.
Eine anderer deutscher Kniewippschwerpunkt ist Bremerhaven. Dort löste sich die Selbsthilfsgruppe jedoch gerade wieder auf. Ihr ehemaliger Leiter, Hans Schmollnick, führt das auf die „Unverträglichkeit der Charaktere“ zurück, die dort allwöchentlich in der Kneipe „Blauer Peter“ zusammenkamen: „Kniewippen allein genügt nicht!“ So sein Fazit. Obgleich er zugibt, dass ein fähiger „Therapeut“ vielleicht einiges hätte retten können. In Deutschland fehlt es zurzeit noch daran. Etwas schneller waren da die Sozialarbeiter, die sich schon vor zwei Jahren dafür einsetzten, dass man die Kniewipper nicht einfach ihrem Schicksal überlässt, sondern ihnen eine „qualifizierte Betreuung“ angedeihen lässt. Der Berliner Freie Träger „Pegasus“ hat dazu im Frühjahr 2011 bereits ein „Pilotprojekt“ gestartet. Der Geschäftsführer der Spandauer Einrichtung, Martin Rausche, sieht das Problem der Kniewipper, von denen seine Sozialarbeiter inzwischen 21 Fälle betreuen („Nur die Spitze des Eisbergs“), quasi existentialistisch: „Es geht dabei ums Weggehenwollen, während man irgendwo sitzt. Es ist eine simulierte Flucht, ein bedingter Abhau-Reflex, der in dem Moment chronisch wird, da das nicht gelingt – und man festsitzt. Seit der Globalisierung und den Mobilitätsanforderungen schafft so etwas ein ,unglückliches Bewusstsein‘ – das allerdings nicht länger therapieresistent ist, also der Bearbeitung durchaus zugänglich.“

Duke of Wellington mit Pilon. Photo: Peter Loyd Grosse
Reiseerinnerungen
„Der Moment, da man auf den Auslöser drückt, ist schon der Moment eines Verschwindens,“ schreibt der SZ-Rezensent des schwedischen Films „Verblendung“ über das „Hilfsmittel Photographie“ und die „poetische Kraft der Erinnerung“. Dunkle Worte. Er meint wahrscheinlich, das Knipsen/Ablichten einer Situation – mit und ohne Personen. Ich habe ungefähr 100.000 Urlaubsdias gesammelt, die nun langsam verblassen. Sie stammen zumeist von Ehepaaren aus den Jahren 1956 bis 1987. Ich kaufte sie günstig auf West- und Ostberliner Trödelmärkten. Niemand sammelt Dias. Sie sind das letzte, was von diesen Ehepaaren übrig geblieben ist. Er knipste, sie posierte – meistens vor einer Sehenswürdigkeit. Wobei sie sich gerne bemüht lässig an ein Geländer lehnte. Und er sich ordentlich Zeit für die Aufnahme nahm. Man photographierte damals noch oft mit Stativ und Diafilme waren teuer. Deswegen sparte man sie sich für „die kostbarste Zeit des Jahres“ auf. Wenn die Sonne lacht – Blende acht! Der Moment, da die Ehefrau für den (anscheinend notwendigen) Vordergrund sorgte, indem sie sich ins Bild stellte bzw. gestellt wurde, der ist nach dem Ablichten natürlich, möchte man sagen, sofort verschwunden. Denn ihre Befindlichkeit und wie sie diese zum Ausdruck brachte oder umgekehrt: wie diese sie zum Ausdruck brachte – der ist sozusagen einmalig. Man steigt nicht zwei Mal in das selbe Gefühl!
Aber etwas bleibt: die Sehenswürdigkeit im Hintergrund. Sei es eine Burg, die das schon seit dem Mittelalter stand, oder ein Wasserfall, der auch schon ewig so plätscherte und schäumte. Ihre Bedeutungen haben sich allerdings immer wieder gewandelt: Die Ehefrauen der deutschen Männer bis zu dem noch siegreichen Vormarsch der Wehrmacht posierten in dieser Zeit bestimmt strammer hinter den Zinnen der Burgruine – mit Blick über das weite Land, als die junge Gattin des Kriegsheimkehrers, bei der die Anstrengungen der US-Reeducation (Umschulung) bereits sichtbare Erfolge in „Coolness“ – damals sprach man von „lässig“ – zeitigten. Oder jedenfalls taten sie so. Heute würde die Frau wahrscheinlich diese „Haltung“ zitieren. Und aus der malerischen Burg ist inzwischen ein Youth-Hostel geworden. Mindestens findet dort ein „Mittelalter-Fest“ oder ein „Oper-Air-Festival“ statt. Dabei kommt es aber in besagtem Moment zu einer Verschiebung: Da beide inzwischen knipsen, bitten sie einen als Ritter oder Troubador verkleideten Arbeitslosen, der im Sommer auf der Burg eine MAE-Stelle (einen 1-Eurojob) hat, sich vor die Zinnen zu stellen. Er wird quasi dafür bezahlt, dass er für die photographierenden Urlauber den Vordergrund abgibt.
Und dann weiß man inzwischen auch, dass die alte Burg mindestens zum Teil neu hochgemauert wurde – gleich nach der Wende schon. Und dass die neuen wie die alten („authentischen“) Steine sich in jedem Moment ihrer Existenz verändern: Ihre Moleküle ziehen sich zusammen oder dehnen sich aus, im Inneren finden chemische Prozesse statt, die Oberflächen werden ständig durch Wind und Wetter abgetragen – in mikroskopischen Mengen. Die Spur der Steine zieht sich bis ins Archaikum. Kurzum: Auch sie unterliegen im Moment des Knipsens dem Verschwinden. Im sichtbaren Bereich allerdings sehr viel langsamer als die Ehefrau im Vordergrund. Wenn sie nach ein paar Jahren noch einmal auf der Burg posierte, was den Dias gelegentlich zu entnehmen ist, dann sieht sie bereits merklich älter aus. So ein knipsendes Ehepaar hinterläßt in der Regel zwischen 5 und 10.000 Dias. Nicht wenige haben jedes Jahr im selben Ort Urlaub gemacht. Mit zunehendem Alter mehren sich Photos von ihren Lieblingsbänken, auf denen sie Rast machten, und z.B. sinnend über das Tal blickten oder einen Imbiß zu sich nahmen. Auch scheinen die Tourismusverantwortlichen immer mehr Bänke in den neuerdings „Gebietskulisse“ genannten Urlaubsregionen aufzustellen. Sogar in der Wüste Gobi stehen schon welche.
Als ich dort einmal mit einer Journalistengruppe auftauchte, knipsten meine Kollegen alles, was ihnen vor die Kamera kam – mit und ohne Einheimische im Vordergrund. Sie kuckten gar nicht mehr richtig hin. Das taten sie erst zu Hause – am Labtop. Ich war heilfroh, nicht in diese Falle getappt zu sein – weil ich weder einen Photoapparat noch ein Handy dabei hatte. Aber dann zeigte mir der Kollege vom Tagesspiegel einen schönen Stein, den er gerade gefunden hatte. Und der wurde dann prompt zu meiner Falle, denn fortan kuckte ich nur noch auf den Boden – auf der Suche nach seltenen Steinen. Am Ende schleppte ich einen halben Zentner mit nach Hause. Von dort brachte ich sie dann zwecks näherer Bestimmung ins Naturkundemuseum. Der diensthabende Geologe holte jedoch derart weit aus – in erdgeschichtlicher und petrologischer Hinsicht, dass ich passen mußte – und mir erst Mal ein Geologie-Lehrbuch kaufte, das er mir empfohlen hatte. Den Sack mit meinen Steinen ließ ich bei ihm – unter einem seiner Schränke mit Steinproben aus der ganzen Welt. Über das immer wieder unterbrochene Studium des Geologie-Lehrbuchs vergaß ich die Steine aus der Gobi völlig. Immerhin schrieb ich aber einen Aufsatz über die Steinmauern auf der kroatischen Insel Losinj, der dann auch einen Abnehmer fand. Überhaupt schärfte sich mein Sinn für Steine enorm. So weit wie Theodor Lessing ging ich dabei jedoch nicht. Er war der Meinung, von ihnen, den Steinen, „ist zu erfahren, was ich auf Euren Märkten verlernte: Leben.“ Im Gegenteil: Je mehr ich mich mit Steinen beschäftigte, desto mehr vermißte ich genau das: Leben.
Kürzlich nahm ich an einer weiteren Journalistenreise teil, die uns durch drei Wojwodschaften von Westpolen führte. In deren Hauptstädten Stettin, Jielena Gora und Poznan bekamen wir Stadtführungen und unterwegs im Bus hatten wir ebenfalls eine kundige Polen-Führerin. Wieder knipsten die Kollegen alles was sie sahen bzw. was man uns zeigte. Und das waren ebenfalls meistens Steine – in Form von Herrensitzen, Rathäusern, Marienkirchen und Zisterzienserklöstern, Hotenneubauten, Universitäten, Messehallen, der größten Brauerei der Welt, riesigen Denkmälern für die von den Kommunisten seit 1956 niedergeschlagenen Arbeiteraufstände, sowie eines pompösen Schlosses, das Kaiser Wilhelm sich in Posen gönnte und Albert Speer dann nach den Wünschen von Adolf Hitler innen umgestaltet hatte. Auch das erst drei Jahre alte Sheraton-Hotel in Poznan wurde bereits umgebaut: Sein Restaurant ist jetzt eine Sportbar, in der es mexikanisches Essen gibt. Wir sahen und knipsten ferner viele Stadthäuser und Landsitze, die man innen und außen renoviert hat in den letzten Jahren. Die Polen sind berühmt dafür, dass sie das sehr schön machen. Nachdem die Deutschen zuletzt etliche Städte fast vollständig zerstört hatten, bestanden die dortigen Politiker darauf, dass trotz dringenden Wohnungsbedarfs erst einmal die Stadtkerne „originalgetreu“ wiederaufgebaut wurden. Dabei hat sich unter den polnischen Restauratoren seit den Achtzigerjahren die „Mode“ durchgesetzt, kleine Teile der übrig gebliebenen Bausubstanz zu entbergen – als eine Art Authentizitäts-Zitat, das nun innerhalb und außerhalb der Gebäude an den überraschendsten Stelle auftaucht, nicht selten hinter Glas. In den guterhaltenen Kirchen und Klöstern geschieht das selbe nur umgekehrt – zum Teil mit EU- und Unesco-Mitteln: Hier werden ursprüngliche Mauer- bzw. Farbschichten behutsam freigelegt. Die daran beteiligten Studenten der Hochschule für Restauration in Thorn lassen sich ordentlich Zeit – und auch durch heftigstes Blitzlichgewitter nicht stören. Ich hatte wieder keine Kamera und kein Handy dabei. Wenn meine Kollegen mal das Pech hatten, dass die wechselnde Wetterlage es verhinderte, von diesem oder jenem steinernen Objekt ein „ansprechendes Bild“ zu machen, tröstete unsere Reiseführerin sie: „Das könnt ihr euch zur Not auch im Netz runterladen. Oder ihr sagt mir, was ihr braucht und ich brenn euch das auf CD.“
Zwar würden sie nur jeweils ein, höchstens zwei Photos für ihren Reisebericht verwenden können (das galt auch für den mitgereisten Radiojournalisten, der neuerdings neben O-Tönen noch Bildmaterial für die Internet-Präsentation seines Senders mitproduzieren muß), aber ich verstand: Wenn man sich solch eine Reise zu Hause noch einmal vergegenwärtigen will oder muß, dann erleichtert eine nahezu lückenlose Dokumentation die Arbeit. Wie oft ist es mir schon passiert, dass meine frischen Reiseeindrücke schon nach ein paar Tagen vom Alltag wieder verschüttet waren. Da wäre eine Photostrecke wahrscheinlich hilfreich gewesen. In Ermangelung dessen und weil dann auch meine schriftlichen Notizen sich oft als nur allzu mangelhaft bzw. kryptisch erwiesen, ließ ich das „Thema“ dann schlußendlich ganz fallen bzw. vergaß es einfach. So wie die Steine aus der Gobi.
Dabei ist es nicht so, dass ich nie eine Kamera dabei habe. Wenn meine Freundin und ich z.B. in die Rhön fahren, habe ich immer eine dabei und sie mindestens ihr Handy mit Kamerafunktion. Aber wir knipsen damit meist nur Pilone (s.O.), Poller oder andere Absonderlichkeiten in der Region, zwischen Fulda, Würzburg und Meiningen gelegen. Besonders die frischrenovierte „Theaterstadt“ Meiningen ist in Hinsicht auf Poller, d.h. Straßenbegrenzungspfähle, sehr ergiebig. Beim letzten Mal entdeckten wir in unserem Hotel dort ein Ölbild im Frühstückszimmer, dass das Haus eines romantischen Dichters aus dem 18.Jahrhundert zeigte – mit einem Poller davor. Dieser sollte damals allerdings weniger das Parken verhindern als vielmehr die Passanten vor einem durchgehenden Kutschpferd schützen. Wir machten uns auf die Such nach dem Haus der Dichters. Es stand noch, allerdings hatte es kein Fachwerk mehr, sondern war inzwischen modernisiert, d.h. neu verputzt und gelb gestrichen worden. Außerdem hatte man das Dach ausgebaut und verglast. Und obendrauf einen Dachgarten gesetzt mit immergrünen Sträuchern. Der Poller stand auch noch da, bei näherem Hinsehen erwies er sich jedoch als ein neuer – von der Frankfurter Firma Wellmann industriell hergestellt. Der Poller auf dem Ölbild war noch ein quasi handgeschnitzter gewesen – ein Unikat. Wir machten trotzdem ein Photo davon, nachdem wir schon das Ölgemälde aufgenommen hatten. Es war übrigens nicht so, dass ich nicht auch gerne ein paar markante Poller in Westpolen geknipst hätte, aber ich war mir schon vorab sicher gewesen, dass dies von den polnischen Stadt und Tourführerinnen als unhöflich begriffen worden wäre. Sie gaben sich so viel Mühe, uns die beeindruckendsten Gebäude zu zeigen – und ich zeigte nur ein Interesse an den Poller davor. Auch meine unentwegt knipsenden Kollegen, manche mit Teleobjektiv ausgerüstet, hätten wohl mein Photographierverhalten als reichlich verschroben empfunden – oder jedenfalls nicht sonderlich weltläufig. Was man von einem Reisejournalisten aber doch erwartet. Jede dieser Journalistenbranchen hat ja ihre eigene Distinktionskultur.

Poller mit Hut. Photo: Peter Loyd Grosse
Elektronische Poller und Informationen
Beim ersten Golfkrieg wurden vor der neuen englischen Botschaft in Berlin neben dem Adlon-Hotel dicke schwere Steinpoller installiert, die die Wilhelmstraße halbseitig sperrten – um islamistische Autobomben-Attentäter abzuhalten. Beim zweiten Golfkrieg wurden diese ersetzt durch elektronisch versenkbare Stahlpoller, die vor und hinter der Botschaft die ganze Wilhelmstraße absperrten und daraus eine Sackgasse machten. Nun geht der anti-islamistische Krieg der westlichen Industriestaaten bereits ins Soundsovielte Jahr. Inzwischen hat sich eine Gewerbetreibenden-Initiative (GI) rund um die englische Botschaft gebildet, die zusammen mit dem CDU-Kulturpolitiker Uwe Lehmann-Brauns für eine Entpollerung der Wilhelmstraße kämpft – bis jetzt allerdings vergeblich: „Denn die weltpolitische Sicherheitslage hat sich nicht gebessert,“ heißt es zu jeder ihrer dringenden Anfragen aus der Senats- Innenverwaltung lapidar Nun bekommt die GI Schützenhilfe von einer Gruppe „US-Wissenschaftler“. Sie hat errechnet, dass die inzwischen innenbeleuchteten Stahlpoller vor der englischen Botschaft nicht mehr hydraulisch versenkt werden können, wenn die „weltpolitische Sicherheitslage“ sich bis 2015 nicht wesentlich geändert hat: Sie sind dann nämlich festgerostet und müßten mühsam herausgesprengt werden.
Der thüringische Schriftsteller Landolf Scherzer gibt sich neuerdings gerne peripatetisch, d.h. er schreibt nur über das, was er zu Fuß erreicht. Kürzlich veröffentlichte er seine Wandererlebnisse im Banat – durch Ungarn, Kroatien, Serbien und Rumänien. Als er an einem Feldweg entlanggeht, überholt ihn „ein Zigeuner einspännig“. Scherzer berichtet: „Für 20 Lei will er mich auf sein Wägelchen steigen lassen. ‚Nein,‘ sage ich und frage ihn, ob ich auf dem richtigen Feldweg zur Hauptstraße nach Timisoara bin. Er nickt. ‚Immer der Sonne in die Augen schauen‘. Und verlangt 5 Lei. Ich protestiere. Er sagt, dass heutzutage auch Informationen Geld kosten. Wir einigen uns auf ein Butterbrot, dass Maria mir am Morgen mitgegeben hat.“
Trotz modernster Informationsgesellschaft läuft es doch immer auf das selbe hinaus: Gastfreundschaft gegen Gespräch/Geschichte. Naturalwirtschaftlicher Austausch auf sozialer Basis. Als ich bei diversen Bauern in Westdeutschland als „landwirtschaftlicher Betriebshelfer“ arbeitete, merkte ich irgendwann, dass sie fast mehr als an meiner Arbeitskraft daran interessiert waren, zu hören, was ich ihnen über die Wirtschaftsweise der anderen Bauern erzählen konnte, bei denen ich vorher gearbeitet hatte. Auch das Pferd, mit dem ich unterwegs war und das mein Gepäck trug, war den Bauern mehr wert als meine Arbeitskraft: Gerne boten sie dafür Hafer, Stall und Weide an. Bei den modernen aber nostalgisch gestimmten Bauern erwies sich meine Hannoveranerstute als ein wahrhaft trojanisches Pferd: Überall fand ich Unterkunft und Arbeit.
Landolf Scherzer hatte es da als berucksackter Wandersmann schwerer, auch vom Gepäck her. Aber er ging auch „Zu Fuß durch Europas Osten“, wie es im Untertitel seines Banat-Reiseberichts „Immer geradeaus“ heißt. Während ich durch den Westen ging, dort kam allerdings erschwerend hinzu, dass ich im „Deutschen Herbst“ losgegangen war – und das ganze Land damals gerade paranoisch gemacht wurde. Manche Ehefrau eines Bauern hörte sich erst mal am Telefon in Wiesbaden die Stimmen der Terroristen an, bevor sie mir halbwegs entspannt gegenübertrat. Mit dem Pferd war ich im übrigen auch bei den vielen Polizeikontrollen damals fein raus. Mir wäre jedoch nie eingefallen, dass das alles mal in einer „Informationsgesellschaft“ enden würde, wie sie Landolf Scherzer sich erwandert. In seinem vorletzten Buch ging es um die Rhön zu beiden Seiten der ehemaligen DDR.Grenze zwischen Thüringen, Bayern und Hessen. Diese Wanderung auf dem ehemaligen Kolonnenweg mit Abstechern in die Dörfer links und rechts davon, teilte er sich in Abschnitte und für jeden verabredete er vorab telefonisch (per Handy?) einige Gesprächstermine mit dort lebenden Leuten, wobei er sich natürlich auch den zufälligen Begegnungen nicht verschloß, denn er war ja als Geschichtensammler unterwegs und nicht auf der Suche nach Arbeit. Es ging ihm um die „Befindlichkeiten“ der Bewohner zu beiden Seiten der Grenze und nicht darum, die „alte Kunst des Wanderns“ ökologisch inspiriert wieder zu beleben, wie es – etwa zur gleichen Zeit – sein Westkollege Ulrich Grobe ebenfalls in der Rhön uns vorexerzieren wollte.
Während dieser z.B. am „Point Alpha“, dem einst markantesten Beobachtungsposten der Amerikaner in der Rhön, die Aussicht beschreibt, erzählt Landolf Scherzer seine dortige Begegnung mit einer Ausflugsgruppe, die hauptsächlich aus Frauen bestand: „eine Fitneßgruppe aus Gönnern. Ich frage, wo Gönnern liegt. Bei Marburg, ob ich Timo Boll nicht kennen würde, den Tischtennisweltmeister. Sie sind beleidigt, dass ich nichts von Timo Boll und Gönnern weiß, und eine der Frauen sagt, dass es noch lange dauern wird mit der Einheit, wenn die Ostdeutschen noch nicht einmal Timo Boll kennen“.

Das Leben ist keine Demo! Photo: abendblatt.de
Der Kairo-Virus
Der KV ist durchaus noch virulent, aber die Nachrichten darüber stimmen einen nicht unbedingt fröhlich: Im Jemen und in Syrien gab es heute wieder viele tote Demonstranten, in Tunesien, Ägypten und Libyen drängen die rückwärtsgewandten Religiösen an die Macht, in der Türkei hat der Krieg gegen die Kurden wieder zugenommen, in Israel, im Iran und in Palästina haben die herrschenden Bellizisten Oberwasser.
Auch der Sub-KV „Occupy“ im Westen ist noch aktiv: in Berlin z.B. zogen heute etwa 100 Demonstranten vor die Brandenburger Torheit und warfen dort mit Konfetti. Das ist nichts Großartiges. Dafür hat sich die Süddeutsche Zeitung nicht lumpen lassen – und vier KVler und „Occupy“er in die Redaktion einfliegen lassen, wo sie die vier Jungs und Mädels für das SZ-Magazin interviewten. Einer, aus Syrien, blieb anschließend gleich da – in München, und beantragte politisches Asyl.
1. Aufruf:
„„Banken in die Schranken!“ – unter diesem Motto ruft ein breites Bündnis dazu auf, am 12. November das Frankfurter Bankenzentrum und das Berliner Regierungsviertel mit Menschenketten zu umzingeln. Initiatoren der beiden Großaktionen sind Attac, das Kampagnennetzwerk Campact und die Naturfreunde Deutschlands. Mit dabei sind bisher außerdem die Katholische Arbeitnehmerbewegung, das Inkota-Netzwerk, Terres des Hommes Deutschland, die Grüne Jugend und die Linksjugend Solid sowie der DGB Region Frankfurt-Rhein-Main…“
2. Aufruf: Transnationales Treffen in Tunesien
„Verschiedene Gruppen aus Europa und Tunesien veranstalten ein dreitägiges transnationales Treffen Ende September in Tunesien. Themenblöcke werden sein: „Für Bewegungsfreiheit : Migrationen“, „Jenseits der politischen Ökonomie von Prekarität, Verschuldung und Arbeitslosigkeit“, „Wissen und Kultur“ sowie „Neue Formen von Organisation und kollektiver Intelligenz“. Dabei wird es u.a. um Prekarität, den Aufbau autonomer Netze und Medien, globale Bewegungsfreiheit, soziale Wissenschaft und soziale Medizin, Möglichkeiten des aufständischen Urbanismus und Selbstorganisierung gehen. In Tunis, Sousse, Sidi Bouzid (dort wo die Revolution begann) und in Hammam Lif sollen sich bei den verschiedenen Workshops Aktivist_innen von beiderseits des Mittelmeeres über die Perspektiven der Revolution austauschen…“

Occupy Kairo! Photo: independent.ie
P.S.: Die ersten novembrigen Realzynismen sind da:
Die Korrespondentin der Jungen Welt in Damaskus hält weiterhin dem Assad-Regime die Stange. Heute (15.11.) titelt sie: „Syrien erneuert seine Einladung an die Arabische Liga“ Was ist das für eine Realitätswahrnehmung – eine blöde propagandistische Regierungsmeldung aus Syrien uns zu melden?!
AFP berichtet: „Arabische Liga berät in Marokko über vorläufigen Ausschluss Syriens“
Dpa meldet aus Syrien: „Jetzt wendet sich das Blatt. Die Opposition kommt politisch voran…“
Gemeint ist damit: „Deserteure schließen sich zu Guerillatrupps zusammen….Deserteure und Soldaten lieferten sich am Dienstag heftige Gefechte in den Provinzen Deraa und Idlib. Insgesamt sollen bei Zusammenstößen zwischen Regimetruppen und Anhängern der Protestbewegung innerhalb von 24 Stunden mehr als 70 Menschen und seit Sonntag sogar 100 Menschen getötet worden sein….In der Nähe der Ortschaft Chirbat Ghazale sei es zu einem Gefecht zwischen Angehörigen der Armee und der Sicherheitskräfte auf der einen und Deserteuren auf der anderen Seite gekommen. Dabei seien mindestens 34 Soldaten und Angehörige der Sicherheitskräfte sowie 12 Deserteure ums Leben gekommen, meldete die Organisation Syrischer Menschenrechtsbeobachter.
Die Oppositionsbewegung „Erklärung von Damaskus“ veröffentlichte einen Aufruf an die „schweigenden“ Gegner des Regimes. Diese sollen sich den „Revolutionären“ anschließen.
In der Erklärung hieß es weiter – mit geradezu zwingender Logik: „Denn dann erst schlägt für das Regime die Stunde der Wahrheit. Dann ist auch Schluss mit den Illusionen über den angeblich so großen Rückhalt, den (das Regime) noch in der Bevölkerung hat und dann wird die Rechnung, die von den Syrern mit ihrem Blut bezahlt werden muss, auch weniger hoch ausfallen.“
Aus dem Jemen meldet unterdes AP lapidar: „Mehr als 20 Tote bei Kämpfen im Jemen am Wochenende…“
Aus Berlin und Ägypten (eine Front?) berichtet dpa:
1. „Der Kairoer Verleger Mohamed Hashem bekommt morgen den angesehenen Hermann-Kesten-Preis der Schriftstellervereinigung PEN-Zentrum verliehen.
Schon vorab meinte er gegenüber dpa: Die demokratische Öffnung in der islamischen Welt wird Ägypten die Demokratie bringen – trotz vieler Widerstände. „Aber am Ende wird die Freiheit siegen“, sagte der 53-Jährige. „Ich glaube fest daran, auch wenn wir noch etwas Zeit brauchen könnten, dass es einmal eine Demokratie in Ägypten gibt. Die Demokratie hat einen Preis – und wir bezahlen diesen Preis gern. Natürlich soll das alles unter dem Motto einer friedlichen Revolution geschehen.“
2. Zwei Wochen vor der ersten Parlamentswahl in Ägypten nach der Ära von Husni Mubarak sorgt ein Sex-Skandal für Aufregung. Die Website des arabischen Nachrichtensenders Al-Arabija meldete am Dienstag, eine Aktivistin der revolutionären Jugendbewegung 6. April namens Alia al-Mahdi habe auf ihrem Blog Fotos veröffentlicht, auf denen sie nackt zu sehen sei. Das Medienbüro der Jugendbewegung, die im vergangenen Februar mit ihren Demonstrationsaufrufen zur Entmachtung von Präsident Mubarak beigetragen hatte, erklärte, die junge Frau habe der Bewegung nie angehört. Man müsse sich fragen, was Ziel der schon seit einiger Zeit andauernden Kampagne einiger Medien gegen den 6. April sei.
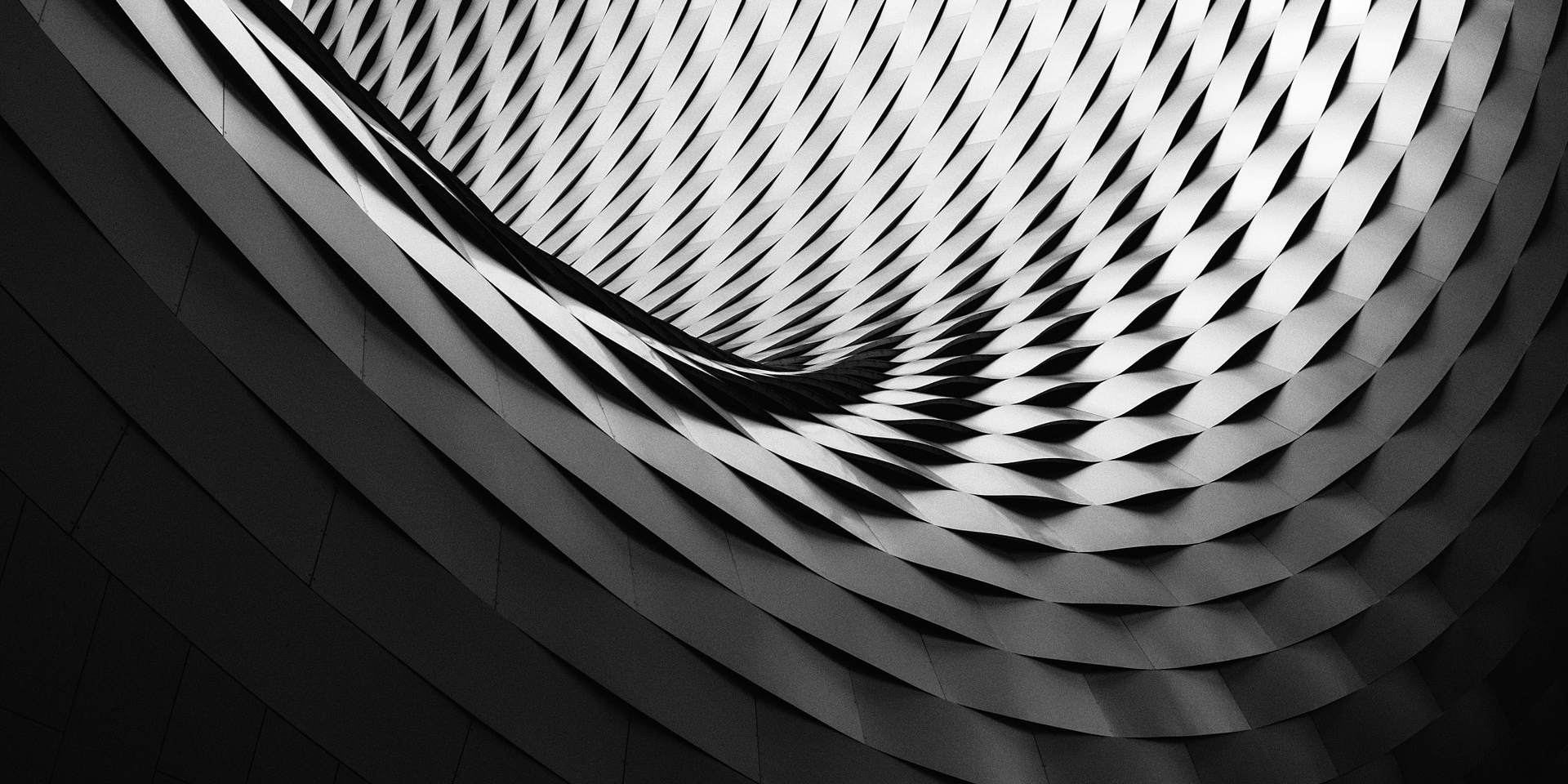



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx