Alles muß raus! Traders of the universe
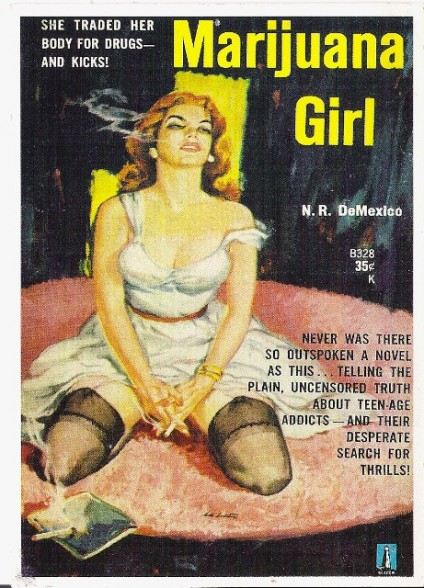
“Dein Körper gehört dir, nicht wie ein geistiges oder historisches Eigentum, sondern wie ein Auto oder ein Bankkonto. Er gehört dir wie Waren im Kreislauf, du kannst ihn verkaufen, vermieten, drauf sitzenbleiben, ihm Mehrwert abtrotzen oder ihn verspekulieren. Je neosexueller du bist, desto weniger kannst du Heimat in ihm haben, aber desto mehr Profit kannst du ihm entnehmen.” (Georg Seeßlen)
Anläßlich des Todes von Käthe B., er starb kürzlich an einem Gehirntumor, stellte Ernst Volland anstatt eines Nachrufs ein Dutzend Selbstkunstwerke des Westberliner Performators Käthe B. in seinen taz-blog (siehe dort).
In „Die Zeit“ hatte ich am 18.8.1995 eine Art Vorruf auf Käthe B. veröffentlicht:
Von Beruf: Medienhengst
Käthe B. aus Eckernförde, etwa 33 Jahre alt, gibt an, Melker gelernt zu haben. 1981 kam er nach Berlin. Käthe B., der richtige Name ist den Redaktionen unbekannt, hatte zwar zuvor seinen Wehrdienst absolviert, gehörte aber noch zu jenen jungen Pazifisten, die in der Schule im Rechnen eine Fünf, aber im Malen immer eine Eins hatten und in West-Berlin deswegen irgendwie kreativ tätig werden wollten. Anders als die meisten, die erst mal ein Atelier anmieteten, das sie mit Ölfarbengeruch und einer Staffelei füllten, interessierte sich Käthe B. nicht für die Kunst an sich, sondern mehr für das, was sie an öffentlicher Aufmerksamkeit auf sich zieht. Ein Erkenntnisinteresse, wie es schon beim frühen Donald Duck ausgeprägt war, geht es doch in vielen von Donalds Geschichten ausschließlich darum, wie er ohne den Umweg über Arbeit, Leistung und so weiter berühmt werden will. Käthe B. ist das gelungen. Er ist, sagt er von sich, ein „Medienhengst“, Medienhengst von Beruf. Auch als er sich 1990 an den Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus beteiligte („Die gute Wahl – Käthe B.“), war der Einstieg in eine politische Karriere für ihn nur ein „Sprungbrett, um in die Talk-Shows zu kommen“. Das Anfertigen und Kleben des Wahlplakats hat ihn viel Geld und Zeit gekostet. Überhaupt hat er es sich nie leichtgemacht. So flog er zum Beispiel regelmäßig nach New York. „Das Tolle ist ja, wenn man sagt, daß man da gewesen ist, da reden die Leute gleich ganz anders mit einem“, hat Käthe B. Ende 1990 in einem Seminar anläßlich der Ausstellung „Käthe B. und die Photographie“ in der Galerie von Ernst Volland „Voller Ernst“ festgestellt.
In New York bekam er auch seine erste Hauptrolle – in einem Film von Miron Zownir. „Das war Zufall“, sagt Käthe B. Ein anderer Schauspieler sei krank geworden. „Ich war in dem Film ein Drogendealer, hinter dem zwei Mafiosi her sind. In der Schlüsselszene schlug mir Zownir ein Telephonbuch über den Kopf, und ich mußte daraufhin gegen eine Heizung fallen, und so dann daliegend hat er mich von hinten gevögelt. In dem Moment wußte ich, worum es ging in dem Film und warum der andere Darsteller krank geworden war. Meine Mutter hatte mich immer schon davor gewarnt, nach New York zu gehen und solche Filme zu machen. Aber ich habe mir gedacht: Alle haben so angefangen. Rambo hat früher auch immer solche Sexfilme gedreht. Und was ist das heute für ein Star.“ In der erwähnten Ausstellung bekannter Berliner Photographen ging es ausschließlich um Käthe B., der gern mit aufgeklebten Gegenständen wie Kerzen, Glühbirnensockel, Tannenbaum oder Plastikaraber auf dem Glatzkopf posiert. Viele seiner Portraits werden mittlerweile in den hauptstädtischen Touristentreffs als Ansichtskarten verkauft. Einige wurden auch zu Werbeanzeigen weiterentwickelt: Berühmt wurde seine Spargel-Werbung für die Lebensmittelkette Bolle, auf der er das Spargelbund wie Dynamitstangen in der Hand hielt.
Käthe B. geht davon aus, daß es auf eine gewisse Balance zwischen Verausgabung und Einnahmen ankommt: „Wenn ich finanziell am Ende wäre, würde ich Schluß machen. Nie könnte ich so leben wie Anita Ekberg“, gestand er einmal dem Satiremagazin Kowalski. Einkünfte brachte ihm zum Beispiel eine Ausstellung von Röntgenbildern im Oranienstraßen-Studio „Endart“ ein: „Gleich am Anfang kam da so ’n Galerist an und hat gefragt, ob ich schon was verkauft hätte. Drei bis vier Teile, habe ich einfach so dahingesagt, und – zack – hat er sich sofort auch eins gekauft.“ Neben Kain Karawahn, in dessen Volksbühnenstück „Videoprozeß“ Käthe B. 1993 einen Richter spielte, der eine Kamera wegen Betruges zu verurteilen hatte, gehört der Kneipen- und Diskothekenbesitzer Dimitri zu seinen engsten Freunden und Förderern. In dessen Kreuzberger „Fischbüro“, wo es um die Vermischung von Alltagsforschung und forschem Alltag ging, stellte sich Käthe B. Ende der Achtziger immer wieder gerne an das der Kneipe zentrale Rednerpult, um den Gästen aus seinem Adreßbuch vorzulesen. Dabei erklärte er, welcher Name darin aus welchem Grund eingetragen war. Später wurde daraus ein regelrechter Discjockey-Job in Dimitris Schöneberger „Fischlabor“, wo Käthe B. allnächtens Filmmusiken auflegte.
Rückblickend sieht Käthe B. dieses Bargeschäft jedoch kritisch: „Die Grundidee dabei war, viele Superstars, wie Robert de Niro oder Jörg Immendorf etwa, haben am Ende ihrer Karriere eine Kneipe eröffnet, also dachte ich mir: Das machst du gleich am Anfang, dann hast du es hinter dir. Aber drei Jahre war zu lang, nur wegen des Geldes bin ich dabeigeblieben.“ Danach ein kurzes Selbstinterview als Videofilm: „To B. or not to B.“ sowie eine Einladung zu einer zehntägigen Albanienreise, wo er dann unter dem Schutz bewaffneter Bodyguards badete: „Das war mal was ganz anderes!“ Talk-Show-Auftritte und öffentliche Meinungsäußerungen (über den Golfkrieg etwa) waren ihm da schon zur Routine geworden, sogar als Sänger trat er einmal auf, und von global players wie Genscher und Daimler-Benz inspiriert, gründete er spontan die „Käthe B. Production“: „Irgendwie bin ich in so ’n Mediensog reingekommen. Da hab‘ ich echt gemerkt, daß ich dadurch ’n bißchen arrogant geworden bin. Aber nur ganz kurz – paar Minuten, schätz‘ ich.“ Später präzisierte er: „In zwei Wochen sechzig Interviews, und du bist anders als alle anderen.“
Seit 1986 gibt es den Käthe B. Fan-Club (KBFC), aus dem man nicht austreten kann („In Käthe We Trust“). Dafür werden alle paar Jahre die Ausweise neu ausgegeben. Highlights des Clublebens waren bisher die öffentlichkeitswirksam feininszenierten Auftritte von Käthe B. in verschiedenen europäischen und New Yorker Großfußgängerzonen, wo er jedesmal seinen Kahlkopf in eine frischzementierte Gehwegplatte drückte. Zu den berühmtesten KBFC-Mitgliedern zählen Paul Simon und Madonna, die sich mit Käthe B. auch photographieren ließen: „Eigentlich wollte die Photographin in New York nur Madonna knipsen. Aber ich habe inzwischen schon so ein Gehör, daß ich in dem Moment, wo die Photographen auslösen, und ich bin ganz woanders, da höre ich das, und dann – sssst – bin ich ganz schnell im Bild, zeichentrickmäßig. Das sieht man ja auf dem Bild: Ich stand eigentlich nur im Weg.“
Mittlerweile ist es eher umgekehrt – seine Fans langweilen ihn: „Die Ironie geht verloren, wenn da Leute ernsthaft eintreten. Ich überlege mir schon, ob ich den ganzen Club inklusive aller Mitglieder nicht an einen abgehalfterten Schlagersänger oder Discjockey verkaufen soll.“ In einer seiner Ausstellungen bot er bereits ein „Personality-Set“ (für 49,95 Mark) an, bestehend aus einer Filmglatze, Visitenkarten, Ausweis et cetera: „Die perfekte Ausstattung für Doppelgänger.“ Hinzu kommen müßten noch seine schwerfällig-schleswigsche Art sowie der merkwürdige Widerspruch zwischen seinem jugendlichen Gesichtsausdruck und seinem eher massigen, gedrungenen Körper, der sich noch in seinen Gedanken wiederfindet, bei denen man nie weiß, ob und wie ernst er sie meint. Obwohl er gerne „rumlungert“, bemühte Käthe B. sich unlängst erstmalig selbst um eine Rolle: Er rief beim Regisseur Detlev Buck an und bat darum, in dessen neuestem Berlin-Film mitspielen zu dürfen. „Du bist bereits vorgesehen“, wurde ihm geantwortet.
Kürzlich hat sich Käthe B., weil nebenan gerade seine Wohnung renoviert wird, in einem Laden am neuen Kreativcenter Haakesche Höfe in Berlin-Mitte einquartiert, wo er alle vier Räume mit Videokameras bestückte. Deren Bilder werden auf einen Monitor übertragen, der im Schaufenster steht: „Käthe B. at Home“. Das „Überwachtes-Wohnen-Experiment“ soll bis Oktober dauern. Tag und Nacht klumpen sich nun die Zuschauer draußen vor dem Monitor, und die Journalisten platzten gleich im Dutzend bei ihm rein. Hernach war wieder von „Exhibitionismus“ (SZ), „Voyeurismus“ (Zitty) und von einem „Meister der Selbstdarstellung“ (Morgenpost) die Rede. Der Mann von dpa notierte sich penibel die „Titel der Platten“, die Käthe B. auflegte, und die Frau aus der taz merkte sich all seine „Statements“ dazu. Käthe B. freut sich nicht nur über diese geballte „Medienpräsenz“, sondern insbesondere darüber, „wie gut die das untereinander, als Fernsehsender und Printmedien, abgestimmt haben: Wenn man einen Beitrag gerade vergessen hatte – boff, kam der nächste“. Mir verriet er: „Bevor du kamst, war gerade der Spiegel da, und für übermorgen hat sich die Woche angesagt.“
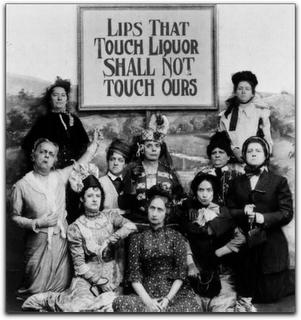
Jetzt – nach Käthe B.s Tod – finde ich im taz-blog von Joachim Lottmann, der sich „Anti-Goetz“ nennen läßt – am 5.10.2011 in einer Eintragung, die mit „Erregung in der Mariahilfstraße“ betitelt ist, eine „Message“, die nahelegt, dass Lottmann die Medienpräsenzpflicht noch einen Zacken weiter verschärft hat – und insofern ein würdiger Nachfolger von Käthe B. ist:
„Ja, man spürt sie durchaus, die zunehmende Aufgeregtheit der Menschen, die heute nachmittag die Mariahilferstraße bevölkern (Foto). Von der Mariahilferstraße geht die Schottenfeldgasse ab, und gleich an der Ecke, nämlich in der Nr. 3, wird heute das LOTTMANN’s mit einer Doppel-Buchpräsentation eröffnet, mit den neuen Romanen UNTER ÄRZTEN von Kiepenheuer & Witsch und HUNDERT TAGE ALKOHOL vom Czernin Verlag. Star des Abends wird sicherlich Christa Zöchling werden, mit mir verlobt seit dem 14. September und nun erstmals öffentlich zu sehen (hallo Fans, Handycamera bereithalten!); aber auch Thomas Draschan, der den Verleger Helge Malchow spielt, und Philipp Hochmair, der HUNDERT TAGE ALKOHOL liest, werden viel bewegen. Wie natürlich auch Czernin-Verleger Dr. Benedikt Maria Föger (Redner), Kiepenheuer & Witsch Cheflektor Marco Verhuelsdonk (Laudator, Moderator, Lebensmensch, dunkelhaariger Belgier und Frauenschwarm) und zahllose liebe und wichtige Freunde, vor allem jene, die mich nach Wien holten und vor Berlin Mitte retteten….“
P.S.: In dem Roman „Hundert Tage Alkohol“ geht es Lottmann, so weit ich das verstanden habe, darum, dass Sex ohne Liebe keinen Zweck hat.

Der Schriftsteller Rainald Goetz bearbeitet ebenfalls die Prominenz, Publicity, public affairs, Events, Medienpräsenz etc. – aber anders als Lottmann: sezierend, sich distanzierend, er bleibt jedoch dran… Im Wikipedia-Eintrag über Goetz heißt es:
„Zu den Themen, die er literarisch verarbeitet hat, zählen der Deutsche Herbst (Kontrolliert), seine eigenen Erfahrungen bei der Arbeit in der Psychiatrie (Irre) und die Techno-Bewegung in Deutschland (unter anderem veröffentlichte er einen Text über Sven Väth, den Roman Rave und zusammen mit Westbam das Buch Mix, Cuts & Scratches).
Durch nahezu alle Schriften zieht sich eine typische Tendenz: Die Wahrnehmung des Erzählers ist meist die eines Solitärs und Einzelgängers, dessen Alltag von geistiger Arbeit geprägt ist und dessen Eintreten in die jeweiligen Musikszenen (Punk in Irre, Techno in Rave) als wichtige Ergänzung zur sonstigen Lebensorganisation wahrgenommen wird.“
Ähnliches könnte man auch über den taz-blogger Detlef Kuhlbrodt sagen, der mit seinem letzten Suhrkampbuch „Morgens leicht, später laut“ in den Worten des taz-Literaturredakteurs einen „kleinen Hype“ landete. Umgekehrt schrieb Detlef Kuhlbrodt über Rainald Goetz, als dieser eine Party in der Oranienstraße gab, um das Ende seines blogs zu feiern:
…Alles war supervoll und schwül in dem Raum, so dass man gleich anfing zu schwitzen. Alles sei völlig chaotisch und großartig gewesen, berichtete C. Rainald Goetz hätte nach einleitenden Sätzen, in denen er das Internet gefeiert habe, Positionen klargemacht. Er hätte sich gegen Benjamin von Stuckrad-Barre, den ehemaligen taz-Autor und jetzigen BZ-Schreiber, gewandt, der neulich in Cicero über die taz hergezogen war und den Goetz früher sehr mochte.
Dann sei es um einen Satz von Frank Schirrmacher gegangen, in dem der Dichter all das versammelt gefunden hatte, wogegen sich sein ganzes Schreiben und Sein richte. Eine furchtbare Feistheit des Denkens.
Die Musik war sehr schön und aus unterschiedlichen Zeiten. Die Stimmung war superangenehm. Die einen kamen wohl vom Schreiben, die anderen vom Lesen. Julia Schulz und Georg Nolte legten die Musik auf und warfen manchmal ihre Arme in die Luft. Wir tanzten zu David Bowies „Let’s Dance“, und Rainald Goetz sagte, er hätte Bowie erst durch diese, von Puristen gehassten Platte, toll gefunden, und ich erzählte, wie ich damals auf drei Konzerten der „Let’s Dance“-Tournee gewesen war.
Wir dachten zurück an Klage. Klage war ja immer auch der Einspruch gewesen; die Klage der Wirklichkeit gegen die Literatur, also Maxim Biller, dessen Fall eines der großen Themen des Blogs gewesen war, die Klage, die Rainald Goetz gegen seine Telefongesellschaft geführt hatte; die Klage der Trauer über die Welt und den Tod. Als Klage begonnen hatte, hatte es zunächst richtige Anfeindungen gegeben, weil der Blog auf den Seiten von Vanity Fair erschien und alle die Zeitschrift doof fanden. Später hatte Rainald Goetz sich warmgeschrieben und alle waren plötzlich zu Klage-Fans geworden. Es hatte die großen Wutausbrüche – gegen die Familienministerin – gegeben, viel Fragmentarisches, Gedichte immer wieder, kleine und große Rezensionen von Büchern und Ausstellungen, immer wieder war es um das Schreiben, um Text und Wirklichkeit gegangen.
Über Rainald Goetz‘ Buch „loslabern“ schrieb die FR-Rezensentin Ina Hartwig laut „perlentaucher.de“:
Einen ambivalenten Eindruck hat Rainald Goetz‘ neues Buch „loslabern“ bei Rezensentin Ina Hartwig hinterlassen. Die Lektüre hat ihr meistens, wenn auch nicht immer, Spaß gemacht. Sie empfindet Goetz als einen „Medienmönch“ und überlegt, ob der mönchische Aspekt die „merkwürdige Sexuallosigkeit“ seines Beobachterposten hinreichend erklärt. Den Spott, den Goetz für Frauen Ende 30 übrig hat, die sich wie 24-Jährige aufführen, schluckt sie hinunter. Besser gefallen ihr die Berichte über drei große Partys der Kulturschickeria aus dem Jahr 2008, unter anderem den Herbstempfang der FAZ in Berlin, in denen Goetz wunderbar sich „mächtige Männer“ vornimmt. Ein wenig unbehaglich fühlt sich Hartwig allerdings, wenn sich der Autor an Heidi Paris erinnert, die 2002 Selbstmord begangen hat. Zwar ist sie berührt von Goetz‘ „Herzensbekenntnis“ für Paris, die den Autor in ihre Suizid-Pläne eingeweiht hat. Aber für sie stellt sich doch auch die Frage, „ob diese katholische Glut sich gut macht im Textmeer all der Hass(liebes)tiraden“.
Nach diesem Buch veröffentlichte Rainald Goetz ein weiteres Buch: „elfter September 2010“, in „Die Zeit“ erklärte er selbst dazu:
„Der springende Punkt bei der Konzeption des Buches war: totale Konzentration auf die Bilder, schwarz-weiß, ein Layout, das durch seine Ruhe starke Effekte ermöglicht, darunter knappe, öffnende Bildunterschriften. Das führte jetzt zu diesem Buch: Man nimmt es in die Hand, blättert ein bisschen darin und hat es sofort intuitiv erfasst, hat es drin. Andererseits kann man auch richtig einsteigen und sich sehr darin vertiefen. Eine weiterer Punkt war: Suhrkamp, mein Verlag, ist in diesem Frühjahr von Frankfurt nach Berlin gezogen, da wollte ich darauf reagieren. ZEITmagazin: Wie fanden Sie den Umzug? Rainald Goetz: Erst war ich entsetzt, ich lebe ja in Berlin. Ich hatte das Gefühl, die Eltern ziehen in die Stadt, in der man wohnt. Als ich das der Verlegerin mal gesagt habe, war sie gleich ganz beleidigt. ZEITmagazin: Sie ist nur wenige Jahre älter als Sie. Rainald Goetz: (lacht) Genau. Aber dann sagten meine Lektoren, sie freuten sich auf den Umzug, und von dem Moment an habe ich mich auch gefreut. Dann gab es diese Einweihungsfeier in Berlin, an diesem strahlenden Wintersonnentag, im neuen Verlagshaus in der Pappelallee, wo ich so glücklich war und dachte: Hier kann jetzt wirklich etwas losgehen. Das spiegelt das Buch auch ab, dieses Gefühl.“

Kuttner?
Der taz-blogger Joachim Lottmann begegnete Rainald Goetz auf seinen nächtlichen Celebrity-Suchstreifzügen durch Berlin und schrieb dann über ihn – in einem Eintrag vom 22.6. 2008 – unter der Überschrift „Das Ende von Rainald Goetz“:
„Abschiedsparty ist noch immer nicht in Sicht. Sie begann ja auch erst um 22 Uhr, zu einer Zeit also, als Holland gerade den Ausgleichstreffer gegen Rußland erzielte. Ich sah das Spiel mit hochrangigen Funktionären der Z.I.A. in einem Kreuzberger Lokal, in Sichtweite zur Goetz-Party. Um 23 Uhr marschierten wir geschlossen rüber und waren die ersten Gäste. Der Hausherr und Blog-Beender begrüßte uns mit Handschlag. Er freute sich über diese ersten Gäste riesig, wie immer bei ersten Gästen, denn vorher denkt man als Gastgeber ja schnell, es käme NIEMAND. Und dann doch diese Gesichter. Ich dankte Goetz förmlich für die Einladung (die es gar nicht gegeben hatte), und stellte ihm meine Begleiter vor, nachdem ich vorher höflich gefragt hatte, ob sie ihm bereits bekannt seien. Goetz meinte, das Gesicht des einen zu kennen – es war Philipp Rühmann – den anderen Herrn aber leider noch gar nicht. Ich sagte: „Die beiden sind hochrangige Funktionäre der Z.I.A.! Rainalds Gesicht riß auf. Ja, davon hatte er gehört!
Er wandte sich erst Philipp zu, dann aber viel intensiver Dr. Cornelius Reiber, als dieser nämlich ihm erzählte, in Princeton zu lehren. Die beiden fanden schnell zueinander, und ich wollte mich schon separieren, als der große Schriftsteller sich noch einmal an mich wandte: „Es ehrt mich, daß Du heute gekommen bist, Lojo. Ich erwiderte ohne zu zögern, es sei außerordentlich schade, daß der Blog ‚Klage‘ zusammengebrochen sei. Es würde nun etwas fehlen, daß für manche existentiell wichtig und unersetzbar gewesen sei. Goetz antwortete leise, es sei jetzt umso dringlicher, daß ich nicht auch aufgebe. Ich straffte mich. Eigentlich hatte ich genau das vorgehabt. Aber er hatte recht, mein Blog durfte nun nicht verstummen. Irgendwann, aber nicht jetzt. Ich drückte ihm noch einmal ergriffen die Hand, als Zeichen des Einverständnisses. Ich sah, daß nun andere Gäste kamen, und ging mit Rühmann und Dr. Reiber in den Küchentrakt.
Kaum waren wir aber dort, drängten etwa zwanzigtausend Gäste nach, von der Treppe her, die alle vom Länderspiel kamen, das nun zuende war, nach der dritten Verlängerung. Jetzt ärgerte sich Rainald Goetz vielleicht, daß er uns so leichtfertig die Hand gegeben hatte. Viel wichtigere und bedeutendere Personen kamen, etwa Ulf Poschardt und Rainer Schmidt. Schon nach wenigen Minuten ging der Sauerstoff in den niedrigen Räumen zur Neige. Doch Rainald mußte die angekündigte ‚Textaktion‘ abhalten. Er machte das aber sehr charmant, muß man sagen, wirklich EXTREM charmant. Er sprang auf einen wackeligen Tisch und hielt spontan die eine und andere kleine Rede, unterbrochen von Schweigen, Wortesuchen, Ratlosigkeit. Hier sah man doch deutlich die Tradition Karl Valentins, in der Goetz steht, ohne daß es ihm oder den vielen Germanisten je aufgefallen ist. Aber es war wie gesagt wahnsinnig heiß, und der Vortragende mußte noch mehr schwitzen als die nach Luft ringenden Zuhörer. Inzwischen war das gesamte Treppenhaus mit Leuten verstopft. Niemand kam mehr heraus. Goetz sah, daß ich über eine Feuerleiter floh (in Kreuzberger Industriegebäuden des 19. Jahrhunderts gibt es das), und machte es mir später nach. Da es seine Party war, mußte er später wieder rein und weitermachen, während ich nach Hause ging. Gewiß ist es die Party des Jahres.
(Partyphoto – u.a. von Holm Friebe, Intelligenzagentur)
Am 23.6.2008 kam Lottmann noch einmal auf Rainald Goetz zu sprechen:
„Nils Minkmar schrieb dann in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung sehr prominent über diese ‚Klage‘ Abschiedsparty, wie ich ja auch, und so ergibt sich für mich die Notwendigkeit eines Nachtrags, eines ganz kleinen. Minkmar sieht nicht, daß es Goetz um das Denken geht und nicht ums Erzählen. Vielleicht muß ich das mit einem Détail aus der Partynacht, das ich sorgsam verschwieg, untermauern. Als ich nämlich über die Feuerleiter die brüllend heiße Party vorzeitig verließ und Goetz mir in gebührendem Abstand heimlich gefolgt war, traf ich ihn unten auf der Straße etwa 500 Meter weiter. Soweit war er gegangen, um einen Platz zu finden, an dem er sich abkühlen konnte, ohne von einem der Partygäste aufgestöbert zu werden. Er wollte sich natürlich auch sozial abkühlen. Die nahezu völlig distanzlosen Begegnungen mit den vielen viel zu bekannten Mitmenschen hatten ihn noch mehr zermürbt als die Sauerstofflosigkeit in dem zellenartigen, fensterlosen Partyraum. Er hatte nun eine Bank in einem Rasenstück entdeckt, dreißig Meter abseits der Straße gelegen, der Oranienstraße übrigens. Diese Oranienstraße und überhaupt ganz Kreuzberg war in einen mir bis dahin ganz und gar unbekannten Rausch des Sommers, der nächtlichen Hitze, des Massenhaften, des Vergnügens geraten. Ich hatte so eine Stimmung erst einmal zuvor in meinem Leben gesehen, nämlich am Quatorze Juillet in Paris.
Damals, ich war noch ein halbes Kind, entsetzten mich Feuerschlucker, Betrunkene, Straßenmusikanten, und eben viel zu viele unsinnig lachende Menschen, bestimmt mehrere Millionen. Sie feierten wie jedes Jahr an diesem Tag den Sieg über die Deutschen, und auch das irritierte mich. Diesmal nun ging es um den Sieg der türkischen Nationalmannschaft, glaube ich, und wieder waren bengalische Feuer, lachende Jugendliche, ja die Jugend der ganzen Welt am Werk, und wieder waren es Millionen. Das war die Lage, als Rainald Goetz eine kleine Pause machte, sich auf die Bank fallen lassen wollte, neben der türkischen Imbißbude. Er wollte ja nicht viel, er forderte nichts, er wollte nur eine Minute lang oder zehn die Augen schließen, allein unter Wildfremden, unbehelligt, sprachlos, und auf keine Anregung reagieren, auf kein unschuldiges Hallo, von keinem Türken und auch von sonst keinem. Er wollte einfach nur, daß der verdammte Schweiß ein wenig abtrocknete, oder wenigstens abkühlte, der seinen ganzen Körper und all seine Kleidungsstücke erfaßt hatte. Es war ihm völlig gleich, wer neben ihm auf der Bank saß, ob Türke, Albaner, Brite oder Würzburger. In dem Moment erkannte er MICH. Das war lustig zu sehen, also in Makrozeitlupe war es lustig: er erkannte mich nämlich in verschiedenen Stufen. In der ersten Zehntelsekunde meldete ihm sein Gehirn ’netter Bekannter‘, vielleicht sogar ‚Freund‘, oder so eine Art Falschmeldung wie ‚der Albert‘. Sein Körper machte eine freudige Bewegung auf mich zu, der rechte Arm, der schlaff nach unten gehangen hatte, schwang affenartig nach oben, der andere machte eine Gegenbewegung im umgekehrten Kreissinne, wie Podolkski bei seinem zweiten Tor.
In der nächsten Zehntelsekunde meldete sein Rainald-Goetz-Gehirn ‚Joachim Lottmann‘. Er schlug entsetzt die Hände vors Gesicht. Er rief „Nein, nein! und drehte sich in die andere Richtung, ziemlich unkoordiniert, und wollte sich von mir, der Bank, der Imbißbude wegbewegen. Er schaffte ein, zwei Schritte, rief dabei „BITTE jetzt nicht!, und ich sprang ängstlich auf, um ihm zu Hilfe zu kommen. Er taumelte ja fast. Ich klopfte ihm auf die durchnäßte Schulter und sagte ganz automatisch Beruhigendes: „Dir gehts wie mir, ich wollte auch ein bißchen Abkühlen! Er wimmerte „nein, nein, und nun erinnerte ich mich, daß er ja Rainald Goetz war, also so problematisch, und daß er, wie Nils Minkmar geschrieben hatte (ich hatte das vorab gelesen und ein bißchen geschönt), eben dieses Problem mit der Distanz hatte. Also so hat das im Manuskript gestanden, ich hatte das auch nicht mehr wegredigieren können, deswegen nehme ich ja jetzt die Gelegenheit wahr, das zu diversifizieren. Also: Ich trug Rainald zurück zur Bank, setzte ihn darauf, schwor ihm, ihn nie wieder anzusprechen, und lief dann nicht zur Party zurück, sondern zur S-Bahn (wie gestern berichtet). Es ist nämlich so, also die Moral von der Geschichte ist: Rainald denkt. Er schreibt seine Gedanken. Immer inspiriert, immer poetisch – aber es sind Gedanken. Es ist die Literatur der Gedanken, nicht die der Situationen (die Minkmar bei Goetz nicht findet).
Ich dagegen erzähle. Ich denke nicht. Ich schreibe erzählend. Das hat Vorteile und Nachteile in jedem Fall. Ich will nichts gegen mich selbst sagen (will mir ja nicht schaden), deshalb erwähne ich nur den Vorteil meiner Art. Meine Sätze altern nicht, denn sie haben ja keine Zeitkomponente. Gedanken sind immer zeitabhängig, deshalb altern Rainalds Sätze. Mir ist kein einziger Satz seit meinem fünften Lebensjahr peinlich. Jeder klingt, als hätte ich ihn heute morgen geschrieben. Dafür ist auch keiner klug. Beide Methoden, seine und meine, reichen nicht aus. Es muß, also darin hat Minkmar nun recht, ein Thema dazukommen. Ein Thema ist ein Gottesgeschenk. Ich habe gerade eines gefunden, daher weiß ich das. In meinem Leben waren Themen leider extrem selten, die Ausbeute ist nahe Null, aber es ist möglich. Rainald hatte mit ‚Rave‘, ‚Irre‘ und jetzt ‚Klage‘ auch schon diese Erfahrung, also diese plötzliche, unerwartete, beglückende Erfahrung, daß es ein Thema für ihn GIBT. Möge er sie noch oft haben. ‚Klage‘, wie gesagt, halte ich für ein solches echtes Thema, ohne das jetzt ausführlich/multimedial/philosophisch ausführen zu wollen, also hier (könnte schon), und widerspreche nur dem Kollegen Minkmar, sozusagen in aller Form“.“

Den von taz-blogger Lottmann mit Fotos promoteten Holm Friebe von der Intelligenzagentur kennen auch die taz-blogger Schröder/Kalender oder jedenfalls besuchten sie dessen Event. „9to5 – Wir nennen es Arbeit“ hieß die dreitägige Veranstaltung:
„Um Mitternacht tranken wir Rotwein auf der Spree-Terrasse, Juergen Broemmer, Klaus Bittermann, Sonja Vogel und Jörg Sundermeier gesellten sich zu uns. Und Gerd Conradt lud uns zur Premiere seines Films ‚Die Spree – Sinfonie eines Flusses‘ am 28. August ein, die auch im Radialsystem stattfindet. Helmut Höge stand wie immer in der Nähe der Theke, so hatte er den Überblick und konnte jeden abfangen.
Dann erschienen Reimo Herfort, Franz Schütte, Henning Watkinson und der Tonmischer Tilo Schierztrusius vom Jeans Team. Sie setzten sich an unseren Tisch. Wir kennen Reimo und Franz seit Oktober 2003 als die Künstlerin Simone Gilges, Reimos Frau, uns zur Lesung in der Galerie ‚Neue Dokumente‘ einlud. Ich (BK) beglückte Milena, die Freundin von Frank, mit garantiert schadstofffreiem Gel gegen die Spree-Mücken. Und Frank erzählte mir (BK) dann von den Dreharbeiten zum Video ‚Das Zelt‘. Sie drehten auf einer Dorfstraße, da kam ein alter Mann vorbei und fragte: »Na Kinder, Langeweile?« Und der Regisseur antwortete: »Nein, wir nicht, aber du vielleicht?«“ Nun gut, ich laß es genug sein…es sind eigentlich nur Materialien für eine Medienkultur-Kritik. Käthe B. war übrigens alles andere als erfreut über diesen Zeit-Artikel, er war richtiggehend entsetzt. Und bis heute weiß ich nicht, warum.
Kürzlich, am 1.12., blogten Schröder/Kalender in eigener Sache:
„Es adventet sehr – bei strahlendem Sonnenschein. ‚Schröder erzählt‘-Subskribenten aus Franken schickten uns eine Kiste mit Lebkuchen, Freunde aus Köln einen Stollen nach schwäbischem Rezept der Großmutter und gerade ging eine ZEIT-Rezension über ‚Immer radikal, niemals konsequent‘ von Frank Schäfer ein. Alles in allem ein guter Text mit ein paar Einschlüssen. Denn an die hip-urbane Post-Pop-Intelligenzia, wie sie Kiepenheuer und Witsch repräsentiert, haben wir nie Anschluss gesucht. Jedoch, wir wollen nicht meckern! Morgen wird das Buch nun auch in fluter – der Bundesprüfstelle für jugendtaugliche Schriften – besprochen. Also: Gaudeamus igitur – pereat tristitia.“

Einige Männermacken – zugegeben:
1. Kniewippen
Wer kennt sie nicht, die jungen Männer, die in der U-Bahn, im Kino, in der Kneipe, kurz: überall, wo sie sitzen, mit dem Knie wippen. Zwar macht jeder Mann in seiner Jugend eine Kniewipp-Phase durch, aber nur jeder dritte bleibt dabei. Von diesen wippen 64% mit dem rechten und 36% mit dem linken Knie. Bei den Männern mit chronisch gewordenem Kniewippen kommt ein großer Teil aus der Unterschicht bzw. ist sozial abgestiegen, überall tätowiert und/oder hat sich dem Bodybuilding verschrieben. Immerhin ist das Kniewippen heilbar – und als solches eine „Krankheit“, die natürlich ein riesiger Markt für die Pharmaindustrie ist. Deswegen gibt es in den USA gleich drei Konzerne, die in den letzten Jahren Mittel gegen das Kniewippen entwickelt haben. Deren Marktdurchdringung wird nicht zuletzt über eine wachsende Zahl von Selbsthilfegruppen forciert. 2010 gründeten diese „knee-nodder“, wie sie sich nennen, sogar einen nationalen Verband: Es geht darum, das Kniewippen offiziell als Leiden anerkannt zu bekommen. Rückendeckung liefert dem Verband dabei die Pharmaindustrie. Aber auch mehr und mehr Ärzte behandeln das früher von ihnen als „entwicklungsbedingte Macke“ abgetane „knee-nodding“ inzwischen mit mehr Respekt. So kam es kürzlich auf einem Ärztekongreß in Florida bereits zu einem ernsthaften wissenschaftlichen Disput über die tieferen Ursachen des Kniewippens: Während die einen psychologisch argumentierten – und von einem nervösen Zucken aufgrund sich stauender Sexualhormone sprachen, gingen andere von einem Gendefekt und wieder andere von einem Epigeneffekt aus.
Von den letzteren waren mehrere zuvor an der Herstellung eines Anti-Kniewipp-Medikaments namens „Kneeease“ beteiligt gewesen. Einig waren sich die Kontrahenten darin, dass dieses zunehmende „Fear of Falling“-Leiden, wie die US-Soziologin Barbara Ehrenreich es nennt, dank der aufklärerischen Tätigkeit der Selfhelp-Groups kein „tic“ mehr ist, den man schamhaft unter dem Tisch versteckt oder schmerzhaft unterdrückt. Auf Youtube gibt es einen 45minütigen Film – unter dem Stammtisch einer 10köpfigen Männerrunde aufgenommen, der zeigt, das und wie alle ununterbrochen mit den Knien wippen. Er heißt „The suburb knee-nodder“ – Die Kniewipper aus der Vorstadt. Hierzulande gründete sich die erste Selbsthilfsgruppe im Ruhrgebiet. In dieser von schweren sozialen Umbrüchen gekennzeichneten Region gibt es die meisten Kniewipper. Einige der alteingesessenen Ärzte dort behaupten, dass dies eine Spätfolge der sogenannten „Staublunge“ im Kohlenpott sei. Während lokale Sozialkulturforscher – unabhängig von dieser möglichen Ursache – davon ausgehen, dass das Kniewippen schon sehr lange im Ruhrgebiet verbreitet ist, nur sei es bis zum Niedergang der Montanindustrie niemandem aufgefallen, weil die jungen Männer ihr Bier meist im Stehen – an den „Trinkhallen“ – zu sich nahmen. Seitdem es diese Kioske, die oft vor den Fabrik- und Zechentoren standen, nicht mehr gibt, müssen sie in regulären Kneipen sitzen, wo das Kniewippen natürlich auffällt.
Eine anderer deutscher Kniewippschwerpunkt ist Bremerhaven. Dort löste sich die Selbsthilfsgruppe jedoch gerade wieder auf. Ihr ehemaliger Leiter, Hans Schmollnick, führt das auf die „Unverträglichkeit der Charaktere“ zurück, die dort allwöchentlich in der Kneipe „Blauer Peter“ zusammen kamen: „Kniewippen allein genügt nicht!“ So sein Fazit. Obgleich er zugibt, dass ein fähiger „Therapeut“ vielleicht einiges hätte retten können. In Deutschland fehlt es zur Zeit noch daran. Etwas schneller waren da die Sozialarbeiter, die sich schon vor zwei Jahren dafür einsetzten, dass man die Kniewipper nicht einfach ihrem Schicksal überläßt, sondern ihnen eine „qualifizierte Betreuung“ angedeihen läßt. Der Berliner Freie Träger „Pegasus“ hat dazu im Frühjahr 2011 bereits ein „Pilotprojekt“ gestartet. Der Geschäftsführer der Spandauer Einrichtung, Martin Rausche, sieht das Problem der Kniewipper, von denen seine Sozialarbeiter inzwischen 21 Fälle betreuen („Nur die Spitze des Eisbergs“), quasi existentialistisch: „Es geht dabei ums Weggehenwollen, während man irgendwo sitzt. Es ist eine simulierte Flucht, ein bedingter Abhau-Reflex, der in dem Moment chronisch wird, da das nicht gelingt – und man festsitzt. Seit der Globalisierung schafft so etwas ein ‚unglückliches Bewußtsein‘ – das allerdings nicht länger therapieresistent ist, also der Bearbeitung zugänglich.“
2. Schlüsselbundklimpern
…Auch eine echte Männermacke, die immer mehr um sich greift – dachte man, als diese Klimperer dann auch noch anfingen, ihr Schlüsselbund mit überdimensionierter Karabinerhaken am Gürtel zu tragen, oft auch noch zusammen mit einem Flaschenöffner. Man mochte gar nicht hinkucken, es sah zu Scheiße aus, aber weghören kann man ja nicht. Dabei hatte man in den Siebzigerjahren noch gedacht, dass mindestens in Berlin mit dem ersten Nachkriegs-Modernisierungsschub – bestehend aus Türsummer und Gegensprechanlagen, die den berühmten zigarrengroßen „Berliner Schlüssel“ für die Haustür quasi aus der bewohnbaren Welt schaffte, eine Ära der sukzessiven Verkleinerung aller elenden Schlüsselbunde begonnen habe. Erst recht, als dann auch noch die zigarillogroßen Wohnungstürschlüssel durch die sehr viel kleineren Schlüssel sogenannter „Sicherheitsschlössern“ ersetzt wurden. Mit den Hausbesetzungen unter ökologischem Vorzeigen kamen dafür jedoch neue Schlüssel – fürs Fahrradschloß und den Fahrradkeller – hinzu, d.h. ans Schlüsselbund. Wieviele Hosentaschen haben die Männer sich damit zerrissen?!
Der Pariser Wissenssoziologe Bruno Latour, dessen „Akteur-Netzwerk-Theorie“ (ANT) gerade en vague ist, setzte in den Neunzigerjahren dem in den ganzen „Aufbau Ost“-Wirren fast vergessenen „Berliner Schlüssel“ mit einem gleichnamigen Buch ein Denkmal. Für Latour begann mit diesem unsäglichen Doppelbart-Relikt, der es ab 20 Uhr, wenn der Hauswart abschloß, trickreich verhindert hatte, dass ein Mieter die Haustür offen ließ, ein Prozeß der Zivilisation, in dem die Moral durch die Technik ersetzt wird. Weswegen Latour dringend dazu riet, der modernen Dichotomie von Subjekt und Objekt zu entsagen, sie mindestens neu zu bestimmen. Aber bis dahin den Artefakten schon mal Sitz und Stimme an unseren Runden Tischen einzuräumen. Das man, um den Berliner Schlüssel am Schlüsselbund zu befestigen, noch eine Extrakonstruktion benötigte, hatte Latour sogar noch vergessen zu erwähnen. Die Schlüsselrolle, die beim Übergang von der Moral zur Technik der „Berliner Schlüssel“ spielte, arbeitete er dafür dann noch einmal am Beispiel der Hotelzimmerschlüssel heraus, die mit immer unhandlicheren Gegenständen beschwert wurden, damit der Gast sie nicht an seinem Schlüsselbund mit nach Hause nahm.
Diese und weitere Schlüssel werden jedoch nun zunehmend durch Magnetkarten ersetzt, die den „Creditcards“ nicht nur ähneln, aber man kann damit nicht mehr klimpern, jedenfalls nicht akustisch. Etwa zur selben Zeit, als die o.e. Schlüsseltexte entstanden, kam die Mode der bunten Schlüsselbänder auf, die man sich um den Hals hängte. Da es sich dabei durchweg um Werbemaßnahmen handelte, die kostenlos unters Volk verteilt wurden – von der Deutschen Bank bis zum „Späti“ am Neuköllner Reuterplatz, besaß bald jeder eine ganze Kollektion zu Hause. Dort, in Neukölln, war es einmal zu einem interessanten Schlüsselbund-Ersatz gekommen: In der Trabantensiedlung „Gropiusstadt“. Dort hatten die Architekten die Klingeln an den Hochhäusern zu hoch angebracht, so dass die kleinen Kinder nicht an die oberen Klingelknöpfe rankamen. Die Mütter in den höheren Stockwerken gaben ihnen deswegen Kochlöffel mit auf den Weg. Damit konnten sie dann klingeln, wenn sie wieder reinwollten. Die schon größeren Kinder machten sich jedoch einen Spaß daraus, ihnen die Kochlöffel abzunehmen. Einer befindet sich heute im Neuköllner Heimatmuseum, es ist der von „Christiane F.“, die einst in der „Gropiusstadt“ aufwuchs, wo man ihresgleichen nicht Schlüssel-, sondern Kochlöffelkinder nannte.
Von einem anderen berühmten Neuköllner, den Ex-Terroristen und Enthüllungsjournalisten Till Meyer, stammt der Hinweis, dass sie in seiner Jugendzeit als Rockerclique in cowboymanier immer am Hermannplatz rumlungerten – und dabei angelegentlich mit ihren Schlüsselbunden klimperten, sich ihrer mindestens in der Jeanstasche immer wieder vergewisserten. Damals lief gerade ein Hollywoodfilm, in dem die verruchte Mae West einen Mann mit den Worten begrüßt: „Ist das dein Schlüsselbund oder freust du dich, mich zu sehen?“ Das Meyersche Schlüsselbundklimpern, das damals noch als „lässig“ galt, wurde mit der Zeit bei den Jungmännern, vor allem bei denen, die dann nicht wie Meyer zur Knarre griffen, um das „Schweinesystem“ aktiv zu bekämpfen, lästig – d.h. zu einer regelrechten Manie.
In dem kurz nach der Wende veröffentlichten 1. Band seiner „Hagen“-Trilogie hat der südelbische Autor Frank Schulz einen seiner durch Kneipen streunenden Hauptfiguren als astreinen Schlüsselbungklimperer dargestellt. Seitdem haben sie sich unter den Jungmännern geradezu epidemisch ausgebreitet, vor allem im Osten, wo der Karabinerhaken lange Zeit proletarisch überkonnotiert war. In der Neuzeit kamen dazu dann noch Handy-Etuis am Gürtel. Beides zusammen soll wie schwer bewaffnet aussehen und Sicherheit signalisieren. Ein dickes Schlüsselbund läßt sich zur Not aber auch wirklich als Handwaffe nutzen. Die Greifswalder Schriftstellerin Judith Schalansky erwähnt in ihrem Bildungsroman „Der Hals der Giraffe“, dass die DDR-Lehrer ihr Schlüsselbund auch gerne als Wurfwaffe – gegen schwatzende Schüler – einsetzten.
Das zwanghafte Schlüsselbundklimpern hat mich einmal fast selbst befallen: Immer wenn ich um 2000 meine Freundin wiedertraf, von der ich mich unrechtmäßig getrennt hatte – aber auch sonst. Bis sie mich einmal genervt fragte: „Mensch, kannst du nicht mal mit dem Schlüsselbungsklimpern aufhören?!“ Ich gab die Gewohnheit jedoch so richtig erst auf, nachdem ich mein Schlüsselbund, an dem u.a. ein USB-Stick hing, verloren hatte. „Kalten Entzug“ nennen die im Umgang mit Schlüsselbundklimperern gewohnten Sozialarbeiter das.
Es verwundert nicht, dass neben den Lehrern vor allem die Justizvollzugsbeamten, die man im Knast „Schließer“ nennt, den höchsten Prozentsatz an Schlüsselbundklimperern aufweisen: 71%. Davon klimpern 2/3 gedankenverloren bzw. ängstlich mit ihren Schlüsseln und das restliche Drittel, um zu provozieren bzw. zu demütigen. Über die Hälfte der Gefangenen empfindet bereits den Entzug des Schlüsselbunds bei der Einknastung als „extrem demütigend“. In einigen norddeutschen JVAs prüft man derzeit, ob man den Gefangenen nicht ihr Schlüsselbund bei der Einlieferung einfach lassen soll: „Die können in ihrer Zelle ja doch nichts damit anfangen,“ so der Leiter eines neuen Bremer Reformgefängnisses für geringfügig Bestrafte – aus vorwiegend Akademikerkreisen, bei denen jedoch in Freiheit das Schlüsselbungsklimpern weit weniger verbreitet ist als in den „nicht so verkopften Bevölkerungsschichten“, wie die Zeitschrift der Schweizer Schlüsseldienste „Keynotes“ dazu kritisch anmerkte. Dort gibt es im übrigen einen „Keymail“-Service – für verlorene Schlüsselbunde. Auf ihrer Internetseite behauptet das Unternehmen, täglich 30 Schlüsselbunde allein in der Schweiz an die Besitzer zurück zu schicken. Wenn ansonsten heute im Internet von „Schlüsselbund-Problemen“ die Rede ist, sind damit fast immer Datei-Zugangsschwierigkeiten (Keychain-Problems) bei Apple gemeint – fast so, als hätte sich die männigliche Klimpermacke da hinein verlagert.
3. Hochstapeln
Der Bremer Postbote Gert Postel ist derzeit neben dem süddeutschen Adligen Guttenberg wohl der bekannteste deutsche Hochstapler: Seine Freundin nahm ihn einmal mit auf eine Ärzteparty, anschließend sagte er sich: „Das kann ich auch“. Als „Dr.Dr. Clemens von Bartholdy“ arbeitete er daraufhin als Amtsarzt in Flensburg sowie als Stationsarzt in einer psychiatrischen Klinik bei Leipzig. Nachdem er aufgeflogen war, veröffentlichte er ein Buch mit dem Titel „Doktorspiele“.
In einem Doppelband über „Hochstapler“ der Zeitschrift „Kultur & Gespenster“ bezeichnete ich ihn 2009 als „Charakterschwein“, weil er die ihm anvertrauten Patientinnen (Prostituierte und Suizidgefährdete) allzu rüde behandelt hatte – und nur nach oben hin als Psychiater glänzen wollte. Er rief mich daraufhin an und beschimpfte mich. Danach versuchte er, mit der Kollegin Barbara Bollwahn ins Geschäft zu kommen, aber sie war auch nicht sonderlich begeistert von ihm (siehe taz v. 23.11.). Im Gegensatz zur Berliner „Irrenoffensive“: Die Initiatoren des antipsychiatrischen „Weglaufhauses“ sowie von autonomen FU-Seminaren über den Wahnsinn sind „große Fans“ von Postel. Sie haben den „falschen Psychiater“ sogar für den Medizin-Nobelpreis vorgeschlagen.
Zum 25jährigen Jubiläum der Irrenoffensive hielt er die Festrede. Es galt einen „Sieg der Irren“ zu feiern: Der Gruppe war es gelungen, die „Patientenverfügung“ gesetzlich durchzusetzen – die Verbindlichkeit schriftlich geäußerter Patienten-Willen. Als „Kern“ ihrer Arbeit erkannte Postel in seiner Rede, dass die „Irren-Offensive durch das Agieren als politische Gruppe Hand an die Wurzel der psychiatrischen Gewalt gelegt“ habe. Das macht Postel auch für sich geltend: „Deutlicher als ich kann man es ja nicht machen – das System entlarven.“ Für die Irrenoffensive ist das „Postel-Experiment“ eine noch gelungenere Entlarvung der faschistischen Psychiatrie, die ihre Patienten mit Chemikalien seelisch verkrüppelt, als das „Rosenhan-Experiment“ – über die Zuverlässigkeit psychiatrischer Diagnosen: David Rosenhan hatte 1968 acht „geistig gesunde Menschen“ in die Psychiatrie einweisen lassen, denen man dort prompt Schizophrenie bzw. manisch-depressive Psychosen attestierte. Postel bescheinigten die psychiatrischen Gutachter, nachdem er aufgeflogen war, eine „narzistische Persönlichkeitsstörung“. Er selbst will sich zu Beginn seiner Psychiater-Karriere gesagt haben: „Du machst dich damit lustig über die Psychiatrie“. Zu seinem „Spiel gehörte aber immer auch die Erhellung. Ich habe mich als Hochstapler unter Hochstaplern begeben.“ Und natürlich wurde das nicht offiziell gewürdigt, sondern als Betrug aufgefaßt: „Da kommt ein Postbote von der Straße und macht den Job besser als die Psychiater.“
Der Spiegel, der ihn als „Artist“ bezeichnete, berichtete, dass er als Amtsarzt in Flensburg die Zwangseinweisungsrate um 86% senkte. Er selbst erzählte, dass er als Weiterbildungsbeauftragter der sächsischen Psychiatrie bereits so sicher war, dass er neue Krankheitsbilder entwarf – u.a. die „bipolare Depression 3.Grades nach Postel“. Schon gleich zu Anfang in Flensburg, wo sein Vorgesetzter ihm eine Professorenstelle an der Kieler Universität verschaffen wollte, bewies er große fachliche Kompetenz: Als der ihn fragte, worin er eigentlich seinen Doktor gemacht habe, antwortete Postel, er habe zwei Doktortitel, einen in Psychologie, wo er über „Kognitive Wahrnehmungsverzerrungen in der stereotypen Urteilsbildung“ promoviert habe. Sein Vorgesetzter war mit dieser Antwort sehr zufrieden, dabei war es bloß eine verquaste Definition von Hochstapelei.
Eine Künstlerin, die sich im Gegensatz zu der taz-Autorin Bollwahn mit ihm verabredete, meinte hernach: „Das ist kein Hochstapler, der ist wirklich Arzt – groß, gutaussehend, redegewandt und einem ständig auf den Arsch kuckend. Und sowieso werden die dümmsten Mediziner immer Psychiater. Schon ihre Ausbildung ist lächerlich, eigentlich müßte der Studiengang ‚Chemikalienkunde‘ heißen.“ Der Fraktionsvorsitzende der Partei „Die Linke“ im sächsischen Landtag Dr. André Hahn ist sich dagegen mit der „Irrenoffensive“ einig, dass Gert Postel „Patron der Psychiatrie-Betroffenen“ ist. Und ein echter Oberarzt gestand ihm, nachdem man ihn als Hochstapler entlarvt hatte, ihn mehr zu bewundern als zu verurteilen, denn immerhin habe er keinem Patienten geschadet. Postel entgegnete: „Ich bin ja auch kein Psychiater.“ Ich bin ebenfalls keiner – und nehme hiermit das „Charakterschwein“ mit dem Ausdruck des Bedauerns zurück.
4. Salonlöwenieren
In Berlin hat schon wieder eine „Denkerei“ (Musing-Hall) eröffnet, am Oranienplatz in Kreuzberg. Die bisherigen nannten sich gerne „Club“ – z.B. der „Republikanische Club“ in der Wielandstraße, der „China-Club“ in der Cranachstraße… Oder auch „Salon“: Nach der Wende entstanden allein in Mitte drei „Literatur-Salons“, in Neukölln eröffnete der „Salon Petra“, die „Musenstube“ von Annette Köhn und der Arbeitslosen-Salon „Lunte“. In Friedrichshain gibt es mindestens zwei solcher Treffpunkte – für junge Kommunisten. In den Räumen des Privatsalons von Nicolaus Sombart in der Ludwigkirchstraße betreibt die Zahnärztin Beate Slominski einen „Salon T-Kult“ und gleich daneben am Fasanenplatz eröffnete der „Salon Berlin-Geflüster“ von Sybille Senff, die daneben noch den „Berliner Business Salon“ organisiert. Auch die Springerstiefeljournalisten haben einen eigenen Salon – für leitende Angestellte und rechte Promis: im obersten Stockwerk ihres Hochhauses. Es gibt sogar einen „virtuellen Salon“: das „Berliner Zimmer“, mit einem nicht-jugendfreien „Erotikportal“. Die Hausbesetzer betreiben gleich eine ganze Reihe von „Salons“, die sie nur nicht so nennen, eher schon „Wohnzimmer“, weil Salon ihnen zu bürgerlich klingt. Und auch die Anarchos nennen ihre Etablissements lieber „Spelunken“ – das „Baiz“ und die „Rumbalotte“ im Prenzlauer Berg z.B..
Ähnliches gilt für die Kunstscene, deren Galerien immer öfter den Charakter von Bohème-Salons annehmen: Angefangen mit der Kreuzberger Galerie „Zinke“ von Günter Bruno Fuchs in den Fünfzigerjahren, der Galerie von Jes Petersen in der Goethestraße, dem offenen Atelier von Johannes Schenk in der Dresdnerstraße, dem „S.O.36“ von Martin Kippenberger, dem Schöneberger „Ex & Pop“ von Fascho-Kurt, dem „Fischbüro“ in der Köpenickerstraße und dem „Kumpelnest 3000“ von Mark Ernestus in der Lützowstraße. Auch der legendäre, sich einst Diskothek nennende Sceneclub „Dschungel“ in der Nürnberger Straße gehörte dazu. Daneben gab es noch jede Menge türkische Arbeiterclubs, und neuerdings ein alevitisches Kulturzentrum in der Waldemarstraße sowie das kleine „Ichorya“ in der Oranienstraße. Einige Kulturwissenschaftler eröffneten nach der Wende im Scheunenviertel das „Aroma“ und eine finnische Künstlerin die Galerie „Morgenvogel Real Estate“ in der Brunnenstraße, aus der ein Salon für Vogelfreunde wurde. Die ehemaligen DDR-Diplomaten trifft man im Club „Spittelkolonnaden“ und die 78er-Lesben immer noch in der „Begine“; auch die ganzen Literatur- und Lyrikhäuser der Stadt kann man gut und gerne als „Salons“ bezeichnen, angefangen mit dem „Buchhändlerkeller“ in der Carmerstraße. All diese Einrichtungen haben quasi eine Zielgruppe, sie versuchen diese jedoch zu erweitern, zudem gibt es immer wieder Überschneidungen.
Berlin hat infolge von Nationalsozialismus, Weltkrieg, Mauerbau und Sozialismus sein Bürgertum gründlich liquidiert. Was sich spätestens seit 89 an seiner Stelle etabilierte, sind special interest Aufsteiger. Und da diese meist von woanders her kommen, aus Westdeutschland oder Sachsen etwa, gab und gibt es einen großen Bedarf an solchen salonähnlichen Läden, Wohnungen, Kneipen und Sälen. Der Siegener Germanist Georg Stanitzek hat sich mit den Salons im 18. Jahrhundert beschäftigt: In ihnen war „Gesellschaft“ noch identisch mit „Geselligkeit, bei der die Menschen einander ‚freudig‘, ‚gleich‘, ‚offen‘ begegnen“ – in einer „konversierenden Interaktion, in der die Teilnehmer sich sympathisierend, symmetrisch, aufrichtig miteinander ins Verhältnis setzen.“ Itzo verschärft sich jedoch die Fragmentierung und Atomisierung der Gesellschaft, so dass gleichzeitig der Wunsch nach Gleichgesinnten oder Anzuhimmelnden enorm zugenommen hat.
Die „Denkerei“ am Oranienplatz will demgegenüber den hiesigen Bürger-Ersatz bilden und belehren – mit Mikro, Podium und Stuhlreihen. Sie bezeichnet sich zum Einen als Dépendance der Uni Lüneburg und bietet zum Anderen gleich eine ganze Altherrenriege aus Karlsruhe auf, die mit Schwerpunktwissen aufwartet: „Psychopolitik“ (Peter Sloterdijk), „Müllkulte“ (Bazon Brock), „Technotheologie“ (Peter Weibel), „Stoische Diätetik“ (Ulrich Heinen), „Molekularbiologie“ (Roland Brock) und „Abendländische Epistemologie“ (Arno Bammé). Sie haben sich – ausgehend von der immer dringenderen Überwindung repräsentativer Demokratien – die Herausarbeitung der Idee des Patienten-Experten bzw. „Profi-Bürgers“ vorgenommen. Dazu hatte Peter Weibel bereits 2005 zusammen mit Bruno Latour eine große Ausstellung organisiert: „Making Things Public. Atmosphären der Demokratie“. Zuvor hatte dieses Feld bereits landauf landab der Beuys-Schüler Johannes Stüttgen mit seinem „Omnibus für direkte Demokratie“ vorbereitet. Bei der Eröffnung der „Denkerei“ am Oranienplatz sprach Bazon Brock von einem „Amt für Arbeit an unlösbaren Problemen und Maßnahmen der Hohen Hand“. Letzteres nennt man gemeinhin staatliche „Verfügungen“, die Hoffnung, dass es diesem „Denker“ dabei um „Gegenmaßnahmen“ geht, blieb leider erst mal unerfüllt, dafür ließ die Verköstigung – das Catering: von der Imbißbude vis à vis, nichts zu wünschen übrig. Aber so ist es ja eigentlich immer – in all den weit über 1000 „Denkereien“ in Berlin: Dass man von dort zwar gut abgefüllt und etwas breit, aber mit leerem Hirn, wieder nach Hause wankt, wo man sich reumütig vornimmt, nächstes Mal etwas weniger „gesellig“ zu sein.
5. Kommunizieren
Berlin gilt als „Hauptstadt der Kommunikation“ (Jürgen Habermas). Aber wer dieses Berlin begreifen will, muß Bielefeld studieren. Die westfälische Kleinstmetropole, die ebenso wie Berlin zerbombt wurde, war bis zur Wende die westdeutsche „Durchschnittsstadt“ – und zwar derart statistisch genau real gemittelt – was Klima, Schicht-, Alters- und Geschlechterverteilung, Religion, Schulbildung und Parteienzugehörigkeit betraf, dass alle Warentester und Meinungsumfrager sich guten Gewissens bei ihren Erhebungen auf Bielefeld beschränken konnten, wenn sie zu wahren Aussagen über die ganze BRD kommen wollten. Sogar US-Wissenschaftler suchten mitunter Bielefeld auf, um diverse deutsche „Befindlichkeiten“ vor Ort zu eruieren – u.a. die berühmte „German Angst“ und das „Waldsterben“ (im Original deutsch, gemeint war damit der Teutoburger Wald bei Bielefeld). Zwei mal kam auch die US-Topkulturkritikerin Susan Sontag nach Bielefeld, um „German Impressions“ zu sammeln, allerdings begnügte sie sich dort mit den Aussagen einiger Bielefelder Taxifahrer.
Als die SPD beschloss, der langsam ausufernden Studentenbewegung das Wasser abzugraben, gründete sie ein Dutzend „Reformunis“, in der nahezu sämtliche Rädelsführer des SDS Festanstellungen fanden, die besten im Planungsstab der Bielefelder Uni, die man Anfang der Siebzigerjahre im Schnellbauverfahren auf der Grünen Wiese hochzog – um einen riesigen überglasten Indoor-Campus herum, der schon bald zum Vorbild aller deutschen Einkaufs-Passagen wurde, namentlich und zuletzt der „Potsdamer Platz Arkaden“. Besonder hier wurde dann deutlich, wie das Privatkapital zwar alles kopieren und verbessern kann, jedoch ohne das Soziale, das in diesem Fall im Bielefelder Indoor-Campus zurückblieb und bleibt.
Nicht zufällig siedelte sich dort dann auch der berühmteste deutsche Soziologe, der Lüneburger Niklas Luhmann, an, dessen zentrale Begriffe „System“ (Bielefeld), „Medium“ und „Kommunikation“ heißen. Und in der Tat: In Bielefeld wird kommuniziert wie verrückt. Besonders um diese Jahreszeit, da das gesamte System der innerstädtischen Fußgänger-Einkaufszonen aus einem einzigen Weihnachtsmarkt besteht, den zu besuchen allen Bielefeldern anscheinend süße Pflicht ist – am Liebsten in Kleingruppen, von denen viele sich mit rotweißen Santaclaus-Mützen ausgestattet haben, damit sie sich im Gedränge leichter wiederfinden. Da das jedoch immer mehr Kleingruppen tun, ist es immer weniger hilfreich, wie man sich leicht denken kann. Nicht so die Bielefelder, die dieses „Kuddelmuddel“ bloß zu noch mehr „Kommunikation“ aufreizt. Für den Bielefelder Soziologen Luhmann ist sogar die (systemische) Liebe nur ein „Medium“ der Kommunikation. Tatsächlich scheint der durchschnittliche Bielefelder (eine Tautologie) dieses „Medium“ sogar eher gering zu schätzen.
Wenn man am Bahnhof ankommt, stößt man bereits in der Haupthalle auf die zwei neben der Uni größten Beschäftigungsbetriebe der Region: auf das Logo von „Dr.Oetker“ und „Bethel“. Beide werben mit „Kommunikation“: der Behindertenkonzern, der eigenes Geld im Umlauf hat, mit dem Zusammenbringen von Menschen mit den unterschiedlichsten Handicaps und der Backpulverkonzern mit dem Zusammenhalten von Kernfamilien über Süßes – vornehmlich Pudding und Kuchen.
Während man es anderswo, in Paris z.B. bedauert, dass wir seit Luhmann schier gezwungen sind zu kommunizieren: „Wir dürfen nicht einfach mehr miteinander reden!“ so der Kulturkritiker Jean Baudrillard bitter, ist es in Bielefeld genau andersherum. Und dies hat damit etwas zu tun, das hier die „Kommunikation“ quasi erfunden wurde und allgemein verbreitet ist, während sie z.B. in Berlin komplett arbeitsteilig erledigt wird: von Kommunikationsagenturen, Werbefuzzis, PR-Beratern, Webdesignern, und ähnlichem Kreativgesindel.
In den Bielefelder Buchläden stapelt sich deswegen das neue Buch „I hate Berlin“, in dem u.a. der Bielefelder Brotdichter Wiglaf Droste über die Hauptstadt vom Leder zieht, dass er nur so seine Bewandtnis hat. Berlin, das ist auch äußerlich nichts anderes als Bielefeld ins Maßlose und Professionelle verstiegen – bis zur völlige Verblödung. Wenn du in Rom bist verhalte dich wie die Römer, sagt man, aber wenn du in Berlin bist, mußt du dich wie ein Ami ausdrücken („upgedateten Modus generieren“). Kommt noch hinzu, dass Bielefeld die Wiege aller Juvenilmoden ist, die der Berliner in seiner Verblendung für New York Fashion hielt und hält: „Sue Ellen- und Mecky-Frisuren, Schlag- und Röhrenhosen, Punk, Piercing, Tatoos, Baumscheiben, kurze knappe Jeans, die den Vaginaspalt betonen, bauchfreie T-Shirts, Röcke über Hosen, zerfetzte Jeans, Kapuzenpullis, die albernsten Kopfbedeckungen, hochgegeelte Kurzhaarfrisuren… Selbst die Berliner Juvenilmacke, nächtens mit Becksbier-Flaschen in der Hand von einer Location zur nächsten zu wandern und dabei womöglich noch laut über Foucault, Derrida, Slavoj Sloterdijk und die neuesten Hollywoodfilme und natürlich über Luhmann zu reden, stammt ursprünglich aus Bielefeld – nur dass man dort Herforder Pils Flaschen umklammert.
Eine bis heute erhaltene Besonderheit der Bielefelder besteht darin, dass sie auf den Photos ihrer Lokalzeitung „Westfalen-Blatt“ stets ein beschriebenes Blatt, ein Poster, einen Geschenkgutschein, ein Diplom oder eine Protestparole in die Kamera halten, wovon im dazugehörigen Artikel dann ausführlich die Rede ist. Allein in der Ausgabe vom 25.November 2011 finden sich nicht weniger als 25 solcher Photos. Diese „Bielefelder Redundanz“, wie sie auch genannt wird, hat bewirkt, dass dort das stets und überall dräuende Primat des Bedeutenden über das Bedeutete mit einem „Kunstgriff“ quasi kurzgeschlossen wurde. Alle Achtung!

Geschenke auspacken nicht vergessen!




Was ist das bitte für eine degenerierte und nichtssagende wall of text und wie bin ich hier gelandet? Sexuelle Promiskuität ist immer Zeichen des zivilisatorischen Niedergangs, wie der Freudianer und Marxist J. D. Unwin 1934 in „Sex and Culture“ darlegte. Wäre ich nicht gläubiger Christ, ich erhängte mich ganz so wie Philipp Mainländer.