


Photo: einestages. spiegel.de
In dem Friedrichshainer Versammlungsraum „Zielona Gora“ wurde kürzlich über die Revolution in Ägypten diskutiert, im Moabiter Haus der Kulturen der Welt wird gerade drei Tage lang über die Revolution in Ägypten (mit Kulturprogramm drumherum) diskutiert. Aus Ägypten selbst kommt die dpa-meldung:
Das neue Ägyptische Museum vor den Toren Kairos soll 2015 eröffnet werden. Bis dahin werde die dritte und letzte Phase der Bauarbeiten beendet sein, kündigte der Minister für Altertümer, Mohammed Ibrahim, am Dienstag an. Der umgerechnet fast 650 Millionen Euro teure Bau gilt als weltweit größtes Museum seiner Art. Es soll mehr als 100 000 Exponate aus der Zeit der Pharaonen beherbergen und für 20 000 neue Jobs sorgen.
„Wo gehobelt wird, da fallen Menschen,“ titelt die FAZ über eine Rezension des Theaterstücks „Marija“ von Isaac Babel, inszeniert von Andrea Breth in Düsseldorf:
„Das Stück spielt 1920 in Russland. Die junge Sowjetunion im Bürgerkrieg. Rote Armee gegen Weiße, Invasionstruppen und polnische Eroberereinheiten. Marija, die Titelheldin, tritt nicht auf. Sie schreibt nur einen Brief und kämpft als rote Politkommissarin an der Front. Ihre Familie, Großbürgertum, Vater einst zaristischer General, Schwester Ludmilla ein Adelsgroupie, lüstern-kokett, samt Hausdame und Kinderfrau, bewohnt in St. Petersburg, das noch nicht Lenin-, sondern Petrograd heißt, immer noch die Beletage. Die siegriechen Revolutionsproletarier kommen erst langsam aus den Kellern und auf den Geschmack. Dazwischen Schieber, Schwarzhändler (Lebensmittel gegen Sex), Schmuggler (Zwirn, Juwelen, Graupen, Schnaps, Wurst), Krüppel (Beine ab, Gesicht verbrannt), Zuhälter. Zwischenzeitstimmung. Das Alte ist nicht mehr, aber immer noch da. Das Neue ist zwar da, aber noch nicht wirklich….
Ein wunderbares Stück, aber vergangen mit seiner Zeit. Wir brauchen andere Stücke. Im Schauspielhaus Düsseldorf sieht man jetzt solch ein anderes Stück. Es heißt auch „Marija“, stammt auch von Isaak Babel und wirkt in der Inszenierung von Andrea Breth wie ein Drama von heute….
Bei Andrea Breth ist die Hausmeisterin in Gestalt von Elisabeth Orth ein ziemlich ungemütlicher Drachen, prügelt der dreckige Proletarier seine hochschwangere Frau. Und die das zukünftige Sowjetreich gebären soll mit ihrem kommenden kleinen Sowjetbürger, windet sich unter Krämpfen, Weinen und Angstträumen. Derweil wirbelt die junge, durchgeknallte Putzfrau zu einem irren Revolutionslied, das durch die Fenster von den Boulevards heraufdröhnt, sich in einen wahnsinnigen Tanz hinein. Damals nannte sich der Tanz noch „Revolution“. Die Namen ändern sich. Zurzeit heißt er „Krise“.
Die Umstände sind von gestern, das Gefühl dafür aber ist von heute: Was kommt, kommt mit Schrecken. Wer es aushält, ist groß. Und kann nichts weiter tun, als ins große Leere zu greifen. Aber wie er da greift, darauf kommt es an.“
Aha! „Untergehen – aber mit Würde!“ Das riet lange vor der Wende bereits Karl Markus Michel den bundesdeutschen Linken im Kursbuch. Das mit dem „Untergehen“ war dann kein Problem, aber mit der „Würde“ haperte es nicht selten. Nachdem zuletzt 1993 auch noch „Bischofferode“ (das Kalibergwerk im Eichsfeld) untergegangen war, schrieb ich:
Unter Zugzwang
Der Intercity Max Liebermann verläßt den Hamburger Hauptbahnhof um 18 51 Uhr. Ziemlich genau drei Stunden später läuft er im Berliner Bahnhof Zoo ein. Ich betrat den Bahnsteig an einem der letzten Freitage überpünktlich – bereits um 21 30 Uhr und mit einem Blumenstrauß, weil ich eine Freundin abholen wollte, welche die Woche über beim NDR gearbeitet hatte. Was zum Teufel ist denn hier los?
Die Bahnsteigkante war gesäumt mit Männern, die alle genauso aussahen wie ich, und jeder zweite hatte auch mindestens eine Blume, zumeist eine Rose, in der Hand. Sie warteten ebenfalls alle auf den IC aus Hamburg. Oh, Gott, war mir das in meiner Individualität unangenehm – mich dort unter all die wartenden Männer mischen zu müssen, denen die Verlegenheit ebenfalls anzumerken war (nicht wenige hatten sich hinter einem RowohltBuch oder einer Hamburger Wochenzeitung verkrochen)!
Aber das Schlimmste kam erst noch: Als nämlich der Zug aus Hamburg zum Stehen kam, entstiegen ihm mehr als hundert junge Frauen – die alle so aussahen wie meine Freundin, und, wie ich dann herausbekam, auch wie sie alle in Hamburg bei irgendwelchen Zeitungen, Fernsehanstalten, Verlagen oder Werbeagenturen arbeiteten.
Übers Wochenende fuhren sie zurück „nach Hause“, zu ihren festen Beziehungen beziehungsweise Ehepartnern in Berlin „Nutten Expreß“ wird dieser IC hier mittlerweile genannt, weil die Frauen bloß zum Anschaffen nach Hamburg fahren, ihren echten Liebesschwerpunkt aber weiterhin in Berlin aufrechterhalten.
Am Sonntag, am IC Hungaria, der um 20 Uhr Berlin verläßt und um 22 51 Uhr in Hamburg ankommt, passiert ähnliches andersherum: Dann stehen da über hundert Paare auf dem Bahnsteig und küssen sich zum Abschied. Meiner Freundin und mir fiel ebenfalls nichts Besseres ein. Allerdings drückte ich ihr beim Einstieg in den Zug keine Pralinenschachtel in die Hand, wie es die meisten Männer taten. Meine Freundin berichtete mir am Montag telephonisch, daß in jedem Abteil mindestens eine Frau saß, die, kaum daß der Zug Spandau hinter sich gelassen hatte, ebenso tapfer wie dumpf ergeben ihr Pralinengeschenk verschlang.
Während diese zumeist akademisch gebildeten Berlinerinnen am Sonntag en masse vom Westbahnhof Zoo aus die Stadt verlassen, kommen ungefähr zur gleichen Zeit auf dem Ostbahnhof Lichtenberg mindestens ebenso viele Polinnen an. Viele sind ebenfalls hochqualifiziert, arbeiten aber zumeist als Putzfrauen und Küchenhilfen in Berlin. Nicht wenige sind auch tatsächlich als Prostituierte tätig. 550 Bordelle gibt es mittlerweile in Berlin und vier Straßenstriche „Die Polinnen versauen uns noch das ganze Geschäft“, stöhnen viele deutschpässige Prostituierte bereits.
Ähnlich schimpfen auch viele Bauarbeiter über die männliche Billigkonkurrenz aus Polen. Mehrmals kam es zu handgreiflichen Auseinandersetzungen. Einmal wurde dabei ein polnischer Bauarbeiter mit heißem Teer übergössen.
Auf der 22. Sitzung des Stadtforums – einer Expertenrunde unter der Leitung des Senators für Stadtentwicklung – kam schon die Frage auf: Was ist eigentlich, wenn sich in Berlin nur Klitschen und kleine Industrien auf niedrigstem Lohnniveau ansiedeln statt high tech philosophisch permanent unter Dampf stehendes Dienstleistungsgewerbe? Es deute sich doch bereits an, daß der Zustrom an West Gewinnern ausbleibe und dafür die Verlierer aus dem gesamten Ostblock nach Berlin strömten. Der Tagesspiegel sprach hernach von einer drohenden „Polonisierung der Stadt“.
Für viele unter Zugzwang stehende Männer – an der Max LiebermannBahnsteigkante beispielsweise – bedeutet eine solche Tendenz jedoch eher eine gewisse Entlastung „Wir haben jahrzehntelang vor allem Berlin gelernt, und das gibt es jetzt nicht mehr, es ist einfach verschwunden“, so sagte es neulich ein Schriftsteller aus dem Westteil der Stadt. Für den Osten gilt dies in noch größerem Maße. Auch der Schriftsteller brachte dann übrigens seine Freundin an den Zug nach Hamburg. Sie hatte ein Vorstellungsgespräch beim Bauer Verlag, wollte dann aber keine Anstellung dort: „Das war mir wirklich zu erniedrigend!“ Später beschlossen die beiden, schon etwas angetrunken: „Untergehen, aber mit Würde!“ Das waren exakt ihre Worte nicht wissend, daß Karl Markus Michel bereits zehn Jahre zuvor genau denselben Entschluß in einer seiner Kursbuch Veröffentlichungen gefaßt hatte.
Ich gehe davon aus, daß diese Verplanung ihres letzten Lebensdrittels für die beiden das gleiche bedeuten wird wie für Michel seinerzeit: einfach so weitermurkeln wie bisher – und dabei versuchen, immer wieder „Kraft durch Nörgeln“ zu schöpfen.
Auch die taz rezensierte kürzlich die Düsseldorfer Inszenierung des Isaak Babel Stücks „Marija“:
„Wieder hat es die Regisseurin nach Russland gezogen, eine „Manie“, wie die sonst eher pressescheue Breth in einem der vielen Interviews vor der Premiere bekannte. Warum gerade jetzt „Marija“? „Weil ich glaube, dass wir uns in kürzester Zeit in ähnlichen Situationen befinden werden“, orakelte Breth, „es liegt Revolution in der Luft.“
Bürgerkrieg in Düsseldorf? Eher schon in Syrien – AP meldet von dort:
Die Gewalt in Syrien hält trotz der Anwesenheit internationaler Beobachter im Land nach Angaben von Aktivisten unvermindert an. Soldaten und mutmaßliche Deserteuren lieferten sich am Mittwoch in der Unruheprovinz Homs heftige Gefechte, wie das in Großbritannien ansässige Observatorium für Menschenrechte mitteilte. Berichte über Todesopfer lagen zunächst nicht vor. Unterdessen strahlte der Fernsehsender Al-Dschasira ein Interview mit einem Mann aus, der als früherer Beobachter der Arabischen Liga vorgestellt wurde. Anwer Malek erklärte darin, die Mission sei eine Farce, die Beobachter seien „zum Narren gehalten worden“.
Die Tagesschau meldete aus Syrien:
14 Tage war Anwar Malek mit der Arabischen Liga in Syrien unterwegs. Doch nicht das Ende der Gewalt beobachtete er, sondern die Machtlosigkeit gegenüber dem „bewaffneten Terror“ des Assad-Regimes. Weil er nicht länger „Erfüllungsgehilfe“ sein wollte, quittierte er den Dienst.
Nach zwei Wochen hat es Anwar Malek gereicht. Der Algerier ist einer der gut 150 Beobachter, die die Arabische Liga nach Syrien geschickt hat – besser: Er war es. Denn aus Frust über seine Erfahrungen hat Malek den Dienst quittiert. Alles Lüge, das Ganze eine Inszenierung des Assad-Regimes, zieht er persönlich Bilanz im arabischen Fernsehsender Al Dschasira.
„Mir ist klar geworden, dass ich zum Erfüllungsgehilfen des Regimes wurde und kein unabhängiger Beobachter war, der die Lage dokumentiert. Ich muss mir vorwerfen, dass ich dem Regime mehr Zeit zum Morden verschafft habe. Ich konnte das nicht verhindern. Die haben sogar ihre eigenen Leute umgebracht, um die Beobachter zu überzeugen, dass sie gegen bewaffneten Terror vorgehen müssen. Ich habe mich gefühlt wie ein Shabiha, wie einer dieser Schläger und Mörder des Regimes. Deshalb habe ich den Dienst als Beobachter quittiert.“
Auf das syrische Regime trifft die Liedzeile „The harder they come the harder they fall“ zu. AP meldet aus Syrien:
Syrische Regierungstruppen haben nach Angaben von Aktivisten das Feuer auf Teilnehmer einer Sitzblockade eröffnet und dabei einen Demonstranten getötet. Mindestens 20 weitere wurden verwundet, wie das in Großbritannien ansässige Observatorium für Menschenrechte berichtete. Der Angriff fand nach Angaben des Örtlichen Koordinationskomitees am Freitagabend in der nördlichen Stadt Sarakeb statt, wo zahlreiche Demonstranten auf dem zentralen Platz acht Tage lang campiert hatten. Beiden Aktivistengruppen zufolge eröffneten Truppen zudem am Samstag das Feuer auf Teilnehmer einer Sitzblockade in Homs. Dabei wurde mindestens ein Mensch getötet.
Die FAZ interviewte den Deutschland-Korrespondenten von Al Dschasira – Aktham Suliman:
„Wir erleben eine gesellschaftliche Explosion
Die Aufstände in Tunesien und Ägypten wurden in westlichen Medien als „Facebook-Revolutionen“ bezeichnet. Würden Sie diesen Begriff auch verwenden?
Ich habe diese Bezeichnung nie für richtig gehalten, denn Facebook und andere neue soziale Medien wie Youtube oder Twitter tragen dazu bei, Dinge zu verbreiten, Kommunikation herzustellen. Aber ob sie Revolution oder Aufstände überhaupt erst möglich machen, daran zweifle ich sehr stark. Die Französische Revolution hatte kein Facebook, die Oktoberrevolution hatte kein Al Dschazira. Ich denke, die inneren gesellschaftlichen Widersprüche in den unterschiedlichen arabischen Ländern sind das Thema. Und ich fürchte, dass wir die Analyse dieser Widersprüche hier im Westen unbewusst ausklammern, Widersprüche, die automatisch dazu führen, dass eine gesellschaftliche Explosion stattfindet, manchmal im negativen, manchmal im positiven Sinne.
Wenn nicht die jungen Internetaktivisten, wer hat die Aufstände gemacht?
In Tunesien waren und sind die Gewerkschaften sehr stark. Außerdem ist die Analphabetenrate dort sehr niedrig und das Selbstverständnis der Bürger sehr entwickelt, was die Entwicklung beschleunigt hat. In Ägypten spielten andere Faktoren eine Rolle, aber auch hier hat sich in den vergangenen zehn Jahren eine aktive zivile Gesellschaft herausgebildet – das führte zu mehr Individualisierung und einem anderen Verhältnis zum Staat als in anderen arabischen Ländern.
Welche Rolle spielte Al Dschazira?
Al Dschazira, aber auch Al Arabija hat vielen Menschen eine Stimme verliehen und das Gefühl gegeben, als Subjekte wahrgenommen zu werden. Das war vorher nicht so. Außerdem hat das Satellitenfernsehen Vergleichsmöglichkeiten angeboten – als es in Tunesien losging mit dem Aufstand, konnten das die Ägypter sehen, die Libyer, die Syrer. Das hat zu einem Ansteckungseffekt geführt.
So Partei ergriffen für die Aufständischen in Ägypten oder Tunesien wie Al Dschazira haben westliche Medien nicht.
Was übersehen wird bei der Kritik an Al Dschazira oder arabischen Politiker, ist Folgendes: Handelt es sich um eine spezifische Kritik, die Al Dschazira als arabisches Medium betrifft, oder eine breitere Kritik, die allgemeine Medienphänomene wie Agenda-Setting, einseitige Berichterstattung, die Abhängigkeit von Politik oder die Entstehung von Nachrichtenfaktoren und Feindbildern umfasst? Kommt es am Ende nicht darauf an, ob es sich ein Journalist leisten kann, seinen eigenen Chefredakteur zu kritisieren? Wenn wir über die Macht der neuen elektronischen Medien sprechen, die Überflutung durch Handyvideos, den sogenannten Bürgerjournalismus oder die mangelnde Zeit nachzudenken, trifft das in Marokko ebenso zu wie in Iran oder Frankreich. Das sind Gefahren für Journalismus weltweit. Zu sagen, nur Al Dschazira übertreibt, ist manchmal auch ein Rechtfertigungsversuch für die Zwänge, denen man selbst unterworfen ist. Ich behaupte, unsere punktuelle Berichterstattung erzeugt punktuell denkende Menschen und damit die Gefahr, dass Zusammenhänge verlorengehen.
Im Westen macht man sich Sorgen über das starke Abschneiden von Salafisten und Muslimbrüdern bei den Wahlen in Ägypten, Tunesien und Marokko.
Solange diese Kräfte wählbar und abwählbar sind, gibt es für mich kein Problem. Das fängt erst an, wenn sie nicht mehr abzuwählen wären – ganz gleich, ob es sich um Islamisten, Nationalisten oder Sozialisten handelt. Ob die gewählten Kräfte meinen persönlichen Geschmack oder den im Westen treffen, finde ich in diesem Zusammenhang unwesentlich. Schließlich geht es um Millionen von Menschen, die auf der Suche sind nach Zukunft, nach Perspektive. Sollen sie das doch ausprobieren können, Verteufeln hilft da sicherlich nicht weiter. Außerdem darf man nicht übersehen, dass dieser Trend hin zu islamistischen Kräften nicht von heute auf morgen begann, sondern ein Prozess der vergangenen zwanzig Jahre ist – mit zwei Kriegen im Irak, den Anschlägen vom 11. September und dem Einmarsch westlicher Truppen in Afghanistan. Ein Prozess übrigens, der nicht nur die arabische Welt berührt: Als ich Anfang der neunziger Jahre nach Deutschland kam, sprach man von uns noch als Arabern. Irgendwann waren wir nur noch Muslime.“
In einer Rezension des neuen Aufsatzbandes „Generation Facebook“ heißt es in der taz:
„…Die Soziologin Carolin Wiedemann entdeckt in dem sozialen Netzwerk ein System, das die Praktiken der „evaluativen Selbstbeobachtungen“ verstärkt. Schon das Ausfüllen der allerersten Onlineformulare für den eigenen Profilkatalog erscheint ihr, als handle es sich dabei um einen Lebenslauf für eine Bewerbung. Man arbeitet an sich selbst, man managt das Selbst. Und man wird dabei ständig aufgefordert, weiterzumanagen, mehr auf diese Riesenleinwand zu malen, die keine Grenzen zu haben scheint. Was Wiedemann damit sehr deutlich macht: Der Ausdruck des Ich findet innerhalb eines Programms statt, das die Ausdrucksmöglichkeiten eng begrenzt. Und sei es, dass die Kategorie Geschlecht nur als etwas Binäres gedacht werden darf. Missmut ist in dem Programm auch nicht wirklich vorgesehen. Der Daumen kann nur nach oben zeigen. Und zwei Identitäten gelten dem Facebook-Chef Mark Zuckerberg schon als ein Mangel an Integrität. So hat er das zumindest irgendwann mal gesagt. Eine Welt, in der mancher online Carl Salztal heißen möchte, obwohl in seinem Pass etwas anderes steht, möchte er sich nicht vorstellen.
Mit den Auswirkungen des starren Gedankenkorsetts, das die Programmierung dieser vermeintlich freien Leinwandfläche ausmacht, befasst sich der Netztheoretiker Geert Lovink. Es stehen eben nur ganz bestimmte Stifte und Dosen für die Wandbemalung zur Verfügung. Die Farben sind bevorzugt grell, „gespielt fröhlich, vorgetäuscht freundschaftlich, voller Eigenlob, routiniert verlogen“, so hat es die britische Schriftstellerin Zadie Smith einmal ausgedrückt. Was ist nun der Ausweg aus diesem System des „Smile or Die“, fragt Lovink, dieser „Herstellung von Wahrheit durch endloses Klicken“. Vielleicht, überlegt er, genüge als Ausweg das Bekenntnis: „Ich bin nicht, der ich bin.“ Wer den Namenswechsel im Netz akzeptiert, akzeptiert auch die Neuerfindung. Wie traurig wäre das Gegenteil: „In einem System, das darauf abzielt, den Ausbruch von Nonkonformismus zu verhindern, werden offene Persönlichkeiten und fließende Identitäten nur mit dem Gesetz in Konflikt kommen“, schreibt Lovink. Pseudonyme billigen, heißt das Verlangen, ein anderer zu werden, anzuerkennen. Lovink wird dann ein wenig sehr kulturpessimistisch und vergleicht dieses Vollfressen mit Facebook-Statusmeldungen mit dem Vollstopfen in einem FastFood-Restaurant, übles, leeres Fett. Alles sieht viel aus, ist aber am Ende erbärmlich wenig. Großes Kotzen des Autors angesichts des Konsumwahns.“
AFP berichtete aus Tunesien:
Ein arbeitsloser Tunesier hat sich am Donnerstag vor dem zentralen Regierungsgebäude in der verarmten Provinz Gafsa selbst angezündet. Er sei mit schweren Verbrennungen ins Krankenhaus gebracht worden und schwebe in Lebensgefahr, sagte ein lokaler Gewerkschafter. Der Vorfall ereignete sich während eines Besuchs von drei Ministern in der von hoher Arbeitslosigkeit geprägten Region. Der 48-jährige Vater von drei Kindern war Teil einer Gruppe arbeitsloser Männer, die vor dem Regierungsgebäude eine Sitzblockade abhielten, um damit für Arbeit zu demonstrieren. Er habe die Ministerdelegation treffen wollen, habe aber auf seine Anfrage keine Antwort erhalten, sagte eine lokale Quelle. Ein Augenzeuge erklärte, der Mann habe sich dann mit Benzin begossen und angezündet, „ohne ein Wort zu sagen“. Ein Sprecher des tunesischen Innenministeriums bestätigte die Selbstanzündung. Nach seinen Angaben versammelten sich anschließend etwa 200 Jugendliche und warfen Steine auf Einsatzkräfte. Die Selbstanzündung eines jungen tunesischen Straßenverhändlers im Dezember 2010 hatte eine Protestwelle ausgelöst, die zum Sturz des langjährigen Machthabers Zine al-Abidine Ben Ali führte. In der Folge entwickelten sich auch in zahlreichen anderen arabischen Ländern beispiellose Volksaufstände.
Aus dem Iran meldete dpa:
1. Ein iranischer Ajatollah, Lotfollah Safi-Golpaygan, hat Facebook als „unislamisch“ und die Mitgliedschaft in dem sozialen Netzwerk als „Sünde“ bezeichnet.
2. Der Iran hat dem Westen vorgeworfen, ihm eine neue Sicht auf Homosexualität aufdrängen zu wollen. „Der Westen sagt, dass die Ehe von Homosexuellen laut Menschenrechtscharta frei und erlaubt sein soll, aber wir sehen darin Sittenlosigkeit und sexuelle Krankheit“, sagte Mohammad-Dschawad Laridschani, der Leiter der Menschenrechtskommission in der iranischen Judikative.
3. Im Iran ist erneut ein tödlicher Bombenanschlag auf einen Atomwissenschaftler verübt worden. Ein Motorradfahrer habe eine Bombe an dem Fahrzeug von Professor Mostafa Ahmadi Roshan befestigt, berichtete die Nachrichtenagentur Fars. „Auf dem vom mutigen Volk des Irans eingeschlagenen Weg gibt es kein Zurück und solche teuflischen Akte der USA und Israels gegen unsere Wissenschaftler werden nicht den geringsten Einfluss haben“, heißt es in dem Statement der Atomorganisation, das von der Nachrichtenagentur Isna verbreitet wurde.
Die FAZ interviewte den israelischen Autor Yoram Kaniuk über den derzeit in seinem Land stattfindenden Kulturkampf:
„Herr Kaniuk, was ist mit Israel los? Ultraorthodoxe Juden bespucken ein kleines Mädchen. Rechtsextreme Siedler zünden Moscheen an. Und die Regierung Netanjahu erlässt in Serie Gesetze, die die Linken als anti-demokratisch einstufen. Ist ein Kulturkampf ausgebrochen?
Neu ist das alles nicht. Israel befindet sich seit 1948 im Ausnahmezustand. Wir haben einen Fehler gemacht, als wir eine Verfassung, wie in der Staatsdeklaration vorgesehen, immer wieder aufgeschoben haben – bis heute. Allerdings hatte David Ben-Gurion damals den Ultrafrommen erlaubt – seinerzeit waren das rund 400 junge Männer -, sich vom Militärdienst zu befreien und stattdessen in die Jeschiwa zu gehen, in die Religionsschule. Heute haben wir bald eine Million Ultraorthodoxe, die mit dem Staat nichts am Hut haben, außer dass sie sich von ihm finanzieren lassen. Israel ist nach seinem Selbstverständnis ein jüdisch demokratischer Staat. Aber das funktioniert nicht. Man kann entweder demokratisch oder religiös sein.
Was bedeutet es für Sie, jüdisch zu sein?
Ich liebe den Judaismus. Die meisten meiner Bücher setzen sich mit dem Judentum auseinander. Viele Rabbiner gehen mir aus dem Weg, weil ich mehr darüber weiß als sie. Aber ich fühle mich jüdisch im Sinne des „Anti“: dagegen zu sein und für soziale Gerechtigkeit einzutreten. Das Christentum entstand aus dieser jüdischen Tradition. Ebenso die Ideen von Karl Marx oder Albert Einstein. Nicht zufällig waren es Juden, die in den USA als Erste gegen die Diskriminierung von Schwarzen kämpften. Gerade weil die Juden kein Land hatten, mussten sie ihren Kopf gebrauchen. Schauen Sie, die Deutschen haben wunderbare Maschinen gebaut. Aber wir sind hundert Mal besser auf dem High-Tech-Gebiet.
Israel ist eine junge Nation. Muss sie womöglich erst noch ihre Balance finden, bevor man zu einer Lösung des Nahost-Konflikts kommt?
Der Punkt ist: Schimon Peres hat 1968 die erste Siedlung im Westjordanland gegründet, statt zu warten, bis die Araber zu Verhandlungen bereit sind. Heute haben wir eine halbe Million Siedler in den besetzten Gebieten, die mehr mit Hooligans als mit Juden in meinem Sinne zu tun haben. Und sie geben den Ton an. Was kann man bei einer solchen Mehrheit, die das Falsche will, schon tun?“
Nicht erst der Kairo-Virus hat uns alle in „Transition“ gestürzt:
„Noch fünf Jahre und überall wird Ausland sein», sagt melancholisch eine Figur in Andrzej Stasiuks Roman «Neun». Es ist bald so weit: Nach der lethargisch brutalen Selbstvergessenheit der realsozialistischen Endzeit und den Wucherungen eines ungezügelten Frühkapitalismus nach 1989 werden die öffentlichen Räume der osteuropäischen Innenstädte nun mit den immergleichen Versatzstücken aus dem Fundus eines globalen Marktes möbliert. Sie decken die Widersprüche zu und taugen ausserdem wenig als Medien einer identitätsstiftenden Erinnerung.“ (NZZ)
Es geht in „Neun“ u.a. um Pawel, ein junger Geschäftsmann, der es zu einem bescheidenen Textilhandel gebracht hat. Er erwacht eines Tages in einer Trümmerlandschaft. Der Spiegel im Bad ist zerschlagen, Tuben, Bürsten und Fläschchen liegen auf dem Boden, Kleider sind aus dem Schrank gerissen. Er verlässt seine Wohnung und fährt durch Warschau, getrieben von Unruhe und Angst. Er hat Schulden, man ist ihm auf den Fersen, er braucht Geld. Ein Freund, Jacek, an den er sich um Hilfe wendet, entgeht knapp einem Überfall und ist ebenfalls auf der Flucht.
Stasiuk erzählt diese Geschichte aus dem kriminellen Milieu so unspektakulär wie beklemmend. Ohne Kommentare, präzise wie ein allgegenwärtiges Kameraauge, begleitet er seine Protagonisten von Schauplatz zu Schauplatz: über Bahnhöfe und Magistralen, durch Industriebrachen und Hotelruinen, wilde Gärten und aufgeweichte Lehmwege, heruntergekommene Innenhöfe und schließlich auf die Dächer hoch über der Marszalkowska, wo die Verfolgungsjagd endet.
Stasiuk hat in seinem neuen Buch die poetische Ausmessung der heutigen polnischen Wirklichkeit weitergetrieben. Hinter allem, was geschieht, wartet der Stillstand. Ein träumerisches Wissen um die Vergeblichkeit jeder Fluchtbewegung durchzieht die Atmosphäre des Romans.
„Meine Leidenschaft [galt] schon immer der Geographie und nicht der Geschichte“, schreibt Stasiuk im Essay über Europa, weil die – nach Osten – offenen Räume ein «Fluchtweg» sein könnten.“
Dort ist nun auch Stasiuks allerneuester Roman „Hinter der Blechwand“ angesiedelt – im Osten als Raum für einen Fluchtweg:
Während z.B. das westdeutsche Millionärsdorf Kampen auf Sylt so arm ist, dass ihm der „EU-Fonds zur Förderung strukturschwacher Regionen“ ein neues Rathaus bauen mußte, gibt es in Mitteleuropa riesige Gebiete, die keinen einzigen Cent für ihre Weiterentwicklung brauchen! Vor einigen Jahren drehten Zoran Solomun und Vladimir Blazevski einen Dokumentarfilm: „Der chinesische Markt“ – in Budapest. Es geht darin um vier Intellektuelle aus Jugoslawien, Rumänien, Mazedonien und Ungarn, die mit dem Zerfall des Kommunismus ihre Existenz verloren haben und nun als Handlungsreisende noch einmal von vorne anfangen. Eine erzählt: „Alles brach um mich herum zusammen – es war ein Alptraum!“ Ein anderer rasiert sich jedesmal, bevor er sich wieder nach Budapest aufmacht, damit er nicht „wie ein Schmuggler“ aussieht. Auf dem Markt arbeiten 5000 chinesische Händler, aber auch z.B. ein ehemaliger Professor aus Kabul: Er verkauft dort chinesische Waren auf Kommission. Die Kleinhändler klagen: „Man muß jede Woche neu verhandeln“. Ihre großen schwarz-weißen Taschen, mit denen sie ihre Waren transportieren, nennen sie „Kühe“, weil sie so viele Menschen ernährt: die Großhändler, das Marktpersonal, Zöllner, Banken, Busfahrer…und am Ende dieser Kette auch noch sie selbst, d.h. „wenn noch etwas übrigbleibt“. Um das Risiko zu verringern, kaufen sie jedesmal alles Mögliche in Budapest ein: Lippenstifte, Mützen, Turnschuhe, Jacken, Uhren, Deosprays, Spielzeug etc.. Einem, der seinen Partisanenausweis immer bei sich hat, als Glücksbringer, gab die „Deutsche Bank“ in Sarajewo einen Kredit von 100 Euro – als Startkapital.
Und so, wie die mit dem Zug nach Berlin reisenden polnischen Kleinhändler sich in Gruppen organisierten, wobei der Älteste den Schmuggeltarif mit den Zöllnern aushandeln mußte, scharren sich die mit dem Bus regelmäßig Budapest ansteuernden Händler um ihr Buspersonal. Diese listen auf der Rückfahrt – bis zur ersten Grenze – alle mitgeführten Waren auf und verhandeln dann mit dem Zoll. Wenn es gut geht, gibt es anschließend keine Beanstandungen bei der Einzelkontrolle der „Kühe“, die jeder Kleinhändler den Zöllnern draußen noch einmal vorführen muß. Und danach wird im ganzen Bus gefeiert und gesungen. Aus gutem Grund.
Nun hat der wunderbare Wahlbeskide Andrzej Stasiuk, der ständig im Osten unterwegs ist (inzwischen bis nach Irkutsk und angeblich sogar bis in die Mongolei), einen Langzeit-Roman über zwei solche mobilen Händler veröffentlicht: „Hinter der Blechwand“. Die beiden überqueren ständig die Grenzen von Polen nach Ungarn, Rumänien, Tschechien, zur Ukraine, nach Wien und Instanbul, aber die meiste Zeit verbringen sie auf irgendwelchen Wochenmärkten in öden Grenzkäffern oder sie sitzen vor ihren Pechhütten mit Blick auf eine Tankstelle auf der anderen Flußseite und warten auf eine neue „Tour“ mit alten Textilien, machen schon mal ihren alten Lieferwagen startklar, bringen Papiermüll weg – und kassieren dafür so viel Geld, dass sie fünf Liter Benzin tanken können. Sie sind hängen geblieben, die Dörfer und Kleinstädte um sie herum haben sich entleert. Das Leben in ihnen ist zum Stillstand gekommen. Alle Hoffnung und Zukunft ist gewichen… „Das war der Refrain dieser Stadt“: ‚Es lohnt sich nicht‘.“
An einigen Ecken stehen „Men in Sportswear“ (MiS), die auf eine günstige Gelegenheit warten, dabei Bier trinken und ununterbrochen rauchen. An anderen Orten treffen sich die „Kids mit den Glatzen und abstehenden Ohren“ – auch sie warten. Einige Grenzkontrollstellen sind aufgegeben, in ihnen haben Zigeuner ihre Warenlager eingerichtet, sie tragen halbe Zolluniformen und mancher Autofahrer hält sogar an, um zu zahlen. Die Waren kommen alle aus China, bis auf die gebrauchten Textilien, Autos und Elektrogeräte, die sich aus ganz Europa hier in seinem geographischen Zentrum noch einmal versammelt haben. Und natürlich der Schnaps und die Zigaretten, die aus lokaler Produktion stammen, die Marlboros aus Moldawien.
Aber alles wirkt verblichen und verstaubt, die neue bunte Welt kommt hier einzig aus dem Fernseher. Die ganzen Billigklamotten, die gleich dazugeliefert wurden, sind nur dazu da, damit die Menschen in dieser Ostzone sich denen im Westfernsehen angleichen. Alle, die dageblieben sind, ähneln inzwischen entfernt irgendwelchen Fernsehstars, deren Gesten sie imitieren, z.B. solche, „die sie bei den Schwarzen in amerikanischen Filmen gesehen haben“. Andere geben sich laut und aggressiv, weil sie denken, „die Menschen müßten sich so verhalten, weil sich die Junkies in amerikanischen Filmen so verhielten.“ Wieder andere haben bloß eine schwere Kindheit hinter sich – und sind quasi authentisch, aber auch sie trauern den alten Zeiten – Ende der Achtziger – nach, als noch alles in Fluß war. U.a. Wladek – der „Chef“ des als Fahrer fungierenden Ich-Erzählers: „Er war der Meinung, die Vergangenheit müsse fortdauern, es gebe keinen Grund, warum sie hätte aufhören und ihn im Regen stehen lassen sollen.“ Immerhin, die beiden sind noch „in Bewegung“, jedenfalls so lange wie ihr Kleinlaster nicht vollends den Geist aufgibt.
“Die Wissenschaft ist grobschlächtig, das Leben subtil, deswegen brauchen wir die Literatur,” meinte Roland Barthes.
Dummerweise waren die Literaten völlig überfordert, als die herrschenden Bürokraten im Ostblock die Privatisierung des “Volkseigentums” zu ihren Gunsten erzwangen: Sie (re)produzierten sich dem gegenüber erst einmal nur als “heilige Narren”. In Restaurationszeiten, und darum handelt es sich derzeit weltweit, produzieren aber auch die anderen Künste und erst recht die Wissenschaften nur Seichtes. Im Maße der “Durchmarsch” der Reaktion mittels Religiosität, Nationalismus, Rassismus und Biologismus aufgrund wirtschaftlicher Krisen erlahmt, fassen jedoch langsam die Literaten wieder Mut – wenn auch immer noch in der Maske des Entertainers und Provo-Clowns. Derzeit liegen dafür mindestens drei gute Beispiele auf Deutsch vor – aus drei korrupten bzw. zerrupften Ostblock-Staaten: Zum Einen die “Hymne der demokratischen Jugend” des ukrainischen Dichters Serhij Zhadan (geb. 1974), zum anderen “Die Hunde fliegen tief” des bulgarischen Schriftstellers Alek Popov (geb. 1966) und drittens “Die Teufels-Werkstatt” des tschechischen Schriftstellers Jachym Topol (geb. 1962).
In allen drei Büchern geht es um den Wahnsinn der neuen Ökonomie, dem nun alle Menschen in diesen Ländern ausgeliefert sind. Die Protagonisten von Zhadan, Popov und Topol werden von der (west-)deutschen Kritik als “Helden der Transformationszeit” bezeichnet, als aktive “Mitspieler in einer Gesellschaft, die sie bald wieder ausspucken wird”: Schön wärs. Eher werden sie ihre “Sportswear” mit dunklen Anzügen austauschen, seriöse Geschäftsleute werden und ihre Kinder nach Harvard schicken – wie alle politischen Massenmörder, heimtückischen Gangster und sonstigen reichen Drecksäcke bisher – damit sie dort veredelt werden und als gebildete Arschlochkarrieristen keine Ahnung von den Schweinereien ihrer sie finanzierenden Eltern mehr aufkommen lassen. Marx hat diese metaphysische Metamorphose als “ursprüngliche Akkumulation” bezeichnet. Auf die Geldwäsche folgt die Kindswäsche!
In Zhadans Roman geht es um einige “Men in Sportswear”, die sich als Wachschutzbrigade verdingen, einen Schwulenclub bzw. ein Bestattungsunternehmen in Charkow eröffnen und sich dem Organschmuggel widmen. All diese Metamorphosen von Natural Born Losern bzw. Existenzgründern schildert der Autor ebenso “rasant” wie zynisch.
Auch in Popovs “Transition”-Roman überschlagen sich laut FAZ die Ereignisse: “Es ist das Wesen, die Logik des Geldes, die hier verhandelt wird, auch in Hinsicht auf ihre charakterlichen Deformationen in Gestalt von Gier, Leichtsinn, Rücksichtslosigkeit.” Die menschlichen Träger dieser Handlung sind zwei Brüder aus Sofia: der eine ging zu Hause mit einem Avantgarde-Verlag pleite und verdingt sich nun in New York als Hundeausführer, wobei er immer wieder zwischen die Fronten zweier Hundeausführer-Gewerkschaften gerät. Der andere arbeitet in einer New Yorker Unternehmensberatungsfirma, die ihn nach Bulgarien schickt, wo er die ins Stocken geratene Privatisierung eines heruntergekommenen Schwermaschinen-Kombinats in Schwung bringen soll. “Die mit ungeheuer wirkungsvollen, bisweilen regelrecht grellen erzählerischen Elementen zusammengefügte Konstruktion bricht auch unter der sich gegen Ende hin dramatisch verstärkenden Kolportage nicht zusammen,” schreibt der FAZ-Rezensent. Wohl aber bricht das Personal dieses Romans unter den Zumutungen des globalisierten Neoliberalismus reihenweise zusammen – fällt gleichsam aus dem ökonomischen und literarischen Rahmen – ins Nichts. Die zwei Brüder finden jedoch schließlich ihr kleines privates Glück. Dieses ist allerdings nur noch eine Parodie des amerikanischen Traums: “Ich fühlte mich geborgen wie in einer Rettungskapsel” – das sagen sie alle, die sich aus den wirtschaftlichen Unwägbarkeiten in eine Kleinfamilie mit 1,8 Kindern und einem Eigenheim in Kensington oder Karow-Nord gerettet haben. Dieses Floß hält aber nur bis zur dreizehnten Kreditrate, dann bricht wieder alles auseinander – und die Protagonisten beschließen, “ein neuer Mensch (zu) werden”.
“Jáchym Topol (der Sohn von Josef Topol) hat eine Gruselgroteske um ein touristifiziertes Theresienstadt geschrieben,” heißt es im “Falter”. Der Ich-Erzähler und seine Kommune-Freunde machen aus der sterbenden KuK-Garnison und Ghettostadt “eine Art Rummelplatz des Schreckens mitsamt Ghetto-Pizza-Buden und Kafka-Shirt-Verkauf”, die immer mehr “Pritschensucher” (Enkel, deren Großeltern dort von den Deutschen inhaftiert waren) anlockt. Ihr Ruhm spricht sich bis nach Weißrussland herum, wo der Ich-Erzähler dann als Gedenkstätten-Experte helfen soll, die dortigen Leichenfelder und Gedenkstätten, u.a. in Katyn, ebenfalls als touristische Destinations (Hotspots) zu entwickeln.
Im Gegensatz zur zynisch-naiven Tabuverletzung des tschechischen Autors Topols steht der rasende Monolog des polnischen Schriftstellers Michal Witkowski: “Queen Barbara”, der jedoch in Polen ähnlich aufgenommen wurde. Es geht darin ebenfalls um die neue Ökonomie und einige waghalsige “Businessmen”, die sich in Polen früher als in der CSSR zeigten, nämlich schon in den Achtzigerjahren. Die Drag-Queen “Barbara” von Witkowski ist tagsüber Betreiber einer unguten Pfandleihe. Zum Schuldeneintreiben beschäftigt er zwei Ukrainer. Wir haben es hier mit einem “Kleinganoven” und einer “Working Mom” in einer Person zu tun. “Als der freie Markt noch jung war,” so bezeichnet Stefanie Peter in ihrer FAZ-Rezension des Buches das gesellschaftliche Umfeld der Protagonisten – die oberschlesische Bergarbeiterregion. “Wie in Witkowskis Debüt ‘Lubiewo’ (2007) stellen die im katholischen Polen besonders gebeutelten Homosexuellen auch hier das Personal. Am Existenzminimum und in Randzonen der Gesellschaft lebend, entfliehen sie der Tristesse durch einen improvisierten Glamour, der mit den minderwertigsten Requisiten der neuen Warenwelt auskommt und zugleich die altpolnische Plauderei adeliger Gutsbesitzer wiederbelebt,” schreibt Stefanie Peter.
Indem die polnischen Schwulen sich bei ihren “Geschäften” der Kunstsprache des altpolnischen Adels bedienen, haben sie eine jagellonische Variante des Camp kreiert. Die mit diesem Wort – Camp” zusammengefaßte Ästhetik der zunächst angloamerikanischen Homosexuellen, die in den Sechzigerjahren entstand und sich im Dandytum eines Oskar Wilde begründet sah, begeisterte sich bereits für die Adelsauftritte einer Rita Hayworth und eines Charles de Gaulle (“A great deal of Camp suggests Empson’s phrase, ‘urban pastoral’,” so Susan Sontag). Hierzulande ging diese “Camp”-Kunst (der Wahrnehmung) fast unter, denn als sie expandierte – vor allem durch Susan Sontags Essay über “Camp”, den sie in den USA bereits 1965 veröffentlicht hatte, interessierte man sich hier – d.h. 1987 (zwei Jahre später erschien hier Susan Sontags Buch “Aids und seine Metaphern”!) – gerade für den zerbröselnden Ostblock, wo dann einige Jahre später auch die “Minderheiten” (“Jeder ist eine Minderheit!” – G. Deleuze) eine nach der anderen “Herauskamen” – angefangen mit den Zigeunern. Allein in den Jahren 1990/93 wurden so viele Bücher von Zigeunern im “ostblog” publiziert wie in den 300 Jahren zuvor nicht. Ihnen folgten die Lesben und Schwulen. Zu letzteren zählt sich Michal Witkowski. Sein in Polen als Skandal empfundener “Tuntenroman ‘Lubiewo’” machte ihn laut Klappentext des Suhrkamp-Verlags “international bekannt”. Die FAZ spricht sogar von einem “Hoffnungsträger der polnischen Literatur”. Vielleicht kommt damit nun der “Camp” quasi von hinten (aus dem Osten) über uns – in Form einer postproletarisch wiederbelebten toten slawischen Hochsprache. In der Ostberliner Moma-Korrespondenz “Kunstwerke” findet gerade eine Photo-Video-Ausstellung von u.a. schwul-lesbischer Aktionskunst statt, diese wiederbelebte jedoch bloß die Siebzigerjahre Protest-Ästhetik der “Minderheiten” in Westeuropa. Auf mich wirkte sie wie ein Déja-vu. Witkowskis Roman ist dagegen paradoxerweise etwas Neues – ein Gutsbesitz, Beutekunst?
Polishing Polish Parts
…So hieß 1987 eine Performance im jetzt abgerissenen Nationalstadion von Warschau, an der sich auch zwei Westberliner taz-Redakteure (an Schuhputzmaschinen) beteiligten – zu den Klängen der Ostberliner Punkband „Feeling B“. Nun gibt es ein Rückspiel in Berlin – und wieder heißt es: Polishing Polish Parts. Da ist zuvörderst die große Ministerialien-Ausstellung im Gropiusbau: „Tür an Tür“, die vor allem Heimatvertriebene im Rentenalter anlockt: In 19 Sälen werden dort mehr als „700 historische und zeitgenössische Exponate ausgestellt“. Der polnische Staat hat sich da nicht lumpen lassen! Und wegen der polnischen EU-Ratspräsidentenschaft 2011 hat sich auch Brüssel das erst 20 Jahre existierende „gute deutsch-polnische Verhältnis“ anständig was kosten lassen, damit auch noch für weniger repräsentative Kulturaustausch-Events gehörig was abfiel.
So moderierte die mit einem polnischen Orden geehrte Kulturwissenschaftlerin Stefanie Peter im Auftrag der „Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit“ eine Diskussion über die zwei Hauptstädte im „dynamischen Umbau“: Warschau – die reichste Stadt Polens und Berlin – die ärmste Stadt Deutschlands. Als es dabei um „Gentrifizierung“ und den Widerstand dagegen ging, war Joanna Erbel von „Krytyka Politiyczna“ (KP) in ihrem (Basis-) Element. Die KP-Gruppe betreibt Politikberatung, hat eigene Zeitschriften in Warschau und Kiew und „Clubs“ in mehreren Städten, demnächst auch einen in Berlin. Diesen stellte sie Ende Oktopber 2011 in den „Kunstwerken“ (KW), Auguststraße, vor, wo es danach thematisch vor allem um Rechtsextremismus und Sarrazinismus in Mitteleuropa ging. Das polnische Institut in der Burgstraße hatte derweil zwei Ausstellungen eröffnet – über die Dichter Jan Brzkowski und Stanisaw Dród, und in der Landesvertretung Sachsen-Anhalt eine Diskussion ausgerichtet – über „Das neue Polen: Chancen und Grenzen einer Gestaltungsmacht“. Das Periodikum der Slawisten „Osteuropa“ hatte dazu der „Denkfabrik Polen“ 392 Seiten gewidmet. In der Akademie der Künste wurden Bilder und Filme der Medienpioniere Zbigniew Rybczyski und Gabor Body sowie Installationen von Miroslaw Balka gezeigt und am 27.10. spielte dort die „Polnisch-Deutsche Ensemblewerkstatt“ Werke junger polnischer Komponisten. Für die Akademie hatte ferner Stefanie Peter in der vierten Ausgabe der „Positionen“ Texte polnischer Autoren der Gegenwart versammelt. Die Ausstellungsräume „Bethanien“ in der Kottbusser Straße zeigten parallel dazu „Contemporary Art from Poland“ – „Polish!“ genannt. Ähnliches gilt auch für das Künstlerhaus Bethanien am Mariannenplatz, wo Magdalena Ziomek-Frackowiak vom Verein „agitpolska“ in der dortigen Krypta die Ausstellung „Gute Nachbarschaft?“ kuratierte.
Diese Schau junger Künstler ist das notwendige Gegenstück zur „Tür an Tür“, weil sie die bis heute fortwirkenden bösen Aspekte in den deutsch-polnischen Beziehungen nicht umschifft, sondern geradezu gesucht hat. Da sind z.B. die lasziven Posen auf den Photos junger polnischer Frauen, mit denen diese im Internet alte deutsche Ehemänner suchen. Da ist ein Film über polnische Schlachtkaninchen, die vom polnischen „Wunderteam“ in Münster ausgesetzt wurden, um mit ihrer Anpassungsfähigkeit und Vermehrungsfähigkeit eine lebende Analogie für die nach Deutschland ausgewanderten Polen zu bilden – sie wurden jedoch sogleich von der Stadtverwaltung eingefangen – und dem Münsteraner Fleischmarkt zugeführt. Umgekehrt verdingte sich der deutsche Künstler Dietmar Schmale in Polen als Putzmann: Mit diesem „kulturellen Austausch“ kam er sogleich in die Feuilletons diverser polnischer Zeitungen. Im Gegensatz zu der Arbeit von Rafal Jakubowicz: Ansichten vom Posener VW-Werk – „Arbeitsdisziplin“ genannt, die er in der Posener Stadtgalerie ausstellen wollte. Auf Druck des VW-Werks auf die Stadtverwaltung wurden die Photos jedoch wieder abgehängt: Sie sahen – auch ohne Computerbearbeitung – zu sehr nach Auschwitz aus. Abschließend sei noch erwähnt, 1. dass all dies ohne den ebenso unermüdlichen wie unentgeldlichen „Kulturaustausch“ des vor 10 Jahren aus dem „Polenmarkt e.V.“ hervorgegangenen „Clubs der polnischen Versager“ in der Ackerstraße nicht möglich gewesen wäre, und 2. dass es zu fast all diesen gutbezahlten „Tür an Tür“-Events dicke Kataloge gibt. Wenn man die durch hat, kann man sich auf den nächsten Eventklopper – über die „komplizierte deutsch-französische Beziehung“ freuen: Sie hat den Arbeitstitel „Arsch an Arsch“.
Rechtsstaatliche Ausländerfeindlichkeit
Pigasus, die „Polish Poster Gallery“ in der Berliner Torstraße 62, ist eine Ausgliederung des Clubs der polnischen Versager. Der Laden in Berlin-Mitte gehört Joanna und Mariusz Bednarski, die dort seit 2003 polnische Plakate, Musik-CDs und DVDs von klassischen Filmen aus dem Ostblock verkaufen. 2010 schickte ihnen der Hauseigentümer eine Mieterhöhungsforderung: Statt sechs Euro sollten sie zukünftig 25 pro Quadratmeter zahlen.
Das war schon schlimm, aber kurze Zeit später, im November 2010, kam es noch dicker: Da bekamen sie eine Abmahnung vom holländischen Elektrokonzern Philips. Der hatte in ihrem Laden zehn russische Filme des Brüssler DVD-Verlags Russian Cinema Council (RussCiCo) gekauft – und dabei eine DVD erworben, die angeblich ohne Lizenzgebühr für ein Philips-Patent gepresst worden war. Dafür verlangte die vom Konzern beauftragte Anwaltskanzlei 1.700 Euro, außerdem sollte das Ehepaar Bednarski eine Unterlassungserklärung unterschreiben und alle im Laden und zu Hause liegenden DVDs – etwa 750 – herausgeben und zur Vernichtung freigeben. Diese Filme stammten von allen möglichen Vertrieben, Verlagen und Presswerken. Sie schrieben dem Philips-Anwalt in Hamburg, dass sie seit 2003 nur zwei DVDs (mit dem sowjetischen Film „Die kleine Vera“), bei denen angeblich keine Lizenzgebühr vom Presswerk bezahlt worden war, verkauft hätten: eine an privat und die andere eben an den Philips-Konzern. Außerdem hätten sie alle anderen Filmtitel von RussCiCo zurückgeschickt, damit sie überprüft werden können.
Einen Tag vor Weihnachten 2010 erschien des ungeachtet ein Gerichtsvollzieher mit einem Lastwagen und fünf Arbeitern. Er hatte eine einstweilige Verfügung vom Landgericht Hamburg dabei und nahm alle 703 DVDs im Laden mit.
Bei der Gerichtsverhandlung in Hamburg am 31. 3. 2011 machten die Philips-Anwälte dann einen Vergleichsvorschlag: Das Ehepaar Bednarski sollte 6.004 Euro zahlen, alle Rechnungen, Speditionsbriefe und Lieferscheine herausrücken, alle beschlagnahmten DVDs zur Vernichtung freigeben und keine weiteren Schritte gegen Philips unternehmen. Im Übrigen behauptete der Konzern vor Gericht, „dass er täglich große Verluste erleide wegen unserer illegalen Aktivitäten“, berichtet Joanna Bednarska.
„Wir waren mit dem Vergleich nicht einverstanden – und ich habe daraufhin recherchiert, wer bei der Herstellung unserer DVDs eventuell ein Philips-Patent verletzt hat.“ Auf der Internetseite von Philips fand sie eine Liste von DVD-Presswerken, die von Philips lizensiert wurden. Diese Firmen erstellen für jede einzelne Pressung ein sogenanntes LSCD-Dokument. „Als wir die Presswerke um diese Dokumente baten, sagten sie, das müssten die Verlage bei ihnen anfordern, und sie würden das an Philips weiterleiten. Das haben wir auch in die Wege geleitet. Aber bis heute haben wir von Philips nichts bekommen – sie seien dazu nicht verpflichtet, teilten sie uns mit.“
Dafür bekamen die Bednarskis jedoch von drei Presswerken, die etwa 95 Prozent ihrer DVDs hergestellt hatten, eine Bestätigung, dass sie die Lizenzgebühr für die Pressung ihrer DVDs bezahlt hätten. Über die restlichen DVDs informierte sie der Verlag, von dem sie stammten, in jeweils welchem Presswerk sie hergestellt worden waren. Diese Werke gab es jedoch nicht mehr.
Die gesammelten Unterlagen schickten die Bednarskis an den Philips-Konzern, „damit sie nicht unsere ganzen DVDs vernichten, die legal hergestellt wurden“. Sich gegen Philips zur Wehr setzen konnten sie nicht, da der Streitwert auf 100.000 Euro festgelegt worden war, was für die Bednarskis mehrere Zehntausend Euro Anwalts- und Gerichtskosten hätte bedeuten können: „So viel Geld haben wir nicht. Unser Jahreseinkommen beläuft sich nur auf etwa 10.000 Euro.“
Im Juni 2011 kamen einige Philips-Leute nach Berlin und prüften die beschlagnahmten 707 DVDs. 46 behielten sie ein, „die anderen bekämen wir wieder zurück, sagten sie, wenn wir 5.000 Euro Strafe zahlen, die Unterlassungserklärung unterschreiben und unserer Auskunftspflicht nachkommen würden. Im Weigerungsfall drohten sie uns ein Strafverfahren und Zwangsvollstreckung an. Also haben wir den ,Vergleich‘ unterschrieben und sie um Ratenzahlung gebeten. Danach haben wir die restlichen 660 DVDs abgeholt – und dabei festgestellt, dass die Prüfer von Philips etwa 220 kaputt gemacht hatten, sie waren damit unverkäuflich geworden.“
Zu den einbehaltenen 46 DVDs teilte Philips dem Ehepaar Bednarski mit, dass sie zwar in einem von ihnen lizensierten Presswerk hergestellt wurden, diese Lizenz sei aber im September 2010 ausgelaufen. „Wir hatten die DVDS aber bereits 2009 gekauft. Dazu schrieb uns Philips: Da das Presswerk ihnen noch Lizenzgebühr schulde, seien auch die DVDs, die ,vor diesem Zeitpunkt ohne Lizenz‘ gepresst wurden, illegal.“
Zusammengefasst: Man hat bei Pigasus eine verdächtige DVD gefunden – und dafür mussten die Ladenbesitzer insgesamt 8.000 Euro an Anwalts- und Gerichtskosten zahlen, außerdem konnten sie sieben Monate keine DVD verkaufen. Wegen der bei der Prüfung zerstörten 220 DVDs reduzierte Philips zuletzt seine Anwaltskosten in Höhe von 5.000 Euro auf 1.000 Euro – diese Summe müssen die Bednarskis nun in Raten abbezahlen. Bei dem ganzen Verfahren handelt es sich um eine Verletzung des europäischen Patents EP 0745 254. Dieses sogenannte EFM-Patent betrifft die „Kanalmodulation des Datenstroms von optischen Datenträgern“, konkret geht es dabei um einen Algorithmus.
Ob der in der Software des Presswerks gegen Zahlung einer Lizenzgebühr zur Anwendung kam, darüber klärt bei jeder Pressung einer DVD das oben genannte LSCD-Dokument auf: „Diese Unterlage bräuchten wir, um zu wissen, womit wir überhaupt handeln, es ist aber weder von Philips noch von den Presswerken, noch von den DVD-Verlagen beziehungsweise -Vertriebsfirmen zu bekommen.“ Das Hamburger Landgericht, bereits berühmt-berüchtigt für seine restriktive Einstellung zu „Diebstahl von geistigem Eigentum“, hatte sie gewarnt: Wenn sie noch einmal eine illegal gepresste DVD verkaufen würden, dann müssten sie bis zu 250.000 Euro Strafe zahlen oder bis zu zwei Jahre ins Gefängnis gehen.
Jetzt versteht man vielleicht, warum sich weltweit Millionen Menschen dafür einsetzen, dass solche oder ähnliche Algorithmen Allgemeinbesitz werden. Bei der Internetallmende Wikipedia heißt es dazu: „Algorithmen für Computer sind heute so vielfältig wie die Anwendungen, die sie ermöglichen sollen. Vom elektronischen Steuergerät für den Einsatz in Kraftfahrzeugen über die Rechtschreib- und Satzbaukontrolle in einer Textverarbeitung bis hin zur Analyse von Aktienmärkten finden sich Tausende von mehr oder minder tauglich arbeitenden Algorithmen. Als Ideen und Grundsätze, die einem Computerprogramm zugrunde liegen, wird Algorithmen in der Regel urheberrechtlicher Schutz versagt. Je nach nationaler Ausgestaltung der Immaterialgüterrechte sind Algorithmen der Informatik jedoch dem Patentschutz zugänglich, sodass urheberrechtlich freie individuelle Werke, als Ergebnis eigener geistiger Schöpfung, wirtschaftlich trotzdem nicht immer frei verwertet werden können.“ Dies war beziehungsweise ist der Fall beim Philips-Algorithmus. Das letzte Wort dazu soll deswegen das dadurch schwer geschädigte und gedemütigte Ehepaar Bednarski haben: „Unser Anwalt riet uns, diese Geschichte nicht an die Presse zu geben. Philips könnte das als eine neuerliche Geschäftsschädigung begreifen – und dann würde das richtig teuer werden.“
Ein Sprecher der Piratenpartei Berlin, um eine Stellungnahme gebeten, meinte: Der springende Punkt an der Geschichte sei der, dass der Philips-Konzern nur die eine DVD hätte einkassieren dürfen, bei der sich nach seinem Testkauf von zehn DVDs der Verdacht erhärtet hatte, dass sie ohne Lizenzgebühr für ein Philips-Patent gepresst wurde. „Die Philips-Anwälte haben da mit gerichtlicher Hilfe eine Art DVD-Sippenhaft praktiziert. Das ist so, als würde man bei einem Buchladen, der ahnungslos einen Raubdruck verkauft, gleich alle Bücher konfiszieren.“ Die Betreiber der Postergalerie Pigasus hätten auf der anderen Seite den Vergleich nicht unterschreiben dürfen.
Das Ehepaar Bednarski hat inzwischen eine Klage beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte eingereicht: Da sie nicht genug Geld haben, hätten sie keine Chance auf ein unabhängiges Gerichtsverfahren gehabt. Zudem fühlten sie sich als polnische Händler, die russische Filme verkaufen, diskriminiert – immer wieder bekamen sie zu hören: „Ja, wenn Sie mit der russischen Mafia zusammenarbeiten … Kein Wunder.“
Das Leben geht weiter – in der Galerie „Pigasus“ wird am 14.1.2012 ab 19 Uhr eine Ausstellung eröffnet: POSTERS THAT DISAPPEARED – von Łukasz Kliś, Magdalena Strączyńska, Sebastian Kubica, Tomasz Jędrzejko, Marcin Urbańczyk.
Polenmärkte
Die Polenmärkte an der 454 Kilometer langen Oder-Neiße-Grenze werden in Polen auch „Deutschenmärkte“ genannt. Zur Zeit gibt es 17 Übergänge mit je einem „Bazar“ für die „Grenzkäufer“ – vornehmlich aus Deutschland, die teilweise mit Bussen von weither anreisen. Der deutsche Verband der Lebensmittelkontrolleure zählte dort allein 460 Zigarettenhändler, die 2004 zusammen 4,2 Milliarden Zigaretten verkauften. Rund um die Polenmärkte haben sich Tankstellen, Restaurants, Autowaschanlagen und Bordelle angesiedelt. Weil die Preise sich in Deutschland und Polen angleichen, werden statt Waren immer mehr Dienstleistungen angeboten: Haarschnitte, Zahnbehandlungen, Tätowierungen, Wellness. Die Prostituierten kommen mehrheitlich aus Russland, der Ukraine und dem Baltikum. Als Verkäuferinnen auf den Bazaren und Tankstellen werden zunehmend Frauen aus Deutschland eingestellt. Die Polenmärkte entwickelten sich seit ihrer Entstehung unterschiedlich: Während in Krajnak Dolny (gegenüber von Schwedt) die neu errichtete „Markthalle“ samt Restaurants schon so gut wie pleite ist, hat sich der Bazar von Osinow Dolny (gegenüber von Hohenwutzen) inzwischen über den ganzen Ort ausgedehnt. Hierher strömten im ersten Jahr der Grenzöffnung bereits 3,6 Millionen Deutsche. Der Bürgermeister sprach von über 700 Händlern.
Den Anfang machte Adam Sablotzki, der noch vor der Eröffnung des Grenzübergangs (!) in den Hallen einer 1945 zerstörten deutschen Zellstoffabrik nahe am Fluß einen „Oder Center Berlin“ genannten Bazar einrichtete, der seitdem ständig erweitert wird – und bereits auf das zwei Kilometer entfernte Dorf überschwappte, das er dadurch gänzlich umgestaltete. Die „Schnäppchenjäger“ kommen hier zumeist aus dem 60 Kilometer entfernten Berlin: Osinow Dolny ist zu einem „Vergnügungsort der Armen“ geworden, schrieb die Berliner Zeitung. Immer wieder berichten deutsche Zeitungen über die Polenmärkte, auch für Künstler und Wissenschaftler sind sie interessant. Die „Basarphase“ sei dort schon fast wieder überwunden, schrieb z.B. der Slawist Karl Schlögel. Er ist Professor an der „Viadrina“ in Frankfurt/Oder, deren neuerrichtetes „Collegium Pollonicum“ im gegenüberliegenden Slubice nebenbeibemerkt den dortigen Bazar aus der Stadtmitte vor der „Friedensbrücke“ an den Rand gedrängt hat.
In seinem Essay „Die Geburt des Basars aus dem Zerfall“ sah Schlögel über alle wirtschaftlichen „Phasen“ hinweg – mit geradezu dichterischen Augen – das große Ganze des Neoliberalismus: Ein riesiges „Netzwerk der Warenströme, das die östlichen Städte mit der Welt draußen und das die Städte ihrerseits mit der Provinz tief im Landesinneren verbindet“. Die Menschen, die daran beteiligt sind, bezeichnete er mit dem russischen Wort „Tschelnok“ – als Weberschiffchen: „Es rast hin und her und erzeugt mit dem Faden, den es abspult, jenes Gewebe, aus dem dann der feste Stoff entsteht“. In einer russischen Untersuchung, die Schlögel zitiert, wird dieser „neue Beruf“ als „kleiner Händler – in der Regel mit Hochschulbildung“ definiert, „der die Funktionen des Staatsmonopols zur Gewährleistung der Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln und alltäglichen Bedarfsartikeln auf sich genommen hat“. Und Hunderttausende lernen dabei im Westen, daß man „’normal‘ leben und die Früchte seiner Arbeit genießen kann“. Auf diese Weise werden die Marktbesuche ihnen zu „Schulen des Lebens“, d.h. wenn man ein Leben „im Sog und im Schatten des Basars“ führt, werden „nicht Institutionen ausgewechselt, sondern eine ganze Lebensform“. Diese ist zwar nicht mehr geplant – wie im Kommunismus, sie hat dennoch eine, wenn auch schwer erkennbare „Ratio“: Sie wird nämlich (wieder) gelenkt von einer „unsichtbaren Hand“ (der Marktwirtschaft selbst), die „nicht nur stärker als die Faust jedes noch so mächtigen Diktators ist, sondern auch effizienter“, denn sie setzt sich aus der „kollektiven Intelligenz Tausender von Menschen“ zusammen – aus der Summe ihrer Handelstätigkeiten quasi.
Man merkt dem Marktbeobachter bzw. Basarbesucher Schlögel an, daß er sein Geld nicht im Kleinhandel oder gar mit Prostitution verdienen muß, ja nicht einmal als Konsument dort auftritt. Denn eine ständige und stabile Konzentration auf das, was sich lohnt, also auf die mögliche Gewinnspanne beim An- und Verkauf einer Ware, die einem an sich völlig gleichgültig ist, verblödet einen Menschen nicht nur, sondern macht ihn – besonders all jene osteuropäischen Kleinhändler „mit Hochschulbildung“, die gezwungen sind, sich für den Rest ihres Lebens am Rande der Illegalität und der Grenze durchzuschlagen – schier verrückt, d.h. mindestens depressiv. Vom Westen aus ist es unverschämt, diese massenhafte Deklassierung einfach als Zugewinn abzubuchen, während es dort eher als Weltverlust empfunden wird, in der neuen Ordnung alle Dinge in Zahlen umrechen zu müssen.
Eher neugierig ging dagegen die Politologin Agata Wisniewska vor, als sie für den Kirchentag in Schwerin 2005 eine ganze Ausstellung über „Polenmärkte“ organisierte – mit deutschen und polnischen Künstlern. Einer, Andrzej Kotula, beobachtet schon seit 16 Jahren das Treiben auf den Polenmärkten. Er begann damit auf dem ersten Markt – der noch vor der Wende in Westberlin entstand. Dieser wurde im Juni 1989 von der Polizei geschlossen – „aus zollrechtlichen Gründen“. Der Dezernent für multikulturelle Angelegenheiten in Frankfurt/Main, Daniel Cohn-Bendit, kritisierte das Verbot des Berliner Polenmarktes als „Kurzschlußhandlung“ der Politik: „Was mich sauer macht, sind diese ordnungspolitischen Sauberkeitsargumente.“ Der Berliner Senat habe die große Ausstrahlung dieses Marktes offenbar noch gar nicht zur Kenntnis genommen. Dieser Markt sei die erste realexistierende Überwindung der Mauer gewesen. Auch im Ausland habe er große Aufmerksamkeit gefunden und sei als „ein Stück neuer Ostpolitik“ angesehen worden. „Wir können doch nicht gegen die autoritäre Bürokratie des Realsozialismus wettern und dann genauso vorgehen.“ Bereits im September 1989 kehrte der Polenmarkt wieder an seine alte Stelle auf dem Potsdamer Platz zurück – mit so vielen „Handelswilligen“, dass die deutsche Presseagentur einen Monat später meldete: “ Mehrere tausend Polen haben am Samstag den Transitverkehr von und nach Berlin erheblich behindert. Die meisten von ihnen kamen nach West-Berlin, um in der Stadt mit Schwarzmarktgeschäften ihr Einkommen durch westliche Devisen aufzubessern. Auf dem sogenannten Polenmarkt wurden bereits 10 000 Polen gezählt. Am Grenzübergang registrierte die Polizei bis zum Morgen 3 900 Personenwagen und 53 Reisebusse aus Polen.“ Die Justiz reagierte darauf mit „Schnellgerichtsverfahren“.
Kurz vor der Währungsunion drehte sich jedoch die Situation um – wie der polnische Sozialrat in Berlin mitteilte: „Während hier der Polenmarkt fast leer ist, kaufen seit der Währungsunion massenhaft DDR-Bürger im billigen Polen ein.“ Das hat sich seitdem nicht groß geändert, nur dass nun mit der Angleichung der Lebensverhältnisse gleichzeitig auch immer mehr Polen in Deutschland einkaufen: in Frankfurt/Oder sorgen sie bereits für 1/3 des Umsatzes bei den Einzelhändlern, die darauf jedoch noch in keiner Weise eingestellt sind. Ihre ersten Schilder auf polnisch lauteten: „Jeder Diebstahl wird zur Anzeige gebracht“. Außerdem nehmen sie ungerne Zloty an.
Wie sich die Ostler in der Krise halten…
Angeblich kommen die Ostdeutschen besser als die Westdeutschen mit gesellschaftlichen Umbrüchen klar, weil sie bereits einen solchen durchgestanden haben. Dies trifft, wenn überhaupt, eher auf Frauen als auf Männer zu. Weil sie sich nicht so wie diese auf eine bestimmte qualifizierte Tätigkeit festgelegt haben, trauen sie sich eher zu, auch ganz andere Arbeiten zu übernehmen, wenn es nicht anders geht.
Nicht ohne Grund schickten die West-Exekutoren der Wiedervereinigung als erstes Millionen ältere Arbeitnehmer im Osten in den „Vorruhestand“. Ihnen traute man am wenigsten zu, sich der neuen Ökonomie anpassen zu können.
Die größere „Fähigkeit“ zur Flexibilität ist jedoch nicht nur positiv, denn sie besteht vornehmlich darin, sich immer wieder neuen Sachzwängen zu unterwerfen. Und tatsächlich haben viele Ostler sich durch ihren Übereifer nicht gerade beliebt gemacht bei ihren neuen Westkollegen. So kontrollieren die aus dem Osten stammenden Etagendamen in einigen Berliner Nobelhotels selbst an ihren freien Tagen die Arbeit der Zimmermädchen, besonders wenn ein prominenter Gast erwartet wird. Und bei Osram musste der Betriebsrat einmal eine Meisterin aus dem Osten rügen, weil sie ihre Mitarbeiter zu sehr gescheucht hatte. Hier setzten auch zwei Arbeiterinnen aus Friedrichshain gegenüber dem Betriebsrat durch, dass sie trotz Frauennachtarbeitsverbot zu Nachtschichten eingeteilt wurden – weil sie unbedingt das Geld brauchten. Für einen Urlaub auf Teneriffa.
So mancher Ostler stöhnt zwar an seinem neuen Westarbeitsplatz: „Nie hört der Nachschub auf!“ (Im Osten musste man dafür kämpfen, auch bei stockendem Nachschub weiter entlohnt zu werden.) Aber die meisten, so scheint es, lassen sich mehr gefallen als Westler. Etwa als es darum ging, ob man auch im Osten nach dem Vorbild Polens „Sonderwirtschaftszonen“ (SWZ) einführen sollte, warnte der DGB-Vorsitzende von Frankfurt/Oder, dadurch würden die neuen Ländern zu „Indianerreservaten“ gemacht – „ohne Rechte für die Beschäftigten“.
Dass solche oder ähnliche Stimmen Gewicht haben, ist für einige Minister in der polnischen Regierung ein Indiz dafür, dass Deutschland und speziell die ehemalige Ostzone im Gegensatz zu Polen immer noch viel zu „sozialistisch“ sei. Dabei ist das Gegenteil der Fall, wenn man dem deutschen EU-Abgeordneten Ulrich Stockmann glauben darf, der sagt: „Die meisten Merkmale einer SWZ erfüllt der Osten ohnehin schon. Eine explizit ausgewiesene SWZ würde deshalb keine nennenswerten Veränderungen bedeuten“.
In anderen Worten: In Ostelbien sind die Beschäftigten bereits weitgehend ohne Rechte. Dieses „Reservat“ hat sich jedoch zur Freude der Unternehmer längst nach Westen ausgedehnt.
Die Ersten, die ihre sozialstaatliche „Insel der Seligen“ verloren haben, waren die Westberliner. Hüben wie drüben veraltete Technologie und unterqualifizierte, störrische Arbeitskräfte, meinte Bundesbanker Thilo Sarrazin in einem Interview. Er setzt deswegen seine Hoffnungen auf eine neue „Elite“, die er aus dem Osten nach Berlin strömend sieht. Aus weiter Ferne allerdings: Er denkt dabei vor allem an „Russen“ und „Juden“.
In Russland wie in Ostdeutschland gibt es jedoch eine Gruppe, die sich auch im neuen Wirtschaftssystem als nur allzu erfolgreich erwies: die letzten Komsomol-Jahrgänge. „Wer früher karrieristisch war, der hat es auch im neuen System geschafft, schnell Karriere zu machen“, so urteilte ein Bundeswehrsoziologe über junge NVA-Offiziere.
Viele, die guten Willens waren, scheiterten aber am neuen Betriebsklima. Immer wieder hört man von Ostlern Geschichten wie diese: „Morgens haben wir im Steglitzer Betrieb erst mal in der Kantine Kaffee getrunken. Mein Kollege, auch aus dem Osten, und ich, wir waren die Einzigen, die sich unterhalten haben, alle anderen aßen stumm ihre Stullen und lasen dabei BZ. Das war schrecklich!“
Der soziale Zusammenhang war in den Ostbetrieben besser – er ließ sich jedoch nicht ohne weiteres bei der Verwestlichung erhalten. Selbst in Betrieben, in denen mehrheitlich Ostler arbeiteten, gelang es den Betriebsorganisatoren des Kapitals schnell, die gewünschte Atomisierung der Belegschaft zu erreichen. Im toyotistisch organisierten Eisenacher Opelwerk etwa wurde und wird nicht mehr in „Brigaden“, sondern in siebenköpfigen „Teams“ mit von außen eingesetztem „Teamleiter“ gearbeitet. Sie sollen durch die Selbstorganisation ihrer Arbeitspensen nebst ständigen Verbesserungsvorschlägen kontinuierlich ihr Arbeitstempo erhöhen. Zwar zieht das „Team“ mal einen mit, der verkatert ist, zu Hause Probleme hat oder einfach mal einen schlechten Tag erwischt hat. Aber jemand, der dauernd zu spät kommt oder dessen Einsatzfreudigkeit kontinuierlich nachlässt – und der so die Teamleistung drückt, wird von seinen Kollegen rausgedrängt. „Da können wir dann auch nichts mehr machen,“ meint der Betriebsrat. Eisenachs IG-Metall-Chefin beklagt sich dagegen über den Betriebsrat, weil der sich zu wenig für seine Leute einsetze.
Das „Betriebsklima“ ist im Vergleich zu früher „kälter“ geworden, kann man unterm Strich sagen. Die Ostler beklagen das immerhin noch. So etwa in den Gesprächen, die Hans-Joachim Neubauer im Berliner Gefängnis Tegel mit Inhaftierten führte. Einer, der schon in der DDR im Knast war, meinte: „Bei uns gab es früher mehr Zusammenhalt, so wie eine Verständigung über Klopfzeichen. So etwas gibt es hier auch nicht.“
Als die Bergarbeiter der Kaligrube „Thomas Müntzer“ in Bischofferode gegen die Abwicklung ihres profitablen Werkes mit einem Hungerstreik und vor der Treuhandanstalt in Berlin protestierten, wurde mit allen politischen und polizeilichen Mitteln, unter anderem mit Agents Provocateurs, versucht, die damals schnell anwachsende Organisation des Widerstands gegen die Abwicklung von DDR-Betrieben zu zerschlagen.
Der für die Bergbaubetriebe zuständige Treuhandmanager Klaus Schucht erklärte im Spiegel: „Wenn man den Widerstand in Bischofferode nicht bricht, wie will man dann überhaupt noch Veränderungen in der Arbeitswelt durchsetzen?“
Vom dem DDR-Dramatiker Heiner Müller stammt die damalige Einschätzung: „Erst mit der Wiedervereinigung ist wieder Klassenkampf in Deutschland möglich.“ Aber derartige Ansätze im Osten wurden schnell im Keim erstickt, obwohl oder weil sie durchaus von Arbeitern im Westen unterstützt wurden. Dafür wurde auf der anderen Seite der Klassenkampf von oben umso massiver forciert – bis hin zu rassistischen Argumentationen (zuletzt von Sarrazin) und der Charakterisierung von „Ostdeutschen“ als kommunistisch debilisiert, tendenziell neonazistisch beziehungsweise ausländerfeindlich verbrettert und eigentlich sowieso unbrauchbar.
Auch dies erinnert an die in „Reservate“ abgedrängten Indianer. Das begann schon gleich nach dem Zusammenbruch des Sozialismus, der im Übrigen nicht an der „Unfreiheit“, sondern an der zu großen Freiheit – im Produktionsbereich nämlich – zugrunde ging. Da empfing ein Treuhandmanager eine Gruppe von Betriebsräten in seinem Büro – und hatte die Beine auf dem Schreibtisch. Auf ihr Erstaunen hin erklärte er: „Ja, das kennt ihr noch nicht. Das ist jetzt der neue amerikanische Stil.“ Als er zurückgeduzt wurde, verbat er sich dies jedoch aufs Schärfste.
In Summa: Die Integration der Ostler, die inzwischen auch von weit hinter dem Ural kommen, hat in der hiesigen Wirtschaft zu immer demütigenderen Arbeitsverhältnissen geführt. Für die nicht in den Vorruhestand Entlassenen unter ihnen wurde ein gigantisches Umschulungswerk im Osten aufgebaut, das sich im Laufe der Zeit auch auf den Westen ausdehnte.
Der Regisseur Harun Farocki hat mehrere Jahre diese deutsch-deutsche Reeducation-Maßnahme begleitet – und daraus drei aufklärerische Filme gemacht: „Leben BRD“ (1990), „Die Umschulung“ (1995) und „Die Bewerbung“ (1997). In den dort dargestellten Bildungszentren wird den Teilnehmern unter anderem beigebracht, wie man sich richtig bewirbt. „Sie müssen lernen, sich besser zu verkaufen!“, heißt es. Es sind videogestützte Auftritts-Schulungen, in denen das wirkliche Leben geübt werden soll – für eine neue Gesellschaft, die laut Harun Farocki vollständig auf ihr Abbild hin organisiert ist.
„Angst haben alle“, sagt einer der Ausbilder in dem Film „Umschulung“. Der vom Arbeitsamt bezahlte Kursus dient denn auch zur Bekämpfung dieser Existenzangst, die inzwischen einschließlich der Umschulungskurse ganz Westdeutschland erreicht hat. Forciert wird sie noch laufend durch Kündigungen aus den nichtigsten Anlässen: Einer Supermarktkassiererin, weil sie drei Pfandbons nicht abgerechnet hat, einer Arbeiterin, weil sie sechs übrig gebliebene Maultaschen mitgenommen hat, und einem Arbeiter, weil er einige Pappen aus dem Abfall als Umzugskartons für seine Tochter mitnahm. Diese von Arbeitsgerichten juristisch abgesegneten Entlassungen zeigen, auf welchem Niveau und von wem die Klassenkämpfe seit der Wiedervereinigung geführt werden.
Die Verschweinung des Ostens
Westberlin wird von Wildschweinen aus dem Osten heimgesucht: 5000 leben inzwischen in der Stadt, 1000 wurden zum Jahreswechsel erschossen, darüberhinaus von einem der Jäger auch der Schwiegersohn. In den Kinderbauernhöfen leben außerdem noch etwa 20 Hausschweine, wovon zwei hochqualifizierte Zirkussauen sind.
Das sich von Menschen entleerende Umland wird dagegen von West-Schweinen besetzt. Im nahen Eberswalde gab es zu DDR-Zeiten den größten Fleischverarbeitungsbetrieb Europas, er beschäftigte 3000 Leute. In der dazugehörigen Mast- und Zuchtanlage wurden 200.000 Schweine jährlich aufgezogen. Lange regte man sich im Westen über diese Gigantomanie auf, nach der Wende mußte der Betrieb aus ökologischen Gründen verkleinert werden. 2000 wurde die abgespeckte Anlage mit 300 Mitarbeitern an den Megakulaken Eckhard Krone verscherbelt. Heute ist sein Schweinekonzern wieder der „größte Hersteller von Fleisch- und Wurstwaren in Brandenburg“.
Ständig wird nun aber in Ostelbien versucht, ihn zu übertrumpfen. 2006 fand dazu eine Ausstellung im Schloß Neuhardenberg statt. In der Schau „Arme Schweine“, kuratiert vom HUB-Kulturwissenschaftler Thomas Macho, ging es exemplarisch um die von einem holländischen Investor im uckermärkischen Haßleben geplante „industrielle Schweinemastanlage“. Daneben aber auch um das gesunde Schwein als „Ersatzteillager“ für marode Menschen. Dazu hieß es im Katalog: „Man rechnet im Jahr 2010 mit ersten klinischen Versuchen zur Transplantation von Schweineherzen auf den Menschen“, zuvor müssen die Tiere „genetisch manipuliert“ werden. Für die Mastanlage in Haßleben mußten die Menschen ökonomisch manipuliert werden: Vor dem 20 Fußballfelder großen Objekt standen Schilder mit der Aufschrift: „Ja zur Schweinemastanlage! Für Arbeitsplätze und sozialen Ausgleich!“ Flankiert von zwei Pappschweinen, die den Autofahrern fröhlich zuwinken. Auch zu DDR-Zeiten wurden hier schon Schweine gemästet: 146.000 Tiere jährlich – mit 800 Mitarbeitern. Im Dorf selbst gründete sich um die neue Anlage – mit 850.000 Schweinen und 54 Mitarbeitern – eine Bürgerinitiative, die sich „Pro Schwein“ nennt und eine, die „Kontra Industrieschwein“ heißt, in ihr ist auch ein Veterinär aktiv, er sagte: Die frühere Anlage war „katastrophal, da wollte keiner gerne als Tierarzt arbeiten“.
Dies galt auch für unsere mit 8.000 Schweinen kleine Anlage in der LPG „Florian Geyer“, Saarmund, wo ich zuletzt arbeitete: Es war laut und stank, jeden Morgen musste man einige tote Tiere rauskarren und eigentlich waren alle froh, als eine winzige Dorfinitiative eine Demo mit 12 Leuten vor dem Tor organisierte – woraufhin die Ämter in Potsdam die sofortige Schließung der Schweinemast verfügten – und 15 Leute ihren Arbeitsplatz verloren. 1990 konnte sich noch niemand vorstellen, dass sie vielleicht nie wieder eine Anstellung finden würden. In Haßleben geht dagegen der „Schweinekrieg“ (Bild) nun schon ins achte Jahr – und ein Ende ist nicht abzusehen. Sie wurde erst nicht genehmigt, dann im Plan abgeändert und nun sind wieder die Tischützer dran – mit Experten, Gutachten und Protesten.
Ähnlich sieht es zur Zeit in Tollenseetal aus, wo der „berüchtigte Herr Straathof“, ein holländischer Investor, der bereits eine Schweinemastanlage in Medow für 15.000 Schweine betreibt, nun „Europas größte Ferkelfabrik“ errichten will – mit 10.000 Sauen und 40 Mitarbeitern, die 250.000 Ferkel jährlich produzieren. Die lokale Bürgerinitiative schreibt: „Die Riesenanlage vernichtet Arbeitsplätze im Tourismus und ruiniert die kleinen Schweinezüchter in der Umgebung, Wohnungen und Häuser verlieren an Wert, die Lebensqualität in der Region geht verloren“. Auf einem „Sternmarsch“ war 2009 von einer „Verwurstung des ganzen Landes“ die Rede, im Jahr darauf wurde die Riesensauerei dennoch genehmigt. Aber noch ist hier nichts entschieden. Der „Freitag“ kam desungeachtet bereits zu dem Rechercheergebnis:
„Immer mehr Züchter aus Holland gründen große Schweinemastanlagen in Ostdeutschland. Hier ist erlaubt, was ihnen zuhause längst verwehrt ist – sie können viel Fleisch fabrizieren, ohne auf die Umwelt über Gebühr Rücksicht nehmen zu müssen. Gemeinden in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg sind dankbar für die Investoren und Investitionen.“ Einer hat sein „Schweine-Imperium“ bereits bis nach Tschechien und in die Ukraine ausgedehnt, sein hiesiger Verwalter meint: „Zu Hause in Holland wirst du als Schweinezüchter ständig wie ein Krimineller behandelt. Das ist in Ostdeutschland anders. Hier kannst du noch Unternehmer sein. Umweltkosten spielen keine Rolle.“ Dagegen mucken jedoch immer mehr Bürger auf. Ihnen ist inzwischen klar: „Wer Countrymusic spielen will, muss eine Menge Mist gerochen haben!“ (Hank Williams)
Aus einer Rundmail von eben:
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde,
wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass der Kunstraum Kreuzberg/Bethanien eine der Sammelstellen für die Aktion „Deutschland schafft es ab“ ist:
Der Künstler Martin Zet ruft im Rahmen der siebten berlin biennale dazu auf die Bücher von Thilo Sarrazin „Deutschland schafft sich ab“ einzusammeln:
Infos und Poster zum herunterladen: http://www.berlinbiennale.de/blog/news/„deutschland-schafft-es-ab“-–-buchsammelaktion-17483
Mit mehr als 1,3 Millionen verkauften Exemplaren ist „Deutschland schafft sich ab“ von Thilo Sarrazin das erfolgreichste Sachbuch eines deutschen Autors der Nachkriegszeit. Im Rahmen der 7. Berlin Biennale für zeitgenössische Kunst initiiert der tschechische Künstler Martin Zet die Kampagne „Deutschland schafft ab“. Er versucht, möglichst viele Exemplare des Buches zu sammeln und sich seiner so zu entledigen. „Ab einem bestimmten Moment ist es nicht mehr wichtig, was die Qualität oder wahre Intention eines Buches ist, sondern welchen Effekt es in der deutschen Gesellschaft hat. Das Buch weckte und förderte anti-migrantische und hauptsächlich anti-türkische Tendenzen in diesem Land. Ich schlage vor, das Buch als aktives Werkzeug zu benutzen, welches den Menschen ermöglicht, ihre eigene Position zu bekunden.” erklärt Martin Zet. Der Künstler ruft dazu auf mindestens 60.000 Exemplare zu sammeln, was weniger als 5 Prozent der kompletten Auflage entspricht. Die Bücher werden in einer künstlerischen Installation in der 7. Berlin Biennale gezeigt; nach Ende der Ausstellung werden sie recycelt.
Die Berlin Biennale bittet darum Exemplare des Buches in einer der teilnehmenden Sammelstellen abzugeben oder per Post in die KW zu schicken.
Die erste Sammelstelle in Berlin gibt es ab heute in den KW Institute for Contemporary Art, Auguststraße 69, 10117 Berlin-Mitte (zugänglich täglich von 10 bis 20 Uhr).
Weitere Sammelstellen in Berlin sind bisher:
– Alte Möbelfabrik | Karlstraße 12 | Köpenick
– Berlinische Galerie | Landesmuseum für Moderne Kunst, Fotografie und Architektur | Alte Jakobstraße 124–128 | Kreuzberg
– Buchhandlung Pro qm | Almstadtstraße 48–50 | Mitte
– C/O Berlin | Postfuhramt | Oranienburger Straße 35/36 | Mitte
– Freie Volksbühne Berlin | Ruhrstraße 6 | Wilmersdorf
– Haus der Kulturen der Welt | John-Foster-Dulles-Allee 10 | Mitte
– ifa-Galerie Berlin | Linienstraße 139/140, Mitte
– Kunstraum Kreuzberg / Bethanien | Mariannenplatz 2 | Kreuzberg
– Kulturnetzwerk Neukölln e.V. | Karl-Marx-Straße 131 | Neukölln
– Neuer Berliner Kunstverein (n.b.k.) | Chausseestraße 128/129 | Mitte
– Schlossplatztheater | Alt-Köpenick 31 | Köpenick
– Theater an der Parkaue | Parkaue 29 | Lichtenberg
Bisherige Sammelstellen deutschlandweit:
– Der Kunstverein, seit 1817 | Klosterwall 23 | 20095 Hamburg
– dieschönestadt | Am Steintor 19 | 06112 Halle an der Saale
– Frankfurter Kunstverein | Steinernes Haus am Römerberg | Markt 44 | 60311 Frankfurt/Main
– Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig | Karl-Tauchnitz-Straße 9–11 | 04107 Leipzig
– Hartware MedienKunstVerein (HMKV) | Hoher Wall 15 | 44137 Dortmund
– Kunstverein Hannover e.V | Sophienstraße 2 | 30159 Hannover
– Kunstverein Harburger Bahnhof | im Bahnhof über Gleis 3/4| Hannoversche Straße 85 | 21079 Hamburg
– Stiftung Bauhaus Dessau | Gropiusallee 38 | 06846 Dessau
Eine ständing aktualisierte Liste der Sammelstellen finden Sie auf unserer Webseite www.berlinbiennale.de.
Die Berlin Biennale fordert dazu auf, sich der Aktion anzuschließen und eigene Sammelstellen einzurichten. Der Transport der Bücher nach Berlin wird über die 7. Berlin Biennale organisiert.
Es geht hier alles durcheinander: Das von der CDU gegen die linken Kreuzberger Institutionen aufgebaute Zentrum „Kunstwerke“ in der Auguststraße kämpft gegen das schweinöse Buch von Sarrazin – und Sarrazin selbst geht nun argumentativ gegen seine eigene Klasse vor – die taz meldet heute:
„Sarrazin schreibt Buch über Euro-Krise“, meldete AFP gestern. Und gleich wird wieder auf den beliebten Fantasy-Autor eingeprügelt, der für sein umstrittenes Werk „Deutschland schafft sich ab“ im Jahr 2010 herbe Kritik einstecken musste. In Thilo Sarrazins neuem Buch sind diesmal nicht Ausländer, Migranten und Unterschichtler schuld an allem Elend dieser Welt, sondern die Banker, deren „Erbfaktoren“ für ihr „Versagen“ im Weltwirtschaftssystem verantwortlich sind: „Ganze Clans haben eine lange Tradition von Inzucht und entsprechend viele Behinderungen. Es ist bekannt, dass der Anteil der angeborenen Behinderungen unter den englischen und amerikanischen Bankern weit überdurchschnittlich ist. Aber das Thema wird gern totgeschwiegen. Man könnte ja auf die Idee kommen, dass auch Erbfaktoren für das Versagen von Teilen der internationalen Bankiersfamilien in der Euro-Krise verantwortlich sind“, heißt es in einem Vorabzitat. Ob Thilo Sarrazin sich damit Freunde unter der diesmal zum Abschaum erklärten Bevölkerungsgruppe macht, ist allerdings fraglich.
AFP meldet aus dem Jemen:
Bei Kämpfen zwischen verfeindeten islamischen Konfessionsgruppen im Jemensind am Donnerstag 20 Menschen getötet worden. Die Gefechte zwischen sunnitischen Salafisten und schiitischen Saiditen ereigneten sich in der nordwestlichen Provinz Hadscha, wie ein örtlicher Behördenvertreter mitteilte. Eine als Huthis bekannte saiditische Rebellengruppe kämpft seit 2004 gegen die Zentralregierung in Sanaa, der sie Diskriminierung vorwirft.
Nach Angaben des Behördenvertreters war die Stadt Mustaba nahe der Hafenstadt Midi am Roten Meer Schauplatz der Kämpfe. Auch in der Provinz Saada, in der die Rebellen besonders stark vertreten sind, habe es Kämpfe mit dem sunnitischen Waela-Stamm gegeben.
Die Salafisten treten für eine besonders strenge Auslegung des Korans ein und streben eine Rückkehr zur Lebensweise der Gefährten des Propheten Mohammed an. Die Saiditen sind eine im Jemenverbreitete Untergruppe der Schiiten. Sie schlossen sich im vergangenen Frühjahr dem Aufstand gegen Jemens langjährigen Präsidenten Ali Abdallah Saleh an, auch wenn dieser selbst ihrer Glaubensrichtung angehört.
Aus Tunesien und Algerien meldet dpa heute:
Kurz vor dem ersten Jahrestag der Revolution wird Tunesien von einer neuen Welle von Selbstverbrennung erschüttert. In der Stadt Gafsa starb nach Krankenhausangaben vom Dienstag ein 43 Jahre alter Familienvater an seinen schweren Brandverletzungen. Er hatte sich Ende vergangener Woche vor dem Sitz der Bezirksregierung angezündet, um gegen die Arbeitslosigkeit zu protestieren. Fünf weitere Selbstverbrennungsfälle wurden aus anderen Orten des Landes, gemeldet. Sie endeten allerdings ebenso wie die Verzweiflungstat eines 27-jährigen Arbeitslosen aus der südalgerischen Stadt Saida nicht tödlich. Er hatte sich nach Angaben des Online-Journals „Tout sur l’Algérie“ selbst in Brand gesteckt, weil er keinen Job fand.
Fälle wie des 43-Jährigen aus Gafsa erregen in Tunesien besondere Aufmerksamkeit, seitdem ein junger Straßenhändler im vergangenen Dezember mit seiner Selbstverbrennung landesweite Massenproteste und Unruhen auslöste. Die Verzweiflungstat in Sidi Bouzid rund 250 Kilometer südlich von Tunis rüttelte Hunderttausende Tunesier auf und führte am 14. Januar zum Sturz von Diktator Zine el Abidine Ben Ali.
Am ersten Jahrestag der Revolution soll an diesem Samstag der Opfer des Aufstands gedacht werden. Die geplanten Feierlichkeiten werden allerdings von einer äußerst angespannten sozialen Situation überschattet. Etlichen Menschen geht es seit der Revolution wirtschaftlich eher schlechter als besser. Nach den Unruhen sind im vergangenen Jahr die ausländischen Investitionen eingebrochen. Auch viele Touristen mieden das nordafrikanische Mittelmeerland aus Angst vor neuen Ausschreitungen.
Aus Jordanien meldet AFP:
In Jordanien hat sich ein Mann durch Selbstverbrennung das Leben genommen. Der 52-jährige Familienvater erlag am Dienstag seinen Verletzungen, wie die Sicherheitsbehörden in Amman mitteilten. Der Mann hatte sich demnach am Vortag im Stadtzentrum selbst angezündet und am ganzen Körper Verbrennungen erlitten. Es habe sich um den ersten Selbstmord dieser Art in Jordanien gehandelt. Seiner Familie zufolge war der Mann hoch verschuldet und hatte bereits zwei Mal zuvor aus Verzweiflung versucht, sich das Leben zu nehmen. Er musste eine 15-köpfige Familie versorgen.
Der Mann war 22 Jahre lang Angestellter im Rathaus von Amman. Im Juni wurde er in den vorzeitigen Ruhestand versetzt. Die Stadtverwaltung gab an, ihm eine Entschädigung in Höhe von umgerechnet knapp 9000 Euro gezahlt zu haben. Außerdem habe er ein Mietdarlehen in Höhe von umgerechnet rund 33.000 Euro bekommen.
Aus Saudi-Arabien meldet dpa:
Ein Foto, das den konservativen Kronprinzen Naif mit einer Frau zeigt, sorgt im islamischen Königreich Saudi-Arabienfür Aufregung. Das Foto, das am Montag von saudischen Medien veröffentlicht wurde, zeigt den Prinzen bei einem Empfang für Beamte der Gesundheitsbehörden. Die Aufnahme wurde am Montag von Saudis in sozialen Netzwerken heftig diskutiert.
Der mögliche Thronfolger schüttelt auf dem Bild einer Frau die Hand, deren Gesicht unverschleiert ist. Dies lehnen viele strenggläubige Muslime in Saudi-Arabienab.
Aus Stuttgart meldet dpa die Sicht der Kommunikations-Polizei auf die nächste Protestaktion
Die Bundespolizeidirektion Stuttgart bereitet sich auf einen weiteren Einsatz rund um das Bahnprojekt Stuttgart 21 vor. Seit Anfang 2010 bewältigt die Behörde von Peter Holzem, Präsident der Bundespolizeidirektion Stuttgart, die Dauerlage am Hauptbahnhof. Die anstehenden Abrissarbeiten erfordern einen hohen Planungs- und Koordinierungsaufwand. Die Bundespolizei geht von einem weitgehend friedlichen Verlauf der Protestaktionen aus. „Wir sind gut vorbereitet.“ so Präsident Holzem. „In den letzten Monaten erlebten wir zwar weiterhin Proteste gegen das Projekt Stuttgart 21, diese gestalteten sich aber ruhig und besonnen.“. Mehrere Hundertschaften aus der gesamten Bundesrepublik werden am kommenden Wochenende die Bundespolizeidirektion Stuttgart bei ihrem Einsatz am Hauptbahnhof unterstützen. Im Gegensatz zum benachbarten Schlosspark, ist der Südflügel eine Anlage der Deutschen Bahn AG. Für die Bundespolizei bedeutet dies, dass ihr alle Gefahren abwehrende Maßnahmen in diesem Bereich obliegen. Wichtigstes Ziel für die Bundespolizei ist die Aufrechterhaltung des Bahnbetriebes.
Letztlich wird dieses auch den an- und abreisenden Demonstrationsteilnehmern zugute kommen. Dabei wird verstärkt auf
Kommunikation gesetzt. „Bisher haben wir durch offene Kommunikation mit den Bürgern sehr gute Erfahrung gemacht. Darauf setzen wir auch in diesem Einsatz“ so Peter Holzem. Gemeint sind Kommunikationsmanager der Bundespolizei. Die mit blauen Westen gekennzeichneten Bundespolizistinnen und -polizisten sollen durch den Kontakt mit Demonstranten das polizeiliche Handeln transparent machen und so die Entstehung von Konflikten frühzeitig vermeiden. Peter Holzem ist überzeugt: „In Stuttgart sind unsere Kommunikationsmanager bereits ein fester Bestandteil unserer Arbeit geworden.“
Am Samstag gibt es in der taz eine Schwerpunktausgabe zu den arabischen Aufständen – unter besonderer Berücksichtigung der Rolle der Frau darin:
Aufbruch im Männerland
Vor einem Jahr verjagten die Tunesier ihren Diktator Ben Ali. Ihre Revolution erfasste die ganze arabische Welt. In der ersten Reihe demonstrierten, stritten und kämpften Frauen für eine gerechtere Gesellschaft und für ihre Würde. Aber was hat der Arabische Frühling ihnen gebracht?
– Sind Frauen die Siegerinnen dieses Umsturzes? SEITE 14
– Wovon träumen Frauen aus Libyen oder Saudi-Arabien? SEITE 16, 17
– Was bedeutet der nackte Protest einer Bloggerin? SEITE 19
– Welche Rolle spielt jetzt der Islam? SEITE 20
– Warum sollte man unbedingt nach Tunesien reisen? SEITE 32, 33

Die Frage „Was hat sie für die Frauen gebracht?“ stellte sich nach der russischen Revolution bereits die russische Kunsthistorikerin Fannina B. Halle – in ihren zweibändigen Werk „Die Frau in Sowjetrussland“ – das 1973 im Westberliner „Verlag für das Studium der Arbeiterbewegung“ neu herausgegeben wurde.
Fannina Borisovna Halle (geb. Rubinštejn) wurde am 26. Oktober 1881 in der litauischen Stadt Panevežys (bis zum 1. Weltkrieg russ. Ponewež im zaristischen Gouvernement Kowno) geboren. Nach dem Lehrerdiplom reiste sie nach Berlin um dort Philosophie und Germanistik zu studieren. 1907 heiratete sie einen Österreicher und erhielt die österreichisch-ungarische Staatsangehörigkeit. Nach einigen Semestern des Studiums der Kunstgeschichte in Zürich und Berlin fing F. Halle 1914 an der Wiener Universität ihre Doktordissertation zur Bauplastik von Vladimir-Suzdal zu schreiben, die 1929 veröffentlicht wurde. Diese Arbeit zählt zu den grundlegenden Beiträgen zur russischen Architektur und steht in einer Reihe mit den Forschungen von I. I. Tolstoj und N. P. Kondakov.
Neben der altrussischen Kunst gehörte auch das moderne Avantgarde-Theater zu den Interessen von F. Halle. In Wien war sie Vorstandsmitglied der Gesellschaft zur Förderung moderner Kunst, die Anfang der 20-er Jahre gegründet war. In den Zwanzigern veröffentlichte sie Abhandlungen zu Marc Chagall, Lasar Segall, Wassily Kandinsky und Paul Klee. Ihre Artikel wurden in der deutschen Zeitschrift „Der Querschnitt“ (1925) gedruckt, für welches u.a. so bekannte Persönlichkeiten wie Leonid Leonow, Lidia Sejfulina, Alexander Tairov, Larissa Reissner und Wladimir Majakowski schrieben. 1929 war sie Mitarbeiterin in der berühmten Bauhaus-Schule in Dessau. Ihr Buch „Alt-Russische Kunst“, 1922 in Berlin publiziert, war das erste Werk zu Ikonen in deutscher Sprache und wurde auch ins Französische und Italienische übersetzt.
Eine freundschaftliche Beziehung verband F. Halle mit mehreren Intellektuellen und Künstlern, so z.B. mit Wassily Kandinsky und Oskar Kokoschka, der ein Portrait von ihr zeichnete (heute in der Tate Gallery, London).
Vor und nach der Revolution besuchte F. Halle mehrmals Russland. Dort lernte sie 1911 A. I. Anisimov kennen, der ihr – nach eigenem Zeugnis – eine Ikone schenkte. Womöglich war das die großformatige Ikone der Muttergottes von Vladimir, die heute in Recklinghausen ist. Im Ikonen-Museum Recklinghausen wird ein Aufsatz A. I. Anisimovs aufbewahrt mit der Widmung auf Russisch: „Für Fanni Borisovna Halle mit aufrichtigen Grüßen des Autors. Moskau. Mai 1921). Dort wird auch A. I. Anisimovs Buch „Die vormongolische Periode der altrussischen Malerei“ (Moskau 1928) mit der Widmung „Der teuren Fanni Borisovna Halle mit herzlichen Grüßen von einem alten Freund, der diese Abhandlung verfasste. Die Buchstaben b.m. stehen für Bogomater’ [Muttergottes]. A. I. Anisimov.“
Mit der Doktorarbeit waren für F. Halle Anfang der 1920-er Jahre neue lange Reisen in das sowjetische Russland verbunden. So reiste sie zu wissenschaftlichen Zwecken 1924 dorthin mit der Unterstützung von VOKS – Allunions-Gesellschaft für kulturelle Verbindung zum Ausland. Im selben Jahr veröffentlichte F. Halle einen kleinen exklusiven Ikonenkatalog der Sammlung des ehemaligen Museums Kaiser Alexander III. in St. Petersburg. Die gesamte Auflage war für den Kreis der Freunde des berühmten Leipziger Verlags für Kunstliteratur E.-A. SEEMANN vorgesehen.
In den 1930-er Jahren begeisterte sich F. Halle für Soziologie und Publizistik, veröffentlichte neue Arbeiten zu altrussischer Kunst und zu der Rolle der Frau in der Sowjetunion. 1940 emigrierte sie in die USA und war dort Stipendiatin der Yale University. Halle hielt als erste Frau eine Vorlesung in dem Oriental Club an dieser Universität. 1946 arbeitete die Forscherin an einem Buch über den Berg-Juden im Kaukasus. F. Halle starb am 14. Dezember 1963 in New York. Ihr Archiv befindet sich im Bakhmeteff-Archiv an der Columbia University, ihre zehn russischen Ikonen ab 1957 im Ikonen-Museum Recklinghausen. (Dieser Text stammt aus: dertag.forenworld.com/viewtopic.php?f=27&t=152)
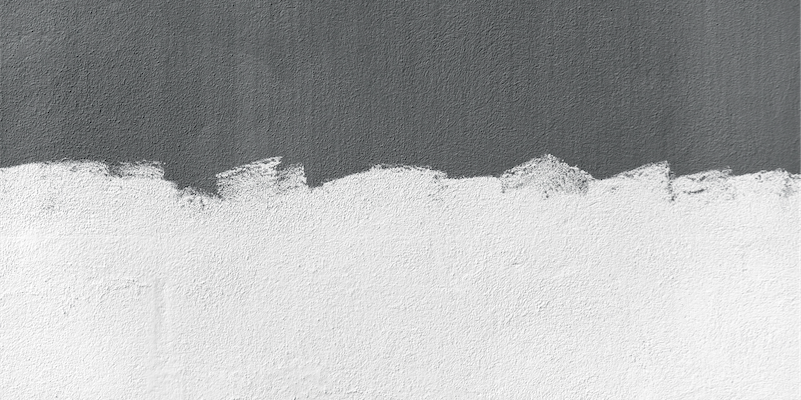



cccc