
cooperacion
Jetzt habe ich den Rosa-Luxemburg-Kongreß verpaßt. Wie konnte das geschehen? Fehlte es dem Kongreß an Werbemitteln oder habe ich sie alle übersehen?
All die Jahre hat man sich in diversen Sälen die Reden der nicht selten von kommunistischen Staaten geschickten Redner angehört, ich erinnere aber auch den Vertreter der KP der Türkei, Auslandsorganisation: „Die immer tiefer gehende Finanzkrise hinterläßt im Leben der Völker unheilbare Wunden“ und den Senegalesischen KP-Chef Ahmat Dansokho: „Der Widerstand gegen den US-Imperialismus, in Athen z.B., ist noch zu schwach. Wir müssen uns stärker verbünden.Leider ist das Netz der Globalisierungsgegner zu heterogen, dazu kommen die stalinistischen Fehlentwicklungen im Ostblock, die den Antikommunismus stärken… Wir müssen die Welt mit neuen Augen sehen!“
Auf dem Abschlußpodium saß gelegentlich auch mal ein Autonomer, ich erinnere Markus Mohr: „Brauchen wir neben der Linken eine marxistische Partei? Eher nicht.“ Jetzt hatte man Dietmar Dath eingeladen. Den hätte ich mir auch gerne angehört (da mal reingehört), dachte ich, fand dann aber in der Jungen Welt, dem Kongreßveranstalter, quasi einen Vorabdruck von Daths aktueller Denke: „Kollektivitäten sichtbar machen – Über die Organisationsfrage. Teil zwei: von Lenin bis heute“…
Was für ein West-Stuß!:
„Man erkennt Anarchisten nicht daran, daß sie es verschmähen, Lenin zu zitieren – die RAF tat das gern, hielt aber anders als jener ihre Programmatik (die Kapitalisten und ihre Handlanger müssen weg) für eine Strategie (wir bringen sie um) und diese schließlich für eine Taktik (wir tun das, wenn sich dafür eine gute Gelegenheit anbietet). Daß man im »Konzept Stadtguerilla« und den Nachfolgeschriften mehr politische Globalanalyse als beispielsweise Einordnung der eigenen Organisation in ein Geflecht von der Art findet, daß die Berufung auf leninsche Konzepte der Avantgarde und Kaderführung samt bizarrer Andreas-Baader-Mystik wenig mit »Was tun?«-Lektüre und viel damit zu tun hat, daß der Name Lenin für Zerfallsprodukte der Studentenbewegung einfach ästhetisch als das Härteste, Unumstößliche, Unbestechlichste galt, das Gegenteil also der real gerade stattfindenden Diffusion, liegt auf der Hand.
In »Was tun?« schreibt Lenin an die Adresse gewisser russischer Ultramarxisten der vorrevolutionären Zeit, sie sollten, anstatt nur Polizeiauftritte gegen Streikende für ernsthafte Probleme zu halten, lieber »alle möglichen Erscheinungen« der Unfreiheit und überhaupt des Unrechts beachten, zum Thema machen: »Die Landeshauptleute und die Prügelstrafen für Bauern, die Bestechlichkeit der Beamten und die Behandlung des ›gemeinen Volkes‹ in den Städten durch die Polizei, der Kampf gegen die Hungernden und das Kesseltreiben gegen das Streben des Volkes nach Licht und Wissen, die Zwangseintreibung der Abgaben und die Verfolgung der Sektenanhänger, das Drillen der Soldaten und die Kasernenhofmethoden bei der Behandlung der Studenten und liberalen Intellektuellen – warum sollen alle diese und tausend andere ähnliche Erscheinungen der Unterdrückung, die nicht unmittelbar mit dem ›ökonomischen‹ Kampf verbunden sind, weniger weit anwendbare Mittel und Anlässe der politischen Agitation, der Einbeziehung der Massen in den politischen Kampf darstellen? Ganz im Gegenteil: Von all den Fällen, in denen der Arbeiter unter Rechtlosigkeit, Willkür und Gewalt zu leiden hat (weil sie ihn oder ihm nahestehende Personen betreffen), sind zweifellos die Fälle der polizeilichen Unterdrückung gerade im gewerkschaftlichen Kampf nur eine geringe Minderheit. Warum also von vornherein den Umfang der politischen Agitation einengen, in dem man für ›weitest anwendbar‹ nur eines der Mittel erklärt, neben dem es für einen Sozialdemokraten andere geben muß?«1
Die Risiken der Partikularisierung, die eben nicht nur identitär-semiotische, sondern auch ökonomische Gefechte mit sich bringen, pariert Lenin mit dem Verweis auf Zugang zur Bildung, Varianten sozialer Mobilität, Zensursorgen, den man leicht ergänzen kann um Angelegentliches wie Überwachung, Rassismus, Sexismus, Homophobie, Krankenversorgung (und, um sie gruppiert, viele andere Felder, auf denen von der Arbeiterbewegung erkämpfte soziale Errungenschaften seit ihren schweren Niederlagen im späten zwanzigsten Jahrhundert auch in den liberalsten Regionen vom Staat unterm Druck der ökonomischen Gewalthaber zur Disposition gestellt werden).
Der Vorteil solcher Themen ist, daß sie nicht lokal, das heißt im ökonomisch-gewerkschaftlichen Begriffssystem: »betriebsübergreifend« interessieren – die elende, nur sehr schwer aufzuhaltende oder gar zurückzuschlagende Verbetrieblichung von Tarifauseinandersetzungen, das Verschwinden von Flächentarifverträgen, das zersplitterte Wursteln an jedem Ort, welche die Kapitalseite in jüngster Zeit auf Gebieten erzwungen hat, wo die letzten funktionierenden Großgewerkschaften ihre Jagdgründe zu vermuten gewohnt waren, sprechen da eine bedrohliche Sprache. Lenins Vorschlag ist kein bloßer menschenfreundlicher Themenkatalog, sondern ein Versuch, Kollektivitäten sichtbar zu machen, die quer zu den Gruppenbildungen liegen, welche der Produktionsprozeß, die Bildungskasernierung, die Funktionalität des vorhandenen Gemeinwesens den Leuten auferlegen; aus scheinbaren Abstrakta will er durchaus Klassenbewußtsein holen, aber eben nicht einfach eines der Facharbeiter (oder der »Opel-Arbeiter« oder etwas noch Begrenzteres), sondern der Besitzlosen – das Feilschen um den Cent, das diesem Ansinnen entgegensteht, nennt er »Handwerklerei« und nennt es einigermaßen optimistisch »nicht eine Krankheit des Verfalls, sondern eine Wachstumskrankheit«2.
Viel, aber nicht überwiegend Lustiges, hat sich geändert in der Zeit zwischen dem Erscheinen der Erstausgabe von »Was tun?« und dem Moment, da wir die Schrift zitieren. Die Arbeiterbewegung (oder was allenfalls von ihr übrig ist) hat es heute eher mit »Krankheiten des Verfalls« als solchen des Wachstums zu tun – die Geschichte, die dahin führte, ist in ihren Grundzügen bekannt, die siegreichen Gegner der Arbeiterbewegung behindern ihre Verbreitung nicht; daß sich die Niederlage bis in die entlegensten Winkel herumspricht, scheint ihnen ein Herzensanliegen. Der politische Arm dieser Bewegung, dessen Taufname »Sozialdemokratie« war, hat spätestens seit Eduard Bernstein die Vorteile der Neuorganisation seiner Politik von der Taktik her (Parlamentsarbeit, Kompromisse, Gelegenheiten) bis in die Programmatik (wir wollen, daß der Sozialismus kommt, ohne daß wir ihn durchsetzen müssen, und beschließen deshalb, fortan daran zu glauben, daß er das schon von allein tun wird) schätzen gelernt. Die Handwerklerei nach der Seite der Versöhnung zu überwinden statt nach derjenigen der revolutionären Transformation des Gemeinwesens, war ein Vorgehen, das in der berühmten Spaltung der russischen Sozialdemokratie in eine bolschewistische und eine menschewistische Fraktion historisch in ein Sinnbild faßt, an dem bessere Leute als wir verzweifelt sind (langfristig betrachtet hat sie beiden Fraktionen nicht gutgetan).
Die Gewerkschaften, ökonomischer Arm der Bewegung, erlebten unterdessen einen befremdlichen Positionswechsel, zu dem sie vielfach gelangten wie die Jungfrau zum Kind: Von einer innersozialdemokratischen »Rechten«, die den revolutionären Schwung bremst, wurde sie mancherorts unversehens zu einer Linken, die bei Strafe des Entzugs jeder Existenzberechtigung auf ein paar Minimalforderungen bestehen muß, deren Zerschmetterung durch »New Labour«, Schröders »Neue Mitte« und verwandte Tiefschläge des politischen Arms sonst beschlossene Sache wäre. Daß diese Tiefschläge überhaupt mit Aussicht auf Erfolg gewagt werden konnten, hat abermals mit dem Ende der sozialistischen Staatenwelt zu tun – in England etwa war schon zu Thatcherzeiten ein Pionierversuch unternommen worden, aber die damals aus der Labourpartei ausscheidenden rechtsopportunistischen »Social Democrats« waren zu früh gekommen; erst Blair machte ihre Träume wahr, weil der allgemeine politische Horizont der Arbeiterbewegung (ohne den die Politisierung, das Kooptieren neuer Menschen, wie wir oben gesehen haben, eine ziemlich aussichtsarme Angelegenheit ist), das Projekt »Sozialismus«, in eine schwere Legitimitätskrise gestürzt war.
Die Nützlichkeit von »Was tun?« ist im Buch selbst auf andere Art dargetan als von der Geschichte, diejenigen, die das im Buch Mitgeteilte verwarfen, fuhren in ihren jeweiligen revolutionären Situationen nicht gut damit, aber die Leninkritik Pannekoeks, Luxemburgs, Rühles war nicht allein daran festgemacht, daß in der Aufstiegsphase innerhalb der Bolschewiki zu wenig diskutiert worden sei, sondern auch am Gebrauch der dann eroberten Staatsmacht durch die Bolschewiki. Muß der aus dem alten neu zu schaffende Staat von der Partei gelenkt werden, muß sie andere Parteien verbieten? Diskutiert man das im luftleeren Raum, fällt das Allerwichtigste weg, nämlich die Unterschiede zwischen der Pariser Kommune, Chile unter Allende, Deutschland nach der Flucht des Kaisers. Lenins politisches Genie bestand darin, daß er konnte, was auch Marx konnte. Der erklärte, als die Kommune ausgerufen wurde, die Theorie sage zwar, jetzt sei dafür der falsche Zeitpunkt, aber wir machen die Theorie für die Leute, und so er die Kommune unterstützt, verteidigt und alles, was in seinen dazumal schwachen Kräften stand, dafür getan, daß sie eine Chance hatte. Umgekehrt verstand sich Lenin wie wenige aufs Zurückrudern, wenn die Lage das verlangte, vom Brester Frieden bis zur NÖP.
Cargo-Kult also betreibt, wer sagt: Wir ahmen nach den Niederlagen Lenins Politik nach, dann werden wir unbedingt Lenins Erfolge haben; solche Reden wecken den Wunsch, denen, die sich in sie werfen, ein bißchen Unterricht in ceteris paribus und totaliter aliter zu geben (der Unterricht ist eine Metapher; nichts besorgt ihn besser als die Praxis).
Je aufgabengemäß differenzierter – ganz unmetaphorisch: intelligenter – die Organisation ist, die eine Auseinandersetzung führt, desto wahrscheinlicher, daß sie richtig, sensibel und schnell reagiert, vor allem aber noch etwas anderes leistet: Tatsachen setzen, die den Gegner zwingen, zu reagieren. Die Lösung Pannekoeks und Geistesverwandter, statt auf die Partei auf die Räte zu setzen, ist also ein sympathischer Kategorienfehler (etwas Einfaches durch etwas Einfaches zu ersetzen, löst kein Problem; die Überlegung reicht an die Schwierigkeiten, die Lenin mal recht, mal schlecht gelöst hat, gar nicht heran), genau wie auf anderer Ebene Luxemburgs Ahnung, der spontane Streik (von dem sie nicht einmal überall an den einschlägigen Stellen klar sagt, ob es ein Schlüsselstellenstreik, ein Generalstreik oder was sonst sein soll) sei das entscheidende Instrument des Kampfes um die Staatsmacht.
Nicht mal Zähneputzen ist immer besser als eine Brücke, es kommt nämlich auf den Zustand der Zähne an. Immer bleibt ausschlaggebend für praktische Solidarität, ob man die richtige Ebene sieht, ob man zu abstrakt gedacht und angegriffen hat oder nicht abstrakt genug. Klandestinität und Konspiration bei einer Demonstrationsvorbereitung wider die Sicherheitszonenabsperrung um WTO-Treffen zum Beispiel bedeuten in Zeiten elektronischer Netze und Mobilfunkgeräte etwas ganz anderes als Klandestinität und Konspiration für die Erste Internationale Arbeiterassoziation, Reichweiten und Alarmzeiten müssen mit Abhör- und Sabotagerisiken verrechnet werden.
Technische Vorrichtungen befreien Personen und Organisationen von Lasten und zu neuen Funktionen; Parteien oder Gewerkschaften müssen dies und jenes heute nicht mehr leisten, was heute schon die Arbeitszusammenhänge selbst tun, können aber als programmatische Organe und Plattformen der Grundpolitisierung so wichtig sein wie ehedem. Versammlungen sind Orte, deren Auseinandersetzungen man nun mal schwerer fälschen kann als statistische Erhebungen oder andere große Datensammlungen, für die sich Netzsysteme anbieten; ein Sowjetanalogon ohne IT-Stab aber wäre heute ein schlechter Witz.
Die Polarität zwischen einerseits weltanschaulich, programmatisch, übersichtstiftend verfaßten Oppositionsgruppen und direkten Interessenvertretungen oder Bündelungen andererseits hebt all das nicht auf; sie müssen zusammengebracht werden, um die Subsumtion des Menschenlebens unter das Walten des automatischen Subjekts, den großen Geldapparat, zu brechen. Historisch, das ist das Hoffnungsstiftende am Befund, streben sie tatsächlich immer wieder aufeinander zu, haben dann allerdings auch immer wieder die Andockschwierigkeiten, die Lenin an der Relation zwischen Trade-Unionisten und Parteisozialisten expliziert hat. In der gegenwärtigen »Bewegung der Bewegungen« (Naomi Klein) gegen die profitgetriebene Weltwerdung der Welt des automatischen Subjekts findet man genügend Ereignisse, die das belegen – zum Beispiel in Seattle, 1999: Am Rande der ersten Konferenz der Wirtschafts- und Handelsminister der in der WTO vertretenen Staaten auf dem Territorium der USA fanden damals für einen winzigen Augenblick alle möglichen und unmöglichen Unzufriedenheiten mit dem Stand der Dinge (meint: dem damals in full effect über die Menschengattung hinwegrollenden Anschlag auf sämtliche Errungenschaften der Linken seit Geburt der Arbeiterbewegung, begründet mit der Notwendigkeit, die Welt passend zu machen für die Globalisierung – das Versprechen von Prosperität und Sicherheit wurde schon damals, also vor dem Krieg gegen den Terror, propagandistisch lautstark gegen Freiheit und Gerechtigkeit ausgespielt, die Ereignisse, die drei Jahre später folgten, waren schon die zweite reaktionäre Riesenwelle nach dem Ende der Systemkonkurrenz). Umweltidealisten und TRIPS-Gegnerinnen, Aids-Aktivisten, vegane Tierschützer, Studentinnen gegen Sweatshops, Anarchisten, Antiimperialistinnen und Sozialforumsleute rotteten sich zusammen, gaben Laut und lieferten sich Scharmützel mit der Staatsmacht in Gestalt der Polizei, fanden sich aber vor allem auch an der Seite von Arbeiterbewegungsresten wieder, lokal und global gerichteten sogar: Die United Steelworkers of America und von Aussperrung betroffene Streikende der Firma Kaiser Aluminium in Washington State, wenige Autostunden von Seattle entfernt, lieferten das lokale Element, das globale steuerten die Teamsters, also Transportarbeiter bei (was in der Medienresonanz zu schönen Alliterationen führte wie »Teamsters and Treehuggers unite« oder, zu sehen im nicht einmal unerträglich schmalzigen Quasi-Doku-Drama »Battle in Seattle«, »Turtles and Teamsters together« – ersteres meint bedrohte Schildkröten bzw. die Leute, die sie retten wollen).
Die »Teamsters for a Democratic Union« machten sich besonders beliebt; dabei handelt es sich um eine Reformorganisation, welche die traditionell eher nicht weltbewegend linken Mainstreamgewerkschaften der USA mittels Organizing-Methoden aufzurollen bemüht ist; sie verteidigten mit Einfallsreichtum, Hartnäckigkeit und Geschick die strategisch wichtige Gegend von Capitol Hill, einem Viertel, das von signifikanten Teilen der interracial und gay communities der Stadt bewohnt wird. Gewerkschaften drohten sogar mit Streiks für den Fall, daß die teilweise unrechtmäßig festgehaltenen Menschen, die man bei den Demonstrationen aufgegriffen hatte, nicht freikämen – es war ein Moment des Durchatmens, auf den zunächst nur ein einziges theoretisches Dokument folgte, das mit der Reichweite der Proteste (die bald anderswo ihre Fortsetzung und Ausweitung fanden, in Melbourne, Washington, Quebec, Prag, Heiligendamm …) mitzuhalten versuchte, Negris und Hardts »Empire«.
Das Buch handelt von Dingen, die wir nicht glauben: daß man das System, gegen das die Treehuggers und Teamsters sich gewandt hatten, mit Begriffen wie Staat, Institution, Organisation, Imperialismus, Kapital und so fort nicht fassen könne, daß es nicht darauf ankomme, Kämpfe zu bündeln – das Buch hat also einen Impetus, der dem des rund 100 Jahre früher erschienenen Handbuchs »Was tun?« geradezu entgegenstrebt. Kurz nachdem Lenins Arbeit erschienen war, riskierten die Russen, durchaus ohne sie gelesen zu haben, ihren ersten Revolutionsanlauf. Kurz nachdem Negris und Hardts Buch erschienen war, riskierte im Fallout der Anschläge vom 11. September 2001 die Regierung George W. Bush einen großangelegten Versuch, die Welt in entschieden gegenrevolutionärem Sinn zu verändern.“
Fußnoten:
1 Wladimir Iljitsch Lenin: Was tun? Brennende Fragen unserer Bewegung. Berlin 1984, S. 86
2 Lenin a.a.O., S. 134

Aufwärts Genossenschaften gründen!
Mich erinnerte dieser globale Rundumschlag rund um Lenin an den fliegenden Slowenen Slavoj Zizek – vor allem an seine Flugzeugtexte, die er unter dem Titel „Die bösen Geister des himmlischen Bereichs. Der linke Kampf um das 21.Jahrhundert“ immer noch halb höhenwahnsinnig zusammengefaßt hatte:
„Lenin ist offensichtlich besorgt, dass sich Gorki nicht nur eine Erkältung, sondern eine viel schlimmere, ideologische Krankheit zuzieht, wie aus dem folgenden Brief deutlich wird (der gleichzeitig mit dem vorherigen abgeschickt wurde).“
„Es gab in den sowjetischen Medien keine Schwarzbücher, keine Berichte über Verbrechen und Prostitution, (ganz zu schweigen von Arbeiterprotesten oder Demonstrationen).“
„Der stalinistische Terror der 1930er Jahre war ein humanistischer Terror. Sein Festhalten am ‚humanistischen‘ Kern schränkte den Terror nicht ein, es war seine Grundlage, die inhärente Bedingung seiner Möglichkeit.“
„Das Problem ist nicht der Terror als solcher – unsere Aufgabe besteht heute vielmehr genau darin, den emanzipatorischen Terror neu zu erfinden.“
„Im Kern entspricht Chruschtschows Antwort dem Antikriegsargument von Neill Kinnock…“
„Schostakowitsch hat nie diesen Grad des immanenten Scheiterns erreicht. Das Stück, das aufgrund seiner außergewöhnlichen subjektiven Intensität am ehesten mit Prokofjews Erster Violionsonate vergleichbar ist, ist natürlich sein Streichquartett Nr.8…“
„Was sollen wir nun mit diesen Ausführungen anfangen? Man sollte sehr präzise auf der abstrakten Theorieebene diagnostizieren, wo Mao recht hatte und wo er falschlag.“
„Das Paradox von Kants Formel ‚Denke frei, aber gehorche!‘ besteht demnach darin, daß man an der allgemeinen Dimension der ‚öffentlichen‘ Sphäre eben gerade als ein singuläres, der festen kommunalen Identifikation entzogenes oder ihr sogar entgegengesetztes Individuum teilhat.“
„Diese Verlagerung vom politischen Engagement zum postpolitischen Realen zeigt sich vielleicht am besten im Filmschaffen des Erzrenegaten Bernardo Bertolucci, von seinen frühen Meisterwerken wie ‚Vor der Revolution‘ bis zu den späten ästhetisch-spiritualistischen Selbstbefriedigungen wie dem verabscheuungswürdigen ‚Little Buddha‘.“
„Das von Theoretikern wie Claude Lefort und Jacques Ranciere ins Feld geführte Gegenargument, wonach die Form niemals eine ‚bloß Form‘ ist, sondern eine eigene Dynamik entwickelt, die Spuren in der Materialität des Soziallebens hinterlässt, ist absolut stichhaltig…“
Letzter Satz:
„Ihr habt euren antikommunistischen Spaß gehabt und er sei euch verziehen – aber jetzt ist es an der Zeit, wieder ernsthaft zu werden.“

Elektrischer Strom – durch die Kooperative
In der von Amazon vertriebenen Tiqqun-„Anleitung zum Bürgerkrieg“ heißt es an einer Stelle:
„Ich spreche vom Bürgerkrieg, um ihn auf mich zu nehmen, um ihn in Richtung seiner erhabensten Erscheinungsweisen auf mich zu nehmen. Das heisst: meinem Geschmack entsprechend… Und Kommunismus nenne ich die reale Bewegung, die überall und jederzeit den Bürgerkrieg zu zunehmend elaborierter Beschaffenheit vorantreibt.“
Die marxistische Netz-Zeitschrift „grundrisse“ interviewte den Pop-Theoretiker Diedrich Diederichsen zum ersten Tiqqun-Text „Der kommende Aufstand“:
Pascal Jurt: Nun hat es das Büchlein „Der kommende Aufstand“ sogar schon unter die Bestseller der Wiener Filiale einer großen Buchhandelskette geschafft und liegt da ein wenig verloren zwischen Elfriede Vavriks „Nacktbadestrand“ und Giovanni di Lorenzos“ Auf eine Zigarette mit Helmut Schmidt“ herum.
Diedrich Diederichsen: Ich habe in Berlin-Schöneberg in einer Buchhandlung die Szene erlebt, dass ein älteres Mütterchen in die Buchhandlung stapfte, das Buch haben wollte und es dann bereits vergriffen war. Die hatte darüber gelesen oder vielleicht ein Radio-Feature gehört. Die war, wie dann im Gespräch mit dem Buchhändler klar wurde, im Grunde genommen eine Stuttgart 21-Mobilisierte, die dachte, dass sie da ihr Buch findet.
Wofür steht dieses Manifest und worauf reagiert es?
Ich denke, der entscheidende Punkt ist, dass das Manifest die politische Kritik – oder wie immer man es nennen will – wieder anbindet an Lebensformen und zudem zwischen ‚richtiger‘ und ‚falscher‘ Lebensform unterscheidet. Im Grunde genommen geht es um das, was ich als Jugendlicher in den 1970er Jahren gemacht habe, wenn ich mit meinen Freunden, auf irgendwelchen Psychedelika, durch die Straßen gegangen bin, und wir höhnisch auf die Spießer gezeigt haben und sie ‚Plastikmenschen‘ genannt haben. Frank Zappa hat in den 1960er Jahren von den „Plastic People“ gesungen: Leute, die sozusagen manipuliert und stumpfsinnig und als Konsumidioten durch die Welt trotten. Daneben gibt es die Anderen, die versuchen, ein ‚richtiges‘ Leben zu leben und gründen Kommunen. Und auch damals haben sie Kommunen gegründet! Es ist ja auch was dran. Für jemanden, der in einem bestimmten Alter die Möglichkeit hat, auf verschiedene Weise Lebenserfahrungen zu machen, ist das vielleicht eine sehr evidente Zuspitzung, eine Form des Gefühls, dass wirklich alles falsch ist. Dies ist wieder möglich, seit sich in den empfindsamen Schichten wieder herumgesprochen hat, dass ein kreativer Beruf eben nicht die Lösung ist. Das ist das, wonach es sich am meisten für mich anhört: Man kann wieder existenzialistisch – betroffen – über Politik schreiben und ist sich qua Stil zugleich für Betroffenheit natürlich viel zu fein. Aber: Man hat eine Wahl zwischen verschiedenen Lebensformen und man wählt die richtige. Man kann in seiner Art zu leben, etwas politisch richtig machen.
Dem Versprechen, praktische Vorschläge für Subversion anzubieten, begegnet man heute ja eher selten. Ist es nicht erstaunlich, dass ein radikales Buch sich so gut verkauft?
Radikalität ist doch etwas sehr Attraktives, allein schon weil das Radikale im wirklichen Leben selten ist. Zudem ist es ein simpler, leicht einleuchtender Gedanke, dass man tiefer ansetzen muss, nicht an den Symptomen doktern, das ist intellektuelle Folklore. Das Radikale ist aber nicht zwingend politisch. Wenn es sich nur auf der Ebene der Lebensformen abspielt, ist Otto Mühls Kommune sicher sehr radikal, politisch konntest Du sie eher in der Pfeife rauchen. Ich möchte jetzt nicht nur in überlebten Schmähkategorien reden, aber man kann es fast nicht anders ausdrücken: es ist fast schon kleinbürgerlich, das politische Denken darauf hin zu schneidern, wie man damit bei sich selbst anfangen kann. Das sagt es zwar an keiner Stelle explizit, aber das ist die Attraktivität. Und das klappt oft direkt in einen reaktionären Moralismus um – ganz abgesehen davon, dass es politisch nicht hinhaut. Andererseits aber kann eine Auseinandersetzung, ein Gespräch, das zu Einstellungswechseln führen soll, gar nicht anders geführt werden als über eine solche existenzielle Ansprache. Auf irgendeiner Ebene muss das sowieso passieren. Das wäre dann aber eher Agitation oder Propaganda oder auch Pop als Analyse oder Kritik.
Aber ist das Politische des Buches nicht gerade, dass es sich jeder politischen Beteiligung zwecks Verbesserung der Zustände enthält? Geht es nicht stattdessen um Feindbestimmung?
Ja, das sehe ich auch so. Aber Feindschaft ist ja so eine individuell kleinbürgerliche Lösung des Problems, dass ich nicht weiß wohin mit meinen politischen Leidenschaften. Ich denke mir beim Fahrradfahren auch immer Schauprozesse und Standgerichte gegen SUV-Fahrer aus.
Der Protest findet wieder auf die Straße zurück, Soziale Bewegungs- und ProtestforscherInnen konstatierten für 2010 mehr Aufstände und Unruhen als 1968. Griechenland, die nordafrikanischen Ländern und jüngst auch Spanien wurden von heftigen Revolten erschüttert. Selbst in der schwäbischen Hauptstadt Stuttgart wüteten BürgerInnen angesichts eines Bahnhofabrisses. Der kommende Aufstand bezieht sich zum einen direkt auf die Aufstände in Griechenland, in Oaxaca und in Argentinien, repräsentiert aber zum anderen auch die widersprüchlichen Erfahrungen der Linken, die man auch als Krise der Linken lesen könnte.
Die Tatsache, dass es eine Fülle von Aufständen gibt und diese auch als eine Fülle und Vielfalt von Aufständen wahrgenommen werden, hat meiner Meinung auch damit zu tun, dass diese gerade nicht leicht zu vereinheitlichen sind. Das einzig Gemeinsame ist vielleicht, dass man überall auf der Welt seit 30 Jahren mit der gleichen posthistorischen Propaganda lebt; dass allen – ganz egal, was die wollen oder für Interessen haben – vielleicht nunmehr endgültig lang genug gesagt wurde, dass es keine Alternative gäbe. Das will wirklich niemand mehr hören. Die Alternativen, die die Leute je und je hören wollen, sind aber sehr verschiedene.
Ein Begriff für diese Vielheit reicht nicht aus, um der Tatsache Ausdruck zu verleihen, dass unterschiedliche Entwicklungsstadien, auch innerhalb einer globalen Situation, Ausdruck und Anlass für alle Arten von Aufständen liefern. Das ist wirklich ein neues Phänomen, das auch eine andere Vorstellung der Geschichtlichkeit von Aufständen verlangt. Man sollte den Aufstand also nicht mehr gut altmarxistisch als Zuspitzung einer bestimmten Widerspruchssituation sehen, sondern die Gleichzeitigkeit von verschiedenen Aufständen, von historischen Entwicklungsphasen in Betracht ziehen. Man muss nicht nur die Gleichzeitigkeit einer Welt wahrnehmen, in der es eine Erste und eine Dritte Welt gibt, sondern auch die Gegensätze, die im selben Stadtraum aufeinander prallen. Das ist gar nicht hoch genug einzuschätzen als Herausforderung der Beschreibung: die Simultaneität unterschiedlicher Zeitinseln, die ich nicht in eine lineare Entwicklung eintragen will.
Das finde ich einen wichtigen Punkt. Slavoj Zizek wies in einem Gespräch kurz nach dem Rücktritt Mubaraks auf Aljazeera darauf hin, dass die Bilder und Interviews aus Kairo zeigten, dass wir im Moment des Kampfs gegen die Tyrannei unmittelbar solidarisch sind, dass der Kampf um die Freiheit praktischer Universalismus ist.
Ja klar, aber der Gedanke hat auch was Tautologisches. Freiheit ist halt ein Name für erwünschte politische Verhältnisse, auf die sich sogenannte Universalismen einigen können – auf was, wenn nicht auf die Freiheit. Das Problem, dass das schon für Männer und Frauen in Ägypten etwas sehr Unterschiedliches bedeutet, ist dann das Problem dieses Universalismus.
Was die sogenannten arabischen Aufstände für mich als inspirierendes Moment haben – so blöde das klingt aus der Distanz – ist eher der Punkt, dass man eben nicht sagen kann, worum es geht. Aber deutlich sagen kann, dass es darum geht, die Bedingungen zu schaffen, um darüber streiten zu können, um was es geht. Das – finde ich – hat eine extrem utopische Note.
Im Sinne von Derridas „democratie à venir“?
Ich würde mich da nicht einmal auf Demokratie festlegen, aber „(à)venir“ auf jeden Fall. Man sollte den Rahmen offen halten, indem man einen neuen Rahmen schafft, in welchem man sagt, die Ebene, auf der bisher diskutiert wurde, ist völlig defizitär.
Eine kleine Ironie sehe ich auch noch im Titel: ist der kommende Aufstand nicht vielleicht auch eine Antwort auf, oder vielleicht eine sarkastische Antwort auf die kommende Demokratie, also auf Derridas kommende Demokratie?
Und auf die kommende Gemeinschaft von Agamben?
Mit Agamben sind sie wahrscheinlich sogar einverstanden, die kommende Gemeinschaft ist wahrscheinlich ein Endzweck des kommenden Aufstandes, während die kommende Demokratie von Derrida wahrscheinlich ein Problem ist, weil die kommende Demokratie von Derrida – was ich an der kommenden Demokratie ja schätze – eben immanentistisch vorgeht, davon dass, was immer auch passiert, was immer auch sich zum Guten oder Schlechten wendet, sozusagen aus dem Material gemacht ist, das es schon gibt. Und dass es keine Aufstände oder Ereignisse ex machina geben wird. Aber ich glaube, dass das genau der Gegensatz zwischen Agamben und Derrida ist. Jedenfalls kommt – glaube ich – auch das Kommende ein bisschen her. Man kann es ja auch so wenden, dass sie ganz punkig sagen wollen, ob Demokratie oder Gemeinschaft ist völlig egal, uns geht es nur um den Aufstand, nicht um irgendeine Teleologie.
Die Verschränkung der weltweiten Aufstände mit der Diagnose einer entfremdeten Welt ist doch aber eine interessanter Punkt?
Ich finde, das hat das nichts zu tun mit der Diagnose dieses Textes, der eine bestimmte Art von Entfremdung und Sinnverlust, Stumpfsinn und Unterworfenheit beschreibt. Die ist zwar nicht immer komplett falsch, aber sie hat nichts damit zu tun, was zwei U-Bahn-Stationen weiter passiert z.B. in den Banlieues. Ich will da nicht einfach nur auf Bürgerkinder oder Nicht-Bürgerkinder hinaus, das hat auch noch ganz andere Seiten der Unterschiedlichkeit, die nicht mit einem gemeinsam kapitalistisch entfremdeten Leben zu beschreiben sind. Mir wäre doch unter bestimmten Umständen mehr „Entfremdung“, wenn man darunter z.B. eine Versachlichung von Arbeitsverhältnissen verstehen würde, durchaus lieber als die Newspeak der sozialen Kompetenz, der soft skills und des Teamgeistes. Auch wer gegen primär patriarchal begründete Verhältnisse aufbegehrt, also u.a. mit der Analogie von Staat und Familie, möchte doch eher mehr Fremdheit – natürlich ist das nicht die Entfremdung im marxistischen Sinne, aber ob Fremdheit für dieses Verhältnis immer noch die richtige Metapher ist, wäre vielleicht auch zu bezweifeln.
Ich denke, auch der Punkt des Selbstverwirklichungs-Elends ist wichtig. Ich glaube, was jetzt auch weitestgehend allen dämmert, ist, dass die Selbstverwirklichung im kreativen Beruf an gewisse Grenzen gestoßen ist. Zum einen fällt ihr die Maske herunter, aber auch da, wo ihr nicht die Maske herunterfällt, ist sie ein knappes Gut geworden und wird durch Risiko und Stress erkauft, durch Selbst-Unternehmertum und so weiter. Das ist also einfach nicht mehr erstrebenswert und das ist natürlich eine Voraussetzung für dieses Buch, dass viele gebildete, etwas auf ihre Coolness haltende Leute sich nicht mehr wie in den letzten 25 Jahren nach dem Ende der großen politischen Hoffnung darauf freuen können, als Künstler und Künstlerinnen ihr Auskommen zu haben – oder als Designer.
Der andere Punkt, die Enttäuschung der Linken, finde ich wiederum eine größere Sache, weil die Generation, die jetzt unmittelbar davon angesprochen ist, nicht mehr – über generelle Gesinnungsfragen hinaus – erlebt hat, dass die Linke eine realpolitische Option ist – anders als der ältere Herr, mit dem ich heute im Wartezimmer ins Gespräch kam, der mir erzählte, wie in seinem Leben die Gewerkschaften bis 1969 jedes Jahr etwas Neues erkämpften, dann bis in die mittleren 80er noch ganz gut im Geschäft waren und seitdem jedes Jahr eine Errungenschaft preisgeben. Diese Enttäuschungen kennt die aktuelle 20 bis 35jährige Generation gar nicht. Und die, die eine linke Vergangenheit haben, die an irgendwelchen linken Niederlagen lebensgeschichtlich und auch existentiell beteiligt sind, werden – glaube ich – von dem Buch nicht angesprochen.
Das Manifest ist doch für junge Menschen, die trotz ihres akkumulierten kulturellen Kapitals weit von den Privilegien entfernt sind, in deren Genuss ihre Eltern im goldenen Zeitalter der immerwährenden Prosperität noch kamen, sehr attraktiv.
Diese Analyse ist mir fast schon zu triftig, sie stellt das Ganze auf eine zu breite Basis. Attraktiv ist dieser Text doch nur für einen wiederum doch sehr kleinen Teil von Leuten. Nämlich da, wo ein bestimmtes künstlerisches Wissen und eine bestimmte künstlerische Sensibilität in Verbindung mit dem Moralisch-im-Recht-Sein wichtig genommen werden. Also, wo ganz dandyistisch das Recht-Haben ein ganz bestimmtes sprachliches Kleid trägt. Das ist natürlich den meisten politisierten jungen Leuten relativ egal, um nicht zu sagen hinderlich. Das würde sie abstoßen und irritieren, wenn plötzlich jemand auf Stil Wert legte. Wenn sich Studierende an einer Hochschule über den Bologna-Prozess aufregen und zusammentun, gibt es zunächst niemanden, der Stilkritik übt.
Wen adressiert also das Buch letztendlich? Ist das Offene das Erfolgsrezept des Buches?
Wenn man versucht, den Nutzwert zu beschreiben, dann sind es wenige Leute, die so etwas wie dandyistische Linksradikale sind. Ich kann mich in deren Position gut einfühlen, aber das ist eine verschwindende Minderheit und es sind zumeist auch noch Leute, die stolz darauf sind, sich selbst etwas ausgedacht zu haben und sich nicht anderer Leute Aufstände anschließen. Ich glaube, dass eben dieses existenzialistische Denken, das davon ausgeht, dass sich durch Lebensstil oder Lebensformen etwas lösen lässt, einfach so ein wahnsinnig geiles Versprechen ist, dass da sozusagen alle Schranken fallen. Das finden auch Leute gut, die gar nicht unbedingt Revolutionäre werden wollen. Das finden Leute gut, die noch vor zwei Tagen beim Yoga oder beim Kieser-Training ihre Probleme gelöst haben und die auch jetzt nicht Linksradikale oder Revolutionäre werden wollen. Aber die einfach aus dieser Verbindung heraus die Inspiration nehmen, „Ja, da kann man vielleicht auch andere Verbindungen herstellen“. So funktioniert auch die Hermann-Hesse-Lektüre. Man bekommt irgendwie gesagt, wenn man nur auf seine innere Stimme höre und das übertrüge … So funktioniert das, glaube ich. Und außerdem kommt noch dazu, dass diese Art von Linksradikalismus nicht so angstbesetzt ist. Niemand bekommt das Gefühl, morgen muss ich mit einer Kiste Molotow-Cocktails in meinem Transporter irgendwo vorfahren. Sondern, dass es eben eine Sache der Einstellung, der Lebensformen sei. Und das ist einfach jenseits der Zielgruppe „Linke“ attraktiv.
Es gibt aber inzwischen in Frankreich und Italien, aber auch in der französichsprachigen Schweiz eine beträchtliche Szene des Insurrektionalismus, die starken Einfluss auf die Szenen in den Krisenländer Portugal, Spanien und Griechenland hat.
Klar, das ist sozusagen der besser informierte Rand der aktuellen Wut. Allerdings reagieren diese Leute ja auf sehr viel massiver materiell spürbare Folgen einer kapitalistischen Großkrise als die eher auf die Verblödung der Plastikmenschen und die Warenförmigkeit des Junge-Mädchen-Verhältnisses reagierenden unsichtbaren Aufständler. Neu ist ja, dass im Moment wirklich angezeigt ist und auch erwartet werden kann, dass etwas Drittes an die Stelle der etablierten Künstler- und Sozialkritiken tritt, die man dann nicht mehr gegeneinander ausspielen können wird.
Das Buch lag auf englisch schon recht früh in den Kunst-und Theoriebuchhandlungen aus. Semiotext(e) brachte das Buch – nach der französischen Orginalausgabe – im August 2009 als erster Verlag auf englisch in einer Reihe des MIT heraus. Gibt es im Feld der Kunstproduktion nun wieder eine positive Bezugnahme auf Handlungsmöglichkeiten jenseits von Projektarbeit?
Kunst, die glaubt, unmittelbar Politik zu sein (statt: politisch zu sein), hat noch nie funktioniert. Wenn man überhaupt mit einer Ontologie der Kunst arbeitet, kauft man die Trennung der Sphären mit ein, was seine Vor- und Nachteile hat. Eine Zeit lang fand ich ja, dass Kunst so wahnsinnig sozialpragmatisch geworden ist, dass der reale Aktivismus keine andere Chance mehr hatte als sie an Radikalität zu überbieten. Manchmal denken Leute, die sich KünstlerInnen nennen, politisch pragmatischer als die AktivistInnen.
Die Tagung „The Idea of Communism“ in London und an der Berliner Volksbühne adressierte vor allem Künstlerinnen. Wird der Begriff Kommunismus neuerdings auch für dieses Milieu interessant?
Man hat wieder vergessen, wie tief dieser Name diskreditiert war, als 1989 in Bukarest gut aussehende RebellInnen riefen, sie wollten nie wieder Kommunismus. Als Denkmöglichkeit des Nicht-Privateigentums, der Nicht-Eigenschaften begrüße ich das, ich denke, es gibt eine reichhaltige intellektuelle Geschichte des Kommunismus, die das erlaubt. Mich stört allerdings an den prominentesten zeitgenössischen Autoren, die sich auf diesen Namen berufen, dass sie das eher um einer Liebe zur Poesie des Schroffen, des Unversöhnlichen heraus tun – als um etwas neues Altes zu denken.
Am Anfang des Manifests steht die fulminante Abrechnung mit dem Individuum, eine fast schon negativ anthropologisch Diagnose des Leidens des Ichs im Hier und Jetzt. Der Text argumentiert aber nicht klassisch kulturpessimistisch, sondern erinnert auch ein wenig an Alain Ehrenburgs Idee vom „erschöpften Selbst“.
Ja, wobei es im Fall Ehrenburgs Diagnosen sind, die er ganz sachlich vornimmt. Er macht das geradezu unpolitisch und manchmal erlaubt er sich einen Gedanken in Richtung Kulturpessimismus, aber das ist bei ihm kein zusammenhängendes Programm. Ich finde auch, dass das Manifest nicht klassisch kulturpessimistisch ist, sondern eben, dass es sozusagen die Untergangsvisionen sind, die eher Zappa 1966 hatte. Es kommt mir so vor wie die ersten beiden Alben der Mothers of Invention, was dort geredet wird, auch das in den Sarkasmus immer wieder hinein brechende Pathos. Das ist ein typisches Merkmal. Zappa lässt in der Anklage an die „Plastic People“ die Eltern, die unter Schminke ihrem Alkoholismus frönen, ihr falsches Leben leben. Der Ton ist sarkastisch, alles ist Satire und schrille Kleider. Und dann kommen dazwischen so Zeilen, wie „Ever told your kids you’re glad that they can think?“ Da gibt es dann plötzlich so ein unglaublich pathetisches Moment. Ich glaube, es handelt sich hier auch um diese Art der Verwünschung des Bestehenden. Das ist in der Tat kein klassischer Kulturpessimismus. Der klassische Kulturpessimismus sitzt ja eher in der Hotelbar und schaut sich das alles an, ist alleine und will keine Kommunen gründen.
Was meinst Du damit?
Ich finde, der klassische Kulturpessimist ist ein Hendrik de Man, ein Ernst Jünger nach ’45. Das ist so das Modell, das Lutz Niethammer sehr gut in seinem Posthistoire-Buch beschreibt. Der klassische Kulturpessimist ist jemand, der eine Hoffnung hatte in irgendeine Umwälzung und erlebt hat, wie diese gescheitert ist. Das gibt es bekanntlich auch reichlich bei alten Linken und 68ern. Dieses Wissen um das Scheitern hat er als seine Legitimationsstrategie für sein weiteres Leben entwickelt.
Sicher stand aber Debords Kulturpessimismus auch Pate beim Manifest?
Ja, der späte Debord ist ja auch verdammt kulturpessimistisch. Diesen Kulturpessimismus finde ich auch ein Problem bei diesem Text, vor allem ein stilistisches, da Debords Kulturpessimismus sich ja so in der Sprache widerspiegelt. Dieser Sprache des Imperfektes, dieses zurückschauenden Imperfektes – die imitieren sie ja ziemlich genau.
Man hört stark auch den mittleren Debord der Lukács-Phase.
Aber noch mehr – ich kenne ja die klandestinen Verhältnisse hinter diesem Buch nicht, ich kenne nur verschiedene Gerüchte – noch viel mehr in Reinkultur findet man das im Film „Get rid of yourself“ von der Bernadette Corporation. Da spricht ein Typ, von dem ich annehme, dass er dieses Buch geschrieben hat, weil er sehr, sehr ähnlich redet. Und der hat 2001 diesen Debord geradezu bauchrednerisch drauf. Das ist der reine Debord. In der Zwischenzeit – das ist meine These – hat er noch etwas erlebt und etwas gelesen und jetzt ist es nicht mehr ganz so nahe dran. Dieses 2001-Manifest ist totaler Debord und hat auch offen kulturpessimistische, über Debord hinaus gehende Passagen, wo von untergehender Zivilisation die Rede ist, wo es dann nicht mehr nur um den Kapitalismus geht, sondern um „das Abendland“, um „den Westen“ .
Dort sehe ich dann wieder eine Verbindung zu Alain Badiou. Der geht dann auch wieder zurück bis ins frühe Griechenland. Der Film bringt das miteinander in Verbindung. Auch damals ist schon vom Kommunen-Gründen die Rede. Das ist wirklich schon ziemlich ähnlich. Und der Film bringt dieses Kommune-Gründen in Verbindung mit so Dingen wie der Factory in New York oder eben auch Brandschatzen in Genua.
Das Buch besteht ja aus zwei Teilen. Einem zeitdiagnostischen Teil und einen sehr konkreten praktischen Teil. Was hälts Du vom zweiten Teil, der Anleitung zur Praxis? Anleitungen zur Praxis werden eh nie gelesen wie Anleitungen zur Praxis.
Das ist einfach eine Textform. „Do it! Scenarios of the Revolution“ von Jerry Rubin hat auch niemand nachgebaut. Das ist halt nur so eine Textform.
Ich finde, dass dieser Aspekt von Texten nicht uninteressant ist und nicht völlig falsch. Ich finde nur, das mit Politik zu verwechseln, ist ein Problem. Und ich finde auch die Empfehlung, wie man zu leben hat, anmaßend und Käse.
Woran ich mich auch erinnert fühlte, das war Seth Prices Text „How To Disappear in America“, diese Anleitung zu verschwinden. Also wie kann man sich sozusagen aus Datennetzen komplett befreien, wie kann man wirklich unsichtbar werden. Das ist ein toller Text, der das auch als praktische Anleitung beschreibt, aber dem natürlich kein Mensch folgt. 99 von 100 Lesern sind davon fasziniert, aber nicht, um es nachzumachen. Die Textform der Anweisung, die Textform des praktischen Vorschlages ist einfach ein forciertes realistisches Schreiben. Das ist ein weiterer literarischer Trick.
Während im bürgerlichen Feuilleton der glänzende Stil, die poetische Qualität und die konzise Gegenwarts-Beschreibung gerühmt wurde, attestierte die linksliberale (taz) und linke Presse (Jungle World) dem Buch teilweise reaktionäres Gedankengut und ordnete den Kommenden Aufstand als antimoderne Hetzschrift ein.
Es gibt elitäre und aktionistische Komponenten in dem Buch, die ich vielleicht für kompatibel mit rechten Ideen von direkter Aktion halten würde, aber nur wegen Schmitt-Dropping ist man natürlich nicht rechts, da stimme ich der Kritik in der taz nicht zu. Allerdings auch nicht dem Verriss dieser Kritik durch den ansonsten sehr geschätzten Cord Riechelmann in der Jungle World, dem die Bauchschmerzen gegenüber dem Manifest zu „sozialdemokratisch“ waren. Aber es gibt natürlich Berge von Linken, auch sozialdemokratischen Linken wie Chantal Mouffe, die produktiv mit Schmitt arbeiten. Dann gibt es aber auch tatsächlich die, da denke ich dann an Autoren wie Agamben, die mit Schmitt arbeiten und mit anderen rechten Autoren und dabei auch nicht unbedingt rechts werden, aber so in einen radikalen Formalismus abdriften, dass es schon problematisch wird. Vor allem, wenn darauf dann eine Gesellschaftskritik aufgebaut wird, die nur bestehen kann, wenn sie sich als Zivilisationskritik geriert, die die Leute überall fundamental falsch leben sieht.
Diese Art der Zivilisationskritik ist ein rechter Topos?
Ich weiß nicht, ob es ein rechter Topos ist, aber ein fieser: wenn sogar Robert Kurz einmal zustimmend Ernst Jünger zitiert mit dem Beispiel, dass er das Rumgerase auf Motorrädern den Gipfel von Entfremdung findet – und wenn anhand von solchen Beobachtungen bildungsbürgerliche Gemütsmenschen den jungen Leuten ihr sinnloses Treiben als Zivilisationsschaden ausreden wollen oder, wie bei Agamben, mit Heidegger die Diagnosemaschine angeworfen wird, da hört’s bei mir auf. Mein Zivilisationsschaden gehört mir. Auch und gerade im Kommunismus, bitte!
Ich finde die Bezugnahme auf die Riots in den Banlieues interessant. Die Abgehängten der Banlieues wollen sich nicht eingliedern lassen, genausowenig wollen sie sich den etablierten Instrumenten der Repräsentation beugen. Die Linke ist bisher – was die Aufstände der Banlieues betrifft – ziemlich sprach- und ratlos geblieben.
Ich bin mir nicht so sicher, ob ich diesen Gedanken teile. Mir ist das ein Tick zu spontaneistisch. Ich denke, in der Politik jedweder Art gibt es immer ein Element einer Repräsentation. Natürlich gibt es auch immer eine berechtigte Kritik an Repräsentation und Abschaffung von Repräsentation. Aber das Verhältnis von Repräsentation und Intensität wird man nicht in eine Richtung auflösen können zur reinen Intensität hin. Das funktioniert nicht. Natürlich auch nicht in Richtung reiner Repräsentation. Darauf muss man irgendwie hin arbeiten, aber ich denke, dass die Bezugnahme auf die Banlieues-Aufstände auch ein bisschen parasitär ist.
Wobei ja in diesem Text jetzt nicht nur eine reine Unmittelbarkeit gepredigt wird. Der Mühseligkeit der Herausbildung einer realen Klassenbewegung sind sich die VerfasserInnen des Manifestes durchaus bewusst.
Die Londoner Vorgänge dürften noch eine größere Herausforderung darstellen. Man kann die an ihnen Beteiligten ja nicht als allein rassistisch Verfolgte beschreiben, denen man dann aber wiederum die Bündnisfähigkeit implizit abspricht, weil sie sich eher über ihren Islam als über Ihre politische Position beschreiben. London war anscheinend viel komplexer: obwohl Akteure dabei waren und Begriffe zur Verfügung standen und teilweise auch deren Anwendung versucht wurde, die das Ganze in die Geschichte ähnlicher Ereignisse in London einzuschreiben, haut das nicht hin. Ich finde gerade, das schreit nach Versuchen, die repräsentative Ebene der neuen Unruhen zu entwickeln, die Kämpfe zwischen Athen und Wisconsin auf ihren politischen und kulturellen Punkt zu bringen, der darf nicht ewig bei Wut und Uns reicht’s bleiben.
In einem Artikel zur Begriffsbestimmung von Wut in der Jungle World hast Du die linke Option des „metaphysischem Universalismus“ kritisiert. An wen oder was hast Du da genau gedacht?
Ich hatte zu dieser Zeit gerade einen Text von Badiou gelesen, wo er davon spricht, inwieweit der Antikapitalismus etwas ganz anderes sein muss als der Kapitalismus, aus fundamental anderem Weltmaterial zusammengesetzt. Dass er ein ganz eigenes Projekt ist und dadurch auch viel stärker. Das war, glaube ich, in diesem Kunst-Manifest von ihm und da habe ich gedacht, Moment mal, das einzige, was es auf der Welt gibt, das alle diese Bedingungen erfüllt, was wirklich komplett aus etwas Anderem gemacht ist als die globale Gegenwart, ist der Jihad. Nicht einmal der wirkliche Jihad, der ja aus unserer Welt stammt und nur eine Variante des globalen Neo-Traditionalismus, sondern der Jihad, wie ihn sich deutsche Blogger und norwegische Massenmörder vorstellen. Und das fand ich interessant, weil Badiou, der auch darüber nachdenkt, ein paar Kriterien für diese fundamentale Alterität nennt: er sagt z.B., es darf nicht westlich sein. Was ist also das Maximale, was den westlichen Demokratien nicht gefällt? Er kommt natürlich auf etwas, was er nicht Jihad nennt, denn für den Jihad will er auch nicht sein, aber das entspricht genau dem Jihad. Das ist interessant, weil es eine reale Existenz des Jihad gibt und nun diese nicht so genannte negative Ableitung des Jihad von den realen Verhältnissen, die sozusagen derselben Logik folgt. Und auch ein guter Grund ist, warum man so eben nicht denken kann.
Wenn Du einen Konnex zwischen Badious antikapitalistischen Positionen und dem Jihad herstellen, muss man nicht auch beachten, dass es in Frankreich ein anti-antizionistische/anti-antisemitische Kritik nicht gegeben hat?
Wenn ich sage, dass Badiou an den Jihad denkt, dann meine ich damit natürlich nicht direkt den Jihad. Ich dachte an die Idee der radikalen Alterität der Gegenbewegung. Das hat nichts zu tun mit Kritik an Badiou als eventuellem Antisemiten, die es auch gibt. Das ist ein anderer Punkt. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass es diese Diskussionen außerhalb von Deutschland tatsächlich selten in dieser Intensität gibt. Es gibt nur einzelne Personen, die diese Positionen einnehmen.
In Frankreich sind das Nouveaux Philosophes wie Bernard-Henri Lévy, Alain Finkielkraut, oder André Glucksmann, die aber auch alle anti-totalitäre, liberale Positionen vertreten.
Finkielkraut ist in vieler Hinsicht ein Rechter, BHL ist komplizierter. Glucksmann steht für eine Position, die man aus Amerika kennt: Das ist ein Single-Issue-Typ, der sich über die größeren Konsequenzen seiner jeweiligen menschenrechtlichen Issues keine Gedanken macht. Manchmal hat so eine Position Vorteile, aber weit führt sie natürlich nicht. In der politisierten Kunstwelt, die ja viel, viel internationaler ist in ihren Diskussionen als die deutsche Linke, verlaufen die Debatten völlig anders als z.B. in der Jungle World. Positionen, die aus den Debatten über die Realität des Antisemitismus hervorgegangen sind, kann man Leuten, die eher von Judith Butler und anderen Israel-Boykotteuren beeinflusst sind, nur schwer klar machen.
Ein weiterer Kritikpunkt in Deinem Text in der Jungle World war die Option des „Exodus“. Kannst Du diese erläutern?
Die Sache mit dem Exodus habe ich auch gewählt, weil es ein ganz attraktiver Begriff bei Paolo Virno ist, für den ich normalerweise durchaus Sympathien habe. Ich finde, es ist ein Problem, wenn man sagt, es gibt auf der einen Seite eben diese nicht-zu-etwas-führenden und nicht-vereinheitlichten Aufstände und auf der anderen Seite gibt es gegenüber der Kreativität und dem das Leben selbstverwertenden neoliberalen Kreativ-Kapitalismus nichts anderes als den Exodus.
Das ist Dir zu fundamentalistisch?
Nicht nur, auch zu unpolitisch. Zu wenig realpolitisch?
Ich finde die Unterscheidung zwischen Realpolitik und anderer Politik problematisch. Also von beiden Seiten aus. Ich finde die Realpolitik macht es sich zu einfach, indem sie sich selbst stark begrenzt und die revolutionäre oder Nicht-Realpolitik macht es sich zu einfach, indem sie die Realität ausblendet. Das ist für mich keine entscheidende Kategorie. Wie generell all diese antiken Kategorien: Revolution vs. Reform, Radikalität.
Zum Kreativ-Kapitalismus, zu dem der Exodus der einzige Ausweg ist, gehört ja, dass er auch eine historische Entwicklung ist, die die Kritik, die Negation und die Gegnerschaft zum fordistischen Fabrik-Kapitalismus eingegangen ist. Das heißt, sich einfach von ihm davon zu machen, würde sozusagen auch die Geschichte der Kritik sabotieren, würde sozusagen sagen: okay, einmal haben wir es mit Kritik versucht, das funktioniert aber auch nicht, also machen wir es jetzt anders und halten uns woanders auf. Und ich denke im Sinne einer historischen Dialektik ist es tatsächlich sinnvoll, genau so weiter zu machen: dieses halbvolle Glas als halbvoll zu verstehen und dafür zu sorgen, dass es wieder voll wird und nicht zu sagen, es ist nur halbvoll, lass es uns wegschütten.
Inzwischen ist ja fast schon ein neues Genre von „Empörungsliteratur“ entstanden. Stéphane Hessels Buch“ Empört euch“ wurde gleich ein Interview-Band mit dem Titel „Engagiert euch“ hinterhergeschickt. Jean Ziegler hat nun seine in Salzburg nicht gehaltene Rede in gleichem Format und ähnlich gelayoutet als „Aufstand des Gewissens“ in Buchform herausgegeben.
Ja, es gibt eben einen globalen Konsens, dass es nirgendwo und auf keinem Terrain so weitergehen kann. Was fehlt, ist aber nicht noch mehr Emotionen und noch mehr Entschlossenheit zu irgendwas, denn emotional und entschlossen und von dem Gefühl beseelt, dass es so nicht weiter gehen kann, sind eh alle; auch natürlich die Anhänger der Tea Party oder österreichische Kronenzeitungs-Leser, die den Bürokraten in Brüssel ans Leder wollen. Ich glaube, es fehlt an geteilten Zeichen und Habitus-Elementen der gerade neu überall entstehenden potenziellen globalen Linken der Zukunft, aber auch an Begriffen und Zielen, also eigentlich an Internationalität und Mainstreamfähigkeit, nicht von der Substanz her, aber von der Sprache. Ich hätte nie gedacht, als alter Subkulturalist, so etwas einmal zu fordern. Aber so weit ist es gekommen.“

Konsumgenossenschaftswerbung
Erinnert sei in diesem Zusammenhang an eine Bemerkung von Ossip Mandelstam aus dem Jahr 1935 (?): „Ich habe mein Schach von der Literatur auf die Biologie gesetzt, damit das Spiel ehrlicher werde“. Die englischsprachige Netzzeitung „marxists.org“ druckte einen Text von Stephen Jay Gould ab, der zuvor in der Zeitschrift „Natural History“ erschienen war: „Kropotkin Was No Crackpot“. Beim „Crackpot“ handelt es sich um eine Art gebildeten Sonderling, beim Autor Gould um einen 2002 verstorbenen Evolutionsforscher, der als Darwinist und Mitglied der „Sceptic Society“ regelmäßig Biologie-Kolumnen veröffentlichte, die auf Deutsch in mehreren Sammelbänden erschienen. Sein von den Marxisten veröffentlichter Text über Kropotkin gehört in diese Reihe – etwas liberal überheblicher Harvard-Besserwisserei, die man grad noch akzeptieren kann, zumal man nicht dümmer davon wird:
„IN LATE 1909, two great men corresponded across oceans, religions, generations, and races. Leo Tolstoy, sage of Christian nonviolence in his later years, wrote to the young Mohandas Gandhi, struggling for the rights of Indian settlers in South Africa:
God helps our dear brothers and co-workers in the Transvaal. The same struggle of the tender against the harsh, of meekness and love against pride and violence, is every year making itself more and more felt here among us also.
A year later, wearied by domestic strife, and unable to endure the contradiction of life in Christian poverty on a prosperous estate run with unwelcome income from his great novels (written before his religious conversion and published by his wife), Tolstoy fled by train for parts unknown and a simpler end to his waning days. He wrote to his wife:
My departure will distress you. I’m sorry about this, but do understand and believe that I couldn’t do otherwise. My position in the house is becoming, or has become, unbearable. Apart from anything else, I can’t live any longer in these conditions of luxury in which I have been living, and I’m doing what old men of my age commonly do: leaving this worldly life in order to live the last days of my life in peace and solitude.
But Tolstoy’s final journey was both brief and unhappy. Less than a month later, cold and weary from numerous long rides on Russian trains in approaching winter, he contracted pneumonia and died at age eighty-two in the stationmaster’s home at the railroad stop of Astapovo. Too weak to write, he dictated his last letter on November 1, 1910. Addressed to a son and daughter who did not share his views on Christian nonviolence, Tolstoy offered a last word of advice:
The views you have acquired about Darwinism, evolution, and the struggle for existence won’t explain to you the meaning of your life and won’t give you guidance in your actions, and a life without an explanation of its meaning and importance, and without the unfailing guidance that stems from it is a pitiful existence. Think about it. I say it, probably on the eve of my death, because I love you.
Tolstoy’s complaint has been the most common of all indictments against Darwin, from the publication of the Origin of Species in 1859 to now. Darwinism, the charge contends, undermines morality by claiming that success in nature can only be measured by victory in bloody battle – the „struggle for existence“ or „survival of the fittest“ to cite Darwin’s own choice of mottoes. If we wish „meekness and love“ to triumph over „pride and violence“ (as Tolstoy wrote to Gandhi), then we must repudiate Darwin’s vision of nature’s way – as Tolstoy stated in a final plea to his errant children. This charge against Darwin is unfair for two reasons. First, nature (no matter how cruel in human terms) provides no basis for our moral values. (Evolution might, at most, help to explain why we have moral feelings, but nature can never decide for us whether any particular action is right or wrong.) Second, Darwin’s „struggle for existence“ is an abstract metaphor, not an explicit statement about bloody battle. Reproductive success, the criterion of natural selection, works in many modes: Victory in battle may be one pathway, but cooperation, symbiosis, and mutual aid may also secure success in other times and contexts. In a famous passage, Darwin explained his concept of evolutionary struggle (Origin of Species, 1859, pp. 62-63):
I use this term in a large and metaphorical sense including dependence of one being on another, and including (which is more important) not only the life of the individual, but success in leaving progeny. Two canine animals, in a time of dearth, may be truly said to struggle with each other which shall get food and live. But a plant on the edge of a desert is said to struggle for life against the drought…. As the mistletoe is disseminated by birds, its existence depends on birds; and it may metaphorically be said to struggle with other fruit-bearing plants, in order to tempt birds to devour and thus disseminate its seeds rather than those of other plants. In these several senses, which pass into each other, I use for convenience sake the general term of struggle for existence.
Yet, in another sense, Tolstoy’s complaint is not entirely unfounded. Darwin did present an encompassing, metaphorical definition of struggle, but his actual examples certainly favored bloody battle – „Nature, red in tooth and claw,“ in a line from Tennyson so overquoted that it soon became a knee-jerk cliche for this view of life. Darwin based his theory of natural selection on the dismal view of Malthus that growth in population must outstrip food supply and lead to overt battle for dwindling resources. Moreover, Darwin maintained a limited but controlling view of ecology as a world stuffed full of competing species – so balanced and so crowded that a new form could only gain entry by literally pushing a former inhabitant out. Darwin expressed this view in a metaphor even more central to his general vision than the concept of struggle – the metaphor of the wedge. Nature, Darwin writes, is like a surface with 10,000 wedges hammered tightly in and filling all available space. A new species (represented as a wedge) can only gain entry into a community by driving itself into a tiny chink and forcing another wedge out. Success, in this vision, can only be achieved by direct takeover in overt competition.
Furthermore, Darwin’s own chief disciple, Thomas Henry Huxley, advanced this „gladiatorial“ view of natural selection (his word) in a series of famous essays about ethics. Huxley maintained that the predominance of bloody battle defined nature’s way as nonmoral (not explicitly immoral, but surely unsuited as offering any guide to moral behavior).
From the point of view of the moralist the animal world is about on a level of a gladiator’s show. The creatures are fairly well treated, and set to fight – whereby the strongest, the swiftest, and the cunningest live to fight another day. The spectator has no need to turn his thumbs down, as no quarter is given.
But Huxley then goes further. Any human society set up along these lines of nature will devolve into anarchy and misery – Hobbes’s brutal world of bellum omnium contra omnes (where bellum means „war,“ not beauty): the war of all against all. Therefore, the chief purpose of society must lie in mitigation of the struggle that defines nature’s pathway. Study natural selection and do the opposite in human society:
But, in civilized society, the inevitable result of such obedience [to the law of bloody battle] is the re-establishment, in all its intensity, of that struggle for existence – the war of each against all – the mitigation or abolition of which was the chief end of social organization.
This apparent discordance between nature’s way and any hope for human social decency has defined the major subject for debate about ethics and evolution ever since Darwin. Huxley’s solution has won many supporters – nature is nasty and no guide to morality except, perhaps, as an indicator of what to avoid in human society. My own preference lies with a different solution based on taking Darwin’s metaphorical view of struggle seriously (admittedly in the face of Darwin’s own preference for gladiatorial examples) – nature is sometimes nasty, sometimes nice (really neither, since the human terms are so inappropriate). By presenting examples of all behaviors (under the metaphorical rubric of struggle), nature favors none and offers no guidelines. The facts of nature cannot provide moral guidance in any case.
But a third solution has been advocated by some thinkers who do wish to find a basis for morality in nature and evolution. Since few can detect much moral comfort in the gladiatorial interpretation, this third position must reformulate the way of nature. Darwin’s words about the metaphorical character of struggle offer a promising starting point. One might argue that the gladiatorial examples have been over-sold and misrepresented as predominant. Perhaps cooperation and mutual aid are the more common results of struggle for existence. Perhaps communion rather than combat leads to greater reproductive success in most circumstances.
The most famous expression of this third solution may be found in Mutual Aid, published in 1902 by the Russian revolutionary anarchist Petr Kropotkin. (We must shed the old stereotype of anarchists as bearded bomb throwers furtively stalking about city streets at night. Kropotkin was a genial man, almost saintly according to some, who promoted a vision of small communities setting their own standards by consensus for the benefit of all, thereby eliminating the need for most functions of a central government.) Kropotkin, a Russian nobleman, lived in English exile for political reasons. He wrote Mutual Aid (in English) as a direct response to the essay of Huxley quoted above, „The Struggle for Existence in Human Society,“ published in The Nineteenth Century, in February 1888. Kropotkin responded to Huxley with a series of articles, also printed in The Nineteenth Century and eventually collected together as the book Mutual Aid
As the title suggests, Kropotkin argues, in his cardinal premise, that the struggle for existence usually leads to mutual aid rather than combat as the chief criterion of evolutionary success. Human society must therefore build upon our natural inclinations (not reverse them, as Huxley held) in formulating a moral order that will bring both peace and prosperity to our species. in a series of chapters, Kropotkin tries to illustrate continuity between natural selection for mutual aid among animals and the basis for success in increasingly progressive human social organization. His five sequential chapters address mutual aid among animals, among savages, among barbarians, in the medieval city, and amongst ourselves.
I confess that I have always viewed Kropotkin as daftly idiosyncratic, if undeniably well meaning. He is always so presented in standard courses on evolutionary biology – as one of those soft and woolly thinkers who let hope and sentimentality get in the way of analytic toughness and a willingness to accept nature as she is, warts and all. After all, he was a man of strange politics and unworkable ideals, wrenched from the context of his youth, a stranger in a strange land. Moreover, his portrayal of Darwin so matched his social ideals (mutual aid naturally given as a product of evolution without need for central authority) that one could only see personal hope rather than scientific accuracy in his accounts. Kropotkin has long been on my list of potential topics for an essay (if only because I wanted to read his book, and not merely mouth the textbook interpretation), but I never proceeded because I could find no larger context than the man himself. Kooky intellects are interesting as gossip, perhaps as psychology, but true idiosyncrasy provides the worst possible basis for generality.
But this situation changed for me in a flash when I read a very fine article in the latest issue of Isis (our leading professional journal in the history of science) by Daniel P. Todes: „Darwin’s Malthusian Metaphor and Russian Evolutionary Thought, 1859-1917.“ I learned that the parochiality had been mine in my ignorance of Russian evolutionary thought, not Kropotkin’s in his isolation in England. (I can read Russian, but only painfully, and with a dictionary – which means, for all practical purposes, that I can’t read the language.) I knew that Darwin had become a hero of the Russian intelligentsia and had influenced academic life in Russia perhaps more than in any other country. But virtually none of this Russian work has ever been translated or even discussed in English literature. The ideas of this school are unknown to us; we do not even recognize the names of the major protagonists. I knew Kropotkin because he had published in English and lived in England, but I never understood that he represented a standard, well-developed Russian critique of Darwin, based on interesting reasons and coherent national traditions. Todes’s article does not make Kropotkin more correct, but it does place his writing into a general context that demands our respect and produces substantial enlightenment. Kropotkin was part of a mainstream flowing in an unfamiliar direction, not an isolated little arroyo.
This Russian school of Darwinian critics, Todes argues, based its major premise upon a firm rejection of Malthus’s claim that competition, in the gladiatorial mode, must dominate in an ever more crowded world, where population, growing geometrically, inevitably outstrips a food supply that can only increase arithmetically. Tolstoy, speaking for a consensus of his compatriots, branded Malthus as a „malicious mediocrity“.“
Todes finds a diverse set of reasons behind Russian hostility to Malthus. Political objections to the dog-eat-dog character of Western industrial competition arose from both ends of the Russian spectrum. Todes writes:
Radicals, who hoped to build a socialist society, saw Malthusianism as a reactionary current in bourgeois political economy. Conservatives, who hoped to preserve the communal virtues of tsarist Russia, saw it as an expression of the „British national type.“
But Todes identifies a far more interesting reason in the immediate experience of Russia’s land and natural history. We all have a tendency to spin universal theories from a limited domain of surrounding circumstance. Many geneticists read the entire world of evolution in the confines of a laboratory bottle filled with fruit flies. My own increasing dubiousness about universal adaptation arises in large part, no doubt, because I study a peculiar snail that varies so widely and capriciously across an apparently unvarying environment, rather than a bird in flight or some other marvel of natural design.
Russia is an immense country, under-populated by any nineteenth-century measure of its agricultural potential. Russia is also, over most of its area, a harsh land, where competition is more likely to pit organism against environment (as in Darwin’s metaphorical struggle of a plant at the desert’s edge) than organism against organism in direct and bloody battle. How could any Russian, with a strong feel for his own countryside, see Malthus’s principle of overpopulation as a foundation for evolutionary theory? Todes writes:
It was foreign to their experience because, quite simply, Russia’s huge land mass dwarfed its sparse population. For a Russian to see an inexorably increasing population inevitably straining potential supplies of food and space required quite a leap of imagination.
If these Russian critics could honestly tie their personal skepticism to the view from their own backyard, they could also recognize that Darwin’s contrary enthusiasms might record the parochiality of his different surroundings, rather than a set of necessarily universal truths. Malthus makes a far better prophet in a crowded, industrial country professing an ideal of open competition in free markets. Moreover, the point has often been made that both Darwin and Alfred Russel Wallace independently developed the theory of natural selection after primary experience with natural history in the tropics. Both claimed inspiration from Malthus, again independently; but if fortune favors the prepared mind, then their tropical experience probably predisposed both men to read Malthus with resonance and approval. No other area on earth is so packed with species, and therefore so replete with competition of body against body. An Englishman who had learned the ways of nature in the tropics was almost bound to view evolution differently from a Russian nurtured on tales of the Siberian wasteland.
For example, N. I. Danilevsky, an expert on fisheries and population dynamics, published a large, two-volume critique of Darwinism in 1885. He identified struggle for personal gain as the credo of a distinctly British „national type,“ as contrasted with old Slavic values of collectivism. An English child, he writes, „boxes one on one, not in a group as we Russians like to spar.“ Danilevsky viewed Darwinian competition as „a purely English doctrine“ founded upon a line of British thought stretching from Hobbes through Adam Smith to Malthus. Natural selection, he wrote, is rooted in „the war of all against all, now termed the struggle for existence – Hobbes‘ theory of politics; on competition – the economic theory of Adam Smith. … Malthus applied the very same principle to the problem of population. … Darwin extended both Malthus‘ partial theory and the general theory of the political economists to the organic world.“ (Quotes are from Todes’s article.) When we turn to Kropotkin’s Mutual Aid in the light of Todes’s discoveries about Russian evolutionary thought, we must reverse the traditional view and interpret this work as mainstream Russian criticism, not personal crankiness. The central logic of Kropotkin’s argument is simple, straightforward, and largely cogent.
Kropotkin begins by acknowledging that struggle plays a central role in the lives of organisms and also provides the chief impetus for their evolution. But Kropotkin holds that struggle must not be viewed as a unitary phenomenon. It must be divided into two fundamentally different forms with contrary evolutionary meanings. We must recognize, first of all, the struggle of organism against organism for limited resources – the theme that Malthus imparted to Darwin and that Huxley described as gladiatorial. This form of direct struggle does lead to competition for personal benefit.
But a second form of struggle – the style that Darwin called metaphorical – pits organism against the harshness of surrounding physical environments, not against other members of the same species. Organisms must struggle to keep warm, to survive the sudden and unpredictable dangers of fire and storm, to persevere through harsh periods of drought, snow, or pestilence. These forms of struggle between organism and environment are best waged by cooperation among members of the same species-by mutual aid. If the struggle for existence pits two lions against one zebra, then we shall witness a feline battle and an equine carnage. But if lions are struggling jointly against the harshness of an inanimate environment, then lighting will not remove the common enemy – while cooperation may overcome a peril beyond the power of any single individual to surmount.
Kropotkin therefore created a dichotomy within the general notion of struggle – two forms with opposite import: (1) organism against organism of the same species for limited resources, leading to competition; and (2) organism against environment, leading to cooperation.
No naturalist will doubt that the idea of a struggle for life carried on through organic nature is the greatest generalization of our century. Life is struggle; and in that struggle the fittest survive. But the answers to the questions „by which arms is the struggle chiefly carried on!“ and „who are the fittest in the struggle!“ will widely differ according to the importance given to the two different aspects of the struggle: the direct one, for food and safety among separate individuals, and the struggle which Darwin described as „metaphorical“ – the struggle, very often collective, against adverse circumstances. Darwin acknowledged that both forms existed, but his loyalty to Malthus and his vision of nature chock-full of species led him to emphasize the competitive aspect. Darwin’s less sophisticated votaries then exalted the competitive view to near exclusivity, and heaped a social and moral meaning upon it as well.
They came to conceive of the animal world as a world of perpetual struggle among half-starved individuals, thirsting for one another’s blood. They made modern literature resound with the war-cry of woe to the vanquished, as if it were the last word of modern biology. They raised the „pitiless“ struggle for personal advantages to the height of a biological principle which man must submit to as well, under the menace of otherwise succumbing in a world based upon mutual extermination.
Kropotkin did not deny the competitive form of struggle, but he argued that the cooperative style had been underemphasized and must balance or even predominate over competition in considering nature as a whole.
There is an immense amount of warfare and extermination going on amidst various species; there is, at the same time, as much, or perhaps even more, of mutual support, mutual aid, and mutual defense…. Sociability is as much a law of nature as mutual struggle.
As Kropotkin cranked through his selected examples, and built up steam for his own preferences, he became more and more convinced that the cooperative style, leading to mutual aid, not only predominated in general but also characterized the most advanced creatures in any group-ants among insects, mammals among vertebrates. Mutual aid therefore becomes a more important principle than competition and slaughter:
If we … ask Nature: „who are the fittest: those who are continually at war with each other, or those who support one another?“ we at once see that those animals which acquire habits of mutual aid are undoubtedly the fittest. They have more chances to survive, and they attain, in their respective classes, the highest development of intelligence and bodily organization.
If we ask why Kropotkin favored cooperation while most nineteenth-century Darwinians advocated competition as the predominant result of struggle in nature, two major reasons stand out. The first seems less interesting, as obvious under the slightly cynical but utterly realistic principle that true believers tend to read their social preferences into nature. Kropotkin, the anarchist who yearned to replace laws of central government with consensus of local communities, certainly hoped to locate a deep preference for mutual aid in the innermost evolutionary marrow of our being. Let mutual aid pervade nature and human cooperation becomes a simple instance of the law of life.
Neither the crushing powers of the centralized State nor the teachings of mutual hatred and pitiless struggle which came, adorned with the attributes of science, from obliging philosophers and sociologists, could weed out the feeling of human solidarity, deeply lodged in men’s understanding and heart, because it has been nurtured by all our preceding evolution.
But the second reason is more enlightening, as a welcome empirical input from Kropotkin’s own experience as a naturalist and an affirmation of Todes’s intriguing thesis that the usual flow from ideology to interpretation of nature may sometimes be reversed, and that landscape can color social preference. As a young man, long before his conversion to political radicalism, Kropotkin spent five years in Siberia (1862-1866) just after Darwin published the Origin of Species. He went as a military officer, but his commission served as a convenient cover for his yearning to study the geology, geography, and zoology of Russia’s vast interior. There, in the polar opposite to Darwin’s tropical experiences, he dwelled in the environment least conducive to Malthus’s vision. He observed a sparsely populated world, swept with frequent catastrophes that threatened the few species able to find a place in such bleakness. As a potential disciple of Darwin, he looked for competition, but rarely found any. Instead, he continually observed the benefits of mutual aid in coping with an exterior harshness that threatened all alike and could not be overcome by the analogues of warfare and boxing.
Kropotkin, in short, had a personal and empirical reason to look with favor upon cooperation as a natural force. He chose this theme as the opening paragraph for Mutual Aid:
Two aspects of animal life impressed me most during the journeys which I made in my youth in Eastern Siberia and Northern Manchuria. One of them was the extreme severity of the struggle for existence which most species of animals have to carry on against an inclement Nature; the enormous destruction of life which periodically results from natural agencies; and the consequent paucity of life over the vast territory which fell under my observation. And the other was, that even in those few spots where animal life teemed in abundance, I failed to find – although I was eagerly looking for it – that bitter struggle for the means of existence among animals belonging to the same species, which was considered by most Darwinists (though not always by Darwin himself) as the dominant characteristic of struggle for life, and the main factor of evolution.
What can we make of Kropotkin’s argument today, and that of the entire Russian school represented by him? Were they just victims of cultural hope and intellectual conservatism? I don’t think so. In fact, I would hold that Kropotkin’s basic argument is correct. Struggle does occur in many modes, and some lead to cooperation among members of a species as the best pathway to advantage for individuals. If Kropotkin overemphasized mutual aid, most Darwinians in Western Europe had exaggerated competition just as strongly. If Kropotkin drew inappropriate hope for social reform from his concept of nature, other Darwinians had erred just as firmly (and for motives that most of us would now decry) in justifying imperial conquest, racism, and oppression of industrial workers as the harsh outcome of natural selection in the competitive mode.
I would fault Kropotkin only in two ways – one technical, the other general. He did commit a common conceptual error in failing to recognize that natural selection is an argument about advantages to individual organisms, however they may struggle. The result of struggle for existence may be cooperation rather than competition, but mutual aid must benefit individual organisms in Darwin’s world of explanation. Kropotkin sometimes speaks of mutual aid as selected for the benefit of entire populations or species – a concept foreign to classic Darwinian logic (where organisms work, albeit unconsciously, for their own benefit in terms of genes passed to future generations). But Kropotkin also (and often) recognized that selection for mutual aid directly benefits each individual in its own struggle for personal success. Thus, if Kropotkin did not grasp the full implication of Darwin’s basic argument, he did include the orthodox solution as his primary justification for mutual aid.
More generally, I like to apply a somewhat cynical rule of thumb in judging arguments about nature that also have overt social implications: When such claims imbue nature with just those properties that make us feel good or fuel our prejudices, be doubly suspicious. I am especially wary of arguments that find kindness, mutuality, synergism, harmony – the very elements that we strive mightily, and so often unsuccessfully, to put into our own lives – intrinsically in nature. I see no evidence for Teilhard’s noosphere, for Capra’s California style of holism, for Sheldrake’s morphic resonance. Gaia strikes me as a metaphor, not a mechanism. (Metaphors can be liberating and enlightening, but new scientific theories must supply new statements about causality. Gaia, to me, only seems to reformulate, in different terms, the basic conclusions long achieved by classically reductionist arguments of biogeochemical cycling theory.)
There are no shortcuts to moral insight. Nature is not intrinsically anything that can offer comfort or solace in human terms – if only because our species is such an insignificant latecomer in a world not constructed for us. So much the better. The answers to moral dilemmas are not lying out there, waiting to be discovered. They reside, like the kingdom of God, within us – the most difficult and inaccessible spot for any discovery or consensus.“

Genossenschaftliche Vertreterversammlung
Der ehemalige Aktivist im Hamburger KB und jetzige Russlandforscher, Kai Ehlers, hat demgegenüber Kropotkin schöpferisch aufgegriffen – indem er u.a. russische Agrarsoziologen befragte, was aus den russischen Selbstorganisationen, die von oben zu sowjetischen Kollektiven zusammengefaßt worden waren, nach der Privatisierung ab 1991 wurde und wird. Sein Buch darüber heißt „Erotik des Informellen“. Ich entnehme ihm:
Peter Kropotkin schrieb 1902, dass Russland die „vielleicht beste Möglichkeit gibt, die Genossenschaft von den verschiedensten Seiten kennen zu lernen. In Russland ist sie ein natürliches Gewächs, eine Erbschaft aus dem Mittelalter, und während eine formell errichtete Kooperativgesellschaft mit vielen gesetzlichen Schwierigkeiten und dem Argwohn der Behörden zu tun hätte, bildet die formlose Genossenschaft – der Artel – den eigentlichen Inhalt des russischen Bauernlebens.“ Es gab und gibt sie in allen Branchen und selbst in den Haftanstalten und Lager bildeten die Gefangenen sofort einen Artel, mit denen sie ihren Alltag gemeinsam organisierten.
Im 14 Jahrhundert machten die Moskauer Fürsten die Dorfgemeinschaft zur Grundlage ihrer Herrschaft: Diese sogenannten Obschtschinas, auch MIR genannt (was Dorfplatz, Welt und Frieden heißt), regierten sich selbst, indem sie das der Gemeinschaft gehörende Land gemäß den Bedürfnissen der im Dorf lebenden Familien immer wieder neu verteilten. Gegenüber dem Staat hatten sie die Verpflichtung, eine bestimmte Anzahl Soldaten zu stellen und Steuern zu zahlen. Auf diese Weise wurde das riesige russische Territorium mit einem Minimum an Verwaltung beherrschbar, ohne dass die Obrigkeit sich mit den einzelnen „Seelen“, wie man die Untertanen nannte, befassen mußte. Es gab zwar immer wieder Versuche, den Einzelbauern größeren Bewegungsspielraum zu verschaffen, aber bisher hat noch jede Revolution und jeder Umbruch in Russland zu einer Vermehrung der Artel und Obschtschinas geführt. Das gilt für die bolschewistische Industrialisierung, bei der sich die dörflichen Obschtschinas zu betrieblichen Arbeitskollektiven wandelten ebenso wie für die Kollektivierung der Landwirtschaft, bei der sie zu Kolchosen und Sowchosen umgestaltet wurden. Desgleichen gilt dies für die Privatisierung des Staatssozialismus ab 1991, als die Betriebe ihre „grünen Bereiche“ an die bis dahin nur Nutzer gewesenen Mitarbeiter übertrugen: „Ab sofort waren die Betriebsangehörigen für ihre Versorgung mit Grundnahrungsmitteln selbst verantwortlich. Diese bildeten daraufhin Datschengemeinschaften. So verwandelt sich der individuelle Empfänger kollektiver Versorgung in den kollektiv organisierten selbstversorgenden Kleinbürger,“ wie der Moskauer Agrarökonom Gelij Schmeljow den erneut gescheiterten Versuch, die Obschtschina zu liquidieren, beschreibt. Diese heißt heute – wie in der DDR die mit der Wende umgewandelten LPGen: Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Aktiengesellschaft oder Genossenschaftsdorf.
Die von oben über den Homo Sovjeticus gekommene kollektive Versorgung in der Sowchose, Kolchose oder dem Betriebskollektiv enthob ihn vom unmittelbaren Druck der Vorsorge – was ihm in seinem privaten Bereich Spielraum verschaffte. Nun geht es laut Schmeljow um neuen „persönlichen Bewegungsspielraum“ in einer „Symbiose“ von marktwirtschaftlich orientiertem Kollektiv und der garantierten Selbstversorgung der Familie auf eigenem Land. Sie wird von russischen Soziologen auch als „informelle Ökonomie“ bezeichnet. Die symbiotische Beziehung zwischen den großen kollektiven und den kleinen privaten Strukturen ist weder kapitalistisch noch sozialistisch – sie ist russisch.
(Aus der Einleitung eines Textes in einer Aufsatzsammlung über Genossenschaften, die von der taz-Genossenschaft im April im Westend-Verlag herausgegeben wird, Anlaß ist sowohl der taz-Kongreß 2012 – „Das gute Leben“ betitelt – als auch das UNO- „Jahr der Genossenschaften“ als auch die Pflege der taz-Genossen, die als Konsumgenossenschaft die taz finanzieren, welche eine Produktionsgenossenschaft ist. Witzigerweise denken erstere eher kollektiv und letztere mehr und mehr Richtung Ich-AG.)

Konsumgenossenschaftswerbung

Kooperative Wölfe
Der Ehrlichkeit halber sei hier noch ein Interview aus der Nowa Europa Wschodnia wiedergegeben, das Ireneusz Danko mit Andrzej Stasiuk über Russland führte:
Ireneusz Dako: In dem Verlag CZARNE, den du mit deiner Frau betreibst, ist kürzlich Daniel Kalders Buch Der verlorene Kosmonaut erschienen. Dieser „Anti-Reise-Führer“, wie der schottische Autor sein Werk bewirbt, dokumentiert eine Reise durch die russische Provinz. Die Lektüre ist für die Russen nicht erbaulich. Du selbst gehst in deinem Kommentar zu dem Buch noch weiter, wenn du Russland als „Symbol des menschlichen Versagertums“ bezeichnest: „Kein Land wollte je so hoch hinaus und ist dabei so kläglich gescheitert. Russland, kann man sagen, ist die Allegorie der Menschheit, die mit ihren kurzen Ärmchen nach den Sternen greift“. Siehst du unseren östlichen Nachbarn wirklich so negativ
? Andrzej Stasiuk: Jeder von uns hat irgendein Russlandbild. Für mich ist Russland ein Beispiel für das Scheitern der menschlichen Materie. Kalder hat zehn Jahre dort gewohnt und die russische Wirklichkeit sehr gut kennen gelernt. Er ist kein Idiot. Russland sieht einfach so aus, wie er es beschreibt. Du fährst fünftausend Kilometer und siehst immer dieselbe formlose, sinnlose Landschaft. Zero Sexappeal.
Dako: Übertreibst du damit nicht ein bisschen? Für viele Russen ist Kalders Buch nichts anderes als ein Zerrspiegel, eine Art literarischer Slum Tour, bei der wir die ärmsten, heruntergekommensten Winkel eines Landes besichtigen. Nicht alle in Russland leben in Armut, fahren mit der Plackarta (Schlafwagen ohne getrennte Abteile), betrinken sich bis zur Bewusstlosigkeit oder essen fette Tscheburaki auf den Bahnhöfen.
Stasiuk: Kalder gibt offen zu, dass er ein Apokalyptiker ist und ihn nur solche Länder anmachen. Deshalb ist er jetzt in Austin in Texas. Auch mich interessieren die ausgefahrenen Touristenrouten nicht. Aber Kalder hält Russland keinen Zerrspiegel vor. Die Welt, und dieses Land ganz besonders, besteht nicht nur aus reichen Metropolen und zufriedenen Menschen. Die Proportionen sind meist umgekehrt. Die tiefste russische Lektüre der letzten Jahre waren für mich die Bücher von Andrej Platonow. Sein Blick auf Russland ist grausam, aber gleichzeitig mitreißend ästhetisch. Diese Ästhetik berührt den Kern der Wirklichkeit. Natürlich meldeten sich bei Kalders Lesungen, die ich in Polen miterlebt habe, manchmal auch empörte Russinnen zu Wort: „Was ist das für ein Bild von Russland? Ich protestiere!“, sagten sie. Das wirkte wie ein verzweifelter Versuch, die riesigen nationalen Komplexe zu verbergen. Ich selbst würde, wenn ich ein kluger Russe wäre, Kalders Buch als eine der schönsten und empfindsamsten anerkennen, das je über mein Land geschrieben wurde.
Dako: Was macht Kalders Vorzug gegenüber den Büchern anderer Autoren über Russland aus?
Stasiuk: Dieser Schotte hat es wie wenige geschafft, die Schicht von Public Relations zu durchdringen, in der die Russen Meister sind. Er tut das mit großem Charme und viel Humor.
Dako: Kalders Beschreibungen von Russland und Serhij Zhadans, dessen Bücher ebenfalls im Verlag CZARNE erscheinen, Beschreibungen der Ukraine unterscheiden sich wenig im Klima. Beide nehmen vor allem die groteske Hoffnungslosigkeit des Lebens wahr.
Stasiuk: Ich kenne diese Länder nicht so gut wie Daniel und Serhij. Bestimmt unterscheiden sie sich nicht, wenn sie das so geschrieben haben. Die postsowjetische Materie ähnelt sich überall. Ganz gleich, ob ein Schotte oder ein Ukrainer sie beschreibt.
Dako: Im letzten Jahr bist du das erste Mal nach Russland gefahren. Hat es dich früher nicht gereizt, dir das mit eigenen Augen anzusehen?
Stasiuk: Ich hatte keine Lust. Russland hat mich nie fasziniert. Seit ich denken kann, war Russland in meinem Leben nur als große Peinlichkeit präsent, als etwas schrecklich Langweiliges. Aber dann ergab sich eine Gelegenheit, weil mein guter Bekannter Piotr Marciniak polnischer Konsul in Irkutsk geworden ist, und ich bin gefahren. Durch ihn hatten wir einen Ausgangspunkt für unsere Reise in die Tiefe Sibiriens.
Dako: Warst du lange in Russland?
Stasiuk: Drei Wochen. Es war Sommer, gnadenlose Hitze, und ich hatte in Erwartung des sibirischen Frostes einen warmen Pullover eingepackt. Wir flogen mit meiner Frau und unseren Freunden nach Moskau, und von dort gleich weiter nach Irkutsk.
Dako: Wolltest du dir Moskau nicht ansehen?
Stasiuk: Das menschliche Leben ist begrenzt. Wenn man dreißig, vierzig Jahre ist, muss man sich entscheiden lernen. Moskau ist nur eine Visitenkarte, absolut nicht repräsentativ für das wahre Gesicht des Landes. Wiktor Jerofejew, der Russland in und auswendig kennt, riet: „Fahr nicht dorthin, dort findest du nichts Interessantes. Fahr gleich weiter.“ Und das habe ich gemacht. Es hat mich nie gereizt, so einen Städte-Moloch zu erleben. Ich besichtige nicht gern Visitenkarten. Städte wie Moskau oder Petersburg sind quasi für unsereins gebaut. Sie sollen die Russen so zeigen, wie sie sich gern selbst sehen. Aus der Perspektive von Ulan-Ude und Tschita in Sibirien sieht man viel mehr als vom Roten Platz. Ich sehe gern, wie dort das Russische allmählich zur Neige geht, wie die russische Butter nicht reicht, um sie über die ganze Fläche des Landes zu verstreichen.
Dako: Ich war mehrmals in Moskau und Petersburg und habe jedes Mal bereut, dass ich keine Zeit hatte, diese Städte näher kennen zu lernen…
Stasiuk: Daniel Kalder hat in Moskau auch viel Zeit verbraucht und findet auch, dass das eine faszinierende Stadt ist. Mir haben die zehn Stunden auf dem Flughafen Scheremetjewo gereicht, wo ich in die Maschine nach Irkutsk umgestiegen bin. Gleich nach der Ankunft in der Haupthalle von Scheremetjewo fiel mir ein Wachmann in schwarzer Uniform auf, der mit Weibern in Kopftüchern an der Bar saß und auf den Boden spuckte. Er sah genauso aus wie dieser schwachköpfige Russe aus den Witzen, die wir uns als Kinder erzählten. Ganz Scheremetjewo wirkte wie der Autobusbahnhof in Lublin in der Hauptverkehrszeit. Eng wie sau, überall Gedränge und diese Reisebündel. „Skorej, skorej!“ wurde man von den Angestlelten herumgescheucht. Im Laufschritt mussten wir Stiefel und Taschen ablegen, um durch die elektronischen Schranken ins Flugzeug zu kommen. Ein Albtraum.
Dako: Irkutsk hat einen besseren Eindruck gemacht?
Stasiuk: Es hat mich überhaupt nicht überrascht. Es war genauso, wie ich es mir vorgestellt hatte. Das Paradox war, dass ich mehrere tausend Kilometer flog und den Eindruck hatte, ich wäre in einer Art Sokoów Podlaskis hoch zehn gelandet, wo meine Eltern herkommen. Von Moskau aus machten wir noch ein Bratsk Zwischenstation. Keine Ahnung, warum. Der Flughafen dort wirkt wie eine verlassene Fabrikhalle irgendwo im Wald, wo die Arbeiter im Morgengrauen zur Schicht kommen. Grau, schmutzig, unwirtlich. Ich hatte Platonows <Wykop> bei mir. Alles passte wie angegossen zu diesem Buch.
Dako: Hast du nicht daran gedacht, mit der transsibirischen Bahn durch Russland zu fahren? Cedrars, Kapuscinski und viele andere Schriftsteller sind mit dem Zug durch Sibirien gereist. Vor ein paar Jahren erklärte sogar der Brasilianer Paulo Coelho, er wolle sich diesen Traum erfüllen.
Stasiuk: Diesen Traum hatte ich nicht. Als Teenager faszinierte mich Blaise Cendrars Poem über die Transsib, später verging mir diese Faszination. Mir reichte der Anblick der Züge, die aus Moskau im Warschauer Ostbahnhof ankamen, und das Volk, das darin unterwegs war. Als ich schließlich in Sibirien gelandet war, musste ich mich natürlich mit der Bahn zwischen den Städten bewegen, die hunderte Kilometer voneinander entfernt sind. Ein Auto zu mieten, war zu teuer, und ich wäre auch nicht überall hingekommen. Aber ich fuhr nie länger als zwölf Stunden mit dem Zug. Die längste Strecke war die mit der Transsib von Tschita nach Zabajkalsk an der chinesischen Grenze. Wir fuhren am Nachmittag los und waren am frühen Morgen dort. Länger hätte ich auch nicht im Zug ausgehalten. Natürlich, die Russen sind Meister der PR und verkaufen die Legende der Transsib in alle Welt. Alle reden ihnen nach, das sei eine mystische Erfahrung, man müsse unbedingt die ganze Strecke zurücklegen. Dabei ist es eine zum Kotzen monotone Sache, eine Woche lang immer die gleichen Hügel, Sümpfe und mickrigen Birken anzugucken. Null Attraktion.
Dako: Bist du mit Plackarta gefahren?
Stasiuk: Mach keine Witze. Das hätte noch gefehlt, dass ich mich in einem Schlafwagen ohne Abteile durch Sibirien schlage. In der Ukraine bin ich mit Plackarta gefahren, das reicht mir: Gestank, Lärm, da kann man sich nur möglichst schnell zudröhnen und einschlafen, um irgendwie ans Ziel zu gelangen. In Russland fuhren mit dem Kupejny (Liegewagen), in gesonderten Abteilen. Kein Luxus, aber wir konnten uns ausruhen, wenn wir erschöpft aus der Taiga kamen.
Dako: Hast du unterwegs Menschen kennen gelernt?
Stasiuk: Unterschiedlich. Es musste irgendeinen Funken geben, damit wir ins Gespräch kamen. Im Abteil ist man von den anderen Reisenden isoliert. Auf der Suche nach einer Unterkunft haben wir mehr Menschen kennen gelernt. Und gut so. Ich persönlich mag nicht ständig neue Kontakte knüpfen. Ich bin ein Einzelgänger, es reichte mir, dass ich sieben oder acht Russen und Russinnen kennen gelernt habe.
Dako: Russland aus dem Fenster der Transsib – das sind Sümpfe, Hügel, mickrige Birken und sonst nichts?
Stasiuk: In erster Linie. Das ist eine mit einem ganzen dünnen Firnis Zivilisation und Menschlichkeit überzogene Endlosigkeit. Anfangs weiß man nicht, was man davon halten soll. Erst nach einer Weile kommst du darauf, was dieses Land wirklich ist, das du da durchmisst, worauf dieses Phänomen beruht.
Dako: Und worauf beruht es?
Stasiuk: Ganz kurz gesagt, auf Formlosigkeit und Grenzenlosigkeit. In Sibirien herrscht die absolute Melancholie. Man muss viel psychische Widerstandskraft besitzen, um das Tag für Tag auszuhalten.
Dako: Hattet ihr einen Reiseplan? Wusstest du, was du sehen willst?
Stasiuk: Außer dem Flug nach Irkutsk gab es keinen Plan. Wir entschieden immer vor Ort, wohin wir fahren wollten. Manchmal genügte die Magie eines Namens, damit wir Fahrkarten kauften und in den Zug stiegen. Dieses Tschita zum Beispiel. Aus meiner Jugend war es mit Revolutionsfilmen assoziiert, so eine Art sowjetischer Western.
Dako: Krasnokamensk, der Verbannungsort von Michail Chodorkowskij, den ihr auch besucht habt, wird nicht mit der Oktoberrevolution assoziiert.
Stasiuk: Die Fahrt dorthin war eine Idee von Olaf, meinem deutschen Übersetzer, der ein großer Anhänger von Chodorkowskij ist.
Dako: Was habt ihr dort vorgefunden?
Stasiuk: Das Nichts. Dort gibt es ein Uranbergwerk und das Lager, in dem Chodorkowskij festgehalten wird. Ein Taxifahrer brachte uns bis zweihundert Meter an die Zone heran, damit wir Fotos machen konnten. Weiter neljzja. Wir waren vermutlich die ersten Touristen dort, denn die ganze Stadt hat uns angeguckt. Fremde fallen dort sofort auf.
Dako: Haben sie mit euch gesprochen?
Stasiuk: Klar. Der Taxifahrer, mit dem wir fast einen ganzen Tag unterwegs waren, erwies sich als sehr offener und umgänglicher Mensch. In Sibirien gibt es quasi zwei Ebenen der menschlichen Kontakte. Die erste ist die amtliche und zeichnet sich durch große Abneigung, sogar Angst vor Fremden aus. Dafür gibt es bei den normalen Kontakten, auf der Straße oder auf dem Basar, keine Barrieren. In Zabajkalsk an der russisch-chinesischen Grenze erklärte man sich unter großem Widerwillen bereit, uns für eine Nacht im Hotel anzumelden. Aber als uns unterwegs ein Rad am Auto abriss, lief das halbe Dorf zusammen, um uns zu helfen. Diese „Offenheit“ ist manchmal geradezu deprimierend. Ich bin kein Mensch, der sich gern auf die Schulter klopfen lässt, ich freunde mich nicht mit jedem auf der Straße an. Aber dort ist das so. Man bekommt den Verdacht, dass dort beide Arten von Kontakt wahr sind, aber gleichzeitig, und die eine ebenso wenig bedeutet wie der andere, dass sie zerbrechlich sind, dass diese Überschwenglichkeit im persönlichen Kontakt jederzeit enden kann und jeder seiner Wege geht.
Dako: Ryszard Kapuscinski zitiert in seinem Imperium die Worte: „Wot, takaja Zizn'“, die er oft von Russen gehört habe, als er ihr Land Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre bereiste. Er verstand diesen Satz als resignatives Sichabfinden mit der Realität. Er sollte die Lebenseinstellung der Russen am treffendsten wiedergeben. Hat sich seit damals etwas geändert
Stasiuk: Keine Spur. Wir haben am Baikal bei so einer Frau gewohnt, deren einer Mann sich zu Tode getrunken hatte und der andere von Gangster erschossen worden war: „Takaja Zizn'“ sagte sie, und alles war klar.
Dako: Fiel die Antwort auf die Frage nach der Regierung Putin auch so aus?
Stasiuk: Unterschiedlich. Wir kamen gerade zu der Zeit, als die russische Armee in Georgien einfiel. Wir versuchten das Thema anzusprechen, fragten Leute auf der Straße. Nichts, komplettes Desinteresse oder Ausflucht in Gemeinplätze wie den, dass auf der Welt Frieden herrschen sollte. „Nam eto neinteresno. Eto wojna Putina,“ hieß es, und damit war das Gespräch zu Ende. Da wurde mir erst bewusst, das Georgien sechstausend Kilometer entfernt war. Aus so einer Perspektive wundert es nicht mehr, dass der Krieg im Kaukasus für den Taxifahrer in Zabajkalsk schon der Kosmos ist. Fünf Kilometer weit mit der Armee in die eine oder andere Richtung, was macht das für einen Unterschied für Menschen, die mit Maßstäben des Globus operieren?
Dako: Hast du Sympathien für Putin in der Bevölkerung bemerkt? Oder hat es sie gestört, dass er im KGB war, der für Massenverbannungen nach Sibirien zuständig war?
Stasiuk: Ich habe weder Sympathie noch Abneigung bemerkt. Der Typ, der sagte, dass der Krieg mit Georgien Putins Kriegs sei, hatte einen Sohn, der sich beim KGB beworben hatte. Für ihn war das so selbstverständlich wie die Bewerbung bei jeder anderen Firma oder irgend einem Amt.
Dako: Was beschäftigt die Menschen in Siberien denn überhaupt?
Stasiuk: Das Zizn‘, das Leben, der alltägliche Kampf um das Benzin im Tank, um die tausend Kilometer zur Familie zurücklegen zu können. Hungern tut man in Sibirien nicht mehr, doch die Menschen haben immer noch keine Hoffnung auf ein besseres Leben. Hauptsache, es wird nicht schlimmer. Moskau und der Kreml funktionieren in den Köpfen wie ein mythisches Märchenland.
Dako: Hast du einen Unterschied in der Mentalität der Russen und der übrigen Völker Sibiriens bemerkt?
Stasiuk: Klar. Wenn in Irkutsk überhaupt jemand gearbeitet hat, dann waren es vor allem Chinesen. Die Russen saßen entweder in ihren Taxis oder schimpften, dass die Chinesen ihnen die Arbeit wegnehmen und die Miliz nichts dagegen tun. Ihnen fehlt das Gefühl der Verwurzelung, das die Burjaten zum Beispiel haben. Die zeigten mehr Eifer und Optimismus. Manchmal bewiesen sie sogar demonstrativ Geringschätzung oder gar Verachtung für die Russen, dass die nichts zustande kriegen und sich ins Koma saufen. In den Kontakten mit uns waren sie meist zurückhaltender. Es sei denn, sie hatten etwas getrunken, was auch vorkam. Dann hielt man sich besser zurück.
Dako: Darin unterscheiden sie sich vermutlich nicht von betrunken Russen oder Polen.
Stasiuk: Du irrst dich. Die Burjaten vertragen den Alkohol schlechter und reagieren extremer darauf. Doch wenn sie nüchtern sind, weißt du wenigstens, woran du bist. Gewöhnlich sind sie höflich, leicht distanziert, sie respektieren, dass du anders bist. Bei den Russen ist das nicht so. Sie wollen sofort Freundschaft schließen. Es reichte, dass wir ein paar Tage bei jemandem am Baikal wohnten, schon kam es beim Abschied zu herzzerreißenden Szenen. Tränen, Getatsche, wozu ich überhaupt keine Lust hatte. Wir hatten schließlich nur eine Unterkunft gemietet und dafür bezahlt. Klar, wir haben viel geredet und hatten eine angenehme Zeit, aber dass man beim Abschied gleich losschluchzt und sich der Freundschaft versichert? Dako: Diese überschwengliche Gastfreundschaft hast du vermutlich auch auf dem Balkan gefunden?
Stasiuk: Im Süden und Osten Europas herrscht tatsächlich eine ungewöhnliche Gastfreundschaft. Aber in Russland und auf dem Balkan wird das geradezu übergriffig. Du existierst nicht mehr als gesonderte Person. Du hast die Vorstellungen deines Gastgebers von Gastfreundschaft zu erfüllen und basta. Das macht keinen Spaß. Aber du weißt, dass ich ein asozialer Sonderling bin und es nicht mag, wenn man mich zum Trinken und Essen zwingt.
Dako: Vielleicht ist das ein Symptom der berühmten russischen Seele?
Stasiuk: Ich scheiß auf die russische Seele. In Ulan-Ude auf dem glavnaja plosad‘ steht ein großer Leninkopf. Angeblich der größte der Welt. Alle, die wir trafen, waren furchtbar stolz draauf. Jedesmal wurden wir gefragt, ob wir den Lenin gesehen hätten. Ja, antworteten wir, aber er hat keinen besonderen Eindruck auf uns gemacht. Ein andermal sprach uns ein angeheiterter Russe an und wollte sich anfreunden: „A takie gory u Was jest? Takoj les u was jest?“ Wir wussten nicht, was wir sagen sollten. Normale Berge eben, und ein bißchen Gestrüpp. Dieser Nationalstolz verdeckt nur den totalen Saustall dort und riesige Komplexe. Meine Frau Monika hatte nach drei Wochen genug von Russland. Als wir im Auto von Warschau zurückfuhren, sagte sie: „Weißt du, ich wäre glücklich, wenn uns jetzt die polnische Polizei anhalten würde.
“ Dako: Habt ihr schlechte Erfahrungen mit der russischen Miliz gemacht?
Stasiuk: Nein, aber uns reichten diese prüfenden Blick unter den breiten Mützen. In Tschita oder Zabajkalsk wurden wir sofort als Fremde enttarnt. Sogar in Irkutsk, das ja viele Nationalität hat, reagierten die Menschen auf dem Basar sehr lebhaft auf uns. Besonders wenn sie Olaf sahen, der rotblond ist.
Dako: Kapuciski beschreibt im Imperium seine Reise mit der Transsibirischen Eisenbahn und erwähnt die Überlegungen des russischen Philosophen Nikolaj Berdjajew über den Einfluss der weiten russischen Räume auf die russische Seele. Er stellt im Einklang mit dem Russen fest, dass seine Landsleute die meiste Energie auf die Erhaltung des riesigen Landes verwenden müssen, statt eine dynamische, intensive Kultur zu schaffen. Stimmst du dem zu?
Stasiuk: Wenn du dort bist und diese Landschaften siehst, kannst du nur auf solche Gedanken kommen. Die menschliche Erfahrung zählt nicht viel, sie existiert nicht, ist sekundär gegenüber der Erfahrung des monotonen Raumes. Russland ist ein schrecklich depressives, langweiliges Land.
Dako: Die Landschaften oder die Menschen?
Stasiuk: Alles. Die Zivilisation, die Kultur und die Landschaften. Uns ist dort nichts Schlimmes zugestoßen, uns hat nur die furchtbare Melancholie und Traurigkeit erdrückt. Die meisten Orte ähnelten einander. Sogar die russische Natur ist – wie Viktor Jerofejew treffend schrieb – einfach jammervoll. Nehmen wir nur den Mythos der Taiga am Baikal. Es gibt dort keine üppige Pflanzenwelt, denn die Vegetationsperiode ist zu kurz, als dass die Pflanzen sich voll entwickeln könnten. Du gehst dort hinein, du gehst zwei, drei Stunden lang und weißt, dass dieser triste Wald sich noch weitere zweitausend Kilometer s hinziehen wird. Gelangweilt habe ich mich nur deshalb nicht, weil das für mich etwas Neues war, etwas, was etwas über mein Verhältnis zu Russland aussagte.
Dako: Ein – milde gesagt – ziemlich negatives Verhältnis.
Stasiuk: Weder negativ, noch positiv. Eigenschaftslos. Aus meiner Jugend erinnere ich mich, dass der Kontakt mit dem Russischen für mich wie der Kontakt mit der totalen Langeweile war. Die Erzählungen der Russisch-Lehrerinnen, ihre hölzerne Sprache, diese aufgeblasenen Illustrationen aus dem „Sputnik“, das Üben der Lesestücke. Das war die Langeweile, die ich jetzt auch auf dieser Reise wieder erlebt habe.
Dako: Dostojewski, Tolstoj, Bulhakow haben dich auch gelangweilt?
Stasiuk: Die russische Literatur habe ich mir, wie die meisten aus meiner Generation, ohne großes Nachdenken angeeignet. Bulhakow flog durch mich hindurch wie das Futter durch die Gans. Dostojewski hatte ich vorher gelesen und kam nie mehr auf ihn zurück. Einzig Platonow wirkt auf mich. Aber sein Schreiben ist mehr als russisch. Dako: Kapuciski hat neben der Rückständigkeit und dem monstrual aufgeblähten Raum die fortschreitende Modernisierung Russlands wahrgenommen. Er kritisierte das vereinfachte und eindimensionale Bild des mächtigen, wiewohl rückständigen Landes mit Massen von passiven Bürgern, das im Westen und in Polen noch immer funktioniert.
Stasiuk: Ich schätze Kapuciski, aber ich habe mir die Bilder aus Sibirien nicht ausgesucht. Ich habe das Leben dort so beobachtet, wie es ist.
Dako: Glaubst du nicht, dass eine dreiwöchige Reise zu wenig ist, um die Wahrheit über so ein riesiges Land wie Russland zu erfahren?
Stasiuk: Mich interessiert diese sogenannte „Wahrheit“ überhaupt nicht. Wenn ich irgendwo hinfahre, will ich meine Phantasie in Gang bringen und keinen journalistischen Bericht liefern. Ich bin nicht Kapuscinski, der die gesamte Literatur über ein Land studierte, bevor er irgendwo hinfuhr. Er war Reporter aus Fleisch und Blut, ich bin ein Idiot, der beschreibt was er sieht, oft auch bestimmte Dinge nicht versteht oder sie sich einbildet. Ich mag seine Bücher, aber ich habe eine andere Auffassung von der Welt und der Literatur. Er schrieb Selbstverständlichkeiten über Russland, ich schreibe, was ich mir darunter vorstelle. Die Reisen sollen auf meine Sinne wirken, meine Phantasie, sollen mich zum Nachdenken anregen. In dem Buch, das ich zusammen mit Olaf schreibe, werden meine inneren Erfahrungen vorkommen, die für Russland weder gut noch schlecht, sondern gemischt sind. In mir ist nach der Reise nach Sibirien weder Enttäuschung noch Euphorie. Ich lese Platonow, das reicht mir. Es stimmt alles. Du fährst und fährst und fährst und siehst kein Ende. Der totale Verfall, Verpintscherung der Materie, der Kultur, von allem, und gleichzeitig der große Aufbruch zu etwas Kosmischem, Überweltlichem. Russland wollte immer nur entweder das Absolute oder gar nichts. Die Mitte blieb leer. Ich kann verstehen, dass Kalder dort gelandet ist, weil es ihn erregt hat, aber nicht unbedingt, weil es ihm dort gefiel. Ich glaube, dass Russland schon zu fesseln vermag.
Dako: Würdest du gerne noch einmal hin?
Stasiuk: Ich würde lieber Zentralasien sehen, die Steppe dort. Kirgisien, Usbekistan, Tadschikistan – das macht mich an.
Dako: Steppe gibt es auch in der Ukraine genug. Von allen Ländern der ehemaligen Sowjetunion passt sie dir wohl am ehesten.
Stasiuk. Die Ukraine ist mir näher, vertrauter, dort habe ich ein paar Freunde.
Dako: Ist die Ukraine noch Mittel- oder schon Osteuropa?
Stasiuk: Ich weiß nicht, ich kenne die Ukraine nicht gut. Das weiteste war für mich Kiew, meist besuche ich Jurij Andruchowych in Stanislawów (Stanislau) oder gehe mit Taras Prochasko in die Berge. Er ist ein ausgezeichneter Führer. Er kennt Czarnohora und Gorgany wie seine Westentasche. Das sind die wahren, wilden Karpaten, nicht unsere unausgegorenen Bieszczaden hier.
Dako: Könntest du die Grenze zwischen Mittel- und Osteuropa ziehen?
Stasiuk: Diese Teilung hat keinen Sinn, ich finde sie völlig überflüssig.
Dako: Das klingt seltsam aus dem Mund eines Mannes, der als Schriftsteller Mitteleuropas gilt.
Stasiuk: Etiketten interessieren mich nicht. Ich fahre und schreibe, worüber ich will, es spielt für mich keine Rolle, ob das Ost- oder Mitteleuropa ist.
Dako: In dem Buch Mein Europa hast du mit Andruchowytsch über Mitteleuropa geschrieben. Du hast dir sogar sein Wappen „mit Halbdunkel im einen und Leere im anderen Feld“ ausgedacht. Das erste Feld sollte deiner Meinung nach das „Ungewisse“, das andere „den noch immer unerschlossenen Raum“ symbolisieren. Glaubst du nicht, dass dieses Wappen wie angegossen auch auf Russland oder Osteuropa im weiteren Sinne passt?
Stasiuk: Dieses Wappen war lediglich ein literarisches Verfahren. Es ging darum, die Wirklichkeit hübsch in eine Metapher zu fassen. Ich bereue es sehr, den Terminus „Mitteleuropa“ einmal so unvorsichtig gebraucht zu haben. Den Begriff Mitteleuropa haben sich die Deutschen ausgedacht. So wie „Osteuropa“ ist er ein rein geopolitischer Begriff, mich aber interessieren die Landschaft, die Natur, die Menschen. Niemand wird aus mir je einen politischen Autor oder Journalisten machen, dagegen verwahre ich mich
. Dako: Ist es nicht so, dass Mitteleuropa dir einfach langweilig geworden ist und du deshalb nach Russland gefahren bist? Wie oft kann man Rumänien, Ungarn oder Albanien besichtigen?
Stasiuk: Gerade nach Albanien werde ich demnächst wieder mit Olaf fahren. Von Woowiec in den Niederen Beskiden, wo ich wohne, habe ich es ganz nah nach Südeuropa. In viereinhalb Stunden bin ich mit dem Auto in Rumänien. Dieser Teil unseres Kontinents ist viel interessanter als Russland, und die Ländern haben menschliche Ausmaße. Das war meine Antwort auf die Frage meiner russischen Übersetzerin, als sie mich fragte, wie wir in diesem engen, von Grenzen durchschnittenen Europa leben könnte.
Dako: Vielleicht magst du Russland und die Russen einfach nicht?
Stasiuk: Ob ich Russland mag oder nicht mag, spielt überhaupt keine Rolle. Natürlich habe ich in meiner Jugend, wie viele meiner Landsleute, die „Iwans“ verachtet. Ich wollte nicht Russisch lernen. Aber heute bin ich ein großer Junge, und die Russen sind mir einfach egal. Wie übrigens alle anderen Völker auch.
Dako: Ist Russland deiner Meinung nach eher ein asiatisches oder ein europäisches Land?
Stasiuk: Weiß nicht, habe nicht darüber nachgedacht. Als ich in Moskau in Scheremetjewo landete, hatte ich das Gefühl, nur zwei Schritt von Asien entfernt zu sein. Dafür hatte ich in Irkutsk den Eindruck, dass dort noch eine Abart von Europäertum zu finden ist, wenn auch deformiert.
Dako: Die Russen werden es nicht mögen, wie sie in deinem neuen Buch dargestellt sind. Aber wie werden Stasiuks andere Bücher dort aufgenommen?
Stasiuk: Damit muss ich leben. Ich schreibe nicht, um jemandem zu gefallen. Bisher sind vier meiner Bücher ins Russische übersetzt. Mag sein, dass sie jemand gelesen hat, ich jedenfalls habe keine Kopeke vom Verkauf gesehen. In Irkutsk hatte ich eine Lesung, zu der mehrere Dutzend Leute kamen, obwohl niemand etwas von mir gelesen hatte. Dafür fragten mich alle, ob ich Russland schon lieb gewonnen hätte. Mir ist auch etwas von einem Theater in Orjol zu Ohren gekommen, das ein Stück von mir aufgeführt hat. Ich glaube, mit meiner Popularität in Russland ist es nicht weit her.
Dako: Das sieht in der Ukraine schon erheblich besser aus. Übersetzungen deiner Bücher und vieler anderer polnischer Autoren aus dem Verlag Czarne habe ich sogar im fernen Charkow in den Buchhandlungen gefunden. Findet die polnische Literatur den Weg leichter in die Ukraine?
Stasiuk: Ich glaube schon. Da besteht einfach eine größere Anziehungskraft. Sie sind für uns so etwas wie der mythische „Osten“, und wir für sie ein bißchen der magische „Westen“; aber gleichzeitig ähneln wir einander, sind ineinander verstrickt, miteinander verbunden. Jedem zweiten Ukrainer fällt irgendwann ein, dass er eine polnische Urgroßmutter hat, und wenn ein Pole etwas getrunken hat und seine Gefühle zum Ausdruck bringen will, dann versucht er sich wenigstens vokalistisch in einen Ukrainer zu verwandeln. Ja, mit der Ukraine ist das leichter, weil wir die Ukraine einfach in uns haben. Russland auch, aber doch weniger und eigentlich gegen unseren Willen. © Deutsch von Olaf Kühl

Kreditgenossenschaftswerbung

Freinet-Genossenschaft (Werbung?)
Andrej Platonow fegte zuletzt den Hof des Moskauer Literaturinstituts. Die meisten seiner Werke erschienen erst lange nach seinem Tod, auf Deutsch veröffentlichte sie in der Wende nahezu komplett der Verlag Volk und Welt. Bei Wikipedia heißt es über ihn:
„Der Sohn eines Metallarbeiters und Ältester von 10 Kindern wurde 1899 in einem Dorf in der Nähe von Woronesch geboren. Nach seiner Jugendzeit in verschiedenen Berufen und dem Militärdienst in der Roten Armee, wurde er 1924 Ingenieur und schrieb kurze Stücke für Zeitungen. Er begann Anfang der 1920er Jahre mit der Veröffentlichung von Erzählungen und Gedichten, zugleich arbeitete er als Spezialist für Landgewinnung in Zentralrussland. Hier wurde er Augenzeuge der durch die Zwangskollektivierung verursachten Veränderungen und Schäden. 1927 wurde er hauptberuflicher Schriftsteller in Moskau. Er war ein Mitglied der landwirtschaftlichen Schriftstellervereinigung Perewal und schuf die Kurzgeschichtensammlung Die Epiphaner Schleusen. Seine beiden Hauptarbeiten, die Romane Tschewengur und Die Baugrube, entstanden zwischen 1926 und 1930 in etwa mit dem Beginn des ersten Fünfjahresplans 1928. Diese Arbeiten, mit ihrer impliziten Systemkritik brachten ihm heftige offizielle Kritik ein und obgleich ein Kapitel von ‘Tschewengur’ in einer Zeitschrift erschien, wurde keines seiner Werke vollständig veröffentlicht.
Während der stalinistischen Grossen Säuberung der 1930er Jahre, wurde Platonows fünfzehnjähriger Sohn verhaftet und in ein Arbeitslager deportiert, wo er an Tuberkulose erkrankte. Als er schließlich zurückgebracht wurde, steckte sich Platonow bei der Pflege an. Während des 2. Weltkrioeges wurde Platonow als Kriegsberichterstatter eingesetzt, aber sein Gesundheitszustand verschlechterte sich. Nach dem Krieg verlegte er sich vom individuellen literarischen Schaffen auf das Sammeln von Volkserzählungen und gab zwei Sammelbände heraus. Er starb 1951.
Heute gilt Platonow als einer der größten und vor allem sowjetischsten Schriftsteller – und sein posthumer Ruhm wächst.“
Unbedingt Was Tun:
In der Anfangszeit der Kollektivierung “vergesellschaftete” man hier und da sogar das Geflügel. Michail Alexandrowitsch Scholochow schilderte einen erfolgreichen Aufstand der Bäuerinnen gegen diesen revolutionären Rigorismus, den Stalin dann selbst – Anfang 1930 – in seinem berühmten Artikel “Vor Erfolgen von Schwindel befallen” kritisierte.
Andrej Platonow begab sich nach Erscheinen dieses Artikels – im Auftrag der Zeitschrift “Krasnaja now” (Rote Neuigkeit) – sofort in sein Heimatgebiet Woronesh, wo er sich zuvor als Ingenieur an der Melioration und Elektrifizierung beteiligt hatte, um diese von Stalin proklamierte Wende in der Kollektivierungspolitik von unten mit zu bekommen. Seine währenddessen entstandene “Armeleutechronik ‘Zu Nutz und Frommen’” wurde zwar 1931 gedruckt, aber nachdem Stalin eigenhändig “Ubljudok” (Schweinehund) auf die Ausgabe geschrieben hatte, mußte der Chefredakteur Alexander Fadejew sich von ihr distanzieren. Er bezeichnete sie als “Kulakenchronik” und den Autor als “Kulakenagent”, der “das wirkliche Bild des Kolchosaufbaus und -kampfes verfälscht” und “die kommunistischen Leiter und Kader der Kolchosbewegung verleumdet” habe.
Der Erzähler in Platonows “Chronik” ist eine “dämmernde Seele”, “zerquält von der Sorge um das Gemeinwohl”, der unruhig von einem Kollektiv zum anderen über Land wandert. In all seinen Büchern sind die Leute unterwegs, in der “Chronik” ist es Platonow selbst, ein “Pilger durchs Kolchosland” – der das Dorf verstand, wie Viktor Schklowski bereits 1926 feststellte, indem er aktiv an seiner Entwicklung teilnahm, denn “wertvolle Beobachtungen entspringen nur dem Gefühl emsiger Mitarbeit”. Diese Überzeugung teilte Platonow mit Sergej Tretjakow, der sich ebenfalls auf Viktor Schklowski berief, als er meinte, “der Schriftsteller muß in Arbeitskontakt mit der Wirklichkeit treten”. 1930 stellte Tretjakow sich dem nordkaukasischen Kombinat “Herausforderung”, einer Vereinigung von 16 Kolchosen, für Bildungsarbeit zur Verfügung. Anschließend veröffentlichte er das Buch “Feld-Herren” darüber, das bereits im Jahr darauf auf Deutsch herauskam und hier fast zu einem Bestseller wurde. Es ist jedoch mehr von bolschewistischem Enthusiasmus als von wirklicher Kenntnis des Dorfes und der Landwirtschaft getragen – dazu absolut staatstragend.
Der eher anarchistisch inspirierte Platonow ließ dagegen bereits 1928 in seinem Essay “Tsche-tsche-O” seinen Helden sagen: “Die Kollektive in den Dörfern brauchen wir jetzt mehr als den Dnjeprostroi…Und schon bereitet der Übereifer Sorgen…verschiedene Organe versuchen, beim Kolchosaufbau mitzumischen – alle wollen leiten, hinweisen, abstimmen…”, so zitiert ihn die Platonow-Expertin der DDR Lola Debüser, die darauf hinweist, dass der Autor die Tragik und letztlich das Scheitern der Kollektivierung vor allem im “staatlich-bürokratischen und repressiven Mechanismus” von oben sah, der den “Garten der Revolution” mit seinen “kaum erblühten Pflanzen” zerstampfte.
Das Ringen mit dieser “mechanischen Kraft des Sieges” thematisierte Platonow auch in seinen zwei Romanen aus dem “Jahr des großen Umschwungs” 1929: “Tschewengur” und “Die Baugrube”. In diesem läßt er z.B. einen Kulaken sagen: “…ihr macht also aus der ganzen Republik einen Kolchos, und die ganze Republik wird zu einer Einzelwirtschaft…Paßt bloß auf: Heute beseitigt ihr mich, und morgen werdet ihr selber beseitigt. Zu guter Letzt kommt bloß noch euer oberster Mensch im Sozialismus an.” Daneben ging es Platonow auch um die durch die Mechanik der Macht (wieder) forcierte Trennung von Kopf- und Handarbeit, mit der die ganzheitlichen Maßstäbe und die bewußte Teilnahme des Einzelnen am Aufbau des Sozialismus zerstört werden.
“Der Mensch war [durch die siegreiche Revolution] – so empfand Platonow das zumindestens – aus dem System der sozialen Determiniertheit ‘herausgefallen’, alles schien möglich und leicht realisierbar,” schreibt der russische Platonowforscher L. Schubin. Aber diese Möglichkeiten wurden nach und nach von der “Mechanik der Macht” zurückgedrängt. “Die Technik entscheidet alles,” verkündete Stalin 1934 und meinte damit nicht nur die Industrialisierung der Landwirtschaft – vom Traktor bis hin zu agronomischen Verfahren, sondern auch die administrativ umgesetzten neuen Erkenntnisse der Wissenschaft – vor allem der “proletarischen Biologie” (Mitschurin/Lyssenko). Der französische Marxist Charles Bettelheim merkte dazu 1971 an: “Wer hier handelt, das ist die Technik, und es ist der Bauer, auf dessen Rücken gehandelt wird”.
In seinen Samisdat-”Aufzeichnungen aus dem Untergrund” kam Boris Jampolski 1975 zu einer ähnlichen Einschätzung: “Wenn [E.T.A.] Hoffmann schreibt: ,Der Teufel betrat das Zimmer’, so ist das Realismus, wenn die [Sowjetschriftstellerin] Karajewa schreibt: ,Lipotschka ist dem Kolchos beigetreten’, so ist das reine Phantasie.” Für diese Autorin ist Literatur “staatliches Schönschreiben”, könnte man dazu mit Platonow auch sagen. In seinem Roman “Tschewengur” läßt er einen seiner Helden zu der Erkenntnis kommen: “Hier leben keine Mechanismen, hier leben Menschen, die kann man nicht in Gang setzen, solange sie nicht selbst ihr Leben einrichten. Früher habe ich gedacht, die Revolution ist wie eine Lokomotive. Jetzt aber sehe ich: Nein, jeder Mensch muß seine eigene Dampfmaschine des Lebens besitzen…damit mehr Kraft da ist. Sonst kommt man nicht vom Fleck.” Auf dem Plenum der KPdSU zur Agrarpolitik am 15. März 1989 formulierte es zuletzt Michail Gorbatschow rückblickend so: “…die Führung des Landes ging [Ende der Zwanzigerjahre] nicht den Weg der Suche nach ökonomischen Methoden, um die Probleme und Widersprüche zu lösen, sondern einen anderen, direkt entgegengesetzten Weg – den Weg des Abbaus der NEP,…der administrativen Kommandomethoden…Die natürliche Unzufriedenheit der Bauern wurde als eine Art Sabotage gedeutet. Und damit wurde die Notwendigkeit repressiver Maßnahmen gerechtfertigt…Im Agrarsektor lebten die Methoden außerökonomischen Zwangs aus den Zeiten des Kriegskommunismus wieder auf”.
Hierzulande kennen wir dagegen den “ökonomischen Zwang im Agrarsektor” nur allzu gut – wenn auch in umgekehrter Weise: “Wer nicht wachsen will muß weichen”, sagen die Bauern dazu, d.h. von der EU wird permanent eine Politik der Liquidierung der Dorfärmsten als Klasse betrieben – zugunsten der Kulaken. Dies entspricht der US-Entwicklungspolitik in Agrarländern. In Platonows “Armeleutechronik” sucht der unstete Wanderer demgegenüber einen humanistischen Weg. Im Kolchos “Kulakenfrei” trifft er auf den Vorsitzenden Senka Kutschum, der eine interessante Kollektivierungspolitik betreibt. Und im Kolchos des Vorsitzenden Kondrow geht die Kollektivierung so erfolgreich und ohne Überspitzungen voran, , “weil er selbständig denkt und andere zum Mitdenken auffordert, auch weil er sich gegen unqualifizierte Direktiven von oben wehrt. Kondrow ist glücklich, als Stalins Artikel seinen vernünftigen Weg bestätigt. Platonows Erzähler stellt fest: ‘…es gab Orte, die frei blieben von schwindelerregenden Fehlern…Doch leider waren solche Orte nicht allzu zahlreich’.” Stattdessen gab es viele Aktivisten, die nur allzu bereit waren, jede Maßnahme der Administration zu exekutieren.
In “Die Baugrube” hat Platonow solch einen porträtiert: “Auch dem Aktivisten war der gelbliche Abendhimmel, diese Begräbnisbeleuchtung, aufgefallen, und er beschloß, gleich morgen früh das Kolchosvolk zu einem Sternmarsch zu formieren, der in die umliegenden Dörfer führen sollte, die sich noch immer ans Einzelbauerntum klammerten…Der Aktivist befand sich noch auf dem Orghof, die vorige Nacht hatte nichts erbracht, keine einzige Direktive war von oben herab auf den Kolchos geflattert, und so mußte er notgedrungen den Gedanken im eigenen Kopf freien Lauf lassen. Doch sie brachten Unterlassungsängste mit sich. Braute sich nicht doch Wohlstand auf den Einzelgehöften zusammen? War ihm in dieser Beziehung etwas entgangen? Andererseits war nichts gefährlicher als Übereifer – deshalb hatte er nur den Pferdebestand vergesellschaftet und grämte sich nun über die vereinsamten Kühe, Schafe und Hühner, denn in der Hand des spontanen Einzelbauern konnte schließlich auch der Ziegenbock zum Hebel des Kapitalismus werden.”
Platonow spielt hier sowohl auf die Parteirechten um Bucharin an, die für eine eher sanfte Kollektivierung plädiert hatten, gegenüber den Linken, die Stalin mit den Trotzkisten aus der Partei ausgeschlossen hatte. Diese befürworteten eine noch radikalere Lösung der Bauernfrage. Später wandte sich Stalin auch gegen die Bucharinisten. In der Kolchose von Gremjatschi Log, deren Entwicklung Scholochow beschreibt, wird der Aktivist Makar Nagulnow wegen seines Kampfes für die “hundertprozentige Kollektivierung” plötzlich des Trotzkismus verdächtigt. Er verteidigt sich: “Ich bin nicht Trotzki wegen mit den Hühnern nach links geraten. Er wollte nur so schnell wie möglich “den Eigentumsmenschen, den Kleinbürger matt setzen”. Er muß sich jedoch sagen lassen, dass solche linksradikalen “Verzerrungen” und “ungebührliche Drohungen gegen Bauern” bei der Kollektivierung laut Stalins Artikel “Vor Erfolgen vom Schwindel befallen” nur dem Feind nützen – also dem “rechten Opportunismus”. Die Kollektivbauern bekamen daraufhin ihr Kleinvieh und sogar eine Kuh zurück – und Stalin legte genau fest, wieviel Morgen Land jeder in Zukunft privat bewirtschaften durfte. Damit gerieten viele Kolchosen erneut in Schwierigkeiten, denn die Bauern arbeiteten bald lieber auf ihrem kleinen Privathof als in der großen Kollektivwirtschaft.

Schweizer Genossenschaftswerbung

Berliner Konsumgenossenschaftswerbung von Zille
Kropotkin im Gespräch mit Lenin – über Genossenschaften
Ich kann die Zusammenkunft von Wladimir Iljitsch und Peter Alexejewitsch Kropotkin mit annähernder Sicherheit zwischen den 8. und 10. Mai (1919) datieren. Wladimir Iljitsch bestimmte die Zeit nach den Arbeitsstunden des Sovnarkom (Rat der Volkskommissare) und benachrichtige mich, daß er gegen fünf Uhr in meiner Wohnung sein würde. Ich teilte Peter Alexejewitsch telefonisch Tag und Stunde des Treffens mit und schickte ihm um diese Zeit einen Wagen.
Wladimir Iljitsch erschien früher bei mir als Peter Alexejewitsch. Wir sprachen über die Werke der Revolutionäre früherer Zeiten; Wladimir Iljitsch gab während dieser Diskussion seiner Meinung Ausdruck, daß zweifellos bald die Zeit käme, in der wir vollständige Ausgaben unserer Emigrantenliteratur und ihrer führenden Autoren sehen würden, mit allen erforderlichen Anmerkungen, Vorworten, und allem anderen Untersuchungsmaterial.
“Dieses ist äußerst notwendig”, sagte Wladimir Iljitsch. “Nicht nur müssen wir selbst die Geschichte unserer revolutionären Bewegung studieren, sondern wir müssen auch jungen Forschern und Schülern die Möglichkeit geben, eine große Anzahl von Artikeln zu schreiben, die auf diesen Dokumenten und auf diesem Material fußen, um möglichst große Massen mit dem vertraut zu machen, was in Rußland während der vergangenen Generation existierte. Nichts wäre verderblicher, als zu glauben, die Geschichte unseres Landes begänne mit jenem Tag, an dem die Oktoberrevolution ausbrach. Trotzdem hören wir diese Meinung jetzt sehr häufig. Solch eine Dummheit ist es nicht wert, daß man sie diskutiert. Unsere Industrie ist wieder hergestellt, die Papier- und Druckkrise geht vorüber, und wir werden hunderttausend Exemplare solch eines Buches wie die “Geschichte der französischen Revolution” von Kropotkin drucken und andere seiner Werke; trotz der Tatsache, daß er Anarchist ist, werden wir seine gesammelten Werke in jeder nur denkbaren Weise herausgeben, mit allen notwendigen Anmerkungen für den Leser, damit er deutlich den Unterschied zwischen den kleinbürgerlichen Anarchisten und der wahren kommunistischen Weltanschauung des revolutionären Marxismus versteht”.
Wladimir Iljitsch nahm ein Buch von Kropotkin aus meiner Bibliothek und ein anderes von Bakunin, die ich seit 1905 besaß, und durchblätterte sie schnell, Seite für Seite. In diesem Augenblick erfuhr ich, daß Kropotkin angekommen war. Ich ging, um ihn zu begrüßen. Er stieg langsam unsere ziemlich steile Treppe hinauf. Ich begrüßte ihn, und wir gingen in mein Arbeitszimmer. Wladimir Iljitsch durchschritt schnell den Korridor und bewillkommte, warm lächelnd, Peter Alexejewitsch. Peter Alexejewitsch errötete und sagte gleich zu ihm: “Wie glücklich bin ich, Sie zu sehen, Wladimir Iljitsch! Wir haben Meinungsverschiedenheiten in einer ganzen Reihe von Fragen, den Mitteln der Aktion, und der Organisation. Aber unsere Ziele sind die gleichen, und was Sie und Ihre Genossen im Namen des Kommunismus tun, ist meinem alten Herzen sehr nahe und teuer”.
Wladimir Iljitsch nahm ihn beim Arm und führte ihn sehr aufmerksam und höflich in mein Arbeitszimmer, ließ ihn in einem Sessel Platz nehmen und setzte sich ihm gegenüber an den Schreibtisch.
“Nun, da unsere Ziele dieselben sind, gibt es vieles, das uns in unserem Kampf verbindet”, sagte Wladimir Iljitsch. “Natürlich ist es möglich, sich einem und demselben Ziel auf verschiedenen Wegen zu nähern, aber ich glaube, daß unsere Wege in vielerlei Hinsicht zusammengehen müßten”.
“Ja, sicherlich”, unterbrach Peter Alexejewitsch, “aber ihr verfolgt die Genossenschaften und ich bin für sie”. “Und wir sind für sie” , rief Wladimir Iljitsch lebhaft aus, “aber wir sind gegen die Art von Genossenschaften, hinter denen sich Kulaken, Landbesitzer, Händler und privates Kapital im allgemeinen verbergen. Wir wollen einfach dieser falschen Genossenschaft die Maske abreißen und den breiten Massen der Bevölkerung die Möglichkeit geben, einer echten Genossenschaft beizutreten”.
“Das will ich nicht bestreiten”, antwortete Kropotkin, “und natürlich muß man, wo immer es dergleichen gibt, dieses mit aller Strenge bekämpfen, da man aller Unwahrheit und Täuschung entgegentritt. Wir brauchen keinen Deckmantel; wir müssen jede Lüge unbarmherzig bloßstellen, überall. Aber in Dmitrov sehe ich, daß man Genossenschaften verfolgt, die nichts mit denen, die Sie gerade erwähnten, gemein haben; und dieses, weil die lokalen Autoritäten, vielleicht gerade die Revolutionäre von gestern, wie jede andere Autorität verbürokratisiert sind, zu Beamten konvertiert, die ihren Untergebenen die Zügel anziehen – und sie glauben, daß ihnen die gesamte Bevölkerung untergeben ist”.
“Wir bekämpfen die Bürokraten überall und zu jeder Zeit”, sagte Wladimir Iljitsch. “Wir bekämpfen die Bürokraten und die Bürokratie, und wir müssen die Überbleibsel mit den Wurzeln ausreißen, wenn sie noch in unserem neuen System nisten; letztlich, Peter Alexejewitsch, verstehen Sie sehr gut, daß es sehr schwierig ist, die Menschen zu ändern, daß, wie Marx sagte, die furchtbarste und uneinnehmbarste Festung der menschliche Schädel ist! Wir ergreifen alle nur denkbaren Maßnahmen, um in diesem Kampf zu siegen; und in der Tat, das Leben selbst zwingt natürlich, viel zu lernen. Unser Mangel an Kultur, unsere fehlende Bildung, unsere Rückständigkeit, sind natürlich überall offenkundig, und niemand kann uns, als Partei, als Regierungsmacht, für das tadeln, was in der Maschinerie dieser Macht an Fehlern begangen wird; noch weniger für das, was in der Tiefe des Landes, weit entfernt von den Zentren, geschieht”.
“Es ist deswegen jedoch keineswegs leichter für die, die dem Einfluß dieser unaufgeklärten Autorität ausgesetzt sind”, rief Peter Alexejewitsch Kropotkin aus, “welche sich bereits als zersetzendes Gift für diejenigen erweist, die sich diese Autorität für sich selber aneignen”.
“Aber es gibt keinen anderen Weg”, fügte Wladimir Iljitsch hinzu. “Man kann keine Revolution machen, wenn man weiße Handschuhe trägt. Sie wissen sehr gut, daß wir eine große Zahl von Fehlern gemacht haben und machen werden, daß es viele Unregelmäßigkeiten gibt, und viele Menschen unnötig gelitten haben. Aber was korrigiert werden kann, werden wir korrigieren; wir werden unsere Irrtümer eingestehen, die häufig nur simpler Dummheit anzulasten sind. Es ist aber unmöglich, während einer Revolution keine Fehler zu begehen. Keine zu begehen hieße dem Leben gänzlich entsagen und überhaupt nicht zu handeln. Wir aber haben es vorgezogen, Irrtümer zu begehen und zu handeln. Wir wollen und werden handeln, trotz aller Fehler, und wir werden unsere sozialistische Revolution zum schließlichen und unvermeidlichen siegreichen Ende führen. Und Sie können uns dabei helfen, indem Sie uns all ihre Informationen über Unregelmäßigkeiten mitteilen. Sie können sicher sein, daß jeder von uns sich dieser Informationen mit größter Sorgfalt annehmen wird”.
“Ausgezeichnet”, sagte Kropotkin. “Weder ich noch sonst jemand wird sich weigern, Ihnen und all Ihren Genossen so weit wie möglich zu helfen, aber unsere Hilfe wird hauptsächlich darin bestehen, Ihnen all die Unregelmäßigkeiten zu berichten, die überall vorkommen und unter deren Auswirkungen die Menschen an vielen Orten stöhnen…”
“Nicht das Stöhnen, sondern das Geschrei der widerstehenden Konterrevolutionäre, demgegenüber wir ohne Gnade waren und sind…,”
“Aber Sie sagen, es sei unmöglich, ohne Autorität auszukommen”, begann Peter Alexejewitsch erneut zu theoretisieren, “und ich sage, es ist möglich. Wohin Sie auch blicken, entsteht eine Grundlage für die Autoritätslosigkeit. Ich habe gerade die Nachricht empfangen, daß in England die Dockarbeiter in einem der Häfen eine hervorragende, gänzlich freie Genossenschaft organisiert haben, die ständig von Arbeitern aller anderen Industriezweige besucht wird. Die Genossenschaftsbewegung ist enorm und ihre Bedeutsamkeit sehr groß…”
Ich beobachtete Wladimir Iljitsch. Seine Augen glitzerten ein wenig spöttisch, und er schien, indem er Peter Alexejewitsch aufmerksam zuhörte, verblüfft, daß jemand angesichts des ungeheuren Aufschwungs und der mitreißenden Bewegung der Oktoberrevolution nur von Genossenschaften und immer wieder von Genossenschaften sprechen konnte. Und Peter Alexejewitsch fuhr fort, unaufhörlich darüber zu sprechen, wie noch an einem anderen Ort in England desgleichen eine Genossenschaft organisiert worden sei, wie an irgendeinem dritten Ort, in Spanien irgendeine kleine Föderation errichtet werde, welchen Aufschwung die syndikalistische Bewegung in Frankreich genommen habe… “Es ist in der Tat schädlich”, konnte sich Wladimir Iljitsch nicht enthalten einzuwerfen, “der politischen Seite des Lebens keinerlei Aufmerksamkeit zu widmen und offensichtlich die arbeitenden Klassen zu demoralisieren, sie abzulenken vom unmittelbaren Kampf…”
“Aber die syndikalistische Bewegung vereinigt Millionen; dies allein ist ein bedeutender Faktor”, sagte Peter Alexejewitsch erregt. “Zusammen mit der Genossenschaftsbewegung ist dies ein ungeheurer Schritt vorwärts…”
“Das ist schön und gut”, unterbrach ihn Wladimir Iljitsch “Natürlich ist die Genossenschaftsbewegung wichtig, ebenso wie die syndikalistische Bewegung schädlich ist. Wie läßt sich das bestreiten? Das ist ganz offensichtlich, wenn sie erst einmal eine wirkliche Genossenschaftsbewegung wird, verbunden mit den großen Massen der Bevölkerung. Aber ist das wirklich der Punkt? Ist es möglich, gerade hierdurch zu etwas Neuem zu gelangen? Glauben Sie wirklich, die kapitalistische Welt wird sich dem Weg der Genossenschaftsbewegung fügen? Sie versucht durch jede Maßnahme und mit allen Mitteln, die Bewegung in ihre Hände zu bekommen. Und diese kleine Genossenschaft, eine Handvoll englischer Arbeiter ohne Macht, wird zermalmt und erbarmungslos zum Diener des Kapitals gemacht werden; diese neu entstehende Entwicklung in der Genossenschaftsbewegung, die Sie so sehr begrüßen, wird in direkter und absoluter Abhängigkeit durch tausende von Fäden sein, die sie wie ein Spinnennetz umgeben. Das alles ist engstirnig! Sie werden mir vergeben, aber das ist alles Unfug! Wir brauchen die direkte Aktion der Massen, die revolutionäre Aktion der Massen, diese Aktivität, die die kapitalistische Welt an der Gurgel packt und sie zu Fall bringt. Jetzt aber gibt es diese Aktivität nicht, gar nicht zu reden von Föderalismus oder Kommunismus oder sozialer Revolution. Das alles ist Kinderei, nutzloses Geschwätz, hat keinen realistischen Boden unter sich, keine Kraft, keine Bedeutung und fast nichts, sich unseren sozialistischen Zielen zu nähern. Ein direkter und offener Kampf, ein Kampf bis auf den letzten Blutstropfen – das ist es, was wir brauchen. Der Bürgerkrieg muß überall ausgerufen werden, unterstützt durch alle revolutionären und oppositionellen Kräfte, soweit sie nur irgend in solch einem Bürgerkrieg gehen können. Es wird viel Blut vergossen werden, und es wird viele Greuel in solch einem Kampf geben. Ich bin überzeugt, daß diese Greuel in Westeuropa noch größer als in unserem Land sein werden, wegen des schärferen Klassenkampfes dort und der größeren Spannung der entgegengesetzten Kräfte, die in diesem vielleicht letzten Gefecht mit der imperialistischen Welt bis zum letzten kämpfen werden”.
Wladimir Iljitsch erhob sich von seinem Stuhl, nachdem er dies alles klar und deutlich, mit Lebhaftigkeit, gesagt hatte. Peter Alexejewitsch saß zurückgelehnt in seinem Sessel und lauschte mit einer Aufmerksamkeit, die in Teilnahmslosigkeit überging, den feurigen Worten Wladimir Iljitschs. Danach sprach er nicht mehr von Genossenschaften.
”Natürlich sind Sie im Recht”, sagte er. “Ohne Kampf kann nichts in irgendeinem Land vollbracht werden, ohne den verzweifeltsten Kampf…”
“Aber nur ein massiver”, rief Wladimir Iljitsch. “Wir brauchen nicht den Kampf und gewaltsame Akte einzelner Personen. Es ist höchste Zeit, daß die Anarchisten dies verstehen und damit aufhören, ihre revolutionäre Energie an gänzlich nutzlose Dinge zu verschwenden. Nur in den Massen, nur durch die Massen und mit den Massen, von Untergrundarbeit zu massivem roten Terror, wenn es nötig ist, zum Bürgerkrieg, zu einem Krieg an allen Fronten, zu einem Krieg aller gegen alle – nur diese Art des Kampfes kann von Erfolg gekrönt sein. Alle anderen Wege – die der Anarchisten eingeschlossen – wurden der Geschichte überlassen, den Archiven, und sie sind von keinerlei Nutzen für irgendjemand, ungeeignet für jeden; niemand wird von ihnen angezogen, und sie demoralisieren nur diejenigen, die sich aus irgendeinem Grund zu diesem alten, unbrauchbar gewordenen Weg verleiten lassen…”
Wladimir Iljitsch unterbrach sich plötzlich, lächelte höflich und sagte: “Vergeben Sie mir. Es scheint, daß ich fortgerissen wurde und Sie ermüde. Aber so ist es nun einmal mit uns Bolschewisten. Dies ist unser Problem, unser Cognac, und es geht uns so nahe, daß wir nicht ruhig darüber reden können”. “Nein, nein”, antwortete Kropotkin. “Es ist äußerst erfreulich für mich, alles, was Sie sagen zu hören. Wenn Sie und all Ihre Genossen in dieser Art denken, wenn sie nicht von der Macht vergiftet sind und sich selbst sicher fühlen vor der Versklavung durch die staatliche Autorität, dann werden sie vieles vollbringen. Dann ist die Revolution wirklich in zuverlässigen Händen”.
“Wir werden es versuchen”, antwortete Lenin gutmütig, “und wir werden sehen (er gebrauchte seinen bevorzugten Satz), daß niemand von uns eingebildet wird und zu hoch von sich selber denkt. Das ist eine furchtbare Krankheit, aber wir haben ein exzellentes Heilmittel: wir werden diese Genossen zurück an die Arbeit schicken, zu den Massen”. “Das ist ganz ausgezeichnet”, rief Peter Alexejewitsch aus. “Meiner Meinung nach sollte dieses jeder viel häufiger tun. Dies ist sinnvoll für alle. Man darf niemals den Kontakt mit den arbeitenden Massen verlieren, und man muß wissen, daß es nur mit den Massen möglich ist, all das zu vollbringen, was in unseren progressivsten Programmen niedergelegt ist. Aber Sozialdemokraten und uninformierte Menschen in allen Ländern glauben, daß es in eurer Partei viele Nichtarbeiter gibt, und daß dieser Bestandteil an Nichtarbeitern die Arbeiter korrumpiert. Was nötig ist, ist das Gegenteil: der Bestandteil an Arbeitern sollte überwiegen, und die Nichtarbeiter sollten den arbeitenden Klassen nur durch Unterweisung helfen, ein Gebiet des Wissens oder ein anderes zu meistern; sie wären wie ein Hilfselement in der einen oder anderen sozialistischen Organisation”.
“Wir brauchen aufgeklärte Massen”, sagte Wladimir Iljitsch, “und es wäre wünschenswert, wenn z.B. Ihr Buch, “Geschichte der französischen Revolution”, sofort in einer sehr hohen Auflage herausgebracht würde. Schließlich ist es für jeden nützlich. Wir würden dies ausgezeichnete Buch sehr gerne publizieren und es in einer Anzahl herausbringen, die für alle Bibliotheken, Leseräume der Dörfer und Kompaniebüchereien der Regimenter ausreichte”.
“Aber wo kann es veröffentlicht werden? Ich werde kein staatliche Ausgabe dulden…” “Nein, nein”, unterbrach Wladimir Iljitsch Peter Alexejewitsch schlau lächelnd. “Natürlich, nicht im Staatsverlag, sondern in einem genossenschaftlichen Verlag…” Peter Alexejewitsch nickte zustimmen. “Nun dann”, sagte er sichtlich erfreut über diese Ermunterung und diesen Vorschlag, “wenn Sie das Buch für interessant und nützlich halten, stimme ich zu, es in einer billigen Ausgabe herauszubringen. Vielleicht läßt sich ein genossenschaftlicher Verlag finden, der es annimmt …”
“Wir finden einen, wir finden einen”, versicherte Wladimir Iljitsch. “Ich bin davon überzeugt”. Damit begann sich die Unterredung zwischen Peter Alexejewitsch und Wladimir Iljitsch zu erschöpfen. Wladimir Iljitsch sah auf seine Uhr, erhob sich und sagte, er müsse sich auf eine Sitzung des Rates der Volkskommissare vorbereiten. Er sagte Peter Alexejewitsch auf das herzlichste Lebewohl, und fügte hinzu, daß er immer froh sein würde, Briefe und Instruktionen von ihm zu bekommen, denen immer ernsthafte Aufmerksamkeit geschenkt werden würde. Peter Alexejewitsch sagte uns Lebewohl und ging zur Tür, durch die Wladimir Iljitsch und ich ihn hinaustreten sahen. Er fuhr im selben Automobil ab, um in seine Wohnung zurückzukehren.
(Aus: Peter Kropotkin – Unterredung mit Lenin sowie andere Schriften zur russischen Revolution, Verlag „Die Freie Gesellschaft“, Hannover 1980. Der Text wurde von Max Otto Lorenzen übersetzt, die Originalquelle ist in der Broschüre leider nicht angegeben. Es ist daher auch nicht ersichtlich, wer über diese Unterredung zwischen Kropotkin und Lenin berichtet.)

Chinesische Werbung für die kleinste genossenschaftliche Einheit

taz-Genossenschaft

Kissenbezug einer Pferdezuchtgenssenschaft

Und das machen die Genetikanhänger aus der cooperacion: ein Gen eine Geno!
Kai Ehlers zitiert den Moskauer Agrarsoziologen Theodor Schanin u.a. mit dem Satz: „Ich glaube, dass Wissen einen eigenen Wert hat, der nicht durch Einkommen, Profit, Zustimmung des Staates oder Regierungsaufgaben aufgewertet werden muß.“
Auf der Flucht vor den aggressiv gegen die bürgerlichen Genetiker vorgehenden Anhänger der „proletarischen Biologie“ wich der Moskauer Biologe Dimitrij Beljajew nach Sibirien aus, wo er sich als Holzfäller verdingte – bis eine Kolchose bei Nowosibirsk, die Silberfüchse züchtete, ihn holte, damit er ihre Tiere zahmer mache. Beljajew sah darin die Chance, den Neodarwinismus aus der Peripherie gegen den voluntaristischen Lamarckismus des Zentrums empirisch zu erhärten:
Mit seinen Domestikationsversuchen bei den Silberfüchsen wollte er wollte nachweisen, dass man die “soziale Intelligenz” wie bei den Hunden, die als einzige Tiere selbst versteckte Hinweise des Menschen mit der Hand oder den Augen verstehen, herauszüchten kann: „Selektion auf Kommunikation“,
konkret: auf zahmes und zutrauliches Verhalten. Kriterium der Auslese war die Fluchtdistanz. Nach 35 Generationen und 45.000 Füchsen war Berdjajew am Ziel, in einigen Berichten heißt es, bereits nach 18 Generationen: Die Tiere waren zahm. Es hatten sich jedoch einige ungewollte Eigenschaften eingestellt: Die Füchse verhielten sich wie domestizierte Hunde, sie sahen auch so aus (scheckig, Schlappohren, erhobene Schwanzspitzen), die Weibchen wurden jetzt zweimal im Jahr läufig, sie hörten sich sogar an wie Hunde. Keines dieser äußeren Merkmale war Zuchtziel gewesen und z. T. sogar völlig unerwünscht. Zur Pelzgewinnung konnte man gescheckte Tiere nicht brauchen. Die Art zerfiel regelrecht (Coppinger, R. u. L., 2001, S. 67) Außerdem hatten sie noch ein Merkmal, das bereits Konrad Lorenz bei domestizierten Tieren aufgefallen war, nämlich ‘niedliche’ Gesichter, runde – wie Teddybären. So sehen alle Säugetiere aus, wenn sie klein sind. In der freien Natur streckt sich später der Schädel, er wird lang und spitz. Die zahmen Füchse blieben Rundköpfe! Damit war klar, dass auch die Hunde vor 10.000 Jahren nicht auf äußerliche Merkmale gezüchtet worden waren. Diese stellten sich vielmehr von selbst ein, wenn man auf Verhalten zielte.
Beljajew erlebte seinen Erfolg nicht mehr; er starb in den 80er-Jahren. Nach dem Zerfall der Sowjetunion mußte sein Institut Mitarbeiter entlassen und die Fuchszucht verkleinern. Dann entdeckte es der Harvard-Wissenschaftler Brian Hare: “Er hat sich mit den übrig gebliebenen Kollegen aus Nowosibirsk zusammengetan und getestet, ob die Füchse auch können, was die Hunde können: den Hinweisen des Menschen folgen. Sie können es, obwohl sie nie darauf trainiert wurden (näheres siehe ‘Current Biology’, 15, S. 226).
Zuerst war in US-Zeitungen die Rede davon, dass all dies dem Harvard-Wissenschaftler Hare gelungen sei. Neuerdings verkaufen jedoch die deutschen Intelligenzblätter das neodarwinistische Berdjajew-Experiment – als deutsche Heldentat. Die USA reagierten darauf mit einer Herabstufung der Kreditwürdigkeit einer Reihe von Eurostaaten, um ringsum Deutschland den Druck zu erhöhen, damit das Land sich nicht länger auch noch mit dieser Pionierleistung schmücke.

Tanzende Eisbären. Photo: via Annette Cornelia Eckert (FB)
Im Internet findet man nebenbeibemerkt jede Menge Anfragen: „Welche Wohnungsbau-Genossenschaft erlaubt Hunde?“ In seinem Buch „Genossenschaften von Lebewesen auf Grund gegenseitiger Vorteile“ bezeichnet der Wiener Amphibienforscher Paul Kammerer diese „Lebensgemeinschaften“ von Haustieren und Menschen als eine ebensolche „Symbiose“ wie etwa die von Pilzen und Algen, die sich zu „Flechten“ zusammengeschlossen haben. Mit dieser „Kooperation“ begann die Symbioseforschung – von einigen russischen Botanikern. Sie begriffen diese als Ergänzung des darwinschen Prinzips der Konkurrenz (des Kampfes ums Dasein). So sah das etwa zur gleichen Zeit auch Kropotkin in seiner Studie über „Die Gegenseitige Hilfe in der Tier- und Menschenwelt“, ebenso dann Paul Kammerer. 1908 schrieb er in seinem Buch „Symbiose – neue Weltanschauung“: „Ohne die Annahme einer ‚Vererbung erworbener Eigenschaften‘ lassen sich die Symbioseerscheinungen nicht verstehen, und umgekehrt.“ Ungeachtet dieses lamarckistischen Credos veröffentlichte er im Jahr darauf in einer Wiener Biologenzeitschrift einen Text über „Symbiose und Kampf ums Dasein als gleichberechtigte Triebkräfte der Evolution“. Der o.e. Interviewband von Kai Ehlers bezeichnet durchweg die Verzahnung zwischen kleinen Selbstorganisationen und großen Kollektiven in Russland als eine „Symbiose“ – die das Besondere in der russischen, sowjetischen und postsowjetischen Ökonomie ausmache.
Als „Hohepriesterin der Symbiose“ wurde zuletzt die US-Mikrobiologin Lynn Margulis bezeichnet – von ihren darwinistischen Gegnern. Sie führte die Symbioseforschung der russischen Botaniker fort, bis dahin, dass für sie jede Zelle eine Genossenschaft war, eines ihrer letzten Bücher heißt „Symbiotic Planet“. Das Internetforum „realitysandwich.com“ veröffentlichte zur Erinnerung an die vor einigen Wochen gestorbene Lynn Margulis einen Nachruf von Simon G. Powell:
„Richard Dawkins, formidable commander of both the Queen’s English and a veritable worldwide army of devoted reductionists, once referred to the late Lynn Margulis as the „high priestess of symbiosis“. Was this a warm colourful accolade or a shrewd slight? Given that Dawkins has spent decades steadfastly clinging to his beloved selfish gene paradigm and has even spoken of selfish cooperation when dealing with the symbiotic side of life that Margulis championed, I suspect his sentiment was not entirely benign. Although Dawkins openly admired Margulis for persevering with the theory that various cell organelles evolved through a process of endosymbiosis, and while aware, like any biologist, that the web of life evinces all manner of symbiotic relationships, he always seemed distinctly rattled by the social connotations that symbiosis invariably evokes. After all, unlike the notion of selfish genes, mutually beneficial cooperation sounds nice. Two or more organisms working together in an integrated and coherent way? Why, symbiosis has an almost ‘lovey-dovey‘ and ‘new-agey‘ air to it! Goddess forbid that we should draw any social lessons from such intimate biological arrangements! Best, then, to employ a cunning linguistic trick and make this embarrassingly alluring aspect of life disappear. Or at least shove it out of the way. Hence Dawkins use of the clumsy term ‘selfish cooperation‘ (as opposed to speaking of, say, emergent higher order selves, or even unconscious cooperation).
According to Dawkins, we might be impressed by two living systems working in some sort of mutually beneficial accord but in reality it is nothing more than a convoluted extension of selfishness. Don’t be too moved by the astonishing sight of a pollen dusted humming bird feeding on a symbiotic nectar rich bloom! Don’t let exotic symbiotic corals (that are a union of an animal and an alga) blow your mind! Don’t gloat too long over a picture of a bobtail squid packed full of symbiotic bioluminescent bacteria! Move on people, this symbiosis business is all smoke and mirrors. Life is, at heart, no more than inert bits of digital DNA code that know nothing of cooperation and harmonious coexistence but only the competitive drive to replicate. If their phenotypic expression is involved in some exquisite symbiotic arrangement or another, then this is really beside the point.
Such was the kind of paradigmatic resistance that Margulis was up against. It is probably no coincidence that it was a woman who came to the fore promoting the significance of symbiosis in the evolution of life — and not just the symbiotic origins of mitochondria and chloroplasts or the symbiosis evinced by corals or flowering plants and their pollinators, but even the emergence of new species through the process of symbiogenesis (this is still a contentious issue — but examples continue to emerge). Is there something deeply feminine about cooperation? Is the drive for co-existence somehow more active in the female psyche than in the male psyche? In any case, legend tells us that Margulis had a really hard time convincing her academic male superiors that certain organelles within mammalian cells were once free living bacteria. It’s one thing to note the symbiotic alliance of, say, cleaner fish with their bigger fish customers (who could easily gobble up the diminutive cleaners if they wanted), but when you realise that mitochondria (the energy engines of animals) and chloroplasts (the energy engines of plants) were once separate living micro-organisms that are now symbiotically woven inside animals and plants, symbiosis emerges as a kind of advanced technique learned by life, so sophisticated and subtle in deployment that we may be blind to it. If, however, we acknowledge the important role symbiosis has played in life’s evolution, the way we perceive life begins to change. Life is no longer seen to be wholly red in tooth and claw — but rather symbiotic in embrace and interchange (at least where possible).
Ever since the publication of Darwin’s The Origin of Species, the general trend has been for biologists and evolutionists (traditionally men) to ‘big up‘ the role of competition, fighting and bloodshed within life’s web. Dog eat dog. Predator and prey. The biological arms race. Survival of the fittest. War and attrition. Head-banging ruts. Leonine infanticide. Parasitic wasps. Army ants. Strangler figs. The battle for resources. In the wake of Margulis’s work however, it is clear that relentless competition is not the sole theme of life. Far from it. Then again, we surely know this deep down. When we walk through a pristine ecosystem, we don’t emerge traumatized and tearful at all the violence and aggravated competitiveness on display. True, competition is evident if our senses are keen. Maybe we observed some birds fighting over a territorial branch. Or the skeletal remains of a mouse eaten by some predator. Or two different species of ant in combat. Or maybe we were bitten by some insectile critter oblivious to our protestations. But such competition was not the whole of the picture was it? If we were really astute we would be aware that about three quarters of all the plant species in the forest had symbiotic fungi attached to their roots — some so intimately entwined that the fungi actually penetrate the membrane of plant cells in order to swap precious living materials. Along with this invisible underground alliance, we would also be wise to the various bacteria that engage in recycling and thereby foster a kind of eco-systemic symbiosis that aids the forest’s sustainability. We would be aware of all the insect species that pollinate the plants. We would also know that the gene complexes inside insects that foster nectar seeking only make sense in the context of the gene complexes inside plants that make nectar (and pollen) bearing flowers. We would likewise realise that the patches of lichen on any rocks we chanced across were composed of tightly cooperative amalgams of fungi and algae. We would be aware of the symbiotic cellulose dining gut bacteria at work inside any ruminants we chanced across (like deer). We might also divine the symbiotic exchange of gases between the plant kingdom and the animal kingdom. Symbiosis is everywhere. Regardless of its alluringly warm connotations, cooperation and synergistic networking are a major feature of life on Earth, a real kind of naturally selected wisdom that makes multicellular life as we know it possible.
The emotional connotations conveyed by certain words and concepts probably also explains why Gaia theory — also avidly promoted by Margulis — found such an icy reception when it first went mainstream back in 1979 after the publication of James Lovelock’s first Gaia book. Gaia has obvious associations with mothers and mythical feminine beings. Gaia suggests nurturing and even maternal love. It is also captures an immense concept — all of life on Earth along with the atmosphere, oceans and soil interconnected into one totality. How at odds with reductionism is such a concept? Exemplified by Dawkins’s rhetoric, there has been an all out attempt by mainstream biology to reduce the artistry of life (and we can all admit that evolving life is exceedingly artistic in terms of organic creativity) to mindless bits and pieces. Like genes. Genes are small and readily quantifiable. Compare this to an entire cell whose contextual configuration will determine what happens within its bounded domain. Also consider large collections of cells and the extensive self-organizing structures that zillions of cells and zillions of genes are involved in making. Unlike immobile stretches of DNA, this vast flowing network of biological relationships is far harder to get one’s head around. Gaia is not simply symbiosis as seen from space as Margulis asserted, but emergent holism with a vengeance. Indeed, symbiosis itself is emergent holism in action. Not everything can be understood by parts alone — some phenomena require a broader vision to perceive. Life is a result of both bottom-up gene oriented processes and top-down contextual processes.
As it stands, if we describe the intricacies of life with terms like ‘dumb‘, ‘blind‘ and ‘selfish‘, then eyebrows tend not to raise. Yet these terms are pejorative. What, one wonders, is our obsession with pejorative terminology when describing the essence of life and its evolution? For the plain truth is that evolving life is the most astonishing process we know of. Organisms are such fabulous systems of self-generating bio-logic and organized complexity that hosts of biology students annually gain PhDs and increase their intelligence and insight by studying and documenting them. As for the genetic code (a code!), it is, as Watson and Crick rightly admitted, ingenious. Yet at the end of the day many influential scientists still insist on reducing the craftsmanship of life to selfish bits. We would never deconstruct an acclaimed classic painting or an acclaimed classic piece of music in this kind of way. Worse, if you try and describe life (or bio-logic) as a kind of natural technology or a natural intelligence (albeit unconscious), this is considered heresy of the highest order. And this is despite the fact that life has, over millions of years, learned the canny art of living and being-perhaps the most refined art of all (and despite also the fact that life has learned how to engineer the conscious human cortex with its ability, if it so wishes, to be stubbornly reductionistic!).
If Margulis’s work is to fruit, I strongly believe that we have to acknowledge symbiosis as a key operating principle of life on Earth and, moreover, attempt to install that operating principle within our culture. This would be in line with the burgeoning biomimicry movement whose guiding premise is that we can learn from Nature and mimic life’s long tested technology for our own ends. After all, our current way of life is beleaguering the health and integrity of the whole biosphere, so we would do well to maximize the lessons we learn from life. We hear talk of sustainability everywhere, from both government and industry. But we often forget that sustainability is not something we invented — life got there first. Think about the fact that a rainforest can sustain itself for millions of years. How come it does not drown in its own waste, or suffer death by relentless internal conflicts, or exhaust its resources? How come a rainforest just keeps going and keeps clean, vibrant and biodiverse without any help from ecosystem managers or ecosystem stewards? Indeed, how did the entire web of life sustain itself for over 3.5 billion years? Clearly life must be doing something right. There must be, as intimated, operating principles of some specific kind. Chief among these is assuredly symbiosis for, as Margulis attested, various forms of symbiosis permeate the web of life. Which means that if seven billion of us wish to sustain our existence then we have no choice but to become an extension of life’s already established modus operandi. Given that we are life — or at last a recently evolved expression of life — this means that we have to play by the same rules and the same symbiotic logic that much of life abides by. Yet human history abounds in overtly parasitic behaviour towards the biosphere (and even towards one another). We have pretty much run amok and done as we pleased, plundering every possible biospherical resource with no thought of a sustainable morrow, rather like belligerent children running amok in a sophisticated playground and clueless about the various smart life principles that underlie their daily existence.
As I have attempted to show in my book Darwin’s Unfinished Business, life is an interconnected, ever-evolving, ever-learning ‘onestuff‘. Conscious human intelligence is part of this smart onestuff and can take life to new levels of networked coherency not yet dreamed of. But we don’t realize this yet — we know not what we are and the true nature of that of which we are embedded parts. Until we do, until we realize fully that we are a conscious expansion of life on Earth’s ancient acumen, we shall remain an immature species and fail to become symbiotically integrated with the rest of life’s great web. We are not stewards or caretakers of the biosphere, but rather apprentices — for we can learn from the wisdom already accumulated by the biosphere and embodied in its deeply interconnected ecosystems. The sooner we acknowledge symbiosis as a crucial operating principle of life and find ways of creating some kind of symbiotic culture, the sooner we can regenerate the bountiful organic paradise that we first encountered all those millennia ago and whose memory still lingers in the dim recesses of our minds. Like it or not, as individuals, as cultural citizens and as planetary beings, we have no choice but to become symbiotic every which way possible. Strength lies not simply in numbers but in their integration and cooperation. Gaia is both tough bitch and wise teacher as Margulis knew full well. Her legacy must continue to ramify.“
Die Universität Berkeley schreibt in ihrem Forum zur Geschichte des Evolutiondenkens:
„Symbiotic microbes = eukaryote cells?
In the late 1960s Margulis studied the structure of cells. Mitochondria, for example, are wriggly bodies that generate the energy required for metabolism. To Margulis, they looked remarkably like bacteria. She knew that scientists had been struck by the similarity ever since the discovery of mitochondria at the end of the 1800s. Some even suggested that mitochondria began from bacteria that lived in a permanent symbiosis within the cells of animals and plants. There were parallel examples in all plant cells. Algae and plant cells have a second set of bodies that they use to carry out photosynthesis. Known as chloroplasts, they capture incoming sunlight energy. The energy drives biochemical reactions including the combination of water and carbon dioxide to make organic matter. Chloroplasts, like mitochondria, bear a striking resemblance to bacteria. Scientists became convinced that chloroplasts (below right), like mitochondria, evolved from symbiotic bacteria — specifically, that they descended from cyanobacteria (above right), the light-harnessing small organisms that abound in oceans and fresh water. When one of her professors saw DNA inside chloroplasts, Margulis was not surprised. After all, that’s just what you’d expect from a symbiotic partner. Margulis spent much of the rest of the 1960s honing her argument that symbiosis was an unrecognized but major force in the evolution of cells. In 1970 she published her argument in The Origin of Eukaryotic Cells.

Piratengenossenschaft
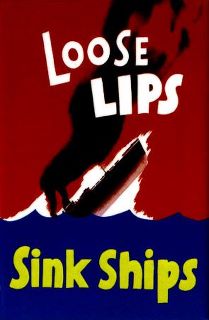
WKZwo-Propaganda-Plakat
Die Piratengenossenschaft Garowe-Nord meldete gestern:
„Überfälle sind unsere Landwirtschaft. Erneut wurden zwei Ernteaktionen vorzeitig bekannt gemacht.“ (Muß wahrscheinlich Enteraktionen heißen – Anm.d.Red.)
AP meldet heute aus Somalia:
Die Lösegeldeinnahmen somalischer Piraten haben einer britischen Studie zufolge zur wirtschaftlichen Entwicklung einiger Landesteile beigetragen. Dabei profitierten vor allem regionale Zentren, hieß es in einer Untersuchung des Forschungsinstituts Chatham House. Die Küstendörfer, von denen die Schnellboote der Piraten starten, zeigten hingegen kaum Fortschritt. Für die Studie wertete die Autorin Anja Shortland Satellitenaufnahmen und Daten von UN und nichtstaatlichen Organisationen aus.
Besonders deutlich sei die Entwicklung von Garowe, der Hauptstadt der halbautonomen Region Puntland. Puntland ist eine Schwerpunktgegend der Piraterie. So zeige der Vergleich der Satellitenaufnahmen von 2002 und 2009 die Verdoppelung der Stadtgröße, schreibt Shortland. Investiert wurde demnach in Wohnbauten, Industrie und Handelsstrukturen.
Die Analyse von Nachtaufnahme zeige zudem einen deutlichen Anstieg des Elektrizitätsverbrauchs in den Städten Garowe und Bossaso, erläutert Shortland. Die Dörfer an der Küste bleiben hingegen ohne Zugang zum Stromnetz. Ähnlich wie bei der Stromversorgung zeige die Lohnentwicklung im Land ein Gefälle. Seit Untersuchungsbeginn im Jahr 2000 sind laut Shortland in den Piratenregionen die Löhne deutlich stärker gestiegen als in Vergleichsgebieten.
Shortland kommt zu dem Schluss, dass die Piraten das Lösegeld in den regionalen Zentren investiert haben. Die Gewinne seien dadurch weit mehr Menschen zugute gekommen als bisher angenommen. Die Chatham-Autorin geht davon aus, dass die lokalen Politiker deshalb auch künftig wenig gegen die Piraterie unternehmen werden.
Infolge der starken internationalen militärischen Präsenz in den somalischen Gewässern ist die Zahl der Piratenangriffe zuletzt leicht zurückgegangen. Die EU kämpft unter deutscher Beteiligung mit der Mission „Atalanta“ gegen die ihrer Meinung nach Kriminellen. Nach Angaben des „Internationalen Maritimen Büros“ sind derzeit zehn Schiffe und 172 Geiseln in der Hand somalischer Piraten.
Neue Genossenschafts-Werbung:
http://www.stories.coop/stories/video/new-pioneers#.Tw6RTNFJvXc.facebook http://www.stories.coop/stories/video/cooperative-you#.TwwsaxyyEj0.facebook
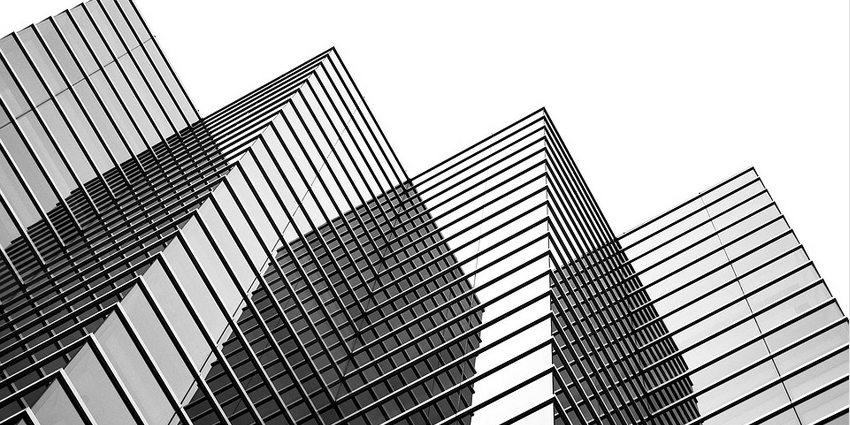



Alles Kulturelle muß jetzt koste es was es wolle an den Tahrirplatz-Ereignissen anknüpfen:
Das Einstein-Forum veranstaltet einen Workshop über „Gewaltfreien Widerstand“ auf Englisch – mit einem russischen Juristen und einer Kairoer Menschenrechtlerin als Publikumsmagneten.
Im Anarchoclub „Machno“ denkt man laut über die Gewaltfrage in Syrien nach, ebenso in der Jungen Welt und in der Partei der Linken, wobei es dort jedoch eher um eine Einhegung der Kämpfe qua arabischem Patriachalgelaber geht, um die überkommene und seit 1989 zerfallende antiimperialistische Front nicht noch mehr zu schwächen.
Die Konrad-Adenauer-Stiftung macht sich laut Gedanken über die verschiedenen Fraktionen der Herrschenden in Ägypten.
Im Mehringhof steht eine „Einschätzung“ der arabischen Aufstände nach einem Jahr auf dem Programm.
In der taz fragt sich eine Sonderkommission, was hat dieses Jahr der Kämpfe den arabischen Frauen gebracht.
Und natürlich ist jedes zweite Kunstevent, vor allem, wenn es vom Staat bezahlt wird, direkt oder indirekt dem Tahrirplatz verpflichtet.
„Was gibt es überhaupt in der Geschichte, was nicht Hoffnung auf oder Angst vor der Revolution ist?“ fragte sich Michel Foucault.
Bei dem aktuellen Kunst/Kultur-Schwurbel fragt man sich: Ist es eine Beschwörung/Bekräftigung dieser Hoffnung oder der Furcht…
Bei manchen „Projekten“ ist das ganz leicht zu entscheiden: so z.B. bei dem des deutschen Wirtschaftsministeriums, das überall an den U-Bahnausghängen, wo es zu den Jobcentern in Berlin geht, Plakate aufhängen ließ mit der Aufschrift: „Noch nie gab es so viele Jobs wie heute. Danke Deutschland.“ Im Hintergrund fummelt ein dümmlich lächelnder Azubi an einem Windrotor rum. Ein richtig ärgerliche Propagandalüge, fast schon wieder faschistisch. Aber wir werden diesen Drecksäcken schon beikommen.
epd meldet am 21.1. aus Syrien:
Frauen spielen nach Einschätzung der syrischen Schriftstellerin Rosa Yassin Hassan eine zentrale Rolle bei den Protesten gegen die Regierung. „Wegen der unglaublichen Gewalt können Frauen nicht auf Demonstrationen gehen“, sagte sie dem Evangelischen Pressedienst (epd) bei den Arabischen Literaturtagen in Frankfurt. Protestierende würden geschlagen und beschossen. Zum Großteil seien es aber Frauen, die Medizin oder Essen zu den Aktivisten schmuggelten, berichtete die 37-Jährige. Daneben versorgten Frauen Verletzte in Feldlazaretten. Aktivistinnen sind nach Hassans Worten auch häufig daran beteiligt, Fotos und Videos außerhalb des Landes zu schmuggeln. Die Kontrollen der Sicherheitskräfte seien bei Frauen meist weniger streng, berichtet die Autorin.
Die Proteste gegen die Regierung von Präsident Baschar al-Assad hätten bereits Veränderungen ausgelöst, die nicht mehr rückgängig zu machen seien. „Ich bin fest davon überzeugt, dass das syrische Volk nicht mehr nach Hausen gehen wird“, sagte die Autorin. „Aber der Preis für die Freiheit wird hoch sein.“ Das Regime gehe extrem brutal gegen Oppositionelle vor und wolle um jeden Preis an der Macht bleiben. Ein Mittel dazu sei das Schüren von Konflikten zwischen den verschiedenen Konfessionen. Viele Aktivisten besuchen nach Hassans Worten daher bewusst Trauerfeiern von Opfern des Regimes, die anderen Religionsgemeinschaften angehören. Damit wollten sie zeigen, dass die Revolution kein Kampf zwischen den Konfessionen sei.
Hassans Bücher sind in Syrien nur in zensierter Form erschienen. Wegen ihres Engagements für Frauenrechte und Demokratie war sie sechs Jahre lang mit einem Reiseverbot belegt, das erst kurz vor ihrem Flug nach Frankfurt ausgelaufen ist. Wegen ihrer Bücher sei sie immer wieder verhört worden, berichtete Hassan. Dennoch komme es für sie nicht infrage, ihr Heimatland zu verlassen. „Man erlebt in seinem Leben nicht oft eine Revolution“, sagte die Schriftstellerin.