
Milchsäurebakterien sind für die Herstellung von Silage als Kuhfutter notwendig, ebenso für die Verdauung der Silage im Kuhmagen und dann auch noch für die Herstellung von Milch in der Kuh und zu ihrer Verdauung in unseren Mägen. Mit Milchsäurebakterien arbeiten aber auch die Genetiker gerne – beruflich.
Der Berater von Biotech-Unternehmen, William Bains, schrieb in der Zeitschrift „Nature Biotechnology“: „Die meisten Anstrengungen in der Forschung und in der biotechnologischen industriellen Entwicklung basieren auf der Idee, dass Gene die Grundlage des Lebens sind, dass die Doppelhelix die Ikone unseres Wissens ist und ein Gewinn für unser Zeitalter. Ein Gen, ein Enzym, ist zum Slogan der Industrie geworden…Kann das alles so falsch sein? Ich glaube schon, aber ich bin sicher, das macht nichts. Denn die Hauptsache ist, dass es funktioniert: Manchmal funktioniert es, aber aus den falschen Gründen, manchmal wird es mehr Schaden anrichten als Gutes tun…Aber die beobachtbare Wirkung ist unbestreitbar…Wir müssen nicht das Wesen der Erkenntnis verstehen, um die Werkzeuge zu erkennen…Inzwischen führen die Genom-Datenbanken, die geklonten Proteine und anderes Zubehör der funktionalen Genetik zu Werkzeugen, Produkten, Einsichten, Karrieren und Optionen an der Börse für uns alle.“
Und so wird munter versucht, das Leben zu verbessern – z.B. Bakterien herzustellen, die ölverschmutzte Meere säubern – ein Auftrag, den der Genetiker Craig Venter vor einigen Jahren von einem amerikanischen Ölkonzern bekam. Der 1991 verstorbene brasilianische Philosoph Vilem Flusser verkündete optimistisch: „Mit der Gentechnik beginnt die wahre Kunst. Erst mit ihr sind reproduktive Werke möglich.“ Im alten Europa und speziell in Deutschland ist man da noch etwas vorsichtiger. In Widerspruch zu Jürgen Habermas und dessen Kritik an gentechnische Veränderung bzw. Neuschaffung von Lebewesen, stellte sich der Oliver Sacks nachfolgende „Chemosoph“ Joachim Schummer. In einem kürzlich veröffentlichten Essay bestritt er:
1. dass die Labor-Firma des „Gentechnik-Papstes“ (BZ)) Craig Venter tatsächlich neues „Leben“ hergestellt hat, und
2. dass dies – falls doch – verwerflich ist. Um so mehr, da er Begriffe wie „Leben“ und „Herstellen“ überhaupt als „metaphysisch“ abtut.
Der Vorkämpfer der „synthetischen Biologie“ Craig Venter, auch „Lord of the Genes“ in den USA genannt, hatte 2010 der Weltpresse verkündet, ihm sei es gelungen, „das Genom einer lebenden Hefezelle“ [also eines Pilzes], zu „synthetisieren“ und dieses in einem Bakterium einzupflanzen [wo es sich fortan mit diesem Einzeller zusammen vermehrte]. Schumanns medien-ethischer Aufsatz, der in der Warnung gipfelt, Wissenschaft und Medien würden sich gegenseitig hochschaukeln: die einen mit zunehmend haltloseren Gewinnversprechungen, die anderen mit immer hysterischeren Warnungen davor, muß man nicht weiter diskutieren.
Der Neodarwinist Neville Seymonds, ein Schüler des Physikers Erwin Schrödinger, jubelte – nachdem dieser 1943 sein für die Molekulargenetik bahnbrechendes Buch „Was ist Leben?“ veröffentlicht hatte: Damit „hörte die Biologie auf, eine ‚unernste‘ Beschäftigung zu sein und wurde erwachsen.“ Und das hieß – auf gut amerikanisch: Sie wurde ein Geschäft! „Nun können wir den Menschen definieren“, erklärte 1962 der Nobelpreisträger und Genforscher Joshua Lederberger. Er sei eine „1,80 Meter lange besondere Molekülsequenz – der Länge der DNS, die eng gewunden im Zellkern des Eis ruht, aus dem er hervorgegangen ist.“
Und damit kann man nun arbeiten
Allen voran der Hirnforscher Craig Venter von der John Hopkins University in Baltimor. Er „hat mit seinen neuen Sequenziertechniken und dazugehöriger Software das Chromosom 7 untersucht und nach eigenen Angaben 90% von dessen Genen identifiziert und beansprucht laut Spiegel mehr als tausend ‚geistige Eigentumstitel‘. Venter hat Anteile an der von seinem Partner William Hasetine gegründeten Firma Human Genome Science und betreibt selbst eine Sequenzierfabrik. Da er sein Verfahren hat patentieren lassen, muß jeder, der es anwendet, Lizenzen zahlen.
Hauptinvestor der beiden erwähnten Firmen sind die Pharmakonzerne Smithkline Beechan und Incyte Pharmaceuticals. Sie haben sämtliche Erstverwertungsrechte an den Erkenntnissen. Diese Rechte sollen in vermarktbare »Gentests« verwandelt werden oder zur Produktion neuer Pharmaka dienen. Mikroorganismen, denen man die identifizierten Genabschnitte einbauen will, sollen Wachstumsfaktoren, Botenstoffe u.a.m. Produzieren. Laut Nature vom April 1996 sind einer Untersuchung der Universität Sussex zufolge zwischen 1981 und 1995 weltweit 1175 Patente für menschliche DNA-Sequenzen erteilt worden. Drei Viertel davon an die Industrie, meist in den USA und Japan; 7% an Einzelpersonen und 17% an den öffentlichen Sektor. Die Hälfte aller Patente erteilte das Europäische Patentamt in München.“ (Aus Erika Feyerabend: „Technik als Weltzustand. Der atomar-genetisch-informationelle Komplex“)
„Die Banalität eines solchen Vermarktungsprozesses,“ wie Erika Feyerabend das in ihrem Text nennt, „hat Bruno Latour in einzigartiger Weise in seinem Aufsatz ‚Der Biologe als wilder Kapitalist‘ beschrieben (auf Deutsch in: ‚Der Berliner Schlüssel‘ 1996), in dem er die Karriere des Biologen Pierre Kernowicz nachgezeichnet hat. Kernowicz ging von der Uni zum Labor, vom Labor zu US-amerikanischen Forschungsstätten. Er untersuchte Eierstöcke, erhitzte Hoden im Wasserbad, die sich in ‚eine Reihe von Diagrammen verwandeln, die sich wieder in Artikel verwandeln, die gegen einen Doktortitel ausgetauscht werden‘ und zu einem noch renommierteren Karriereposten führten. Er untersuchte verschiedene Hormone und erfand einen universalen Wachstumsfaktor.
Kernowicz interessiert sich weder für Wahrheit noch für Informationen als solche, sondern nur für die neuen Informationen. ‚Wenn er etwas noch einmal macht, was schon gefunden worden ist, ist der Wert seiner Arbeit gleich null. Schlimmer noch, der Wert ist negativ, denn er hat Zeit, Arbeit, Energie, Tiere, Material, Raum vergeudet‘. Kernowicz interessiert sich auch nicht für jede neue Information. ‚Zunächst geht es, ich gebe es zu, um Einfachheit, das ist wichtig: Denn wenn du Geld für ein Thema verlangst, mußt du es auch rechtfertigen. Denn wenn du Geld verlangst und derForschungsgegenstand ist zu komplex und du verhedderst dich, sind die Leute, die dir das Geld gegeben haben, nicht zufrieden‘. Kernowicz’ Wachstumsfaktor heißt FGF. Mit ihm hat er es geschafft, sich zum Unternehmer mit Drittmitteloptionen, Patentanwartschaften und Nobelpreisverdacht emporzuarbeiten. Wenn andere Wissenschaftler mit dem FGF arbeiten wollen, kassiert Kernowicz. Er hält das Monopol. Da er seinen Wachstumsfaktor an sehr viele andere Forschungsgegenstände gekoppelt hat und sehr viele Forschungsgegenstände auf seinen Faktor reduzierte, gibt es kaum mehr Fragen in seiner Disziplin, die man an ihm vorbei behandeln kann. Bruno Latour resümiert: ‚Wir sprechen vom Recht der Erkenntnis ›um der Erkenntnis willen‹. Wir glauben, in aller Unschuld die wissenschaftlichen Forschungen den geldgierigen Industriellen entgegensetzen zu können.‘
Doch Pierre Kernowicz ist nichts anderes als ein Industrieller, ein ‚Kapitalist des wissenschaftlichen Beweises‘. Kernowicz ist glaubwürdig. Er hat auf die moderne Molekularbiologie gesetzt und den Weltmarkt gewählt. Er hat sich den Spielregeln entsprechend international engagiert, hat strategische Punkte im Wissenschaftsroulett besetzt – und er hat gewonnen. Die Verhältnisse in der internationalen Forschung am menschlichen Genom sind vergleichbar Man spricht von dem Recht der Erkenntnis, in diesem Fall gar ‚über uns selbst‘. Auch in der Genomforschung sind ‚Kapitalisten des wissenschaftlichen Beweises‘ am Werk.“
Der Spiegel schrieb 2010 über Craig Venters neueste Kreation:
„Um eine echte synthetische Lebensform handelt es sich bei „M. mycoides JCVIsyn1.0″ noch nicht. Die Wissenschaftler benötigten zum einen das Erbgut einer bereits bekannten Mikrobe [Mycoplasma mycoides] als Basis für das künstliche Genom und zum anderen die Hülle eines anderen Bakteriums [Mycoplasma capricolum], um ihrem Kunstgenom einen Körper zu geben.“
Statt Hefe soll es nun also ein Bakterium sein, dessen lebende Teile in eine verwandte Bakterienart verpflanzt wurden. Wenn man bei den Bakterien überhaupt von verschiedenen Arten sprechen kann. Denn bei ihnen ist die Sexualität noch von der Vermehrung getrennt: die zellkernlose Mikrobe vermehrt sich durch Teilung, kann jedoch – u.a. über Sexualpilli – mit jeder anderen Bakterie Gene austauschen. Im Darwinismus wird die Artgrenze durch die Vermehrungsfähigkeit bestimmt, Bakterienarten sollte man deswegen eher nach ihren Stoffwechselfähigkeiten bestimmen, schlägt Peter Berz vor – da man dabei nicht vom erfolgreichen Geschlechtsverkehr, sondern lamarckistisch von der Umwelt (dem Milieu) ausgeht.
Desungeachtet markiert die Arbeit von Craig Venter laut Spiegel einen wichtigen „Zwischenschritt“ – auf dem Weg zum „künstlichen Leben“. Aber dann hörte man aber eine lange Zeit nichts mehr davon. 2012 heißt es etwas abfällig im Spiegel, dass es sich dabei um eine Lebenskreation „nach dem Lego-Prinzip“ handelte, und dass „der Versuch zwar nicht fehlerfrei blieb (14 Gene verschwanden oder wurden beschädigt), doch die so umgebauten Zellen können zweifelsfrei als die ersten Lebewesen mit künstlichem Genom gelten. Dass man sich dazu einer von der Natur produzierten Zellhülle bediente, ist an dieser Stelle verzeihlich.“ (1)

1857 entdeckte der Chemiker Louis Pasteur das für die Milchsäuregärung verantwortliche Bakterium. Dies bestätigte seine 1860 geäußerte Vermutung, dass die Gärung ein von der lebenden Zelle abhängiger Prozess sei und widerlegte das bereits unter den Chemikern Justus von Liebig und Berzelius sowie der damaligen Wissenschaftsgemeinde etablierte Konzept einer ausschließlich chemischen Entität. Es handelt sich bei der Fermentation, so sagt man das heute „im Wahren“, um einen chemischen Prozess in lebenden Organismen.
Das Pariser Pasteur-Institut – Beginnend mit der Quelle Louis-Ferdinand Céline (1894-1961):
„1918 nahm Céline ein Studium der Medizin an der Universität Rennes auf. Ein Jahr später absolvierte er das Baccalauréat. Dann spezialisierte sich Céline auf Seuchenmedizin. 1924 promovierte er mit einer Dissertation über Semmelweis, die aus heutiger Sicht eher wie ein eigenwilliger Roman als wie eine wissenschaftliche Arbeit wirkt. Da er aber noch aus seiner Zeit als Kriegsheld öffentliches Ansehen genoss und seine Geschicklichkeit im Umgang mit Patienten unleugbar war, verlieh man ihm den Doktortitel und die Approbation zum praktischen Arzt. 1936 wurde seine Dissertation mit unwesentlichen Änderungen als literarisches Werk veröffentlicht. (Louis-Ferdinand Celine. Semmelweis. Intro. Philippe Sollers. Atlas Press, 2008, engl.Ausgabe)
Céline verließ seine Frau und Tochter (1926 wurde von der Ehefrau die Scheidung eingereicht), um beim Völkerbund als Sekretär am Institut der Hygiene und Epidemiologie zu arbeiten. Er spezialisierte sich in Liverpool und Paris.“ Dort am Institut Pasteur (http://www.pasteur.fr/ip/easysite/pasteur/fr). Dieses ist „eines der weltweit führenden Grundlagenforschungszentren für Biologie und Medizin mit Hauptsitz in Paris. Es wurde am 4. Juni 1887 gegründet und nach dem Gründer, dem bekannten Forscher Louis Pasteur, benannt. Das älteste Gebäude des Instituts in Paris bildet das Pasteur-Museum: Es umfasst private Wohnungen von Louis Pasteur, die Krypta, in der er beerdigt wurde, und ein Dokumentationszentrum.“ (Wikipedia)
Die Krypta erwähnt auch der Biochemiker Erwin Chargaff in seinem autobiographischen Buch „Das Feuer des Heraklit“ (erschienen 1979 – der Autor starb 2002 in New York, geboren wurde er 1905 in Czernowitz). Chargaff, der 1930 USA verließ, um sich an der Friedrich-Wilhelm-Universität in Berlin im Fach Chemie zu habilitieren, bekam im März 1933 einen Ruf an das Pariser Institut Pasteur, wo er zwei Jahre lang bis zu seiner Reemigration in die USA, in einem der Laboratorien über „Bakterienpigmente und Polysaccharide“ arbeitete. Institutsdirektor war damals Émile Roux, bei dessen Tod er sich wie zuvor schon beim Tod von Rouxs Stellvertreter Albert Calmette, der die „Tuberkuloseabteilung“ leitete und Chargaff ans Institut geholt hatte, in der Krypta an der Totenwache beteiligte. Das Institutsgebäude hatte keine Toiletten, aber „eine recht geschmacklose Krypta, die dem Andenken an Louis Pasteur gewidmet war“. Chargaff erwähnt als Detail seiner Arbeit nur, dass er einmal ein Thermometer bei Calmette bestellte. Dieses wurde dann extra für ihn von Hand gefertigt – ein Schmuckstück, aber es löste sich bereits beim ersten Einsatz völlig auf. In einer Fußnote (auf Seite 66 der dtv-Ausgabe von 1995), die sich auf das „Hauptgebäude“ des Instituts, das „jeder Beschreibung spottete“ bezieht, heißt es:
„Ich brauche gar nicht zu versuchen, dieses Labyrinth von Folterkammern für Kaninchen, Meerschweinchen und Mäuse zu beschreiben. Das ist schon geschehen, und zwar mit meisterhafter Bosheit, in einem der größten französischen Romane dieses Jahrhunderts, in Célines ‚Voyage au bout de la nuit‘.“
Dieser Hinweis bezieht sich auf eine 11seitige Passage, die in der Rowohlt Taschenbuch-Ausgabe (2011) von Célines „Reise ans Ende der Nacht“ auf Seite 366 beginnt. Hier ist von einem „Institut Joseph Bioduret“ (!) die Rede, das der Icherzähler, ein Arzt, wegen eines an Typhus erkrankten Patientenaufsucht, um sich kollegialen Rat zu holen. Erst einmal irrte er dort durch die leeren Labors, in denen ein „Riesendurcheinander von Gerätschaften, kleinen aufgeschlitzten Tierkadavern, Zigarettenstummeln, schartigen Gasbrennern, Käfigen und Glasbehältern mit erstickenden Mäusen darin herrschte“. Der Geruch in den Räumen war von Büchern und Staub bestimmt, der sich „mit dem der Klos“ vermischte.“
Céline hat also die Toiletten im Institut Pasteur im Gegensatz zu Chargaff sofort gefunden – oder er war in noch einem anderen Gebäude, um einen seiner alten Dozenten, der im Institut untergekommen war und sich auf Typhus spezialisiert hatte, zu konsultieren. Dieser, „Sergej Parapine“ genannt, ist jedoch nur noch an kleinen Mädchen interessiert: „Sie können mir glauben, lieber Kollege, Typhus ist mittlerweile ebenso strapaziert wie die Mandoline oder das Banjo.“ Also uninteressant geworden. „Wir schieden als Freunde“.
Die Wissenschaftler am Institut, die sich längst an den Gestank von „verfaulendem Hasengekröse“ gewöhnt hatten, bezeichnet der Icherzähler allesamt als „Gelehrte, die zerstreut rituelle Untersuchungen an Meerschweinchen- und Kaninchendärme betreiben […] Bis an ihr Lebensende für ein Hungerleidergehalt an diese Mikrobenküchen gefesselt […] Sie waren letzten Endes nichts anderes als alte, riesenhafte domestizierte Nagetiere im Überzieher.“
Die Wissenschaftler lassen sich von ihren Versuchstieren mit den Jahren, die vergehen, affizieren – aber sie affizieren wahrscheinlich umgekehrt auch ihre Labororganismen. Heraus kommen Mischwesen. Ein Fall für Donna Haraway oder Bruno Latour, der sich, so kann man sagen, als Feldforscher in der Hauptsache mit Louis Pasteur und dem Institut beschäftigt hat. U.a. geht er am Beispiel der Entdeckung des Milchsäureferments durch Pasteur der Frage nach, ob die im Labor gewonnenen Tatsachen „konstruiert“ oder „wirklich“ sind. „Sein Verdacht erhärtet sich, dass sie ‚konstruiert‘ sind und dass ihre Konstruktion eine geheime Verbindung zur Politik aufweist“, wie es im Klappentext von Latours Aufsatz über Pasteurs Mikroorganismen in: „Die Hoffnung der Pandora“ heißt.
Bei Wikipedia heißt es über Céline weiter:
„Neben seiner Forschungstätigkeit berät Céline die französische Regierung und die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in medizinischen Sachfragen. Es beschäftigt sich mit der Entwicklung und Erforschung von Diagnose- und Testverfahren in der Medizin. Das Institut ist ein epidemiologisches Überwachungszentrum und kontrolliert Ausbrüche von Infektionskrankheiten weltweit.
1926 reiste er in die USA. Wo er sich als Arzt in den Industrievierteln Detroits und beim Automobilhersteller Ford den Fragen der Hygiene widmete. Weitere Aufträge der Seuchenforschungsstelle des Völkerbundes führten Céline nach Afrika, Kanada und Kuba. Seine Aufgabe bestand in der Erstellung von Gutachten zu lokalen Seuchenrisiken. Die letzte dieser Missionen für den Völkerbund war eine Reise ins Rheinland im Frühjahr 1936, wo er die gesundheitlichen Auswirkungen der Massenarbeitslosigkeit auf die subproletarische Bevölkerung untersuchte.
1928 übernahm Céline die Leitung der Abteilung für Infektionskrankheiten an der Staatsklinik von Clichy. 1936 quittierte er den Dienst und war fortan – mit der Ausnahme eines Intermezzos als Schiffsarzt im Jahr 1939 – bis zu seinem Tod privat als praktischer Arzt tätig.“
Ende April 1945 floh der Antisemit und Nazisympathisant Céline mit seiner Frau nach Dänemark und wurde dort interniert. Man klagte ihn der Verbrechen gegen die Menschlichkeit sowie der Beihilfe zum Mord an und inhaftierte ihn, während man seine Frau nach einem Monat freiließ. 1949 wurde seine Inhaftierung aufgehoben. Gleich nach dem Krieg war er in Abwesenheit in Frankreich wegen Kollaboration zu Tod und Vermögensverlust verurteilt, 1950 aber begnadigt worden. 1951 kehrte Céline deswegen nach Frankreich zurück. Seine Pariser Wohnung war unterdes von Mitgliedern der Résistance geplündert worden, so wagte er den postfaschistischen Neuanfang in Meudon außerhalb der Stadt. Dort starb er auch.
Céline war im Ersten Weltkrieg schwer verwundet worden, wovon ihm eine Angstpsychose zurückblieb. Wikipedia schreibt: „Da sein Plan, Chirurg zu werden, aufgrund der Kriegsbeschädigung nicht zu realisieren war, spezialisierte sich Céline auf Seuchenmedizin.“
Ähnliches gilt laut Wikipedia auch für den Genetiker Francois Jacob: „Wegen einer schweren Kriegsverletzungen konnte Jacob nicht als Chirurg tätig werden. So arbeitete er zunächst auf verschiedenen anderen Gebieten, bis er sich 1950 als Schüler von André Lwoff am Institut Pasteur der Biologie zuwandte.“ Dort wurde 1971 Jacques Monod zum Direktor ernannt. „Jacob und Monod entwickelten zusammen ein das ‚Operon-Modell'“ zur Erklärung des „Zusammenwirkens von Regulatorgenen, Operatoren, Promotoren, Strukturgenen und allosterischen Proteinen, den Repressoren, bei der Synthese von messenger-RNA (Transkription).“
1961 schrieben sie: Diese „Entdeckung steuernder und ausführender Gene und hemmender Steuerung der Aktivität struktureller Gene enthüllt, dass das Genom nicht nur eine Reihe von Blaupausen enthält, sondern ein abgestimmtes Programm zur Proteinsynthese sowie die Mittel, dessen Durchführung zu kontrollieren.“ 1961 „war einäußerst erfolgreiches Jahr für Jacob,“ heißt es in der Studie über die Geschichte der Genetik „Das Leben neu denken“ von Evelyn Fox Keller. Zusammen mit Sidnex Brenner und Matthew Meselson hatte er „den Überbringer der Botschaft der Zentralinstanz identifiziert. Er entdeckte den Boten“ – im Zellkern.
In ihren sich amerikanisierenden Metaphern, die Jacob, Monod und Lwoff am Institut Pasteur verwendeten, spiegeln sich die zur selben Zeit entstandenen neuen „Disziplinen“ Kybernetik und Molekularbiologie wieder. Diese nahmen jedoch einen entgegengesetzten Verlauf: „Während die Kybernetik auf den Organismus zurückgriff, um eine neuartige Maschine zu veranschaulichen, versuchte die Molekularbiologie, den Organismus nach dem Vorbild der Maschinen verflossener Zeiten darzustellen.“ (H.F. Keller)
Das „Leben wurde so gleichsam in die Zange genommen – metaphorisch und technisch-analytisch. Lwoff gab 1960 in einer Vorlesung in den USA zu bedenken, dass der Begriff „Information“ für den Biologen eine andere Bedeutung hat als für den Physiker.“ An anderer Stelle betonte er jedoch die Gemeinsamkeiten: „Eine wichtige Ähnlichkeit zwischen einer Botschaft und einem Gen besteht darin, dass man beide als ‚Gestalten‘, das heißt als bedeutsame Strukturen, und ihren Verlust als einen Verlust an ’negativer Entropie‘ betrachten kann.“ Das „Operon-Modell“ der genetischen Steuerung, das Lwoff zusammen mit Jacob und Monod 1960 einführten, trug laut H.F. Keller „erheblich zur Akzeptanz des Begriff der Rückkopplung bei den Molekularbiologen bei.“ Wenn auch mindestens Jacob noch „schwankte zwischen einer Vorstellung von der DNA als Quelle jeglicher Information und Anweisung und der Vorstellung vom Organismus als einem Netzwerk von Regelkreisen, ebenso ging es dem Mathematiker Norbert Wiener [in: „Cybernetics: or, Control and Communication in the Animal and the Machine“].“ Mit diesem war Jacob sich einig: „Der Organismus kann als Botschaft aufgefaßt werden.“ (F. Jacob: „Die Logik des Lebenden 1970) Dennoch tat sich „eine gewisse Kluft auf zwischen Jacobs Begriff der Botschaft als einem Molekül und Wieners Vorstellung von einem Körper, den man ‚durch eine Telegrafenleitung senden‘ kann.“ (H.F.Keller). Zudem bedurfte der molekularbiologische Botschafts-Begriff weiterer Laborarbeit, denn – wie der Biosemiotiker Howard Pattee schrieb: „Um zu verstehen, wie Moleküle zu Botschaften werden…ist ein tiefreichenderes Verständnis der Physik von Schaltungen und der Logik von Netzwerken (2) erforderlich.“
Die Harvard-Wissenschaftshistorikerin Anne Harrington hat den Maschinenbegriff in der Biologie, wie er am Ende des 19. Jahrhunderts in Deutschland gegen die ganzheitlich orientierte Naturforschung – von Goethe über Henri Bergson, Alfred North Whitehead, Hans Driesch und Jakob von Uexküll bis zu Theodore Roszak – in Anschlag gebracht wurde, in ihrem Buch „Die Suche nach Ganzheit“ ausführlich gewürdigt, wohingegen sie die antidarwinistischen Biologien – des Vitalismus, der Biosophie, der „Symbiose“- und der „Umwelt“-forschung sowie der Ethologie, die vor allem in der Weimarer Republik diskutiert wurden, in Eugenik, Antisemitismus und Nationalsozialismus münden läßt.
Nach seiner Remigration in die USA 1935 forschte auch Erwin Chargaff über die RNS- und DNS-Strukturen: „Seine Arbeiten zur Blasenkomplementarität haben entscheidend zur Entdeckung der Doppel-Helix der DNS“ beigetragen,“ heißt es über ihn vorweg – in „Das Feuer des Heraklit“, in dem er seinen Neid auf die damit berühmt und reich gewordenen jungen Kollegen F.H.C. Crick und J.D. Watson nur schlecht verhehlen konnte: Während seine Entdeckung, so schreibt er, „das Ergebnis induktiven Denkens“ war und „auf zahlreiche experimentelle Beobachtungen fußte“, war das „Doppelhelix-Modell der DNS, das einen sehr großen Einfluß auf die biologischen Wissenschaften hatte, etwas ganz anderes. In der Art, wie dieses Modell vorgelegt wurde, stellt es im wesentlichen ein Kunststück der Verpackung dar, ein überaus geschicktes und witziges Denkspiel; und als solches eignet es sich besonders für die kräftige Propagandakampagne, die fast sofort nach seiner Formulierung einsetzte.“
Der ganze Rummel darum hatte eine „bedauerliche Wirkung: die meisten Studenten erforschen nicht mehr die Natur, sie überprüfen Modelle.“ Ihnen gibt er mit auf den Weg: Die biologischen Wissenschaften befinden sich weltweit in „Schwierigkeiten. Und diese werden „durch die bedauerliche Tatsache noch verschärft, daß aus den Naturwissenschaften hauptsächlich eine amerikanische Naturwissenschaften geworden sind.“ Ähnlich großzügig sah ungefähr zur selben Zeit der Semiologe Roland Barthes die Entwicklung der Filmkunst: „Amerikanischer Film“ – das sei „ein Pleonasmus“.
Chargaff hatte in den späten Siebzigerjahren den Eindruck: „Jetzt sprechen nur [noch] Rechenmaschinen zueinander. Die meisten Leute, denen ich in meiner Universität [Columbia in New York] oder in anderen begegne, sehen wie Ausschußware aus den Mistkörben von IBM aus.“ Das sei die Strafe für „unsere übertriebene Verehrung des Wertes induktiven Denkens.“
Im Institut Pasteur kam es einmal zu einer Auseinandersetzung zwischen Jacques Monod und Francois Jacob. Ihr Streit resultierte daraus, dass für Jacob die Bakterien plötzlich nicht mehr genug Individualität besaßen, um sich ernsthaft weiter mit ihnen zu beschäftigen. In seinem Buch „Die Maus, die Fliege und der Mensch“ schrieb er: „Der Bakteriologe Alfred Hershey hatte zwar einmal scherzhaft angemerkt, dass für den Biologen das Glück darin besteht, ein sehr kompliziertes Experiment auszutüfteln und es Tag für Tag zu wiederholen, wobei er jedes Mal nur ein Detail abwandelt. Doch ich wollte eine Veränderung. Seit fünfzehn Jahren ließ ich nun schon ausgesuchte Bakterienpaare im Takt kopulieren. Diese Art von Übung hatte mir viel Befriedigung verschafft. Doch glaubte ich ihre Freuden ausgekostet zu haben. Ich hatte nichts dagegen, eine Art Guru der Sexualität zu werden, aber nicht der Bakteriensexualität. Auch fingen die Bakterien an, mir ein wenig unsichtbar, ein wenig farblos zu erscheinen. Ich wollte etwas Sichtbares, mit Hormonen, Leidenschaften, mit einer Seele. Ich wollte Tiere, denen man ins Auge blicken, die man individuell erkennen, ja benennen konnte. Und die fähig waren, einem auch selbst in die Augen zu blicken.“
Francois Jacob dachte dabei an weiße Mäuse, um die herum er ein ganzes neues Institut zu gründen beabsichtigte, während Jacques Monod bei den Kolibakterien bleiben wollte – und sich damit durchsetzen konnte. „1965 erhielt Jacob gemeinsam mit Monod und André Lwoff den Medizin-Nobelpreis.“ (Wikipedia)
Lwoff ebenso wie Monod scheint der Preis zu Kopf gestiegen zu sein, denn sie gingen ausgehend von ihrer Bakterienforschung 1968 bzw. 1971 aufs Ganze, d.h. sie zielten damit auf eine Welterkärung: Lwoff versuchte mit dem „Operon-Modell“ den Pariser Mai 68 zu erklären (s.u.) und Monod veröffentlichte 1971 sein berühmt gewordenes Buch „Zufall und Notwendigkeit“.
Als junger Wissenschaftler am Pariser Pasteur-Institut war Monod zunächst Mitglied der Kommunistischen Partei und überzeugter Lamarckist gewesen. 1943 kam er mit dem Biologen und Marxisten Marcel Prenant in Kontakt, der damals Leiter der Widerstandsgruppe FTP (Francs-tireurs et partisans) war. Er delegierte Monod zu den Streitkräften des Freien Frankreichs, wo dieser dann im Range eines Majors dem Stab des Generals de Tassigny angehörte. Er war also quasi ein Widerständler.
Nach dem Krieg kehrte Monod an das Pariser Institut zurück, wo er sich in der Folgezeit vom „Lamarxismus““ abwandte und mehr und mehr zu einem militanten Neodarwinisten wurde. Das geschah jedoch nicht aus innerer Überzeugung- – die Amis mußten gehörig nachhelfen. Die US-Genetikhistorikerin Lily E. Kay merkt dazu an „“Eine Verbindung mit der KPF, die in den frühen Fünfziger Jahren in Frankreich sehr präsent war, schien eher schädlich für französische Wissenschaftler, die von amerikanischen Behörden unter der Schirmherrschaft des Marshall-Plans unterstützt wurden…Noch nachteiliger war eine solche Verbindung auf dem Höhepunkt der Hexenjagd des McCarthyismus.“
Denn sie erschwerte es z.B. Monod, um Einladungen an amerikanische Forschungsinstituten zu folgen, ein US-Visa zu bekommen. Nachdem er sich jedoch von der „proletarischen Biologie“ – dem sowjetischen Lyssenkoismus-Mitschurinismus“ – und der KPF distanziert hatte, finanzierte ihm die Rockefeller-Stiftung sogar ein eigenes Labor für Molekularforschung im Pasteur-Institut, woraufhin die von De Gaulle eingerichtete „Délégation Générale à la Recherche Scientifique et Technique“ („eine Institution zur militärischen Mobilmachung der Wissenschaft im Kalten Kr’ieg“) die ‚Molekularbiologie‘ als „Speerspitze einer künftigen Wissenschaft und Biotechnologie“ anerkannte, wie Lily E. Kay hinzufügte.
Monod war damit auf die antikommunistische Seite übergewechselt – an die Seite der US-Genetiker. Und Frankreich war damit auch mit seinem Welt- und Menschenbild sowie der naturwissenschaftlichen Forschung in das westliche Verteidigungsbündnis eingebunden, obwohl es daneben immer wieder versuchte, diesbezüglich eine – quasi dritte – Position zu beziehen.
Die Harvard-Historikerin Anne Harrington hat sich 1996 die europäischen, vor allem deutschen Ganzheits-Bestrebungen vorgenommen und eine „Geschichte biologisch-psychologischer Ganzheitslehren: Vom Kaiserreich bis zur New-Age-Bewegung“ veröffentlicht – die 2002 unter dem Titel „Die Suche nach Ganzheit“ auf Deutsch erschien. Zwar erwähnt sie darin nicht André Lwoff, dafür jedoch Konrad Lorenz, der ausgehend von seiner Gänseforschung die 68er-Bewegung analysierte. Es fehlen auch die Ganzheitler Fuhrmann, Portmann und Pawlow, dafür geht die Autorin jedoch ausführlich auf Jakob von Uexküll ein. An einer Stelle zitiert sie dazu den Tagebucheintrag von Thomas Mann (am 1.3.1921):
„Ich las in der ‚Theoretischen Biologie‘ von Uexküll. Stellte fest, daß die Beschäftigung mit biologischen Dingen, auch wenn sie neuer, geistfreundlicher, antidarwinistischer Art ist, in politicis konservativ und streng macht. Ähnliches lag bei Goethe vor.“
Laut Harrington verwendeten alle Anti-Maschinendenker unter den Biologen ihre „an Metaphern reiche Sprache der Ganzheit, um für Verbindungen zwischen den Entwicklungen der Klinik und des Labors einerseits und Lösungen der dringlichen kulturellen Fragen der damaligen Zeit andererseits zu streiten.“
Inzwischen ist die Bakterienforschung derart weit gediehen, dass sie sozusagen aus sich heraus politisch geworden ist – und das mit globaler Bedeutung. Schon Erwin Chargaff hat vor „genetischer Herumpfuscherei“ gewarnt:
„Was den Menschen angeht, haben Bakterien und Vieren immer einer höchst wirksamen biologischen Untergrundbewegung angehört. Unser Verständnis des Guerillakriegs, mit dessen Hilfe sie auf höhere Formen des Lebens einwirken, ist sehr lückenhaft.“ Deswegen Hände weg von genetischen Experimenten mit ihnen. „Ich betrachte den Versuch, in die Homöostase der Natur einzugreifen, als ein unvorstellbares Verbrechen. ..Die Zukunft wird uns deshalb verfluchen.“

„Was gibt es überhaupt in der Geschichte, was nicht Ruf nach oder Angst vor der Revolution wäre?“ (Michel Foucault)
Der Optimist Foucault unterschied den „universellen Intellektuellen“, dessen Ursprünge er bei Voltaire ansetzte und der vor allem von gebildeten Jouristen verkörpert wurde, vom „spezifischen Intellektuellen“, der in seiner besonderen Stellung zur Macht, durch seine berufliche Tätigkeit selbst zum moralischen Widerstand gelangt. Das „Scharnier“ zwischen den beiden Intellektuellentypen war für ihn der Atomphysiker Robert Oppenheimer.
Der Pessimist Günter Anders sah dagegen in der selben Zeit „Die Antiquiertheit des Menschen“ heraufdämmern. Sein Paradebeispiel dafür war der Koreakrieg und sein „Scharnier“ General McArthur, der dort für den Einsatz von Atombomben plädierte. Die Computer der Militärs hielten jedoch die Fortsetzung des konventionellen Kriegs für vorteilhafter: McArthur trat zurück – und wurde Vorstandsmitglied des Büromaschinenkonzerns Burroughs. Nicht die Moral verhinderte hier den Massenmord, sondern ein rechnerisches Kalkül!
Während in der Sowjetunion die neodarwinistischen Genetiker aus der biologischen Forschung eliminiert wurden, zugunsten einer „proletarischen Wissenschaft“, die das Individuum bis hin zur Zelle für wesentlich beeinflußbar durch die Umwelt hielt und sogar Weizen, Kartoffeln etc. für „umerziehungsfähig“, wurde in der vom Militär finanzierten Forschung der USA die Molekularbiologie mit der neuen Kybernetikbegrifflichkeit ausgerüstet – und damit der Unterschied zwischen Maschinen und Organismen eliminiert.
Diese neue Semiotik wurde laut der Biologiehistorikerin Lily Kay „in den neuen Bedeutungsregimen des industriell-militärisch-akademischen Komplexes und der Kultur des Kalten Krieges formuliert“ – im selben Jahr, 1948, da in der Sowjetunion eine vom Präsidenten der Leninakademie der Landwirtschaftswissenschaften, Lyssenko, mit einem Referat über die „Situation in der biologischen Wissenschaft“ eingeleitete Tagung stattfand, mit der die sowjetischen „Mendelisten-Morganisten“ militant aus der Forschung gedrängt wurden. Während die neue mitschurinistisch-lyssenkistische Begrifflichkeit zugleich voller Liebe und Zärtlichkeit daherkam: Da werden Erbanlagen „gelockert“, es finden bei der Bestäubung „Liebesheiraten“ statt, die Hirse wird „erzogen“ (B.Brecht), Bäume „opfern“ sich freiwillig für den Wald usw..Weniger zärtlich gingen die proletarischen „Lyssenkoisten“ allerdings mit ihren Feinden – den Anhängern der bürgerlichen Genetik – um.
Umgekehrt setzten die US-Genetiker zusammen mit den -Kybernetikern in der westlichen Welt ebenfalls „eine neue Denkweise durch“, die „mit dem Aufbau von Waffenlenk- und -kontrollsystemen“ aufkam, wobei sie sich der „Informationsverarbeitung und der Rückkopplungsregelung“ widmeten – und dabei „die Unterschiede zwischen Belebtem und Unbelebtem verwischten“. „Ich vermute, daß ein großer Teil eines Tiers oder einer Pflanze redundant ist, denn es hat gewisse Probleme damit, sich exakt zu reproduzieren, und es gibt eine Menge Rauschen. Eine Mutation scheint ein Stück Rauschen zu sein, das in eine Nachricht hineingerät,“ schrieb Norbert Wiener 1948, für den die „Gene“ dann das grundlegende „Kontrollelement“ waren.
Der Genetiker John B.S. Haldane, der Linguist Roman Jakobson, der Politikwissenschaftler Karl W. Deutsch, der Mathematiker John von Neumann, der Harvard-Soziologe Talcott Parson u.a., die alle wie Wiener für das Militär arbeiteten, übernahmen seine „kühnen Gedanken“, aus denen der Ökonom Kenneth E. Boulding dann ein „missionarisches Werk“ machte, das inzwischen die ganze Welt beherrscht – seit 1961 auch die sowjetische! Aber wenn alles „programmierte Kommunikationssysteme“ sind, dann gibt es laut Jean Baudrillard „überhaupt kein Medium im buchstäblichen Sinne des Wortes mehr: von nun an läßt es sich nicht mehr greifen, es hat sich im Realen ausgedehnt und gebrochen…“
Der Peenemünder Raketenwissenschaftler und Steuerungsexperte Helmut Gröttrup, behauptete daneben eine originelle Zwischenposition. Er arbeitete erst in der Sowjetunion und wurde dann vom CIA angeworben, zog es jedoch vor, bei Siemens in München anzufangen, wo er bis zu seiner Entlassung, weil er angeblich einen sowjetischen Spion gedeckt hatte, elektronische Rechenmaschinen konstruierte, aus der u.a. die Geldautomaten hervorgingen, auch das Wort „Informatik“ stammt von ihm. Vor Hamburger Geschäftsleuten führte er aus, dass die unternehmerische Freiheit ein bloßer Irrtum sei – der auf Informationsmangel beruhe. Hier war der Informationsbegriff keine Metapher, dafür war aber nun die „unternehmerische Freiheit“ eine – für Blödheit und mangelnde Weltkenntnis.
Wie sind wir dahingekommen? Die Computerisierung leitete die dritte Industrielle Revolution ein – und diese bereitete sich zur selben Zeit wie die Gründung von IWF und Weltbank am Ende des letzten imperialistischen „Zweiten Weltkriegs“ vor. Dazu fanden zwischen 1946 und 1953 die so genannten „Macy-Konferenzen“ statt, auf denen sich die „technokratische Wissenschaftselite der USA“, darunter viele Emigranten aus Europa, versammelt hatte – um ausgehend von der Waffenlenk-Systemforschung, der Kryptologie, der Experimentalpsychologie und der Informationswissenschaft sowie von Erwin Schrödingers 1943 erschienenem Buch „What is Life?“ Theorie und Praxis der „Circular Causal and Feedback Mechanisms in Biological and Social Systems“ zu diskutieren. Hierzu gehörten u.a. John von Neumann, Norbert Wiener, Claude Shannon, Gregory Bateson und Margret Mead, als Konferenzsekretär fungierte zweitweilig Heinz von Foerster. Im Endeffekt entstand daraus die inzwischen nahezu weltweit durchgesetzte und empirisch fruchtbar gewordene Überzeugung, dass die Gesetze komplexer Systeme unabhängig von dem Stoff, aus dem sie gemacht sind – also auf Tiere, Computer und Volkswirtschaften gleichermaßen zutreffen.
Als einer der ersten Gegner dieses bald immer mehr Wissenschaftsbereiche erfassenden Paradigmenwechsels trat 1953 der Schriftsteller Kurt Vonnegut mit seinem Buch „Das höllische System“ auf, in dem er die Massenarbeitslosigkeit produzierenden Folgen des kybernetischen Denkens bei seiner umfassender Anwendung beschrieb, die Herbert Marcuse dann als „Herrschaft eines technologischen Apriori“ bezeichnete, was der Wiener Philosoph Günters Anders wiederum zum Ausgangspunkt seiner Überlegungen und Recherchen zur „Antiquiertheit des Menschen“ machte. Diese besteht nach ihm darin, dass spätestens mit dem Koreakrieg (1950-53) die rechnerischen Kalküle alle moralischen Urteile ersetzt haben. Selbst die antifaschistischen Charakteranalysen von Adorno im amerikanischen Exil fanden noch Eingang in die Macy-Konferenzmaschine, indem man schließlich auch den „‚Antiautoritären Menschen nach Maß‘ noch zum Ziel der Kybernetik erklärte“.
In dem Aufruhr-Horrorszenario, das Vonnegut entwarf – indem er die Militärforschung des „Fathers of Cyborg“ Norbert Wiener und des Mathematikers John von Neumann weiter dachte – geht es um die Folgen der „Maschinisierung von Hand- und Kopfarbeit“, d.h. um die vom Produktionsprozeß freigesetzten Menschenmassen, die überflüssig sind und nur noch die Wahl haben zwischen 1-Dollarjobs in Kommunen und Militärdienst im Ausland, wobei sich beides nicht groß unterscheidet. Theoretisch könnten sie sich auch selbständig machen – „Ich-AGs“ gründen, wie das 1997 in Wisconsin entwickelte „Trial Job“-Modell nach Übernahme durch die rotgrüne Regierung hierzulande heißt.
„Reparaturwerkstätten, klar! Ich wollte eine aufmachen, als ich arbeitslos geworden bin. Joe, Sam und Alf auch. Wir haben alle geschickte Hände, also laßt uns alle eine Reparaturwerkstatt aufmachen. Für jedes defekte Gerät in Ilium ein eigener Mechaniker. Gleichzeitig sahnen unsere Frauen als Schneiderinnen ab – für jede Einwohnerin eine eigene Schneiderin.“
Da das nicht geht, bleibt es also dabei: Die Massen werden scheinbeschäftigt und sozial mehr schlecht als recht endversorgt, während eine kleine Elite mit hohem I.Q., vor allem „Ingenieure und Manager“, die Gesellschaft bzw. das, was davon noch übrig geblieben ist – „Das höllische System“ (so der deutsch Titel des Romans) – weiter perfektioniert. An vorderster Front steht dabei Norbert Wiener. Schon bald sind alle Sicherheitseinrichtungen und -gesetze gegen Sabotage und Terror gerichtet. Trotzdem organisieren sich die unzufriedenen Deklassierten im Untergrund, sie werden von immer mehr „Aussteigern“ unterstützt. Der Autor erwähnt namentlich John von Neumann. Nach Erscheinen des Romans beschwerte sich Norbert Wiener brieflich beim Autor über seine Rolle darin.
Die Biologiehistorikerin Lily Kay bemerkt dazu in ihrem 2002 auf Deutsch erschienenen „Buch des Lebens“ – über die Entschlüsselung des genetischen Codes: „Wiener scheint den Kern von Vonneguts Roman völlig übersehen zu haben. Er betrachtete ihn als gewöhnliche Science Fiction und kritisierte bloß die Verwendung seines und der von Neumanns Namen darin.“ Vonnegut antwortete Wiener damals: „Das Buch stellt eine Anklage gegen die Wissenschaft dar, so wie sie heute betrieben wird.“ Tatsächlich neigte jedoch eher Norbert Wiener als der stramm antikommunistische von Neumann dazu, sich von der ausufernden „Militärwissenschaft“ zu distanzieren, wobei er jedoch gleichzeitig weiter vor hohen Militärs über automatisierte Kontrolltechnologien dozierte.
Der Roman geht dann so weiter, dass die von der fortschreitenden Automatisierung auf die Straße Geworfenen sich organisieren, wobei sie sich an den letzten verzweifelten Revivalaktionen der Sioux im 19. Jahrhundert orientieren: an den Ghost-Dancers, die gefranste westliche Secondhand-Klamotten trugen. Im Roman heißen sie „Geisterhemd-Gesellschaften“ – und irgendwann schlagen sie los, d.h. sie sprengen alle möglichen Regierungsgebäude und Fabriken in die Luft, wobei es ihnen vor allem um den EPICAC-Zentralcomputer in Los Alamos geht. Ihr Aufstand scheitert jedoch. Nicht zuletzt deswegen, weil die Massen nur daran interessiert sind, wieder an „ihren“ geliebten Maschinen zu arbeiten. Bevor die Rädelsführer hingerichtet werden, sagt einer, von Neumann: „Dies ist nicht das Ende, wissen Sie.“
1984 griff Thomas Pynchon diesen Gedanken von Vonnegut noch einmal auf: „Is it o.k. to be a Luddit?“ fragte er sich in der New York Times Book Review – und antwortete dann: „Wir leben jetzt, so wird uns gesagt, im Computer-Zeitalter. Wie steht es um das Gespür der Ludditen? Werden Zentraleinheiten dieselbe feindliche Aufmerksamkeit auf sich ziehen wie einst die Webmaschinen? Ich bezweifle es sehr…Aber wenn die Kurven der Erforschung und Entwicklung von künstlicher Intelligenz, Robotern und der Molekularbiologie konvergieren. Jungejunge! Es wird unglaublich und nicht vorherzusagen sein, und selbst die höchsten Tiere wird es, so wollen wir demütig hoffen, die Beine wegschlagen. Es ist bestimmt etwas, worauf sich alle guten Ludditen freuen dürfen, wenn Gott will, dass wir so lange leben sollten.“
Mitte der Siebzigerjahre zog sich der Mathematiker Theodor Kaczynski von der Universität Berkeley zurück – um sich in den Wäldern von Montana eine Henry Thoreaus „Walden II“ nachempfundene Existenz aufzubauen. Ab 1978 begann er von dort aus, mit Briefbomben gegen die aus der Kybernetik hervorgegangenen Technologien der Kontrolle und Kommunikation und vor allem gegen ihre „Macher“, seine einstigen Kollegen, vorzugehen. Nachdem man ihn verhaftet und zu lebenslangem Zuchthaus verurteilt hatte, veröffentlichte der Schriftsteller Jim Dodge einen Roman, in dem er am Beispiel einer Gruppe von Verschwörern, AMO genannt, die sich ebenfalls auf den Zentralcomputer in Los Alamos konzentriert, ausführte, wie man erfolgreicher Widerstand leisten könnte. Thomas Pynchon bezeichnete Dodges Buch „Die Kunst des Verschwindens“ als den „ersten bewußt analogen Roman“.
Anfang 2005 stellte der Leipziger Künstler Lutz Dammbeck in der Akademie der Künste seinen Film „Das Netz“ über den so genannten UNA (UN-iversities und A-irlines) -Bomber Kaczynski vor, in dem er dessen „Werdegang“ bis zu den privaten und staatlichen „Thinktanks“, die sich aus den Macy-Konferenzen herausgemendelt hatten , zurückverfolgte, und dabei einige Konferenzteilnehmer interviewte. Ausschnitte aus Dammbecks Interviews, sowie Abschnitte aus den ins Deutsche übersetzten Macy-Konferenzprotokollen lagen 2005 zwei Berliner Workshops zugrunde.
Vorangegangen war diesen allerdings eine allgemeine Ermüdung bei der Verwendung des Begriff „Cyber“ – nachdem die Kybernetik durch ihre Verschränkung von Science and Fiction sich bereits zu einem „Pop-Phänomen“ ausgeweitet hatte. Eine Teilnehmerin an den Workshops, Gabriele Grammelsberger, gab in ihrer „Positionsbestimmung“ jedoch zu bedenken: Zwar sei die Kybernetik als Theorie der steuerbaren Kommunikation und Information „in vermeintlich neuen Disziplinen aufgegangen“, das ändere jedoch wenig an „ihrer programmatischen Präsenz“ in Form der fortwährenden Wirksamkeit von paradigmatischen und präskriptiven Konzepten wie „System“, „Kontrolle“, „Vorhersage“, „Rückkopplung“, „Programmierbarkeit“, „Information“, „Operator“ und „Beobachter“ sowie der Perspektive „der statistischen Betrachtung, der funktionalen Symbolisierung und der zweckgerichteten systemischen Steuerung und Organisation“.
Rainer Fischbachs Beitrag umriß „das erste große Einsatzfeld der anfänglich fast noch künstlerisch gewesenen Ideen der Macy-Konferenz: den Vietnamkrieg“. Hierbei sei die, vor allem mit den Namen Mc Namara und Henry Kissinger verbundene, Kybernetik jedoch „gescheitert“, was die Militärs bis heute aber nicht daran hindere, sich nahezu weltweit und mit den selben Einsatzmitteln auf Stadtkämpfe einzustellen – wozu sie u.a. Institute für Urbanistik gründen. Die „Urbanismus-Diskurse“ der heutigen Stadtsoziologen und Architekten (für die „Kontrolle“ und „Kommunikation“ z.T. noch in Opposition stehen) sind in diesem Zusammenhang nur die spielerische Variante der Terrorbekämpfung, wie sie zur Zeit u.a. in den urbanen Zentren des Iraks stattfindet. Wenn hierbei nun die städtische Bevölkerung in toto als Guerilla und somit als Feind fixiert wird (wie sie – ebenfalls mit Clausewitz, aber in anderer Perspektive – auch schon Michel de Certeau in seinem Buch „Die Kunst des Handelns“ als potentielle Partisanen dargestellt wurden), dann war es im Vietnamkrieg der unberechenbare Bauer als Vietkong, für den „der Krieg kein Spiel, sondern Kampf“ war, so daß „der rationale, kybernetische Krieg im Massaker endete, ohne auch nur ein einziges seiner erklärten Ziele zu erreichen“, wie Rainer Fischbach schreibt, der sich dabei sinnigerweise auf einen Fictionfilm, nämlich Coppolas „Apocalypse Now“, bezieht.
Günter Anders hatte dafür bereits den Begriff des „Telezids“ geprägt, um die vorherrschende Form der Gewalt zu charakterisieren, mit der die Differenz von Modell und Realität vernichtet wird. Fischbach fügte dem hinzu: Mit Reagans „Strategic Defense Initiative“ (SDI) sei dieses Denken auf ein „totalisierendes System“ hinausgelaufen, das im Konzept des „Cyberspace“ nun bis in das Leben der Individuen vordringe.
Die einst optimistische These von Marshall McLuhan: „Das Medium ist die Botschaft“, ergänzte Jean Baudrillard bereits, eher kulturpessimistisch gestimmt, dahingehend, dass es gar „kein Medium im buchstäblichen Sinne des Wortes“ mehr gäbe: „von nun an läßt es sich nicht mehr greifen, es hat sich im Realen ausgedehnt und gebrochen…“ Ebenso sei es „mit dem Zeitalter der Repräsentation, dem Raum der Zeichen, ihrer Konflikte, ihres Schweigens“ vorbei: „Es bleibt nur die ‚black box‘ des Codes, das Molekül, von dem die Signale ausgehen, die uns mit Fragen/Antworten durchstrahlen und durchqueren wie Signalstrahlen, die uns mit Hilfe des in unsere eigenen Zellen eingeschriebenen Programms ununterbrochen testen“.
Die vom Militär sowie von der Rockefeller-Foundation finanzierte Forschung in der Molekularbiologie rüstete sich in den Vierzigerjahren ebenfalls mit den Begriffen der nen Kybernetik und Informationswissenschaft – wobei sie keinen Unterschied zwischen Maschinen und Organismen machte: Die einen wie die anderen waren fortan „programmiert“ – und hier wie dort ging es um „Information“, ein Begriff, den die Harvard-Biologiehistorikerin Lilly E. Kay als „Metapher einer Metapher“ bezeichnet.
Ab 1970 forschte der chilenische Neurobiologe Humberto Maturana an Heinz von Foersters „Biological Computer Laboratory“ in den USA. Von dort aus gab er den „Artificial Intelligence-Forschern“ zu bedenken, sie „ahmten biologische Phänomene nach. Wenn man (aber) biologische Phänomene nachahmt und dabei nicht zwischen den Phänomenen und seiner Beschreibung unterscheidet, dann ahmt man am Ende die Beschreibung des Phänomens nach.“

Peter Berz schickte mir unlängst die Übersetzung eines Zitats aus dem Buch „Die biologische Ordnung“ des französischen Genetikers André Lwoff, der zusammen mit Jacques Monod und Francois Jacob das noch heute gültige „Operon-Modell“ kreierte. Es operiert mit Repressorenzymen, die in Gegenwart bestimmter Stoffe synthetisiert oder nicht synthetisiert werden und ihrerseits das Ablesen von Teilen des genetischen Codes (Operatoren-Gene) „steuern“. Lwoff schrieb über die damalige Studentenbewegung:
„In Frankreich, im Laufe des Monats Mai 1968, wurde ein bestimmter Typ von Ordnung gestört. Ein Sturm hat die Repressoren beschädigt, die Operatoren-Gene haben die Kontrolle durch die Operons verloren. Neue Moleküle wollten den Platz der alten einnehmen und haben das System der Regulation angezweifelt. Aus alledem resultierten unerwartete Ereignisse, interessante Ereignisse und, um alles zu sagen, sehr bemerkenswerte Ereignisse. Es gibt anscheinend nichts Gemeinsames zwischen einer molekularen Gesellschaft und einer menschlichen Gesellschaft. Man kann trotzdem nicht umhin, frappiert zu sein von einer bestimmten Analogie zwischen der phylogenetischen Evolution der Organismen und der historischen Evolution der Gesellschaften. …“
Als Monod 1967 seine Antrittsvorlesung am Collège de France hielt, arbeitete Louis Althusser die darin implizit und explizit enthaltene “Weltanschauung” in seiner ebenfalls 1967 gehaltenen “Philosophievorlesung für Wissenschaftler” an der Ecole Normale Supérieure heraus. Diese Vorlesung wurde 1985 auf Deutsch veröffentlicht – unter dem Titel “Philosophie und spontane Philosophie der Wissenschaftler”. Zehn Jahre zuvor hatte Althussers Schüler Dominique Lecourt bereits eine Analyse der proletarischen Biologie und des Scheiterns der Ideen des Präsidenten der Akademie für Landwirtschaften in der UDSSR Trofim Lyssenko veröffentlicht – mit einem Vorwort von Althusser. Lyssenkos Ideengebäude, mit dem er seine durchaus erfolgreichen landwirtschaftlichen “Techniken” theoretisch begründete, bezeichnete Lecourt darin als “Spontane Philosophie eines Gärtners”.
Über das Weltbild des Lyssenko-Abtrünnigen Monod schrieb Louis Althusser: Zwar habe dieser den “materialistischen Inhalt” beibehalten, “indem er den Mechanizismus und den Vitalismus ausschaltete, und indem er formulierte, dass es keine ‘belebte Materie’, sondern nur lebende System gibt und indem er das DNS als den ‘physischen Träger’ dieser lebenden Systeme kennzeichnete. Aber sobald Monod des Reich der Biologie verläßt, d.h. den Bereich dessen, was er mit einem bereits verdächtigen Begriff als ‘Biosphäre’ (in der Terminologie Teilhards) bezeichnet, um über das zu sprechen, was er mit einem noch verdächtigeren Begriff als ‘Noospähre’ (in der Terminologie Teilhards) bezeichnet, verkehrt er die materialistische Tendenz in eine idealistische und sogar spiritualistische” – indem er die Begriffe und Gesetze seiner “Biosphäre” mechanistisch auf ein ganz anderes “Realobjekt” projiziert – “auf die menschlichen Gesellschaften”.
Die beiden “Sphären” stehen für Monod in einer Art Basis-Überbau-Verhältnis, in dem noch die Marxsche Begrifflichkeit von Sein und Bewußtsein mitschwingt. In diesem Zusammenhang wünscht sich Monod “das Kommen eines ganz großen Geistes herbei, ‘der als Gegenstück zum Werk Darwins eine Naturgeschichte der Selektion der Ideen zu schreiben weiß’.”
Über Monods zentralen Begriff des “Zufalls” (sein 1972 erschienenes Hauptwerk hieß dann “Zufall und Notwendigkeit. Philosophische Fragen der modernen Biologie”) schreibt Althusser: “Innerhalb der Biologie bildet der Zufall für Monod gewissermaßen das genaue Anzeichen für die Bedingungen der Möglichkeit der Emergenz [das Auftreten des Lebens]. Aber wir müssen feststellen, dass Monod denselben Begriff des Zufalls beibehält, wenn er von der Biologie zur Geschichte übergeht, nämlich zur Noosphäre.”
Diese “biologistische Theorie der Geschichte”, dieser “Geschichtsdarwinismus” – ist Ausdruck seiner Kapitulation vor dem (US-)Kapital, das seiner Meinung nach auf dem Feld der “Ideen” genauso wirkt wie die “natürliche Selektion”. Weil er die “Wahrheit” nicht als geschichtlich bedingt und zeitgebunden begreift, reduziert sich sein Forschungsideal auf eine “Ethik der Erkenntnis”. Und weil er die auf dem Klassenkampf beruhende “marxistische Moral” ablehnt, setzt er stattdessen auf eine “subjektive, aristokratisch-intellektuelle Moral”, wobei er zwar die “religiöse Weltanschauung” bekämpft, sich von der “marxistischen” jedoch nur abgrenzt – “ohne sie abschaffen zu wollen”. Noch mal: Um der “Entfremdung der modernen Welt” entgegentreten zu können, setzt Monod statt auf den Klassenkampf als Motor der Geschichte nun auf die “Entwicklung der Erkenntnis” als “Motor der modernen Geschichte”. Dazu abschließend noch ein Zitat aus seiner Antrittvorlesung: “Das höchste Gut innerhalb der Ethik der Erkenntnis – ist die objektive Erkenntnis selbst”.
In Monods Fach, der Genetik, ist das heute allein die verwertbare, d.h. die profitable, Mehrwert schaffende “Erkenntnis”. “Die Problematik rund um den Ethikbegriff ist jetzt dreissig Jahre nach Monods ‘Zufall und Notwendigkeit’ aktueller den je,” schreibt der US-Internetversandhändler “amazon” über die Neuauflage seines Buches.
Der Medienwissenschaftler Peter Berz, der gerade an einem Vorwort zu Monods Antrittsvorlesung im Collège de France schreibt, kam über eine Fußnote in „Zufall und Notwendigkeit“ auf einen finnischen Biologen und Nobelpreisträger, der über sein agrarwissenschaftliches Engagement, u.a. zur Verbesserung der Qualität von Silage – aus Gründen des Geschmacks von Kuhmilch und -käse zur Bakterienforschung gelangte. Aus der Fußnote bei Monod entwickelte sich schließlich für ihn eine Korrespondenz mit den Nachfolgern im Institut des finnischen Forschers sowie eine mit dem brandenburgischen Hersteller von Siliermitteln Dr. Pieper. Neben der Milch und dem Käse sind die Mikroorganismen auch an der Herstellung von Brot und Bier wesentlich beteiligt. (3)
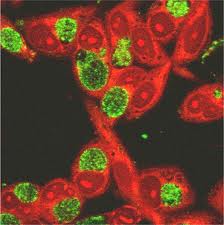
Anmerkungen:
(1) Näheres zu den (Lego-) „Bausteinen“. Über „Mycoplasma capricolum“ heißt es im „microbewiki“: „The infection often leads to destructive results in Africa and Asia goat farming industry.“ Der Baustein wird hier unter dem Gesichtspunkt einer durch ihn verursachten Haustierkrankheit/-Epidemie begriffen.
Unter dem Aspekt, ihn im „Baum des Lebens“ – der Hierarchie der Organismen – einzuordnen, gehört diese „Mikrobe“ – ebenso wie auch „Mycoplasma mycoides“ – zum Genus der Mykoplasmen: Bakterien, die man zur Klasse der Mollicutes zählt:
„Die phylogenetische Verwandtschaft dieser Gattungen wurde durch die auf Carl Woese zurückgehende Analyse der 5S und 16S rRNA ermittelt. Molekular-phylogenetische rRNA-Untersuchungen ergaben ferner, dass die Mollicutes nicht an der Basis des bakteriellen phylogenetischen Baums stehen, sondern vielmehr durch degenerative Evolution aus Gram-positiven Bakterien der Lactobacillus-Gruppe mit einem niedrigen GC-Gehalt der DNA hervorgegangen sind.
Im Zuge dieser degenerativen Evolution haben die Mollicutes einen erheblichen Teil ihrer genetischen Information verloren, sodass sie heute zu den Lebewesen mit dem kleinsten bekannten Genom zählen. Bakterien der Klasse Mollicutes leben nicht als freie Bakterien, sondern sind entweder auf eine Wirtszelle oder einen Wirtsorganismus angewiesen. Als Parasiten oder Kommensalen erhalten sie vom Wirtsorganismus essentielle Stoffwechselkomponenten wie z. B. Fettsäuren, Aminosäuren und Vorstufen der Nukleinsäuren. Die Möglichkeit zur Verkleinerung des Genoms wird auf die parasitäre Lebensweise der Mollicutes zurückgeführt.
Für das Wachstum einiger Vertreter der Mollicutes ist auch Cholesterin erforderlich, eine Komponente, die normalerweise nicht in Bakterien gefunden wird und deren Synthesevorstufen ebenfalls von den Wirtszellen zur Verfügung gestellt wird. Mykoplasmen sind als parasitär lebende Bakterien die Ursache für zahlreiche Krankheiten beim Menschen, Tieren und Pflanzen. In der Regel töten Bakterien aus der Klasse der Mollicutes ihren Wirt jedoch nicht ab. Vielmehr verursachen sie chronische Infektionen, was für eine gute Anpassung an die Wirte spricht, und verkörpern damit eine sehr erfolgreiche Art des Parasitismus.“ (Wikipedia)
Oben war davon die Rede, dass man sie auch zu den „Kommensalen“ zählen kann, also zu den Lebewesen, die zusammen mit anderen von der gleichen Nahrung leben, ohne diese zu schädigen. Verdankt sich diese begriffliche „Unschärfe“ am Ende einer ethisch-religiösen Forschungs-„Haltung“?
So wird in Indien z.B. die „Hauskrähe“ nicht als „Parasit“ begriffen – wie hierzulande von den Bauern und Krähentötern) und auch nicht als „Symbiont“ (wie von den hiesigen Naturschützern und Krähenfreunden), sondern als „Kommensale“. Dementsprechend vielfältig und subtil ist dort der buddhistisch-hinduistisch geprägte Umgang mit den schwarzen Vögeln.
Zur „Lactobazillus-Gruppe“, aus der sich die „Mollicutes“ herausgemendelt haben sollen, laut Carl Woese, hier einige Internet-Einträge:
1. eine Studie der finnischen Universität Oulu, in der es darum ging, herauszufinden, ob ein „Lactobazillussaft“ oder ein Saft aus Preiselbeeren und Moosbeeren zur Prävention von E.coli-Harnwegsinfektionen bei Frauen hilft. Dazu mußten drei Gruppen à 50 Frauen ein Jahr lang täglich diese Säfte trinken. Heraus kam, dass der „Lactobacillussaft eventuell zu unterdosiert war“, um zu wirken, der andere Saft erwies sich dagegen als eine wirksame „Alternative zu Antibiotika“.
Der Lactobazillensaft – das ist eine Art Cocktail aus Milchsäurebakterien. Dazu heißt es im Novamex-Lexikon:
„Sie besiedeln hauptsächlich den Dünndarm. Sie fördern die gesunde Verdauung und stärken das Immunsystem. Lactobazillen sind in einigen Joghurt-Sorten enthalten, einzeln oder kombiniert auch als Nahrungsergänzung erhältlich. Die Lactobazillen (Milchsäurebakterien) gehören zu den gesunden Bakterien bzw. Probiotika im Verdauungstrakt, sie bauen Zucker zu Milchsäure ab. Lactobazillen bestehen mit Lactobacillus acidophilus, casei und rhamnosis, um nur einige zu nennen, aus verschiedenen Gruppen, zu denen wiederum jeweils mehrere Bakterienstämme gehören. Die Lactobazillen sind neben den Bifidobakterien die wichtigste Bakteriengruppe im Darm und hauptsächlich im Dünndarm angesiedelt. Sie sind sowohl für das Verdauungs- als auch für das Immunsystem wichtig.
Lactobazillen fermentieren die Lactose, wodurch Milchsäure entsteht. Lactobazillen können das Enzym Lactase bei Menschen ersetzen, die dieses Enzym, das Lactose verdaut, nicht ausreichend bilden. Lactobazillen können weiter die Funktionen des Immunsystems stärken, da sie beispielsweise organische Säuren im Körper (Essig- und Milchsäure), Bakteriozin (körpereigenes Antibiotikum) und Wasserstoffperoxid bilden. Lactobazillen können helfen, Antigene – wie schädliche Bakterien und Viren – zu bekämpfen. So können beispielsweise mit Hilfe von Wasserstoffperoxid schädliche Antigen-/Antikörper-Komplexe aufgelöst werden. Einige Arten der Lactobazillen können allerdings auch Krankheiten erregen. Dazu gehören Streptococcus pneumoniae als Erreger der Lungenentzündung und der weit verbreitete Streptococcus mutans, der an der Entstehung von Karies beteiligt ist. Gesunde Lactobazillen werden in der Lebensmittelindustrie oft zur Konservierung von Lebensmitteln eingesetzt, das gilt beispielsweise für Joghurt, Sauermilch, Sauerkraut und den Sauerteig.“
Es gibt verschiedene Gruppen von Lactobazillen:
A.: „Lactobacillus acidophilus – besiedelt im Verdauungstrakt den Dünndarm, außerdem die weiblichen Geschlechtsorgane (Gebärmutterhals, Uterus und Vagina).
Diese Bakteriengruppe ist mit rund 200 verschiedenen Stämmen besonders groß und für die Gesundheit wichtig.“
Wikipedia fügt hinzu: „Lactobacillus acidophilus ist ein mittellanges, fakultativ anaerobes, grampositives Stäbchen mit abgerundeten Enden, das einzeln, in Paaren oder kurzen Ketten vorkommt. L. acidophilus kommt in verschiedenen Lebensmitteln, wie Milch, Getreide, Fleisch und Fisch vor. Innerhalb des Menschen besiedelt L. acidophilus den Mund, den Verdauungstrakt und die Vagina bzw. beim Mann das unverhornte Plattenepithel der Fossa navicularis, den erweiterten Bereich kurz vor der Harnröhrenöffnung. Im Allgemeinen vergärt das Bakterium homofermentativ Laktose zu Milchsäure. Einige heterofermentative Stämme können Ethanol, Kohlendioxid und Essigsäure produzieren. 2002 wurde das komplette Genom von L. acidophilus erfasst und am Seventh Symposium on Lactic Acid Bacteria in Egmond aan Zee, in den Niederlanden präsentiert.“
B.: „Lactobacillus brevis – besiedelt den Mund und den Magen-Darm-Trakt.
Dieser Stamm regt die Bildung von Lactobrevin an, das als Bakteriozin (körpereigenes Antibiotikum) wirkt.“
Wiki-answers.com fügt hinzu: „Lactobacillus brevis belongs to the Kingdom Monera.“
Erwähnt sei ferner die Studie: „Die Mikroflora des Sauerteiges XIII. Mitteilung: Das Verhalten von Lactobacillus brevis var. lindneri im Säuerungs- und Backversuch in Gegenwart homofermentativer Milchsäurebakterien“. Dazu heißt es auf „springerlink.com“:
„Es wurde der Frage nachgegangen, ob die Sauerteiggärung durch Wechselwirkungen zwischen den homofermentativen Sauerteigbakterien(Lactobacillus plantarum, L. casei, L. farciminis, L. acidophilus) und Lactobacillus brevis var. lindneri beeinflußt wird. Den Untersuchungen wurde die Detmolder Einstufensauerführung zugrunde gelegt, im Zusammenhang mit der Herstellung von Roggenmischbrot (60:40). Sowohl die Säuerungscharakteristik des Sauerteiges (pH and Säuregrad nach 18 stündiger Führung bei 27° bis 28°C, Gehalt an Milch- und Essigsäure, Gärungsquotient) als auch die Qualitätseigenschaften des Brotes (Elastizität, Säuerung und Geschmack der Krume) blieben unverändert, unabhängig davon, ob neben L. brevis var. lindneri eines der homofermentativen Sauerteigbakterien an der Sauerteiggärung beteiligt war.“
Die Firma Behrens Scheessel bietet als „Siliermittel für Maissilage“ an:
– „Heterofermentative Milchsäurebakterien (DLG-Kategorie 2):
Als Silierzusatz in erster Linie Lactobacillus buchneri bzw. Lactobacillus brevis. Ziel: Bildung von Essigsäure, die Hefen hemmen kann. Langsamere pH-Wert Senkung als homofermentative MSB, NH3-Gehalte steigen regelmäßig Essigsäure wirkt nur hefehemmend, wenn gleichzeitig auch der Zucker knapp wird, da Hefen im geschlossenen Silo eine Entgiftungsfunktion unter Verwendung von Zucker besitzen. Das bedeutet: Auch ein empfohlener Essigsäuregehalt von 2 % – 3,5 % i. d. TS schützt nicht vor Nacherwärmungen, sofern noch Restzucker von Hefen zur Entgiftung genutzt werden kann. Hohe TM-Verluste (Zuckerverluste) durch uneffektive Silierung (+ 1 – 2 % der TM) und durch provozierte Hefenaktivität (Entgiftung) ( + X % der TM) während der Lagerung.
– Homofermentative Milchsäurebakterien (DLG-Kategorien 1 u. 4):
In erster Linie Lactobacillus plantarum, Pediococcus und andere. Ziel: Bildung von Milchsäure zur schnellen pH-Senkung u. Reduzierung der Silierverluste (Nährstoffverluste).“
Erwähnt sei ferner eine globale – schon fast ins Religiöse – reichende sozio-ökonomische Bewegung, deren alpha und omega Milchsäurebakterien sind. Diese werden „EM“ – Effektive Mikroorganismen – genannt und so heißt auch die Bewegung selbst:
Es gibt bereits EM-Kaffee, EM-Gemüse, EM-Erdbeeren, EM-Äpfel, Käse aus Milchviehhaltung mit EM, EM-Eier, EM-Fisch, EM-Fleisch, EM-Wurst, EM-Wein – und demnächst EM-Bier sowie -Limonade. EM ist laut dem ungenau bleibenden „EM Journal“ eine Lösung aus Zuckerrohrmelasse, von und in der „genau definierte“ Milchsäuremikroben, Hefepilze und Photosynthesebakterien leben. In den Handel gelangt diese „braune Flüssigkeit“, die auch als „Mikroben-Cocktail“ bezeichnet wird, in Flaschen oder Kanister mit dem „internationalen Zeichen EM1“. Zur Anwendung gelangt EM1 in Form von EMa: Dabei handelt es sich um eine „Vermehrung keine Verdünnung“ von 1 Liter EM1 zu 33 Liter EMa – binnen einer Woche bei 35-38 Grad Celsius.
Anwenden kann man dieses Konzentrat dann nahezu überall: auf Feldern, in Wäldern, auf Wiesen und Äckern, im Kuhstall, auf der Diele, in der Scheune, in der Küche und in Weiterverarbeitungsbetrieben. Alles wird dadurch besser: die Lebensmittel schmecken intensiver, die Milch der Kühe ist haltbarer, die Tiere sind gesünder.
Darüberhinaus gibt es noch viele weitere „EM-Lösungen“: Sie werden regelmäßig auf den Webseiten des „EM e.V.“, der „Gesellschaft zur Förderung regenerativer Mikroorganismen“ und in den „EM-Journalen“ vorgestellt. Was diese zusammengewürfelten aber kooperierenden Haufen von Bakterien und Pilzen nicht alles können? Sie „steigern die Qualität der Lebensmittel signifikant, indem sie mehr als herkömmliche Lebensmittel so genannte Freie Radikale binden“ (das sind kurzlebige aber aggressive, sauerstoffhaltige Verbindungen mit einem freien Elektron, die verschiedene Vorgänge in den Zellen stören bzw. schädigen). Darüberhinaus sind sie in der Lage, „den Düngemittel-, Fungizid-, Insektizid- und Herbizit-Aufwand drastisch zu reduzieren, wenn nicht überflüssig zu machen.“ Sie versetzen hauseigene Kläranlagen in einen „gepflegten Zustand“ (wenn man 1 Liter EMa auf 1 Kubikmeter zusetzt). Als feinen Biofilm auf Wunden gepinselt lassen sie diese schneller verheilen. In Freibädern eingegeben verbessern sie die Wasserqualität – so z.B. in bisher über 300 japanischen Schulbädern sowie im Hollfelder Freibad, wo das „Zentrum für regenerative Mikroorganismen in Franken ,Der lebendige Weg‘ mit Sitz in Hollfeld“ dieses „EM-Projekt“ mit Rat und Tat begleitet. Darüberhinaus arbeitet man daran, quasi die ganze BRD mit EM-Beratungsstellen zu besetzen.
Deren Mitarbeiter erstellen vor Ort – z.B. in Sonderkulturbetrieben wie den Erwerbsobstbau – „eine PC-gestützte betriebswirtschaftliche Analyse, die auch den Einsatz von EM und die entsprechenden Kosten darstellt. Die Beratung zielt darauf, nicht den gesamten Betrieb von heute auf morgen auf EM-Anbau umzustellen, sondern zunächst auf dem gleichen Schlag eine EM-Variante einzusetzen. Wichtig ist dabei, gleiche Bedingungen zu schaffen. Gleicher Schlag, gleiche Sorte, bei mehrjährigen Kulturen gleicher Pflanzjahrgang.“ Dann kann der Kunde vergleichen, ob der EM-Einsatz etwas gebracht hat – und sich gegebenenfalls darüber mit anderen EM-Anwendern austauschen: Allein in Österreich gibt es inzwischen 15 EM-Stammtische, in Berlin einen. Daneben Jahreshauptversammlungen, Vorträge, Konferenzen, Exkursionen usw. an wechselnden Orten.
Hinter diesen ganzen „breitenwirksamen“ EM-Aktivitäten steckt die Erkenntnis, dass die Mikroorganismen nicht nur schädlich sind (Lebensmittel verderben, Krankheiten übertragen etc.), sondern auch überaus nützlich: Ja, ohne die etwa 2 Kilogramm Bakterien und Pilze an und in unserem Körper wären wir überhaupt nicht lebensfähig. Mit den meisten sozusagen körpereigenen Mikroorganismen leben wir in seiner Symbiose und sie untereinander ebenfalls: „Geht es den Mikroben in uns gut, geht es auch uns gut“, so sagen es die EM-Berater. Mikrobiologen wie Lynn Margulis gehen noch weiter: Sie vermuten, dass sich diese Einzeller einst zusammengeschlossen haben, um einen Vielzeller – nämlich uns – zu schaffen, damit sie immer ein ausreichendes Nährmedium zur Verfügung haben. Der Biochemie-Nobelpreisträger Richard J. Roberts kam jüngst zu dem Ergebnis, dass 90% der Zellen in unserem Körper Bakterien sind.
Der japanische Professor für Gartenbau Teruo Higa, Begründer der EM-Bewegung und der „EM-Research-Organisation“ (EMRO), unterscheidet zwischen für uns guten und schlechten Mikroben: „Wo gute sind, können sich schlechte nicht ansiedeln.“ Um die guten in Form von EMa auszubringen, kann man auf „EM-Technologie“ zurückgreifen. Auf den EM-Webpages werden dafür auch immer wieder selbstgebastelte Geräte vorgestellt. Von Professor Higa kann man außerdem „Bokashi“ beziehen, das ist Kompost, mit dem sich Blumen düngen lassen, der aber auch eine „gute Grundlage für die Tiere ist“.
In ihrem Buch über „EM-Lösungen für Haus und Garten“ erklären die Autoren, der Diplomlandwirt Ernst Hammes und die EM-Beraterin Gisela van den Höövel, die beide im EM-Zentrum Saraburin in Thailand ausgebildet wurden, wie man „Bokashi“ aus den unterschiedlichsten organischen Abfällen selbst ansetzen kann. Außerdem geben sie Beispiele, wie ihre „effektiven Mikroorganismen“ als EM-Mix u.a. im Haushalt verwendet werden können: bei der Wasseraufbereitung, beim Wäschewaschen, in der Spülmaschine und bei der Schnitt- bzw. Topfblumenpflege…
Einige weitere EM-Einsatzorte sind: in „selbstgemachten Joghurts“, bei der Sanierung alter Sofas sowie bei alten Holzmöbeln und – flächendeckend – auf der ersten „EM-Apfelplantage“ in Weissrussland. Dort wurden zuvor bereits beim Rübenanbau gute Ergebnisse mit EM erzielt: So stiegen die Ernteerträge von 350 Zentner pro Hektar auf 600-650, auch die Qualitätsziffern wurden deutlich besser: Der Zuckergehalt lag bei 17-18% und Stickstoff gab es halb so viel wie auf den Vergleichsflächen. Ähnlich erfolgreich ist die Teppichreinigung von Thomas von Stinissen in Wien: 2007 gewann er mit seiner dabei angewandten EM-Technologie den Umweltpreis „Energy Globe Austria.“
Die Brandenburger „Bauernzeitung“ berichtete, dass EM bereits in über 120 Ländern genutzt werde, allein in Deutschland gab es Ende 2006 über 3000 EM-Bauern. In dem Artikel wird namentlich der Milchbauer Thomas Unkelbach aus Hergolding erwähnt, der täglich seine Ställe mit einem „EMa-Wasser-Gemisch“ aussprüht und dessen Kälberverluste seitdem von über 20% auf unter 5% sanken. Ferner der Hühnerzüchter Bernhard Hennes aus Langenspach: Er installierte einen „Vernebler“ für das „EMa-Wasser-Gemisch in seinem Legehennenstall – und wurde damit der Milbenplage Herr. Sowie ein Dr. Franz Ehrnsperger von der Neumarker Lammbräu, wo die „EM-Technologie in nahezu alle Betriebsabläufe integriert wurde“, das beginnt bereits bei der Behandlung des Saatguts. Weitere Erwähnung fand eine Gänsezüchterin im norddeutschen Lohne, Iris Tapphorn, bei der in der Elterntierhaltung dank EM-Einsatz die Darmerkrankungen erheblich zurückgingen. Gute Erfahrungen mit EMa wurden außerdem bei der Silierung von Mais gemacht – was nahe liegt, da es sich hierbei um ein Milchsäuregärungsverfahren handelt, das man mit den zugefügten „Milchsäurenmikroben“ gewissermaßen „effektiviert“.
Den EM-Beratern ist am Verkauf ihrer Produkte gelegen, sie bemühen sich daneben aber auch um ein immer genaueres Verständnis der Wirksamkeit ihrer Mikroben-Konzentrate. Dazu verfolgen sie die Arbeiten der Mikrobiologen. Die Süddeutsche Zeitung schrieb über eine Forschungsarbeit der Mikrobiologin Susse Kirklund Hansen von der TU in Lyngby, Dänemark:
„Bevor Bakterien sich zusammenschließen, gibt es eine Art Absprache. Jedes Bakterium sondert Signalmoleküle aus, um seine Anwesenheit zu demonstrieren. Erreicht die Konzentration dieser Stoffe einen Schwellenwert, fangen die Keime mit der Schleimproduktion an. Dieses Kommunikationssystem wird als ,Quorum Sensing‘ bezeichnet.“
Die EM-Experten Hammes und Höövel gehen davon aus, dass die Mikroorganismen dabei über Elektronen kommunizieren: „Jede lebende Zelle strahlt ultraschwaches Licht aus.“ Dieser Forschungsansatz geht auf den russischen Biologen Alexander Gurwitsch (1874-1954) zurück und wird heute insbesondere von dem Biophotonenforscher Fritz Albert Popp in seinem Institut in Kaiserslautern weiterverfolgt. Die FAZ berichtete jüngst von einer Arbeit an einem Washingtoner Institut mit in Gewässern lebenden Bakterien der Art Shewanella oneidensis. Diese übertragen ihre elektrischen Ladungen über Nanodrähte, mit denen sie sich untereinander verbinden und die oft Dutzende von Mikrometern lang sind. Ähnlich können auch Cyanobakterien (Blaualgen) solche „elektrisch leitfähigen Strukturen“ ausbilden. Anderswo beobachtete man einen „Elektronentransfer per Stromkabel zwischen Mikroben unterschiedlicher Art“.
Während also hierbei das Kommunikations-Medium erforscht wird, geht es der Biologin Susse Kirklund Hansen in Dänemark und der deutschen Susanne Häusler (am Braunschweiger Zentrum für Infektionsforschung) um das (soziale) Zusammenleben der Mikroben: „Ihre Versuche zeigen, dass viele Bakterien im Biofilm nicht einfach nur viele Bakterien sind, sondern eine organisierte, kommunizierende Gemeinschaft, die sich nur schwer zerstören läßt“ – und manche nach einiger Zeit ausschließt. Robert Kolter von der Harvard Medical School spricht von einer „Stadt der Mikroben“: Das „Leben im Biofilm ist wie eine multikuturelle Gesellschaft. Man sucht sich die richtige Wohngegend mit passenden Nachbarn, profitiert von der Arbeit der anderen und wenn es unerträglich wird, zieht man wieder weg.“
So werden aus Bakteriologen Stadtforscher. Ironischerweise begann die (soziologische) Stadtforschung einmal – in englischen Armenvierteln – unter bakteriologischem Vorzeichen: Es ging dabei um Hygiene – und üble Krankheitserreger (z.B. im Trinkwasser). Den EM-Experten geht es nun ebenfalls wieder um Hygiene („Erhaltung, Förderung und Festigung der Gesundheit“ – laut Wikipedia), diese wollen sie jedoch nicht mehr mit keimtötenden Mitteln erreichen, sondern im Gegenteil mit keimvermehrenden Maßnahmen – u.a. in Badezimmern, Autowaschanlagen, Abwassersystemen und Kochtöpfen. Wobei sie jedoch zu bedenken geben, dass für einen erfolgreichen EM-Einsatz eine „Offenheit im Denken“ erforderlich ist. Im Grunde ist dieses Denken eine Ausweitung bzw. Konzentration der Ökologie auf den nichtsichtbaren Nahwirkungs-Bereich.
So bezeichnet dann auch Steven Gill vom „Institute of Genomic Research“ in Rockville, Maryland, die Bakterienflora im Darm z.B., wo 10 bis 100 Billionen Bakterien der unterschiedlichsten Art leben, als ein „Ökosystem“ bzw. als ein „Mikrobiom, das gewissermaßen ein zweites Ich darstellt“. Zur Aufbereitung unserer Speisen ist die „Zusammenarbeit mehrerer Gruppen von Mikroorganismen in einer Nahrungskette erforderlich“.
Die Berliner Zeitung schrieb über Gills Forschung:
„Beim menschlichen Stoffwechsel läßt sich kaum auseinanderhalten, welchen Beitrag der Mensch und welchen die Darmflora leistet. Dass Mensch und Mikroben in enger Symbiose leben, ist seit langem bekannt. Und man weiß auch, dass die winzigen Bewohner dem Wirt mehr nützen als umgekehrt. Sie bauen unverdauliche Nahrungsbestandteile zu verwertbaren Nährstoffen um, versorgen den Körper mit Vitaminen, die er sich selbst nicht beschaffen kann, und sie halten Krankheiten sowie Entzündungen in Schach.“
Der Spiegel befragte dazu 2005 den britischen Chirurgen und Bakteriologen Mark Spigelman: „Sie schlagen vor, Chirurgen sollten vor einer Operation die Hände in Lösungen aus gutartigen Bakterien, wie etwa solche aus Joghurt, tunken. Was ist so falsch an der Desinfektion?“ „Nichts. Antiseptische Seife ist unsere beste Waffe im Kampf gegen Bakterien. Aber wenn ich das als Chirurg den ganzen Tag mache, komme ich am Ende aus dem OP und habe sämtliche normalen, nützlichen Hautbakterien auf meinen Händen abgetötet. Das schafft erst den Raum für die fiesen Keime, sich dort niederzulassen.“
Auf der menschlichen Haut leben rund 180 Bakterienarten. Die Mikrobiologin Zhan Gao und ihre Kollegen an der New York University haben kürzlich herausgefunden, dass sie sich dem individuellen Lebenswandel der Menschen anpassen: „Nur eine kleine Gruppe von harmlosen Hautbakterien bleibt einem Menschen treu, die meisten Bakterien sind bloß vorübergehend zu Gast. Ihr Gedeihen wird beeinflußt von Faktoren wie Wetter, Licht, Hygiene und Medikamenteneinnahme,“ berichtete die Berliner Zeitung 2007. Im Jahr darauf führte ein Mikrobiologe auf einem Kongreß im Paris aus, dass Untersuchungen auf einem französischen Bauernhof ergeben hätten, dass nicht nur alle Nutztiere dort die gleichen Mikroorganismen an und in sich gehabt hätten, sondern auch die Bauernfamilie inklusive ihres Hundes und ihrer Katzen.
Grundsätzlich gilt demnach für alle das, was die EM-Experten für die Landwirtschaft sowie die Viehzucht empfehlen und der Biochemiker Richard J. Roberts dem Menschen: „Der einzige Schutz vor krank machenden, pathogenen Keimen ist die Besiedlung durch nicht krank machende Bakterien. Lactobacillus oder Bifidobakterien im Joghurt sind vor allem deshalb gesund, weil sie andere, pathogene, Bakterien fernhalten. Der Trick ist, jede ökologische Nische auf und im Körper mit unschädlichen Keimen zu besetzen. Übertriebene Sauberkeit schafft dagegen erst Leerräume für die Besiedlung durch wirklich gefährliche Keime.“
Ende 2006 berichtete der Spiegel über Tom Baars, dem weltweit ersten Professor für biologisch-dynamische Landwirtschaft an der Universität Kassel in Witzenhausen:
Der holländische Anthroposoph verpasse dort vermeintlich „Okkultem“ wissenschaftliche Weihen – warnte das Magazin und zitierte dazu gleich mehrere Wissenschaftler, die entsetzt waren, wie leichtfertig die renommierte Agrarfakultät sich damit dem „Esoterik-Verdacht“ aussetze. Zum „Beweis“ referierte die Spiegel-Hausbiologin Rafaela von Bredow eines der biologisch-dynamischen Verfahren: „Eine von Rudolf Steiners Erleuchtungen verdanken die Bauern etwa die Anweisung, Kuhhörner (von weiblichen Tieren, die schon einmal gekalbt haben) im Acker zu verbuddeln, gefüllt mit zerriebenen Quarzkristallen (nach Ostern mit Regenwasser zu einem Brei rühren!). Mars, Jupiter und Saturn heißt es, strahlten über solche ,kieseligen Substanzen‘ von unten nach oben und verströmen ihre kosmischen Kräfte, indem sie auf Blütenfarbe, Frucht und Samenbildung wirkten. Nach ein paar Monaten Lagerzeit graben die Anthroposophenbauern die Hörner wieder aus und kratzen deren Inhalt heraus. Braucht nun etwa ein Tomatenbeet kosmische Zuwendung, verrühren die Landwirte eine winzige Menge davon in einem grossen wassergefüllten Faß. So ,dynamisiert‘ der bäuerliche Alchemist das Wasser. Den fertigen Zaubertrank schleudert er dann mit Hilfe eines Handbesens in Tröpfchen über das Gemüse.“
Fast genauso könnten auch die EM-Berater und -Bauern über die Herstellung und Anwendung ihres Bakterien-Konzentrats sprechen – nur dass sie im vergrabenen Kuhhorn, gefüllt mit Quarz (sie würden allerdings japanische Tonerde vorziehen) weniger die „kosmischen Kräfte“ als vielmehr die „mikrobiotischen“ am Werk sehen. Auch die „Dynamisierung“ dieses Prozesses in wassergefüllten Gefäßen durch Rühren und Abstehen lassen, wäre ihnen nicht fremd, nur dass sie statt von Verdünnen von Vermehren sprechen würden. Was an den „EM-Technologien“ eher noch mehr stört als an der biologisch-dynamischen Wirtschaftsweise, ist die ständige Betonung der „Effektivierung“ – aller Lebensvorgänge im Hinblick auf ihre marktwirtschaftliche Verwertung.
Zwar wird wohl zugegeben, dass dieses Geschäft auch und gerade das mikrobiotische Miteinander zerstört hat – auf den Äckern, Wiesen, in Gärten und Ställen, ja sogar in den Wohnhäusern und Körpern , aber wieder ins Gleichgewicht gebracht werden soll es mit einem weiteren Produkt – EM1 , das sich in seiner Warenform als „Allheilmittel“ anpreist, und somit sämtliche „Fehlentwicklungen“ monokausal erklären muß. Am Ende hat ihre Bakteriologie als angewandte Wissenschaft alle anderen ersetzt. Ist das schon „offenes Denken“ – oder noch Teil einer „Biopolitik der Unsichtbaren“, von der die neuen Studien einiger Autoren, darunter der „Anthraxforscher“ Philip Sarasin, über „Bakteriologie und Moderne“ handeln? Sie beschränken sich darin auf die Geschichte der Verfolgung und Vernichtung der Mikroorganismen und verfolgen dabei die Wege zur allgemeinen Überzeugung, dass dies dringend notwendig sei – während die EM-Propagandisten uns nun genau das Gegenteil versprechen: einen Biofilm mit Happy-End.
C.: „Lactobacillus casei – besiedelt den Dünndarm.
Dieser Stamm hat wie L. acidophilus einige wichtige Funktionen im Verdauungs- und Immunsystem, er ist jedoch in seiner Wirkung eingeschränkter. L. casei ist in einigen Käsesorten enthalten, beispielsweise im italienischen Provolone und Parmesan sowie im spanischen Manchego. L. casei ist einigen fermentierten Milchprodukten zugesetzt (u.a. Actimel und Yakult) sowie allgemein in vielen Joghurt- und Kefir-Produkten enthalten. L. casei ist gegenüber Magen- und Gallensäuren resistent, daher übersteht er meist den Transit durch den Magen, wenn er zusammen mit anderen Nahrungsmitteln aufgenommen wird.“
D.: „Lactobacillus rhamnosis – besiedelt den Verdauungstrakt.
Dieser Stamm wurde zunächst als Stamm des L. acidophilus, später als Stamm des L. casei eingeordnet (daher findet sich manchmal die Bezeichnung L. casei GG). Seit 1989 gilt er als eigenständige Gruppe der Lactobacillen. Ähnlich wie L. acidophilus hat auch L. rhamnosis sehr viele Funktionen im Körper, er gehört zu den wichtigsten Gruppen der Lactobacillen. Dieser Stamm ist für das Verdauungssystem wichtig, er kann helfen, Diarrhoe zu lindern und generell die „intestinale Permeabilität“ (Durchlässigkeit der Darmwände) zu verringern. L. rhamnosis heftet sich an die Zellen der Darmwände, ohne die Darmwände zu beschädigen. Darauf wird ein Großteil seiner nützlichen Funktionen im Verdauungssystem zurückgeführt. L. rhamnosis kann außerdem Harntrakt-Infektionen lindern und auch Candida albicans hemmen.
Dieser Stamm kann (Nahrungsmittel-)Allergien lindern, verschiedene Bakterien und Viren sowie die toxischen (giftigen) Nebenwirkungen von Antibiotika bekämpfen. Auch (atopische) Dermatitis kann eventuell durch L. rhamnosis verringert werden. L. rhamnosis ist wie L. casei gegenüber Magen- und Gallensäuren resistent, er übersteht meist den Transit durch den Magen, wenn er zusammen mit anderen Nahrungsmitteln aufgenommen wird.“
E.: „Lactobacillus plantarum – besiedelt den Mund und den Magen-Darm-Trakt.
Diese Gruppe der Lactobazillen hat einige Funktionen im Verdauungs- und Immunsystem und kann außerdem einen erhöhten Blutdruck senken. L. plantarum ist im Sauerkraut enthalten.“
Wikipedia ergänzt: „Viele Arten der Lactobacillaceae bilden Bacteriocine, giftige Proteine oder Peptide, die von Bakterien abgesondert werden und andere (konkurrierende) Bakterienarten töten oder das Wachstum behindern. Bacteriocine die von verschiedenen Lactobacillus-Arten gebildet werden sind u. a. Lactacin-F und Bavaricin-A. Lactobacillus plantarum bildet verschiedene Plantaricine – A, S, T, und Plantaricin-SIK.“
Die ostdeutsche Firma „Dr.Pieper“ macht seit der Wende mit Lactobazillus plantarum – als wesentlicher Bestandteil seiner „Silierhilfe“ BIO-SIL – gute Geschäfte. In ihrem Katalog heißt es:
„BIO-SIL ist ein DLG-geprüftes biologisches Siliermittel zur Flüssigapplikation. Es ist eine gefriergetrocknete Bakterienkultur, die aus den Stämmen Lactobacillus plantarum DSM 8862 und Lactobacillus plantarum DSM 8866 besteht.“

Vor einigen Jahren besuchte ich den Agrarökonom Bernd Pieper und seine damalige „Garagenfirma“ in Wuthenow bei Neuruppin – und notierte mir:
„Silage ist – ähnlich wie Sauerkraut – ein milchsäurevergorenes Grünfutter, das im Freien gelagert wird. Im Westen meist unter weißen Plastikplanen, die mit alten Autoreifen beschwert werden, im Osten in dreiwandigen Betonsilos. Mit seinen Zusätzen zur Steuerung und Verbesserung des Gärvorgangs liegt Pieper „genau im Trend“, wie er meint, „denn über die Silagequalität werden 60 Prozent der Leistung einer Landwirtschaft bestimmt und die Bauern, auch die im Westen, müssen heutzutage auf Qualität und Leistung achten“. Interessenten an seinen Entwicklungen aus England und den USA, und über hundert landwirtschaftliche „Spitzenbetriebe“ in Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Bayern als Kunden geben ihm Recht. Mittlerweile beschäftigt er schon zwei Wissenschaftler, einen Landtechniker und eine Assistentin in seiner neuen Firma hinterm Haus.
Vorne im Wohnhaus praktiziert seine Frau als Ärztin. Bereits während seines Studiums in Rostock hatte Bernd Pieper sich auf Tierernährung spezialisiert. Er arbeitete dann in der Futterökonomie der Agrarindustrievereinigung Fehrbellin, später im Milchberatungsdienst einer Molkerei. Als diese 1991 geschlossen wurde, fand er für kurze Zeit Anstellung bei „Müller-Milch“: „Ich war mit der Standortvorbereitung im Rahmen ihrer Expansion in den Osten beschäftigt.“ Über den Produktentwickler von „Müller-Milch“ kam Pieper bei einem Berliner Sportgetränke-Hersteller zum ersten Mal mit „organischen Hydrokolloiden“ in Berührung. Sie sind wichtiger Bestandteil von Tapetenkleister, beim Sportgetränk sollten sie für die Sämigkeit sorgen. Pieper hatte die Idee, sie bei der Silage zum Binden des Sickersaftes einzusetzen, so dass davon nichts mehr in den Boden abfließen kann. Eine kurze Arbeitslosigkeits-Phase nutzte er, um sich in die entsprechende Literatur einzulesen, mit den Herstellern zu korrespondieren und in seiner Garage zu experimentieren. Dann meldete er ein erstes (Verfahrens-)-Patent an (siehe oben): „Es funktionierte, einige Großbetriebe haben es erfolgreich getestet. Wir müssen aber noch die Rezeptur des Pulvers optimieren: d.h. eine höhere Zusammensetzung und einen Preis dafür finden, der so ist, dass dabei ein Gewinn entsteht.“
Zur Steigerung der Grünfutter-Qualität bietet die Firma „Dr. Pieper“ inzwischen noch weitere „intelligente und umweltfreundliche Silierhilfen“ an: Melasse z.B., ein Abfallprodukt der Zuckerproduktion aus Rüben, das bereits bei derGrünfutterernte mittels eines Dosiergerätes über den Häcksler der Silage beigemischt wird. Mit dieser Kohlehydrat-Applikation läßt sich die Milchsäurebildung forcieren. Pieper verkauft auch die dafür notwendigen Tankanhänger und Installationen, während sein Elektroingenieur Norbert Lindszus fortwährend an ihrer Verbesserung arbeitet. Ein weiteres Problem bei der Milchsäurekonservierung ist die Überhitzung der Silage – durch zu viel Sauerstoff. Auch dafür hat Pieper eine Lösung im Angebot: Trockeneis von BASF, das zwischen die Grünfutter-Schichten des Silos verteilt wird. „Damit bleibt das Ganze saftig und frisch.“
Was mit der „Silage in Aspik“-Idee anfing, wuchs sich inzwischen zu neun Patenten aus, einem Werkstattneubau in Planung und Kooperationsabkommen mit der Universität von Kentucky, der Preussag AG sowie der amerikanischen Firma „Alltech“. „Langsam rechnet es sich“, verriet Bernd Pieper bereits der Berliner Zeitung. Sein unternehmerischer Optimismus äußert sich u.a. in der Überzeugung, dass mit der Verwissenschaftlichung der Grünfutter-Silierung das Heu langsam aber sicher überflüssig wird. Politisch steht er der SPD nahe, die den Parteilosen als Kandidaten für das Stadtparlament von Neuruppin aufstellte, wo er nun dem Ausschuß für Wirtschaft, Umwelt und Tourismus vorsitzt. Dort engagiert er sich insbesondere für den Umbau der Pfarrkirche in ein Kongreßzentrum. Daneben reist er viel – auf landwirtschaftliche Kongresse z.B., wo er seine Silage-Verbesserungsideen vorstellt: „Wissenschaftlich gesehen haben wir was Neues gemacht, und dafür schon viel Anerkennung bekommen, aber auch Neider und Skeptiker haben sich eingestellt, das gehört ja dazu.“
F.: „Lactobacillus reuteri – besiedelt den Mund und den Verdauungstrakt.
Diese Gruppe der Lactobazillen kann Diarrhoe erleichtern und einige schädliche Bakterien, darunter Escherichia coli und Salmonellen, hemmen.“
G.: „Lactobacillus salivarius – besiedelt den Verdauungstrakt.
Diese Gruppe der Lactobazillen hat einige ähnlicher Funktionen wie L. acidophilus. L. salivarius kann das Wachstum vieler schädlicher Bakterien, speziell von Listeria monocytogenes, hemmen.“
Wikipedia fügt hinzu:
„Lactobacillus salivarius und L. ruminis zählen zu der autochthonen Darmflora des Menschen. Autochthone Bakterien sind innerhalb des jeweiligen Lebensraums regelmäßig nachweisbar. L. salivarius und L. ruminis sind somit ‚feste Bewohner‘ des menschlichen Darms. Nur zeitweilig treten die Arten Lactobacillus paracasei, L. brevis, L. fermentum, L. plantarum und L. rhamnosus im Darm auf. In Mägen verschiedener Tiere wie Mäusen, Schweinen und Ratten formen Laktobazillen Zellschichten, die mit den Epithelzellen des Magens verbunden sind. Im Verdauungstrakt von Schweinen treten vor allem Lactobacillus amylovorus, L. johnsonii und L. reuteri auf. Weiterhin bilden einige Laktobazillen dichte Schichten am Epithel im Kropf von Vögeln, hierbei vor allem die Art Lactobacillus salivarius….Verschiedene Arten von Lactobacillus bilden die sogenannte Döderlein-Bakterien oder Döderleinsche Stäbchen. Die Döderlein-Bakterien sind ein Teil der natürlichen Scheidenflora der Frau. Durch die Gärung erzeugen die Bakterien in der Scheide eine saure Umgebung und schützen so die Scheide vor anderen, krankheitserregenden Bakterien, die einen niedrigen pH-Wert nicht tolerieren. Zu den bei verschiedenen Untersuchungen am häufigsten bestimmten Arten zählen Lactobacillus crispatus, L. gasseri, L. jensenii und L. iners. Früher wurde Lactobacillus acidophilus als dominierende Art in der Scheidenflora von gesunden Frauen bestimmt.
Die Milchsäuregärung wird sowohl von homofermentativen als auch von heterofermentativen Arten geleistet: „Homofermentative Arten produzieren durch Fermentation praktisch ausschließlich Milchsäure, während heterofermentative Arten neben Milchsäure zu einem bedeutenden Teil auch andere Endprodukte erzeugen, meist Ethanol und Kohlendioxid. Den heterofermentativen fehlt in der Regel das Enzym Aldolase….Arten von Lactobacillus sind meist resistenter gegen niedrige pH-Werte als die übrigen Milchsäurebakterien, und wachsen auch bei pH-Werten von 4 bis 5.“
Im Wikipedia-Eintrag finden die L.-Bazillen eine weitere Unterteilung – nach ihrer Nützlichkeit (auch wenn daran meist noch andere Bakterienarten beteiligt sind):
„- Käseproduktion: Arten von Lactobacillus wie beispielsweise Lactobacillus helveticus
– Sauerkraut: Verschiedene Arten von Lactobacillus, zu den weiteren beteiligten Gattungen zählt u. a. Leuconostoc.
– Sauermilch: Lactobacillus acidophilus.
– Joghurt: Unter anderem Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus (in diesen Zusammenhang in der Literatur meist als Lactobacillus bulgaricus bezeichnet).
– Silage in der Landwirtschaft: Pediococcus pentosaceus und Lactobacillus plantarum.
– Rohwurstherstellung (z. B. Salami): In Starterkulturen werden von den Pediokokken hauptsächlich die Arten Pediococcus acidilactici und P. pentosaceus, den Laktobazillen Lactobacillus pentosus, L. curvatus, L. sake und L. casei eingesetzt. Weitere Bakteriengattungen, die in Starterkulturen genutzt werden, sind Staphylokokken (z. B. Staphylococcus carnosus und S. xylosus) und Micrococcus varians.
– Bei der Herstellung einiger Biersorten wie der Berliner Weiße: Verschiedene Arten Lactobacillus zusammen mit Hefen.“
Im Home Brew Forum findet sich dazu die Anfrage: „Hey guys, Does anybody know where I can get ahold of some lactobacillus brevis? I’d like to use it to make a Berliner Weisse…“
Das PCR-Labor gibt auf seiner Internetseite jedoch zu bedenken: „Lactobacillus brevis besitzt allerdings ebenfalls eine große Bedeutung als Bierverderber in der Getränkeindustrie.“
Und die Münchner Universität gibt bekannt:
„Seit Juni 2009 bietet das Forschungszentrum Weihenstephan für Brau- und Lebensmittelqualität den Nachweis und die Identifikation von bierschädlichen und potentiell bierschädlichen Bakterien als Auftragsanalytik an. Diese Methode detektiert auch Bakterien, die erst in den letzten Jahren als bierschädliche Arten bekannt geworden sind, wie z.B. Lactobacillus backi, Lactobacillus rossiae und Lactobacillus collinoides. Die Abbildung zeigt einen bierschädlichen Stamm der Art Lactobacillus brevis, welcher deutlich sichtbar Schleim bildet, der hauptsächlich aus Exopolysacchariden besteht.“(3)
„Eine neue Verwendung gibt es als Hauptbestandteil von Zahnpasta: der Lactobacillus paracasei gegen Karieserreger.“ (Wikipedia)
Das „Zentrum der Gesundheit“ wirbt für ein Mittel namens „Combi Flora“: „Durch einen gezielten Aufbau der Schleimhäute der Darmflora und der Scheide können Sie Ihre Gesundheit wesentlich unterstützen. Dazu bieten wir Ihnen ein reichhaltiges Angebot an Probiotika, den freundlichen Lactobakterien und Bifidobakterien aus der Combi-Flora…“
Auf „was-hilft-mir.com“ wurde dazu ein Erfahrungsbericht veröffentlicht:
„Seit meiner Jugend leide ich unter einem Reizdarm. Sobald Stress aufkommt oder mir etwas Neues bevorsteht, geht es los. Durchfall, Blähungen und das Gefühl, besser nichts zu essen. Ich wollte dem endlich ein Ende bereiten und ging zur Heilpraktikerin. Dieser erklärte mir, dass die häufigste Ursache für Darmerkrankungen eine gestörte Darmflora sei und sie mir mit einer Darmsanierung helfen könne. Die Darmsanierung wurde mit Olvuson Lactobacillus rhamnosus und Lactobacillen acidophilus durchgeführt. Ganz bequem konnte ich täglich das Pulver selbst einnehmen und war erstaunt, wie gute es mir von Tag zu Tag ging. Die Darmreizung verschwanden langsam und auch mein Immunsystem, was sonst immer sehr weit unten war, baute sich langsam wieder auf. Ich fühlte mich fitter und belastbarer…“
Auf „urbia.de/we are family“ findet sich dagegen folgende Warnung:
„Hallo Mamis,
möchte jetzt keine Hysterie auslösen, aber ganz Holland ist in Aufruhr wegen neue Resultate bei Studien nach Lactobacillen (Actimel, Activia, Yakult &Co). Leute, die eine ernsthafte Pankreas- (Bauchspeicheldrüse) Erkrankung hatten, die im KH behandelt worden sind, haben die in 2 Gruppen aufgeteilt. 75 Probanden bekamen Lactobacillen, 75 bekamen Placebos. Von der Placebo Gruppe starben 6 Menschen (etwa 8%), von der Lactobacillen gruppe ganze 26 (34%!). Die Meinungen gehen stark auseinander. Die Produzenten sagen natürlich, dass es daran nicht liegen könnte. Bin selber eine Befürworterin der Lactobacillen, da mein Kind seitdem er Actimel bekommt deutlich weniger Krank ist (gar nicht sogar). Aber jetzt bin ich auch verunsichert, ob es keine Dauerschäden verursachen kann. Werde euch auf den Laufenden halten, so bald ich mehr weiss…“
Zurück zu den aus Lactobazillen herausmutierten „Mollicutes“:
„Mollicutes (lat. mollis = „weich“, cutis = „Haut“, die Weichhäutigen) bezeichnet eine Klasse von Bakterien. Sie gehören zum Stamm der meist grampositiven Firmicutes, sind selbst aber gramnegativ, weil sie keine Zellwand besitzen. Sie repräsentieren die kleinsten und einfachsten bekannten Organismen, und sie leben parasitisch von anderen Zellen. Die winzigen Mollicutes sitzen dabei auf oder in ihren Wirtszellen und entnehmen diesen viele der Verbindungen, die sie zum Leben benötigen. Besonders in der Familie der Mycoplasmen findet man Krankheitserreger. Das Genom der Mollicutes ist sehr klein und lässt zahlreiche Gene für die Synthese lebenswichtiger Moleküle (etwa Aminosäuren) vermissen. Dies beruht – genau wie das Fehlen einer Zellwand – auf der Anpassung an die parasitische Lebensweise. Vertreter der Mollicutes sind in Forschungslabors gefürchtete Kontaminanten von Zellkulturen, weil sie aufgrund ihrer geringen Größe und flexiblen Zellstruktur bakteriendichte Filter passieren können. Durchschnittlich 30 % aller Zellkulturen sollen Mycoplasmen enthalten. Die häufigsten Kontaminanten sind Mycoplasma hyoorhinis, M. laidlawaii, M. arginii und M. orale. Die Mycoplasmen können physiologische und morphologische Parameter der infizierten Zellen verändern und so die Ergebnisse verschiedener Experimente beeinflussen. Zellkulturen müssen deshalb regelmäßig auf Kontamination untersucht werden.“
Weiter heißt es auf Wikipedia – unter Mycoplasmen: „Es sind sehr kleine, selbstständig vermehrungsfähige Bakterien aus der Klasse der Mollicutes. Mit einer Größe von 580-1.380 kbp haben die Gattungen Mycoplasma und Ureaplasma das kleinste Genom der zur Auto-Replikation befähigten Prokaryonten mit Ausnahme des Tiefsee-Archaeons „Nanoarchaeum equitans“ (~500 kbp). Mykoplasmen sind parasitär, intra- und extrazellulär lebende Bakterien, die beim Menschen, Tieren und Pflanzen die Ursache für zahlreiche Krankheiten sind. Sie leben aerob bis fakultativ anaerob. Die erste Art wurde 1898 beschrieben.“
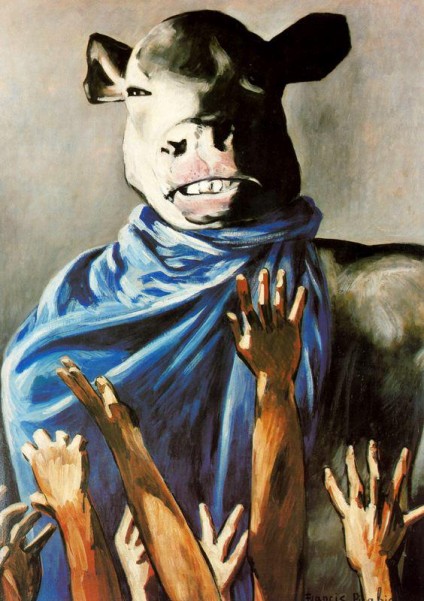
In der Süddeutschen Zeitung wurden 2012 einige Forschungsergebnisse zusammengefaßt, in der es historisch um die Milchsäurebakterien ging – wann und wie sie für die Menschen nutzbar wurden:
„Sehen Sie mal, wie die Schwänze der Kühe hier über den Köpfen der Melker liegen!“ Die Anthropologin Ruth Bollongino von der Universität Mainz zeigt auf die Abbildung einer Melkszene auf einem sumerischen Relief aus dem Tempel der Fruchtbarkeitsgöttin Ninhursag. Dort sitzen zwei Melker nicht neben, sondern direkt hinter den Kühen. „Vermutlich wird hier das sogenannte Kuhblasen gezeigt, die Melker blasen den Kühen in die Vagina oder den After, um die Milchproduktion zu stimulieren.“
Als Bauern noch keine Hochleistungskühe gezüchtet hatten, war das Abmelken größerer Milchmengen offenbar ein komplizierter Vorgang. Dann fällt der Forscherin noch ein Detail auf: „Die Kälber – unmittelbar neben der Kuh! Beim frühen Hausrind mussten die Kälber nah bei den Müttern stehen, damit diese Milch geben konnten.“
Die Analyse von Bollongino zeigt, wie man mit der Hilfe von interdisziplinärem Wissen und genauer Beobachtungsgabe zu weitreichenden Schlüssen kommen kann. So war sich die Fachwelt lange Zeit einig, dass das 4400 Jahre alte Relief einer der frühesten historischen Belege für das Melken von Tieren ist. Doch Bollongino wollte sich mit diesem Datum nicht zufriedengeben.
Sie gehört nämlich zu einem Forscherteam, das anhand von Genuntersuchungen an jahrtausendealten Rinderknochen erstmals die Herkunft des europäischen Hausrindes aufklären konnte. Das Ergebnis war spektakulär: Demnach stammen alle unsere Hausrinder von weniger als 100 weiblichen Auerochsen aus Anatolien ab.
Das bedeutet: Die Domestizierung des wilden Auerochsen ist in Europa vermutlich nur an diesem einzigen Ort gelungen. Für Bollongino ist das gut nachvollziehbar: „Der Auerochse war ein mächtiges Tier mit einer Schulterhöhe von bis zu 1,80 Meter. Wir vermuten, dass er sehr schwierig zu handhaben war.“ Als die Viehhalter mit ihrem kostbaren Zuchterfolg nach Europa einwanderten, sorgten sie deshalb dafür, dass sich ihre Rinder nicht mehr mit wilden Auerochsen zurückkreuzten. „Sie mussten sie also streng absondern, in Gehegen zum Beispiel.“
Und dieser ganze Aufwand nur, um das Fleisch der Rinder zu nutzen – nicht aber die nahrhafte Milch? Wieso fanden sich in der Jungsteinzeit bislang keine Spuren von Milch und Käse? „Unsere Forschung zeigt, dass der Mensch vor 10.500 Jahren die ersten Rinder domestizierte“, resümiert Bollongino. „Soll er etwa über 5000 Jahre Rinder gehalten haben, ohne sie zu melken?“ Kaum zu glauben.
Bis vor wenigen Jahren stellte dieser Sachverhalt Prähistoriker und Archäozoologen vor ein großes Rätsel: Wann hat der Mensch das Melken erfunden, und was hat er mit der Milch gemacht? Doch dank neuester naturwissenschaftlicher Methoden und akribischer Spurenlese können sich Forscher mittlerweile langsam ein Bild von der frühen Milchwirtschaft machen.
Einen wichtigen Erfolg erzielten dabei Kollegen Ruth Bollonginos am Nationalen Museum für Naturgeschichte in Paris. Die Archäozoologen dort entwickelten in vielen Jahren neue Methoden, wie man selbst an uralten Tierknochen verlässlich Spuren der Milchwirtschaft herauslesen kann: So weiß man zum Beispiel, dass ein bestimmtes Schlachtalter bei Kälbern nur dann sinnvoll ist, wenn die Muttertiere viel Milch geben sollen.
Wenn man nun nachweisen könnte, dass tatsächlich viele Jungtiere regelmäßig in diesem Alter getötet wurden, wäre dies ein starkes Indiz für das Melken. Tatsächlich gelang genau dies einer Forschergruppe um den Archäozoologen Jean-Denis Vigne. Sie fanden an 6000 bis 8000 Jahre alten Fundstätten zahlreiche Rinderknochen mit deren Hilfe sie eine jungsteinzeitliche Schlachtstatistik erstellen konnten. Ergebnis: Dort starben viele sehr junge Kälber und alte Muttertiere.
Roz Gillis, Knochenspezialistin aus Vignes Team, sagt: „Diese Kälber wurden nur gehalten, damit die Kühe Milch geben konnten, danach wurden sie nicht mehr gebraucht und geschlachtet. Das tut man nur, wenn man ausschließlich an der Milchnutzung interessiert ist.“
Ein Makel aber blieb bei den faszinierenden Knochenfunden. Sie konnten die Milchnutzung nur indirekt belegen. Milch und Käse selbst bleiben bei diesem Verfahren weiterhin unsichtbar.
Britische Archäologen der Universität Bristol schafften hier den Durchbruch: Das Team um den Biochemiker Richard Evershed hatte in zahlreichen Tonscherben von jungsteinzeitlichen Fundstätten winzige Fettreste entdeckt. Sie entwickelten ein chemisches Analyseverfahren, mit dem sie zuverlässig unterscheiden konnten, ob die Fettreste von fleischlichen Fetten oder von Milchfetten aus vergorener Milch stammten.
So konnten die Wissenschaftler erstmals an 6000 bis 8000 Jahre alten Geschirrresten direkte Spuren von Milch beziehungsweise ihren weiterverarbeiteten Produkten nachweisen. „Wir haben jetzt anerkannte chemische Nachweisverfahren,“ sagt Richard Evershed. „Wir reden hier also wirklich von harten Beweisen und nicht von irgendwelchen Interpretationen.“
Doch woher stammt die vergorene Milch? Von frischer Trinkmilch, die in den Tongefäßen langsam vergärte oder von gezielt hergestellten Milchprodukten wie zum Beispiel Joghurt oder Käse? „Wir vermuten, dass sie von Milchprodukten und nicht von frischer Trinkmilch stammt, aber beweisen kann unser Verfahren das nicht“, schränkt Richard Evershed ein, „auch wenn die Art der untersuchten Tongefäße darauf hindeutet, dass es um die Weiterverarbeitung von Milch ging und nicht nur um den Transport.“
Selbst die Milchfette konnten also noch nicht klären, was die frühen Viehhalter beim Melken ihrer Kühe gewinnen wollten: Trinkmilch, Käse oder beides? Diesmal waren es wieder Forscher der Universität Mainz, die den fehlenden Puzzle-Stein lieferten – durch die Analyse menschlicher Gebeine.
Das Team um den Anthropologen Joachim Burger war nämlich auf der Suche nach den Ursprüngen des Milchtrinker-Gens, einer Genmutation, die es in der Jungsteinzeit einigen Europäern erstmals ermöglichte, auch als Erwachsene Frischmilch zu trinken. Denn sie konnten dank dieses neuen Gens Laktose – also Milchzucker – verdauen. Wer hingegen dieses mutierte Gen nicht in sich trägt, den plagen nach Frischmilch-Konsum Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen; er ist laktoseintolerant.
Evolutionär ist Laktoseintoleranz eigentlich der menschliche Normalzustand. Nach den ersten Kinderjahren schaltet ein Gen das Verdauungssystem um, ab dann kann keine Laktose mehr verdaut werden. Menschen mit Laktoseintoleranz können deshalb als Erwachsene nur Milchprodukte aus vergorener Milch konsumieren, denn beim Vergären wird die Laktose abgebaut. Menschen mit dem mutierten Milchtrinker-Gen hingegen können ihr ganzes Leben lang auch Frischmilch genießen.
Die Mainzer Anthropologen suchten nun in zahlreichen Knochenfunden aus ganz Europa nach diesem Gen. Dabei fanden sie heraus, dass die Genmutation erst vor etwa 7000 Jahren in Südosteuropa auftrat – von dort aus breitete sie sich dann nach West- und Nordeuropa aus. Heute besitzt in diesen Regionen die überwiegende Mehrheit der Menschen dieses Gen. „Aus evolutionärer Sicht hat es sich extrem schnell verbreitet, das weist auf einen hohen positiven Selektionsdruck hin.“ Joachim Burger ist sich seiner Sache sicher: „Menschen mit dem Milchtrinker-Gen hatten in dieser Region einen Überlebensvorteil!“
Das Wissen um die Entstehungszeit und die Verbreitung der Mutation belegt nun zwei entscheidende Sachverhalte: Zum einen muss die Milchnutzung schon vor 7000 Jahren in Europa mehr als nur eine marginale Bedeutung gehabt haben. Aber: Vor dem Auftreten des Gens kann Frischmilch gar nicht das Ziel der frühen Viehhalter gewesen sein.
Das führt die Wissenschaftler zu einer logischen Schlussfolgerung: „Nach dem Einzug der ersten Bauern in Mitteleuropa müssen diese über mindestens 2000 Jahre lang vergorene Milchprodukte zu sich genommen haben, das heißt Joghurt, Dickmilch, Sauermilch, Käse“, fasst Joachim Burger zusammen. „Das kann man gar nicht anders erklären, weil sie überhaupt nicht in der Lage waren, Frischmilch zu konsumieren.“
Oder zugespitzt formuliert: Den ersten Milchmelkern ging es vor allem um den Käse. Das Milchtrinken kam erst sehr viel später.“

Der Priester und Entwicklungshelfer Al Imfeld berichtete 2005 in seiner Aufsatzsammlung „Blitz und Liebe – Geschichten aus vier Kontinenten“, dass es einmal zu einem Streit zwischen seinem Vater, einem Schweizer Milchbauern, und einem Massai kam. Letzterer hatte behauptet: Alle Kühe/Rinder dieser Welt würden von den Rindern der Massai abstammen, von dort hätte man sie geklaut – und weitergezüchtet.
Auf „kuhparadies.de“ heißt es über die Herkunft der Rinder:
„Die ältesten Nachweise über die Vorfahren unserer heutigen Hausrinder reichen bis in das 8. Jahrhundert v. Chr. zurück. Der Ursprung der Wildrinder liegt in Asien und Afrika, wo auch heute noch die meisten wildlebenden Tiere existieren. Viele Rinder zu besitzen, bedeutete Reichtum und Wohlstand. Man konnte sich viele Dinge, zum Beispiel ein Stück Land, für ein Rind kaufen…Durch verschiedene Züchtungen gibt es bis heute etwa 500 Rinderrassen weltweit.“
Unter dem Wikipedia-Eintrag „Massai“ findet sich folgende Bemerkung:
„Engai, der Gott der Massai, der auf dem Gipfel des Ol Doinyo Lengai in Tansania thront, hat ihnen, nach dem Glauben der Massai, alle Rinder dieser Erde überlassen, woraus folgt, dass alle anderen Rinderbesitzer Viehdiebe sein müssen. Daraus leiten die Massai auch das Recht ab, anderen Völkern ihre Rinder gewaltsam abnehmen zu können. Dies war oft der Auslöser für kriegerische Auseinandersetzungen mit anderen Völkern. Nachdem das grammatikalische Geschlecht in der Massai-Sprache normalerweise weiblich ist (d.h. männliches Genus wird explizit markiert), muss auch der Hauptgott Engai als weiblich angesehen werden.
Ihre Kultur dreht sich um das Rind. Ein „guter“ Massai hat nicht weniger als 50 Rinder. Das Trinken von Rinderblut, teilweise vermischt mit Milch, gehört zum Leben und den Zeremonien dazu. Dabei wird dem Rind der Kopf festgehalten und mit einem Pfeil die zum Anschwellen gebrachte Halsvene angeritzt – jedoch nicht durchtrennt. Nach dem Auffangen von bis zu zwei Litern wird das Rind verbunden und lebt weiter. Nach Zugabe der Milch wird das Gefäß lange geschüttelt, um einen „Blutkuchen“ zu verhindern. Es wird frisch – aber auch nach einer Reifephase von zwei Tagen – getrunken und ist das Hauptnahrungsmittel der Massai. Es wird saroi genannt.
Um die Hütten, in denen auch Kleintiere schlafen, wird eine Dornenhecke gezogen. Nachts kommen die Rinder, Schafe und Ziegen in diesen Schutzbereich. Die Massai jagen so gut wie gar nicht. Sie ernähren sich hauptsächlich von dem Fleisch ihrer Schafe und Ziegen. Manchmal jagen jedoch Massaikrieger Löwen und Elefanten, um die eigene Stärke zu zeigen.“
Erwähnt sei ferner, dass in der westfriesischen Hauptstadt Lieuwarden ein Kuhdenkmal auf dem Marktplatz steht – mit der Aufschrift „Us Mem“ (Unsere Mutter).
„2012 wurde von einer internationalen Forschergruppe rund um Wissenschaftler der Universität Mainz festgestellt, dass die heutigen Rinder letztendlich von 80 weiblichen Tieren abstammen, die irgendwo im Nahen Osten, im Südosten der Türkei, Syrien, Iran, Irak gelebt haben müssen.“ (Wikipedia)
Die Uni Leipzig behauptet auf ihrer Internetseite:
„Die ältesten Nachweise von domestizierten Rindern stammen aus Turkestan (8 000 Jahre v. u. Z.) und Griechenland (6 500 Jahre v. u. Z.). Für die Domestikationszüchtung unseres Hausrindes, des Bos taurus, aus dem Ur oder Auerochsen wird der Zeitraum des 7. bis 8. Jahrtausend v. u. Z. angenommen.“
Al Imfeld kam 2009 noch einmal auf dieses Thema zurück – „Zu den afrikanischen Ursprüngen von Kuh oder Vieh (Bos spp Linnaeus)“ hieß sein Aufsatz:
Bis vor kurzem hätte keine/r nur zu denken gewagt, dass auch Afrika seine Kuh hat. Die Kuh gehörte einfach zu den heiligsten Tieren ins Gebiet des Fruchtbaren Halbmonds; sie gehörte wie der Weizen kurz nach seinem Verlust des Paradieses an den Ort nach dem Beginn des Menschen. Das sagte die Hl. Schrift; das glaubten abendländische Menschen; und sie waren der Massstab. So war es dem uns bereits in diesem Buch bestens bekannten H. Epstein mit seinem gigantischen Werk 1971 von weit über 1000 Seiten über den Ursprung der Haustiere in Afrika ganz selbstverständlich, dass die Kuh mit Afrika keinen Ursprungsbezug haben konnte. Wie alle bis anhin leitete auch er seine Kühe vom scheinbar inzwischen ausgestorbenen Auerochsen ab.
Seitdem wir jedoch die Bibel als Ausgangspunkt verlassen, seit wir uns vom Crescent Circle als Ursprungsort etwas mehr in die Welt hinaus begeben haben, ja, seit wir uns von der Mittel-Ost zentrierten Diffusionstheorie mehr und mehr abzuwenden oder sie zu modifizieren beginnen und nicht mehr alles über das Zivilisationsbad Ägypten nach Afrika einfliessen muss, hat sich auch die Geschichte der Kuh und des Viehs insgesamt verändert. Plötzlich kann gleichzeitig und unter ähnlichen Umständen an verschiedenen Gegenden der Welt Ähnliches und Gleiches nicht nur gezüchtet, sondern auch domestiziert wurde, kommt die Forschung zögernd zu einer dritten und zwar einer afrikanischen Variante eines Ursprungsorts der Kuh.
In die Irre geführt wurde die Rinderforschung in der wissenschaftlichen Frühzeit durch den Wahn der Messung. Lange wurden die Hirnkapazitäten (cranial capacity) aller Rinder der Welt zu erfassen versucht, um damit – wie angenommen wurde – eine Verwandtschaft und somit Abstammung festzustellen. Ein weiteres Studium bildeten die Hörner, ob kurz oder lang, ob wie Harfen in die Lüfte geschwungen oder eher wie Speere, und man fragte sich, ob sich etwa daraus Kämpfe aus der Evolutionszeit ableiten liessen? Ein drittes wichtiges Merkmal war der Buckel: Buckel oder keinen, das war die herausfordernde Frage.
Die Bauern rund um den Napf und am Rand der Obwaldner- und Brienzeralpen haben drei ganz verschiedene Braunrassen, die eine für die Alp angepasst, die andere an die steile Hügelkultur, die Entlebucher mit einer Kuh mit Klauen eher ans Tal angepasst, dazu kamen die Emmentaler Flecken. Vier Kuhtypen in einem so kleinen Raum; Afrika zeigt uns dasselbe: kleinräumliche Viehkulturen, weil es stets eine neue Anpassung brauchte, um nicht nur überleben, sondern einigermassen lustvoll leben zu können.
Afrikanische Viehbauern waren jedoch mehr an Schmuck und Schönheit, etwa an Hörnern und am Geweih interessiert, besonders wenn es eine betende oder ehrfürchtige Stellung einnahm. Die Haut war bei anderen ganz wichtig: ob hell oder gefärbt, ob gezeichnet und wie Bilder einer jenseitigen Welt. Vor der Milch kam meistens der Kot, denn Kuhmist war das Beste, für ihren kargen und salzigen Boden das Geheimnis. Eine ganz wichtige Rolle spielten Kuh und Ochs als Zugtiere; man stellt dies vor allem in Westafrika fest.
Drei Sichten manifestierten sich also: die gewöhnlichen Bergbauern in Zentraleuropa, die vielen Sichten Afrikas und die der Wissenschaftler. Am Unbeholfensten traten lange die Viehwissenschafter an Ort und Stelle. Die Erforschung der Vergangenheit und des Ursprungs war ihnen versperrt; sie gaben sich zwar aufgeklärt, hielten jedoch noch lange an den falsch verstandenen Aussagen der Schriften fest.
Man hat erst in der Domestikationsforschung langsam die Grenzen gesprengt; der Mönch Mendel und Charles Darwin erst wiesen neue Wege. Schritt für Schritt, jedoch sehr mühsam, ist das Feld weiter und somit auch älter geworden. Man ist nicht mehr an das alte Datum von 8000 BC gebunden. Man begann die alten Felszeichnungen der Sahara neu zu analysieren und stellte fest, dass sie vor 12’000 BP entstanden sein müssen, also zu einer Zeit, als die Sahara noch fruchtbar und feucht war. Durch die ganze Wüste hindurch fielen an Felsen und in Höhlen die vielen Kuh- und Kalbmotive auf. Diese Menschen mussten doch ein Vorbild gehabt haben, folglich gab es die Kuh schon früher, als andernorts der Ursprung angenommen wurde.
Nach und nach in den letzten 30 Jahren wurde die Geschichte des Viehs viel komplexer und auch spannender. Man hat dabei auch realisiert, dass Menschen in ihrem Kontext weltweit ähnliche Gedanken, Absichten und Ziele hatten, und dass nicht einzelne Dinge plötzlich von oben offenbart wurden und sich dann über die Erde verbreiteten. Aus einem Interventionismus von oben und Kreationismus ex nihilo waren wir mit menschlicher Geschichte auch im Tier- und Pflanzenreich konfrontiert. Die menschliche, aber auch die Geschichte von Fauna und Flora mit allem Drum und Dran wurden spannend, mehrdimensional, somit aber auch etwas konfuser. Die Eindimensionalität war begraben.
In den letzten Jahren nun kam die Hilfe der Gen-Analyse dazu. Die Forschung hatte schon lange damit gearbeitet, doch sie drang immer tiefer in die Chromosomen. Ganze Teams forschten zusammen. Hervor gingen die bekannteste Arbeiten von D.G. Bradley zusammen mit D.E. MacHugh, P. Cunningham und R.T. Lotus. 1996 veröffentlichten sie „Mitochondrial Diversity and the Origin of African and European Cattle. Seither tauchen ihre Namen in Forschungsberichten laufend auf. Ihr Schluss lautet 2008 klar: Es gibt einen dritten und zwar afrikanischen Ursprung des Rinds.
Gleichzeitig arbeitete D. G. Bradley (und die anderen bereits erwähnten MacHugh, Cunningham, Loftus) mit der Mitrochondrial Verschiedenheit und stellte neue Bezüge zwischen Europa und Afrika und umgekehrt, also ganz klar sogar einen Einfluss aus Nordafrika heraus auf Europa fest.
Die Mitochondrial-Forschung hat den Weg des Genlesens bereitet. Die mitochondriale DNA oder kurz mtDNA ist laut biologischem Lexikon „ein zirkuläres, doppelsträngiges DNA-Molekül im Inneren (Matrix) der Mitochondrien“ und wurde erst 1963 entdeckt. Man kann also schrittweise auf den Ausgangspunkt rückschliessen, weil (theoretisch) angenommen wird, dass Mitochondrien und Chloroplasten ursprünglich eigenständige Organismen waren und daher zu Vorläuferzellen wurden. Die Muster der mitochondrialen Verschiedenheit lassen beim Rind auf keinen Fall auf nur einen einzigen Ursprungsort innerhalb der letzten 10’000 Jahre schliessen. Afrika hat seriös einbezogen zu werden. Vorderhand könnte man gar den Schluss wagen, dass Afrika früher als Europa am Rind dran war. Eine Domestikation in der früheren Sahara schliessen Bradley et al. (1996) heute nicht mehr aus.
Ist das Gen allein schon spannend, wird es noch viel mehr, sobald man Zusammenhänge oder Abhängigkeiten feststellen will. So wird komplizierte Genforschung letztlich auch ein Teil der Erforschung der Geschichte von Menschen, Tieren und Pflanzen. Die europäische Forschung müsste stärker auf der nacheiszeitlichen Lage aufbauen, diese Eiszeiten ernst nehmen. Die Eiszeiten sind der neue Kontext einerseits, aber auch der Blick darüber hinaus nach neuen Ideen kommt hinzu. Dabei ist die Saharagegend nicht ausgeschlossen. Zeichen der Fels- und Höhlenmalerei gilt es, nicht kontinental auseinanderzureissen.
Über die Erstellung der gesamten Genom-Struktur wurde Ende April 2009 in Science 324, 522-531 berichtet. Somit gilt das Erbgut der Kuh als entschlüsselt. Die Wissenschaftler klassifizierten rund 22’000 Gene, 80% davon mit Menschen teilend; 1000 Gene, die sie nur mit Hunden und Nagetiere gemeinsam haben. Die Genome zeigen, dass die Rinder den Menschen genetisch ähnlicher sind als Nagetiere – und dies hat einige überrascht, weil das Nagetier zeitlich dem Menschen näher steht.
Wir wurden auch wieder einmal an die Grenze geologischer Festlegungen geführt, etwa jener, dass selbst das Pleistozän weltweit nicht überall dasselbe Gesicht zeigte. Im Unteren Pleistozän (auch Calabrium genannt; datiert von 1,8 Mill. Jahre bis etwa 7’800 Jahre BP) gab es im Norden Eiszeiten, derweil im südlichen Teil der Halbkugel Feuchtigkeit vorherrschte und die Sahara fruchtbar war. Nach 12’000 BP hielt in der Sahara langsam die Trockenheit Einkehr. Wir sehen, auch Geologen haben in Zukunft flexibler zu sein und mehr als bloss „objektives“ Gestein, sondern auch Landschaftsbilder, einzubeziehen.
Zurück zu den früher angenommenen zwei Grundrassen, den Bubalus und den Synverus, dem asiatischen und dem afrikanischen Büffel. Die haben wohl mitgespielt, denn die Menschen haben alles nur Mögliche ausprobiert; sie haben nie einseitig oder eingleisig gezüchtet; man probierte aus, liess fallen, nahm andere Arten mit auf, bezog ein, also ein Hin und Her. So ist es auch einsichtig, dass es weltweit derart viele Rinderrassen gibt und das Hausrind überall verbreitet ist. Die Zebu-Rassen sind den Tropen besser als jede andere Art angepasst. Wahrscheinlich – auf diesem Hintergrund – bleibt der Auerochs (Bos Primigenius) eher eine mythische Figur.
Damit stossen wir auf einen symbolischen und sakralen Aspekt der Kuh. Sie wird zum Urbild der Mutter. Sie wird in Indien zum Hl. Tier. In der alten Sahara wird sie zum Urbild des Lebenden, denn soviel wie sie vermag niemand, weil sie vier Mägen, den Pansen, den Netzmagen, den Blättermagen und den Labmagen besitzt. Eine Kuh setzt wahrlich ihr Futter um und gibt erst noch am Ende den kostbaren Kuhfladen her.
Studiert man die Rindergeschichte fällt auf, welche Lust und Freude Viehzüchter – männlich wie weiblich – am Kreuzen, Isolieren, besonderer Pflege, Futterproben usw. gehabt haben müssen. Von einem anderen Gesichtspunkt aus versteht man die grosse Liebe des Pastoralisten zu seinem Vieh.
Ein afrikanischer Mitursprung einer eigenen Kuh-Domestikation gilt 2009 als sicher. Man wird die Masai-Kühe in Kenya/Tanzania und die Borana Kühe in Äthiopien/Nordkenya, die Fulani- oder Peul-Hirtenzüchter neu und anders als nebensächlich in die Landwirtschaftsgeschichte einbeziehen müssen.
Eins muss man H. Epstein – sehen wir einmal von afrikanischer Haustiergeschichte ab – zuerkennen: er listet alle möglichen Kühe und Rinder des ganzen Kontinents auf und beschreibt sie konzis. Er teilt die Kühe ein in Langhorn mit Buckel und Kurzhorn ohne Buckel. Man ist erstaunt über diese Vielfalt afrikanischer Kühe, sodass man aus einiger Distanz heute beinahe spontan sagt: solche Diversität konnte nicht aus einer Quelle allein kommen. Bei Epstein ist ein zentraler oder primärer Ausgangspunkt hamitisch und Ägypten; sekundär kommen dann in Westafrika die Portugiesen hinzu, etwa bei der buckellosen, Langhorn-Kuh N’Dama in Guinea, Gambia, Sierra Leone und Liberia. Sollen denn wirklich die tschadische Kuri mit den Riesenhörnern, die den See braucht, weil sie der Trockenheit kaum widersteht, die Namji Langhorn in Nordkamerun, die bis vor kurzem nur sakralem Zweck diente, oder die Bambara-Kreuzung in Mali, leicht gefärbt, und ausserordentlich dem Boden und Klima angepasst, von Ägypten ausgegangen sein? Steht dahinter nicht eine Missionsidee auf Kuh-Ebene?
Die afrikanischen Rinder werden hoch aktuell mit ihrem besonderen Erbgut, ihrer gezüchteten, stets ausserordentlichen Anpassungsfähigkeit an Klima, tägliche Hitze oder eine nächtliche Kühle, an Trockenheit und gemischtes Futter. Eine afrikanische Kuh ersteht sehr lebendig. Die Kuh hat zusammen mit dem Menschen seit Jahrtausenden in diesen Gegenden gelebt und beide haben sich dem Gegenüber immer wieder angepasst. Die Geschichte der afrikanischen Kuh ist eine stolze und geht weiter“
Zum Stichwort „Lab“ schreibt Wikipedia:
„Lab (auch Laab, Kälberlab, Käsemagen) ist ein Gemisch aus den Enzymen Chymosin und Pepsin, welches aus dem Labmagen junger Wiederkäuer im milchtrinkenden Alter gewonnen und zum Ausfällen des Milcheiweißes bei der Herstellung von Käse benötigt wird.
Vor allem Chymosin dient natürlicherweise dazu, die Muttermilch durch Eindicken verdaubar zu machen. Jedes Säugetier produziert in seinem Magen eine spezielle Form von Chymosin, um das Milcheiweiß – Kasein – im Magen auszufällen und damit verdaubar zu machen. Beim Menschen heißt dieses Enzym Chymotrypsin.
Jeder Käse, der mittels Süßmilchgerinnung (daher die Bezeichnung Süßmilchkäse) erzeugt wird, benötigt Lab oder Labaustauschstoff als Zusatzstoff zur Koagulation der Milch. Nahezu alle bekannten Hart- und Schnittkäsearten kommen aus der Süßmilchgerinnung. Auch Frischkäse, der zwar typischerweise durch Sauermilchgerinnung unter Zuhilfenahme von Milchsäurebakterien aus Quark oder Joghurt hergestellt wird, kann Lab enthalten.
Die Eigenschaft vom Lab, das Milcheiweiß Kasein so zu spalten, dass die Milch eindickt, ohne sauer zu werden, wurde schon im Altertum erkannt und für Käseproduktion nutzbar gemacht. Z.B. rühmt Aristoteles das Lab von jungen Hirschen oder Rehen als besonders wirksam.“
Das Lab gewinnt man aus den Mägen geschlachteter Jungtiere oder aus mikrobiellen bzw. pflanzlichen Quellen. Das Forum „vebu.de“ ergänzt:
„Lab muss nicht deklariert werden, da es international nicht als Lebensmittelzusatzstoff eingestuft wird. Es ist ein sogenannter Produktionshilfsstoff. Daher kann man die Käsepackungen oft drehen und wenden wie man möchte, es befinden sich keine Informationen zum möglicherweise enthaltenen Lab auf ihnen. Darf man nun als Vegetarier_in gar keinen Käse mehr essen? Oh doch. Zum Glück gibt es genug Alternativen…
Glücklicherweise können nur 35 Prozent der weltweiten Käseproduktion mit Naturlab, also Lab aus Kälbermägen, hergestellt werden. Für die verbleibenden 65 Prozent müssen Alternativen eingesetzt werden – ein Vorteil für vegetarisch lebende Menschen. Es gibt sowohl pflanzliche als auch mikrobielle Labaustauschstoffe. Da die pflanzlichen Alternativen den Geschmack des Käses verändern, wird des öfteren mikrobieller Ersatz benutzt. Zu den mikrobiellen Alternativen gehören Schimmelpilze, die zur Gerinnung der Milch bei der Käseherstellung eingesetzt werden.“ Für vegetarisch lebende Menschen gibt es also zahlreiche Möglichkeiten, Käse weiterhin zu genießen. Unsere detaillierte Liste zeigt, welcher Hersteller in welchem Käse welche Labsorte verwendet.“
Zuvor muß jedoch erst einmal die Kuh das Kalb gebären. Und dazu muß sie ordentlich ernährt werden, wobei heutzutage und hierzulande als Winterfutter meist Silage verfüttert wird:
„Silage, Gärfutter oder Silo ist ein durch Milchsäuregärung konserviertes hochwertiges Futtermittel für Nutztiere, vor allem für Wiederkäuer (insbesondere das Hausrind), da diese durch die Fermentation der Nahrung im Pansen auch in der Lage sind, Strukturkohlenhydrate zu verdauen. Es werden aber auch nachwachsende Rohstoffe, die als Energiequelle in Biogasanlagen dienen, durch Silierung haltbar gemacht. Siliert werden können grundsätzlich alle Grünfuttermittel, unter anderem Gras (Grassilage), Mais (Maissilage), Klee, Luzerne, Ackerbohnen oder Getreide (als Ganzpflanzensilage). Ferner können auch vermahlenes und mit Wasser zu einem Brei vermischtes Getreidekorn, Rübenblätter oder Nebenprodukte wie Biertreber siliert werden.
Das zu silierende Pflanzenmaterial wird im Allgemeinen vor Einbringung in das zur Silierung (und anschließenden Lagerung) dienende Silo mittels Feldhäcksler oder Ladewagen zerkleinert, da zerfasertes oder zerrissenes Erntegut vor allem durch bessere Verfügbarkeit der Kohlenhydrate infolge teilweiser zerstörter Zellwände und der leichteren Verdichtung, damit geringerem Sauerstoffgehalt, besser vergärt. Nach der Einbringung des Erntegutes in das Silo wird dieses verdichtet und luftdicht abgeschlossen. Hierdurch werden pflanzeneigene Enzyme sowie aerobe und fakultativ anaerobe Mikroorganismen (Bakterien, Hefen, Schimmelpilze) unterdrückt. Die Milchsäurebakterien wandeln den Zucker in Säuren (vor allem Milchsäure) um und der pH-Wert fällt auf typischerweise 4,0-4,5 ab. Dadurch werden weitere gärschädliche Bakterien am Wachstum gehindert: Coli-Aeorogenes-Gruppe, Listerien und Clostridien.“ (Wikipedia)
Zur Produktion von Silage braucht es also Milchsäurebakterien. Beim Fressen landet dieses Futter erst einmal im Pansen der Kuh…
Robert E. Hungate zitiert in seinem 1966 veröffentlichten Buch „ The rumen and its microbes“ (Der Pansen und seine Mikroben) den Zoologen und Kuhforscher Robert W. Hegner, der die Widerkäuer an die Spitze der evolutionären Entwicklung der Säugetiere setzte, weil ihr Verdauungssystem weiter als das menschliche Gehirn spezialisiert sei.
„Der Pansen (lat. pantex, über frz. panse „Wanst“; anatomisch Rumen) ist ein Hohlorgan bei Wiederkäuern (Ruminantia) und der größte der drei Vormägen. Er ist eine große Gärkammer, welche dem eigentlichen Drüsenmagen (bei Wiederkäuern als Labmagen bezeichnet) vorgeschaltet ist. Im Pansen erfolgt der Aufschluss der Zellulose durch Mikroorganismen („Pansenflora“) und die Resorption der dabei entstehenden Verbindungen.
Die Gesamtheit der Mikroorganismen im Pansen wird als Pansenflora und -fauna bezeichnet. Es handelt sich um vorwiegend anaerobe (nur unter Sauerstoffabschluss lebensfähige) Bakterien, Einzeller (sogenannte „Infusorien“) und Pilze. Sie machen etwa 20 % des Volumens des Panseninhalts aus.
Die Bakterien spalten Kohlenhydrate (Zellulose, Hemizellulose, Pektine, Xylane, Zucker) und Proteine. Im Pansen sind etwa 1010 bis 1011 Bakterien/ml vorhanden, die vorwiegend an den Oberflächen der Nahrungspartikel und des Pansenepithels anhaften. Sie gehören zu etwa 200 verschiedenen Arten, unter anderem Ruminococcus ssp., Lactobacillus ssp., Clostridium ssp. und Bacteroides ssp. Neben den Abbauprozessen sind die Bakterien auch an der Aufrechterhaltung des Pansenmilieus beteiligt. Die am Epithel haftenden sauerstoffverzehrenden Bakterien halten das anaerobe Milieu aufrecht und das negative Redoxpotential von 250 bis 300 mV sorgt dafür, dass der Abbau der Kohlenhydrate nur bis zu den kurzkettigen Fettsäuren und nicht vollständig zu Kohlendioxid und Wasser erfolgt. Die im Pansensaft befindlichen Archaeen bilden aus Kohlendioxid und Wasserstoff Methan und senken somit den Wasserstoff-Partialdruck im Pansen, was eine übermäßige Bildung von Ethanol und Milchsäure verhindert. Methan ist für den Wiederkäuer nicht verwertbar und muss zusammen mit dem Kohlendioxid als „Abgas“ über den Ruktus abgegeben werden. Die Abgabe dieses Kohlenwasserstoffs senkt jedoch die Effizienz der Energieverwertung.
Die Protozoen bilden etwa die Hälfte der Biomasse der Pansenflora und setzen sich vor allem aus Wimpertierchen (105 bis 108/ml, vor allem Vertreter der Isotrichidae und Ophryoscolecidae) und in geringerem Maß aus Geißeltierchen (103 bis 104/ml) zusammen. Protozoen sind in geringerem Umfang am Kohlenhydrat- und Eiweißabbau (ca. 10 %) beteiligt. Sie können leicht abbaubare Kohlenhydrate aufnehmen und verhindern so deren überstürzten Abbau und damit eine Pansenazidose infolge zu hoher Mengen an organischen Säuren. Außerdem können die Protozoen schädliche Futterbestandteile (toxische Pflanzeninhaltsstoffe und Schwermetalle) abbauen oder binden. Darüber hinaus nehmen die Protozoen Bakterien auf und regulieren damit deren Population. Die Protozoen scheinen jedoch für die Vormagentätigkeit nicht unbedingt notwendig zu sein, vielfache Studien belegen gar, dass sie für eine ineffiziente Stickstoffnutzung verantwortlich sind. Die Effizienz der Stickstoffnutzung kann durch ein Entfernen der Protozoen aus dem Pansen, der sogenannten Defaunierung, gesteigert werden. Zudem kann so die Methanproduktion verringert werden, da Protozoen von Methanbildnern als Wirt genutzt werden. Über die Bedeutung der im Pansen vorkommenden Pilze liegen bislang noch keine gesicherten Erkenntnisse vor. Sie verwerten in geringem Ausmaß lösliche Kohlenhydrate und Proteine und sind auch zur Bildung langkettiger Fettsäuren befähigt. Ihr Vorkommen gilt ebenfalls als nicht zwingend erforderlich.“ (Wikipedia)
Halten wir fest: Der Lactobacillus (ssp.) ist auch hier im Pansen der Kuh am Stoffwechselprozeß aktiv beteiligt. So gesehen stellt die Silage (im Silo) bereits eine Verdauung der Kuhnahrung im Vorfeld dar. Und da diese Bakterien – wenigstens in mutierter Form – auch bei unserer Verdauung der Kuhmilch bzw. bei der Herstellung von Käseprodukten aus dieser Milch beteiligt ist, kann man hierbei von einer ganzen Lactobacilluskette zur Nahrungsaufbereitung für uns sprechen, die bei der Silage beginnt.
Der Schweizer „Weltwoche“-Korrespondent Christoph Neidhardt legt in seinem Buch „Ostsee“ die Vorstellung nahe, daß es sich dabei um ein Meer der Gesänge handelt: Ringsum wird gesungen wie verrückt. Neben der Gesangskunst, die am Mare Balticum gedeiht, arbeitet der Autor aber auch noch heraus, daß die Ostsee a) „ein Milchsäuremeer“ und b „eine See der starken Überzeugungen“ ist – gemeint sind vor allem Sozialdemokratismus und Bolschewismus, ferner, daß man dort überall gerne Kaffee trinkt. Und dann steigt auch noch das Land ringsum langsam aus dem Meer empor. Genau umgekehrt ist all dies an der Nordsee. Angefangen mit der Beobachtung des römischen Geschichtsschreibers Tacitus, dass die Bewohner des „Mare Frisicum“nicht singen: „Frisia non cantat“ Aber Kühe züchten auch sie – ebenso füttern sie mit Silage und essen bzw. verkaufen Milchprodukte.
Wenn man die Kolibakterien schon fast als Teil unseres Dickdarms bezeichnet, dann gilt dies noch mehr für Kühe: ihre Verdauungsorgane, speziell der Pansen, sind derart voll mit celluloseabbauenden Bakterien, dass man laut der US-Mikrobiologin Lynn Margulis sagen kann: „Sie sind die Kuh.“ Und sie produzieren in ihr die Milch.

An dieser Stelle tritt ein anderer Aspekt in den Vordergrund – die Milchqualität: In dem von Martin Voss und Birgit Peuker herausgegebenen Reader „Verschwindet die Natur. Die Akteur-Netzwerk-Theorie in der umweltsoziologischen Diskussion“ findet sich u.a. ein Beitrag von Cordula Kropp: „Enacting Milk. Die Akteur-Netz-Werke von ‚Bio-Milch'“.
Eingangs heißt es darin: „Milch, und erst recht Bio-Milch, erscheint zunächst als ein einfaches Produkt – quasi das ‚Naturprodukt‘ par excellence: dem Kuheuter entnommen, abgefüllt und verkauft. Und doch erweist schon der zweite Blick ‚Trink-Milch‘ als ein überaus veränderliches Ergebnis von zu Grunde liegenden Produktions-, Verarbeitungs- und Vermarktungsleistungen, die ihrerseits Teil sehr komplexer und vielfältiger Beziehungen von heterogenen Komponenten sind:
Im Rahmen dieser Beziehungen interagieren Kühe, Euter, Ställe, Futtermittel, Bauern, Quoten, Mikroben, Milcheigenschaften, Qualitäts- und Hygienestandards, aber auch Regionen, Erfassungsstrukturen, Molkerei(technik)en, Verpackungen, Verkaufswege, Märkte aus Handelskonzernen neben kleinen Naturkostfachhändlern, Kühltheken, Einkaufstaschen, Vorratskammern und VerbraucherInnen und verändern sich mehr oder weniger erfolgreich wechselseitig zugunsten strukturbildender Festschreibungen.“
Gerade bei der Milch sind die bestehenden Verflechtungen in den letzten Jahren „als politischer Gegenstand konfliktreicher Festschreibungen geworden“. Das begann Ende 2000 mit dem ersten deutschen BSE-Fall, da verkündete die damalige grüne Landwirtschaftsministerin Renate Künast:
„Der BSE-Skandal markiert das Ende der Landwirtschaftspolitik alten Typs. Wir stehen vor einem Scherbenhaufen.“ Die daraus resultierende politische Forderung an die Landwirtschaft hieß: fürderhin „Mehr Klasse als Masse“ zu produzieren. Und für die an der Latourschen Akteur-Netzwerk-Theorie (ANT) orientierten Autorin des Aufsatzes über die Bio-Milch bedeutete das: „Milch wäre in der Konsequenz Gegenstand und Resultat der konkreten Netze, innerhalb deren sie zirkuliert, nicht eine biologisch bestimmbare Essenz.“ Innerhalb dieses Netzes geht es dabei um „Übersetzungen“ – und diese müssen empirisch verfolgbar sein, sie treten als physische Veränderungen in den Blick.
„Senkt im uns interessierenden Zusammenhang beispielsweise ein Anbieter den Preis für Bio-Milch, verändert er in aller Regel erfolgreich den Absatz: Die Milchtüten verschwinden schneller, in größerer Anzahl und/oder auf anderen Wegen. Der Anbieter hat die bestehende Assoziation aus Milchtüten, Preisen, Lagerhaltung, Konkurrenz und Kundinnen verändert; er kontrolliert einen gewissen Raum, hat seine (Vermarktungs-)Interessen in neuer Weise übersetzt und damit nolens volens im Laufe der Zeit auch sich selbst modifiziert: Vielleicht hat er nun das Gesicht eines Discounters. Vielleicht hat er seinem Handlungsprogramm ‚Milchabsatz‘ neue Aktanten (Konsumentinnen) hinzugefügt und die Assoziation von Angebot und Nachfrage verstärkt.
Vielleicht hat er aber auch nur die bisherigen Konsumenten durch preissensiblere substituiert und muss in der Folge auch weitere Produkte seines Sortiments unter stärkerem Preisdruck anbieten. Vielleicht benötigt er heute größere Kühltheken und morgen andere Lieferanten, die einen geringeren Erzeugerpreis akzeptieren. Welche Folgetransformationen die erste Übersetzung nach sich zieht, ist zunächst eine empirische Frage: Gemäß ANT wird nicht die Theorie darüber entscheiden, sondern die Bewegungen im Problemfeld und ihre Spuren in Datenform.
So wäre es denkbar, dass die empirische Studie herausstellte, dass weniger der Handel erfolgreicher, preissenkender Aktant war, sondern dass er nur als Vermittler (intermediary) der Preissenkung auf der darunter liegenden Wertschöpfungsstufe der Molkereien in Erscheinung trat: Im Bericht wäre an dieser Stelle dann nicht über das Angebot des Marktes zu sprechen, sondern über die Vermarktungsstrategien der Molkereien. Aber das ist nicht der Fall. Empirisch zeigt sich vielmehr eine starke Abhängigkeit der Hersteller vom Handel, die letztlich zur Handelsmarkenproduktion, zur Austauschbarkeit der Lieferanten und einem intensiven Preiswettbewerb führt.“
Es folgt ein kurzer Abriß der Entstehung von Trinkmilch, in dem die Autorin darauf hinweist, dass die Laktose-Intoleranz von Nord nach Süd steigt, in Äquator-Nähe vertragen nur 2% der Bevölkerung Milch. „Die Rede von Milch als ‚Grundnahrungsmittel‘ und ‚Fitmacher‘ ist also sozial, biologisch und symbolisch ethnozentrisch, unterschlägt den Multinaturalismus der Kuh-Mensch-Beziehungen.“ Der knappe Tour-d’horizon läßt bereits ahnen, „dass Milchviehaltung keineswegs eine kulturelle Universale ist, sondern mit weitreichenden Entscheidungen für Ökologie, Ökonomie und Gesellschaft verbunden ist. Von den ca. 1,3 Milliarden Rindern weltweit leben 15 Millionen in Deutschland, sie liefern jährlich fast 29 Millionen Tonnen Milch und machen uns zum größten Milchproduzenten in der Europäischen Union.“
Die Molkereien kommen nicht erst ins Spiel, wenn die Milch im Rahmen klar definierter Erfassungskontingente, -wege und -zeiten die landwirtschaftlichen Betriebe verlassen hat. „Unter ihre dominanten Perspektive von der ‚Verderbniskontrolle‘ definieren sie die Milchqualität bereits in den Ställen mit strengen hygienischen Vorgaben zu allen Abläufen und bspw der Präferenz solcher Futtermittel, die nur wenige und nur dünnwandige Bakterien in die Milch tragen.“ Sie kontrollieren die Produktionsbedingungen nach ihren Ansprüchen. „Während die meisten Verbraucher die Wissenschaft in der Lebensmittelproduktion fürchten und naturbelassenen Lebensmitteln zumindest rhetorisch den Vorzug geben, fürchten die Lebensmittelwissenschaftler die Natur. Für die Landwirtschaft bedeutet das, dass sie immer sterilere Milch abzuliefern haben. Die zulässigen Keimzahlen wurden mehrmals herabgesetzt. Aber bei der Ermittlung der Keimzahl wird nicht unterschieden zwischen gefährlichen und nützlichen Keimen, entscheidend ist nur die Zahl. So wurde Sterilität zum Wert an sich. Das Natürliche wird zur Gefahrenquelle, das künstlich Sterile zur Norm. Deshalb wird Vollmilch heute nicht mehr Dickmilch, wenn sie ungekühlt stehen bleibt, sondern faul. Mit Milchqualität hat das wenig zu tun.“
Über den Endverbraucher heißt es im Aufsatz: „Die VerbraucherInnen erwiesen sich in der Untersuchung als perfekt kontrollierter Intermediär: Ihre eigenen Handlungsmotive und -ansprüche (etwas nach weidenden Kühen, ‚frischer‘ Milch ‚von hier‘ und dem individuellen Bedarf anpassbaren Mengen) bleiben im Milchmarkt weitgehend folgenlos.“ Das gilt auch für Bio-Milch, denn der „Öko-Bereich beugte sich sukzessive den neuen Bedingungen auf dem Markt“ – z.B. indem er sich 2001 für „ultrahocherhitzte Bio-Milch“ öffnete, „auch wenn sie seinen Überzeugungen von ‚gesunder‘ und ’natürlicher‘ Milch widersprach. ‚Involvement‘ hat ihren Preis.“ Dann kam noch die bis zu drei Wochen haltbare ESL-Milch dazu. Sie ist teurer als pasteurisierte Frischmilch.
Inzwischen ist jedoch nicht mehr klar, „wie lange die ’neue‘ Milch noch als Frischmilch verkauft werden darf, noch ob aus verbraucherpolitischer Perspektive über die Unterschiede hinreichend informiert wird.“
Die Autorin meint: „Die erste deutsche BSE-Kuh kann als Glücksfall der Akteur-Netzwerk-Theorie betrachtet werden,“ weil sie ein so „mächtiger Aktant“ war, dass sie nahezu alle ausgedehnten Verflechtungen sichtbar machte – bis hin zum Verbraucher. Der BSE-Kuh gelang darüberhinaus, woran die Agraropposition Jahrzehnte scheiterte: nämlich die – zumindest symbolische – Neuorientierung der Agrarpolitik weg vom durchgesetzten Protektionismus und dem Rent-Seeking von Agrarlobbies für Agrarlobbies. ‚Das Argument: Mehr Verbraucherschutz! ist das Ergebnis eines Lebensmittelskandals (BSE),‘ schreibt dazu der Bauer und Agrarwissenschaftler Onno Poppinga.“
Über die Formel „Mehr Klasse statt Masse“ und was sie für den Verbraucher bedeutet, meint der selbe, „es erwies sich schnell, das die Verbraucher die ihnen [dabei] zugedachte Aufgabe nicht erfüllten bzw. nicht erfüllen konnten.“ Poppinga kritisiert, dass versäumt wurde, „unmittelbare Qualitätsunterschiede bei Lebensmitteln – Frischmilch statt pasteurisierte, Milch auf der Grundlage von Weidegang statt aus Futterkonserven (um nur zwei Beispiele zu nennen) als Ansatzpunkte für eine Transformation von ‚Masse zu Klasse‘ zu nutzen.“
Aber kann wenigstens die Kuh die ihr dabei zugedachte Aufgabe erfüllen? Die FAZ interviewte dazu den Leiter des Schweizer “Zentrums für tiergerechte Haltung Tänikon”: Herr Gygax, sind die Tiere, die in der Forschungsanstalt Tänikon leben, glücklich?
„Um Tierwohl zu beurteilen, würden wir dem Tier am liebsten einen Fragebogen geben. Den könnte es ausfüllen und uns verraten, in welcher Umgebung es ihm am besten gefällt.
Das geht jedoch leider nicht. Um etwas über tierische Emotionen in Erfahrung zu bringen, brauchen wir einfache und direkt einleuchtende Indikatoren. Diese zielen darauf ab, Schmerz, Leid und Krankheit zu vermeiden. Dann gibt es sogenannte Verhaltensindikatoren. Das bedeutet, dass zum Beispiel die Liegebox von Kühen so konzipiert sein muss, dass die Kuh in gleicher Art und Weise aufstehen kann, wie sie es auch auf der Weide tun würde. Ich finde es sehr gut, dass man seit geraumer Zeit vermehrt darüber spricht, dass es nicht nur wichtig ist, negative Zustände zu vermeiden, sondern den Tieren auch positive Erfahrungen zu geben. Die Forschung steckt hier aber noch in den Kinderschuhen.“
Die Nachrichtenagentur dpa verbreitete unter Bezug auf das Online-Journal „Anthrozoos“ eine bemerkenswerte Meldung: „Kühe geben im Jahresdurchchnitt 258 Liter mehr Milch – wenn man ihnen einen Namen gibt.“ Untersucht wurden hierfür von der Studienleiterin Catherine Douglas 516 britische Milchbauern und zwar im Hinblick auf deren Einstellung zum Verhalten und Wohlergehen der Kühe. 46 Prozent der Befragten gaben ihren Kühen Namen – und genau diese Kühe geben so viel mehr Milch, belegt die Studie. Und siehe da, die Milchbauern haben offenbar mehr drauf als manche Führungkraft. „Genauso wie Menschen stärker auf persönlichen Kontakt reagieren, fühlen sich auch Kühe entspannter und wohler, wenn man ihnen ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenkt“, so Douglas´ Ergebnis. Kühe, die dagegen nur wie eine unter vielen behandelt werden, geben eben jene 258 Liter Milch weniger im Jahr.
Die Kuhverhaltensforschung geht aber noch weiter – abseits vom Indikator Milchleistung:
„Eine Kuh, die zufrieden wiederkaut, mag vielleicht aussehen wie Susi Sorglos, aber hinter diesen großen braunen Augen, die schon der griechischen Göttin Hera den wundervollen Beinamen „die Kuhäugige“ für ihre Schönheit gaben, geht eine Menge vor. Kühe sind genauso verschieden wie Hunde, Katzen und Menschen: Manche sind klug, andere lernen eher langsam. Manche sind kühn und auf Abenteuer aus, andere sind schüchtern und zurückhaltend. Manche sind freundlich und besonnen, andere großspurig und verschlagen. Nach Angaben der Öko-Farmerin Rosamund Young, Autorin des Buches The Secret Lives of Cows (Das geheime Leben der Kühe), können Kühe “hochintelligent, mäßig intelligent oder begriffsstutzig sein; freundlich, besonnen, aggressiv, fügsam, erfindungsreich, langweilig, stolz oder schüchtern.”
Aber Kühe weisen nicht nur eine ausgeprägte Persönlichkeit auf, sondern sind, so die jüngste Forschung, auch sehr intelligente Tiere mit einem Langzeitgedächtnis. Tierverhaltensforscher haben herausgefunden, dass Kühe auf sozial komplexe Weise interagieren, im Laufe der Zeit Freundschaften entwickeln, zuweilen Kühen grollen, die sie schlecht behandelt haben, und innerhalb ihrer Herden soziale Hierarchien bilden. Sie verfügen über eine Vielzahl an Emotionen und die Fähigkeit, sich über die Zukunft Sorgen machen zu können.
Kühe lieben Herausforderungen und empfinden es als aufregend, so die Wissenschaftler, eine Aufgabe gelöst zu haben oder ihren Intellekt zu nutzen, um ein Hindernis zu überwinden. in einem Artikel über die Intelligenz von Kühen schreibt ein Reporter, dass “Donald Broom, Professor für Tierschutz an der Cambridge University, den Konferenzteilnehmern vermittelt, wie aufgeregt Kühe werden können, wenn sie ein Problem gelöst haben, das eine intellektuelle Herausforderung war. In einer Studie stellten die Forscher Kühe vor eine echte Herausforderung: Sie mussten herausfinden, wie man eine Türe öffnet, um an Futter zu gelangen. Es wurde ein Elektroenzephalograph eingesetzt, um die Gehirnströme zu messen. ‘Die Gehirnströme zeigten ihre Freude; ihr Puls ging rauf und einige machten sogar einen Luftsprung. Wir nannten es ihren Eureka Moment’, so Professor Broom.”
Die Forschung belegt, dass Kühe ganz eindeutig den Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung kennen – ein absolut zuverlässiges Zeichen für das Vorhandensein fortgeschrittener kognitiver Fähigkeiten. So können Kühe beispielsweise lernen, wie man einen Hebel betätigt, um einen Trinkbrunnen zu aktivieren, wenn sie durstig sind, oder mit dem Kopf einen Knopf drückt, um an Getreide zu gelangen, wenn sie Hunger haben. Wie Menschen und andere Tiere lernen auch Kühe schnell, Dingen fernzubleiben, die ihnen wehtun, wie z.B. Elektrozäune und bösartige Menschen.
Aufgrund ihrer komplexen sozialen Interaktionen besitzen Kühe auch die Fähigkeit, voneinander zu lernen, ein weiteres Anzeichen für ihre Intelligenz, die vergleichbar ist mit der eines Hundes und etwas höher angesiedelt als bei einer Katze. Nach Angaben der Humane Society of the United States (Amerikanischer Tierschutzbund), lernt der Rest einer Kuhherde daraus, wenn eine einzelne Kuh an einem Elektrozaun einen Schlag bekommt, und wird ihn folglich meiden. Nur ein kleiner Teil der Herde wird daher jemals einen Schlag bekommen.
Viele Kühle sind anhängliche Tiere von tiefgreifender Loyalität gegenüber ihren Familien und menschlichen Gefährten. Kühe können ihre Körperhaltung und ihre Stimmlaute dazu einsetzen, eine ganze Palette an Emotionen auszudrücken, einschließlich, Zufriedenheit, Interesse, Wut und Leid. Diese sanften Riesen trauern, wenn jemand gestorben ist, den sie liebten, und können sogar Tränen über dessen Tod vergießen.
Eine Herde Kühe ist einem Rudel Wölfe sehr ähnlich mit Alpha-Tieren und komplexer Sozialdynamik. Jede Kuh ist imstande, mehr als 100 Herdenmitglieder zu erkennen, und Sozialbeziehungen sind sehr wichtig für sie. Kühe gehen enge Freundschaften mit bestimmten Mitgliedern der Herde ein—besonders die Mutter-Tochter-Beziehung ist eng, und Kälber gehen Bindungen mit anderen ihrer Altersgruppe ein.
Die Sozialbeziehungen zwischen Kühen beeinflussen viele Bereiche ihres täglichen Lebens. Legt sich die Herde z.B. ab für ein Nickerchen, hat jede Stellung einer Kuh und die Anordnung, wie sie liegen, einen direkten Bezug zu ihrem Status in der Herde.
Kühe unter unnatürlichen Bedingungen aufzuziehen, wie z.B. in überfüllten Weiden, ist für sie sehr stressig, da es ihre Hierarchie stört. Der Forscher der University of Saskatchewan, Jon Watts, merkt an, dass Kühe, die in Gruppen von mehr als 200 auf kommerziellen Weiden gehalten werden, ständig unter Stress leiden und Dominanz ausfechten (Weiden in Amerika umfassen jeweils Tausende Kühe). Er sagt, dies trete auf, weil die Kühe ihren Müttern zu früh weggenommen würden, man ihnen ausreichenden Platz vorenthält und sie ihre Nische in einer solchen großen Gruppe nicht finden.
Dies ähnelt wohl sehr dem Gefühl, das Menschen hätten, würden sie auf kleinster Fläche mit Tausenden ihnen fremden Personen zusammengepfercht. Genau wie wir, mögen auch Kühe in der Nähe ihrer Familie und Freunde sein, und der Stress des Lebens in der Intensivhaltung führt dazu, dass sie sich verstört, verängstigt und alleine fühlen.
Trennt man sie von ihren Familien, Freunden oder menschlichen Gefährten, trauern Kühe über diesen Verlust. Wissenschaftler berichten, dass Kühe sichtlich bedrückt werden, selbst nach einer kurzen Trennung. Die Mutter-Kalb-Beziehung ist besonders fest, und es gibt zahlreiche Berichte über Mutterkühe, die fanatisch nach ihren Babies rufen und sie suchen, wenn man ihnen die Kälbchen weggenommen und auf Kalbfleischfarmen verkauft hat.
Der Autor Dr. Oliver Sacks, schrieb von einem Besuch, den er und der Rinderexpertin Dr. Temple Grandin auf einer Milchfarm absolvierten und von dem großen Tumult aus Gebrüll, das sie hörten, als sie ankamen: “‘Sie haben wohl heute morgen die Mütter von den Kälbchen getrennt’, meinte Temple, und tatsächlich, genau das war geschehen. Wir sahen eine Kuh außerhalb des Geheges umherstreifen und nach ihrem Kalb suchen und brüllen. ‘Das ist keine glückliche Kuh’, meinte Temple. ‘Das ist eine traurige, unglückliche, verärgerte Kuh. Sie will ihr Baby. Sie brüllt nach ihm, sucht nach ihm. Sie mag es für eine Weile vergessen, doch dann beginnt sie von neuem. Es ist wie ein Grämen, Trauern – darüber wurde noch nicht viel geschrieben. Die Menschen gestehen ihnen nicht gerne Gedanken oder Gefühle zu.’”
John Avizienius, Wissenschaftler beim britischen Tierschutzbund, sagt, dass er “sich an eine spezielle Kuh erinnert, die mindestens für eine Dauer von sechs Wochen schwer getroffen schien von der Trennung von ihrem Kalb. Als ihr das Kalb weggenommen wurde, war sie zunächst in akuter Gram; sie stand vor dem Gehege, wo sie ihr Kalb zuletzt gesehen hatte und brüllte stundenlang nach ihrem Kind. Sie ging erst weg, als man sie dazu zwang. Selbst noch nach sechs Wochen blickte die Mutter immer wieder auf das Gehege, wo sie ihr Kalb zuletzt sah, und blieb manchmal für einen Augenblick vor dem Gehege stehen. Es war fast so, als hätte man ihren Geist gebrochen, und alles, was sie tun konnte, war, Anzeichen von Gesten zu machen, ob ihr Kalb noch da wäre.”
Dies sind nur einige wenige der endlosen Geschichten über Kühe, die an ihrem Leben hängen und den Tod fürchten, genau wie Menschen und alle anderen Tiere. Alleine in Deutschalnd werden alljährlich ca. 4,2 Millionen Kühe für die Fleisch- und Milchindustrie getötet. Schon in jugendlichem Alter verbrennt man sie mit heißen Eisen (Brandmarken) oder durchsticht ihnen die Ohren, reißt ihnen die Hoden aus dem Hodensack (Kastration) und schneidet oder brennt ihnen die Hörner ab – alles ohne Schmerzmittel. Sind sie herangewachsen und groß genug, transportiert man sie auf riesige, dreckige Weiden, um für die Schlachtung gemästet zu werden.
Die ca. 5,2 Millionen Kühe, die auf Milchfarmen in Deutschland leben verbringen den Großteil ihres Lebens entweder in riesigen Ställen oder auf von Fäkalien verseuchten Dreckplätzen, wo Krankheiten krassieren. Kühe, die ihrer Milch wegen gehalten werden, werden immer wieder geschwängert, ihre Kälber aber nimmt man ihnen weg und entsendet sie auf Kalbfleischfarmen oder andere Milchfarmen. Geben ihre ausgemergelten Körper nicht mehr länger genug Milch her, landen auch sie beim Schlachter und schließlich im Fleischwolf, um Hamburger aus ihnen zu machen.
Zahlreiche Kühe sterben auf dem Weg zum Schlachter, und die Überlebenden erschießt man mit einem Bolzenschuss, hängt sie an den Beinen auf und schleppt sie auf die Tötungsebene, wo man ihnen die Kehle aufschlitzt und sie häutet. Manche Kühe sind noch voll bei Bewusstsein während des gesamten Prozesses.
Machen Sie sich folgendes klar: Die Massentierhaltung der modernen Landwirtschaft strebt danach, eine maximale Menge an Fleisch und Milch so schnell und billig wie möglich zu produzieren, und das bei minimaler Platzanforderung. Kühe und Kälber werden in kleinen Käfigen oder Ställen gehalten, oft so beengt, daß sie sich nicht einmal umdrehen können. Man beraubt sie jeglicher Bewegungsmöglichkeit, damit ihre ganze Körperenergie in das Fleisch geht, das der Mensch später verzehrt.
Rinder werden mit einer unnatürlichen Diät aus großvolumigen Körnern und anderen “Füllstoffen” (einschließlich Sägemehl) ernährt, bis sie ca. 500 kg wiegen. Sie werden ohne Betäubung kastriert und enthornt. Auf den Transportern leiden sie unter Angst, Verletzungen, den extremen Temperaturen, unzureichender Futter- und Wasserzufuhr und mangelnder ärztlicher Versorgung. Die Kälber, die männlichen Nachkommen der Milchkühe, die des Kalbfleisches wegen aufgezogen werden, haben das schlimmste Schicksal: sie werden den Müttern nur wenige Tage nach der Geburt entrissen und dann in kleinen Boxen von knapp 80 cm Breite angekettet. Der Lattenrostboden, auf dem sie stehen müssen, verursacht große Schmerzen in den Beinen und Gelenken. Die Milch der Mutter, die für das Kälbchen gedacht ist, wird ihnen geraubt, damit der Mensch sie trinken kann. Dafür werden die Kälbchen mit einem Milchersatz gefüttert, der mit Hormonen angereichert ist und dem Eisen entzogen wurde, denn Blutarmut macht das Fleisch schön weiß und zart. Allerdings werden die Kälbchen davon sehr schwach. Im Alter von 16 Wochen werden sie dann geschlachtet. Oft sind sie schon zu schwach und verkrüppelt, um noch laufen zu können. In den USA stirbt z. B. jedes zehnte Kalb bereits während der Mastzeit in der Box. Für Deutschland gibt es hier keine offiziellen Statistiken, jedoch düfte es hier sehr ähnlich sein.
Kühe, die ihrer Milch wegen gehalten werden, werden immer wieder geschwängert, ihre Kälber aber nimmt man ihnen weg und entsendet sie auf Kalbfleischfarmen oder andere Milchfarmen. Geben ihre ausgemergelten Körper nicht mehr länger genug Milch her, landen auch sie beim Schlachter und schließlich im Fleischwolf, um Hamburger aus ihnen zu machen.
Melkmaschinen verursachen oft Verletzungen, die beim Melken mit der Hand nicht entstehen würden. Diese Verletzungen leisten Vorschub für die Entstehung von Mastitis, einer bakteriellen Infektion, die speziell in der Milchindustrie bekannt ist. Mehr als 20 verschiedene Bakterien verursachen diese Infektion, die sich leicht von einer Kuh auf die nächste überträgt und die, wenn sie unentdeckt bleibt, zum Tode führen kann. In einigen Fällen bekommen Kühe durch die Milchmaschinen wiederholt Elektroschocks, was erhebliches Unbehagen, Angst und Störungen des Immunsystems verursacht und manchmal zum Tode führt. Ein einziger Bauernhof kann mehrere Hundert Kühe aufgrund unkontrollierter Elektroschocks verlieren. Milchmaschinen werden trotzdem benutzt, da sie Arbeitskräfte sparen und es einem einzigen Arbeiter ermöglichen, 86 Kühe in zwei Stunden zu melken.
Das größte Leid, das Milchkühen widerfährt, ist vielleicht, daß sie immer wieder ihre Jungen verlieren. Weibliche Nachkommen werden möglicherweise zu neuen Milchkühen herangezogen, aber die männlichen werden ihrer Mutter gewöhnlich binnen 24 Stunden nach der Geburt weggenommen, bevor sie noch etwas von der Muttermilch zu trinken bekommen. Sie werden dann auf Auktionen versteigert, entweder für die berüchtigte Kalbfleisch-Industrie oder an Rindfleisch- Produzenten. Wird das Kalb getötet, solange es noch jung ist, wird sein vierter Magen auch für die Herstellung von Käse verwendet, denn er enthält Lab, ein Enzym, das verwendet wird für die Milchgerinnung, damit daraus Käse entsteht. Labmagen, die Membran, dessen Extrakt Labferment ist, kann in diesem Prozeß ebenfalls verwendet werden. Es ist möglich, Käse auch ohne Labmagen herzustellen; diese Käse sind in Gesundkostläden erhältlich. Allerdings bedingt die enge Verbindung zwischen der Milch-, Kalbfleisch- und Lederindustrie, daß es für den Käsehersteller billiger ist, Teile des Kalbes zu verwenden als pflanzliche Enzyme.
Innerhalb von 60 Tagen wird die Kuh wieder geschwängert. “Ist die Kuh vor dem Kalben noch nicht “trocken”, gönnen ihr die Bauern des öfteren ein paar Tage Ruhe. Einige sind der Ansicht, daß eine Ruhepause von einem Monat wertvoll ist, jedoch sehen andere das als eine Zeitverschwendung an.” Während sieben Monate ihrer neuen neunmonatigen Schwangerschaft wird die Kuh weiter gemolken und ihr so die Milch weggenommen, die für ihr vorheriges Kalb gedacht war. Eine typische, industriell ausgebeutete Milchkuh wird in ihrem kurzen Leben drei- oder viermal gebären. Läßt ihre Milchproduktion nach, heißt es “ab ins Schlachthaus”, und es werden aller Wahrscheinlichkeit nach die nächsten Hamburger aus ihr gemacht.
Sie können diesen sanften, intelligenten, sensiblen Tieren helfen, indem Sie Milch und Fleisch aus Ihrer Ernährung streichen. Bitte bedenken Sie auch, dass jedes Mal, wenn Sie eine Lederjacke oder Lederschuhe kaufen, sie damit Tiere zu lebenslänglichem Leiden verurteilen. Der Kauf von Leder trägt direkt zu Intensivhaltung und Schlachthöfen bei, da Tierhäute der wichtigste Teil unter den Nebenprodukten der Multimilliarden EURO Fleischindustrie sind.“ (Quelle: goveggie.de)
Im Gegensatz zur Verhaltensforschung arbeitet die Gentechnik der industriellen Landwirtschaft direkt zu, wie Bild der Wissenschaft berichtet:
1998 wurde auf dem Versuchsgut nahe Oberschleißheim bei München die erste Klonkuh Uschi unter dem Mikroskop gezeugt. Wenige Monate später stakste sie im Stall umher. Uschis Enkel weiden heute einige Dutzend Kilometer entfernt in Hilgertshausen, auf dem Gelände der Firma Agrobiogen. Seither hat Eckhard Wolfs Team dort 30 weitere Klonrinder erschaffen. Noch mehr werden folgen.
Den 63 Kühen, die Wolf „Leihmütter“ nennt, werden eines Tages Klonembryonen eingesetzt werden. Diese Embryonen enthalten das Erbgut von anderen Rindern, die Wolf als „Spendertiere“ bezeichnet und die in einem anderen Stall stehen. Den Spendern wird etwas Haut hinter dem Ohr entnommen. Der Zellkern aus den Hautzellen wird mit einer feinen Nadel unter dem Mikroskop herauspräpariert und in eine entkernte Rinder-Eizelle hineinbugsiert. So entsteht ein Klonembryo, eine genetische Kopie des Spendertiers. Noch erkennt man unter dem Mikroskop allerdings nicht mehr als einen Zellhaufen.
Mit diesem Verfahren, dem somatischen Zellkerntransfer, hauchte der Schotte Ian Wilmut 1996 dem Klonschaf Dolly Leben ein und erzeugte damit das erste geklonte Säugetier. Dolly war allerdings schon in jungen Jahren altersschwach und starb 2003 vorzeitig an einer Lungeninfektion. Es gibt keinen gesunden Klon, lautete Wilmuts ernüchternde Bilanz nach diesem und weiteren Klonversuchen. Später gab er das Klonen auf (siehe bild der wissenschaft 4/2008, „Dolly-Vater Wilmut: Klonen war ein Irrweg“).
Umso erstaunlicher ist es, dass Klonen nun die Tierzüchter interessiert. Die Deutsche Gesellschaft für Züchtungskunde hält das Klonen „mittel- bis langfristig für ein wichtiges Instrument, das die vorhandenen Züchtungstechnologien sinnvoll ergänzen kann“, wie sie in einer Stellungnahme vom 18. März 2008 schreibt. „Mittel- bis langfristig“ klingt nach ferner Zukunft. Tatsächlich wird die Zahl der Klonkühe schon heute weltweit auf 4000 geschätzt, die der Klonschweine auf knapp 1500. In vielen Ländern sitzen Unternehmen, zumeist Tierzuchtbetriebe oder Genetikfirmen, die das Klonen längst im Portfolio haben. Sie heißen Cyagra, Viagen, Trans Ova Genetics, Minitube (alle USA) oder AG Research (Neuseeland). Allein die texanische Firma Viagen verkauft jedes Jahr 150 geklonte Rinder an Tierzüchter.
Die Besamungsstation „Bavarian Fleckvieh Genetics“ in Poing bei München hat den Vorzug der bayerischen Standardkuh erkannt. Im Internet kann man erlesenes Fleckvieh bestaunen. Etwa die drei Turbokühe „Marlene“, „Biene“ und „Flittchen“. Von jedem Exemplar können Landwirte und Tierzüchter künstlich befruchtete Eizellen bestellen. Sie entstehen im Reagenzglas. Die Rinder-Eizellen werden mit Sperma künstlich befruchtet. Wohlgemerkt: Bei diesen zweigeschlechtlichen Embryonen handelt es sich nicht um Klone.
Der weltweite Trend geht jedoch in Richtung kontrollierte Fortpflanzung: Der Export der Embryonen von Bavarian Fleckvieh Genetics boomt, seit das Unternehmen 2006 damit begonnen hat. Mehr als 16 000 Rinderembryonen wurden seither isoliert. Der Nachwuchs aus den bayerischen Keimzellen ist bei mehreren Tausend Farmern in allen Erdteilen untergebracht.
Der Vorteil für Bavarian Fleckvieh Genetics: Mit den Embryonen passieren Hunderte von Rindern die Grenzen. Preiswert, platzsparend, scharenweise. Entsprechend viele ausgewachsene Rinder ließen sich kaum an Bord eines Frachters pferchen. Noch dazu bestünde die Gefahr, dass mit ihnen Tierseuchen verschleppt würden. Solche Sorgen sind durch den Embryonenversand ausgeräumt. Am Ziel angekommen, werden die Embryonen in den Bauch heimischer Kühe eingebracht – ein Verfahren, das als Embryotransfer bezeichnet wird und ebenso wie die künstliche Besamung zu den Techniken der „assistierten Reproduktion“ gehört. Mittlerweile werden in den Industrienationen acht von zehn Rinder mittels assistierter Reproduktion gezeugt.
In Zukunft könnten Tiergenetiker schon am Erbgut erkennen, wie fett oder saftig das Fleisch, wie proteinreich oder mager die Milch oder wie widerstandsfähig ein Rind sein wird. Schon heute kann das Gen DGAT beim Rind darüber Auskunft geben, wie viel Milch die Kuh später produzieren wird. Weitere Gentests für die Tierzucht sollen folgen.
Bis die Visionen der Forscher Wirklichkeit werden, haben Politiker und Bürger aber noch ein Wörtchen mitzureden. Das Europäische Ethikgremium hält Klonen für die Nahrungsmittelversorgung nicht für gerechtfertigt, weil die Tiere dabei leiden: Geklonte Tiere haben häufig ein erhöhtes Geburtsgewicht, einen zu großen Rumpf im Vergleich zu den Gliedmaßen, manchmal Fehlbildungen an Organen sowie Atemprobleme. Häufiger als sonst muss der Klonnachwuchs per Kaiserschnitt geboren werden. Das Europäische Parlament will deshalb das Klonen und den Verkauf von Produkten geklonter Tiere verbieten. „Den Tierschutz kann man im Moment in der Tat anprangern. Über 90 Prozent der Klonembryonen sterben“, räumt Oback ein. Allerdings, so betont er, „scheinen die Nachkommen von Klonen gesund zu sein, wenn sie durch Befruchtung gezeugt wurden.“
Unbestritten ist, dass Klone keine perfekten Kopien sind: Sie unterscheiden sich von den Spendertieren durch die Aktivität ihrer Gene. Weil die Protein-Baupläne im Erbgut unterschiedlich stark abgelesen werden, bilden sich die Proteine in den Zellen in abweichenden Mengen. Das erklärt beispielsweise, weshalb Copycat – die erste geklonte Katze – ihrer genetischen Vorgängerin nicht besonders ähnlich sah. „Dieser epigenetische Unterschied ist statistisch hochsignifikant. Was er besagt, wissen wir aber noch nicht“, urteilt Wolf. Er ergründet dieses Phänomen derzeit in einer europaweiten Studie. Uschis Enkel gehören zu den Studienobjekten. Trotz der offenen Fragen würde Wolf vor dem Steak eines geklonten Rindes nicht zurückschrecken.

Wenn wir von der Kuh reden, dann befinden wir uns noch immer in der Naturgeschichte – und meinen vielleicht ihre Herauszüchtung aus dem respekheischenden Auerochsen bis zur Klonkuh „Uschi“. Aber selbst diese noch lebende und schon halb in die Menschheitsgeschichte integrierte „Chimäre“ hat keine Biographie. Zwar mehren sich die Stimmen, die im Namen der Kuh sprechen – und sie so repräsentieren: Tierschützer, Biobauern, Tierärzte, Verhaltensforscher, vielleicht sogar der eine oder andere Melkanlagenhersteller und Futtermittelgroßhändler, aber es gibt noch immer keine Feldforschung bei Kühen, die diese von ihrer Geburt bis zum Tod im Schlachthof begleitet. Obwohl allein in Deutschland über 5 Millionen Kühe leben und die meisten nicht älter als vier Jahre alt werden, die Mastbullen werden nicht einmal halb so alt.
In einem Interview der „Zeit“ mit dem Begründer der Akteur-Netzwerk-Theorie Bruno Latour meinte dieser: „Die Kühe haben das Wort!“:
ZEIT: Jeder scheint heute zu wissen, was Gene sind. Was ist ein Gen für den Wissenschaftsforscher Latour?
LATOUR: Wir haben es wie bei der Auslegung des Evangeliums mit Lesarten zu tun, die sich nicht vereinheitlichen und vereindeutigen lassen. Das Gen ist vielerlei. In Frankreich gibt es zum Beispiel seit Jahren eine Patientenorganisation, die zur Erforschung der genetisch bedingten Krankheit ihrer Mitglieder, der Muskeldystrophie, Millionen an Forschungsgeldern gesammelt hat. Da geht es um ein isolierbares Gen und eine präzise Hoffnung auf Heilung; auf Befreiung. In diesem Zusammenhang treten Gene in der Öffentlichkeit anders auf als in der Lesart des Oxforder Zoologen Richard Dawkins, der gegen den klassischen Humanismus argumentiert und meint, es seien die „egoistischen Gene“, die das menschliche Verhalten bestimmten. Der Populationsgenetiker Richard Lewontin in Harvard hingegen hält die Informationen der Gene für zu unbestimmt, um aus ihnen kausal etwas zu folgern. Wäre der Organismus ein Computer, meint Lewontin, hätte er ihn längst weggeworfen, weil sich aus seinen Informationen nichts berechnen lässt. So vielfältig wie die Deutungen der Gene, so komplex ist auch ihr Zusammenspiel. Genetiker, die die Karte des Genoms vor sich haben, wissen das selbst am besten.
ZEIT: In Ihrem Buch Hoffnung der Pandora fragen Sie nach der Realität wissenschaftlicher Entdeckungen und überlegen, ob die Milchsäurefermente existierten, bevor Pasteur sie entdeckte. Gab es das Humangenom, bevor es entdeckt wurde?
LATOUR: Wissenschaftliche Entdeckungen wie die der Gene hängen von einer Ausstattung ab, von Maschinen, Darstellungstechniken, Geldern. Die Tatsachen sind zwar objektiv und real, aber ohne ihre Verfertigung im Labor gäbe es sie nicht. Nur im Nachhinein kann man sagen: Die Gene existieren. Es gibt sie nicht ohne die Geschichte ihrer Erforschung.
ZEIT: Ist es das, was Sie meinen, wenn Sie schreiben, dass die Wissenschaftsforschung der Wissenschaft Wirklichkeit hinzufügt?
LATOUR: Ja. Wenn ein Genetiker vom Gen spricht, will ich wissen, wie seine Tatsachen zustande kamen. Wer die Umstände des Forschens nicht hinzufügt, nimmt durch die Behauptung von Eindeutigkeit und Einheitlichkeit eine reine Position der Macht ein. Nimmt man dem Genetiker sein Labor weg, bleibt von den Genen nichts übrig. Nimmt man den Ökonomen ihre Rechenmaschinen weg, ergeht es ihnen nicht anders. Die Frage nach der Realität des Erforschten finde ich nicht so wichtig wie die andere, ob es demokratisch sozialisiert wird. Mich interessiert, wie sich in der Forschung soziale, ethische, ästhetische, politische, instrumentelle Aspekte durchdringen. Das ergibt eine offene Landkarte vielfältiger Handlungen und Verwicklungen. Das Thema der Biomacht, dasFoucault aufgeworfen hat, ist Teil einer verästelten politischen Kultur.
ZEIT: Fürchten Sie nicht, dass die Genetik die politische Diskussion ersetzen könnte?
LATOUR: Nein. Die politische Diskussion muss sich nun um die Vorschläge der Genetik kümmern. Dafür muss ein öffentlicher Raum geschaffen werden, ähnlich wie ein neues Stadtbild Berlins entsteht. Und die Wissenschaft muss vom Anspruch der Autonomie befreit werden.
ZEIT: Sie unterscheiden in Ihrem Buch zwischen autonomer „Wissenschaft“ und „Forschung“, die sich ihrer Abhängigkeiten und Allianzen bewusst sind. Der Forschung soll die Zukunft gehören. Was ändert sich damit für den Genetiker?
LATOUR: Ändern muss sich weniger seine Arbeitsweise als vielmehr die öffentliche und humanwissenschaftliche Deutung seiner Arbeit. Die Forscher im Labor wissen genau, wie komplex ihre Abhängigkeiten sind. Wenn sie sich an ihre Sponsoren wenden, sprechen sie sehr offen über Deutungen, Risiken, Mittel und Alternativen. Aber wenn sie ihr Labor verlassen und sich an die Öffentlichkeit wenden, spricht bisher zumeist der reine Newton aus ihnen.
ZEIT: Newton, das heißt: Tatsachen ohne Relativität. Eine gereinigte Wissenschaft, frei von Störungen und Unsicherheit.
LATOUR: Das klassische Paradigma der Moderne eben, das ein einheitliches, von Werten gereinigtes Weltbild hervorbringen sollte. Aber die gegenwärtige Situation ist neu, das zeigen etwa Treibhauseffekt oder Rinderwahnsinn: Wir haben es mit viel mehr divergierenden Expertenmeinungen zu tun und auch mit mehr Forschungsgegenständen, die alle prompt ihre Risiken nach sich ziehen. Das Politische zieht in die Wissenschaften ein. In die Dinge selbst. Die Natur ist ein politischer Prozess.
ZEIT: Die Arena existiert schon.
LATOUR: Ja. Mir geht es nun darum, dass wir nicht länger sagen, auf die Erhebung der Tatsachen folge die moralische Bewertung, sondern dass wir kollektiv mit den Wissenschaftlern in einem offenen Prozess entscheiden, welche Risiken wir tragen wollen.
ZEIT: Was ist nun der Unterschied zwischen Ihrer Politik der Dinge und Habermas‘ Vorstellung von einer diskutierenden Öffentlichkeit?
LATOUR: Um zum Parlament der Dinge zu gelangen, muss man eine Portion Habermas mit einer Portion Gedanken vermischen, die er entsetzlich fände. Habermas bemüht sich ja gerade darum, die menschliche Kommunikation frei von instrumenteller Vernunft zu halten. Die will ich aber, in einer verwandelten Form, in der Arena laut werden lassen: dadurch, dass stellvertretend für die nichtmenschlichen Wesen gesprochen wird. Diese Stimmen mischen sich dann mit den menschlichen Interessen. Für Anhänger von Habermas klingt das monströs.
ZEIT: Wie sollen wir uns denn vorstellen, dass die rinderwahnsinnige Kuh im Parlament der Dinge ihre Stimme erhebt? Und mit uns diskutiert?
LATOUR: Nach der Katastrophe des Rinderwahnsinns sind wir klüger als zuvor. Wir haben Tiermehl verfüttert – aber haben wir zuvor nach der Meinung der Konsumenten gefragt? Wir haben auch die Kühe nicht gefragt, ob sie Tiermehl fressen wollen. Sie haben nicht das Recht, sich zu äußern, wir haben einfach ein unkontrolliertes Experiment mit ihnen durchgeführt. Wir müssen also ein Verfahren finden, die Kühe und die Konsumenten zu Wort kommen zu lassen. Bisher hat nur die instrumentelle Vernunft gesprochen mit Argumenten wie dem, das Tiermehl sei effektiver. Nun brauchen wir Assoziationen, die vor einer Katastrophe präventiv beraten und entscheiden. Das Parlament der Dinge stellt die Balance zwischen Menschen und nichtmenschlichen Wesen wieder her.
ZEIT: Jeder, der die Kuh sprechen lässt, spricht mit eigenen Interessen. Als Konservativer, als Grüner, als irgendwer, aber als Mensch.
LATOUR: Wie bei jedem politischen Problem.
ZEIT: Aber dann sind wir wieder mitten in der Verständigung unter Menschen, in der Intersubjektivität angelangt.
LATOUR: Nein, in der Verständigung mit den Dingen, in der Interobjektivität.
ZEIT: Wie höre ich im Stimmengewirr der Interessen ausgerechnet die Stimme der Kuh?
LATOUR: Indem sie Thema ist, und durch die verschiedenen Färbungen der Meinungen hindurch vernehmen Sie auch die Kuh. Das Entscheidende ist für mich, dass die Debatte über die Kuh nicht mehr auf der Basis feststehender wissenschaftlicher Tatsachen geführt wird, sondern dass die Wissenschaft politisch wird. Jeder Landwirt, jeder Konsument beinhaltet in gewisser Weise nicht nur die Kuh, sondern ein Weltbild, eine Vorstellung von Landschaft, Natur, Gesundheit.
Die Situation der Moderne ist vorbei, und also ist auch Ihre moderne Hoffnung überholt: den Wissenschaftlern die Kühe zu überlassen und den Politikern die Entscheidungen für die Menschen. Jetzt stehen die Kühe, vertreten durch vielfältige Interessen, mitten in der Arena. Die objektive Kuh gibt es nicht. Zudem geht es bei der Kuh nicht nur um ihre Milch, sondern auch um ihr Fleisch bzw. um das ihrer Kälber.

Früher war der tägliche Fleischgenuß dem Adel vorbehalten, mit der Demokratisierung des Konsums essen nun in den Industrieländern fast alle Menschen Steaks, Lammkoteletts oder Hamburger – und das täglich mehr: Im Durchschnitt verzehrt heute jeder Erdenbürger fast doppelt so viel Fleisch wie 1970. Bis 2050 wird sich der weltweite Fleischverbrauch nochmals verdoppelt haben. Dem ging eine globale Ausbreitung der Rinder- und Schafzucht voraus. Ein Viertel der gesamten Landmasse der Erde dient heute als Weideland. Vor allem in Südamerika müssen immer mehr Wälder den Rinderherden Platz machen: In Brasilien wurde seit 1960 knapp ein Fünftel des Amazonas abgeholzt – mehr als zweimal die Fläche von Deutschland. Doch das Mastrind im deutschen Stall ist nicht ökologischer gehalten als das auf der argentinischen Weide. Wenn wir Rinder bei uns im Maststall halten, wird das Kraftfutter importiert und das belastet Luft und Böden ebenfalls: Durch den Anbau und Transport des Futtermittels und die nicht bodengebundenen Ausscheidungen der Tiere – mit schlechter Ökobilanz.
Doch abgesehen von der Belastung der Böden – zu viel Fleisch zu essen ist schädlich für das Klima. Einem aktuellen UN-Bericht zufolge belastet der globale Rinderbestand das Weltklima genauso stark wie alle Menschen Indiens, Japans und Deutschlands zusammen. 70 Prozent des vom Rind freigesetzten Methans stammt vom Erhaltungsumsatz des Tieres. Mit Hochleistungszüchtungen ließe sich die Methanbildung pro Liter Milch oder pro Kilo Fleisch zwar senken. Doch das Tier erbringt die höhere Leistung nur mit Kraftfutter und dessen Produktion kurbelt wiederum die klimaschädlichen Gase an.
Für 300 kg Fleisch (Mastrind bei durchschnittlichem Lebensalter von zwei Jahren) werden verbraucht: 14.600 Liter Wasser, 3,5 Tonnen Soja und Getreide. Daraus entstehen: drei Mio Liter Kohlendioxid aus der Verbrennung der 2.500 Liter Treibstoff für den Futtermittelanbau, 200.000 Liter Methan aus dem Verdauungstrakt, 14,6 Tonnen Dung. Sinnvoll wäre also in erster Linie, sich auf die Produktionskapazitäten in unserem Land zu beschränken und unabhängig von Fremdfuttermitteln aus Übersee zu werden. Das reduziert den Energieverbrauch und verhindert, dass Methan in den Tropen und Subtropen freigesetzt wird. Die Landwirtschaft wiederum könnte angemessene Preise für gute Produkte bekommen…So argumentiert der Münchner Biologe Josef Reichholf. Auf der Erde leben derzeit etwa 1,48 Milliarden Rinder, dagegen 6,2 Milliarden Menschen. Aber unser Lebensgewicht beträgt insgesamt nur 0,3 Milliarden Tonnen, während das der Rinder vier Mal so hoch ist – und dementsprechend fällt auch ihr Energieverbrauch aus. Reichholf meint, dass die Rinder es damit darwinistisch gesprochen zur erfolgreichsten Säugetierart gebracht haben – indem sie sich als „Haustier“ dem Mensch andienten: man könnte sie als unsere „Number-One-Exosymbionten“ bezeichnen.
Wenn Schafe und Kühe aufstoßen, atmen sie Methan aus und tragen damit zur Erwärmung der Erdatmosphäre bei. Seit dem Ende der Adelsprivilegien ab 1789 nahm die Methankonzentration in der Atmosphäre um mehr als 150% zu. In Australien machen die Methanausdünstungen der millionenköpfigen Schaf- und Rinderherden heute 14 Prozent der gesamten Treibhausgas-Emissionen aus. Die Verdauungsorgane dieser Wiederkäuer, speziell ihr Pansen, sind voll mit celluloseabbauenden Bakterien. Das Methan, das diese Bakterien bei ihrer Verarbeitung der Gräser im Pansen freisetzen, kann der Körper nicht absorbieren, er gibt es deswegen durch Furzen und vor allem Rülpsen frei – und das in solchen Mengen, dass man inzwischen die Rinder dieser Welt fast für den gesamten Methananteil in der Atmosphäre (etwa 15%) verantwortlich macht. Das ist mehr als beunruhigend, aber im Kapitalismus darf es dagegen nur technische – d.h. profitable – Lösungen geben: So wollen z.B. die Agrobiologen den Methanausstoß der Rinder mit Bakterien aus Känguruhmägen reduzieren: Känguruhs produzieren wegen dieser speziellen Bakterien in ihren Vormägen kein Methan.
Als erstes Agrarland will Dänemark damit das Klima verbessern. Allein die dänischen Kühe geben pro Jahr 140.000 Tonnen Methangas in die Atmosphäre ab. In der „Technology Review“ wurde darüberhinaus kürzlich ein neuer Impfstoff angepriesen, der das Immunsystem der Tiere mobilisieren und den Methanausstoß eindämmen soll. Um acht Prozent konnte André-Denis Wright, Molekularbiologe vom australischen CSIRO-Institut und seine Kollegen damit die Methan-Ausdünstungen bei Schafen bereits reduzieren. Ein Schaf produziert rund 20 Gramm Methan pro Tag. Das macht sieben Kilogramm pro Jahr. Neuseeländische Forscher setzen dagegen auf eine neue Futtermittelpflanze: Legume Lotus mit kondensierten Tanninen soll den Methanausstoß bei Tieren um bis zu 16 Prozent reduzieren.
Wissenschaftler der dortigen AgResearch Grasslands haben die neue Futtermittelpflanze bereits getestet und für brauchbar befunden.
In Deutschland, wo 13 Mio Rinder leben, die jährlich 500.000 Tonnen Methan produzieren, kommen rund drei Viertel des landwirtschaftlichen Methanausstoßes aus der Rinderhaltung. Jürgen Zeddies von der Universität Hohenheim, die mit 16 Instituten an der interdisziplinären Erforschung der Quellen klimarelevanter Gase und umwelttoxischer Stoffe arbeitet, will diesen Ausstoß um bis zu einem Fünftel durch die Zugabe bestimmter Fette, Tannine und weiterer Substanzen vermindern: „Wird die Futterration der Kuh verändert, läuft die Methanproduktion anders ab“.
Prof. Dr. E. Pfeffer führte auf einer Tagung der Arbeitsgemeinschaft für Wirkstoffe in der Tierernährung (AWT) aus: Eine extensive Tierhaltung ist nicht immer die umweltfreundlichste. Eine Kuh, die 2.500 kg Milch im Jahr gibt, scheidet, bezogen auf die Milchleistung, 41 kg Methan je kg Milch aus. Eine Kuh mit 5.000 kg Jahresleistung dagegen nur 22 kg Methan je kg Milch. Bei einer 7.500-kg-Kuh sind es nur noch 17 kg Methan je kg Milch. Umgerechnet sind das bei der 2.500-kg-Kuh rund 102.500 kg Methan. Das bedeutet: werden für 5.000 kg Milch (wegen der Extensivierung) zwei Kühe benötigt, wird die Umwelt mit ca. 205.000 kg Methan im Jahr belastet; bei nur einer Kuh dagegen mit 110.000 kg.
Weltweit werden derzeit von den Wiederkäuern 80 Millionen Tonnen Methan produziert. Das Gas wirkt sich 32 mal schädlicher auf das Klima aus, als die Kohlendioxid-Emissionen von Autos oder Industrieanlagen. Der Anteil des Gases in der Atmosphäre steigt jährlich um 0,6 Prozent. Um den Trend zu stoppen, müsste die Produktion um 320 Prozent zurückgeschraubt werden. Seit der Klimakonferenz in Kyoto 1997 spielt das Thema eine große Rolle. Professor Winfried Drochner vom Institut für Tierernährung der Universität Hohenheim will die Kühe auf eine Spezialdiät setzen. Obendrein will er ihnen eine Riesenpille – einen pflanzlichen Vormagen-Bolus – verabreichen. Und damit gleich drei Dinge erreichen: weniger Kosten, weniger Treibhausgas – und letztlich ein gesteigertes Wohlbefinden der Tiere. „Wir suchen dafür noch Sponsoren“. Da die „Riesenpille“ aber nicht nur klimafreundlich wirkt, sondern sich in barer Münze auszahle, ist er optimistisch, in Kürze fündig zu werden. Einige Experten der Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft sind dagegen eher skeptisch: Die Anstrengungen, Kühe durch Bakterien-Impfungen oder Spezialfutter „methanärmer“ zu machen, halten sie für Ablenkungsmanöver, weil die heutigen Milchkühe Hochleistungsproduzenten sind – und jegliche Beeinflussung der komplizierten Bakterienflora im „Gärreaktor“ Kuhmagen ein schwieriges Unterfangen ist. Seit 1990 hat sich jedoch der CH4-Ausstoß der Bundesrepublik bereits halbiert, dennoch lag Deutschland bis 2004 im europäischen Vergleich noch in der Methan-Spitzengruppe. Aber BSE (Rinderwahn) und andere Lebensmittelskandale haben den Deutschen dann den Appetit auf Fleisch verdorben – was dem Klima zugute kam.
Als z.B. der “Rinderwahn” ausbrach und überall auf der Welt die Herden zu tausenden “gekeult”, d.h. getötet wurden, verkündete die US-Talkshowmoderatorin Oprah Winfrey, sie werden fortan keine Hamburger mehr essen. Prompt wurde sie daraufhin von texanischen Rinderzüchtern auf 12 Millionen Dollar Schadensersatz verklagt – der Betrag entsprach den Verlusten, die ihnen durch den Rückgang des Rindfleischverkaufs seit der Talkshowsendung entstanden. In Nordfriesland demonstrierten die Bauern gegen die staatlichen Rinderwahn-Eindämmungsmaßnahmen – vor allem um die existenzzerstörenden Massentötungen von Rindern zu verhindern. Sie forderten eine “Kohortenlösung”, d.h. im BSE-Fall nicht eine “Keulung” der gesamten Herde, sondern nur des betroffenen Tieres, seiner Familie und seines Jahrgangs. Der französische Bauernführer José Bové kritisierte in diesem Zusammenhang die Kapitalisierung der Landwirtschaft in toto: “Nur verrückte Menschen machen die Rinder wahnsinnig”.
Zwischendurch kam es in den letzten Jahren fast schon regelmäßig zu Fleischkandalen. Sie betrafen meist bayrische Fleisch-Großhändler, die mit ihrem “Gammelfleisch” osteuropäische Abnehmer bzw. inländische Döner-Hersteller belieferten. 2004 ging es um 333 Tonnen “Ekelfleisch”, das ein Kühlhausunternehmen nach Osteuropa verschob, 2005 erwischte man dabei erst einen Münchner Großhändler und dann 50 weitere Fleischlieferbetriebe. Der Spiegel schrieb: “Dass weder eine Fleischmafia noch ein übergreifendes Netzwerk dahinter steckt, macht das Ausmaß des Lebensmittelskandals umso bedenklicher.” 2006 ging es um 180 Tonnen “Schlachtabfälle”, die ein bayrisches Unternehmen auf dem Berliner Markt “entsorgte”. Jedesmal verschärfte man anschließend die Fleischkontrollen, aber aufgedeckt wurden die Fälle stets von gemobbten Mitarbeitern. Einmal war es ein gescholtener LKW-Fahrer, zuletzt ein geohrfeigter Azubi.
2007 fordern die 2500 deutschen Lebensmittelkontrolleure 1500 weitere Stellen, zudem soll das nicht mehr zum Verzehr zugelassene so genannte “K3″-Fleisch grün eingefärbt und eine Datenbank namens “Tizian” dafür eingeführt werden . Zuvor hatte man bereits mit BSE-Prionen oder Dioxyn verseuchtes “K1″-Fleisch schwarz eingefärbt und das mit Tierseuchen infizierte “K2″-Fleisch gelb. Betroffen sind von dem jüngsten “Gammelfleisch”-Skandal vor allem die Dönerläden: Um 40-50% sanken ihre Umsätze in Berlin und in Ostdeutschland sogar um 60%. Nicht nur tausende von Arbeitsplätze in diesen Imbissbuden sind dadurch gefährdet, sondern mindestens noch mal so viel in den von ihnen abhängigen türkischen Gemüseläden und Bäckereien.
Ein weiterer Wahnsinn bahnte sich 2008 mit den sinkenden Milchpreisen an: Bloß noch etwa 5 Cent bekommten z.B. die bayrischen Bauern für einen Liter, deswegen gehen immer mehr dazu über, daneben Biogasanlagen aufzustellen, die mit Gülle und Grünfutter Methan produzieren, das einen Generator antreibt, der Strom in das Netz einspeist – etwa 12 Megawattstunden pro Tag. Für jede Kilowattstunde zahlt ihnen der lokale Energieversorger 14,7 Cent. Wenn in drei Jahren die EU-Milchgarantieverordnung abgeschafft wird, lohnt sich die Kuhhaltung für die Bauern gar nicht mehr – sie werden dann nur noch Methan produzieren: ebenfalls mithilfe von auf Regenwaldböden angebautem Grünfutter. Die Biogasanlage, das ist die Kuh – und umgekehrt. Aber das ist noch Zukunftsmusik.
Und sowieso stiegen die Milchpreise plötzlich weltweit wieder, weil wegen der Klimaveränderung und der dadurch verursachten Trockenheit Australien und Ozeanien als große Milchlieferanten auf dem Weltmarkt zurückstecken mußten. Hinzu kam noch: „Die Nachfrage aufstrebender Länder wie China und Indien sowie der Boom bei Biokraftstoffen treiben die Preise vieler Rohstoffe nach oben“, so Torsten Schmidt vom Essener Institut für Wirtschaftsforschung RWI. „Die Butter ist bereits auf einem 20-Jahrespreishoch“, stellte die Export-Union für Milchprodukte kürzlich fest.
Es ging rauf und runter. 2009 standen die Milchbauern erneut im Mittelpunkt der Agrar-Berichterstattung:
Wegen des Milchpreisverfalls ging es ihnen nun immer schlechter. Im April berichtete die F.R. über eine Demonstration hessischer Milchbäuerinnen vor der Wiesbadener Staatskanzlei. Sie forderten einen “Milchkrisengipfel”. Ihr hessischer Verband der Milchviehhalter sah das Problem im Überangebot an Milch, deswegen forderte er die “Festschreibung einer Höchstmenge, um den Preisverfall zu stoppen”. Die derzeit existierende Milchquote sei zu hoch, man brauche eine “flexible Mengenregulierung”.
Zuvor hatte die FAS in einem langen Artikel über “Kraftwerke auf dem Melkkarussel” noch geschrieben: “Glückliche Kühe. Ihre Milch ist so begehrt wie lange nicht.” Dennoch forderte damals schon der Bundesverband Deutscher Milchviehhalter (BDM) mindestens 35 Cent pro Liter, besser wäre aber noch 40 Cent, “um kostendeckend zu wirtschaften”. In dem Artikel kam außerdem noch der Chef einer Käserei zu Wort. “Sein Fazit: Milch sei knapp und werde es vorerst bleiben.” Denn “Milch ist eben ein sehr langsames Geschäft”.
Ende Mai 2009 veröffentlichte die FAS jedoch einen ganzseitigen Report über das Ehepaar Dammeyer, die in Sachsen-Anhalt eine LPG für 200.000 DM kauften. Sie haben 240 Kühe und bestellen 440 Hektar Land, von denen ihnen 100 Hektar gehörten – bis sie es der Bank verpfändeten. “Die Dammeyers erwirtschaften derzeit 13.000 Euro Verlust im Monat, seit der Milchpreis so niedrig ist…Knapp 23 Cent gibt es pro Liter Milch. Vor einem Jahr waren es 50% mehr.
Die Lage der Milchbauern in der EU wurde als katastrophal bezeichnet. Die gesunkenen Preise waren für viele Milchbetriebe “akut existenzbedrohend”.Deswegen stellte das European Milk Board (EMB), ein Dachverband von rund 100.000 Milchbauern aus 14 europäischen Ländern, dem EU-Agrarrat und der EU-Kommission ein Ultimatum, das am 30. Juni 2009 ablief.
Die Milchproduzenten drohten erneut mit einem europaweiten Lieferstreik, sollte sich die Politik den notwendigen Reformen in der Milchwirtschaft verweigern. Das beschlossen sie kürzlich auf einer Tagung in Kappel am Albis in der Schweiz. Zahlreiche Bauern hätten wegen des Verfalls der Milchpreise “Probleme, Essen und Kleidung für ihre Familien zu bezahlen”, erklärte der Präsident des Europäischen Bauernverbandes Padraig Walshe (Irland). Die Preise für Butter seien seit September um über 40 Prozent, die Käsepreise sogar um durchschnittlich 50 Prozent gefallen, sagte Walshe. “Ich selbst muss meine Milch zu Preisen unterhalb der Produktionskosten verkaufen”, erklärte der irische Bauer. In mehreren Städten fanden Bauerndemonstrationen statt.
Die Agrarministerin Ilse Aigner (CSU) will sich jedoch nicht umstimmen lassen: “Wo ich auch stehe, sage ich: Die Milchquote, die einer künstlichen Verknappung der Milchmenge gleichkommt, läuft nach derzeitiger Beschlusslage aus.” Von der „Zeit” wurde sie daraufhin gefragt: “Die Pleite Tausender kleiner Milchbetriebe steht also fest?” Aigner: “Das ist nicht gesagt. Es überlebt nicht zwingend der größte, sondern derjenige, der sich am besten auf den Strukturwandel einstellt.”
So ähnlich sah das auch die FAZ, Anfang des Jahres bereits, als sie meinte, den Bauern schon mal “Trost” zu spenden und Mut zu machen: “Die deutschen Landwirte haben offenbar viel gelernt in diesen volatilen [beweglichen] Märkten, sie sind selbstbewusster und unternehmerischer geworden. Dies gilt letztlich auch für die Milchbauern.”
„Das Säemann”, das Zentralorgan der Landarbeiter-Gewerkschaft, die in die IG BAU aufging, meldete: Die 42.000 Arbeitnehmer in der Milch erzeugenden Landwirtschaft in Deutschland sehen einer Gefährdung ihrer Arbeitsplätze entgegen: “mehrere hundert haben wegen der viel zu niedrigen Milchpreise schon ihren Arbeitsplatz verloren”. Die Hoffnung auf neue Zuwachsraten im Absatz durch Erschließung neuer Exportmärkte entpuppe sich “als Märchen”. Die Gewerkschaft forderte ein gemeinsames Vorgehen der “Lieferkette” – Produzenten, Verarbeiter und Handel.”
Die Nachrichtenagenturen meldeten unisono: „Tausende Bauern geben auf. Preisverfall bei der Milch trägt zum Höfesterben bei.“ Dpa erklärte: „Wegen des „Preisverall“ der Milch haben 2009 erneut viele Milchbauern ihren Betrieb aufgeben müssen. Die Zahl der Milchkuhhalter sank von Mai 2009 bis Mai 2010 um 4 Prozent. 3.934 Höfe stellten ihre Milchviehwirtschaft ein. Die Zahl der Milchhöfe sank in den vergangenen Jahren stetig. Die Zahl der Milchkühe blieb allerdings relativ konstant.“
Etliche Tageszeitungen zwischen dem Allgäu und der Küste dokumentierten daraufhin „Einzelschicksale“: Da gab es z.B. Bauer Jürgen Jacobsen aus Nordfriesland. Er ging wie jeden Morgen in den Stall. Seine Frau war beunruhigt. Sie rief ihn auf dem Handy an: „Ist alles in Ordnung? Er beruhigte sie. Alles bestens. Dann schaltete er die Melkanlage an und erhängte sich.“ Oder Bauer Thomas Schneekloth aus Barsbek: „Bei 200 Kühen dachte ich, jetzt bin ich gut dabei, erzählt er. Bei 300 dachte er, jetzt kann nichts mehr schiefgehen. Jetzt hat er 400 und Existenzangst.“ Oder Bauer Roland Thomsen aus Norstedt: Im Juni holte der Viehhändler seine 53 Kühe ab. „Der NDR war da und filmte das Ende einer Milchbauernexistenz. Filmte, wie der Landwirt die Stalltür ein letztes Mal öffnet, wie die schwarz-weiß gefleckten Holsteiner heraustraben, wie er die Tür hinter ihnen schließt. Filmte auch, wie Thomsen weint.“
Andere drehen eher durch, wenn ihr kleinbäuerlicher Hof zwangsversteigert wird. Der bayrische Schriftsteller und JW-Kolumnist Franz Dobler hat das in seinem Roman „Tollwut“ zum Thema gemacht. „Der Markt bietet keine Ruhe, er bietet Chancen“, so sieht dagegen das realzynische Schleswig-Holsteiner „Bauernblatt“ die Agrarmisere. Mit den Chancen sind u.a. die „Milchquoten“ gemeint, d.h. die festgelegten Milchmengen, die jeder Kuhhalter produzieren darf. Erhängt er sich oder gibt er seinen Betrieb auf, kann ein anderer seine Quote kaufen. Sie können auch angeheiratet, geleast und gepachtet werden. Heute werden sie dreimal im Jahr an sieben deutschen Milchbörsen gehandelt.
Und es ist inzwischen allen klar: So wird man die Milchproduktion nie an den Bedarf anpassen. Deshalb soll die Quote 2015 abgeschafft werden – und allein der Markt das regeln. Das wird dem Höfe- und Bauernsterben wahrscheinlich einen neuen Schub geben, obwohl gleichzeitig mehr und mehr Arbeitslose aus der Stadt sich auf dem Land „Subsistenzwirtschaften“ aufbauen. Die Agrarsoziologin Silvia Pérez-Vitoria meint sogar, dass das 21. Jahrhundert ein Jahrhundert der Bauern sein wird.
„Tod eines Milchbauern“ hieß dagegen dann ein quasi aktueller Kriminalroman des Biobauern Thomas B. Morgenstern. Er spielte im Kehdinger Land bei Stade und dort hat der Autor auch seinen Demeterbetrieb: die „Hofgemeinschaft Aschhorn“. „Alle meine Erzählungen spielen im näheren oder weiteren Umfeld des bäuerlichen Lebens. Da fühle ich mich am sichersten, wenn ich Alltägliches beschreiben will. Ich könnte schwerlich einen Roman verfassen, der im Milieu von Krankenhausärzten oder Piloten spielt“, sagte Morgenstern in einem Interview, das auf seiner Hof-Webpage zu finden ist. Auch in diesem, seinem zweiten Regionalkrimi ermittelt der regionale Milchkontrolleur Allmers – und man erfährt dabei viel über den Milchbauern-Alltag. Morgensterns erster Krimi hieß schlicht: „Der Milchkontrolleur“.
Abgesehen davon, dass aus der „Klonkuh Uschi“ schon ganz viele geworden sind und von den „Turbokühen ‚Marlene‘, ‚Biene‘ und ‚Flittchen'“ künstlich befruchtete Eizellen in alle Welt exportiert werden, kann man auch die „normal“ hochgezüchteten 4,1 Millionen Kühe in Deutschland nur bedingt zur Natur zählen: Sie sind bald – enthornt und entherdet – bloß noch Einzelteile einer Maschinerie zur Produktion von Milch. Wenn nach 4-5 Kuhjahren der Stallcomputer wegen nachlassender Milchleistung bei gleichbleibendem Futterverbrauch ihre „Aussortierung“ anordnet, liefern sie auch noch Fleisch und Leder. Mit dem Bauern, der sie einst liebte, haben diese namenlosen Tiere kaum noch Kontakt. Stattdessen regeln Melkroboter, Futterautomaten, Lichtschranken, Responder am Körper und der Zentralcomputer ihr kurzes, hochproduktives Stall-Leben. Auch ihr Futter wird nicht mehr vom Bauern produziert, sondern in Lateinamerika, wo es ebenfalls hochtechnisiert angebaut wird. Unsere Holstein-Frisian-Kühe produzieren heute bis zu 80 Liter Milch am Tag, ab 40 Liter kann ihr Pansen die dafür notwendige Energie nicht mehr liefern, deswegen wird das mit Formaldehyd behandelte Soja-Kraftfutter „pansenstabil“ gemacht, damit dessen Verdauung erst im Dünndarm stattfindet. Man kann diese künstliche Ernährung riechen: Früher war der Kuhstall ein olfaktorischer Genuß – heute stinkt er. Und die Milch, die dort produziert wird, sollte man auch besser meiden – ebenso das Fleisch. Die ganze Anlage ist ein einziger Rinderwahnsinn! Ihr ist nur noch zu entnehmen, dass auch uns ein ähnlich durchkontrolliertes Hightech-Schicksal blüht. So lautet das Fazit von Bernhard Kathan – in seinem Buch „Schöne neue Kuhstallwelt“.
Der Vorarlberger Autor ist in der Landwirtschaft groß geworden und hat sich bereits in seinen früheren Büchern mit dem sich wandelnden Mensch-Tier-Verhältnis befaßt. Anders der Berliner Autor Florian Werner, den es – eher romantisch gestimmt – mit seinem Buch „Die Kuh“ in die entgegengesetzte Richtung trieb: „So wir nicht umkehren und werden wie die Kühe, so kommen wir nicht in das Himmelreich,“ lautet sein von Nietzsche entlehntes Motto dafür. Beide Autoren lieben die Kühe, deren „fromme Augen“ und „seliges Muhen“ sie auch in Zukunft nicht missen möchten. Aber während der norddeutsche Autor, Werner, dafür alle verfügbare Literatur – von Goethe über Gandhi bis Bertolt Brecht – nach Kuh-Zitaten durchforstete und daraus laut Klappentext eine „Fundgrube“ und ein „Nachschlagewerk“ gemacht hat, befaßte sich der Österreicher Kathan zum Verstehen dessen, was rings um ihn herum bei seinen bäuerlichen Nachbarn im Kuhstall geschieht, mit literarischen Utopien, in denen es bereits um die Mechanisierung und Automatisierung von Lebensläufen, Lust, Strafen usw. ging. Das reicht von de Sade über Èmile Zola und Frank Wedekind bis zu Franz Kafka und Max Brod.
Ungeachtet ihrer unterschiedlichen Herangehensweise dürften sich die beiden Kuhbuch-Autoren jedoch mit der ehemaligen grünen Landwirtschaftsministerin Renate Künast einig sein, die 2001 verkündete: „Der BSE-Skandal markiert das Ende der Landwirtschaftspolitik alten Typs. Wir stehen vor einem Scherbenhaufen.“ Es gehe nun darum, „mehr Klasse statt Masse“ zu produzieren. In Wahrheit wurde jedoch das unselige Prinzip „Wachse oder weiche!“ beibehalten.
Florian Werner spricht in seinem Kuhbuch von einer „ökologischen Fehlentwicklung“, für die er „jenes weltweite Geflecht aus Viehhaltern, Futtermittelproduzenten, Schlachtbetrieben, Lederverarbeitern, Rindfleischessern, Milchtrinkern und anderen am globalen Kuhhandel beteiligten Menschen“ moralisch verantwortlich macht, die der US-Soziologe Jeremy Rifkin als „Rinderkomplex“ bezeichnete. Mit Rifkins Bestseller „Das Imperium der Rinder“ begann 1994 das Genre „Kuhbuch“ populär zu werden, 2004 wurde es von dem Münchner Biologen Josef Reichholf mit seinem Werk „Der Tanz um das goldene Kalb“ noch einmal erweitert.
Diesen beiden Autoren ging es jedoch nicht um die Entmenschlichung der Kuhhaltung, sondern eher um die Verrinderung der irdischen Landmasse, wovon 1/4 bereits in Weideland umgewandelt wurde – zur Deckung des wachsenden Fleisch- und Milchbedarfs. Einem UN-Bericht zufolge belastet der globale Rinderbestand inzwischen das Weltklima genauso stark wie alle Menschen Indiens, Japans und Deutschlands zusammen.
Bernhard Kathan geht es in seinem Kuhbuch demgegenüber um die Belastung (Denaturalisierung) der Rinder durch das Nützlichkeitskalkül der Menschen: „Im Augenblick bewegen wir uns an jener historischen Schnittstelle,“ schreibt er, „an der das Maschinelle zunehmend lebendig und das als lebend Verstandene den Gesetzmäßigkeiten der Maschine unterworfen wird,“ d.h. der „Kuhstall als lebendiger Organismus“ wurde „keinem Lebewesen nachempfunden“, vielmehr zeige die „Geschichte der Landmaschinentechnik, dass sich technologische Durchbrüche der Abkehr von Mensch- oder Tiermodellen verdanken.“
Dieser „Abkehr“ möchten Kathan und Werner mit einer „Rückkehr“ entgegentreten – die sie jedoch in ihren Büchern nur noch im „Jenseits“ lokalisieren bzw. in der „Erinnerung“. An diesem Ende setzt eine Schweizer Publikation für eine Ausstellung ein, die 2008 im Talmuseum von Erlenbach stattfand und das Lebenswerk des Simmentaler Vieh- und Wanderfotografen Arthur Zeller zeigte. Er starb fünfzigjährig 1931. Der Ethnologe Markus Schürpf schreibt im Vorwort: „Der Milchbauer Zeller etablierte sich als Fotograf der Simmentaler Rasse und hielt im ganzen Kanton Bern die besten Tiere der damals führenden Züchter fest.“ Bei diesen Rindern stand neben der Milch- und Fleischleistung auch noch die „Zugkraft“ im Vordergrund. Bei ihren Porträtphotos ging es darum, ihre „Charakterzüge genau wieder zu geben“. Die reicheren Milchbauern hatten ihre besten Tiere zuvor in Öl malen lassen. Zeller fertigte seine Photographien vor allem für Kataloge von Landwirtschaftsausstellungen an.
Auch heute gibt es noch solche Kuhfotografen: Wolfhard Schulze aus Niedersachsen z.B.. Während Zeller noch bemüht war, bei der Aufnahme „Schönheit und Nutzen“ der betreffenden Kuh zu zeigen, steht heute ihr Nutzen im Vordergrund. Für die Schönheit der meist preisgekrönten Hochleistungstiere sorgen Schulzes drei Assistenten mit allerlei Tricks und danach sein Computerprogramm „Photoshop“. Dergestalt wird der Kuh sogar noch bei ihrem Abbild der Naturalismus ausgetrieben.

Eine Kritik der Kuhkultur kann man auch aus der Sichtweise eines Dorfes leisten. Dies hat der niederländische Publizist Geert Mak in einer Studie versucht, die den Titel “Wie Gott verschwand aus Jorwerd” hat. Sein Buch wurde in viele Sprachen übersetzt, im Deutschen bekam es 1999 den Untertitel: “Der Untergang des Dorfes in Europa”.
Um die Jahrhundertwende wohnten ungefähr 650 Leute in Jorwerd, nach dem Zweiten Weltkrieg waren es noch 420, 1995 nur noch 330, wobei die meisten in der Stadt arbeiteten. 1956 schloß das Postamt, 1959 gab der letzte Schuster auf, der Hafen wurde zugeschüttet, die Bäckerei schloß 1970, zwei Jahre später wurde die Buslinie stillgelegt, 1974 gab der letzte Binnenschiffer auf, der Fleischer schloß seinen Laden 1975, der Schmied gab 1986 auf und 1988 machte der letzte Lebensmittelladen dicht, 1994 wurde die Kirche einer Stiftung für Denkmalschutz übergeben. Als ich das erste Mal – im Herbst 2000 – dort hin kam, hatte nicht einmal mehr die Dorfkneipe “Het Wapen van Baarderadeel” täglich geöffnet. Ansonsten sah das Dorf aber sehr freundlich und gemütlich aus. Der Autor Geert Mak meint denn auch am Schluß seines Buches – sinngemäß, daß man den Jorwerdern ihr langsames Verschwinden nicht anmerke: wie eh und je feiern sie alljährlich ihr rauschendes Dorffest, die “Merke” – “So lebt das Dorf weiter, im Traum des Frommen, im langsamen Tanz der Alten, in einer Leichtigkeit, die es früher nicht gekannt hat”.
Über die Ursachen aber, wie es dazu gekommen ist, gehen die Meinungen in Jorwerd auseinander. Für die Bäuerin Lies Wiedijk z.B. begann das Unglück damit, daß das Milchgeld, das ihnen jeden Freitag der Molkereifahrer ausgehändigt hatte, plötzlich auf ein Konto überwiesen wurde. Hiermit setzte die schleichende Verwandlung der Produktionsgemeinschaft in eine Konsumgesellschaft im kleinen ein, wobei die ökonomischen Banden nach und nach durch sportliche und kulturelle ersetzt wurden. Gerade die Neuhinzugezogenen stürzten sich häufig mit aller Energie ins Dorfleben, lernten Friesisch und traten dem Theaterclub bei. Da hier noch und zunehmend das Gesetz der kleinen Zahl galt, brauchte jedoch bloß einmal ein “aggressiver Schreihals in einen Neubau” einziehen – und ein paar Wochen in der Kneipe herumstänkern: schon blieben die Gäste aus. Zum Glück zog er wieder weg, “sonst wäre das wichtigste soziale Zentrum des Dorfes in ernste Schwierigkeiten geraten”. Geert Mak meint: “Mit der Landwirtschaft war die Stabilität nicht nur aus der dörflichen Wirtschaft, sondern aus dem gesamten sozialen Leben des Dorfes gewichen”.
Und die Landwirtschaft hatte man sukzessive mit den staatlichen Subventionen zur Förderung konkurrenzfähiger Agrarbetriebe aus den Dörfern vertrieben. Weit über 100.000 Bauern gaben nach 1945 in Deutschland, Frankreich und den Benelux-Ländern alljährlich auf. Heute sind es allein in Deutschland noch 10.000 jährlich. Und ein Ende dieses Konzentrationsprozesses und damit der industriellen Tier- und Pflanzenproduktion ist nicht in Sicht. Was in der Sowjetunion die Kulakenvernichtung hieß, war und ist in Westeuropa die Vertreibung der Kleinbauern. Die “Bauernkultur” erlebte in der Mitte des 19.Jahrhunderts ihr letztes “großes Feuerwerk”, danach begann – mit der Mechanisierung – ihr Niedergang.
Im Mai 1940 setzten auch etliche Jorwerder “Bauern in ihrer Armut all ihre Hoffnungen (noch einmal) auf die neue Ordnung…Minne und seine Mutter traten begeistert den Nationalsozialisten bei, Lammert hatte sich sogar den Schwarzhemden angeschlossen”. Sietske, Fedde und Pieter versteckten dagegen untergetauchte Juden auf ihren Höfen: “Wir haben viel Spaß miteinander gehabt”. Dafür wurden sie nach dem Krieg in Israel geehrt, Lammert wurde zum Tode verurteilt, später jedoch begnadigt.
In den darauffolgenden Wiederaufbaujahren registrierten die Bauern die Brüche immer individueller: Für Sake Castelein war es die erste Melkmaschine, mit der “die Gemütlichkeit auf dem Hof innerhalb von ein paar Jahren verloren ging”. Für Bonne Hijlkema war es der erste Trecker 1960, und für Cor Wieddijk der erste Liegeboxen-Laufstall für die Kühe. Überhaupt wurde alles mehr und mehr auf Milchwirtschaft ausgerichtet.
Wegen der wachsenden Überproduktion zog die EU-Landwirtschaftspolitik die Notbremse: Es gab Abschlachtprämien für Kühe – und festgelegte Milchquoten. Die kleinen Milchbauern gaben auf – und verkauften ihre Quote: Noch “Mitte der Neunzigerjahre stellten in den Niederlanden durchschnittlich sechs Viehhalter pro Tag ihren Betrieb ein”. Inzwischen gibt es auch eine Mistquote. Und es mehren sich die Fälle von Viehverwahrlosung – “Früher hatte ein Kuh immer recht”. Jetzt ist sie ein Produktionsfaktor, so wie auch das Land, für das immer mehr “Naturpläne” aufgestellt werden: “Manche Grundstücke wurden zu Biosphärenreservaten erklärt – und der Bauer erhielt eine Kompensation. Es wurden sogar Planierraupen eingesetzt, um den fruchtbaren Ackerboden zu entfernen und das Terrain wieder künstlich karg zu machen.”
Immer mehr Menschen erwarben sich ihren Reichtum durch Worte, durch Papier und abstrakte Geschäfte”. Dabei schien die Stabilität in der Provinz einer “heimlichen Panik” zu weichen. Früher wurde man hier umgekehrt wie in der Stadt ausgelacht, wenn man einer Mode folgte. Heute wird auch auf dem Land “ein Projekt nach dem anderen konzipiert – ausgereift und unausgegoren, brauchbar und wahnwitzig, alles durcheinander”. Feriendörfer, Yachthafen, Transrapid – es wimmelt von Masterplänen. So wurde Jorwerd zu einem Global Village.
Der holländische Agrarforscher Frank Westerman hat sich statt auf ein westfriesisches Dorf auf drei Dörfer in Oldampt am Dollart konzentriert:
Ende der Neunzigerjahre lagen hier Tausende von Hektar brach: Der Getreideanbau lag in den letzten Zügen und schien ein willenloses Opfer der Landschaftsplaner mit ihren Riesenbudgets.” Die Verwaltung des “Naturschutzgebietes” in der ostgroninger Region Oldambt ließ das Land “vogelfreundlich” anlegen und errichtete für die Menschen “Vogelbeobachtungspunkte”. Westerman schreibt: “Vom Deich aus sah ich Hunderte von Säbelschnäblerpaaren mit ihren Jungen am Ufer des Wattenpriels herumlaufen, dort, wo in den Achtziger Jahren noch Raps gestanden hatte.” In diesem einstigen „Getreideparadies“ gab es früher viele Landarbeiter, noch 1994 stimmten hier über 50% der Wähler für die Kommunisten. Man nennt diese ostgroninger Region deswegen “das rote Dreieck”.
Von hier stammte auch der einstige Herrenbauer und Sozialist Sicco Mansholt – der erste und wichtigste Landwirtschaftskomissar der EU, damals noch EWG genannt. Der “Kulturlandgewinner” Mansholt entwarf das Agrarsubventionsmodell, das noch heute – wieder und wieder modifiziert – gültig ist. Und er war es auch, der sich zuletzt für “Kulturlandvernichtung” – die Renaturierung, sogar Flutung von Ackerland einsetzte und an “Stillegungsprämien” dachte. Das war, nachdem er in Brüssel Petra Kelly kennengelernt und sich in sie verliebt hatte, wie Frank Westerman berichtet, der darüberhinaus neben der “grünen” auch noch eine “blaue Front” am Dollart ausgemacht hat, die die Landwirtschaft nun quasi von beiden Seiten in die Zange nehmen.
Mit letzteren sind die Wasserwirtschaftsverbände gemeint, die bereits eingedenk der Klimaerwärmung daran gehen, aus der niederländischen Küste eine “Sonderzone” zu machen, um “auf dem Land Raum für das Meer zu schaffen”. Über all diese “grünen” und “blauen Projekte” haben sich jedoch die Getreidepreise in den letzten zwei Jahren verdoppelt, wie ein Oldambter Bauer dem Autor, Westerman, 2007 schrieb. Die zuständigen Behörden hätten ihm deswegen versprochen: “Auf guten, landwirtschaftlichen Böden soll keine Natur mehr angelegt werden.”
Vielleicht kommt es noch so weit, dass die EU sogar Fördermittel für Existenzgründungen von Kleinbauern auflegt. Wie schon Marx und Engels war auch Sicco Mansholt davon überzeugt gewesen, dass der kleinbäuerliche Familienbetrieb keine Zukunft hat – nur die industrielle Großlandwirtschaft. Sein berühmtester Gegenspieler war und ist der ostfriesische Bauer Onno Poppinga – aus Upgant auf der anderen Seite des Dollart. Seit den Siebzigerjahren kritisiert er schon die EU-Agrarpolitik. Das brachte ihm eine Landwirtschaftsprofessur an der Universität Kassel ein. Als er dort 2008 emeritiert wurde, und fortan wieder Pferde züchten wollte, widmete ihm die taz ein Porträt, u.a. heißt es darin:
„Er hat die herrschende Agrarpolitik immer aus einer linken Perspektive heraus kritisiert’, sagt der EU-Parlamentarier Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf. Den mag Poppinga, obwohl er bei den Grünen ist’, ‘Parteien sind mir Wurst’, sagt er, mit denen wollte ich nie etwas Näheres zu tun haben’”. Poppinga wird sich mit seiner Zeitung “unabhängige Bauernstimme” auch weiterhin für eine Agrar-Subventionspolitik einsetzen, die den bäuerlichen Familienbetrieb stützt und nicht auslöscht – zugunsten industrieller Agrarbetriebe, die den Gegensatz von Kulturland und Natur verschärfen: “Da zentraler Grundkonsens jeder bisherigen staatlichen Agrarpolitik und der wissenschaftlichen Agrarökonomie die permanente Auflösung landwirtschaftlicher Betriebe und Abwanderung von Arbeitskräften war und ist, konnte von dort eine Bindung von staatlichen Zahlungen an die landwirtschaftliche Arbeit überhaupt nicht in den Blick kommen (es wäre ein ‘Verrat an Grundsätzen’). Stellt man dagegen andere Interessen nach vorne (z. B. Erhöhung landwirtschaftlicher Wertschöpfung, regionale Erzeugung, sorgfältige Einzeltierbetreuung, Beitrag zur Minderung von Massenarbeitslosigkeit), so verändert sich die Frage nach der Bindung der staatlichen Zahlungen an die in der Landwirtschaft geleistete Arbeit auf den Gesichtspunkt der Zweckmäßigkeit, und die ist leicht lösbar.”
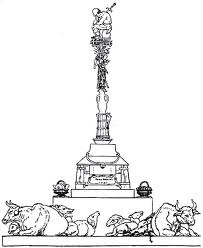
Entwurf eines Bauernkriegs-Denkmals von Albrecht Dürer
In Schleswig-Holstein kam es in den späten Zwanzigerjahren zu einem heftigen bäuerlichen Widerstand gegen die (damalige) Agrarpolitik:
Die Kämpfe der „Landvolkbewegung“ hatten zum Hintergrund eine massive Agrarkrise – im Zusammenhang der Weltwirtschaftskrise, von der vor allem die dortigen Mittelbauern betroffen waren, insofern sie als Viehmäster (Gräser) eine spekulative Landwirtschaft betrieben, d.h. sie nahmen Kredite auf, um im Frühjahr Mastvieh zu kaufen, dass sie anschließend mit Gewinn wieder zu verkaufen hofften. Weil aber immer mehr Billigimporte aus dem Ausland auf die Preise drückten, mußten viele Bauern Konkurs anmelden, zumal sie auch noch mit jede Menge Steuern belastet wurden. Bis 1932 wurden 800.000 Hektar Land zwangsversteigert und über 30.000 Bauern mußten ihre Höfe aufgeben.
“Keine Steuern aus der Substanz!” das war dann auch die Parole, unter der am 28. Januar 1928 140.000 Bauern in Heide, der Kreisstadt von Dithmarschen, demonstrierten. Ihre Sprecher wurden der Landwirt und Jurist Wilhelm Hamkens aus Tetenbüll im Eiderstedtischen und der Bauer Claus Heim aus St.Annen in Oesterfeld. Die beiden suchten sich ihre intellektuellen Bündnispartner sowohl in rechten als auch in linken Kreisen. Um die Landvolkbewegung voranzubringen, verkaufte der “Bauerngeneral” genannte Claus Heim dann 20 Hektar seines Landes und gründete eine Tageszeitung, außerdem wurden von dem Geld zwei Autos angeschafft. Als Redakteure gewann er den später kommunistischen Bauernorganisator und Spanienkämpfer Bruno von Salomon sowie dessen Bruder Ernst von Salomon, der zu den Rathenau-Mördern gehörte und in antikommunistischen Freikorps gekämpft hatte. Während die Kopfarbeiter fast alle aus der seit dem Kapp-Putsch berüchtigten “Brigade Ehrhardt” kamen, waren die Handarbeiter der Zeitung Kommunisten. Da man ihnen aus Geldmangel keine Überstunden vergüten konnte, durften sie gelegentlich auch eigene marxistisch inspirierte Artikel im “Landvolk” veröffentlichen.
Als Heims “Adjudant” fungierte jedoch bald der antisemitische Haudegen Herbert Volck, der wie folgt für die schleswig-holsteinische Bewegung gewonnen wurde: “Kommen Sie, organisieren Sie uns!” bat ihn ein Bauer in Berlin, “setzen Sie ihre Parole ‘Blut und Boden’ in die Tat um”. Volck gab ihm gegenüber zu bedenken, “ihr müßt euer Blut dazu geben”, nur für bessere “Preise von Schweinen, Korn und Butter kämpfe ich nicht”. Die Ursache für die wachsende Not der Bauern sah er darin, daß “plötzlich auf den jüdischen Vieh- und Getreidenhöfen die Preise herunterspekuliert” wurden. Und als wahre Kämpfer anerkannte er dann nur ganz wenige: “Claus Heim, der Schlesien- und Ruhrkämpfer Polizeihauptmann a.D. Nickels und ich,…keine Organisation, aber selbst bereit, in die Gefängnisse zu gehen, wollen wir dem Volke ein Naturgesetz nachweisen – das Gesetz des Opfers”.
Tatsächlich mußten die Aktivisten später alle unterschiedlich lange im Gefängnis sitzen. Die Landvolkbewegung radikalisierte sich schnell, zugleich spaltete sich ein eher legalistischer Flügel um Wilhelm Hamkens ab – und die schleswig-holsteinische NSDAP ging ebenfalls auf Distanz zur Landvolkbewegung. Es kam zu Bombenattentaten, Landrats- und Finanzämter wurden in die Luft gesprengt, und Polizei und Beamte daran gehindert, Vieh zu pfänden. Ein Landvolk-Lied ging so: “Herr Landrat, keine Bange, Sie leben nicht mehr lange…/Heute nacht um Zwei, da besuchen wir Sie,/ Mit dem Wecker, dem Sprengstoff und der Taschenbatterie!” Bei den Bombenattentaten wurde jedoch nie jemand verletzt. Einmal sprachen die Bauern sogar ein Stadtboykott – gegen Neumünster – aus, nachdem auf einer Bauerndemo ihr Fahnenträger, der Diplomlandwirt Walther Muthmann, schwer verletzt worden war. Er mußte dann nach Schweden emigrieren, später kehrte er jedoch wieder nach Deutschland zurück, wo man ihn für einige Wochen inhaftierte.
In Neumünster war 1928/29 der ehemalige Gutshofhilfsinspektor Hans Fallada Annoncenaquisiteur einer kleinen Regionalzeitung. Als ihr Gerichtsreporter saß er dann auch im Landvolk-Prozeß. Sein 1931 erschienener Roman “Bauern, Bonzen und Bomben” ist allerdings mehr ein Buch über das Elend des Lokaljournalismus als über die Not der Bauern. Von dieser handelte dann sein Roman aus dem Jahr 1938 “Wolf unter Wölfen”, in dem es um drei ehemalige Offiziere des Ersten Weltkriegs geht, die auf einem Gutshof bei Küstrin untergekommen sind. Auch Fallada arbeitete lange Zeit als Gutshilfsinspektor. Mit den Landvolkaktivisten teilte er dagegen mehrfache Knasterfahrungen. Während der “Bauerngeneral” Claus Heim bei seinem Prozeß und auch danach jede Aussage verweigerte, begannen seine Mitangeklagten schon in U-Haft mit ihren Aufzeichnungen.
Herbert Volck nennt seine abenteuerlichen Erinnerungen “Landvolk und Bomben”, Ernst von Salomons Erfahrungsbericht heißt “Die Stadt”. Erwähnt seien ferner die Aufsätze der Kampfjournalisten Friedrich Wilhelm Heinz und Bodo Uhse. Heinz arbeitete später im Range eines Majors mit antisowjetischen Partisanen in der Ukraine zusammen und machte dann eine kurze Karriere in Adenauers “Amt Blank”. Uhse brachte es zu einem anerkannten Schriftsteller in der DDR und war dort kurzzeitig Institutsleiter in der Akademie der Künste. Nach dem Krieg kamen vor allem Richard Scheringer und Ernst von Salomon noch einmal auf die Landvolkbewegung zu sprechen – Salomon in seinem berühmten Buch “Der Fragebogen” und der bayrische Bauer und DKP-Funktionär Scheringer mit seiner Biographie “Das große Los – unter Soldaten, Bauern und Rebellen”.
Noch später – nämlich nach der Wiedervereinigung – fühlte die FAZ sich im Sommer an Hans Falladas Neumünsterroman erinnert und übertitelte einen langen Kampfartikel gegen das unerwünschte Fortbestehen vieler LPGen in den fünf neuen Ländern mit: “Bauern, Bonzen und Betrüger”, ihm folgte der noch schärfere Spiegel-Aufmacher “Belogen und betrogen”. Vorausgegangen waren diesen West-Schmähschriften eine Reihe von Ost-Straßenblockaden und Demonstrationen – u.a. auf dem Alexanderplatz – von LPG-Bauern, die gegen den Boykott ihrer Waren – durch westdeutsche Lebensmittelkonzerne und von Westlern privatisierte Schlachthöfe sowie Molkereien – protestierten. Für die FAZ waren sie bloß gepresstes Fußvolk der “Roten Bonzen”, die sich noch immer an der Spitze der LPGen hielten, inzwischen jedoch Geschäftsführer von GmbHs, Genossenschaften oder sogar Aktiengesellschaften geworden waren.

Meine persönlichen Erfahrungen mit der Landwirtschaft sind eher bescheiden:
Ende der Siebziger-, Anfang der Achtzigerjahren arbeitete ich bei verschiedenen westdeutschen Bauern als landwirtschaftlicher Betriebshelfer. Manchmal blieb ich auf einem Hof nur eine Woche, einmal über ein Jahr. In der Hauptsache hatte ich mit der Bullen- und Schweinemast sowie der Milchproduktion zu tun. Schon als Kind hatte ich bei unserem Nachbarn, einem Bauern, gerne geholfen. Er war – in den späten Fünfzigerjahren – fast noch Selbstversorger gewesen – und arbeitete noch mit Pferden. Mir gefielen aber auch die Tischsitten und die seltsam intensiv bis herbe schmeckenden Speisen, die sie z.B. abends aßen, wenn sich die ganze Großfamilie in der Küche versammelte, während nebenan die Bauersfrau noch an der Milchzentrifuge saß und Sahne bzw. Butter machte. Dabei las sie einen Adels-Roman.
In den Siebzigerjahren schwebte uns diese Art von Bukolik vor, als wir zu mehreren aufs Land – in die Wesermarsch – zogen. Die Bauern dort hatten sich inzwischen derart weit davon entfernt, daß sie uns freudig dabei halfen: Sie schenkten uns einen alten Traktor und andere ausrangierte Geräte, gaben uns Tips fürs Brotbacken und für die Käseherstellung. Aber all das waren eher Schwimmübungen auf dem Trockenen – jedenfalls in ökonomischer Hinsicht. Um wirklich „alternativ“ mit den Tieren und dem Boden umzugehen, wollte ich zuvörderst erst einmal die „normale Landwirtschaft“ kennenlernen.Meistens arbeitete ich dann auf 100-Hektarhöfen, die von einem Ehepaar bewirtschaftet wurden, das die Arbeit kaum schaffte – insbesondere wenn Modernisierungs- und Ausbaumaßnahmen anstanden. So war ich jedesmal neben der täglichen Fütterung und dem Melken sowie der Ackerbestellung bzw. Ernte auch noch mit handwerklichen Tätigkeiten beschäftigt.
Von der einstigen bäuerlichen Selbstversorgung war meist nur noch eine kleine Hühnerhaltung und ein Mastschwein übrig geblieben, für den eigenen Gebrauch. Es wurde extra gefüttert, was ich ein bißchen unmoralisch fand. Ein Bauer im Allgäu klärte mich später darüber auf, daß das quasi ein Gewohnheitsrecht sei: Schon bei den alten Naturalabgaben an Lehrer, Klerus und Adel hätten die Bauern immer nur die „Masse“ jedoch nie die „Klasse“, wie die Agrarministerin Künast das nannte, eingehalten.
Die anderen Schweine bekamen Fertigfutter, gelegentlich eine Penicillinspritze bei Unpässlichkeit, ihnen wurden außerdem die Schwänze abgeschnitten und den männlichen Ferkeln die Hoden entfernt. Dazu hatte sich ein Bauer in der Wesermarsch extra einen kleinen Seziertisch aus einem Stiefelknecht und Einweckgummis gebastelt. Überhaupt wurde auf den Höfen viel gebastelt bzw. „organisiert und umfrisiert“: Z.B. Viehanhänger aus Autobahnleitplanken, aufgebohrte Düsen am Spritzgerät, um sie nicht nach jeder aufs Feld gebrachten Chemikalie mühsam wechseln zu müssen, usw.. Daneben „entsorgten“ wir beispielsweise das übriggebliebene Saatgut, das mit Quecksilber und allen möglichen Giften gebeizt war, der Einfachheit halber im Weizenhaufen, der für den Verkauf an die Mühle bestimmt war. Auch dabei hatte ich ein schlechtes Gewissen. Noch mehr berührte es mich allerdings, daß die Kälbchen überall gleich nach der Geburt weggenommen wurden – und fortan in einem dunklen Verschlag vor sich hin dämmern mußten.
Bei einem Bauern an der Mosel geriet ich einmal in einen regelrechten Milchkrieg, der über die Euter ausgetragen wurde. Er hatte seinen alten Kuhstall mit Fördergeldern erweitert und umgebaut: Statt auf Stroh sollten die Tiere in Zukunft auf Beton-Spaltenböden stehen. Ich half ihm beim Bau. Die Unzufriedenheit der Kühe steigerte sich in dem neuen Stall von Tag zu Tag: Es kam zu immer mehr Euterverletzungen. Wir nähten ihnen schließlich Euterhalter zum Schutz. Diese wurden von den Tieren aber immer wieder abgerissen, so daß wir ständig die Konstruktion verbessern mußten. Wochenlang waren wir fast mit nichts anderem als mit dem Widerstand der Tiere beschäftigt. Dabei war uns klar: Sie werden auf immer größere Michleistungen hin gezüchtet, zudem wird ihre Hochleistungzeit immer kürzer, so daß ihr ganzes schnelles Leben vom Euter abhängt, dessen Krankheiten sich denn auch fortwährend mehren – und die deswegen das einzige sind, was den Bauern wirklich noch interessiert.
„Der Betrieb läuft noch nicht richtig rund!“ Das war die Meinung so ziemlich aller Bauern. Aber sie arbeiteten hart daran. In der biologisch-dynamischen Landwirtschaft ist dies sogar das Leitprinzip: Das, was dem Betrieb an Substanz entnommen wird, muß ihm in irgendeiner Form wieder zugeführt werden. Wobei der fortwährende Versuch, es auszubalancieren, sich an einem quasi-naturwissenschaftlichen Kreislauf-Modell orientiert. In der „normalen Landwirtschaft“ interessiert vor allem der Geld-Kreislauf. Laufend flattern den Bauern irgendwelche Zwischenabrechnungen von der zentralen Buchhaltungsstelle ins Haus und ständig müssen sie aufs Neue mit Banken und Landwirtschaftsberatern diskutieren, planen, projektieren. In der Toscana, wo es mich einmal hinverschlug, war es am Extremsten: In einem Jahr bekam man EU-Prämien für das Umsägen von Olivenbäumen und für das Anpflanzen von Weinreben stattdessen, im nächsten Rechnungsjahr war es genau umgekehrt.
Bereits unser Nachbarbauer, der in den Fünfzigerjahren in Norddeutschland einen 7-Hektarhof bewirtschaftete, pflegte mit einer Mischung aus Angst und Großkotzigkeit zu sagen: „Wie möt konkurrenzfähig blievn!“ Wo er das nur her hat? wunderte ich mich damals.
Die Schweine fristen inzwischen fast überall ein absolut trostloses Dasein. Im Münsterland mußte ich einmal einem Schweinemäster eine Leiter zurückbringen, dabei bat ich ihn, mir seinen neuen Großstall zu zeigen. Zu meinem Erstaunen druckste er herum, schließlich willigte er aber doch ein: Er machte die Tür auf, knipste das Licht an, wir gingen die etwa 80 Meter lange Futtergasse runter – und traten an der anderen Seite des Stalles wieder ins Freie. Der Bauer blieb stehen und überlegte, dann sagte er: „Dieser Spaß hat mich jetzt 750 DM gekostet.“ Ich war entsetzt, er erklärte mir: „Die sind alle aufgesprungen und haben Krach gemacht – und dabei einen Gewichtsverlust erlitten, der in Futterkosten umgerechnet etwa dieser Summe entspricht“. Er war nicht nur geknickt über diesen Gewinneinbruch, sondern auch ein bißchen stolz darauf, ihn sich leisten zu können.
Die meisten Bauern, bei denen ich arbeitete, besaßen nur eine kleine Schweinemast – höchstens 100 Tiere, und daneben noch einige Zuchtsauen. Letztere kamen gelegentlich ins Freie und wurden auch sonst umkümmert. Aber die zur Mast bestimmten Tiere wurden nur noch auf ihre Gleichförmigkeit hin beobachtet – und das so selten wie möglich am Tag, sie wurden meist von Futterautomaten bedient. Eigentlich machte man in den Mastställen nur Kontrollgänge. Es roch darin nicht gut und war laut. Auch die Schwalben brüteten dort ungerne. Ähnliches gilt für die Rinder-Laufställe, wo man jedoch nach wie vor wenigstens mit angenehm duftendem Futter – Silage, Stroh und Heu – zu tun hat. Bei den Kuhställen bilde ich mir inzwischen ein, es riechen zu können, ob die Tiere sich darin einigermaßen wohl fühlen oder nicht. Am Schrecklichsten waren für mich die sogenannten Hühner-KZs, wenn ich konnte, vermied ich es, bei einem Bauern zu arbeiten, der eine industrielle Hühnermast betrieb. Manchmal ließ es sich jedoch nicht vermeiden. Wenn ich inmitten dieser weißen Wogen aus zerrupften Hühnern stand, hatte ich immer das Gefühl, mich mit irgendwelchen Krankheiten zu infizieren. Wenn ich jetzt Hühnerfleisch esse, sehe ich immer diese armen Vögel vor mir – und meide deswegen ihr Fleisch. Übrigens halten sich auch viele Hühnermäster noch privat irgendwelche schönen Vögel – Perlhühner, Gänse, Flugenten, die sie vor Weihnachten für sich und ihre Verwandtschaft schlachten. Gerade sind Strausse und Rentiere groß im Kommen.
Weil hier im Gegensatz zu Osteuropa das „Bauernlegen“ vor allem die kleinen trifft, indem die EU-Quoten (für Milch, Zuckerrüben etc.) vor allem den großen Höfen zugutekommen, die daraufhin noch mehr expandieren können, schreitet die „Entfremdung“ zwischen dem Land, den Tieren und den Bauern weiter fort. In vielen Kuhställen gibt es heute einen Computer, der die tägliche Milchleistung jeder Kuh parat hat und dementsprechend die Futtermenge zuteilt sowie das Töten der jeweils Leistungsschwächsten empfiehlt. Die Tiere haben keine Namen mehr, sondern nur noch Nummern.
Vollends fühlte ich mich jedoch erst als KZ-Wächter, nachdem wir – ein paar Freunde und ich – im November 1989 bei einer LPG in der Nähe von Babelsberg als Rinderpfleger angefangen hatten. Bis nach den Märzwahlen 1990 hielten wir diese Arbeit aus, vorher beschafften wir „unserer“ LPG zur Freude unseres Vorsitzenden Kärgel – noch einen Stand auf der Grünen Woche – in der Halle für ökologischen Landbau. In der Brigade hatten die Männer nur mit dem Ausmisten und dem Einstreu sowie dem Füttern der Mastrinder zu tun, und die Frauen mit der Kälberaufzucht. Manchmal mußte ich in der nahen Schweine-Vorvormast aushelfen. Unser Mittagsessen wurde uns täglich mit einem LKW gebracht. Und regelmäßig schaute ein Veterinär nach dem Vieh – d.h. er gab dem einen oder anderen Tier eine Spritze. Alle vier Wochen kam außerdem ein Desinfektor – ebenfalls mit einer langen Spritze – vorbei. Zur Reparatur der Stalltechnik rückte eine Schlosserbrigade an. Bei den Schweinen bestand meine erste Aufgabe morgens oftmals darin, mit der Schubkarre die Toten der Nacht einzusammeln und in einen nahen Schuppen zu bringen, wo der LKW der Abdeckerei sie regelmäßig abholte.
Wenn ich einmal die Stallgasse zu gründlich fegte, sagte mein Kollege Günther: „Mach es nicht zu gut, daß stecken sich nur die da oben wieder an den Hut!“ Einmal meinte ich zum Essensfahrer, er solle doch ein bißchen Putz mitbringen nächstes Mal – beim Ausmisten mit dem Traktor sei an der Stalltür ein großes Stück Putz abgeplatzt. Das könnten wir nebenbei nach und nach wieder ausbessern. „Bist Du verrückt!“ schalt mich während der Kaffeepause im Frauenruheraum mein Kollege Michael, „solche Arbeiten vorzu schlagen – dafür ist die Maurerbrigade zuständig!“ „Aber die gibt es doch gar nicht mehr, die wurde doch auf die Stallbrigaden aufgeteilt, das weißt du am Besten, du warst doch selber Maurer,“ entgegnete ich. „Das ist aber nicht unser Problem,“ beendete Michael das Gespräch, „da müssen die da oben sich einen Kopf drüber machen.“
Während Ernst Jünger die Verwandlung der deutschen Arbeiter in Soldaten besang, wunderte sich der Kriegskorrespondent Curzio Malaparte in den sowjetischen Kolchosen über die dort gelungene Umschmiedung der Bauern zu Soldaten. Was hier in der DDR später zu der Gegen-Formel „Schwerter zu Pflugscharen“ geriet, daß begann also mit einer Proletarisierung der „LPG-Bauern“ – mit „Ernte-Kampagnen“ und „Ernteschlachten“ etc.. Der Chefredakteur des „Sonntag“ dichtete einst als Redakteur einer Dorfzeitung „Mit Teterower Schwung in die Frühjahrsbestellung!“ „Unser“ LPG-Vorsitzender war einst in der Kampagne „Kader aufs Land“ mobilisiert worden – und dann hier bei Babelsberg hängengeblieben. Auch die LPG-Barackenarchitektur mit ihrem hohen Zaun drumrum und den Desinfektionsbecken an den Ein- bzw. Ausfahrten erinnerte stark an militärische Einrichtungen, wenn nicht gar an Konzentrationslager. Auch die Haltung der meisten Mitarbeiter in der Rinderbrigade ähnelte der von Akkordarbeitern bzw. von dienstverpflichteten Soldaten. Ständig mußten die Rinder umgetrieben werden – wobei elektrische Schlagstöcke zum Einsatz kamen, ich benutzte dazu meine Mistgabel.
Im Potsdamer Schlachthof erzählte mir später jemand, daß sie früher bei den Rindern oft ganze Partien Leder rausschneiden und wegschmeißen mußten, weil sie voller Blutergüsse waren: Die Ausstattung der Tierproduktions-Genossenschaften mit elektrischen Schlagstöcken sollte dem abhelfen. Von einem DDR-Agrar-Funktionär erfuhr ich noch später, daß wir im falschen Objekt gearbeitet hätten: In den stadtnahen LPGen – mit großer Fluktuation – sei das „bäuerliche Bewußtsein“ leider schon so gut wie verschüttet. In den West-Landwirtschaften schien mir dies primär ein „Eigentümer-Bewußtsein“ gewesen zu sein, das dann doch einen pfleglicheren Umgang mit den Tieren gebot. Oder jedenfalls besteht der Idiotismus des Landlebens dort anders als im Sozialismus fort. Hier schimpfte ich z.B. einmal gegenüber dem Traktoristen Egon laut über das nasse, teilweise schon schwarzvergammelte Stroh, das er aus einer unabgedeckten Feldmiete holte und daß kaum mehr zum Einstreu zu gebrauchen war: Nach 20 Minuten standen die Rinder schon wieder im Mist. Sowohl im alten Anbindestall des ehemaligen Gutshofs als auch in den neuen Freilaufställen, einzig in dem einst von Chruschtschow durchgesetzten „Rinderoffenstall“ konnten sich die Tiere auch im nassen Stroh noch einigermaßen wohl fühlen. Dort gab es auch die wenigsten Erkrankungen. Egon entgegnete mir daraufhin: Beim Ausmisten mit dem Traktor sei gerade das nasse Stroh sehr praktisch – und daher dem trockenen vorzuziehen.
In Westdeutschland war es dagegen mehrmals vorgekommen, daß ein Spediteur mit LKW und großem Anhänger zu einem Bauern gekommen war, bei dem ich gerade arbeitete, um Stroh für holländische Viehzüchter einzukaufen. Wir stapelten den Lastwagen äußerst sorgfältig mit den Ballen voll – trotzdem fehlten am Ende immer etliche hundert Kilo am Gewicht. Kurzerhand schloß der Bauer einen Schlauch an und bespritzte die Strohballen so lange mit Wasser – bis der Transport das nötige Gewicht hatte, und der Fahrer zufrieden abfuhr. Auch dieser marktwirtschaftlich rationale Irrsinn geht auf Kosten der Tiere.
Ähnlich in Ost und West war auch der Zwang zu ihrer immer schärferen Vernutzung – aufgrund des Verbraucher-Drucks, allzeit preiswertes Fleisch zu bekommen. Die Kippstelle hierbei, das war vielleicht der „Sonntagsbraten“ in den Arbeiterhaushalten, von dem der Ernährer jedesmal das größte Stück abbekam. Seitdem will jeder am Tisch in den Genuß kommen – und das täglich. Die Landwirtschaft, der Viehhandel und die Schlachthöfe vernutzen seitdem die Rinder, Schweine und Hühner wie am Fließband. In Amerika bereits so schnell, daß das Fleisch dieser junggeschlachteten Tiere noch „geschmacksneutral“ ist – und deswegen extra „Flavour“ zugesetzt werden muß, zudem wird es so portioniert, daß jeder Hinweis auf seine tierische Herkunft getilgt ist. Dazu trägt schließlich auch noch die Beleuchtung der Fleisch-Verkaufstresen bei. Eine US-Ökologin entwarf für die dortigen Schlachthöfe gerade eine neue sprialförmige Rampe, auf der die Tiere zum Töten hochgetrieben werden – dabei sollen sie angeblich bis zum letzten Moment nicht mitbekommen, was mit den vor ihnen passiert ist. Also wir sollen nicht mehr wissen, was für Tiere wir essen und die sollen nicht mehr merken, daß wir sie essen!
Selbst als Landwirtschaftshelfer bekommt man das nicht mit: Sie kommen entweder nach einiger Zeit in die Hauptmast oder große Speditionsfirmen holen sie ab und transportieren sie irgenwohin. Dafür füllen sich die Ställe dann mit neuen Tieren. Unter den schon etwas älteren Kälbern gibt es immer ein paar, die man besonders sympathisch findet. Solche suchte zu DDR-Zeiten gelegentlich das Studio Babelsberg sich in den Ställen „unserer“ LPG aus: Sie sollten in Kinderfilmen mitspielen – und wurden daraufhin für die Dauer der Dreharbeiten dem Studio zur Pflege überlassen. Anschließend waren sie jedoch derart „verzogen“, daß sie in der LPG ständig Prügel bezogen, weil sie in ihrer Anhänglichkeit die Stallarbeit behinderten.
Die US-Journalistin Anjana Shrivastava kam in einer Studie zu dem Schluß, daß all die obigen Probleme in der „Demokratisierung des Fleisches“ angelegt seien, so daß durchaus eine Rückkehr zum alten Jagd- und Fleisch-Privileg für alle das Wünschenswerteste wäre. Nur wer würde diesmal die privilegierte Kriegerkaste stellen, die all die anderen – Vegetarier – hegt und pflegt? Nein, wir müssen wohl durch diesen ganzen Scheiß hindurch – damit am Ende jeder freiwillig zur Selbstzucht (und sei es von Fleischkaninchen) gelangt, oder sich den „Sonntagsbraten“ wieder so selten leistet wie den Sonntags-Ausflug (mit der ganzen Familie).
In der Kochkunstklasse von Professor Kubelka im Frankfurter Städel geht man inzwischen von der Annahme aus: „Ein wirklich guter Koch kann das getötete Tier in der Pfanne widerauferstehen lassen“. – Und darauf komme es letztendlich an!
Hier noch zwei Kurzporträts von Freunden, die in der Landwirtschaft geblieben sind bzw.dorthin zurückkehrten:
– Der 1943 in Ostberlin geborene Hanns-Peter Hartmann wollte eigentlich Tierarzt werden. Stattdessen machte er 1960 erst einmal in Falkenberg seinen Facharbeiter für Schweine- und Rinderzucht. Ab 1963 besuchte er in Oranienburg die Fachschule für Landwirtschaft – zusammen mit seinem Freund Siegfried Mattner, der heute Geschäftsführer des großen Bauernmarkts Schmachtenhagen ist. Nach seiner NVA-Zeit fing Hartmann als Melker in Langenlipsdorf an. 1971 besuchte er die Hochschule für LPG in Meißen, die er zwei Jahre später als Diplom-Agraringenieur verließ. Seine Abschlußarbeit bestand aus „Vorschlägen zur Erweiterung und rationelleren Nutzung moderner Milchproduktionsanlagen“. Für die Note 1 oder 2 mußte man eine noch nicht ins Deutsche übersetzte sowjetische Arbeit als Quelle benutzen. Hartmann fand eine von Admin und Savzan aus dem Versuchsbetrieb Kutusowska, in der es u.a. darum ging, den Färsen zwei mal täglich kurz die Euter zu massieren: das würde die Milchleistung später um ca. einen Liter täglich erhöhen. Als Praktiker nahm Hartmann diese Empfehlung jedoch selbst nicht ernst, ähnlich waren zuvor bereits die Landwirtschafts-Neuerungen von Lyssenko in vielen Kolchosen aufgenommen worden. „Wer hätte dafür Zeit gehabt, allen Färsen die Euter zu massieren und wieviel das gekostet hätte – dieses zwei mal tägliche Als-Ob-Melken?! Außerdem standen die meisten Färsen in den Chrustschowschen Rinder-Offenställen, in denen sie frei herumliefen: da wäre man gar nicht an die rangekommen“.
Nach dem Studium heiratete Hartmann eine Bauerstochter und gelernte Diplomökonomin. Sein Freund Mattner holte die beiden wenig später in die LPG Schmachtenhagen, die er damals gerade übernommen hatte. Hartmanns Frau arbeitete in Schmachtenhagen als Hauptbuchhalterin, er wurde Leiter der Tierproduktion. „Meine Frau hat es dort aber nicht gepackt, sie wollte wieder weg. Wir sind dann nach Kloster Zinna. Ich als stellvertretender Betriebsleiter in einer 2000er-Rinderanlage und sie als Hauptbuchhalterin in einer Landmaschinenfabrik. 1979 haben wir uns scheiden lassen und ich bin erst mal zurück nach Berlin, wo ich in der Batteriefabrik BAE in Oberschöneweide angefangen habe. In einer neuen Abteilung an einer Fließpresse. Da wollte niemand hin. Meine Brigade bestand zu 60% aus Vorbestraften, dazu gab es noch etliche ‚braune Socken‘, so haben die sich selbst bezeichnet.
Zusammen mit einem Kumpel habe ich es dann geschafft, dass unsere Brigade durch Neuerungsvorschläge schließlich die bestverdienendste des ganzen Betriebs wurde. Ende 89 hieß es ‚Wir brauchen Betriebsräte!‘ Einige Kollegen haben mich vorgeschlagen. Ich wußte gar nicht richtig, was das ist, war nicht mal in der Gewerkschaft“. Ein Jahr später wurde der Betrieb geteilt und Hartmann ging als Betriebsratsvorsitzender in das Gerätebatteriewerk in Niederschöneweide, wo er dann vorwiegend gegen die Abwicklung des Werkes durch die Treuhand kämpfte. Das schaffte er auch, aber die neuen Investoren aus München teilten ihm dann mit: „Herr Hartmann, Sie haben uns sehr geholfen, jetzt ist jedoch der Klassenkampf beendet, wir brauchen Sie nicht mehr – Sie sind entlassen!“ Kurioserweise blieb er trotz Hausverbots Betriebsratsvorsitzender. Und in einem Vergleich vor dem Arbeitsgericht mußte ihm die Treuhand schließlich 150.000 DM zahlen. Hartmann kaufte sich davon eine Eigentumswohnung in der Nähe. Er selbst blieb aber in einem Block wohnen, das dem Batteriewerk gehörte. Es gelang ihm, für den dortigen Hinterhof 100.000 DM Begrünungsgeld vom Senat loszueisen. Mit dem Geld wurden Büsche und Bäume gepflanzt sowie ein Koi-Teich angelegt: „Ich war da fast wieder landwirtschaftlich tätig – wenn es auch mehr in Richtung Fischzucht ging“.
1994 wurde er als Betriebsratsvorsitzender wiedergewählt, außerdem bat ihn die PDS, für den Bundestag zu kandidieren – als Arbeitsloser unter der Parole: „Ich kämpfe für Arbeit“. In Bonn saß er dann im Europa-Ausschuß und diskutierte über Kakaopreise sowie eine neue EU Rebstockverordnung. Bei der nächsten Wahl 1998 ließ er sich nicht mehr aufstellen – und war somit wieder arbeitslos, diesmal jedoch, ohne Leistungsempfänger zu sein. Dafür bekam er zwischen 1999 und 2003 drei mal eine ABM-Stelle als Projektleiter. Gleichzeitig erwarb er zusammen mit seiner Freundin Ewa einen Bauernhof in Polen, der erst einmal ausgebaut werden mußte. Außerdem schaffte er sich dort Hühner, Schafe und Ziegen an, so daß er fortan quasi gezwungen war, ständig zwischen Berlin und Polen zu pendeln. Zwar weiß er noch nicht, wie er das ganze auf Dauer finanziell geregelt kriegen soll, aber er ist sich schon mal sicher, daß er dort auf seinem Hof dereinst auch sterben wird und will. An sich hat ihn die frische pommersche Landluft aber erst mal aufleben lassen.
– Der Biobauer Matthias Stührwoldt (41) aus Stolpe bei Plön, 107 Hektar, 60 Kühe, verheiratet, fünf Kinder, veröffentlicht, seitdem er den Hof von seinem Vater übernommen hat, regelmäßig Gedichte und Geschichten in der „unabhängigen Bauernstimme“. Daraus sind bisher vier Bücher entstanden, aus denen Stührwoldt auf zumeist ländlichen Veranstaltungen vorliest. Einige Hörbücher zeugen bereits davon. Es gibt nicht viele Bauern, die nebenbei noch Schriftsteller und Unterhalter sind, erst recht nicht solche, die ausschließlich von ihrem Hof, ihrer Familie, ihren Tieren und ihrem Ackergerät erzählen – und dabei doch die ganze Welt auf dem Kieker haben. Stührwoldt ist Milchbauer, den Milchbauern geht es derzeit schlecht, sie klagen und demonstrieren. Auch Stührwoldt klagt über den Preisverfall bei der Milch infolge des Überangebots – u.a. mit einem selbstverfaßten „Cattle Blues“ (er kann auch singen) und einer Geschichte über seine Lieblingskuh „Schwarzer“: Sie bringt zwar kaum Milchgeld ein, „auf der ‚Euro-Tier‘ wird sie jedoch mit Sicherheit Sieger werden,wenn die Kuh mit der niedrigsten Leistung und der flachsten Laktationskurve prämiert wird“!
Selbst aus noch gröberen Mißgeschicken im landwirtschaftlichen Alltag schnitzt Stührwoldt selbstironisch eine Kolumne nach der anderen. Dieser Bauer macht den Eindruck, als wäre er mit sich und der Welt im Reinen – jedenfalls im kleinen Ganzen. Seltsamerweise gehört er auch noch zu denen, die ihre Emails innerhalb von zehn Minuten beantworten. Es kam deswegen bereits der Verdacht auf, dass er ein Indoor-Bauer sei. Einer, der seine funk- und GPS-gesteuerten Geräte vom Büro aus mit dem Joystick über die Äcker schickt. Dagegen sprachen seine Geschichten – „Die Erfindung des Melkroboters“ und „Der Düngerstreuerkomplex“. Nein, die Wahrheit war technologisch einfacher, wie sich dann herausstellte: Stührwoldt sitzt oft und gerne auf seinem Trecker – ein Fendt: der Mercedes unter den Zugmaschinen. Früher ist er damit abends sogar zur Disco und auf die Parties der Landjugend gebrettert – mit einem Strohanhänger hintendran.
In seinem ersten Buch „Verliebt Trecker fahren“ erzählt Stührwoldt, wie er einmal mit der jungen Buchhändlerin Frida nach einer Party darin übernachtete – und sie ihm mit dem Satz ‚Ach, dein Fendt ist soo stark‘ in die Arme sank. Das war noch während seiner Lehrzeit – auf einem Biohof, von der sein Vater ihm schärfstens abgeraten hatte: „Die kommen vor Hunger nicht in den Schlaf“. Als eine Hofbesichtigung anstand, versuchte der Autor ihn dennoch zu überreden, sich das mal anzukucken: „Und was ist, wenn mich jemand erkennt?“ wich der aus, sein Sohn entgegnete: „Vater, du gehst nur auf einen Biohof, nicht in einen Sexshop!“ Nachdem Stührwoldt den Hof seines Vaters vor zehn Jahren übernahm, sitzt er auf seinem eigenen Fendt – und hört Deutschlandfunk: „Bloß keinen hirnlosen Privatsender, dabei kommt man nicht zum Denken. Zum Einfallenlassen neuer Texte gibt es ansonsten nichts Besseres als anspruchsarme Arbeiten auf dem Trecker.“ Anscheinend ist sein Fendt inzwischen auch noch mit einem iPhone ausgerüstet – um u.a. Emails zu beantworten. Es gibt darüber keine Geschichte von ihm, wahrscheinlich, weil er seinen elektronisierten Kindern gegenüber gerne den „naturverbundenen Landmann“ herauskehrt – mit Nackbaden im nahen See, Wollmütze auf dem Kopf bei der Arbeit, einem Hass auf Bewegungsmelder und dem Verdacht, dass alle (Rinder-) Züchter Rassisten sind. Von einem seiner Kinder bekam er zu Weihnachten einen „Gutschein für einmal Gameboy-Konfiszieren“ geschenkt.
Seine älteste Tochter ist mittlerweile „selbsternannte Gleichstellungsbeauftragte“ auf dem Hof – seitdem werden auch die Bullenkälber benamt. Und weil er seine Frau Birte in seinen Büchern immer „Die Liebste“ nennt oder vielleicht auch trotzdem, trägt sie gerne ein T-Shirt mit dem Aufdruck „Die Liebste“ bei der Arbeit. Ein Gedicht handelt z.B. vom Spazierengehen mit ihr: „weit kucken kann man nicht/überall Mais/ doch die zarte Hand der Liebsten/fühlt sich gut an/in meiner Pranke/(…)/wir kommen beim Nachbarn vorbei/er mischt gerade Futter/’Na, haben sie dich zweckentfremdet?’/ruft er mir zu.“ Auf Mallorca notierte der Bauer: „Hier müsste man mal Steine sammeln/und herrje!/ um all die Mandel- und Olivenbäume/ rumzupflügen/macht bestimmt auch keinen Spaß/(…) „meine Kinder malen mir Bilder/mit Kühen drauf/ damit ich die Sehnsucht aushalten kann/(…)/ungeniert sitz ich auf einem Felsen/und seh den Bauern bei der Arbeit zu.“
Noch einige Bemerkungen über einen Dokumentarfilm, der zwei Neueinrichter aus dem Westen im Osten zum Thema hat:
“Lieber nach Osten als nach Kanada” von Sophie Kotanyi und Ulli Frohnmeyer verfolgte die mehrjährige Enwicklung eines “landwirtschaftlichen Projekts” in Mecklenburg- Vorpommern von Anne Schritt und Wilhelm Höper aus Schleswig- Holstein. Als “weichende Erben” konnten beide den Hof ihrer Eltern nicht übernehmen. Schon immer waren solche Nachgeborenen dort nach Pommern ausgewichen.
Den beiden gelang es 1991, ein 300 Hektar großes kirchliches Gut in Strellin zu pachten, auf dem sie biologisches Getreide anbauen und eine Milchviehproduktion aufbauen wollten. Die Filmemacher sind schon lange mit den beiden befreundet: Ulli Frohnmeyer arbeitete einmal auf dem Hof von Wilhelms Eltern.
Für das junge Bauernpaar galt es erst einmal, sich einzurichten, Arbeitskräfte einzustellen und einen großen Kuhstall zu bauen. Die Landmaschinen wurden auf Kredit gekauft. Zur Einweihung des Stalls gab es ein Dorffest, und der Pfarrer der Nachbargemeinde, Schorlemmer, hielt eine Rede. Inzwischen kann die Ernte als biologisch anerkannt verkauft werden, so daß sich der Betrieb mit seinen 4 bis 5 Mitarbeitern zu einem Drittel davon trägt, ein weiteres Drittel bringt die Milchproduktion, und das letzte kommt über EG-Mittel herein.
Ihren filmenden Begleitern war bei diesem “Aufschwung Ost”- Beispiel wichtig: Wie würden die Nachbarn, das Dorf Strellin und die Mitarbeiter auf die Westler reagieren? Und würden sich diese als Kolonialisten gebärden beziehungsweise als solche angesehen werden? Anne und Wilhelm trafen zunächst tatsächlich auf Skepsis und Mißtrauen. “Wir hatten befürchtet, daß es schwer sein würde, dies zu dokumentieren”, meint Sophie Kotanyi, “aber die ,Einheimischen’ sprachen offen über ihre Gefühle vor der Kamera.” Unerwartete Probleme gab es jedoch umgekehrt – mit Anne und Wilhelm, “die sich bald vor uns fürchteten und versuchten, ein allzu glattes Bild von sich abzugeben. Es plagte sie die Angst, ihre Bemühungen um Akzeptanz in der Gegend könnten gefährdet werden, wenn sie sich offen über die Menschen in ihrer neuen Umgebung äußern würden. Sie versuchten deswegen zu kontrollieren, was in den Film hinein dürfte und was nicht. Neben der Anstrengung des Hof-Aufbaus produzierten wir mit unserer Anwesenheit als Filmteam zusätzlichen Streß. Außerdem bereitete unsere Kamerafrau aus der DDR, Julia Kunert, ihnen Mühe, offen zu ihren Meinungen zu stehen. Uns schubsten sie dafür mehr als einmal, damit wir unsere ,Berührungsängste’ mit den Einheimischen überwanden.”
“Es lohnt sich heute mehr, nach Osten zu ziehen, als nach Kanada”, so der vollständige Gedanke von Anne, geht es auch um ihre immer noch unklare Rolle zwischen Haushalt, Kindern, Buchhaltung, Vermarktungsaktivitäten und ihrem Anspruch, Mit- Chefin auf dem Hof zu sein. Wilhelms Rolle als Chef ist vergleichsweise einfacher gestrickt, aber auch er – von antiautoritärem Gedankengut angekränkelt und bemüht, kein Besserwessi zu sein – kann und will dabei nicht einfach auf traditionelle Verhaltensmuster zurückgreifen. – Selbst wenn das bisweilen der eine oder andere Mitarbeiter verlangt, der eher autoritär gestrickte LPG-Kader gewohnt war, die zudem quasi wissenschaftlich in “Menschenführung” ausgebildet wurden und ihre Anforderungen stets mit dem “Weltfrieden” begründen konnten. Dafür gab es “früher” keine Entlassungen, selbst bei exzessivstem Alkoholkonsum nicht, wohl aber jetzt – bei dem neuen Gutsherrn, der nicht nur von staatlichen und marktwirtschaftlichen Strukturen abhängig ist, sondern sich auch noch mit den Zwängen der europäischen Agrarförderung auseinandersetzen muß. Erst lief der Film in Berlin und dann auch im Dorf Strellin – er fand dort viel anerkennende Worte. Wir fragen seitdem die Filmemacher immer mal wieder: Wie geht es Anne und Wilhelm? “Gut, sie haben die Anfangsschwierigkeiten überwunden…Und ihre Kuhherde vergrößert, dazu haben sie einen neuen Großstall gebaut.“
Die Süddeutsche Zeitung bezeichnete solche Ställe bereits als „Zeichen für einen gewaltigen Strukturwandel“, denn diese „riesigen Laufställe“ werden nicht mehr an einen Hof, sondern freistehend auf der Grünen Wiese gebaut – ähnlich wie Supermärkte, Logistikzentren und Fertigungsstätte.
In Bayern werden sie laut SZ noch als „futuristische Fremdkörper“ in der Landschaft wahrgenommen. Dort hat man auch bedeutend weniger Windkraftanlagen genehmigt. Das Bauernehepaar Kaspar und Regina Raßhofer hat sich deswegen etwas einfallen lassen – und einen renommierten Architekten für den Stallbau beauftragt, woraufhin das Objekt prompt Eingang in das „Deutsche Architektur Jahrbuch 1909/1910“ fand. Der neue Laufstall soll sehr viel mehr „Kuhkomfort“ als die alten „Anbindeställe bieten. Laufställe führte einst der Bauernsohn Chruschtschow ein, als er Generalsekretär des ZK der KPDSU wurde. In der DDR hießen sie dann „Offenställe“, weil sie nach einer Seite hin offen war. In der LPG, in der ich arbeitete, waren die Offenställe die besten – der Tierarzt mußte bei den Rindern in diesen Ställen so gut wie nie aktiv werden. Für Biomilch-Bauern ist der Laufstall demnächst gesetzlich vorgeschrieben. Auf der Grünen Woche führte der Bauernverband 2010 einen modernen Offenstall – mit Melkroboter – vor. In Bayern wird der Bau solcher Ställe – auf der Grünen Wiese – staatlich gefördert, seit 2006 entstanden dort bereits fast 1000 neue Laufställe. „Kathedralen für mehr Milch“ nennt die SZ sie. In ihnen drücke sich der „Trend zu immer größeren Betrieben“ aus, wobei das Bestreben nach „artgerechter Haltung“ mit dem Erhalt „bäuerlicher Kleinbetriebe“ in Widerspruch gerate, am Ende obsiege ein „Kapitalismus mit tierfreundlichem Antlitz“. Die Single-Point-Bewegung der Tierschützer mag es freuen.
Auch noch nicht richtig wahrgenommen hat man eine Rinderkrankheit namens Botulismus. In der Berliner Zeitung berichtete Katja Tichomirowa am 30.7.2012 darüber: Krankes Vieh, Kranke Bauern
„Verdrängte Gefahr im Futter: Ein Bakterium, das chronischen Botulismus verursacht, kann ganze Rinderherden dahinraffen. Es gefährdet auch die menschliche Gesundheit.
Klaus Wohldmanns Geschichte begann auf einer überschwemmten Wiese bei Baumgarten in Mecklenburg. Im Februar 2002 trat die Warnow über die Ufer und überschwemmte die Niederungen beidseits des Flusses, Wiesen, die Klaus Wohldmann zur Futtergewinnung für seine Rinder dienten. Erst im Mai zog sich das Wasser zurück und die Silage, das Futter für die Rinder auf dem Hof, wurde geerntet. Die Qualität war schlecht, das hatte die Kontrolle der Landwirtschaftlichen Untersuchungs- und Forschungsanstalt LUFA ergeben, aber die Silage war nicht unbrauchbar. Als Wohldmann im August mit der Verfütterung begann, wurden seine Rinder krank.
Es gab Totgeburten, die Kälber hatten Durchfall, die Rinder bewegten sich nur noch zögerlich, wurden immer schwächer und konnten sich schließlich nicht mehr aufrichten. „Es war ein elendes Bild“, sagt Wohldmann. Der Hoftierarzt war ratlos. Es wurde ein Termin mit dem Rindergesundheitsdienst der Tierseuchenkasse vereinbart. Zu diesem Zeitpunkt war bereits die Hälfte des Viehbestands erkrankt.
Trotzdem hätte man ihnen noch helfen können, sagt Wohldmann, wenn die Amtstierärzte die richtigen Schlüsse aus den Befunden gezogen hätten, die das Göttinger Clostridien Center (GCC) erstellt hatte: eine hochgradige Belastung des Betriebs mit Chlostridium Botulinum. Das Nervengift, dass dieses Bakterium ausscheidet, Botulinum-Toxin, kennt man seit Langem. Der akute Botulismus ist eine auch für den Menschen lebensbedrohliche Vergiftung, ausgelöst durch verdorbene Lebensmittel, in denen sich Botulinum-Toxin gebildet hat.
In der Landwirtschaft stehen Futtersilos und Biogasanlagen unter Verdacht, Botulinum-Brutstätten zu sein. Auf dem Hof von Klaus Wohldmann tötete das Gift langsam – die Kühe, die Katzen, den Hund. Bald zeigten sich auch bei Wohldmann ähnliche Symptome wie bei seinen Tieren. Er wurde schwächer. Schließlich erkrankte die Familie. Seine Frau, die zur Zeit des Ausbruchs der Krankheit auf dem Hof hochschwanger war, brachte ein schwer körperlich und geistig behindertes Kind zur Welt. Derweil stritten die Sachverständigen weiter über die Ursachen. Die Tierärztin vom Rindergesundheitsdienst in Rostock diagnostizierte chronischen Botulismus. Die Amtstierärztin aber wollte davon nichts wissen. Und in ihrem Unglauben, dass es sich bei den Krankheitsfällen auf dem Wohldmann-Hof um chronischen Botulismus handeln könnte, sah sich die Amtstierärztin einig mit so ziemlich allen zuständigen Behörden. Man kennt das Phänomen, will aber nicht von einem Krankheitsbild sprechen.
Inzwischen sind oder waren laut Schätzungen über 2000 Betriebe in Deutschland von chronischem Botulismus betroffen. Auf der einschlägigen Seite des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR) findet sich der Hinweis, es werde seit einiger Zeit von einem chronisch verlaufenden Krankheitsbild in Rinderbeständen berichtet, „das einige Experten als spezielle Form des Botulismus ansehen und als (chronischen) visceralen Botulismus bezeichnen“. Eine Ansteckungsmöglichkeit für den Menschen werde diskutiert. Das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz erklärt dagegen, der wissenschaftliche Nachweis, dass es diese Krankheit überhaupt gibt, sei nicht erbracht. Chronischer Botulismus ist für das Ministerium bislang nur „eine Hypothese“.
Für Klaus Wohldmann und viele andere Bauern, die von der Krankheit betroffen waren oder sind, hat das erhebliche Konsequenzen. Man hält ihnen vor, die Erkrankung ihres Viehs sei auf mangelhafte Tierhaltung zurückzuführen. Sie seien mithin selbst schuld. Und man verweigert ihnen Hilfe. Die Tiere könnten geimpft werden, was in Deutschland aber nur in Ausnahmefällen und auf Anordnung des Amtstierarztes geschehen darf. Dem Bundesministerium fehlen die „fachlichen und rechtlichen Kriterien zur Einführung einer Anzeige und Meldepflicht für chronischen Botulismus“.
Als Tierseuche ist die Krankheit nicht anerkannt. So will auch die Tierseuchenkasse keine Entschädigung zahlen. Auch bei Wohldmann war das der Fall. Die Tierseuchenkasse lehnte eine Ausgleichszahlung im November 2003 ab. Seine private Versicherung sah sich nicht zuständig. Diverse Tierärzte, die Landwirtschaftsbehörde, der Bauernverband, das Ministerium – alle sind sich einig, dass es die Krankheit, an der Wohldmann, seine Familie und seine Rinder litten, nicht gibt. Die Familie kapitulierte 2005. Sie verließ den Hof, ohne ein Möbelstück mitzunehmen. „Ich habe alles verbrannt“, sagt Wohldmann. Geblieben sind 250.000 Euro Steuerschulden.“
2012 wurde das Tierschutzgesetz novelliert – auf den neuesten Stand (der Erkenntnis und der Einflüsse auf die „Gesetzgeber“) gebracht.
Danach ist es fortan den Zirkusunternehmen aus Gründen der „artgerechten Haltung“ verboten, Wildtiere zu halten und zu dressieren. Zwar galten die von Zirkusunternehmen präsentierten Dressurakte immer als der Immobilisierung der Tiere in Zoos überlegen, so wie man auch Strafgefangene zu ihrem eigenen Besten mit leichter Arbeit beschäftigt, aber – wie die Süddeutsche Zeitung erklärte: “Je genauer man die Zirkustiere wissenschaftlich beobachtete, desto unvermeidlicher traten alle ihre Leiden hervor.” Das Zirkuswildtier-Verbot geschah jedoch laut SZ-Rezensent allein wegen “unseres guten Gewissens” – nicht aus “Sorge um die Tiere”, geschweige denn um die Zirkusbetreiber und Dompteure.
Verboten ist fürderhin auch das Kastrieren männlicher Ferkel ohne Betäubung sowie eine Enthornung von Rindern ohne Betäubung, dies ist nur noch in den ersten sechs Lebenswochen des Kalbes zulässig. „Doch diese Vorgabe beruht auf der – mittlerweile als falsch eingeschätzten Annahme –, dass junge Tiere keinen Schmerz empfinden. Dem ist aber nachgewiesenermaßen nicht so. Das Kalb äußert seinen Schmerz durch Drücken des Kopfes gegen die Wand oder Schlagen mit den Hinterbeinen,“ heißt es im Forum „tiergesundheit-aktuell.de“.
Deshalb diskutieren die Experten derzeit über eine Verschärfung des Tierschutzgesetzes beim Enthornen des Rindes. In den Niederlanden oder in der Schweiz wird schon lange nur noch mit Betäubung bzw. Schmerzausschaltung enthornt. Als Möglichkeit zur Schmerzausschaltung bieten sich verschiedene Methoden an, z.B. die Anästhesie des Nervs, an dem die Hornanlage liegt, und/oder ein schmerzstillendes Medikament.
Eine biologische und tierfreundliche Alternative ist die Zucht auf Hornlosigkeit. Da das Gen Hornlosigkeit dominant ist über das Gen Hörner, haben alle Nachkommen aus der Anpaarung reinerbig hornloser Bullen mit gehörnten Kühen keine Hörner.“
Die Hörner sind beim Rind notwendig zur Herstellung der Rangordnung in der Herde, ihre Entfernung „ist aber notwendig, um schwere Verletzungen bei Tieren und Tierhaltern durch Hornstöße zu vermeiden,“ schreibt die FAZ. Weiter heißt es dort:
„Notwendig wurde das Enthornen vor allem, seitdem immer mehr Kühe in Laufställen gehalten werden. Gegenüber Anbindeställen, in denen Tiere an einem Platz fixiert werden, lassen sich Laufställe effizienter managen und ermöglichen den Tieren ein artgerechteres Verhalten. Doch gerade die natürlichen Verhaltensweisen sind im Laufstall auch ein Problem, denn zu ihnen gehören Rangkämpfe, bei denen – wenn vorhanden – auch die Hörner eingesetzt werden. Unter natürlichen Bedingungen verschafft sich eine ranghöhere behornte Kuh meist bereits durch drohende Gesten Respekt. In den modernen Laufställen können sich die Tiere aber nicht so weit aus dem Weg gehen, wie es nötig wäre, um nicht doch den einen oder anderen Stoß abzukriegen.“

Tiertransporte:
Rinder werden zu Lande, zu Wasser und in der Luft transportiert. In Friesland werden schon seit Jahrhunderten Rinder auf Schiffen ins Ausland verbracht – bis nach Südamerika und Südafrika. Rinderpfleger zur See war dort quasi ein normaler Beruf. In Westfriesland erinnert auf dem Viehmarkt von Lieuwarden noch ein Kuhdenkmal – Us Mem (Unsere Mutter) genannt – an die wirtschaftliche Bedeutung der Rinder für diese Küstenregion. Die nordfriesischen Rinder wurden im Schiff – nach Hamburg, aber auch nach England – dicht nebeneinander im Laderaum verstaut, damit sie bei rauer See nicht umfielen. Und damit sie sich nicht hinlegten, wurden unter ihren Bäuchen Balken befestigt. Die Bauern in den alten durch Eindeichung gewonnenen Kögen nennt man in Nordfriesland „Gräser“: Sie kaufen Jungvieh, mästen es auf den Marschweiden und verkaufen es dann. Es ist eine spekulative Landwirtschaft: abhängig von den Fleischpreisen, die von vielen intervenierenden Variablen beeinflußt werden – bis die Tiere „so weit“ sind. Heute werden sie mehr und mehr per Bahn oder LKW transportiert. Allein auf „unseren Straßen“ sind jährlich vier Millionen Rinder unterwegs. Bei den Rindertransporten auf Schiffen machten in den letzten Jahren vor allem die Australier und Neuseeländer von sich reden, indem ihre Viehhändler sich riesiger Spezialschiffe – sogenannte „Livestock Carriers“ – bedienten, mit denen sie bis zu 40.000 Schafe oder 16.000 Rinder auf einmal transportieren – in den Nahen und Mittleren Osten zumeist.
Das riesige Tiertransportschiff – „MV Becrux“ – war Gegenstand eines Arte-Films, nachdem der Spiegel 2008 einen Bericht über ihre Jungfernfahrt vom australischen Hafen Portland nach Saudi-Arabien – „Seeweg zum Schlachthof“ betitelt – veröffentlicht hatte: „Es ist der zwanzigste Tag ihrer Jungfernfahrt, als die Geschehnisse an Bord außer Kontrolle geraten. In den vergangenen zwei Tagen sind mehr als 150 Rinder an Hitzestress verendet. Die extreme Witterung ist für das Massensterben verantwortlich, gegen 40 Grad Hitze und 90 Prozent Luftfeuchtigkeit kommen auch die Ventilatoren nicht an. Stündlich sterben vier bis fünf Tiere. Die MV „Becrux“ verwandelt sich in ein Leichenschiff. Der Kapitän kann nur befehlen, die toten Tiere über Bord zu schmeißen. Die Tragödie auf der MV „Becrux“ blieb kein Einzelfall. Zehntausende Rinder und Schafe verendeten zwischen Mitte 2002 und Ende 2003 auf ihrem Weg von Australien in den Mittleren Osten. Vor allem die Odyssee der ‚Cormo Express‘ im Sommer 2003 erregte weltweit öffentlichen Protest. Mehr als zwei Monate lang kreuzte das Schiff mit fast 58.000 Schafen an Bord im Arabischen und im Roten Meer…Bei einem Transport von 80.000 Schafen sterben im Schnitt 720 Tiere an Bord. Wenn dann an Bord die Ventilation der Ladedecks ausfällt, ist das Massensterben auch mit einem Tierarzt an Bord nicht mehr aufzuhalten. So geschehen auf der MV „Corriedale Express“ im Golf von Oman. Mehr als 6000 Schafe erstickten qualvoll.“
Auf den großen Schlachtviehcarrier – z.B. der niederländischen Reederei Vroon – sind auch Schafe und Rinder aus Argentinien, Frankreich und den USA in Massen auf den Weltmeeren unterwegs. Immerhin strich die EU-Kommission 2005 die bis dahin gezahlten Exportsubventionen für lebende Schlachtrinder ersatzlos. Der Viehexport aus der EU in den Mittleren Osten brach daraufhin fast völlig zusammen. Laut Spiegel verschiffte „Deutschland“ jährlich rund 100.000 Schlachtrinder allein in den Libanon: „Begonnen hatte dieser Boom vor mehr als 20 Jahren.“ Nach dem „Zusammenbruch des Sozialismus“ wurde die Ausfuhr von Schlachtrindern zu einem Milliardengeschäft. „Fleischbarone wie Willi März und Alexander Moksel verfrachteten damals Vieh aus den niedergehenden LPGs und Kolchosen Osteuropas vor allem in den Mittleren Osten, nach Marokko, Algerien, Libyen, in den Libanon und in die Türkei. Für den Transport suchten sie sich Generalunternehmer, die die komplette logistische Kette organisierten – vom mecklenburgischen Genossenschaftsbauern bis zum türkischen Schlachthof.“ Ein Spiegel-Informant „erinnert sich, dass im Hafen von Triest verletzte Rinder manchmal mit dem Kran aufs Schiff geladen wurden. Die Europäische Union zahlte Exportsubventionen nur für Tiere, die das Territorium der Gemeinschaft lebend verließen.“
Der Tierbuchautor und Tierfilmer Horst Stern erzählte 1997 in einem Interview, dass er bereits vor langer Zeit im Fernsehen gezeigt habe, „wie man Kühe, die schon halb tot sind, von den Transportwagen herunterzieht. Heute sind das wieder Neuigkeiten. Ich war kürzlich in Berlin, da wurde ein Film gezeigt und mit der Goldenen Kamera geehrt, ein Film über Tiertransporte. Das hab ich vor 20 Jahren gezeigt. Und heute wird das wieder so gefeiert, als sei es etwas völlig Neues…Also kurzum, ich hatte die Sauereien eigentlich schon vorgeführt.“ Heute, wieder fast 20 Jahre später, sind Tiertransporte erneut für Schlagzeilen gut.
In den letzten Jahren sind vor allem Rinder- und Kälbertransporte mit LKW der Tierquälerei beschuldigt worden. Dazu werden laufend neue „Tiertransport-Erlasse“ verabschiedet und Tierschutzorganisationen – wie der Verein „RespekTiere“ machen Kontrollen u.a. an Grenzübergängen, wo die Transporte mitunter tagelang in glühender Hitze auf ihre Abfertigung durch den Zoll warten müssen. Grad dokumentierten Tierschützer auf Youtube „Bullentransporte in die Türkei“, die nach wie vor unter Mißachtung der europäischen Tierschutzkonvention geschehen.
Im Internetforum „Tiergesundheit aktuell“ findet sich eine Meldung über eine 2008 gefundene politische „Lösung für Kälberexporte nach Italien“: „Danach können ab sofort unter 90 Tage alte Kälber, die von geimpften Muttertieren stammen oder natürlich immunisiert sind, auch von sogenannten Sammelstellen nach Italien verbracht werden. Nach abgeschlossener Impfung der Muttertiere steht dem Kälberexport damit nichts mehr im Wege. Unter Berücksichtigung der Doppelimpfung bei Rindern mit einem Intervall von 3 bis 4 Wochen und 23 bis 25 Tage bis zum Erreichen des Impfschutzes dürfte der Kälberexport nach Italien damit bald wieder reibungslos laufen.“ Italien hatte auf Grund der Blauzungenkrankheit die Einfuhr von deutschen Kälbern mit hohen Restriktionen belegt, die den Export dieser Tiere nach Italien nahezu zum Erliegen brachten. „Von den Beschränkungen besonders betroffen waren Bayern und das Allgäu. Italien ist eine bedeutende Zielregion für den deutschen Kälberexport. Allein aus Bayern werden pro Jahr circa 35.000 Milchkälber nach Italien geliefert.“
Eine diesbezügliche Tierschutzaktion hört sich auf der Internetseite der österreichischen „tier-wege“ so an: „Am Montag sichteten TierschützerInnen einen Kälbertransporter in Fahrtrichtung Italien. Sofort verständigten wir die Polizei, denn dieser Lkw war uns bereits bei zwei Kontrollen im November und Dezember mit schweren Missständen aufgefallen. Zwei Polizisten stoppten den Tiertransporter schließlich bei der Raststation Kaiserwald…Die Tiere waren augenscheinlich extrem lange nicht versorgt worden. Drei Kälber konnten nur noch im Transporter liegen – sie waren zu schwach um aufzustehen. Es hatte den Anschein, sie standen kurz vor ihrem Ende, denn sie atmeten nur noch schwer. Insgesamt 240 Kälber waren auf drei Etagen verladen, wobei das mittlere Deck viel zu niedrig für die Tiere war, denn der Rücken der Kälber stand oben an der Decke an, sodass die Tiere nicht einmal den Kopf heben konnten.“
Wir streicheln und wir essen sie,“ überschrieb die Süddeutsche Zeitung eine Rezension des gleichnamigen Buches von Hal Herzog, der darin „unser paradoxes Verhältnis zu Tieren“ thematisierte. Der US-Autor hat das „Paradox“ auf angloamerikanisch-pragmatische Weise für sich so gelöst: „Ich habe folgende Regel,“ sagt er, „Wenn ich draußen bin und von einer Bremse gestochen werde, darf ich sie totschlagen. Aber wenn die Bremse zu mir ins Haus fliegt, muß ich sie retten und nach draußen bringen.“ Herzog hat damit bloß die frühorientalische Blutrache zusammen mit der dortigen Gastfreundschaft verbunden und auf Tiere übertragen.
Neuerdings haben zwei kanadische Kulturpsychologen, Matthew Ruby und Steven Heine, untersucht, was es mit dem „Gesicht“ der Tiere, die wir töten, auf sich hat.
Dabei fanden sie laut FAZ vor allem Nützliches für die „Strategen von Tierschutzverbänden“ heraus: Nach Befragung von jeweils über 60 Kanadiern, Amerikanern, Hong-Kong-Chinesen und Indern, welches Tier sie essen würden und welches nicht, kam heraus: „Die Menschen scheint die Frage, ob sie andere intelligente Lebewesen essen, am meisten zu beschäftigen.“
Daneben spielte auch ein niedliches Gesicht bei Tieren eine Rolle, wobei jedoch die Auswahl der Tiere als Lebensmittel bei den eher kollektiv denkenden Indern und Chinesen mehr von ihrer jeweiligen Peer-Group beeinflußt wurde als bei den individualistischeren Amerikanern und Kanadiern. Zuvor hatten die beiden Kulturpsychologen eine Studie veröffentlicht, mit der sie belegten, dass Frauen, denen man unterschiedliche Dating-Profile vorlegte, Männer, die Vegetarier waren, als weniger maskulin einschätzten. In Deutschland und Israel leben inzwischen knapp 9 Prozent und in Indien 40 Prozent der Bevölkerung vegetarisch.
Auf dem taz-Kongreß 2012 „Das gute Leben“ gab es einen Workshop, in dem es bereits um diese Fragen ging. Die in der Lüneburger Heide lebende Schafzüchterin und Tierschützerin Hilal Sezgin behauptete dort, sie würde keine Tiere essen, nur Pflanzen, weil die kein „Gefühl“ hätten. Sie bekam heftige Kritik aus dem Publikum für dieses Abtun der Flora als gefühllos. Das entspräche schon lange nicht mehr dem Forschungsstand, wie u.a. ein sowjetischer Laborfilm bewies, der zur gleichen Zeit wie der Workshop im Haus der Kulturen der Welt gezeigt wurde. Eine eher vermittelnde Position nahm dort der Schweizer Tierrechtsexperte Antoine F.Goetschel ein. Der Autor des Buches „Tiere klagen an“ meinte, er sähe das alles nicht so eng, so würde er z.B. nach wie vor Lederschuhe tragen, jedoch nur gute – solche, die mindestens 15 Jahre halten. Auf dieses reduktionistische Qualitätsargument verfallen derzeit auch viele Autoren, die der Tierschutzgedanke bis zu einem persönlichen Vegetarismus und darüberhinaus treibt.
Zum Beispiel Karen Duves, die 2010 ein vielbesprochenes Buch über das Essen veröffentlichte. Zu jeder Rezension wurde ein Photo der Autorin mit einem Huhn auf dem Arm abgedruckt. Die Hamburgerin wohnt in Brandenburg auf dem Land. Sie ist Veganerin und als Tierschützerin mit der Kamera unterwegs, ihr Buch heißt “Anständig essen” und folgt auf das Buch “Tiere essen” von Jonathan Foer, mit dem zusammen Karen Duve dann einige Lesungen bestritt. “Anständig essen” ist quasi das Buch zum Film “Dioxin-Skandal” – und das auch noch rechtzeitig zur “bisher größten” Lebensmittel-Demonstration anläßlich der Grünen Woche 2010. Die Autorin berichtet darin über die Schandtaten der Agrarindustrie und ihre eigenen Essensexperimente: Sie ernährte sich biologisch, vegetarisch, vegan und frutarisch (für die Frutarier ist sogar das Ausreißen einer noch lebenden Mohrrübe Mord.
Das Huhn auf dem Arm der Autorin hat einen Namen: Rudi. Der Berliner Zeitung verriet sie, dass es einer “Befreiungsaktion” aus der überbelegten Halle eines Biohofs entstammt. Und das ihr, indem sie das Essen mit Moral verband, jeder “Hackbraten zu Quälfleisch” wurde.
Ähnlich radikal – jedoch in bezug auf Pflanzen – denken die Wissenschaftler im Berliner Botanischen Garten: Als ich dort einen ihrer Sprecher interviewte, fragte ich zwischendurch, ob ich rauchen dürfe, was mir erlaubt wurde. Als ich daraufhin meinem Gesprächspartner auch eine Zigarette anbot, lehnte er jedoch heftig ab – mit der Begründung: „Nein, also Pflanzen verbrennen, das kann ich nicht, können wir hier alle nicht.“
Ein solche florafreundliche Einstellung dürfte selbst in der beim Pflanzenschutz vorne liegenden Schweiz selten sein. Wobei die Berliner Botaniker in ihrer Ernährungsnot wahrscheinlich gnadenlose Tieresser sind: „Fleisch ist mein Gemüse“, könnten sie auch sagen. Es mehren sich derzeit vor allem Bücher und Pamphlete, die das Problem „Tiere aufessen oder streicheln“, wie der Workshop auf dem taz-Kongreß hieß, thematisieren. Erwähnt seien außer den bereits genannten: „Fleisch essen,. Tiere lieben. Wo Vegetarier sich irren und was Fleischesser besser machen können“ von Theresa Bäuerlein sowie „Wir haben es satt! Warum Tiere keine Lebensmittel sind“ von Iris Radisch und Eberhard Rathgeb. Iris Radisch ist Redakteurin der „Zeit“, in der sie regelmäßig über die Fortschritte der Vegetarierbewegung berichtet. Schließlich sei noch das Buch „Der Verrat des Menschen an den Tieren“ von Helmut F. Kaplan erwähnt. All diese Autoren sind mehr oder weniger auch tierschützerisch aktiv. Ihnen kommt von anderer Seite ein hierzulande neuer Zweig der Kulturwissenschaft entgegen: Die „Animal-Studies“. Auch in diesem aus Amerika über uns gekommenen Forschungsbereich geht es den Wissenschaftlern nicht zuletzt um aktiven Tierschutz.
Dazu sei hier schließlich noch Nietzsche zitiert, der sich um die Verrinderung der Menschen sorgte, jedoch meinte,
“der Fortschritt in Richtung Kuh ist noch aufzuhalten. Und zwar dadurch, dass man den Versuch unternimmt, die Kuh…den echten menschlichen Idealen anzupassen”.
Im Zarathustra-Konvolut heißt es:
„So wir nicht umkehren und werden wie die Kühe, so kommen wir nicht in das Himmelreich. Wir sollten ihnen nämlich eins ablernen: das Wiederkäuen.
Und wahrlich, wenn der Mensch auch die ganze Welt gewönne und lernte das eine nicht, das Wiederkäuen: was hülfe es! Er würde nicht seine Trübsal los. Also sprach der Berg-Prediger und wandte dann seinen eignen Blick Zarathustra zu – denn bisher hing er mit Liebe an den Kühen.“
In der Vorrede zur Genealogie der Moral schreibt Nietzsche:
„…um dergestalt das Lesen als Kunst zu üben, eins vor allem not, was heutzutage gerade am besten verlernt worden ist – und darum hat es noch Zeit bis zur »Lesbarkeit« meiner Schriften –, zu dem man beinahe Kuh und jedenfalls nicht »moderner Mensch« sein muß: das Wiederkäuen.“
„Alle guten Dinge haben etwas Lässiges und liegen wie Kühe auf der Wiese.“ (Friedrich Nietzsche, II, Aph. 107)
Gender-Grill
Es sind immer die Männer, die sich in Open-Air um das Grill-Fleisch kümmern, während die Mehrzahl der Frauen lieber privat und unbeobachtet in der Küche wurschtelt. Zudem liegen sie bei der Reduzierung des Fleischkonsums weit vorne. Die Vorkämpfer für den Vegetarismus zwecks Weltrettung sind: Zeit-Redakteurin Iris Radisch, Bestsellerautorin Karen Duve („Anständig Essen“) und die taz-Kolumnistin Hilal Sezgin. Der Tagesspiegel ermittelte bereits ihre Breitenwirkung: „Während die meisten Mädchen bei Unter 18 durchaus über Ethik beim Essen nachdenken, gaben die Jungen ein klares Votum für Fleisch ab.“
Die Mädels sind dabei aber auch doppelt und dreifach motiviert: Erstens sieht es schick und supermodern aus, wenn sie in knappsten Hotpants zu fünft an einem Runden Tisch Platz nehmen und in ihren rotgrünen Salattellern rumstochern, wobei sie die Gabeln charmant mit abgespreiztem Finger fassen. Zweitens erhalten sie sich dadurch ihre Kinderfigur, die sie mit einer Ganzkörperrasur noch betonen – und einem klitzkleinen Intim-Tattoo krönen. Und Drittens haben sie so immer wieder ein gemeinsames Thema: Gesundheit, Nichtrauchen, Yogging und Joga, Kalorien und Biofood. „Um die Welt zu verbessern, muß jeder bei sich selbst anfangen“ und „Du bist, was du isst!“
Dieser ganze Schwachsinn nennt sich „Ethikdebatte“. Junge Männer mischen darin höchstens mit Provopamphleten à la „Fleisch ist mein Gemüse!“ mit. Wenn die Berliner Journaille sich dieses heißen „Diskurses“ annimmt, dann hat sie noch jedesmal die Warteschlange vor der Wurstbude am Mehringdamm „Curry 36“ mit der am „Gemüse-Kebab“-Stand gleich daneben verglichen: Hier junge sportlich aussehende Pflanzenvertilger meist weiblichen Geschlechts – mit gutem Abitur, dort ebenso dickbäuchige wie bräsige Ekelfleisch-Vernichter, meist männlichen Geschlechts – mit höchstens Mittlerer Reife. Und während diese die Scheiße im Stehen stumm und geradezu verbissen in sich reinschaufeln, setzen sich jene auf ein Mäuerchen neben dem Vegan-Imbiß und reden miteinander oder kontrollieren ihr Smartphone, während sie wie nebenbei und äußerst graziös kleine Gemüsestücke zwischen ihre süßen Lippen schieben. Man sieht gar nicht, wie sie kauen, noch weniger, wie sie verdauen. Tun sie das überhaupt oder rückverwandelt sich das florale Chlorophyll bei ihnen etwa schon auf der Höhe ihres Herzens zu nahrhaftem Sonnenlicht (Solarenergie)? In bunten Sommerkleidchen sehen sie bereits alle aus wie Blumen.
Der Philosoph Jean-Francois Lyotard meinte nach einem Besuch des Weltzentrums für Öko-, Bio-, Buddha- und Body-Kunst Kalifornien: „Das Weiß der Frau-Haut ist [dort] das Licht!“ Soll heißen: Die schlanke, sportliche, sonnengebräunte Jungkalifornierin – das ist nun der amerikanische Traum – topaktuell. Und gilt also jetzt auch hierzulande – nur noch unerbittlicher. Dazu gehört auch, was zwei kanadische Kulturwissenschaftler, Matthew Ruby und Steven Heine, in einer empirischen Studie herausfanden: dass Frauen, denen man unterschiedliche Dating-Profile vorlegte, Männer, die Vegetarier waren, als weniger maskulin einschätzten“ – sie mithin als potente Liebhaber und potentielle Väter für ihre Kinder eher ablehnten. Die weibliche „Ethik“ umfaßt also auch noch dies: dass sie – als sich „bewußt gesund ernährende Frauen“ – fleischfressende und muskeltrainierende Kindsköpfe bevorzugen, denen sie dann jedoch ab dem dritten Tag beides abgewöhnen – am Liebsten mühsam und mit großer Geduld. Ebenso wie sie ihnen das nahezu tägliche Wechseln der Unterhosen und Socken beibringen. Weil das alles für die Ernsthaftigkeit ihres Beziehungsanliegens spricht.
Aber es kommt noch dümmer und dicker, kaum hat dieses junge weibliche Gemüse die 30 überschritten und nennt sich kokett „U40“, kleidet es sich zügig sackartiger – in Läden für „Übergrößen“ – ein, wo man die Klamotten als „bequem und extraweit“ bezeichnet. Und statt in Salattellern zu stochern, sitzen sie nun gerne in sogenannten Müttercafés, wo sie Biokuchen mit Sahne in sich reinstopfen und dazu Kaffee mit Sojamilch trinken. Wobei sie wie ihre Großmütter, Gott hab sie selig, ständig beteuern: „Nur noch einen kleinen Schluck!“ Dabei dämmert es ihnen, dass diese ganze Bauchpflegerei für die Katz war. Innen wie außen. Nun gehen sie aufs Ganze. Am Mehringdamm, bis wohin sich die sogenannten „Futonficker vom Südstern“ (siehe taz v. 10.10.1997) inzwischen ausgebreitet haben, eröffneten 2012 zwei Frauen, Anne Bonnie und Sara Rodenhizer, einen öko-feministischen Sexshop, in dem sie u.a. „vegane Peitschen“ verkaufen. Das ist schon man mal hart an der Grenze des Zumutbaren – für Männer, die durchaus erziehungswillig sind, vollends zu weit gegangen ist nun aber Heike Kügler-Anger mit ihrem Rezeptbuch: „Vegan Grillen“.


SZ vom 21.6.2012:
Vor 7000 Jahren malte ein unbekannter Künstler im Wadi Imha in der libyschen Wüste grazile Rinder an eine Felswand, die auf eine frühe Agrarwirtschaft hindeuten. Doch erst jetzt gelang britischen Forschern um die Geochemikerin Julie Dunn von der University of Bristol der Nachweis, dass die frühen Bewohner Nordafrikas auch die Milch der Kühe nutzten.
In Tonscherben aus der Takarkori-Grabung im Tadrart-Acacus-Gebirge Libyens fanden sie mithilfe der Isotopenanalyse Belege, dass die Gefäße der Verarbeitung von Milchfetten gedient haben mussten. „Wir wussten bereits, wie wichtig Molkereiprodukte wie Milch, Käse, Joghurt und Butter für die neolithischen Bewohner Europas waren“, sagt Studienautorin Dunn. „Es ist aufregend, jetzt den Beweis zu führen, dass diese Produkte auch für die prähistorischen Menschen Afrikas von Bedeutung waren.“
Die neuen Funde seien vor dem Hintergrund ökologischer Veränderungen zu sehen. So war die Sahara noch vor 10.000 Jahren feuchter und grüner gewesen, sodass die Menschen dort als Jäger und Sammler überleben konnten. Vor 7500 bis 5000 Jahren wurde die Region dann trockener, und die Bewohner nahmen einen eher nomadischen Lebensstil an, der stärker auf der Nutzung von Rindern beruhte und offenbar auch auf dem Konsum von Milchprodukten.
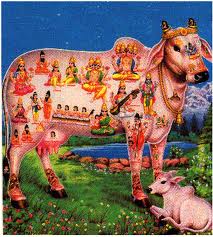
Indische Rinder:
Schätzungsweise 40% der indischen Bevölkerung von 1,3 Milliarden ernährt sich vegetarisch (in Deutschland sind es etwa 8% bei einer Bevölkerung von 82 Millionen). Auf dem indischen Subkontinent leben ca. 190 Millionen „Heilige Kühe“, die nicht geschlachtet werden dürfen: sie sind „unantastbar“ (Aghnya) – ein Nahrungstabu. „In der Geschichte Indiens war der Kuhschutz so wichtig, dass islamische Eroberer ihren Heeren oft Kühe vorantrieben, wodurch Hindus sie nicht angreifen konnten“ (Wikipedia).
Die Zeitschrift „natur“ (8/12) berichtet, dass Indien dennoch zum größten Rindfleischimporteur (noch vor Brasilien, Australien und USA) aufsteigt: „Es wird in diesem Jahr 1,3 Millionen Tonnen Rindfleisch exportieren“ – das sind 1,3 Milliarden Kilogramm („Weltrekord“ schreibt „natur“ und beruft sich dabei auf einen Report des US-Landwirtschaftsministerium). Exportiert wird jedoch nicht das Fleisch von „Heiligen Kühe“, sondern von Wasserbüffeln.
Der österreichische Sender ORF berichtete im Mai 2012 aus Indien von einem Kampf um die „Heiligen Kühe“ – als „Symbol der Unterdrückung“:
„Im vergangen Monat kam es in der südindischen Unistadt Hyderabad zu gewaltsamen Auseinandersetzungen, nachdem Hindu-Aktivisten eine Studentenparty angegriffen hatten. Es gab fünf Verletzte, zwei Autos wurden in Brand gesteckt. Aus europäischer Sicht wirkt der Grund bizarr: der Verzehr von Rindfleisch. In Indien ist dieser Konflikt aber alles andere als harmlos.
Die Auseinandersetzungen nach einer „Rindfleisch-Party“ an der Osmania-Universität mussten von der Polizei unter Einsatz von Tränengas beendet werden – und es war nicht der erste Vorfall dieser Art. Immer wieder kommt es in Indien zu Gewalttaten zwischen strenggläubigen Hindus und Dalits, die früher auch als Kaste der Unberührbaren bezeichnet wurde.
Obwohl das streng hierarchische Kastensystem offiziell schon lange der Vergangenheit angehört, werden Dalits als unterste Kaste immer noch diskriminiert. Und in ihrem Kampf um Anerkennung und mehr Rechte haben sich die Dalits ein Ziel erkoren, dass sie als Symbol ihrer Unterdrückung sehen – eben Rindfleisch. Die Kuh gilt im Hinduismus als heiliges Tier, Symbol für die Leben spendende Mutter Erde sind. Viele nennen sie auch Go Mata, Mutter Kuh. Dieser Stellenwert kommt freilich auch von pragmatischen Gründen. Die Tiere lieferten mit Milch die Grundnahrung, sie war wichtigstes Zugtier und ihr Dung Heizmaterial und Dünger.
Heute ist das freilich nur in den armen ländlichen Regionen so. Dennoch hat sich am Stellenwert der Kuh wenig geändert – im Gegenteil. In den vergangenen Jahren wurden die Regelungen zu Schutz auf Bundesstaatsebene auf Druck von nationalistischen Parteien wie der BJP verschärft. In mehreren Staaten ist das Schlachten von Kühen – genauso wie der Verkauf – mittlerweile verboten, die Strafen wurden drakonisch angehoben.
Die Brahmanen, die oberste Kaste, berufen sich auf Jahrhunderte alte Traditionen. Doch die sind mitunter ein bewusstes Konstrukt: Der Rigveda, der älteste Teil der Sammlung religiöser Schriften im Hinduismus enthalte etliche Verweise auf die Zubereitung und auch Opferung von Rindfleisch, so der indische Historiker Dwijendra Narayan Jha. Für sein 2001 erschienenes Werk „Der Mythos der heiligen Kuh“ erhielt Jha Morddrohungen, ein Verbot des Buches wurde gefordert.
Jha wies nach, dass es bis ins 19. Jahrhundert durchaus üblich für Hindus war, Rindfleisch zu essen. Es sei zwar eher verpönt gewesen, aber jedenfalls keine Sünde. Erst mit dem reformistischen Gelehrten Dayananda Saraswati wurde der Schutz der Kuh aufgewertet, allerdings eher als strategisches Werkzeug, um sich stärker vom Islam und dem Christentum abzugrenzen.
Und vor allem im Widerstand gegen die britische Kolonialherrschaft sei die Verehrung von Kühen zum einigenden Moment einer politischen Massenbewegung geworden – geleitet von den höheren Kasten, heißt es in einem Kommentar in britischen „Independent“. Vor allem Mahatma Gandhi habe gepredigt, dass das Töten einer Kuh eine Sünde ist. Gandhi hatte übrigens gegen Tee genauso angeschrieben wie gegen Rindfleisch, dort allerdings mit weniger nachhaltigem Erfolg.
Die Kritiker verweisen wiederum auf den Dalit-Politiker und einen der Begründer der indischen Verfassung, Bhimrao Ramji Ambedkar. Er sah in der traditionellen Verehrung der Kuh vor allem den Versuch, den Brahmanismus über den Buddhismus zu stellen. Als Antwort darauf konvertierte er 1956 zum Buddhismus, Hunderttausende Dalits folgten seinem Beispiel.
Eine der streitbarsten Verfechterinnen des heutigen Rindfleischgenusses ist die Dichterin, Feministin und Aktivistin Meena Kandasamy. In einem Kommentar in „Outlook India“ spricht sie von „Nahrungsfaschismus“, den es zu bekämpfen gelte. Niemand werde gezwungen, das Fleisch zu essen. „Ihre Heiligkeit Mutter Kuh ist ein Bürger erster Klasse mit Gesundheitsversicherung und Pensionsplan. Dalits, (die indigenen, Anm.) Adivasi, Muslime und Christen dürfen als Rindfleisch essende Minderheiten nicht diese Privilegien fordern.
Allerdings ist der Schutz der Kühe auch in der indischen Verfassung geregelt – wenn auch nicht aus offensichtlich religiösen Gründen. Doch nicht nur entlang von Religion und sozialer Stellung scheiden sich die Geister. In einigen Regionen Nordindiens ist der Verzehr von Rindfleisch durchaus üblich.
Und das Schlachtverbot wird teilweise sehr großzügig interpretiert: Indische Medien weisen aber darauf hin, dass die Regelung häufig schwammig ist, alte Tiere dürfen teilweise doch getötet werden. In anderen Bundesstaaten gibt es wiederum eigene Einsatztruppen zum Schutz von Kühen, in Delhi etwa werden Geschäfte genauestens kontrolliert, ob sie nicht doch Rindfleisch anbieten.
Entgegen den offiziellen Bestimmungen blüht ein enormer Schwarzhandel: Geschätzte 1,5 Millionen Kühe werden jährlich aus Indien herausgeschmuggelt, berichtet CNN. Experten meinen, dass damit 50 Prozent des im Nachbarland konsumierten Rindfleischs gestellt werden. Während Kühe heilig sind, nimmt man es bei Büffel nicht ganz so ernst. Laut indischen Regierungsangaben produziert das Land pro Jahr 1,5 Millionen Tonnen Büffelfleisch, nur ein Viertel davon wird exportiert.
Doch auch offiziell boomt das Geschäft. Laut US-Schätzungen wird das Land noch heuer die USA als weltweit drittgrößter Rindfleisch-Exporteur ablösen – wobei Büffel dabei inkludiert sind. Bei einer prognostizierten Steigerungsrate von 25 Prozent von 2011 auf 2012 könnte Indien Schätzungen zufolge bald die Spitzenreiter Argentinien und Australien ablösen. Und die Rinder, die für die wichtige Lederindustrie verwendet werden, sterben im seltensten Fall von alleine an Altersschwäche.
Bleibt schließlich auch die Tatsache, dass der Schutz der Kühe auch im Alltag zu einem immer größeren Problem geworden ist. Allein in der Hauptstadt Neu Delhi leben geschätzte 36.000 Kühe. Sie gehören oftmals zu illegalen Molkereien und werden von ihren Besitzern tagsüber freigelassen, um sich selber ihr Fressen zu suchen – das meist aus Müll besteht.
Vom Kampf ums Überleben ermüdet, lassen sich die Kühe oft mitten im chaotischen Verkehr der Millionenmetropole nieder – immer in der Gefahr, angefahren zu werden und elendig zu verenden. Gleichzeitig kommt es immer wieder zu schweren Unfällen, bei denen auch Menschen ihr Leben lassen müssen, weil die Fahrer Kühen ausweichen und dabei schwere Unfälle verursachen.“
Auf „proplanta.de“ heißt es über die „Heiligen Kühe“ Indiens:
Das Füttern einer Kuh gilt bis heute als Bestandteil der Krishna-Verehrung. Heiligkeit schützt nicht vor Arbeit Die vedischen Schriften sind die ältesten überlieferten religiösen Schriften der Menschheit und Grundlage des Hinduismus. Schon in diesen uralten Schriften wird von der Kuh als „Erfüllerin aller Wünsche“ oder einfach „Wunschkuh“ gesprochen und bereits damals waren die Gaben der Kuh besonders wertvoll. Seit jeher haben sie auch religiöse Bedeutung. Tote werden zur Verbrennung mit Butterschmalz übergossen, Opfertätigkeiten können ohne Butterschmalz und Milch nicht durchgeführt werden. Von der Kuh hängen sowohl die Opfer für die Götter als auch die für die Ahnen sowie die Erhaltung des Körpers ab. Doch die Bedeutung der heiligen Kühe beschränkt sich nicht allein auf rituelle, kultische Gesichtspunkte.
Die Kuh ist für die vegetarisch lebenden Hindus auch ökonomisch von großem Wert. Denn die Heiligkeit schützt die Tiere – sofern sie stark genug sind – nicht vor dem Einsatz als Arbeitstier. Kühe sind die größten Helfer in der indischen Landwirtschaft. Die Kraft der Tiere hilft bei der Feldbestellung und beim Transport von schweren Gegenständen. Die Gaben der Kuh werden in ganz Indien geschätzt und effizient genutzt; Butterschmalz wird auch als Lampenöl, der Dung als Brennmaterial verwendet. Die Wertschätzung, die die Hindus den traditionellen Arbeitstieren entgegenbringen, hat neben religiösen also auch ökonomische Wurzeln.
Am 5.9. 2005 berichtete der Spiegel – unter der Überschrift „Inder für Rinder“:
„Wurde BSE vom Menschen auf das Rind übertragen? Einer neuen Theorie nach sollen menschliche Leichenteile aus Indien an britische Kühe verfüttert worden sein.
In Indien werden viele Leichen verbrannt. Dass die oftmals nur halb verbrannten Leichen anschließend den Ganges hinabtreiben, war bislang nur für örtliche Umweltgruppen Grund zur Besorgnis. Nun jedoch präsentieren zwei britische Forscher eine abenteuerlich klingende Theorie, die den hinduistischen Totenkult zum Thema hiesiger Seuchenwächter machen könnte.
Wie Alan und Nancy Colchester im medizinischen Fachjournal „The Lancet“ darlegen, könnten die toten Hindus im Ganges den Rinderwahn in Europa ausgelöst haben. Menschliche Leichenteile aus Indien sollen demnach (vermischt mit Tiermehl) an britische Rinder verfüttert worden sein. Ein Teil dieses Gewebes, so die Vermutung, stammte von Indern, die an der BSEähnlichen Creutzfeldt-Jakob-Krankheit (CJK) gestorben waren – und erst die Übertragung der menschlichen Erreger führte bei Kühen zum Rinderwahn.“
Der französische Bauernsprecher José Bové machte für die BSE-Fälle bei den Rindern die Kapitalisierung der Landwirtschaft insgesamt verantwortlich: „Nur verrückte Menschen machen die Rinder wahnsinnig,“ meinte er.

Nicht nur Bakterien können partisanisch werden, wie Erwin Chargaff meinte, sondern auch die Bauern. Wie sieht es inzwischen mit deren Widerstand aus?
1996 veröffentlichte der Wiener Soziologe Roland Girtler ein Buch „Vom Untergang der bäuerlichen Kultur: Sommergetreide“. 2002 eine Studie über „Echte Bauern“, die es nur noch in einigen vergessenen Winkeln der Weltgeschichte gäbe. Gleich am Anfang heißt es, „daß sich seit der Jungsteinzeit, also seit über 5000 Jahren, als der Mensch seßhaft und zum Bauern wurde, in unseren Breiten nicht soviel geändert hat wie nach dem letzten Krieg und vor allem in den fünfziger und sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts, als bei uns die alte bäuerliche Kultur allmählich zu Ende ging.“
Girtler fand echtes Bauernleben nur noch im indischen Gujarat und im rumänischen Siebenbürgen. Über ihn und seine Agrarstudien heißt es: „Er kennt und benennt die ‚Agrarindustrie‘, die ‚Chemisierung des Brotes‘, den ‚Gigantismus‘ der Tierfabriken, die ‚Erniedrigung der Tiere‘, die brutale ‚Gewinngier‘.“ Girtler macht sich keine Illusionen: „Auch die sogenannten Bio-Bauern sind Spezialisten, die sich jedoch bemühen, einigermaßen natürlich, also ohne viel Chemie und freundlich gegenüber den Hühnern und anderem Vieh zu wirtschaften. Mit echten Bauern haben sie nicht viel zu tun.“ Dieser stellt laut Girtler „so ziemlich alles, was er zum Leben braucht, selbst her. Er übersteht Krisenzeiten wie Kriege mit Würde und Tüchtigkeit. Er widerspricht einer langweiligen, konformistischen Konsumkultur. Heute hingegen wird der Bauer dirigiert und geknechtet. Der echte Bauer war autark und auf sich bezogen. Er benötigte keine Förderungen und Ausgleichszahlungen, um überleben zu können.“ Girtlers „echter Bauer“ ist ein Archetyp – ob es ihn nun nicht mehr gibt oder doch wieder geben wird, bleibt letztlich offen. „Die Wahrheit ist uns zumutbar. Der ‚echte Bauer‘ ist eine würdige Gestalt der Trauer wie der Hoffnung“ – so ein Rezensent der Girtlerschen Feldforschung in den Dörfern dieser Welt.
Ebenfalls 1996 hatte der holländische Schriftsteller Geert Mat eine gründliche Einzelstudie über den „Untergang des Dorfes in Europa“ veröffentlicht – am Beispiel der friesischen Bauernsiedlung Jorwerd.
Einige wenige Bauern schaffen es jedoch zu überleben, indem sie sich verwandeln: in Projektemacher, schlechtbezahlte Heimarbeiter oder Agrar-Experten bzw. -Manager. Früher verschwand der Bauer vorübergehend – als Wilderer und als Partisan im Wald bzw. im Gebirge. Auch über den Wilderer verfaßte Roland Girtler mehrere Studien – zu dessen Verteidigung, denn der bäuerliche Wildschütz akzeptierte das Waffenverbot und das (herrschaftliche) Privateigentum an Wald und sonstwie unbebauten Fluren ebensowenig wie der nomadische Viehzüchter.
Eine umfangreiche Regionalstudie, in der je nach Höhenlage mehrere Typen von Wilderern unterschieden werden, veröffentlichte 2001 der Sozialforscher Norbert Schindler über das Salzburger Land: „Wilderer im Zeitalter der Französischen Revolution“. Über die Wandlung des Bauern zum Partisanen urteilt der im Zweiten Weltkrieg als Partisan in Italien tätig gewesene BBC-Programmchef Stewart Hood in seinem Bericht „Carlino“, dass nunmehr, mit dem Verschwinden der Bauern, kein Partisanenkampf mehr möglich sei.
Die Widerstandstheoretiker Marx und Engels wußten bereits, dass der kleinbäuerliche Familienbetrieb keine Zukunft habe, unweigerlich werde er Agrarkonzernen des Kapitals weichen. Die Europäische Union (damals noch EWG genannt) bremste dieses Unheil durch ihren ersten Landwirtschaftskommissar, den Ostgroninger „Herrenbauer“ Sico Mansholt, sozialdemokratisch ab: mit subventioniertem Zwang zum „Wachsen oder Weichen“.
Zwar protestierten immer mal wieder einzelne Bauernfraktionen in Brüssel: Gegen zu niedrige Milchpreise, für höhere Subventionen bei Fleischexporten etc., was in Frankreich bis zur Gründung einer radikalen Agrargewerkschaft – durch den Schafzüchter José Bové – ging. Anderswo – in Lateinamerika, wo es eine schier ununterbrochene Tradition von oft indigenen Bauern-Aufständen gibt, gründete sich die internationale „Bewegung“ der Kleinbauern und Landarbeiter „Via Campesina“, der z.B. auch die österreichische Bergbauernvereinigung angehört. In Indien, wo es schon lange einen organisierten Widerstand gegen das „Bauernlegen“ gibt – vornehmlich von autonomen Waldvölkern und den untersten Kasten, haben andererseits schon über tausend Kleinbauern, Baumwollanbauer die meisten, in den letzten Jahren Selbstmord begangen, weil sie ihren Hof aufgeben mußten.
Die Herausgeber einer Aufsatzsammlung über „Bauernwiderstand“, Michael Mann und Hans Werner Tobler, meinen, dass dieser Widerstand erst in den Siebzigerjahren in das Blickfeld der (Agrar-)forschung fiel. Zu einer Zeit mithin, in der das damals schon halb entleerte Dorf partiell wiederbelebt wurde – im Osten wie im Westen: Hier waren es arme Linke einerseits und reiche Rechte andererseits. Erstere wollten von den Bauern lernen und deren kulturelle Reste – z.B. in Landkommunen und Schäfereigenossenschaften – bewahren. Letztere wollten sie mit all ihren städtischen Errungenschaften quasi belehren. In Geert Mats beispielhaftem Friesendorf Jorwerd kam dabei schließlich heraus, dass „heute ein Projekt nach dem anderen konzipiert wird – ausgereift und unausgegoren, brauchbar und wahnwitzig, alles durcheinander. Feriendörfer, Yachthafen, Transrapid – es wimmelt von Masterplänen“.Aus Jorwerd wurde so ein „Global Village“.
Aus Bischofferode, dem 1993 durch seinen langen Arbeitskampf berühmt gewordenen Bergarbeiterdorf, berichtet dagegen die Pastorin Christine Haas, „daß jetzt nach der Niederlage so viel rückwärtsgewandtes Zeug im Eichsfeld passiert: Schützenvereinsgründungen, Traditionsumzüge und sogar Fahnenweihen. Zum Glück hat man so etwas noch nicht an mich herangetragen.“
Der englische Schriftsteller John Berger kam in den Achtzigerjahren in seiner Trilogie „Von ihrer Hände Arbeit“ über Bauern trotz aller Bauernaufstände in der Geschichte zu dem Ergebnis: Während für den Stadtbürger die Zukunft immer mehr Möglichkeiten eröffnet, ist es für den Bauern auf dem Land die Vergangenheit, die leuchtet.
Früher reichten einer Familie fünf Kühe, sie durften ihre Schafe selber schlachten, aus der Stadt zugezogene Nachbarn konnten ihnen noch nicht den „stinkenden“ Misthaufen hinterm Haus verbieten, ebensowenig, dass die Kühe beim Gang von und zur Weide jedesmal die Dorfstraße vollschissen…
Die Bauern sind sukzessive in ihren Dörfern zu einer kleinen Minderheit geworden, in vielen Dörfern gibt es gar keine mehr. Zudem sind inzwischen tausende von Dörfer in Ost und West verschwunden – und das nicht nur in Tagebaugebieten.
Man sieht es nur nicht, da man heute auf dem Land meist wie durch einen Tunnel fährt – links und rechts hohe Maisfelder – mit wenigen Sonnenblumen darin. Sie werden subventioniert. Es ist dies eine ästhetische EU-Maßnahme. Dazu gehört auch die Rekonstruktion von Dorf-Brunnen, -Teichen und -Backhäusern. Die ländlichen Gemeinden ähneln heute, mit ihren Fachwerk-Häusern Potemkinschen Dörfern. Wo bleibt der Widerstand?
Gewiß, es gab und gibt immer wieder punktuelle Proteste: die „Landvolkbewegung“ Ende der Zwanzigerjahre in Schleswig-Holstein, mit der sich die Bauern gegen ihre Besteuerung wehrten – und dabei u.a. Finanzämter in die Luft sprengten. Treckerdemonstrationen in Wackersdorf, Gorleben und Lüchow-Dannenberg – gegen Atom-Anlagen bzw. – Deponien. In Berlin protestierten die LPG-Bauern gegen die Abwicklung ihrer Betriebe. Im Alten Land bei Hamburg wehrten sich die Obstbauern gegen ihre Enteignung zugunsten einer Landebahnerweiterung für Airbusse. In Polen gründeten die Bauern aus Protest gegen die EU-Beitrittsmodalitäten sogar eine eigene Partei. Derweil geht das „Hofsterben“ jedoch munter weiter: In Polen geht die EU von mehreren hundertausend Kleinbauern aus, die nach und nach aufgeben werden; in China wurden zig Millionen gezwungen, als Wanderarbeiter ihre Dörfer zu verlassen. Ähnlich ist es im Nahen Osten sowie in Nordafrika.
Und dennoch macht sich zur gleichen Zeit, da mit der Computerisierung und Privatisierung auch immer mehr Industriearbeitsplätze wegfallen, eine wahre „Landlust“ bemerkbar. So heißt hierzulande die einzige erfolgreiche neue Zeitschrift. Daneben begeistern sich die jungen Städter zunehmend auch praktisch für „Urban Gardening“ und „Urban Farming“. Massenhaft werden Straßenbaum-Scheiben bepflanzt. In Frankreich sind die landwirtschaftlichen Fachschulen überbelegt… Aber das alles ist keine „Rückkehr des rebellischen Bauern“, wie die Autoren des o.e. Buches über den „Bauernwiderstand“ titeln, den sie dann auch vornehmlich in Asien und Lateinamerika verorten, sondern läuft eher auf eine Verbäuerlichung der rebellischen Jugend hinaus. „Soweit man eine Vorstellung von einer Veränderung hatte, rechnete man ebenso häufig mit einer Verschlechterung seit dem Goldenen Zeitalter des Ursprungs wie mit einem Fortschritt.“ Das schrieb der Anthropologe Alfred Kroeber 1923. Was man bis in die Sechzigerjahre auf den Bauern münzen konnte, gilt heute auch für Städter. Andersherum kann man mit dem Biologen Josef Reichholf vielleicht auch sagen, dass man bei Städtern und der Stadtentwicklung in ökologischer Hinsicht von einem „Öffnungsprozeß zur Landschaft hin“ sprechen kann, während „bei den Dörfern die historische Entwicklung bis in die allerjüngste Zeit fast genau umgekehrt verlaufen“ ist: Aus der „Eingebundenheit in das Umland wurde eine zunehmend stärkere Trennung; eine Isolation, die durch scharfe Trennung zu den monotonen Maisfeldern oder anderen großflächigen Monokulturen so verstärkt wurde, dass den Dörfern oft ihr Wesenszug abhanden kam“ – vor allem wenn in ihnen auch noch die Tierzucht industrialisiert und in Zweckbauten separiert wurde sowie drumherum riesige Anlagen zur Energiegewinnung errichtet werden.

Das Schweinesystem
„Präsident sollte nur jemand werden, der auch Schweine versteht!“ (Harry S. Truman)
Der westdeutsche Ökologe und Tierfilmer Horst Stern erinnerte sich in einem Interview 1997: „Ich hatte in einem meiner Filme mal gesagt: So sind sie, die Ethologen. Die Südsee ist ihnen nicht tief genug, kein Urwald ist ihnen dicht genug und gefährlich genug. Aber in einen Saustall, da bringt sie niemand hinein.“ Trotz einer Schwemme von „Tierstudien“ und „Human-Animal-Studies“ gilt dies auch heute noch – für Schweine. Immerhin ersetzen gelegentlich engagierte Tierschützer die verbeamteten Tierforscher – in den Schweineställen, indem sie nächtens dort einbrechen und die traurigen Lebensbedingungen für die Tiere dokumentieren. Hier und da wird auch schon mal gegen eine im Bau befindliche Riesenmastanlage demonstriert oder diese sogar in Brand gesteckt.
In unserer mit 8.000 Schweinen noch relativ kleinen Anlage der LPG „Florian Geyer“, Saarmund, wo ich zuletzt arbeitete, war es laut, heiß und stank, regelmäßig mußte der Tierarzt irgendeinem Tier Antibiotika spritzen und ebenso regelmäßig rückte der Desinfektor an, jeden Morgen musste man ein oder zwei tote Tiere rauskarren und eigentlich waren alle froh, als eine winzige Dorfinitiative, angeführt von der Gemeindeschwester, eine Demonstration mit etwa 20 Leuten vor dem Tor organisierte – woraufhin die Kreisverwaltung in Potsdam die sofortige Schließung der Schweinemast anordnete: und 15 Leute ihren Arbeitsplatz verloren. Damals, im Februar 1990 konnte sich noch niemand vorstellen, dass sie vielleicht nie wieder eine neue Anstellung finden würden.
2006 fand im Schloß Neuhardenberg eine Ausstellung über Schweine statt, in der es u.a. auch um eine ebenfalls nach der Wende abgewickelte Mastanlage ging, in der 800 Beschäftigte 146.000 Tiere jährlich „fett machten“. Dort – im uckermärkischen Haßleben -plante seit 2004 ein holländischer Investor eine neue Anlage – für 67.000 Schweine. Er, Harry van Gennip, betrieb bereits seit 1994 eine für 65.000 Schweine ausgelegte Anlage im altmärkischen Sandbeiendorf. Einer seiner Berater,Helmut Rehhahn, war früher SPD-Landwirtschaftsminister in Sachsen-Anhalt und noch früher Leiter einer Bullenprüfstation in der DDR. „10 000 Mastschweine. Alles andere ist Spielerei,“ erklärte er 2007 dem Spiegel. „‚Haßleben wird noch moderner. Haßleben,‘ sagt er, ‚das kommt. Das kriegen wir hin‘.“ Um den Bau dieser Fleischfabrik – für inzwischen „nur“ noch 37.000 Schweine – wird jedoch noch immer vor Ort gestritten. Auf der einen Seite der Investor mit einer „Pro-Schwein-Haßleben“-Bürgerinitiative, auf der anderen Seite eine „Kontra-Industrieschwein-Haßleben“-Bürgerinitiative und der Deutsche Tierschutzbund. Die Bild-Zeitung spricht von einem „Schweinekrieg“.
Der findet nicht nur in Haßleben statt, denn in Ostdeutschland errichteten und errichten viele Investoren riesige Schweinemastanlagen. Einer verriet dem „Freitag“ freimütig, warum: „Zu Hause in Holland wirst du als Schweinezüchter ständig wie ein Krimineller behandelt. Das ist in Ostdeutschland anders. Hier kannst du noch Unternehmer sein. Umweltkosten spielen keine Rolle.“
Diese Großprojekte für Tierzucht-, -Mast und -Schlachtung stoßen jedoch auf immer mehr Widerstand. Auch im Altmark-Dorf Cobbel gibt es eine Bürgerinitiative gegen eine dort von Harry van Gennip geplante Schweinemastanlage (auf einem ehemaligen sowjetischen Flugplatz). Er „hat vor, hier etwa 97.000 Ferkel zu züchten,“ erfuhr der Freitag-Reporter bei der Bürgermeisterin von Cobbel, „also werden wir dann täglich Dutzende von Transportern mit Tierfutter, Ferkeln und Schweinen durch unser Dorf fahren sehen. Wer bezahlt den Schaden? Eine solche Mast belastet die Umwelt, das heißt, in einem wertvollen Naturschutzgebiet wird Wald mit Ammoniak verseucht, der Grundwasserspiegel sinken und der Boden sauer.“
Ähnlich argumentieren auch die Tierschützer in Haßleben. In einer Stellungnahme des für die Genehmigung der dortigen Schweinemastanlage zuständige Ministeriums in Potsdam hieß es zuletzt – am 18.4.2012: „Der Investor will dem Antrag zufolge die Anzahl der Schweinemastplätze von 35.200 auf 4.400 reduzieren. Ursprünglich handelte es sich um 67.000 Tierstellplätze. Das für das Genehmigungsverfahren zuständige Landesamt muss nunmehr die geänderten Antragsunterlagen erneut prüfen. Dabei wird es insbesondere um die Auswirkungen auf Natur und Umwelt gehen.“
Im Mai 2012 hatte das Bundeskabinet eine Novellierung des Tierschutzgesetzes beschlossen, das nun neben dem Wildtier-Verbot für Zirkusunternehmen, weil diese sie nicht „artgerecht“ halten können, auch einige Restriktionen bei der Massentierhaltung beinhaltet: z.B. den „Ausstieg aus der betäubungslosen Ferkelkastration zum 1. Januar 2017“, wie „agrarheute“ schreibt. Außerdem muß der Tierhalter seine Schweine fürderhin „angemessen ernähren, pflegen und verhaltensgerecht unterbringen“ , dazu gehört eine „Förderung des Erkundungsverhaltens der Schweine, die jederzeit Zugang zu veränderbarem Beschäftigungsmaterial haben müssen, das von ihnen untersucht und bewegt werden kann,“ wie das niedersächsische Amt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit die neue Verpflichtung für die Züchter und Mäster erklärt, ihre Schweine nicht nur „verhaltensgerecht“ aufzuziehen, sondern auch noch für ihre „Unterhaltung“ zu sorgen. Nicht nur emsländische Schweinebauern klagen, dass es noch kein brauchbares „Spielzeug für Schweine“ auf dem Markt gibt. Einige behelfen sich einstweilen mit Holzscheite, die sie an Ketten in die Ställe hängen – als eine Art Kauknochen.
Der Kurator der Ausstellung „Arme Schweine“, Thomas Macho, Kulturwissenschaftler an der Humboldt-Universität, siedelte die Problemlage erst einmal im Grundsätzlichen an: „Jene Tiere, die seit Jahrtausenden mit den Menschen lebten und arbeiteten – nämlich die Haustiere – wurden aus allen konkreten Lebens- und Arbeitskontexten der Moderne verdrängt. Die Rinder wurden durch Traktoren ersetzt, durch Mähdrescher und andere landwirtschaftliche Maschinen, die Ziegen und Schafe durch die Produktion synthetischer Bekleidung. Die Kavallerie wurde gegen Panzerdivisionen ausgetauscht; und zunehmend wurden die ehemals militärisch idealisierten Pferde zu Zugtieren degradiert, die allenfalls jene Gulaschkanonen schleppen durften, in denen sie bei Bedarf gekocht und an die Soldaten verfüttert werden konnten. Die Kutschen wichen den Eisenbahnen und Automobilen, die Lasttiere den Kränen und Baggern, die Brieftauben den Computern und Telefonen. Wollten wir die Grundtendenz des Modernisierungsprozesses in gebotener Knappheit erfassen, so müßten wir sie als progressive Eliminierung der Haustiere durch Maschinen beschreiben. Diese gesellschaftliche Verdrängung der Haustiere reduzierte die Tiere schlagartig auf eine einzige Funktion, die noch kein Wild- oder Haustier jemals zuvor in vergleichbarer Größenordnung erfüllen mußte: auf die Funktion des Massenschlachtviehs.“
Die Schweine, die zu den am frühesten domestizierten Tieren zählen, waren schon immer Schlachtvieh. Sie lebten jedoch länger und es wurde alles – einschließlich der Innereien – verwendet. Heute sind Schweine in einem Alter von etwa einem halben Jahr und einem Gewicht von rund 110 Kilo schlachtreif. Und es wird sowohl in der Schweine- als auch in der Tierfutter-Forschung ununterbrochen versucht, die Fleischproduktion noch effektiver zu machen. Laut Statistischem Bundesamt wurden 2008 genau 26.380.900 Schweine in Deutschland gehalten, die meisten davon, etwas über 8 Millionen, in Niedersachsen. 66.400 Betriebe züchteten Schweine. Derzeit gibt es wieder mal eine preisdrückende Überproduktion, die bisher jedoch stets eine vorübergehende war: „Schweinezyklus“ genannt.
An der Mosel bat ich einmal einen Bauern, mir seine neue Mastanlage zu zeigen, er willigte nach langem Zögern ein, öffnete die Tür, machte das Licht an, 4000 Tiere sprange nach und nach auf und schrien, wir gingen den Gang entlang und traten am Ende durch eine andere Tür wieder ins Freie. Nachdem der Bauer das Licht ausgemacht hatte, beruhigten sich die Tiere langsam wieder. „So, sagte er, das kurze Vergnügen hat mich jetzt rund 120 DM gekostet – diese Verzögerung ihrer Gewichtszunahme, dadurch dass wir die Schweine aufgestört haben.“
In der Schweiz, wo man vor einigen Jahren das weitestgehende Tierschutzgesetz verabschiedete und gerade eine Kommission an einem analogen – d.h. auf Individuen zielendes – Pflanzenschutzgesetz arbeitet, macht sich u.a. der „Zürcher Tierschutz“ dafür stark, deutsches Schweinefleisch zu boykottieren: „Die Schweiz importiert jährlich 10 Millionen kg Schweinefleisch aus Deutschland und Italien. Dort werden Mastschweine und Muttersauen eingepfercht gehalten und Ferkel ohne Betäubung kastriert, was äusserst schmerzhaft ist. All dies ist zu Recht in der Schweiz verboten. Die Tatsache, dass Grossverteiler, Gastromärkte, Caterer und Fleischverarbeiter nach wie vor Schweinefleisch aus tierquälerischer Haltung importieren und verkaufen, widerspiegelt unserer Ansicht nach einen bedenklich tiefen ethischen Standard.“
Diesen haben die deutschen Tierschützer unterdes auch in den Schlachthöfen ausgemacht. 2011 wurden in 5100 zugelassenen Betrieben fast 60 Millionen Schweine geschlachtet. 750 Schweine pro Stunde und Betrieb: In Schlachthöfen wird im Sekundentakt gearbeitet. „Darunter leidet der Tierschutz“, wie das Handelsblatt am 21.6.2012 schrieb: „Die Tiere werden automatisch betäubt, zum fachgerechten Töten per ‚Entblutestich‘ sind dann etwa fünf Sekunden Zeit. 12,5 Prozent der Tiere seien jedoch nicht richtig betäubt. Die Grünen fordern härtere Regeln, die Branche wehrt sich.“
Die letzten Aporien des Schweinesystems kommen von österreichischen und taiwanesischen Wissenschaftlern: 1. In Ötztal hat ein zweiwöchiger Tierversuch begonnen, bei dem 29 Schweine lebendig unter einer Lawine begraben werden. Diese Lawine wird simuliert, um durch die toten Schweine mehr Aufschlüsse über die Todesumstände von Lawinenopfern gewinnen zu können. 2. Taiwanesische Forscher haben drei fluoreszierende Schweine gezüchtet, die im Dunkeln grün leuchten. Dafür sei in den Zellkern eines Schweineembryos ein fluoreszierendes Protein injiziert worden, das aus Quallen gewonnen worden sei, erklärte Wu Shinn Chih von der Nationalen Universität Taiwans. Damit sei ein „wichtiger Fortschritt“ bei der Stammzellforschung gelungen, weil Schweine Tiere seien, die dem Menschen besonders nahe sind.

(2) „Network is a purely conceptual tool,“ meint Bruno Latour. So etwas Ähnliches wie „Konzeptkunst“? Oder betreiben wir Projektemacher das Networking konzeptmäßig? Das Netzwerk ist laut Latour „what allows you to trace but it’s not what is traced“.
Zur Genealogie des Begriffs hat unlängst der Siegener Medienprofessor Erhard Schüttpelz Erhellendes beigesteuert: Ursprünglich waren mit dem „Netzwerk“ Infrastrukturen wie die Strom- und Wasserversorgung gemeint – und es ging mit dem Begriff darum, die diesbezügliche Technik zu standardisieren: Von 1900 bis etwa 1930 „ist das makrotechnologische ‚Netzwerk‘ nichts als ein materielles ‚Objekt‘ der Organisation, das entsprechende ‚Subjekt‘ sind große Firmen, Institutionen und vor allem der Betrieb durch ‚Systeme‘. Das Eisenbahnnetzwerk etwa, das waren die Schienen, Weichen, Gleise, Bahnhöfe und Signalapparate, aber nicht die Eisenbahngesellschaft.“
Etwa seit dem Zweiten Weltkrieg wird mit dem Begriff „Netzwerk“ aber auch noch versucht, „die Subjektivität der informellen Sozialbeziehungen zu erfassen“. Dennoch „handelt es sich im mikrosoziologischen ‚Netzwerk‘ bis in die 70er Jahre des 20. Jahrhunderts um einen schwachen Terminus.“
Aber schon in den frühen Neunzigerjahren begriffen z.B. amerikanische Studenten ihr Studium eher als Chance zum „Networking“ denn zur Wissensübermittlung, wie die Westberliner Künstlerin Maria Eichhorn klagte, die damals als Dozentin in den USA arbeitete: Ihre Studenten waren weniger an ihrer Kunst als an ihren Verbindungen und Adressen – von Galerien, Kuratoren, Kunstzeitschriften, Stiftungen etc. – interessiert. Die Berliner Hochschulen haben dazu neuerdings sogar ein ganzes – feministisches – Programm aufgelegt. Es nennt sich „ProFil – Professionalisierung für Frauen in Forschung und Lehre“ und bietet „Mentoring – Training – Networking“ an – zur „Entwicklung der strategischen Kompetenzen und besseres ‚Self-Marketing'“.
Daneben gibt es in Berlin auch noch den politischen Förderfonds „Netzwerk“, der gerade eine Broschüre mit Adressen von 230 Stiftungen und Förderquellen für Projekte und Initiativen veröffentlichte. Die Inanspruchnehmer sind jedoch derart viele (geworden), dass sie mehr als diese Adressen/Adressaten ihrer „Projekte“ brauchen, nämlich „aktives Networking“, bis dahin, dass sich ihnen sein „Inhalt“ ergibt. So meint z.B. die Genossenschaftsforschung, dass die Berliner Förderung von Genossenschaftsgründungen so verzwickt ist, dass nur solche Genossenschaften sie in Anspruch nehmen (können), die ausschließlich wegen der Fördergelder gegründet wurden.
Schüttpelz schreibt: „Wenn die Sozialform der ‚Netzwerke‘ früher einmal ‚Korruption‘ und ‚Klientelismus‘ genannt wurde, und wenn man in den legalisierten ‚Netzwerken‘ der Gegenwart durchaus alle Züge eines klassischen ‚Klientelismus‘ ausmachen kann, dann muss man davon ausgehen, dass diese Sozialformen heute sehr viel stärker legalisiert worden sind als vor dreißig Jahren“.
Das ist freundlich ausgedrückt, man könnte auch sagen: Jedes Networking ist Kriminell! Bereits der Begründer der Nationalökonomie Adam Smith war sich sicher: „Geschäftsleute des gleichen Gewerbes kommen selten zusammen, ohne dass das Gespräch in einer Verschwörung gegen die Öffentlichkeit endet oder irgendein Plan ausgeheckt wird, wie man die Preise erhöhen kann“. “Americas Business is the Business!“ präzisierte später der US-Präsident Coolidge. Und noch später der „StreetSmart Marketer“ Paul Tobey: „Networking is a powerful business tool that every business owner should use extensively.“
Das ist nur halb so fatal wie der Umstand, dass wir nun alle bloß noch als „Geschäftsleute“ zusammenkommen. Denn tiefer noch als sämtliche Privatisierungen greift heute das „ökonomische Raster“ der Neoliberalen, indem es den Begriff des „Humankapital“ und einen neuen „homo oeconomicus“ hervorbrachte, der gleichzeitig „Unternehmer seiner selbst“ und „in eminenter Weise regierbar ist“, wie Michel Foucault in seinen Vorlesungen über „Neoliberale Gouvernementalität“ und „Die Regierung des Selbst und der anderen“ ausführte.
Wenn man das „Netzwerk“ nun mit Latour als ein rein konzeptuelles Werkzeug begreift, das es uns erlaubt, etwas zu verfolgen, das selbst jedoch nicht das ist, was wir verfolgen, dann stellt sich mit einer solchen Umkehrung der Malaise die Frage, ob wir damit aus der „Falle“ herauskommen. Michel Foucault redet zwar nicht von einem Netzwerk, sondern von einem „Beziehungsgeflecht“, gegen dessen Eingrenzung man sich ständig zu widersetzen habe, aber er sieht das nicht als eine Falle: „Zwar befinden wir uns stets in dieser Art Situation. Was aber bedeutet, dass wir stets die Möglichkeit haben, die Situation zu verändern, dass diese Möglichkeit stets existiert. Wir können uns nicht aus dieser Situation herausversetzen, und wir sind nirgendwo frei von jeder Machtbeziehung. Aber wir können stets die Situation umgestalten. Wir sitzen also nicht in der Falle, sondern im Gegenteil, wir sind frei. Kurz gesagt gibt es stets die Möglichkeit, die Dinge umzugestalten.“


(3) Zur „Alkoholherstellung“ sei noch Folgendes angefügt: Britische Astronomen entdeckten Anfang April 2006 eine 463 Millionen Kilometer lange Alkoholwolke im All – und zwar im Abschnitt “W3 (OH)”. Sie besteht aus reinem Methanol – sogenanntem Fuselalkohol, der blind macht. Im Gegensatz zu Ethanol, der nicht nur trinkbar ist, sondern auch als Treibstoff, ähnlich wie Erd- oder Flüssiggas, verwendet wird – zur Substituierung von Benzin, d.h. von Erdöl. Kürzlich stellten einige Autofirmen ihre neuen, damit angetriebenen PKW-Modelle vor, u.a. den “Ethanol-Ford”. Daneben wird auch immer öfter das Sumpf- oder Faulgas Methan (Methylwasserstoff), industriell genutzt – ebenfalls als Energiequelle. Die Kühe bzw. ihre Bakterien im Pansen produzieren es wie erwähnt in solchen Mengen, dass die Tiere es nicht im Körper abbauen können, sondern sich dieses “Biogases” durch Furzen und vor allem Rülpsen entledigen: Sie haben dadurch die Atmosphäre bereits zu 15% mit Methan angereichert, was u.a. den Treibhauseffekt bewirkt hat.
Umgekehrt produzieren immer mehr Bauern hierzulande gezielt das Biogas, indem sie Mist, Gülle, Klärschlamm und anderen organischen Abfall in Gärbehältern sammeln. Das bei der bakteriellen Zersetzung entstehende Methangas wandeln sie direkt über einen Motor, der einen Generator antreibt, in Elektrizität um, den sie in das Stromnetz einspeisen. Für jede Kilowattstunde zahlt man ihnen 14,7 Cent”, wobei jedoch die Energieausbeute der dabei verwendeten Verfahren noch nicht über 55% hinauskommt. Beim mikrobiellen Teil des Verfahrens “verarbeiten” laut FAZ “in einem ersten Schritt fermentative Bakterien das ‘Futter’ in Zucker, organische Säuren und Alkohole. Essigsäurebildende Bakterien machen daraus sodann Essigsäure sowie Wasserstoff. Und in einem dritten Schritt produzieren ‘Methan-Bakterien’ das Biogas, das außer aus dem erwünschten Methan noch aus Kohlendioxyd, geringen Mengen an Wasser, Schwefelwasserstoff und Spurengasen besteht.” Wenn bald die Milchsubventionen komplett wegfallen, bekommen die Bauern wahrscheinlich für ihren verstromten Kuhmist mehr Geld – als für die Milch ihrer Kühe.
In Schweden will man sich vor allem mittels Bio-Ethanol vom Öl unabhängig machen. “Ist diese Schnapsidee ein Modell für den Rest der Welt?” fragte sich der Spiegel. Dabei werden ganze Wälder, aber auch komplette Weizen-, Mais- und Zuckerrohr-Ernten (aus Brasilien) sowie schnellwachsende Weidenbäume in einem chemischen Wandlungsprozeß industriell verflüssigt, d.h. zu Ethanol verarbeitet. Die Schweden sollen den Alkohol fürderhin nicht mehr trinken, sondern verfeuern. Ihre neuen Ethanolfabriken und -abfüllanlagen werden deswegen vor verwegenden Trinkern besonders geschützt. Hier will Volkswagen demnächst Autos herstellen, die mit Ethanol fahren, das man beliebig mit Benzin mischen kann. Dazu liebäugeln die hessischen Weizenanbauer bereits mit der Umwandlung ihrer überschüssigen Ernten in Bio-Ethanol. Die chemische Formel für Methan, dem einfachsten Alkan und Kohlenwasserstoff, lautet: CH4, seinen Alkohol nennt man Methanol oder Methylalkohol, er hat die Summenformel CH3OH. Als solcher kommt er in der Natur in Baumwollpflanzen, im Bärenklau, sowie in Gräsern und ätherischen Ölen vor.
Bei der Verbrennung ist Methan effektiver als Methanol. Letzerer wird durch einen “Veresterungs”-Prozeß (d.h. durch eine Additions-Eliminierungs-Reaktion) zu “Biodiesel”. Die Produktion dieses Treibstoffs wird als erneuerbarer Energieträger derzeit subventioniert – sein Ausgangsprodukt ist hierzulande meistens Raps, aber auch Sonnenblumen. Etliche Bauern sind bereits dazu übergegangen, Biodiesel zu produzieren. In Mecklenburg gibt es einige Landwirte, die sich zusammengetan und Produktionslinien aufgebaut haben, die vom Rapsanbau bis zur Biodiesel-Tankstelle reichen, also in kleinstem Stil den gesamten Upstream- und Downstream-Bereich umfaßen, wie er auch von den meisten Ölkonzernen – im größtmöglichsten Stil – angestrebt wird.
Die Kunst des in Bukarest, Bergen und Oslo lebenden Künstlers Dan Mihaltianu bestand lange Zeit aus Schnäpsen. Schon sein Großvater beherrschte die Kunst der Destillation – zur Selbstversorgung. “Mich interessiert jedoch nur der Brennprozeß – und der Alkohol als Geruchs- und Geschmacks-Erinnerung,” meint der Künstler und denkt dabei weniger an den Rauscheffekt dieses Getränks als an die Proustsche Wiedereinsetzung aller Sinne in ihr altes Recht, am inneren Erleben, d.h. Erinnern, teil zu nehmen. Das Schnapsbrennen ist so gesehen auch ein Kampf gegen die Okulartyrannis, die nur (optische) Bilder gelten läßt. Andererseits verändert jedoch der Schnaps die optische Wahrnehmung derart, dass man in ästhetischer Hinsicht die verschiedenen Alkoholika durchaus bestimmten Kunstrichtungen zuordnen, d.h. dafür verantwortlich machen könnte – beispielsweise den in der Schweiz auf Wermutbasis destillierten Absinth (“Grüne Fee” genannt) für den Impressionismus, der einst in der französischen Bohème zum Kultgetränk aufgewertet wurde. Nicht wenige Maler gestalteten damals Etiketten von Absinthflaschen. Er wurde damals auf Druck vor allem der Weinhersteller verboten – und ist erst seit einigen Jahren wieder offiziell im Handel zugelassen.
Für den rumänischen Künstler ist das Methanol wie erwähnt bloß “Fuselalkohol”, der giftig und somit nicht zum menschlichen Genuß geeignet ist. Aber gerade darum, d.h. um die Geselligkeit, geht es den meisten Künstlern, die in irgendeiner Weise mit “Allohol” arbeiten, wie der “freischaffende Kunsttrinker” Thomas Kapielski diesen Stoff – Ethanol, mit der Summenformel C2H5OH – nennt. Und womit er bereits auf seine Verwendung als “Rauschmittel” anspielt, das man als die weltweit am häufigsten verbreitete Droge bezeichnen kann. Es wirkt besonders auf das Nervensystem und speziell das Gehirn: Man fängt an zu lallen (das gilt auch für Tiere), die Reaktionszeiten verlangsamen sich und das Blickfeld verengt sich (Tunnelblick). Aber so wie es unter den Prostituierten 0,1 bis 1 Prozent gibt, die ihre Arbeit zum eigenen Vergnügen tun und das Geld nur als zusätzliche Stimulanz brauchen, gibt es auch unter den Trinkern einige wenige, die quasi umgekehrt – im Tunnel Licht sehen, d.h. die mit steigendem Alkoholkonsum klarer denken und schneller und schärfer artikulieren…Forscher – natürlich an der Universität von Stockholm – haben herausgefunden, dass bereits täglich 50 Gramm Ethanol (was etwa einem Liter Bier entspricht) “bleibende Schäden hinterläßt”. Die gesundheitspolitische Aufklärung weltweit ist deswegen voll von Warnungen vor zu viel Alkoholkonsum, während ein Großteil der privaten Reklameflächen voll von Alkoholwerbung ist.
Zwischen dieser Spannung lebt der Trinker, was er mit fortschreitendem Alter besonders morgens tief, fast schmerzhaft, empfindet. Es gibt noch eine weitere Spannung – in der nicht zuletzt auch Dan Mihaltianus Destillationen stehen und die das Mischungsverhältnis zwischen heimlichem und geselligen Trinken mitbestimmt: Während in Russland der Begriff des “Heiligen Narrs” und seine Wertschätzung sich dabei für lange Zeit, fast bis heute, quasi schmerzlindernd auswirkte, war in Deutschland der Adel stets davon überzeugt, das Bürgertum werde beim Trinken entweder aggressiv oder sentimental, weswegen er es vorzog, unter sich zu trinken. Die Bürger übernahmen später u.a. auch diese Meinung vom Adel – um sie dann ihrerseits gegenüber den Saufereien des Proletariats in Anschlag zu bringen. Ganz anders verlief dieser Prozeß in Tschechien, wo sich (noch?) in den Kneipen eine sozusagen gesamtgesellschaftliche Geselligkeit erhalten hat. Dort – in „Pilsen“ – wurde nebenbeibemerkt auch das (untergärige) Bier erfunden. In Deutschland bloß der dazugehörige „Männlichkeitsdiskurs“:

Im Jahr 1805/06 veröffentlichte der Populärphilosoph und braunschweigische Hofrath Carl Friedrich Pockels “eines der wichtigsten Werke zum Männlichkeitsdiskurs um 1800″: das zweibändige “Der Mann. Ein anthropologisches Charaktergemälde seines Geschlechts”. Wie fast alle Aufklärer vor und nach ihm kommt er darin zu der Auffassung, dass der Mann seiner Natur nach asozial/egoistisch, aggressiv und unzivilisiert ist, erst durch den Einfluß einer Ehefrau wird aus ihm ein das Soziale nicht mehr gefährdendes Individuum.
2008 hat der Soziologe Christoph Kucklick die Männer-Studien von Pockels, Kant, Hegel, Fichte usw. als eine “Negative Andrologie” zu Beginn der Moderne bezeichnet – in seiner Doktorarbeit: “Das unmoralische Geschlecht”. Pockels machte sich darüberhinaus jedoch auch laut Kulick Gedanken, “wie Sozialität unter Männern denkbar ist” – unter Männern, die keine Ehe eingehen (können oder dürfen). Für sie gibt es statt einer Frau den Wein! Pockels Abhandlung über “das Verhältnis des Mannes zum Wein” ist fast 100 Seiten lang. Sie las sich damals weniger kurios als heute, meint Kulick, denn auch Kant u.a. Aufklärer erörteren um 1800 den Wein als Vehikel der “Offenherzigkeit”. Während Frauen laut Pockels durch den Alkohol “lüstern” wie Männer werden, bewirkt der Wein bei Männern umgekehrt, dass “mäßiger Rausch” sie zu Frauen macht. Sie werden toleranter und liebenswürdiger. Sie sind “keiner Verstellung und Hinterlist” mehr fähig, kurzum: sie machen “zur Freude der ganzen Welt” eine Wandlung zum Guten durch. Aber vor allem öffnet der Trunk ihr Herz – “und ergänzt so die weibliche Kardialbelebung durch eine alkholische” (Ch. Kulick). Der Alkohol wirkt “als Antidot zu den Differenzen der Gesellschaft und den Egoismen der Männer”, ihre mit Wein verbundene Geselligkeit “ist eine Art konkrete Utopie, die Versöhnung nach Feierabend” – indem sie sich beim gemeinsamen Zechen laut Pockels “untereinander zu einem Geiste der Offenheit bekennen”.
Für Kulick “könnte das auch die Beschreibung einer Ehe sein. Und in der Tat entspricht das Trinken bei Pockels genau einem Eheschluß – ohne Frauen. In der Kneipe heiraten Männer. Der Alkohol sorgt dafür, dass Männer miteinander einen ähnlichen Grad an sozialer Kohäsion erreichen wie sonst nur mit ihren Frauen in der Ehe.” Das ist utopisch gedacht, Pockels hat dabei nicht die schlechte Realität (in den Wirthäusern) übersehen: Der “Schwermüthige” wird im Rausch zum “wirklich gefährlichen Menschen”, der Geschäftsmann wird zum Angeber, der Soldat spricht “mit nicht geringerm Egoismus von seinem Metier”, der Gelehrte “träumt sich eine Celebrität”, andere Männer werden “zanksüchtig, empfindlich und ungestüm.” Der Geheimrat Goethe sah in diesem Phänomen anscheinend auch was Gutes: “Der Wein, er erhöht uns, er macht uns zum Herrn und löset die sklavischen Zungen”. An dieser Ambivalenz – einerseits verblödet das Trinken auf Dauer, andererseits steigert es aber auch die Kreativität und den Gedankenmut, wie zuletzt der Philosoph Gilles Deleuze in seinem Film-Interview “Abécédaires” ausführte – hat sich bis heute wenig geändert.
Der rumänische Künstler Dan Mihaltianu bringt bei der Herstellung seines Schnapses genauso wie sein Großvater zwei Verfahren zur Geltung: Erst einmal ein mikroorganismisches, bei dem die zucker- und stärkehaltigen Substanzen durch Hefepilze oder Bakterien zur alkoholischen Gärung gebracht werden und dann ein physikalisches – die eigentliche Destillation: das Brennen, das aus einem thermischen Trennverfahren besteht. Dabei wird dem System Energie in Form von Hitze zugeführt, wodurch die vergorene Masse (bei der Bourbonherstellung nennt man sie Bier) hochkocht – und sich zwei gegenläufige Strömungen im Destillator ergeben: Der flüssige Teil fließt über Röhren nach unten, die gasförmigen Bestandteile strömen nach oben, darunter der Alkohol, der daraufhin in einem Kondensator abgekühlt wird. Das nunmehr wieder flüssige Kondensat wird aufgefangen. Es ist das, was man haben will: den Spiritus (von lateinisch Geist). Damit er reiner, konzentrierter wird, wiederholt man diesen Prozeß mehrmals. Das Wort Destillieren kommt aus dem lateinischen destillare – herabtröpfeln, es gewinnt, seitdem man vor etwa 1000 Jahren den Alkohol (Ethanol) entdeckte, stetig an Bedeutung. Das Alkoholbrennen ist in Deutschland ein beliebtes Hobby, so dass man hierzulande alle möglichen “Mini”-Destilliergeräte im Handel bekommt.
Durch diese oder andere Destillierverfahren wird jedoch kein Alkohol produziert, sondern fast im Gegenteil – der zuvor von Hefepilzen und Bakterien produzierte Alkohol nur isoliert (gewonnen), durch wiederholte Destillation wird er jedesmal hochprozentiger.
Dass es sich bei seinen Produzenten überhaupt um selbstgesteuerte Lebewesen handelt, dass also schon bei der Entstehung von Alkohol so etwas wie Geist mitwirkt , offenbarte sich erst im späten 19. Jahrhundert – als Louis Pasteurs Laborexperimente in dessen Schrift “Études sur la bière” gipfelten. Herrschende Lehrmeinung war damals die von Justus von Liebig, demzufolge es sich bei der Alkoholbildung um eine rein “chemische Reaktion” handele. Die von Pasteur entdeckten Mikroorganismen schienen deswegen zunächst einen üblen Rückfall in den “Vitalismus” zu bedeuten. Dieser behauptete nämlich ebenfalls einen Wesensunterschied zwischen der belebten und der unbelebten Natur – und befand sich damit im Gegensatz zum Mechanizismus und Materialismus, die alle Naturvorgänge auf chemische und physikalische Prozesse zu reduzieren trachteten und das auch immer noch tun, bis hin zu den Gehirnfunktionen.
Neben den Hefepilzen (Eukaryoten) können auch Bakterien (Prokaryoten) Alkohol produzieren: echten Tequila z.B., für den man das Bakterium Zymomonas mobilis mobilisieren muß – auf der pflanzlichen Grundlage von mindestens zehn Jahre alten Blauen Agaven, eine Sukkulentenart, deren “Herzen” erst einmal gebacken werden, um dann daraus einen Sirup zu machen. Nachdem die Bakterien diesen verarbeitet und in Alkohol umgewandelt haben, wird er zwei mal destilliert.
Ansonsten sind viele Bakterien eher an der Vernichtung als an der Produktion von Alkohol beteiligt. Namentlich die so genannten Essigbakterien, die ebenso wie die Hefepilze in freier Natur vorkommen: Sie ernähren sich von Alkohol und erzeugen Essig. Aus diesem Grund müssen z.B. die schottischen Whiskyhersteller ihre Gärbottiche und Fermenter regelmäßig mit hoher Temperatur sterilisieren, während die amerikanischen Whiykshersteller dafür chemische Substanzen verwenden. Auch hierzu hat Louis Pasteur die Voraussetzung geschaffen, indem er sich irgendwann fragte: “Wenn Bakterien Alkohol verderben, können sie dann nicht auch Menschen krank machen?” Als seine Bakterientheorie endlich anerkannt war, rief sie jedoch ebenfalls (neue) Forschungswiderstände hervor, denn nun sah man in den Bakterien vor allem giftige, mehr oder weniger lebensgefährliche “Keime” bzw. “Mikroben”, die es zu bekämpfen galt.
2008 argumentierte der Biologe Josef Reichholf in seinem Buch “Warum die Menschen seßhaft wurden”, dass das Getreide anfänglich nicht zu Brot verbacken, sondern zu Bier verbraut wurde, das man gemeinschaftlich auf Festen trank. Laut seiner “Bier-statt-Brot”-Hypothese war das Klima vor 10.000 Jahren so mild, dass der Mensch auch ohne den Anbau von Getreide leben konnte.
Seine zunächst “umstrittene Theorie” wurde nun von dem Archäologen Patrick McGovern erhärtet: “Uncorking the Past” heißt sein Buch darüber. Der US-Autor untersuchte Funde in einem prähistorischen Dorf in China, in einer “feindlichen und rohstoffarmen Umgebung”, während Reichholf sich auf Ausgrabungen aus dem fruchtbaren Süden Jordaniens stützte. Seine “Überfluß”-Theorie steht somit im Gegensatz zu dem, was McGovern eine “weise Überlebensstrategie” nennt – nämlich bei ständig knappen Ressourcen “energiereichen Zucker und Alkohol in sich hineinlaufen zu lassen”.
Eine dritte These, die sich auf die Region Flandern in Belgien stützt, wo man noch heute über 500 Biere braut, könnte da lauten: Dass man über gemeinschaftsstiftende Gelage eher als mit Brot für sich und die Welt aus der Armut herausfindet. Dafür spricht eine Untersuchung der deutschen Agentur für Arbeit, wonach Arbeitslose, die viel Zeit in Kneipen verbringen, über mehr Kontakte verfügen und auch schneller wieder Arbeit finden, als solche, die bereits morgens anfangen, Sat1 zu kucken. Schon bei Bertolt Brecht kommt in “Herr Puntila und sein Knecht Matti” die Dialektik mittels Alkohol in Fluß. Brecht nimmt dabei den Hegelschen Begriff der “Flüssigkeit” wörtlich. Laut Dieter Kraft gewinnt er dadurch eine ermutigende Botschaft: “Die Verhältnisse sind zwar dreckig, aber eigentlich kann man sie schon mit Kutscherschnaps wegspülen”.
Um 1400 gehörte Flandern zu den Produktionszentren, in denen das Kaufmannskapital zur Bildung von Stadtgemeinden führte. Und während eine Mehrheit der Handwerker zu Arbeitern herabsank, gelang einer Minderheit der Aufstieg zu “experimentierenden Meistern”, zu Ingenieuren und Künstlern schließlich. Allein 140 “Flämische Maler” zählt diesbezüglich Wikipedia auf. Die Scheidung zwischen Hand- und Kopfarbeit zeichnete sich laut Alfred Sohn-Rethel zuerst in den Produktionszentren der Textilindustrie, “namentlich in Florenz und Gent”, ab.
80 Jahre kämpften die selbstbewußten flämischen Bauern und Bürger dann um ihre politische Autonomie. In Charles de Costers Epos des Freiheitskampfes der Flamen gegen die spanische Herrschaft “Tyll Ulenspiegel” geht es auch und vor allem darum, dass die beiden Helden sich kreuz und quer durch Flandern essen und trinken. Jedes Dorf hatte seine Spezialitäten. Und damals war bereits bekannt, dass man die Lebensmittel nicht weiter als eine Tagesreise (etwa 100 Kilometer) von ihrem Herstellungsort transportieren darf, wenn sie ihren Geschmack behalten sollten. Das gilt auch für Bier. Ein Braumeister versicherte uns, das ein in Gent gebrautes Bier anders schmeckt als wenn man es in Brüssel herstellen würde, weil dabei andere Pilze und Bakterien mitwirken.
2010 lud das flandrische Tourismusbüro zu einer Bier-Verköstigungstour durch Gent und sein Umland:
In Deutschland konnten die flandrischen Bierbrauer bisher, u.a. wegen des “Reinheitsgebots”, nicht so richtig Fuß fassen. Nun informierte man mich vorab: “In Belgien hat sich die Vielfalt der Biersorten wie in keinem anderen Land erhalten. Im ausgehenden 19. Jahrhundert gab es mehr als 3.500 unabhängige Brauereien in Belgien. In der Nachkriegszeit mussten viele Brauereien ihren Betrieb einstellen, aber in letzter Zeit entstehen viele Hausbrauereien, so dass die Bierkultur eine wahre Renaissance erlebt. Heute werden die berühmten belgischen Biere in die ganze Welt exportiert” – nur eben kaum nach Deutschland.
Als wir in der alten Universitätsstadt Gent ankamen, hatten die Bürger wegen der “Klimaerwärmung” gerade beschlossen, wenn man so sagen darf, an einem Tag in der Woche kein Fleisch mehr zu essen – um die Treihausgasemissionen, die auf das Konto der Rinderzucht gehen, zu reduzieren. Man ist mit diesem “Entschluß” quasi am anderen Ende der Wohlstandsspirale angekommen: Anfänglich war es in der Stadt am Zusammenfluß von Leie und Schelde primär darum gegangen, sich mindestens einmal in der Woche Fleisch leisten zu können. Noch die Arbeiter in den Genter Textilfabriken und Brauereien mußten hart dafür kämpfen. Das große Gebäude der Sozialisten im Stadtzentrum zeugt bis heute davon. Aus ihren Fabriken wurden jedoch längst Museen, Einkaufspassagen und Büros.
Wir besuchten als erstes die kleine neue “Stadtbrauerei Gruut” – am Ufer der Leie. Hier wird nicht mit Hopfen, sondern mit einer Kräutermixtur, “Grut” genannt, gebraut. Im 13. Jhd. teilte der Fluß Gent in eine französische und eine deutsche Stadthälfte. Auf der östlichen Seite durften die Braumeister nur Hopfen und auf der westlichen nur Grut verwenden. Heute ist es hier eine Braumeisterin, Annick de Splenter, die uns “Gruut Blond” zapft. Ihre Hausbrauerei produziert 10 Hektoliter in der Woche. Während der abendlichen “Bierwanderung durch Genter Kneipen” finden wir zum gehopften Bier zurück. In den nächsten Tagen sollten wir noch “Kirschbier” und süßsaures “Dark Bier” sowie diverse Trappisten- und Abteibiere kennenlernen. Letztere in der Benediktinerabtei Affligem. Die 18 dort lebenden Mönche haben die Brauerei an den holländischen “Heineken”-Konzern verkauft. Einige der Affligem-Biere läßt man wie Champagner in der Flasche nachgären. Jährlich sind es insgesamt 200.000 Hektoliter.
Die Trappistenbiere werden noch immer unter Aufsicht von Mönchen gebraut. Ein Großteil der Erlöse aus ihrem Verkauf muß für soziale Zwecke verwendet werden. Ob dazu auch Alkoholentzugskliniken gehören, konnten wir nicht rausbekommen, wohl aber, dass es in den Kneipen verschiedene “Bierrituale” gibt und in den Restaurants viele Speisen mit Bier zubereitet werden, es gibt ganze “Bier-Menüs”. Flandern schien uns reich – während wir über Land fuhren – von Brauerei zu Brauerei. Bei “Liefmans” in Oudenaarde an der Schelde erwartete uns die älteste Braumeisterin Belgiens: Rosa Merckx. Sie hatte dort einst als Sekretärin angefangen, 1972 wurde sie Braumeisterin.
Bei ihr kosteten wir neben warmem “Glühbier” mehrere Biere, die mit Milchsäurebakterien fermentiert werden – weswegen sie immer am selben Standort gebraut werden müssen, wie uns der junge Nachfolger von Rosa Merckx erklärte. “Der eher saure als bittere Geschmack kommt von dem speziellen Bakterien-Mix”. Die in der Flasche nachgegorenen “Liefmans”-Biere werden wie Sektflaschen verkorkt.
In Oudenaarde wurde 1606 der Maler Adriaen Brouwer geboren. Er malte ausschließlich Szenen aus dem Bauern- und Wirtshausleben, das ihn laut Wikipedia auch persönlich derart anzog, dass er schließlich verarmte. Wir tranken in seiner Geburtsstadt ein “Adriaantje” auf den Maler, nachdem wir dort auch noch die Brauerei Roman besichtigt hatten. Sie ist seit 1545 in Familienbesitz, man sieht dem Fabrikkomplex noch an, dass er aus einem Landwirtschaftsbetrieb entstand. Wir probierten hier die Marken “Ename Double”, “Triple” und “Blond” sowie das Bier “Sloeber” – so nennt man einen Genießer, “der vom Leben [anderer] profitiert” und ferner das “Adriaen Brouwer Dark Gold” – mit einem Alkoholgehalt von 8,5%. “Triple”-Biere können bis zu 9,5% haben. Deren Beliebtheit wird mit dem Mönchsleben erklärt: “Sie brauten das Starkbier im Winter – während der Fastenzeit, weil es nahrhafter ist, also im Winter dunkles und im Sommer blondes.”
Daneben kennt man in Flandern auch noch “Endjahresbiere” – mit einem doppelten Hopfenanteil, was sie extrem bitter macht. In einer der Genter Kneipen lernten wir außerdem das “Quak-Bier” kennen: um es zu trinken, muß man einen Schuh abgeben, der in einem Korb an der Decke deponiert wird. In einer anderen Kneipe probierten wir ein perlendes “Geuze”. Es wird aus verschiedenen Jahrgängen des “Lambiek”-Biers hergestellt – was ein durch Spontangärung entstandenes Weizenbier ist. Es zählt zu den ältesten der Welt. Die Geschmacksbildner sind hierbei zwei Hefepilze, die nur in der Gegend um Brüssel vorkommen, der eine heißt “Brettanomyces Lambicus”, der andere “B. Bruxellensis”.
Ich hoffe, ich habe bei diesen vielen Bierverköstigungen und -belehrungen nichts durcheinander gebracht. Die Bierkultur entstand in Flandern jedenfalls mit den Klosterbrauereien. Noch heute unterscheidet man Biere, “die man innerhalb der Klostermauern braut, von denen, die außerhalb gebraut werden”. Beim Abendmahl verwandeln die Mönche und Priester Brot und Wein in Blut und Leib Christi, bzw. Brot und Wein wandeln sich zu Repräsentationen des Blutes und Leibes Christi.
Die erste Wandlung wird als Transsubstantiation, die zweite als Consubstantiation bezeichnet. Beide haben eine weitere “Wesensverwandlung” zur Voraussetzung: Die von Getreidekörner in Brot (bzw. Bier) und von Trauben in Wein. Für diese beiden Transsubstantiationen braucht es den Einsatz von Mikroorganismen. Praktisch wird damit bereits seit 11-15.000 Jahren experimentiert, das Wissen darüber verdankten wir anfänglich den Forschungen von Louis Pasteur. Inzwischen weiß man also: Beim Wein verwandeln die Mikroorganismen den Fruchtzucker der Trauben in Alkohol, beim Bier ist der Ausgangsstoff für die Gärung Stärke.
Flandern ist ein Bierland und ein katholisches Land. Kann es mithin sein, dass die eine Transsubstantiation nicht ohne die andere zu haben ist? Also dass die erste Transsubstantiation, wenn man ihr Endprodukt genießt (trinkt), empfänglich macht für die zweite, dass man vulgar ausgedrückt erst besoffen sein muß, d.h. als Bevölkerung die massenhafte Erfahrung von Trunkenheit gemacht haben muß, um die Verwandlung eines alkoholhaltigen Getränks in das Blut des Herrn beim Abendmahl zu akzeptieren? Und wenn ja, ist das nun gut oder schlecht, also machen die alkoholhaltigen Erfrischungsgetränke nun so blöd, dass man am Ende religiös wird oder so dermaßen luzide, dass sich einem lauter Fernwirkungen entbergen? Aber hat die Frage noch etwas mit den Mikroorganismen bei der Alkoholherstellung zu tun? Egal, hierzulande gilt jedenfalls noch immer: “Der Sauf bleibt ein mächtiger Abgott bei uns Deutschen. ” (Martin Luther)
Ein Kneipengespräch
“In der Trunksucht liegt Verachtung gegen sich selbst,” sagte ich vorwurfsvoll zu Jan, als ich ihn im “Abstieg” traf und er mir gleich, ohne mich zu fragen, einen Wodka spendierte. “Richtig,” erwiderte er, “das ist ja gerade das Gute, Wahre, und Schöne daran: Saufen ist Konter-Egoismus”.
Da wurde ich nachdenklich und bestellte selbst zwei weitere Wodka – wenn auch mit Zweifel. Jan nickte mir aufmunternd zu: “Platonow war der Ansicht, ‘Trink Wodka, und die ganze Weltanschauung ändert sich schlagartig’.” “Hat er das positiv oder negativ gemeint?” fragte ich, “Platonow steht doch eigentlich für eine ebenso nüchterne wie unkorrumpierbare Betrachtung revolutionstrunkener Ereignisse…”
Jan wiegte nachdenklich den Kopf, dann sagte er: “Ich weiß nicht, wie er es gemeint hat, aber das läßt sich herausfinden – experimentell.” Da stimmte ich ihm zu, “aber dafür bräuchten wir saubere Bedingungen, also die Kenntnis unserer unbesoffenen Weltanschauung, um hinterher feststellen zu können, ob die intervenierende Variable Alkohol daran etwas geändert hat.” “Bezweifelst du etwa, dass der Wodka unsere Weltanschauung zersetzt?” erstaunte sich Jan. “Natürlich,” erwiderte ich, “und Du doch auch, sonst läge Dir dieser Platonowsatz nicht so am Herzen – wenn es ein Allgemeinplatz wäre. Bisher bin ich immer davon ausgegangen, dass der Alkoholgenuß die jeweilige Weltanschauung höchstens spiralistisch in immer dünnere Luft schraubt. Eine Art Richthofensyndrom, wo man zuletzt nicht einmal mehr die eigene Schrift entziffern oder die Worte artikulieren kann…”
“Is klar,” sagte Jan, “es gibt aber ja noch mehr dunkle Sätze bei Platonow, laß uns aber erst mal noch einen trinken.” “Sag mir noch mal einen Aphorismus von ihm,” bat ich und winkte der Kellnerin Margarita. “Na, zum Beispiel dieser fast als eine Aufforderung zu verstehende Satz ‘Ins Unreine leben, wie in einer Hütte ohne Schornstein’.” “Das gehört doch zusammen,” vermutete ich: “das Anti-Egoismusprogramm ‘Saufen’ und das ins zunehmend Unreinere Leben – bis man sich aufs Wesentliche reduziert hat.” “Mich erinnert es an Solschenizyn,” meinte Jan, “der hat mal gesagt ‘Es kommt nicht darauf an, immer mehr zu verdienen, sondern immer weniger zum Leben zu brauchen.” “Das bezieht sich bei dem aber doch nicht auf Alkohol, das ist doch ein ganz klarer Kopf, ein Abstinenzler geradezu,” warf ich ein.
“Das befürchte ich auch,” stimmte Jan mir zu, “es gibt noch einen anderen Gedanken von Platonow, der nachdenkenswert ist, gerade heute, da immer mehr junge Leute nur noch Ficken, Feiern und Konsum im Sinn haben: ‘Nach Liebe sehnen sich Menschen ohne gesellschaftliche Bedeutung’…” “Was?” fragte ich, “für eine Medienkarriere lassen die doch heute alles sausen.” “Das ist aber doch nicht das selbe wie ‘gesellschaftliche Bedeutung’, brauste Jan auf, “im Gegenteil!” Und schon stritten wir uns über Medien, von denen Jan behauptete, dass sie bloß noch an einer Fiktion von gesellschaftlicher Bedeutung stricken würden, real bestünde diese jedoch darin, dass man für andere oder für ein Wir Verantwortung übernehme – und sei es durch das Putzen des Gemeinschaftsklos.
Dieses Gespräch fand im Herbst 2010 statt. Im Jahr darauf begab ich mich zusammen mit einigen Journalisten auf eine „Sauftour“ durch drei polnische Woiwodschaften:
Ein Journalist in der Reisegruppe nach Polen erzählte, er hätte in der Toskana in einer Kneipe mit Einheimischen Grappa getrunken und, obwohl er kaum Italienisch konnte, irgendwann alles und alle um ihn herum verstanden. Ein ähnliches Erlebnis hatte ein anderer Journalist einmal in einer Bar in Havanna mit Rum gehabt. Wir zogen daraus den Schluß, dass man im Ausland zum besseren Verständnis der Einheimischen den Alkohol trinken sollte, der dort auch produziert wird. Was aber ist der den Polen sozusagen gemäße Alkohol – und kann oder mag man als Fremder da mithalten? Zur Beantwortung dieser Frage fuhren wir als Erstes in die Woiwodschaft Westpommern, wo wir in der Hauptstadt Stettin den Wodka des noch staatlichen Konzerns Polmos kosteten.
Schnaps zu produzieren ist zuvörderst ein biologischer Prozeß, dem ein bis drei physikalische folgen, die aus einem thermischen Trennverfahren bestehen. Dabei entsteht mit Hilfe von Hitze und Destilliergeräten ein flüssiges Kondensat: (mehr oder weniger hochprozentiger) Schnaps.
Früher fanden diese beiden Prozesse sowie auch der Anbau der dazu notwendigen Pflanzen quasi unter einem Dach statt, heute unter mehreren getrennten, wobei die Zutaten teilweise von weit her kommen. Dies ist auch beim Wodka der Firma Polmos in Stettin der Fall: Die Grundsubstanz, Roggen, wird von pommerschen Bauern angebaut und an verschiedene kleine Destillerien in der Region verkauft, diese versorgen Polmos dann mit Alkohol, der in Stettin zunächst mit Wasser versetzt, d.h. auf trinkbare 40-50% reduziert wird, um dann in Kellergewölben gelagert zu werden.
Die tiefen Keller waren früher Teil eines Stettiner Forts, in das 1863 eine Brauerei einzog, die dort “Victoria-Bier” produzierte. Nach dem (verlorenen) Ersten Weltkrieg stellte sie auf Weinbrand um – und nach dem Zweiten auf Wodka der Marke “Starka”. Die Eichenfässer, in denen er lange reifen muß, bis zu 50 Jahre, werden zunächst für fünf Jahre nach Spanien geschickt, wo sie mit Malagawein gefüllt werden – und dadurch ein Aroma ansetzen, das anschließend dem Stettiner Wodka zugute kommt. Wir probierten 5, 10 und 18 Jahre alten “Starka”, er sieht im Glas aus wie Cognac oder Whisky – und für die EU ist er das auch. Aber eigentlich handelt es sich dabei um einen in Polen schon seit 500 Jahren üblichen “Hochzeitsschnaps”, den man bereits kurz nach der Geburt des Bäutigams ansetzte und dann lagerte. Pro Jahr werden bei Polmos eine Million Liter produziert, im Keller lagern ständig 3 Millionen. Die Firma hat 84 Mitarbeiter, aber nur einen Geschmackstester, der für den Mix zuständig ist, durch den eine gleichbleibende Qualität gewährleistet werden soll. Daneben produziert Polmos auch noch einen Kräuterschnaps sowie einen “Jonny-Walker-Lookalike” – Whisky, der sich bei der zunehmend wodkaablehnenderen Jugend in Polen großer Beliebtheit erfreut.
Der mitreisende SZ-Journalist meinte nach dem Probieren: “Das war schon mal ein sehr guter Einstieg” – in das Thema polnischer Alkohol. En passant erfuhren wir dann beim Essen am Stettiner Hafen noch, dass man dort auch immer mehr Touristen an die einheimischen Alkoholikas heranführt, die aus ganz unterschiedlichen Motiven nach Westpommern reisen: Die Franzosen aus sentimentalen Gründen, weil seit den napoleonischen Kriegen etliche Franzosen hier hängen blieben. Die Deutschen wegen der Wellness- und Fitness-Angebote sowie auch der vielen Zahnkliniken in der Stadt. Die Norweger wegen der Golfplätze. Die Dänen und Schweden wegen der Campingplätze. Die Italiener und Spanier, weil ihr Söhne oder Brüder hier auf einem Nato-Stützpunkt stationiert sind. Die Russen, weil man in Westpommern unkomplizierter Angeln kann als z.B. in Deutschland. Und die Finnen – wegen des billigen Alkoholangebots. Dazu zählen jedoch nicht die Wodkas der Marke “Starka”, von denen die teuerste Flaschenabfüllung über 150 Euro kostet.
Um noch mehr Touristen nach Stettin zu locken, setzt man auf maritime Freizeitvergnügen, u.a. Regatten und Segelschiffparaden, dazu will man die Wasserwege und vor allem Inseln erschließen, die Grünanlagen ausbauen und sogenannte “Floating Garden” anlegen.
In der benachbarten Woiwodschaft Lubuskie, “favourable for investors and tourists”, geht es ebenfalls um die “Bewirtschaftung” von Seen und Stränden sowie den Ausbau der zwei Nationalparks, wovon einer, an der Warthemündung, in den deutschen Nationalpark “Unteres Odertal” übergeht. Deswegen gibt es hier auch mehrere grenzüberschreitende Projekte – u.a. das Jugendbegegnungszentrum “Lesna”, das man mit der Oderbruch-Gemeinde Golzow zusammen plant.
Unsere erste Zwischenstation auf dem Weg in das polnische Weinbaugebiet um Zielona Gora ist das 2001 eröffnete Schloßhotel Mierzecin. Hier bauten deutsche Gutsbesitzer seit 1861 Kartoffeln an und machten daraus Wodka. Im Zweiten Weltkrieg wurden die Gebäude fast vollständig zerstört. Jetzt gehört es den Besitzern der Lackfabrik Novol. Sie steckten bereits mehrere Millionen Euro in ihr Schloss-Hobby. Allein 80 Mitarbeiter sind hier mit der Pflege des Reitstalls, einer Fischzucht, des Hotelbetriebs, eines Weinbergs und eines englischen sowie eines japanischen Parks beschäftigt. In den nahen Gewässern kann man Kajak fahren, die Gemeinde Dobiegniew will sie für Segler ausbauen, für die Hotelgäste gibt es ein “Spa”-Angebot, das ebenfalls erweitert werden soll. Mit dem Weinanbau wird aber noch experimentiert. Zwar geht er auf Zisterziensermönche im 13. Jahrhundert zurück – und wurde im 19. Jahrhundert im “Lubusker Land” noch einmal wiederbelebt, aber erst mit den neuen (privaten) Schloßbesitzern wurde jetzt ein neuer Versuch gewagt. Im kommunistischen Polen hatte es zuvor nur Obst- und Importweine gegeben. Auf dem zu “Mierzecin” gehörenden Weinberg wachsen derzeit 18 verschiedene Sorten, die “Technologie” stammt von Weinbauern an der Mosel. Der Ertrag liegt bei 5000 Flaschen jährlich und wird für den Hotelbedarf verbraucht. Wir konnten ihn noch nicht kosten, da die erste Weinernte erst noch bevorstand, bekamen dann jedoch im Hotelrestaurant – ohne nähere Erläuterungen – Wein, Sekt und Weinbrand aus Polen serviert.
Auch bei unserer nächsten Zwischenstation, auf dem Zisterzienserkloster Paradyz in Goscikowo, gab es keine Weinverköstigung. Zwar wird dort noch Obst im Klostergarten angebaut, aber diesen hat man verpachtet. Das Kloster ist heute Sitz des Priesterseminars der polnischen römisch-katholischen Diözese Zielona Góra-Gorzów. Ein junger Diakon zeigte uns die derzeit von der EU und der Unesco finanzierten Restaurationsarbeiten im Inneren der 1230 erbauten Kirche. Insbesondere die Journalistinnen unserer Gruppe waren von seinen weltgewandten Ausführungen begeistert. Warum das so ist, erklärte uns später der Polenreisende Karl-Markus Gauß (in seinem Buch “Im Wald der Metropolen”): Weil sich in diesem Land “nur jene Männer für die Frauen entscheiden, die für den geistlichen Stand zu hässlich sind”.
In anderen Worten: die attraktivsten polnischen Männer werden Priester. In anderen Ländern bekommt man eher den Eindruck, dass es dort genau anders herum ist. Wenn in Polen Gruppen junger Geistlicher durch die Gegend ziehen, senden “die Mädchen ihnen Blicke eines ganz anderen Bedauerns hinterher als bei uns,” will der Salzburger Autor Karl-Markus Gauß beobachtet haben.
Die nächste Station auf dem Weg nach Zielona Gora war ein Weinberg nahe Zabor. Er gehört einem Lokaljournalisten, dessen Eltern früher Kirschbäume bewirtschafteten. Krzysztof Fedorowicz baut seit fünf Jahren Wein an und hat einen eigenen Weinkeller – die “Winnica Milosz”, wo wir u.a. seinen Spätburgunder, Zweigelt und Traminer probierten. Der Weißwein war mir etwas zu geschmacklos und der Zweigelt schmeckte ähnlich wie ein in Tschechien weitverbreiteter Rotwein. Aus Mähren holt sich der nebenberufliche Weinanbauer, der 2000 Liter jährlich produziert, auch seinen Rat. Es gibt etwa 30 bis 40 Weinbauern in der Gegend, erzählte er uns, sie bieten ihre Produkte vor allem auf dem alljährlichen Weinfest in Zielona Gora an. Da dem polnischen Staat noch nicht klar ist, wie er sie besteuern soll – ob als Bauern und/oder als Unternehmer (was einen großen Unterschied macht), behelfen sich die Weinbauern einstweilen noch damit, dass sie für 15 Zloty bloß ihre Visitenkarten verkaufen – und eine Flasche Wein gratis dazugeben. Seit Beginn der neuen Zeit in der nördlichsten Weinanbauregion Europas wird der Wein ungeachtet dieser Distributionsprobleme in Polen immer populärer, versicherten alle unsere Begleiter und Informanten.
In Zielona Gora gibt es einen imposanten Weinberg mitten in der Stadt – mit einem Palmenhaus obendrauf, das gleichzeitig eine Art Bürgerzentrum mit Restaurant und Veranstaltungsräumen ist. Unten in der Altstadt besichtigten wir noch ein Heimatmuseum, das dem örtlichen Weinanbau eine ganze Abteilung gewidmet hat. In dem einstigen Grünberg waren es zuletzt vor allem deutsche und jüdische Fabrikanten, die aus den einheimischen Trauben erst billigen Wein, dann aber auch Sekt und Weinbrand machten. Unser Dolmetscher dort las uns eine von vielen um 1900 kursierende Satiren auf den sauren Grünberger Wein vor – und behauptete dann, dass sie – immerhin – dazu beigetragen hätten, dass später – im Kommunismus – die meisten Kabarettisten stets aus Zielona Gora kamen. Das sei noch heute in Polen so. Dass wir auf der “Fließend Polnisch”-Fahrt so wenig polnischen Wein zu kosten bekamen lag wohl auch daran, dass er noch eher ein Mittel zum Zweck – “gemütlichen Beisammenseins” – ist (so wie vielleicht das Obstweinfest in Werder bei Berlin während der Baumblüte), als ein “guter Tropfen”, den man gerne auch alleine zu Hause genießt. Dabei mangelte es auf der Tour nicht an Gemütlichkeit. Diese stellte sich meist beim Essen in Kellerrestaurants ein. In Polen mag man anscheinend rustikale Kellergewölbe. Wir vermuteten, dass dies mit den ruhmreichen Perioden der polnischen Geschichte zusammenhängt, in denen das Land okkupiert war und nahezu die gesamte Gesellschaft in den Untergrund ging, um sich von da aus zu sammeln und den Aufstand zu wagen. Kaum befreit und auf ihren Nationalstolz beschränkt, drohte die polnische Gesellschaft aber auch schon wieder zu verzagen. Die Kellerrestaurants und -clubs wirken dabei als eine Art von Gegengift – d.h. wirkliche Gegenwart. Dazu paßt, dass unser polnischer RBB-Kollege uns versicherte, in Zielona Gora gäbe es eine sehr lebendige “Underground”-Scene – und dieser “Underground” sei es, der die Gesellschaft immer wieder vorangebracht habe, nicht die Unternehmer und das Bürgertum.
Die Wodkafirma, die wir nach der Weinexkursion in Zielona Gora besuchten, war früher ebenfalls eine Weinbrand-Fabrik gewesen. Als man 1999 die Marken des staatlichen Wodka-Monopolbetriebs “verteilte”, wurde die Marke Luksusowa an einen schwedischen Konzern verkauft, der u.a. “Absolut-Vodka” produziert. Aber so wie in Autofabriken keine Autos mehr hergestellt, sondern nur Teile zusammengebaut werden, wird auch bei “Luksusowa”der Wodka nicht mehr destilliert. Die Firma bezieht den Alkohol aus den kleinen Schnapsbrennereien der Umgebung, die im Kommunismus wie auch schon während der deutschen Gutsherrschaft Teil landwirtschaftlicher Betriebe waren. Die dort Beschäftigten taten dabei nichts anderes als das, was auch die Landwirtschaftsminister der EU heute “ihren” Bauern abverlangen: Dass sie ihre Produkte selbst weiter verarbeiten und wo möglich direkt verkaufen, denn Gewinn bringt heute vor allem der Handel.
Die Firma “Luksusowa”, die quasi nur noch den Alkohol mit Wasser verdünnt und in Flaschen abfüllt, agiert heute primär am Markt und kreiert dafür immer wieder neue Wodkamarken – billige auf Kartoffel- und teurere auf Roggen-Basis. Bei ihrem letzten Luxuswodka – “Pan Tadeusz”, benannt nach dem gleichnamigen Epos des Nationaldichters Adam Mickiewicz, geriet sie mit dem Staat in Konflikt, der eine derartig enge Verknüpfung dieses Kulturgutes mit dem Nationalgetränk der Jugend nicht zumuten wollte. Auf dem Etikett verschwand daraufhin ein Zitat von Mieckiwicz und sein Konterfei wurde mit mit dem Porträt eines Unbekannten (Dichters oder Trinkers) ausgetauscht.
Den FAZ-Kollegen inspirierte das dazu, sich später ein Buch zu kaufen, in dem nahezu sämtliche Gedanken polnischer Schriftsteller über Alkohol aufgelistet waren. Sein polnische Frau würde ihm einige übersetzen – für seinen Reisebericht, meinte er. Es gab gleich mehrere Journalisten in der Gruppe, die sich über eine oder mehrere Ehen mit einer Polin quasi zu Polenexperten entwickelt hatten. Bei unserer in Berlin lebenden Reiseführerin, Magdalena Korzeniowska, war es dagegen umgekehrt. Und wieder anders war es bei Friedrich Nietzsche, der zu viel “Bier” in der deutschen Intelligenz fand – und darüber zu einem Polen wurde.
In der Luksusowa-Fabrik werden jährlich 60 Millionen Flaschen Wodka abgefüllt – auf zwei Produktionsstrecken: die eine schafft 5000 Flaschen, die andere 15.000 pro Stunde. Besonders beeindruckte uns dabei eine Arbeiterin, die fast allein in der Fabrikhalle in äußerst unbequemer Haltung vor einem der Fließbänder saß auf einem Styroporstück und bei jeder Flasche den Verschluß und die Zollbanderole kontrollierte. An unserem Arbeitsplatz sitzen wir dagegen in der Regel auf einem ergonomisch ausgetüftelten Bürostuhl und haben es mit 26 verschiedenen Buchstaben zu tun. Nach dem Rundgang probierten wir im Verwaltungsgebäude vier Export-Marken der Firma “Luksusowa”, wobei uns der schlichteste (billigste) Wodka am Besten schmeckte, ihr “Kirschwodka” dagegen am Wenigsten.
Weiter ging es nach Poznan – Hauptstadt der Woiwodschaft Wielkopolska. Auf dem Weg dorthin kehrten wir noch in einer der vielen kleinen über das Land verstreuten Brennereien ein. Diese – in Koscian – produzierte den Alkohol für die größte polnische Wodka-Firma “Wyborowa” in Poznan, hatte also einen festen Abnehmer und war dazu noch spezialisiert auf deren teuerste Wodka-Marke “Exquisit” (die Flasche zu 120 Zloty), wofür sie eine besondere Roggensorte verwendete. Der Produktionsleiter bot uns im Keller der Destillerie fünf unterschiedliche “Wyborowa”-Wodkas zur Verköstigung an – nachdem er uns den Produktionsprozeß erklärt hatte. Hier waren die Arbeiter noch nicht von den Automatisierungs-Ingenieuren zu leidiger “Wetware” degradiert worden.
Zwischen den einzelnen Behältern und Pumpen für die biologischen und physikalischen Prozesse, die zur Alkoholproduktion nötig sind, standen Topfpflanzen – die liebevoll gepflegt schienen und überhaupt konnte man es in den Produktionsräumen gut aushalten. Der Betrieb liefert wöchentlich 20.000 Liter “Spiritus”, wie man im katholischen Polen sagt. Er wurde 1991 privatisiert und gehört jetzt zum englisch-irischen Agrarkonzern “Top Farms”, der skandalöserweise mit seinen zwei polnischen Unternehmensteilen (in den Wojewodschaften Oppeln und Wielkopolska) der größte Bezieher von EU-Agrarsubventionen in Polen ist.
Diese sehen vor, große Agrarbetriebe zu bevorzugen, um sie wettbewerbsfähig zu machen, gleichzeitig sollen sie bewirken, dass von 4 Millionen polnischen Kleinbauern etwa die Hälfte aufgibt – und als Arbeiter sein Auskommen sucht. Der Alleinabnehmer der Brennerei, die älteste Wodkafabrik in Poznan “Wyborowa” , befindet sich im Besitz des französischen Spirituosenherstellers “Pernod Ricard”. Als dieser sie erwarb, gab es ebenfalls Ärger wegen EU-Subventionen. “Wyborowa”-Wodka wurde bereits 22 mal als weltweit “bester Wodka” ausgezeichnet, es gibt ihn in 91 Ländern, am meisten wird er seltsamerweise in Italien getrunken. Die “Exquisit”-Flasche entwarf Frank Gehry, ein US-Architekt, der winkelverdrehte Häuser baut – und so nun auch die Wodkaflasche.
Zum Mittagessen, in einem Restaurant am Marktplatz der Altstadt, servierte man uns dort selbst hergestelltes Bier – mit einer speziellen Sorte Gerste und teurem Hopfen gebraut. Bei den Mengen, die man zur Gänze im Restaurant verbrauche, 300.000 Liter im Jahr, könne man sich das gerade noch leisten, meinte der Braumeister, als er uns die Anlage vorführte. Und dann schimpfte er auf das “Scheißlager” der großen Brauereien, die das Bier bis zum Gehtnichtmehr standardisieren und haltbar machen würden. So eine, die zur Zeit modernste der Welt, besichtigten wir dann am Nachmittag: die “Lech”-Brauerei. Sie gehört heute dem südafrikanisch-nordamerikanischen Getränkekonzern “SAB-Miller”. Ihre 700 Beschäftigten in der Brauerei bei Poznan werden von Eurest mit Fließband-Essen versorgt. Diese Catering-Firma gehört der US-”Compass Group”, die in 80 Ländern vertreten ist. Die alte Lech-Brauerei befand sich in der Innenstadt von Poznan, sie ist heute ein riesiges Kunst- und Kommerz-Zentrum, das als “schönstes Einkaufszentrum weltweit” gilt.
Die neue Brauerei am Stadtrand produziert nun noch mehr Bier als früher – nämlich 600 Millionen Liter jährlich. In Polen werden 96 Liter pro Kopf im Jahr verbraucht, insgesamt geht der Bier-Konsum jedoch zurück. Das Lech-Gebräu wird auch exportiert, es muß mindestens 6 Monate “stabil” bleiben. Für einen Liter braucht es 3000 Gerstenkörner und 200 Gramm Malz, viel Wasser und ein bißchen Hefepilz. Die Produktion ist vollautomatisiert. Der Braumalz wird gleich nebenan von einer französischen Firma produziert. Den Bier-Herstellungsprozeß erklärte uns eine sprachkundige junge Frau, die zu einer ganzen Gruppe akademisch ausgebildeter Fabrikführerinnen gehörte. Sie arbeitet auf Honorarbasis bei Lech. Die Besucher stehen dort Schlange. Während früher mehr Wodka in Polen getrunken wurde, verzehrt man jetzt mehr Bier und Wein, erfahren wir. Von Poznan fuhren wir zurück nach Berlin – mit weiteren Schnaps-, Wein- und Bierproben im Gepäck, dazu noch jede Menge regionales Informationsmaterial.
P.S.: Auf dem Internetforum „univie.ac.at“ wurde neulich die Frage gestellt: „Ich habe gerade in einem Ärztemagazin einen Beitrag gelesen, wo Alkohol ein Nährstoff für Bakterien sein soll! Also dass diese sich dabei stark vermehren! Hätte bis jetzt immer gedacht, dass Alkohol (min. 90%ig) Bakterien abtötet…Kann mir das jemand erklären?
„Hab jetzt mal schnell gegoogelt und diese Aussage gefunden – bei Wikipedia: ‚Wasserfreier Alkohol härtet die Bakterien.Tötet sie nicht‘.“
„Also gilt für die Bakterien, was auch für die Nazis und ihre Erziehungsmethoden galt: ‚Was uns nicht umbringt, härtet uns ab‘!?“





süddeutsche zeitung v. 28.August:
Um Salami appetitlich aussehen zu lassen, braucht es Bakterien. Und zwar solche, die Milchsäure produzieren können. Diese Substanz macht rohe Salami chemisch sauer, sie senkt also den pH-Wert der Wurst. Damit wird die Salami zum unwirtlichen Lebensraum für unerwünschte Keime wie E. coli und Salmonellen, die schwere Infektionen hervorrufen können. Damit die Salami genießbar bleibt, müssen also Bakterien andere Mikroben vernichten. Diesen Kampf aber verlieren die nützlichen Keime, wenn sich in der Salami Rückstände von Antibiotika befinden. Das gilt sogar dann, wenn die Medikamentenkonzentration unterhalb der EU-Grenzwerte bleibt. Dies legt eine Studie dänischer und irischer Forscher um Hanne Ingmer nahe (mBio, online). Die Wissenschaftler stellten im Labor den Reifeprozess von Salami nach und verfolgten die Überlebensrate der schädlichen Bakterien. ‚Wir konnten sehen, dass die Milchsäure-produzierenden Bakterien empfindlicher auf Antibiotika reagieren als die pathogenen,‘ sagt Ingmer. Die Medikamente schwächen also ausgerechnet diejenigen Bakterien, die die Salami sicher machen sollen. Die nächstliegende Lösung wäre, Schweinen weniger Antibiotika zu verabreichen. Ingmer jedoch hat noch eine andere Idee, die angesichts wachsender Sorgen vor multiresistenten Erregern etwas skurril klingt: Die Forscherin will Milchsäure-Bakterien züchten, die geringe Antibiotikamengen vertragen.twn