Kleine Geschichte ihres Entstehens und Vergehens
(Gerade noch rechtzeitig vor den Kartoffelferien – und lange vor der nächsten Kartoffelrevolution)
„Als Kartoffelrevolution werden Tumulte bezeichnet, die im April 1847 in Berlin ausbrachen. Die Ursachen lagen in der elenden sozialen Situation größerer Teile der Stadtbevölkerung. Anlässe lieferten die stark überhöhten Lebensmittelpreise aufgrund vorangegangener Missernten. Erst durch Einsatz von Militär konnten die Unruhen nach drei Tagen beendet werden. Die Tumulte werden zur Vorgeschichte der Märzrevolution von 1848 gerechnet.“ (Wikipedia)

Kartoffelkunst: „Erwin“

Kunstkartoffel: „Amflora“
Siehe dazu auch: http://blogs.taz.de/hausmeisterblog/2010/08/06/kulturgut_kartoffel/

Vincent van Gogh: Die Kartoffelesser

Diego Rivera: Kampf um Kartoffelfelder

Mexiko-Poller vor dem Diego Rivera Haus
Die Neurochirurgie in den USA bezeichnete in den Fünfzigerjahren stark hirngeschädigte Patienten als „menschliches Gemüse“. Noch heute bekommt man in angloamerikanischen Internetforen ( wie „answers.com“) auf die Frage, was damit gemeint war, die Antwort: z.B. „That car crash turned her into a human vegetable“.
Zu den damaligen Kritikern dieser Bezeichnung gehörte der vor den Nazis nach Amerika geflüchte jüdische Neurologe Kurt Goldstein, der einen antidarwinistischen, d.h. gegen die „Reduktionisten“ und „Mechanisten“ in den Lebenswissenschaften gerichteten, (goetheanisch-) ganzheitlichen Heilungsansatz bei den Patienten verfolgte. Schon ihre Bezeichnung als „Fälle“ lehnte er ab, weil dies gleichbedeutend mit der „Nummer“ sei, die Naziärzte ihren Patienten auf den Arm tätowierten.
Heilen und Töten seien integrale Bestandteile der selektiven Sozialpolitik der Nationalsozialisten gewesen, ergänzte der Historiker Christian Pross – nach dem „Ärzteprozeß“ in Nürnberg (1947). Die darwinistische Reduktion der Kultur auf Natur und diese auf den Darwinschen Schlüsselbegriff „Selektion“ führte in Deutschland zur Selektion auf der Rampe von Auschwitz: Das „Prinzip Mengele“, wie der Schriftsteller Hans Wollschläger das 1987 genannt hat.
Der radikale Tierschützer wollte damit sagen, dass sich am Prinzip nichts geändert hat: „Sie [die Tiere] werden in Gefängniszellen gehalten, so eng wie die Stehsärge von Oranienburg“. In den Achtzigerjahren kamen dazu in Westdeutschland die Worte „Hühner-KZ“ und „Schweine-KZ“ auf. Das richtete sich gegen die immer weniger artgerechte Haltung von Nutztieren in der industrialisierten Landwirtschaft.
Ich hatte auch manchmal das Gefühl, ein „KZ-Wächter“ zu sein – 1989/90 als Rinderpfleger in der LPG „Florian Geyer“ in Saarmund auf der Vormastanlage in Fahlhorst. Mit welcher Gleichgültigkeit wir dort mit dem Vieh umgingen, war manchmal erschreckend. Aus Bauern oder Bauerseinwollenden waren Arbeiter geworden, die sich nach Feierabend, Ferien und möglichst reibungslosem Ablauf der täglichen Arbeit sehnten – maschinisiert gleichsam. „Der Betrieb muß rund laufen!“ Das pflegten auch die westdeutschen Landwirte zu sagen, meinten damit zunächst aber nur: „Wie möt konkurrenzfähich blievn!“ Mit der Ründe Ernst machten die nach der ganzheitlichen Biosophie Rudolf Steiners wirtschaftenden Bio-Bauern, und blieben dabei sogar noch mehr als „konkurrenzfähig“.
„Mechanisten“ wurden ab Ende des 19. Jhds. parallel zur Industrialisierung Deutschlands die darwinistisch inspirierten Lebenswissenschaftler genannt, weil sie den Organismus und seine Organe als Maschinen begriffen, die ineinander greifen. Dahinter wirkte noch Descartes‘ Diktum, dass Tiere (gefühllose) Maschinen seien. Heute stellt man sich erst recht die Funktionsweise des Gehirns und seines Gedächtnisses vornehmlich als eine Art Computer mit Speicherkapazität vor. Schon vor Ende des Zweiten Weltkriegs waren in den USA Kybernetik und Genetik als zwei Seiten der Medaille – aus der Waffenlenksystemforschung des Militärs – hervorgegangen. Der Nobelpreisträger Francois Jacob, Genetiker am Pariser Institut Pasteur, meinte 1968, man habe sich vom „Leben“ verabschiedet: Heute interessiere sich die Biologie nur noch „für die Algorithmen der lebenden Welt“.
In Deutschland hatten nach 1933 die „Ganzheitler“ unter den Naturwissenschaftlern, sofern sie antibolschewistisch und antisemitisch genug waren, gegenüber den „Mechanikern“ zunächst die Nase in puncto Reputation und Forschungsgelder vorne, indem sie z.B. ihre ganzheitliche Biologie als „deutsche Biologie“ darstellten. Aber dann setzte sich mit der Wiederaufrüstung ab 1936 in der „nationalsozialistischen Bewegung“ die Pragmatik durch – und es wurden wissenschaftliche Technokraten gebraucht.
Die Harvard-Wissenschaftshistorikerin Anne Harrington resümierte diesen Prozeß in ihrer „Geschichte biologisch-psychologischer Ganzheitslehren. Vom Kaiserreich bis zur New Age-Bewegung: ,Die Suche nach Ganzheit'“ wie folgt: „Die wenigen praktischen Anwendungsmöglichkeiten der ganzheitlichen Pyschologie und Medizin im Dritten Reich unterlagen schließlich der militaristischen darwinistischen Ethik und den Technologien des Rassenmanagements, die die Technokraten anzubieten hatten (Rassentrennung, Sterilisation, Kastration und schließlich die Methoden der massenhaften ,Euthanasie‘).“
Am Rande sei erwähnt, dass der zur Menschenzüchtung sich aufschwingende Neodarwinismus – als „Eugenik – in den Zwanzigerjahren mit den Fortschritten der Genetik zunächst auch in der Sowjetunion, in England und Amerika durchaus auf Interesse stieß. So bot z.B. der US-Genetiker Hermann Joseph Muller, der für seine Mutationsexperimente an Taufliegen (Drosophila) 1947 den Nobelpreis bekam, seinen eugenischen Bevölkerungsplan „Out of the Night“ zunächst Stalin an. Nachdem die Prawda Teile daraus veröffentlicht hatte, u.a. dass es bloß noch sozialistischen Helden erlaubt sein sollte, sich fortzupflanzen, dies dafür massenhaft, nur so schaffe man den „Neuen Menschen“, erhob sich ein Sturm der Entrüstung – vornehmlich von Frauen- und Intelligenz-Organisationenen. Muller warb daraufhin in den USA für seine „Biopolitik“.
In Deutschland wurde sie dann weitestgehend realisiert. Hier war seit 1925 insbesondere der sowjetische Genetiker Timofejew-Ressowski, der ebenfalls mit Drosophila forschte (in Berlin-Buch), erfolgreich: Er veröffentlichte seine Überlegungen in der NS-Zeitschrift „Der Erbarzt“. In den Achtzigerjahren schrieb ihm der sowjetische Schriftsteller Daniil Granin eine verlogene Biographie hinterher – mit dem Titel: „Sie nannten ihn Ur“. Nachdem die Rote Armee ihn 1945 „befreite“ hatte, ließ er sich im Ural mit einem informellen Genetik-Institut nieder. Von dort aus erfuhr dann die staatliche sowjetische Genforschung auch ihren Neuanfang.
Mit der Zwangskollektivierung der Landwirtschaft war es zuvor – d.h. ab 1929 – einigen Pflanzenzüchtern, Philosophen, Technologen und Bürokraten gelungen, die sowjetischen Genetiker mit einer „proletarischen Biologie“, die sie der „bürgerlichen“ (genorientierten) entgegensetzen, in den Instituten und Lehrbüchern zu tilgen. Ihr prominentester Vertreter, der Genetiker Nikolai Wawilow starb 1943 im Gefängnis. Die neue Biologie, die auf praktische Erfolge in der Landwirtschaft abzielte, wurde wahlweise auch als „Lyssenkoismus-Mitschurinismus“, „Lamarxismus“ oder „schöpferischer Darwinismus“ bezeichnet. Zu einer Zeit, da die Genetik noch wenig hilfreich war für die Landwirtschaft, schien diese neue – in Wahrheit eher antidarwinistische – Wissenschaft pragmatisch und volksnah genug, versprach nicht weniger als blühende Landschaften – und natürlich Superernten. Brecht hat sie 1950 in seinem Poem „Die Erziehung der Hirse“ besungen.
In der DDR waren und sind demgegenüber die Biologen stolz darauf, dass sie – unter der Führung eines neodarwinistischen Nazi-Botanikers, Hans Stubbe – den „lyssenkoistischen Irrsinn“ fernhalten konnten – und deswegen jetzt als DDR-Wissenschaftler scheinbar gut „aufgestellt“ sind. Die junge Greifswalder Schriftstellerin Judith Schalanski hat ihren Bemühungen in Form einer Biologielehrerin jüngst ein kleines Denkmal gesetzt – mit einem „Bildungsroman ,Der Hals der Giraffe'“. Was allein schon ein Antidarwinismus ist, da dessen vermeintlicher Gegenspieler in der Evolutionstheorie, Lamarck, die Vererbung erworbener Eigenschaften – um einer sich verändernden Umwelt gewachsen zu bleiben, u.a. am Beispiel des langen Halses der Giraffen erklärte. Während Darwin für die Entwicklung der Arten nur zufällige Mutationen gelten ließ, die einer natürlichen und einer sexuellen Zuchtauswahl unterworfen sind.
Zurück zum „human vegetable“, ein äußerst „behindertenfeindlicher Begriff“, wie schon der Neurologe Goldstein kritisierte, der sich in den USA mit der „Abstraktionsfähigkeit“ beschäftigte. Den Verlust dieser Fähigkeit hatte er bereits bei gehirnverletzten Soldaten des Ersten Weltkriegs, die er therapierte, beobachtet (ähnlich wie im Zweiten Weltkrieg dann der wunderbare sowjetische Psychologe Alexander Lurija). Nun versuchte Goldstein sie evolutionsgeschichtlich zu begreifen, wobei er von der „primitiven Konkretheit“ ausging – und bei der für ihn in evolutionärer Hinsicht fortgeschritteneren Fähigkeit, zu trennen und zu abstrahieren, endete. Anders gesagt: Er verfolgte die Entwicklung vom primitiven zum euro-amerikanischen Denken anhand der Heilung eines Hirngeschädigten.
„Primitiv“ ist es, nicht zwischen Kultur und Natur, Subjekt und Objekt, Fakt und Fetisch zu trennen, und statt abstrakt die Tiere, Pilze und Pflanzen nach Arten zu differenzieren, diese als „Leute“ quasi anzusprechen. Wir kennen dieses Denken u.a. aus Wladimir Arsenjews Bericht und Akira Kurosawas Film über Dersu Usala, der einst Taigajäger eines kleinen Volkes am Ussuri war. Neuerdings auch noch aus einem Bericht von Dan Everett über das ebenso kleine Volk der Pirahas, das an einem Nebenfluß des Amazonas lebt und inzwischen wegen seiner Unfähigkeit zu abstrahieren oder auch nur zwei und zwei zusammen zählen zu können, von Wissenschaftlern geradezu überrannt wird. Die Pirahas lehnen alles Religiöse ab, weil sie in ewiger Gegenwart leben, d.h. keine Vergangenheit und Zukunft kennen, auch keine Farben und ähnliche Abstrakte, und nur Augenzeugenberichte als Geschichten gelten lassen. Außerdem erwiesen sie sich bis jetzt fast allen zivilisatorischen Versuchungen gegenüber als resistent.
Seit den Dreißigerjahren bereits hat man bei der Adoption von Schimpansen – durch Familien von Wissenschaftlern – zur Beobachtung der Entwicklungsdifferenzen zwischen ihnen und Menschenkindern, die Erfahrung gemacht, dass ihre geistige und motorische Entwicklung in den ersten Jahren in jeder Hinsicht schneller als die des Menschen verläuft, aber dann stagniert sie. Darum werden solche Experimente meist nach einigen Jahren abgebrochen. Für die betroffenen Menschenaffen ist das nicht selten tödlich.
In Gambia gibt es als touristische Sehenswürdigkeit eine biologische Station, wo Wissenschaftlerinnen zur Auswilderung bestimmte Schimpansen, die in Zoos oder Forschungseinrichtungen groß geworden sind, helfen, in der Freiheit zu überleben. Die gambische Station wird vom „Chimpanzee Rehabilitation Trust“ verwaltet. Deren Gründerin, Stella Brewer, gestand kürzlich in einem Interview, dass Schimpansen, die in einer normalen US-akademischen Mittelschichts-Familie aufgewachsen und erzogen worden sind, nicht an die Freiheit gewöhnt werden können. Sie empfinden sich als Menschen, können vielleicht rechnen, ein bißchen Blindensprache und mit Messer und Gabel essen, aber einem Leben in der Wildnis – und wohlmöglich noch unter Affen – sind sie nicht gewachsen.
Die FAS machte daraus eine große – beispielhafte – Geschichte über Lucy: Eine ab 1964 bei einem US-Psychotherapeuten-Ehepaar aufgewachsene Schimpansin, die später als Erwachsene, weil sie im Haus alles kaputt machte und sogar bald als „gefährlich“ galt, von ihrer „Babysitterin“, Janis Carter, ins gambische Rehabilitationszentrum verfracht wurde, wo die angehende Psychologin sie acht Jahre lang zur Autarkie zu erziehen versuchte, zuletzt gar indem sie sich monatelang selbst in einen Käfig sperrte. Am Ende scheiterte sie dennoch: „Das ganze Projekt war eine einzige Katastrophe,“ so Stella Brewer. Es war aber nicht die erste (1)
Wer oder was sind die bisherigen objektgewordenen Personenkreise: Wir haben den um seine Abstraktionsfähigkeit trauernden Soldaten in den Lazaretten des Ersten Weltkriegs, der eine schwere Kopfverletzung abbekommen hat. Den „Irren“ in den Psychiatrien der USA, der sich chirurgische, chemische und elektrische Eingriffe in sein Gehirn gefallen lassen muß. Die Kinder unter drei bis vier Jahren. Dann den „Primitiven“ (Amazonasbewohner), der nicht rechnen kann, auch wenn er es versucht zu lernen – und sich Abstraktionen gleichwohl fröhlich verweigert. Und schließlich einen anthropologischen Modellorganismus, unseren „nächsten Verwandten“: den Schimpansen – der wegen seiner Zivilisationserfahrung quasi zwischen Natur und Kultur wie zwischen Baum und Borke steckengeblieben ist – und nun weder jemals alleine in eine Kita gehen kann, auch wenn die gleich um die Ecke ist, noch sich wieder in „Freiheit“ behaupten kann – schon allein aus Angst vor wilden Schimpansen (die dann Lucy auch aller Wahrscheinlichkeit nach umbrachten, kurz nachdem ihre amerikanische Babysitterin sie für immer verlassen hatte). Franz Kafka hat das alles bereits kommen sehen – im „Bericht für eine Akademie“. Darin leugnet ein von Hagenbeck gefangener Affe seine Herkunft, um nicht in den Zoo und damit in die Halbwildnis zurück zu müssen.
So etwas Ähnliches geschah von der anderen Seite her auch der Primatenforscherin Dian Fossey: Sie schlug sich im Laufe ihrer Feldforschung derart konsequent auf die Seite einer wilden Gorillagruppe in Ruanda, dass sie die diese gefährdende Zivilisation immer rabiater zurück zu drängen versuchte – bis einige Leute – vermutlich Wilderer – sie schließlich ermordeten.
Der holländische Biologe Midas Dekkers fragte einmal den Tierfilmer Sir David Attenborough, ob Dian Fossey, mit der Attenborough befreundet gewesen war, nicht zu weit gegangen wäre – bei ihrer Verteidigung der Berggorillas gegenüber den von ihr sogenannten Wilderern: „Ja,“ antwortete der „Und sie ging überhaupt zu weit in ihrer Abneigung gegen die Afrikaner. So ließ sie die Bauern in Ruanda wissen, dass sie ihr Vieh nicht im Naturpark weiden lassen durften. Aber es ließ sich kaum sagen, wo der Park begann und endete. Und die armen afrikanischen Bauern hatten nur wenig zu essen. Wenn ihr es doch tut, sagte sie, treffe ich Gegenmaßnahmen. Trotzdem tat es einer von ihnen. Also jagte sie jeder seiner Kühe eine Kugel ins Rückrat. Sie tötete sie zwar nicht, doch sie lähmte sie und raubte dem Besitzer damit Hab und Gut. Einst verschwand ein Gorillababy. Dian glaubte, zu Recht oder zu Unrecht, dass sie den Täter kannte und kidnappte seinen Sohn. Sie band Afrikaner mit Stacheldraht an einen Baum und prügelte sie durch. Das ist keine Art, um die Unterstützung der ansässigen Bevölkerung zu bekommen. Wie auch immer – seit ihrem gewaltsamen Tod, 1985, ist kein einziger Gorilla mehr verschwunden.“ (Noch weitaus brutaler ging dann der Leiter der kenianischen Nationalparks, Richard Leakey gegen (somalische) Wilderer vor, die massenhaft Elefanten wegen ihres Elfenbeins erschossen. Sein Bericht darüber heißt auf Deutsch „Wildlife“. Die New York Times berichtete gestern ganzseitig, dass wegen der wachsenden chinesischen Kaufkraft nun die Elefanten im Kongo massenhaft von Wilderern erschossen werden, wobei jedoch fraglich ist, ob man bei den einheimischen Jägern überhaupt von „Wilderern“ sprechen darf.
Eva Krafczyk schreibt – aus Anlaß von Dian Fosseys 25. Todestag: „Für sie waren die Gorillas nicht nur Inhalt ihrer Arbeit, sie wurden auch zum Familienersatz. Vor allem den Verlust von Tieren durch Wilderer nahm Fossey persönlich. Sie startete einen regelrechten Kreuzzug gegen Wilderer und zerstörte nicht nur ihre Fallen, sondern ließ auch ihre Häuser und Felder niederbrennen. Mit ihrem Vorgehen brachte sie viele Menschen gegen sich auf. Sie warfen ihr vor, Affen wie Menschen zu behandeln und Menschen wie Affen. Viele Ruander sagten, dafür habe sie sterben müssen. Angelegt hatte sie sich auch mit Ruandas Tourismusbehörde, die der Meinung war, Fossey schade dem Tourismus im Land. Die Behörde wollte ihr kein neues Visum ausstellen, nur durch Intervention an höchster Stelle bekam sie es doch noch. Dies habe ihren Tod besiegelt, schreibt der Fossey-Biograf Farley Mowat in seinem Buch. Denn vermutlich hätten nicht Wilderer sie getötet – so die offizielle Version -, sondern Personen im Auftrag der Regierung.“
Diese Geschichte bekam kürzlich ein Pointe, da meldeten die Nachrichtenagenturen: Im „Dian Fossey Gorilla Fund’s Karisoke Research Center“ haben Forscher beobachtet, wie drei männliche Gorillas mehrere Fallen von Wilderern auseinandernahmen – und zwar äußerst fachmännisch. Die Fallen waren für sie als Erwachsene zwar nicht gefährlich, jedoch sei wenige Tage zuvor ein kleiner Gorilla in solch einem „Schnappseil“ zu Tode gekommen, nachdem er sich beim Versuch, daraus zu entkommen die Schulter gebrochen hatte. Das hätte die an sich friedlichen – rein vegetarisch lebenden – Tiere wohl bewogen, zur Tat zu schreiten.
So weit ließ es die kalifornische Anthropologin Shirley Strum nicht kommen. Sie studierte, ähnlich wie die drei o.e. „ersten“ Primatenforscherinnen, aber nach ihnen, 14 Jahre lang Paviane – auf einer englischen Rinderfarm in Kenia, die 18.000 Hektar umfaßte. Als diese verstaatlicht wurde und man Kleinbauern auf dem Land ansiedelte, kam es zum Konflikt: Die Paviane plünderten deren Maisfelder. Dabei wurde immer wieder einer der Räuber getötet. „Ich hasste die Bauern,“ schrieb Shirley Strum in ihrem Buch „Leben unter Pavianen“. Dennoch bemühte sie sich um Deeskalation. Sie war trotz ihrer langjährigen Feldforschung unter Schimpansen nicht ganz so menschenfeindlich geworden wie ihre Kollegin Dian Fossey bei den Berggorillas in Ruanda. Die FAZ schrieb über sie: Ihre Begabung, sich in das Wesen der Gorillas einzufühlen, habe „extremem Gegensatz zu ihrer Unfähigkeit gestanden, im zwischenmenschlichen Bereich Feingefühl, Diplomatie oder Kompromissbereitschaft zu zeigen.“ Sie wurde dann auch auf dem „Gorillafriedhof“ beerdigt, den sie nahe ihrer Forschungsstation angelegt hatte. Ihr Tod sei „das perfekte Ende“ gewesen, meinte ihre Schülerin Kelly Stewart – perfekt aus Fosseys eigenem Blickwinkel: „Sie sah sich als Kriegerin, die hinausging, um den Feind zu konfrontieren. Sie hat immer über eine letzte Begegnung phantasiert.“ (Ähnlich rambomäßig verblödet phantasiert auch Richard Leakey in seiner e.e. Biographie.)
Die Pavianforscherin Shirley Strum erreichte es zusammen mit einem US-Kollegen, den sie später heiratete, dass eine Schule für die Bauern gebaut wurde und man ihnen Landwirtschaftskurse sowie „Wildlife“-Erziehungsprogramme anbot. Zwar änderte sich daraufhin ihre Einstellung gegenüber dem US-Forschungsvorhaben – bis dahin, dass einer der Bauern meinte: „Lieber haben wir Überfälle durch die Paviane und ein Pavian-Projekt, das sie studiert und uns hilft, als keine Paviane und kein Projekt,“ aber schließlich mußte die Forscherin mit ihren etwa 120 Paviane doch weichen: 1984 fing sie die Tiere ein und siedelte sie auf dem Gelände einer anderen Farm in Kenia an. Sie selbst kaufte sich mit ihrem Mann ebenfalls eine Farm – in der Nähe der Hauptstadt Nairobi.
Ein anderer US-Anthropologe, Robert Sapolsky, erforschte ebenfalls jahrzehntelang Paviane in Kenia – insbesondere ihren sich verändernden Hormonspiegel (sein Buch darüber heißt „Mein Leben als Pavian“). „Seine“ Paviane lebten in einem Schutzgebiet, das dann jedoch zerstört wurde – und mit ihm die Pavianhorde. Sapolsky kehrte daraufhin nach Amerika zurück, wo er sich seitdem in Kalifornien mit den neuronalen Ursachen von Depressionen befaßt.
Im Gegensatz zu seinem Forschungsansatz werden inzwischen auch auch bei anderen Affen, vornehmlich von feministischen Wissenschaftlerinnen, über deren innere „Natur“ hinaus ihre kulturellen Errungenschaften studiert, die zwischen einzelnen Gruppen durchaus unterschiedlich sind – z.B. in der Konstruktion ihres Sozial- und Geschlechtslebens, bei der Wahl und dem Gebrauch ihrer Werkzeuge…
Die ersten Affenforscher, die sich als Kulturwissenschaftler begriffen, waren Japaner, u.a. Jun’ichiro Itani, der das 1985 so begründete: „Die japanische Kultur macht kein Aufhebens um den Unterschied zwischen Menschen und Tieren und ist damit bis zu einem gewissen Grad vor den Verlockungen des Anthropomorphismus geschützt…Wir sind davon überzeugt, daß dies zu vielen wichtigen Entdeckungen geführt hat.“ Und tatsächlich hat es das diesbezügliche „Forschungsdesign“ verändert.
Bei der amerikanischen Pavianforscherin Barbara Smuts hört sich das Ergebnis inzwischen so an – in ihrem Buch „Sex and Friedship in Baboons“: „Zu Beginn meiner Forschungsarbeit waren die Paviane und ich in keiner Weise einer Meinung.“ Sie mußte zuvörderst die Paviankommunikation wenigstens annähernd beherrschen: „Erst durch ein gegenseitiges Kennenlernen konnten sowohl Paviane als auch Mensch ihrer Arbeit nachgehen.“ Im Hinblick auf die 123köpfige Affenhorde stellte sich der Forscherin also nicht die Frage: „Sind Paviane soziale Wesen?“ sondern sie mußte sich selbst fragen: „Ist dieses menschliche Wesen sozial?“ (2)
Begründet wurde die japanische Primatenforschung von Kinji Imanishi, der eine Art „Dritten Weg“ zwischen Lamarck und Darwin vorschlug, der dem des russischen Anarchisten Fürst Kropotkin nahe kam. Dazu schrieb der norwegische Friedensnobelpreisträger Jophan Galtung: „Ich möchte betonen, da Kropotkin immer im Gegensatz zu Darwin dargestellt wird, dass es einen japanischen Ansatz gibt, den von Kinji Imanishi. Das ist eine völlig andere Evolutionstheorie. Er beschreibt ebenfalls die Zusammenarbeit, aber auch, dass die Natur sich immer verändert und die Natur sehr viel dynamischer ist, auch in einer kurzzeitigen Perspektive des Dynamischen, und da eröffnen sich neue Nischen. Diese Nischen sind leer. Es gibt keine Tiere, keine Pflanzen, es ist sozusagen wie im Himmelreich. Und dann kommt ein Ei dazu oder ein Samen und fühlt sich ganz wohl und hat dort die Möglichkeit, sich zu entfalten. Das ist weder Kooperation noch Streit, sondern ganz einfach eine Potentialität. Man könnte sagen, dass eine Art, wie Darwin sie dargestellt hat, ein wenig ist wie die britischen Kolonialisten, und das war ja auch sein Modell: Er findet etwas Unterlegenes, und das wird dann ausgerottet. Bei Kropotkin dagegen sind diese Arten liebenswürdig und auf Kooperation eingestellt. Für Imanishi sind sie Entdecker, sie sind auf Entdeckungsreise und finden etwas, wo sie Möglichkeiten haben, ich erwähne das nur, weil ich denke, in einer westlichen Ökonomie sind wir verloren.“
Verloren sind aber auch und erst recht: die gehirnverletzten bzw-amputierten Soldaten, die letzten sogenannten Naturvölker, die zwangszivilisierten Menschenaffen – kurz: das „human vegetable“. Und was ist nun mit den „Couch-Potatoes“ – schaffen sie es noch einmal hoch zu kommen – um sich z.B. dem „Public Viewing“ zu widmen?
Erst einmal gilt es daran zu erinnern, dass sie – als Vorläufer der Computer-Nerds – deswegen Couch-Potatoes genannt werden, weil sie während ihres ausdauernden Starrens auf einen Bildschirm unentwegt Kartoffel-Chips in sich reinstopfen.
Diese Chips, die es in immer mehr „Geschmackrichtungen“ gibt, werden von den ersteren mit „Coke“, von den letzteren mit Bier runtergespült. Ein weiterer Unterschied besteht darin, dass die Computer-Nerds mit ihren Händen die Tastatur bedienen und mit Maus bzw. Joystick arbeiten, während die Couch-Potatoes sich höchstens einmal träge zwischen den Beinen kratzen. Halten wir jedoch fest: Beide leben im Wesentlichen durch Kucken und von Kartoffeln.
Das haben sie mit den „Kartoffelfressern“ gemein – wie die arabischen und türkischen Minderheiten hierzulande die Deutschen nennen. Dies ist teils abfällig gemeint, wird teils aber auch bloß als kleinstes gemeinsames Merkmal aller „Deutschen“ herangezogen. In der Sowjetunion nannte man die Weißrussen „Kartoffelesser“ – weil die Kartoffeln vor allem dort angebaut wurden und viele Sowjetbürger auch nichts weiter als das über sie wußten, außer das sie am entschlossendsten von allen „Sowjetvölkern“ die Deutschen partisanisch bekämpft hatten. Noch heute ist Weißrussland voll mit Kartoffellagern und Partisanendenkmälern.
Dennoch scheint dieses immer noch präindustriell geprägte Land nicht halb so kartoffelversessen zu sein wie die postindustrielle BRD:
Hierzulande wurde die Feldfrucht durch den „Kartoffelbefehl“ Friedrich des Großen eingeführt, dessen 300. Geburtstag man heuer u.a. mit „Kartoffelfeiern“, „-feuern“ und „-reden“ gedenkt. Im „cottamagazin.com“ heißt es über ihn: „Er verordnete den preußischen Landwirten, Kartoffeln anzubauen. Die Lage besserte sich tatsächlich. Seitdem gehören die aus Lateinamerika stammenden Kartoffeln über Generationen hinweg zur Nahrungsmittelbasis in Deutschland.

Der Kartoffelkönig und sein dankbares Volk
Der ,Kartoffelbefehl‘ oder – besser – die wissenschaftlichen Pionierleistungen dazu kommen jetzt nicht aus dem Potsdamer Schloss ,Sanssouci‘, sondern aus den Forschungsinstituten Mecklenburg-Vorpommerns, Sachsen-Anhalts und Niedersachsens. Ziel ihres jetzt gestarteten dreijährigen Projekts ist es, Kartoffeln für die Gewinnung von Energie zu züchten.“ Was für ein Unsinn! (3)
2007 wurde in Deutschland die Sorte „Linda“ zur Kartoffel des Jahres erklärt. 2008 beging man das internationale Jahr der Kartoffel, 2009 kam es ausgehend von „Lindas“ Anbaugebiet um Lüneburg zu einer breiten Protestbewegung gegen die Abschaffung ausgerechnet der beliebten Kartoffelsorte „Linda“ – zugunsten einer von der BASF gentechnisch optimierten namens „Amflora.“
Und gerade ging der „Mecklenburger Kartoffeltag“ zu Ende, wo 200 Kartoffelexperten u.a. darüber diskutierten, warum trotz all dieser Kartoffel-Events und -Kämpfe der Pro-Kopf-Verbrauch an Kartoffeln von 200 Kilogramm im Jahr 1950 auf inzwischen 60 Kilogramm sank. Die Süddeutsche Zeitung vermutet, dass die Deutschen, die ungeachtet ihrer zunehmenden Abwendung von der Kartoffel und ihrer Hinwendung zu noch mehr Döner und Falafel von ihren anatolischen und arabischen Minderheiten weiterhin „Kartoffelfresser“ genannt werden, inzwischen zu faul geworden sind, ihre Erdfrüchte zu schälen. Deswegen fand sie es besonders lobens- und erwähnenswert, dass die Schweiz der Erfindung des Kartoffel-Sparschälers „Rex“ unlängst eine Briefmarke widmete.
Seltsame Ironie: Je weniger Kartoffeln die Deutschen zum Essen schälen, aus Faulheit oder Bequemlichkeit, desto mehr ähneln sie den „Couch-Potatoes“, weswegen das Schimpfwort „Kartoffelfresser“ in gewisser Weise gültig bleibt. Zumal die „Chip“-Hersteller unisono versichern, dass sie hierzulande mit wachsenden Umsatzzahlen rechnen können.
Der Legende nach wurden „Kartoffelchips am 24. August 1853 von George Crum, einem Koch des Hotels Moon Lake Lodge im US-amerikanischen Saratoga Springs, erfunden, weil sich ein Gast – es soll der Großindustrielle Cornelius Vanderbilt gewesen sein – wiederholt über zu dicke Bratkartoffeln beschwert hatte. Als sie schließlich so dünn waren, dass sie sich nicht mehr mit der Gabel essen ließen, war der Gast zu Crums Überraschung begeistert und seine Kreation wurde schließlich als Saratoga Chips in die Speisekarte aufgenommen.
Eine industrielle Herstellung von Kartoffelchips entwickelte sich ab den 1920er Jahren, als Herman Lay, ein Handelsvertreter im Süden der USA, eine Kartoffelschälmaschine erfand. Die Chips blieben zunächst ungewürzt, was ihre Beliebtheit noch begrenzte. In den 1940er Jahren entwickelte der Inhaber eines kleinen Familienbetriebs in Dublin, Tayto, eine Technik zur Zugabe von Gewürzen und Geschmacksstoffen. Nach einigen Experimenten produzierte Tayto die ersten gewürzten Kartoffelchips, Cheese and Onion (Käse und Zwiebel) und Salt ,n‘ Vinegar (Salz und Essig).
Seine Erfindung wurde zu einer Sensation in der Nahrungsmittelindustrie. Die Leiter führender Kartoffelchips-Unternehmen der USA kamen nach Dublin, um bei Tayto das neue Produkt zu begutachten und die Rechte zur Nutzung der neuen Technik auszuhandeln. Durch den Verkauf von Tayto wurde dessen Besitzer zu einem der reichsten Männer Irlands,“ heißt es bei Wikipedia.
Auch die armen – weil enteigneten – Iren waren – in den Augen der Engländer – „Potatoeater“ – bis zwischen 1845 und 1849 die Kartoffelfäule eine Hungersnot auf der Insel auslöste – und drei Millionen Iren starben bzw. in die USA auswanderten. Die Engländer reagierten auf diese Katastrophe ihrer Kolonie vor allem zynisch.
Wie man weiß, übernahm Darwin seinen Populationsbegriff und die Idee der Konkurrenz als treibende Kraft der Evolution vom Nationalökonomen Thomas Malthus. Dieser hatte berechnet, dass die Bevölkerungszahl exponentiell steige, die Nahrungsmittelproduktion in derselben Zeit aber nur linear. Die erheblichen sozialen Probleme seiner Zeit betrachtete Malthus in erster Linie als Folgen einer zu großen Bevölkerung. Er empfahl, die Armenhilfe einzuschränken, sie sei wider den ‚Naturgesetzen der Ökonomie. Denn direkte Hilfe würde seiner Meinung nach die Armen nur ermutigen, noch mehr Nachkommen zu zeugen – und so neue Armut schaffen. „Damit leitete er einen Wandel in der britischen Armenpolitik ein: weg von Almosen, hin zu Zuchthäusern“ – so das „manager-magazin“ – das es managermäßig offen läßt, ob man das nun gut oder schlecht finden soll. Beides kann man auf alle Fälle als eine üble Art von „Kartoffelpolitik“ bezeichnen.

Poller inmitten der „Arabellion“
Anmerkungen:
(1) Das Psychotherapeuten-Ehepaar ließ die kleine Schimpansin zunächst mit ihrem ebenso alten Sohn aufwachsen. Bald merkten sie jedoch, dass Lucy für diesen mehr und mehr zu einem Vorbild wurde – und nicht sie – seine Eltern. Daraufhin trennten sie die beiden.
Die gleich Dian Fossey und Jane Goodall als Nichtakademikerin in die Primatenforschung geratene Birute Galdikas, arbeitet noch heute mit „ihren“ Orang-Utans im Feld. Sie heiratete einen ihrer einheimischen Mitarbeiter auf Borneo, wo sie auch – auf einer Affenstation – lebt. Ihr erstes Kind wurde zusammen mit einem Gibbon und zwei jungen Orang-Utan groß. Er lernte auch als erstes die „Affensprache“. Als Primatenforscherin dachte Birute Galdikas gar nicht daran, diesen „schlechten Einfluß“ auf ihn zu unterbinden. Später lernte er auch die „Sprache seiner Mutter“, und noch später wahrscheinlich auch noch die seines Vaters.
Umgekehrt hatte die russische Primatenforscherin Esperantia Ladygina-Kohts, während sie mit ihrem Mann in den Zwanzigerjahren das „Darwin-Museum“ in Moskau aufbaute, einen Schimpansen wie ihren Sohn großgezogen. Er entwickelte sich ein Jahr lang ähnlich, schien dann aber in seiner Entwicklung stehen zu bleiben.
Zu einem ähnlichen Ergebnis kam kürzlich auch die Leipziger Primatenforscherin Esther Herrmann. Jahrelang war sie nach Afrika gereist, um dort mit Schimpansen zu experimentieren. Es ging darum, ihre Intelligenz zu testen. Daheim in Leipzig, wiederholte sie ihre Versuche – doch diesmal mit zweieinhalbjährigen Menschenkindern. Im Ergebnis kam dabei raus: „Wenn es um logisches Schlussfolgern, räumliches Denken oder das Abschätzen von Mengen geht, sind Schimpanse und Kleinkind ebenbürtig. Sobald aber soziale Fähigkeiten wie das Kommunikationsvermögen gefordert sind, erweisen sich die menschlichen Probanden als deutlich überlegen.“
Erwähnt sei noch die Schimpansenforschung des sowjetischen Wissenschaftsorganisators Otto Julewitsch Schmidt: 1927 hatte der spätere „Held der Sowjetunion“ auf der Affenforschungsstation in Suchumi/Abchasien versucht, Menschen mit Affen zu kreuzen. Damit wollte er die nahe Verwandtschaft von Menschenaffen und Menschen beweisen. Der Versuch mißlang: Es gab nur einen männlichen Schimpansen – und der starb kurz vor Beginn der Verkupplung. Erst seit 1972 weiß man, dass es sowieso nicht geklappt hätte.
Vor einigen Jahren kam eine Slawistin in der Kultursendung „Aspekte“ auf diese Affen-Menschen-Experimente von Otto Julewitsch Schmidt in Suchumi zurück. Ebenso wie dann auch die Bild-Zeitung war dabei wieder davon die Rede, dass dies geschah, weil Stalin „Untermenschen“ bzw. „Arbeitssklaven“ züchten wollte. Auch zwei Wissenschaftshistorikerinnen, Julia Voss und Margarete Vöhringer, kamen später in einem Aufsatz über das Moskauer „Darwin-Museum“ zu einem ähnlichen Resultat. Ihnen zufolge ging es bei den Experimenten jedoch vor allem um zweckfreie Forschung: „Es scheint, als hätten die Aufklärer in Russland die Engführung des Vergleichs von Affe und Mensch im Sinn [gehabt]. Nur, zu welchem Zweck?“
Während es den reaktionären deutschen „Darwinisten“ um einen Beweis der nahen Verwandtschaft von „Primitiven“ und „Primaten“ gegangen war, die sie z.B. gerne photographisch durch Gegenüberstellungen von „Negerkindern“ und „Gorillababys“ demonstrierten, ging es im revolutionären Russland in den Zwanzigerjahren laut Voss und Vöhringer „um die Schließung des ‚missing link zwischen Mensch und Tier.“ (Kürzlich fand man so etwas Ähnliches wie diesen „link“ – namens „Ida“: den Vorfahren des Menschen – als Fossil in der Grube Messel bei Darmstadt.)
(2) Wie man als Affenforscherin feministisch gesonnen auch umgekehrt Kultur in Natur auflösen kann – hat 2008 die Hamburger Schriftstellerin Karen Duve in ihrem – ähnlich wie ihr letztes Vegetarierbuch „Anständig essen“ – aus Selbsterfahrung gespeisten Roman „Taxi“ vorgeführt: Alex, eine etwas lebensuntüchtige Taxifahrerin mit Anflügen von Bonobo-Konfliktverhalten, hat alle Bücher der oben erwähnten Affenforscherinnen sowie noch etliches mehr davon gelesen. Die Kenntnisse daraus dienen ihr nun zur Schilderung – u.a. von Fahrgastbenehmen: „Ein gewalttätiger Mensch“, dessen „Dominanzansprüche aber „in der Zivilisation mit ihren strikten Verhaltensregeln jeden Tag ins Leere liefen. Auswildern ging ja nicht, und so blieb ihm nur die Kneipe ,Goldener Handschuh‘, eines der letzten Biotope, in dem noch das gute alte Schimpansengesetz galt.“
Als der Fahrgast sie blöde anmacht, fragt die Icherzählerin sich verzweifelt, was sie ihm antworten könnte? „Dian Fossey hätte die Situation sofort in den Griff bekommen. Wenn Dian Fossey es mit einem unangenehmen Gorillamännchen zu tun bekam, dann machte sie irgendwelche Schmalzgeräusche und Unterlegenheitsgesten oder stopfte sich ein Büschel Gras in den Mund, um ihn zu beschwichtigen.“ Weil der Icherzählerin aber nichts einfällt, wird ihr Fahrgast immer „hasserfülter…In einer besseren Welt wäre er ein Alphamännchen gewesen – und ich hatte ihm nicht den Respekt gezeigt, den er als Alphamännchen erwarten durfte.“
Dazu fällt ihr die Inschrift auf Dian Fosseys Grabstein ein: „Niemand hat Gorillas mehr geliebt“. Bei einem anderen Fahrgast, der seiner Frau und Tochter sowie der Schwiegermutter während der Fahrt im Taxis durch Hamburg ununterbrochen alle Sehenswürdigkeiten erklärt – jedoch alles falsch erzählt, schimpft die Icherzählerin insgeheim: „Drei Frauen hatte der Blödmann hinter sich sitzen. Drei Frauen! Kaum zu fassen. In einer Orang-Utan-Horde hätte man einen solchen Versager nicht mal in die Nähe der Weibchen gelassen. Das Gesellschaftssystem der intelligenten Raubaffen [womit die Menschen gemeint sind, obwohl die Sumatra-Orang-Utans im Gegensatz zu denen auf Borneo auch gelegentlich kleine Affen jagen und verzehren] sorgte sehr gut für seine unfähigen Männchen. Kein Wunder, dass sie sich mit Veränderungen in diesem System schwer taten.“
Überhaupt nutzt Karen Duve ihr Affenwissen vor allem, um männliches Verhalten zu deuten. Nicht nur das ihrer Fahrgäste, sondern auch das ihrer vier „Chauvi“-Kollegen: „Ich war wie ein einzelner Orang-Utan, den ein geiziger Zoo aus Raummangel mit im Schimpansengehege hielt, wo ihn die Schimpansen zwangen, ein Schimpansenleben zu führen, und ihm gleichzeitig ständig vorhielten, dass er niemals etwas so Tolles wie ein Schimpanse sein würde.“ An anderer Stelle heißt es: „‚Na ja‘, sagte ich, ,letztlich ist auch ein Physiker ein zoologisches Phänomen. Vielleicht ist er dominant. Ein dominantes Primatenmännchen kann schwer nachgeben, geschweige denn Fehler eingestehen – völlig egal, ob es sich um einen Physiker oder einen Schimpansen handelt. Da hilft auch der Doktortitel nicht weiter.“ Einmal wechselt die Autorin jedoch bei ihren Verhaltensvergleichen Geschlecht und Tierart und kommt -lange vor der documenta-Chefin 2012 – auf Frauen und Hunde zu sprechen: Ihr gilt das „Stockholm-Syndrom“ genauso bei Hausfrauen wie bei Haustieren: „Ja, Hunde z.B.. Egal, was für ein mieser Mensch du bist, dein Hund wird dich lieben. Weil er keine andere Wahl hat. Und so funktioniert das eben auch bei Hausfrauen. Man isoliert sie von jedem auch nur halbwegs interessanten Kontakt, und dann lechzen sie natürlich danach, dass der Ehemann nach Hause kommt und ein bisschen was von der großen weiten Welt erzählt…“
Beim Fernsehen zuhause schaltet sie auf einen Tierfilm: Gezeigt wurde, wie eine Anakonda ein Wasserschwein verschlang. „‚Leider konnten wir dem Opfer nicht helfen,“ sagte der Sprecher,“ aber die Icherzählerin ist sich sicher, dass die Filmemacher die Situation sicher für eine „super Szene“ hielten und „vielleicht sogar ein ganz klein bisschen nachgeholfen hatten. Naturfilme, das waren immer auch Snuff-Filme für den Raubaffen Mensch.“
Als 1989 die „Mauer fällt“ muß sie gegenüber einem Freund ihr Desinteresse am Untergang des Sozialismus rechtfertigen: „Das konnte ja gar nicht klappen mit der DDR. Die vorrangigen Primaten-Interessen heißen nun einmal nicht Gleichheit und Brüderlichkeit, sondern Macht und Geltung.“ Ihr Freund meint daraufhin: „Du kannst nicht immer alles mit Affen erklären. Die sind nicht für alles zuständig, deine Affen.“ Als er der Icherzählerin vorschlägt, ihn zu heiraten, entgegnet sie ihm: „Du weißt, dass das nicht geht. Heiraten ist was für Dummköpfe. Eine Primaten-Idee der schwachen Männchen, um die Kämpfe untereinander zu verhindern. Letztlich geht es bloß um die Verteilung derWeibchen. Und um die Befriedigung von Dominanzansprüchen. Deswegen ist es Männern ja auch so wichtig, dass ihre Frauen weniger verdienen und kleiner sind.“
Am Schluß des Romans, als sie langsam genug hat vom jahrelangen Taxifahren, gibt Karen Duve noch einmal ihrer Affenforschungsforschung Zucker – in Form eines Dian-Fossey-Auswegs: „Nehmen Sie einen Schimpansen mit?“ fragt ein Mann sie in einem abgewetzten Zirkuspullover, der auf der Reeperbahn ein Taxi suchte. Sein Schimpanse trug ebenfalls einen Pullover. Die beiden stiegen ein. Der Mann war ein „Brutalo mit kalten Sklavenhalteraugen. Er hatte ein Hundehalsband um den Hals des Schimpansen gebunden. Der arme Affe. Wo man auch hinsah, nichts als Qual und Unterdrückung…Als sich unsere Blicke trafen, begriff ich, dass es dem großen Affen ganz ähnlich ging wie mir: Kein Spaß, kein Ausweg, und nicht die geringste Hoffnung, dass sich daran je etwas ändern könnte…Der Schimpanse sah mir wieder in die Augen und nickte ganz leicht. Herrje, wenn das ein Tier war – was war dann bitte ich? ,Nicht anfassen,‘ sagte der Mann. ,Der ist bösartig, der beißt‘. Er schlug ihm mit der Hundeleine auf den Kopf. ,Nicht schlagen,‘ sagte ich, bitte nicht schlagen.'“
Als der Schimpansenbesitzer, aussteigt, um sich nach hinten zu dem Affen zu setzen, handelt sie „rein instinktiv“ – und gibt Gas. „‚Huuu‘, schrie der Schimpanse.“ Sie fährt zielstrebig stadtauswärts auf die Autobahn in Richtung Südwesten. Der Schimpanse klettert derweil auf den Beifahrersitz. „Immer weiter würden wir fahren, bis nach Spanien, bis wir am Mittelmeer waren.“ Dort würden wir uns bei Nacht nach Afrika übersetzen lassen und dann irgendwie nach Tansania durchschlagen.“
Ob sie sich bis zu der von Jane Goodall in den Sechzigerjahren gegründeten Schimpansenstation in Gombe durchschlagen will, läßt Karen Duve offen. Sie stellt sich vor: „Der Schimpanse würde mir beibringen, wie man in den Dschungelbäumen Schlafnester baut, und ich würde mit meinen letzten Streichhölzern ein Feuer anzünden, in dem wir seinen Häkelpullover und seine Windelhose verbrannten.“ Sie nimmt ihm erst mal das Halsband ab. Der Schimpanse zerstreut den Inhalt des Handschuhfachs, turnt wild im Wagen herum und durchwühlt ihre Haare. „,Verdammt,‘ brüllte ich ihn an, ,kannst du nicht mal fünf Minuten stillsitzen‘.“ Der Affe wird wütend, als er auch noch einen richtigen „Tobsuchtsanfall“ bekommt, kriegt die Icherzählerin Angst. „Ich mußte hier raus. So schnell wie möglich…Wenn ein Schimpanse erst mal einen Angriff gestartet hat, kann man sich jede Unterwerfungsgeste schenken.“ Plötzlich greift der ihr ins Lankrad. „Ich schrie, der Affe schrie.“ Das Taxi schoß über eine Böschung und landete ramponiert in einem Buschwaldstück. Als sie wieder zu sich kommt, ist der Schimpanse weg und sie auf einem Polizeirevier. Auf dem Weg zurück nach Hamburg und in ihre Wohnung muß sie „wieder an den Schimpansen denken…Wie gelassen er durch die geborstene Windschutzscheibe und über die heiße tickende Motorhaube geklettert und in den Büschen verschwunden war, ohne sich ein einziges Mal umzudrehen. Als wüßte er ganz genau, was er nun tun müsste. Ich bereute nicht, dass ich den Affen entführt hatte, aber es kam mir vor wie die Tat eines anderen. So fremd war ich mir in den letzten Stunden geworden.“
(In allen Zeitungen wurde kürzlich Karen Duves letzte Buch – über das Essen – besprochen. Und jedesmal wurde dazu ein Photo der Autorin mit einem Huhn auf dem Arm abgedruckt. Die Hamburger Taxifahrerin wohnt inzwischen in Brandenburg auf dem Land. Sie ist Veganerin geworden und als Tierschützerin mit der Kamera unterwegs, ihr Buch heißt „Anständig essen“ und folgte auf das Buch „Tiere essen“ von Jonathan Foer, mit dem Karen Duve dann einige Lesungen gemeinsam bestritt. Die Autorin berichtet darin über die Schandtaten der Agrarindustrie und ihre eigenen Essensexperimente: Sie ernährte sich biologisch, vegetarisch, vegan und frutarisch [für die Frutarier ist das Ausreißen einer noch lebenden Mohrrübe Mord].
Das Huhn auf dem Arm der Autorin hat einen Namen: Rudi. Der Berliner Zeitung verriet die Autorin, dass es einer „Befreiungsaktion“ aus dem überbelegten Hallenstall eines Biohofs entstammt. Und das ihr, indem sie das Essen mit Moral verband, inzwischen jeder „Hackbraten zu Quälfleisch“ wurde.)
Wie reaktionär ihre Rückführung von Männerverhalten auf Primateninstinkte ist, zeigt die Nähe ihrer Interpretation zu einer neuen Studie von US-Genetikern, die von der Bild-Zeitung wie folgt wiedergegeben wurde:
„Das starke Geschlecht hat mit Affen mehr gemein, als bisher angenommen. Das berichtet das National Geographic“-Magazin in seiner Juli-Ausgabe.
Aus naturwissenschaftlicher Sicht lässt sich heute zwischen Menschen und Menschenaffen keine eindeutige Grenze mehr ziehen. Neueste Studien belegen eine bis zu 99,4 Prozent genetische Gleichheit zum Menschen. So ist beispielsweise das Erbgut von Mensch und Schimpanse – je nach Analysemethode – zu 93,5 bis 99,4 Prozent identisch.
Im Durchschnitt gibt es einen genetischen Unterschied zwischen Schimpanse und Mensch von 1,5 Prozent.
Und jetzt kommt’s: Die Differenz im Erbgut von Menschenfrauen und Menschenmännern kann zwei bis vier Prozent betragen. Es gibt also Männer, die mehr Ähnlichkeit mit Schimpansen haben als mit Frauen! „

Lagos-Poller 1
(3) Der „Kartoffelbefehl“ von Friedrich dem Großen ist heuer Gegenstand einer Ausstellung im Potsdamer „Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte“. Die Ausstellungsmacher sprechen jedoch von einer „Legende“, denn erst unter Friedrichs Nachfolger setzte sich der Kartoffelanbau als billiges Nahrungsmittel durch, „und erst mit der Industrialisierung wurden van Goghs ,Kartoffelesser‘ zum Inbild der Unterschichtenmahlzeit,“ schreibt die FAZ in einer Ausstellungsbesprechung. Desungeachtet legen Verehrer des Alten Fritz auch heute noch Kartoffeln auf sein Grab in Sanssouci.
In Potsdam findet darüberhinaus eine Veranstaltung mit der dänischen Kartoffelkünstlerin Åsa Sonjasdotte im „Syntopischen Salon“ der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften über ihre „Potato Perspectives“ statt. 2010 initiierte sie ein nomadisches Kartoffelfeld mit den unterschiedlichsten Sorten, mittels derer sie die Geschichte dieser Kulturpflanze gewissermaßen nachzeichnete: „The order of the potatoes“ von ihr genannt. Die einzelnen Kapitel daraus bestanden aus jeweils etwa fünf Pflanzen und einem Schild mit den nötigen Erklärungen: angefangen mit den Nachkommen der im 16. Jahrhundert aus Südamerika nach Europa gelangten und 1587 erstmalig beschriebenen neuen Feldfrucht über einige alte bäuerliche Kartoffelsorten, die sich allgemeiner Beliebtheit erfreuen (wie die dänische „Asparges“, die ostdeutsche „Adretta“ und die westdeutsche Industriekartoffel „Linff“) bis zu Neuzüchtungen wie die „Rote Emma“ von Karsten Ellenberg z.B.
Der Kartoffelzüchter aus Barum bei Bad Bevensen baut 170 Sorten an, diese hat er nach der „Mutter der Anarchie Emma Goldmann benannt. Bei einem Rundgang durch die Kartoffelanpflanzungen im Berliner Prinzessinnengarten erklärte Åsa Sonjasdotter: „Die Kartoffelgeschichte hat viel mit Wissen und Macht zu tun. Die Bauern hatten einmal die Macht über ihr eigenes Leben, das dann mehr und mehr reguliert und systematisiert wurde, deswegen nenne ich die Geschichte ‚Order of Potatoes, auch die Kartoffel wurde hochorganisiert.“
Die Künstlerin stammt von der dänisch-schwedischen Insel Ven, wo ihre Eltern eine Hobbylandwirtschaft haben, sie studierte Kunst in Kopenhagen – und kam eher zufällig auf die Kartoffel, wie sie sagt. Das war, als sie sich mit den unterschiedlichen „Stimmen im öffentlichen Raum und der Vielfalt“ beschäftigte. Eine Studienreise nach Indien führte sie zu einer Gruppe von Bäuerinnen, die mit traditionellem Saatgut arbeiteten, um sich damit gegen dessen Industrialisierung im Rahmen der indischen „Green Revolution“ zu wehren: „Sie sind sich des Wissens, das mit der Sorten-Vielfalt verbunden ist, sehr bewußt,“ meint die Künstlerin. Als sie nach Skandinavien zurückkehrte, engagierte sich Åsa Sonjasdotter im Feminismus. Zudem wollte sie die Erfahrung, die sie in Indien gemacht hatte, „auf die hiesigen Verhältnisse“ übertragen. „Die Bäuerinnen redeten von traditionellem und kommerziellem Saatgut. Das bezog sich vor allem auf den Reisanbau. Meine Eltern hatten in ihrer kleinen Landwirtschaft immer Kartoffeln angebaut.“
Åsa Sonjasdotter begann, die Bauern in der Umgebung zu fragen, ob sie noch alte Kartoffelsorten hätten. Es war leichter als sie gedacht hatte. Ihre Funde pflanzte sie auf dem elterlichen Acker ein. „Damals war ich mir noch nicht darüber klar, ob und wie sich das mit meinem Beruf als Künstler verbinden könnte. Ich begann dann nach der Geschichte meiner Kartoffeln zu forschen, die bereits seit Jahrtausenden in den Anden kultiviert werden.“ Die Künstlerin reiste nach Südamerika und studierte den Kartoffelanbau dort. „Man kann die Kartoffel wie ein Prisma benutzen, um die Geschichte zu betrachten. Während der Industrialisierung z.B. brauchten die vielen Menschen, die in die Stadt vertrieben wurden, Nahrung. Die Kartoffel war dafür perfekt geeignet. Einige Historiker meinen sogar, dass sie die damalige Bevölkerungsexplosion überhaupt erst bewirkte. Man hat sich angewöhnt, die Fragen an die Gesellschaft in den Beziehungen von Wissen und Macht zu suchen. Die indischen Bäuerinnen taten genau das. Auch der Kartoffelbauer Ellenberg. Er geht sehr klug vor, er züchtet seine Sorten selbst und verkauft das Saatgut an andere kleine Bauern, die dann damit machen können, was sie wollen. Er hat sich erfolgreich mit seinen Kartoffeln einen neuen Markt geschaffen – von kleinen Bauern. Die Industriekonzerne haben an diesen Markt nicht gedacht. Die meisten Sorten dürfen nicht in der EU gehandelt werden, ähnlich ist es bei den ebenfalls wieder zunehmenden Apfelsorten. Die Kartoffel ‚Rosa Tannenzapfen‘ z.B., die wir auch im ‚Prinzessinnengarten‘ anbauen, kann man nicht im Supermarkt kaufen. Sie sieht aus wie eine Ingwerwurzel. Zu befürchten ist, dass die EU bei den Kartoffeln wie mit den Äpfeln verfahren wird, die dem DUS-Standard – durable, uniform, stable – entsprechen müssen.“
In Peru arbeitete Åsa Sonjasdotter mit Bauern aus sechs Dörfern zusammen, die sich zu einem „Kartoffel-Park“ zusammengeschlossen hatten, um die Sortenvielfalt ihrer Kartoffeln zu schützen. Es war ein „Agroökologischer Naturpark (mit einem ähnlichen Status wie ein Nationalpark). Von diesen Bauern waren dann 2008 auch einige in Bonn – auf dem Weltkongreß Planet Diversity, die der ehemalige taz-Redakteur Benny Härlin mit Hilfe der Zukunftsstiftung Landwirtschaft organisierte.“
Åsa Sonjasdotter war ebenfalls auf diesem internationalen Treffen. Benny Härlin ist sei einigen seit Jahren in der „Gendreck-weg“-Kampagne aktiv, die „Feldbefreiungen“ von Gen-Mais organisiert und derzeit mit ähnlichen Aktionen gegen die Freilandversuche mit der Gen-Kartoffel „Amflora“ vorgeht.
Åsa Sonjasdotters Kunst besteht seit nunmehr 9 Jahren darin, das sie an unterschiedlichen Orten die unterschiedlichsten Kartoffelsorten anbaut. Mehrmals auch bereits in „nomadischen Gärten“, d.h. in transportablen Behältern – u.a. für eine Ausstellung in Amsterdam. 2010 arbeitete sie in Bukarest an einem Projekt der rumänischen Gen-Bank mit: Es werden dort von alten verbrauchten und vom Aussterben bedrohten Sorten Keimstücke abgenommen, aus denen man eine Art von Bonsai-Kartoffeln zieht, „mit dem Saatgut davon lassen sich diese Sorten wieder revitalisieren: they make a new fresh beginning.“ Danacht wird man das Ergebnis in einer Ausstellung zeigen. Fast gleichzeitig nahm die Künstlerin an einem Workshop an der norwegischen Kunstakademie in Tromsö teil, wo man sich viel mit Fragen der Ökologie, der Selbstorganisation und globalen Aktivitäten beschäftigt. Åsa Sonjasdotter war an dieser neugegründeten Akademie die erste Dozentin. Anfang November 2010 war dann Erntezeit für sie in einer Ausstellung in Los Angeles, wo sie 18 amerikanische Sorten ausgepflanzt hatte: beginnend mit solchen aus der Inkazeit herrührend und endend mit der Sorte „Russet Burbank“ – der Mc-Donalds-Kartoffel. „Dort in Kalifornien sind besonders viele Künstler an Garten- und überhaupt ökologischen Projekten interessiert, und die ‚Seed-Saver‘ sind eine große Organisation in den USA. Wenn jemand eine neue Kartoffelsorte gezüchtet hat, gibt denen die Samen dafür. Das sind dann ‚Copyleft-Varieties‘.“
Es ist der Künstlerin zwar wichtig, ihre eigenen Lebensmittel anzubauen, wie sie sagt, aber die knappe Aufzählung ihrer Herbstaktivitäten zeigt bereits: Sie, die derzeit in Berlin lebt, kann sich selbst dort im „Prinzessinnengarten“ nur sporadisch um ihre Kartoffeln kümmern (lat. curare). „Es gibt dort jedoch jemanden, Markus Bennar, der sie täglich gießt, von Kartoffelkäfern befreit usw., ich helfe ihm nur ab und zu, weil ich zu oft unterwegs bin.“ Um eine Zwischenbilanz ihrer Kartoffelkunst gebeten, sagt sie: „The potatoe is the Joker in the Global Game. When the big system fails the people start helping themselve by growing their own food.“

Lagos-Poller 2
Noch ein paar Bemerkungen zum Kartoffelkäfer:
In der Weimarer Republik behauptete die deutsche Propaganda in einem Merkblatt, dass die Kartoffelkäferplage vom Erzfeind Frankreich verursacht worden sei. Im Zweiten Weltkrieg behauptete die Nazi-Propaganda, dass die Amerikaner Kartoffelkäfer als biologische Waffe einsetzen würden, indem sie sie über deutsche Felder abwürfen. Als um 1950 herum fast die Hälfte aller Kartoffelfelder in der DDR vom Kartoffelkäfer befallen wurde, machte die staatliche Propaganda erneut die Amerikaner bzw. die CIA dafür verantwortlich. Gleichzeitig mobilisierte die Regierung alle Schüler und Studenten, um den „Amikäfer“ und seine Larven auf den Feldern abzusammeln. Unterdes forderte die amerikanische Regierung von der Bundesrepublik Deutschland, propagandistische Gegenmaßnahmen zu unternehmen. Diese beschloss daraufhin einen Postversand an sämtliche Gemeinderäte der DDR und den Ballonabwurf von Kartoffelkäferattrappen aus Pappe mit einem aufgedrucktem „F“ für „Freiheit“. Die etwas unglückliche Aktion bestärkte die DDR noch in ihrer Annahme, es mit einer großangelegten US- bzw. Nato-Sabotageaktion zu tun zu haben, die darauf abzielte, eine Hungersnot in den sozialistischen Ländern herbeizuführen.
Auch Polen wurde 1950 von einer Kartoffelkäferplage heimgesucht: „Unerhörtes Verbrechen der amerikanischen Imperialisten“, titelte im Mai des selben Jahres die „Trybuna Ludu. Bis dahin war man dort davon ausgegangen, dass die deutsche Wehrmacht 1939 den Kartoffelkäfer in Polen eingeschleppt hatte. Die Deutschen hatten dort zuvor, im 18 Jahrhundert, schon die Kartoffel eingeführt, weswegen man diese Feldfrucht in Polen auch „Berliner“ nannte. 1950 wurde nun ebenfalls das halbe polnische Volk mobilisiert, um der Kartoffelkäferplage Herr zu werden. Bereits 1946 war dazu eine Kampfschrift: „Der Kartoffelkäfer – ein bunter Saboteur“ von Irena Ruszkowska veröffentlicht worden. An einer Stelle geht es darin um einen Lehrer, der die Kinder und Erwachsenen über die mit der US-Sabotageaktion verbundenen Gefahren aufklärt, um sie zum Kampf gegen die Kartoffelkäfer zu motivieren: „Wenn der Feind die Oberhand gewinnt, wird die Kartoffel vielleicht eines Tages zu einer Delikatesse, die nicht für jedermann erschwinglich ist, so wie Orangen oder Bananen.“
In der DDR veröffentlichte die DEWAG Werbung 1950 eine Broschüre „Arbeiter und Bauern, seid wachsam. Kartoffelkäfer entlang der Bahn und Strassen.“ Das bezog sich vor allem auf den sächsischen Kreis Bautzen. Dazu waren auf einer Karte alle Befallstellen von Kartoffelkäfern in diesem Kreis mit roten Punkten verzeichnet worden.
2001 stand die Kartoffel in Polen erneut im Mittelpunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit: Die Danziger Künstlerin Julita Wojcik hatte eine Performance in einer Warschauer Galerie angekündigt, die darin bestand, dass sie 50 Kilogramm Kartoffeln schälen wollte. Das sei keine Kunst, wurde ihr daraufhin vorgeworfen, ihr gehe es nur um den Skandal, denn „nach der Performance würden die Kartoffeln nicht verzehrt, es handle sich also um Verschwendung und Rowdytum,“ schreibt Sebastian Cichocki in „Alphabet der polnischen Wunder“. 2006 wurde der polnische Präsident Lech Kaczynski von der Berliner tageszeitung mit einer Kartoffel verglichen, woraufhin dieser eine offizielle Entschuldigung von Deutschland, mindestens von der tageszeitung verlangte. Das tat der taz-Journalist, Peter Köhler, auch – allerdings nicht beim Präsidenten, sondern bei der Kartoffel.

China-Poller
2012 wurde zwar nicht der preußische „Kartoffelbefehl“, dafür aber der Befehlsgeber Friedrich Zwo in Polen geehrt – von Künstlern auf der ehemaligen Festung Küstrin:
„Wo Oder sich und Warthe küssen, da entstand aus diesem Schmatz – der Festungsplatz,“ dichtete einst der kunst- und literatursinnige Hohenzollernsprössling Fritz, auch Friedrich Zwo, Friedrich der Große oder Der Alte Fritz genannt (1712-1786). Goethe, der ja bekanntlich das Dichten auch nicht lassen konnte, vertraute deswegen nach dem Tod des laut Erich Honecker „widersprüchlichen Preußenherrschers“ seinem Tagebuch an: „Wir waren alle fritzisch gesonnen“.
Das hat sich gottlob gelegt – sieht man einmal von der völlig verrohten Wilmersdorfer CDU und anderen beinharten „Preußenfans“ ab, die noch heute gerne in Königsberg Danziger Klopse essen – und dazu die Polen scheel ankucken würden (eine der preußischen Tugenden), denn für die Polacken ist unser Alter Fritz schlichtweg ein übles Preußenschwein: Nicht nur war er der erste Deutsche, der ihnen ihre Selbstbestimmung nahm – in der sogenannten Polnischen Teilung (ab 1772), darüberhinaus überzog er sie auch noch mit drei Schlesischen Kriegen ( 1740/1744/1756). Am Ende fühlten sich die Polen als die „Indianer Europas“, wie der polnische Schriftsteller Ludwik Powidaj 1864 schrieb.
Hierzulande hält man den euro-machtgeilen Polenmalträtierer jedoch für einen großartigen Humanisten, einen noch größeren Sumpftrockenleger (Oderbruch) und einen frühkindlich durch seinen Vater – den „Soldatenkönig“ – traumatisierten „Philosophenfreund“. Der Vater ließ nämlich 1730 nicht nur den besten Freund seines damals 18jährigen Sohnes – Hans-Hermann von Katte – köpfen, weil die beiden sich heimlich ins damals liberale England absetzen wollten, sondern tötete 1728 auch noch dessen Lieblingskaninchen. All das geschah auf der Festung Küstrin, wohin sein Vater ihn wegen seiner lyrischen Grillen bis 1732 verbannt hatte.
Die einst slawische Burg war um 1300 über die Tempelritter mitsamt dem sie umgebenden Lebuser Land an die Postgermanen gefallen, die es fortan Altmark nannten – bis es 1945 wieder zur Woiwodschaft Lebus wurde und die Bastion erneut Kostrzyn hieß. Kurz zuvor hatten die kadavergehorsamen Deutschen „ihre“ Festung jedoch derart verbissen verteidigt – noch über das Ende des Krieges hinaus, dass die Rote Armee sie zusammen mit Teilen der polnischen Volksarmee gleichsam schleifen mußte. Am Ende blieb nur ein Steinhaufen übrig, den man zum Teil für den Wiederaufbau von Danzig und Warschau abtrug. Aus den Trümmerfrauen und -männern rekrutierten sich dann die ersten Nachkriegs-Bewohner von Kostrzyn, die sich jedoch außerhalb der Festung ansiedelten. Diese blieb im Wesentlichen „Russenfriedhof“ und wurde dann langsam von der Natur zurückerobert, bis das deutsch-polnische Künstlerduo „Urbanart“ sie 2004 bespielte. „Genius loci“ nannte sich ihr Kunstspektakel, das viele Berliner Kulturinteressierte nach Küstrin lockte. Diese sahen z.B. von der Festung aus zu, wie auf der Grenzbrücke ein polnisches Auto mit einem deutschen frontal zusammenstieß: Das war der Beitrag des bayrischen Künstlers H.S. Winkler. Eine andere Arbeit thematisierte eine auf der versumpften Festung lebende Krötenart, deren Schleim halluzinogene Substanzen enthält.
Im selben Jahr 2004 besuchten über 400.000 polnische Partyschaffende das Umsonst-und-Draußen Festival „Przystanek Woodstock“ am Rande von Küstrin. Wenig später wurde eine von der Bundesbahn stillgelegte Strecke vom Berliner Bahnhof Lichtenberg nach Küstrin wieder – diesmal von privat – in Betrieb genommen. Inzwischen verkehren hier die Züge sogar stündlich. Auch in die Festung wurde investiert: Neben umfangreichen Erhaltungs- und Gestaltungsmaßnahmen richtete man in ihrem „Berliner Tor“ ein Museum ein.
Da die Kulturschaffenden seit der sogenannten „friedlichen Widervereinigung“ am Liebsten grenzüberschreitende „Projekte“ verfolgen (weil diese von der EU üppig gefördert werden), lag es heuer nahe, die 300-Jahrfeier „Friederisiko“ für den Polenschinder Friedrich Zwo von Potsdam bis zur „Bastion Kostrzyn“ auszudehnen. Und da der Leiter des dortigen Festungsmuseums sowie der Bürgermeister von Küstrin mitspielten, hielt den Leiter des Künstlerhauses Bethanien, Christoph Tannert, nichts mehr, 50.000 Euro zusammenzukratzen, um damit zehn Künstler zu überreden, sich an dem Event „Denk-Zeichen Kostrzyn“ zu beteiligen. Am 29.Juli fand die Eröffnung statt – und wieder machten wir -Berliner Kunstbeflissene – uns mit einem Bus-„Shuttle“ auf nach Küstrin, das laut der Einladung noch immer „nicht touristisch erschlossen ist und sich in einem Zwischenstadium befindet“.
Dieses Stadium galt es nun – nebst Freibier und polnischen Würsten – erneut zu würdigen. Als erstes Kunstwerk fiel uns – der Photographin Katrin Eissing und mir – ein riesiges weißes Kaninchen dort auf, das der Dresdner Künstler Roland Boden auf einer ehemaligen Straßenkreuzung aufgesockelt hatte: Zur Erinnerung an das erste Trauma des Alten Fritz.

Kleintier-Denkmal in Küstrin

Kleintier-Handel vor der Volksbühne
An das zweite Trauma – dass er mit ansehen mußte, wie sein Freund, der Offizier Katte, geköpft wurde, sollte eine etwas verhuschte Arbeit von Via Lewandowsky mit dem schlichten Titel „Grundsteinlegung/Ein Denkmal“ erinnern. Während umgekehrt der Frankenberger Ulrich Polster seiner Arbeit, mit der er auf die vermutete narzisstische Persönlichkeitsstörung von Friedrich aufmerksam machen wollte, den kryptischen Titel „“ICD-10 F60.8, 2012, Video / HD Loop, 2:41 min“ gab. Mit der Festung selbst beschäftigte sich die Schweizerin Simone Zaugg, indem sie vis à vis des nicht mehr vorhandenen Schlosses an Stelle der ebenfalls verschwundenen Kirche einen hölzernen Turm errichten ließ, von dem nun stündlich eine Glocke ertönt. Ähnlich zeitbezogen arbeitete auch der Dresdner Roland Fuhrmann: Sein Werk „300 Jahre an einem Tag“ nutzte den Fahnenmast im Schlosshof als Sonnenuhr, die auf Ereignisse der deutsch-polnischen Geschichte weist.
Wer mit eigenem PKW von Berlin nach Küstrin gereist war, konnte unterwegs noch – durchaus auf der „Baltic Fort Route“ bleibend – die Seelower Höhe mitnehmen: eine Gedenkstätte nebst Museum für „Die letzte Schlacht des Zweiten Weltkriegs in Europa“, sowie das Nonstop-Kino im Oderbruchdorf mit der größten europäischen LPG Golzow, wo die längste filmische Langzeitdokumentation aufgenommen wurde und dort gezeigt wird: „Die Kinder von Golzow“. Auf polnischer Seite bot sich dann an, noch den Safari-Park in Swierkocin, mit echten Löwen, und den „Park Dinozaurow“ in Nowiny Wielkie, mit falschen Mammuts, mitzunehmen. Am Ende kam dabei ein mit vielen seltsamen Eindrücken gefüllter Sommerausflug raus. Und man freute sich um so mehr wieder auf sein Zuhause.
Aber schon bald ging es wieder los: nach Stettin: wo 12 deutsche und 11 polnische Künstler im Rahmen einer Polska Biennale eine „Wunderkammer“ mit ihren Arbeiten bestückten. Darunter befand sich auch der Westberliner Künstler Thomas Kapielski, der u.a. einen goldenen Kartoffelstampfer ausstellte. Dieser, so schrieb er, würde dem Amtssiegel Ludwig XIV ähneln, der zur selben Zeit enthauptet wurde da man die Kartoffel in Europa heimisch machte.
————————————————————————————————————————————————–
————————————————————————————————————————————————–

US-Bananenpoller
Zu Ernst Haeckel:
Utopie der deutschen Monisten: „Die Vernunft führt uns zu der Einsicht, daß ein möglichst vollkommenes Staatswesen zugleich die möglichst große Summe von Glück für jedes Einzelwesen, das ihm angehört, schaffen muß. Das vernünftige Gleichgewicht zwischen Eigenliebe und Nächstenliebe, zwischen Egoismus und Altruismus, wird das Ziel unserer monistischen Ethik. Viele barbarische Sitten und alte Gewohnheiten, die jetzt noch als unentbehrlich gelten: Krieg, Duell, Kirchenzwang usw. werden verschwinden. Schiedsgerichte werden hinreichen, um in allen Rechtsstreitigkeiten der Völker und Personen den Ausgleich herbeizuführen. Das Hauptinteresse des Staates wird nicht, wie jetzt, in der Ausbildung einer möglichst starken Militärmacht liegen, sondern in einer möglichst vollkommenen Jugenderziehung auf Grund der ausgedehntesten Pflege von Kunst und Wissenschaft. Die Vervollkommnung der Technik, aufgrund der Erfindungen in der Physik und Chemie, wird die Lebensbedürfnisse allgemein befriedigen; die künstliche Synthese vom Eiweiß wird reiche Nahrung für alle liefern. Eine vernünftige Reform der Eheverhältnisse wird das Familienleben glücklich gestalten.“ (aus: „Die Lebenswunder“ 1904)
Philosophisch verfocht Haeckel eine monistische Naturphilosophie, unter der er eine Einheit von Materie und Geist verstand. So schrieb er in Die Welträtsel: „Die Verschmelzung der anscheinenden Gegensätze, und damit der Fortschritt zur Lösung des fundamentalen Welträthsels, wird uns aber durch das stetig zunehmende Wachsthum der Natur-Erkenntniß mit jedem Jahre näher gelegt. So dürfen wir uns denn der frohen Hoffnung hingeben, daß das anbrechende zwanzigste Jahrhundert immer mehr jene Gegensätze ausgleichen und durch Ausbildung des reinen Monismus die ersehnte Einheit der Weltanschauung in weiten Kreisen verbreiten wird.“ Dabei war Haeckel kein strenger Atheist. Zwar lehnte er jeden Schöpfungsakt strikt ab (daher die Schärfe seiner Auseinandersetzung mit den Kreationisten, etwa mit Arnold Braß und dem Keplerbund), er kam jedoch aus einem christlichen Elternhaus und sah die Natur – bis hin zu anorganischen Kristallen – als beseelt an. Sein Monismus war der einer durchgeistigten Materie, er sah Gott als identisch mit dem allgemeinen Naturgesetz und vertrat einen durch Johann Wolfgang von Goethe und Spinoza inspirierten Pantheismus. In diesem Zusammenhang sprach er u. a. von „Zellgedächtnis“ (Mneme) und „Kristallseelen“. In Die Welträtsel zitiert Ernst Haeckel mehrmals seinen (heute wesentlich weniger bekannten) Kollegen Johann Gustav Vogt, vor allem bezüglich seiner Vorstellungen über Elektromagnetismus und einen universellen Äther. Gemäß Haeckel und Vogt besitzen Masse und Äther sowohl Empfindung als auch Willen, sie „empfinden Lust bei Verdichtung, Unlust bei Spannung; sie streben nach der ersteren und kämpfen gegen letztere“. Wegen dieses Weltbildes werden die beiden auch als hylozoistische Naturphilosophen bezeichnet. Haeckel nahm im September 1904 am Internationalen Freidenker-Kongress in Rom teil, den 2.000 Menschen besuchten. Dort wurde er anlässlich eines gemeinsamen Frühstücks feierlich zum „Gegenpapst“ ausgerufen. Bei einer folgenden Demonstration der Teilnehmer auf dem Campo de Fiori vor dem Denkmal Giordano Brunos befestigte Haeckel einen Lorbeerkranz am Denkmal. Haeckel nahm diese Ehrungen gerne an: „Noch nie sind mir so viele persönliche Ehrungen erwiesen worden, wie auf diesem internationalen Kongreß“. Diese Provokation am Sitz des Papstes löste eine massive Kampagne und Anfeindungen von kirchlicher Seite aus. Insbesondere wurde seine wissenschaftliche Integrität in Frage gestellt, und er wurde als Fälscher und Betrüger dargestellt sowie als Affen-Professor verhöhnt. Allerdings gaben 46 bekannte Professoren eine Ehrenerklärung für Haeckel ab.
Am 11. Januar 1906 wurde auf Haeckels Initiative der Deutsche Monistenbund in Jena gegründet, den Ernst Haeckel schon im September 1904 in Rom vorgeschlagen hatte. Mit dem Monistenbund fanden die bereits seit kurzer Zeit bestehenden, sehr heterogenen monistischen Bestrebungen einen übergreifenden organisatorischen Rahmen, der sich dezidiert auf eine naturwissenschaftliche Basis im Sinne Haeckels stellte, in den aber nicht alle Vertreter des Monismus eingebunden wurden. Haeckel wurde Ehrenpräsident des Deutschen Monistenbundes.
Hans Weinert: Beirat in Ernst-Haeckel-Gesellschaft, Mitherausgeber der Zeitschrift für Rassenkunde, Autor vieler Bücher über Affen, Menschen und den ausgestorbenen Zwischenarten, zuletzt 1957: Die heutigen Rassen der Menschheit:
Hans Weinert (geboren 1887 in Braunschweig; gestorben 1967 in Heidelberg) war ein deutscher Anthropologe, der während des NS-Regimes im Sinne der NS-Rassenhygiene wirkte
In den Jahren 1931 und 1932 unternahm er Blutgruppenuntersuchungen an Menschenaffen, wobei er den Vorschlag machte, eine Schimpansin mit Sperma eines „Afrikaneger(s), am besten vielleicht ein(es) Urwald-Pygmäe(n)“ künstlich zu befruchten.
Weil sich Ernst Haeckel sehr dezidiert zu eugenischen Fragestellungen äußerte und dabei Selektionsmechanismen und Züchtungsgedanken ansprach, wird er von verschiedenen Historikern als einer der wichtigsten Wegbereiter der Rassenhygiene und Eugenik in Deutschland betrachtet.
In Haeckels Buch „Die Lebenswunder“ (1904) heißt es etwa: „Es kann daher auch die Tötung von neugeborenen verkrüppelten Kindern, wie sie z.B. die Spartaner behufs der Selection des Tüchtigsten übten, vernünftigerweise nicht unter den Begriff des Mordes fallen, wie es noch in unseren modernen Gesetzbüchern geschieht. Vielmehr müssen wir dieselbe als eine zweckmäßige, sowohl für die Beteiligten, wie für die Gesellschaft nützliche Maßregel billigen.“ (Die Lebenswunder, 1904, S. 23) Oder: „Hunderttausende von unheilbar Kranken, namentlich Geisteskranke, Aussätzige, Krebskranke usw. werden in unseren modernen Culturstaaten künstlich am Leben erhalten und ihre beständigen Qualen sorgfältig verlängert, ohne irgend einen Nutzen für sie Selbst oder für die Gesamtheit.“ (Die Lebenswunder, 1904, S. 134)
Im Jahre 1900 fungierte Haeckel als Vorsitzender eines Gremiums in einem von der Familie Krupp finanzierten Wettbewerb. Dort wurden Aufsätze bewertet, in denen das Thema „Rassenhygiene“ im Hinblick auf innenpolitische und gesetzgeberische Konsequenzen abgehandelt wurde. Das Gremium behauptete, dass die Idee von der Gleichheit aller Menschen eine „Entartung“ und Degeneration der „Zivilisation“ nach sich zöge.[29] Das Preisausschreiben gewann Wilhelm Schallmayer mit seiner Arbeit Was lernen wir aus den Prinzipien der Descendenztheorie in Beziehung auf die innerpolitische Entwickelung und Gesetzgebung der Staaten?. Diese Arbeit spielte für die Verbreitung der sozialdarwinistischen Ideen in Deutschland eine besondere Rolle, weil sie in großem Maße zu einer Politisierung anthropologischer Themen beitrug.[30] 1905 wurde Haeckel Mitglied in der von Alfred Ploetz gegründeten Gesellschaft für Rassenhygiene. Satzung und Ziel der Gesellschaft sahen die Förderung der „Theorie und Praxis der Rassenhygiene unter den weißen Völkern“ vor. Die Gesellschaft trug in Deutschland wesentlich zur Institutionalisierung der Rassenhygiene als wissenschaftliches Fach bei.
Als einer der ersten deutschsprachigen Autoren, der die Tötung Schwerkranker – auf ihren Wunsch – und Schwerbehinderter – ohne ihre Zustimmung – forderte, wurde Haeckel auch zum Vordenker und Wegbereiter der freiwilligen und unfreiwilligen „Euthanasie“ in Deutschland. Schon drei Jahre vor der Programmschrift Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens von Alfred Hoche und Karl Binding (1920) hatte er in „Ewigkeit“ (1917) über „die unheilbar an Geisteskrankheit, an Krebs oder Aussatz Leidenden, die selbst ihre Erlösung wünschen“, „neugeborene Kinder mit Defekten“ und „Mißgeburten“ unmissverständlich geschrieben: „Eine kleine Dosis Morphium oder Cyankali würde nicht nur diese bedauernswerten Geschöpfe selbst, sondern auch ihre Angehörigen von der Last eines langjährigen, wertlosen und qualvollen Daseins befreien.“ (S. 35) Darin klingt Hoches Begriff der „Ballastexistenzen“ bereits an, und mit seinen Ausführungen über den angeblich geringeren „Lebenswert“ verschiedener Menschengruppen (Lebenswunder, 1904, S. 291-315) hatte Haeckel schon zuvor maßgeblich zur Idee von „lebensunwertem Leben“ beigetragen.
1917 war er an der Gründung der Deutschen Vaterlandspartei, die einen Siegfrieden propagierte, beteiligt. In der Generellen Morphologie heißt es zudem: „Die Unterschiede zwischen den höchsten und den niedersten Menschen [sind] grösser, als diejenigen zwischen den niedersten Menschen und den höchsten Thieren.“ Diesen neuerlichen Affenvergleich folgerte er allerdings ausdrücklich nicht aus der Genetik, sondern aus der sozialdarwinistischen Theorie.
In der Historiographie bestehen zwei Extrempositionen zur politischen Einordnung des Darwinismus bzw. Sozialdarwinismus. Hans-Günther Zmarzlik (1963[32]) zieht eine Linie von sozialdarwinistischen Entwürfen zu rechtsradikalen Ideologien. David Gasmann (1971) und unabhängig davon Richard Weikart sehen in Haeckel gar einen Vordenker des Nationalsozialismus. In Bezug auf den Darwinismus kommt dagegen etwa Gunter Mann (1973) zum Urteil: Darwinismus sei ein integraler Bestandteil der „marxistisch-kommunistisch-materialistischen Weltanschauung“ (Mann). Diese unterschiedlichen Zuschreibungen finden sich vereinnahmend oder ablehnend auch bei Gegnern und Befürwortern Haeckels.
Magnus Hirschfeld gewann Haeckel nach einem Besuch als Autor seiner Zeitschrift für Sexualwissenschaft zum Thema menschliche Hermaphroditen. Bedeutend sind auch die Beiträge, die Haeckels Nachlassverwalter Heinrich Schmidt für die Buchreihen des marxistischen Urania Verlages zum Thema Affenabstammung des Menschen, Kampf ums Dasein oder Fortpflanzung schrieb.
Haeckels Privatsekretär Heinrich Schmidt wurde nach dem Tod Haeckels 1920 dessen Nachlassverwalter und Direktor des Ernst-Haeckel-Hauses der Friedrich-Schiller-Universität Jena sowie Herausgeber der „Monistischen Monatshefte“. Nach dem Verbot dieser Zeitschrift 1933 aus politisch-inhaltlichen Motiven gründete Schmidt die Zeitschrift „Natur und Geist, Monatshefte für Wissenschaft, Weltanschauung und Weltgestaltung“.
Schmidt entwickelte sich zunehmend radikal-nationalistisch.[42] In diesem Zusammenhang griff er auf zum Teil rassistische und nationalistische Argumente zurück, welche in ihrer Radikalität die Meinungen seiner Kollegen Ludwig Plate oder Hans F. K. Günther bei weitem übertrafen.
Sein Versuch, das Ernst-Haeckel-Haus sowie die Person Haeckels im nationalsozialistischen Sinne umzugestalten beziehungsweise umzudeuten, scheiterte letztendlich.
Über den Umweg der Zeitschrift „Natur und Geist“ fanden weltanschauliche Argumente Einzug in das „Standardwerk zur menschlichen Erblichkeitslehre und Rassenhygiene“ von Erwin Baur, Eugen Fischer und Fritz Lenz.
Die Nationalsozialisten beriefen sich immer wieder auf vermeintlich wissenschaftliche Grundlagen, wobei insbesondere auch der „Sozialdarwinismus“ Haeckels vereinnahmt wurde. Haeckel setzte die Kulturgeschichte mit der Naturgeschichte gleich, da beide seiner Meinung nach den gleichen Naturgesetzen gehorchten. Diese Vorstellung soll Hitler stark beeindruckt haben – so jedenfalls die These von Daniel Gasman, The Scientific Origins of National Socialism, 1971.
Dito: Robert Jay Lifton 1986: „Für den Beitrag der jüngeren wissenschaftlichen Tradition zum Nazi-Ethos steht beispielhaft dasWerk von Ernst Haeckel, jenes schrecklichen Biologen und Darwinisten, der durch sein glühendes Eintreten für den romantischen Nationalismus, die rassischen Erneuerung und den Antisemitismus zu einer ideologiegeschichtlichen Schlüsselfigur wurde. Man hat ihn ,den großen Propheten der politischen Biologie in Deutschland‘ genannt.“ Lifton beruft sich hierbei auf Daniel Gasmans Studie über die wissenschaftlichen Fundierungen des Nationalsozialismus – Sozialdarwinismus, Ernst Haeckel und die Monisten New York 1971
Für Lifton war Haeckel „ein starker Befürworter der Eugenik, der ,als direkter Vorläufer‘ des nationalsozialistischen ,Euthanasie‘-Programms bezeichnet werden kann.“ Haeckel als Vorläufer eines Programms?
Über Haeckels „Schüler und Biograph“ Wilhelm Bölsche schreibt Lifton, dass dieser Adolf Hitler „‚direkten Zugang zu den wesentlichen Ideen des Haeckelschen Sozialdarwinismus‘ verschafft hat.“ Wobei er sich erneut auf die Studie von Gasman bezog, sowie auch auf George L. Mosses Buch „Die Krise der Deutschen Ideologie“ – über die Entwicklungslinien der Nazi-Ideologie.
Die Royal Society verlieh Haeckel 1900 die Darwin-Medaille „für seine langanhaltende und hochbedeutsame Arbeit in der Zoologie, die stets vom Geist des Darwinismus inspiriert war“ (Original: „For his long-continued and and highly important work in zoology all of which has been inspired by the spirit of Darwinism)“.
Das Ernst-Haeckel-Haus wurde in der DDR als wissenschaftshistorische Forschungsstätte weiterbetrieben und überstand auch die Wiedervereinigung. In ideologischer Hinsicht wurde bei der Rezeption Haeckels versucht, das revolutionäre Element seiner Biographie zu betonen. So interpretierte Georg Schneider 1950 eine Zeichnung des 16-jährigen Haeckel von 1850 mit dem Titel „Nationalversammlung der Vögel“ als Anteilnahme Haeckels an der innerpolitischen revolutionären Entwicklung Deutschlands, Erika Krauße (1987) wiederum stellte z. B. eine Verbindung der Schullehrer Haeckels mit der Revolution von 1848 her.

Arktik-Poller (am Kap Tscheljuskin)
Zum Alt- und Neubauerntum
1996 veröffentlichte der Wiener Soziologe Roland Girtler ein Buch „Vom Untergang der bäuerlichen Kultur: Sommergetreide“. 2002 eine Studie über „Echte Bauern“, die es nur noch in einigen vergessenen Winkeln der Weltgeschichte gäbe. Gleich am Anfang heißt es, „daß sich seit der Jungsteinzeit, also seit über 5000 Jahren, als der Mensch seßhaft und zum Bauern wurde, in unseren Breiten nicht soviel geändert hat wie nach dem letzten Krieg und vor allem in den fünfziger und sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts, als bei uns die alte bäuerliche Kultur allmählich zu Ende ging.“
Girtler fand echtes Bauernleben nur noch im indischen Gujarat und im rumänischen Siebenbürgen. Über ihn und seine Agrarstudien heißt es: „Er kennt und benennt die ‚Agrarindustrie‘, die ‚Chemisierung des Brotes‘, den ‚Gigantismus‘ der Tierfabriken, die ‚Erniedrigung der Tiere‘, die brutale ‚Gewinngier‘.“ Girtler macht sich keine Illusionen: „Auch die sogenannten Bio-Bauern sind Spezialisten, die sich jedoch bemühen, einigermaßen natürlich, also ohne viel Chemie und freundlich gegenüber den Hühnern und anderem Vieh zu wirtschaften. Mit echten Bauern haben sie nicht viel zu tun.“ Dieser stellt laut Girtler „so ziemlich alles, was er zum Leben braucht, selbst her. Er übersteht Krisenzeiten wie Kriege mit Würde und Tüchtigkeit. Er widerspricht einer langweiligen, konformistischen Konsumkultur. Heute hingegen wird der Bauer dirigiert und geknechtet. Der echte Bauer war autark und auf sich bezogen. Er benötigte keine Förderungen und Ausgleichszahlungen, um überleben zu können.“ Girtlers „echter Bauer“ ist ein Archetyp – ob es ihn nun nicht mehr gibt oder doch wieder geben wird, bleibt letztlich offen. „Die Wahrheit ist uns zumutbar. Der ‚echte Bauer‘ ist eine würdige Gestalt der Trauer wie der Hoffnung“ – so ein Rezensent der Girtlerschen Feldforschung in den Dörfern dieser Welt.
Ebenfalls 1996 hatte der holländische Schriftsteller Geert Mat eine gründliche Einzelstudie über den „Untergang des Dorfes in Europa“ veröffentlicht – am Beispiel der friesischen Bauernsiedlung Jorwerd.
Einige wenige Bauern schaffen es jedoch zu überleben, indem sie sich verwandeln: in Projektemacher, schlechtbezahlte Heimarbeiter oder Agrar-Experten bzw. -Manager. Früher verschwand der Bauer vorübergehend – als Wilderer und als Partisan im Wald bzw. im Gebirge. Auch über den Wilderer verfaßte Roland Girtler mehrere Studien – zu dessen Verteidigung, denn der bäuerliche Wildschütz akzeptierte das Waffenverbot und das (herrschaftliche) Privateigentum an Wald und sonstwie unbebauten Fluren ebensowenig wie der nomadische Viehzüchter.
Eine umfangreiche Regionalstudie, in der je nach Höhenlage mehrere Typen von Wilderern unterschieden werden, veröffentlichte 2001 der Sozialforscher Norbert Schindler über das Salzburger Land: „Wilderer im Zeitalter der Französischen Revolution“. Über die Wandlung des Bauern zum Partisanen urteilt der im Zweiten Weltkrieg als Partisan in Italien tätig gewesene BBC-Programmchef Stewart Hood in seinem Bericht „Carlino“, dass nunmehr, mit dem Verschwinden der Bauern, kein Partisanenkampf mehr möglich sei.
Die Widerstandstheoretiker Marx und Engels wußten bereits, dass der kleinbäuerliche Familienbetrieb keine Zukunft habe, unweigerlich werde er Agrarkonzernen des Kapitals weichen. Die Europäische Union (damals noch EWG genannt) bremste dieses Unheil durch ihren ersten Landwirtschaftskommissar, den Ostgroninger „Herrenbauer“ Sico Mansholt, sozialdemokratisch ab: mit subventioniertem Zwang zum „Wachsen oder Weichen“.
Zwar protestierten immer mal wieder einzelne Bauernfraktionen in Brüssel: Gegen zu niedrige Milchpreise, für höhere Subventionen bei Fleischexporten etc., was in Frankreich bis zur Gründung einer radikalen Agrargewerkschaft – durch den „Bauernsprecher“ José Bové – ging. Anderswo – in Lateinamerika, wo es eine schier ununterbrochene Tradition von oft indigenen Bauern-Aufständen gibt, gründete sich die internationale „Bewegung“ der Kleinbauern und Landarbeiter „Via Campesina“, der z.B. auch die österreichische Bergbauernvereinigung angehört. In Indien, wo es schon lange einen organisierten Widerstand gegen das „Bauernlegen“ gibt – vornehmlich von autonomen Waldvölkern und den untersten Kasten, haben andererseits schon über tausend Kleinbauern, Baumwollanbauer die meisten, in den letzten Jahren Selbstmord begangen, weil sie ihren Hof aufgeben mußten.
Die Herausgeber einer Aufsatzsammlung über „Bauernwiderstand“, Michael Mann und Hans Werner Tobler, meinen, dass dieser Widerstand erst in den Siebzigerjahren in das Blickfeld der (Agrar-)forschung fiel. Zu einer Zeit mithin, in der das damals schon halb entleerte Dorf partiell wiederbelebt wurde – im Osten wie im Westen: Hier waren es arme Linke einerseits und reiche Rechte andererseits. Erstere wollten von den Bauern lernen und deren kulturelle Reste – z.B. in Landkommunen und Schäfereigenossenschaften – bewahren. Letztere wollten sie mit all ihren städtischen Errungenschaften quasi belehren. In Geert Mats beispielhaftem Friesendorf Jorwerd kam dabei schließlich heraus, dass „heute ein Projekt nach dem anderen konzipiert wird – ausgereift und unausgegoren, brauchbar und wahnwitzig, alles durcheinander. Feriendörfer, Yachthafen, Transrapid – es wimmelt von Masterplänen“.Aus Jorwerd wurde so ein „Global Village“.
Aus Bischofferode, dem 1993 durch seinen langen Arbeitskampf berühmt gewordenen Bergarbeiterdorf, berichtet dagegen die Pastorin Christine Haas, „daß jetzt nach der Niederlage so viel rückwärtsgewandtes Zeug im Eichsfeld passiert: Schützenvereinsgründungen, Traditionsumzüge und sogar Fahnenweihen. Zum Glück hat man so etwas noch nicht an mich herangetragen.“
Der englische Schriftsteller John Berger kam in den Achtzigerjahren in seiner Trilogie „Von ihrer Hände Arbeit“ über Bauern trotz aller Bauernaufstände in der Geschichte zu dem Ergebnis: Während für den Stadtbürger die Zukunft immer mehr Möglichkeiten eröffnet, ist es für den Bauern auf dem Land die Vergangenheit, die leuchtet.
Früher reichten einer Familie fünf Kühe, sie durften ihre Schafe selber schlachten, aus der Stadt zugezogene Nachbarn konnten ihnen noch nicht den „stinkenden“ Misthaufen hinterm Haus verbieten, ebensowenig, dass die Kühe beim Gang von und zur Weide jedesmal die Dorfstraße vollschissen…
Die Bauern sind sukzessive in ihren Dörfern zu einer kleinen Minderheit geworden, in vielen Dörfern gibt es gar keine mehr. Zudem sind inzwischen tausende von Dörfer in Ost und West verschwunden – und das nicht nur in Tagebaugebieten.
Man sieht es nur nicht, da man heute auf dem Land meist wie durch einen Tunnel fährt – links und rechts hohe Maisfelder – mit wenigen Sonnenblumen darin. Sie werden subventioniert. Es ist dies eine ästhetische EU-Maßnahme. Dazu gehört auch die Rekonstruktion von Dorf-Brunnen, -Teichen und -Backhäusern. Die ländlichen Gemeinden ähneln heute, mit ihren Fachwerk-Häusern Potemkinschen Dörfern. Wo bleibt der Widerstand?
Gewiß, es gab und gibt immer wieder punktuelle Proteste: die „Landvolkbewegung“ Ende der Zwanzigerjahre in Schleswig-Holstein, mit der sich die Bauern gegen ihre Besteuerung wehrten – und dabei u.a. Finanzämter in die Luft sprengten. Treckerdemonstrationen in Wackersdorf, Gorleben und Lüchow-Dannenberg – gegen Atom-Anlagen bzw. – Deponien. In Berlin protestierten die LPG-Bauern gegen die Abwicklung ihrer Betriebe. Im Alten Land bei Hamburg wehrten sich die Obstbauern gegen ihre Enteignung zugunsten einer Landebahnerweiterung für Airbusse. In Polen gründeten die Bauern aus Protest gegen die EU-Beitrittsmodalitäten sogar eine eigene Partei. Derweil geht das „Hofsterben“ jedoch munter weiter: In Polen geht die EU von mehreren hundertausend Kleinbauern aus, die nach und nach aufgeben werden; in China wurden zig Millionen gezwungen, als Wanderarbeiter ihre Dörfer zu verlassen. Ähnlich ist es im Nahen Osten sowie in Nordafrika.
Und dennoch macht sich zur gleichen Zeit, da mit der Computerisierung und Privatisierung auch immer mehr Industriearbeitsplätze wegfallen, eine wahre „Landlust“ bemerkbar. So heißt hierzulande die einzige erfolgreiche neue Zeitschrift. Daneben begeistern sich die jungen Städter zunehmend auch praktisch für „Urban Gardening“ und „Urban Farming“. Massenhaft werden Straßenbaum-Scheiben bepflanzt. In Frankreich sind die landwirtschaftlichen Fachschulen überbelegt… Aber das alles ist keine „Rückkehr des rebellischen Bauern“, wie die Autoren des o.e. Buches über den „Bauernwiderstand“ titeln, den sie dann auch vornehmlich in Asien und Lateinamerika verorten, sondern läuft eher auf eine Verbäuerlichung der rebellischen Jugend hinaus. „Soweit man eine Vorstellung von einer Veränderung hatte, rechnete man ebenso häufig mit einer Verschlechterung seit dem Goldenen Zeitalter des Ursprungs wie mit einem Fortschritt.“ Das schrieb der Anthropologe Alfred Kroeber 1923. Was man bis in die Sechzigerjahre auf den Bauern münzen konnte, gilt heute auch für Städter.
—————————————————————————————————————————————————————–
—————————————————————————————————————————————————————–

Italo-Poller
Vom Klassen- zum Rassenkampf
Ab Anfang der Siebzigerjahre kam Michel Foucault in seinen Vorlesungen am Collège de France immer wieder auf die Ausgegrenzten und Marginalisierten zurück. Er entwarf dabei ein Konzept der „Gegengeschichte“. Darin postulierte er eine Erklärung durch das Niedere – im Sinne einer Erklärung durch „das Verworrenste, das Dunkelste, das Unordentlichste, das Zufälligste.“ Damals schienen im Westen tatsächlich immer mehr soziale Bewegungen zu erstarken, die sich aus Minoritäten und an den Rand Gedrängten zusammensetzten. Herbert Marcuses diesbezügliches Konzept, resultierend aus den Klassenkampfanalysen in den USA, führte u.a. beim westdeutschen SDS zum Entwurf einer „Randgruppen-Strategie“. Der Philosoph Jean-Francois Lyotard nannte seine politische Idee 1976 „Patchwork der Minderheiten“. Zwanzig Jahre später verlagerte sich diese Nachjustierung des historischen Subjekts geringfügig – auf (illegale) Einwanderer. „Die Fackel der Befreiung ist von den seßhaften Kulturen an unbehauste, dezentrierte, exilische Energien weitergereicht worden, deren Inkarnation der Migrant ist.“ So sagte es z.B. der Exilpalästinenser Edward Said Für den englischen Publizisten Neal Ascherson sind es nun insbesondere die „Flüchtlinge, Gastarbeiter, Asylsucher und Obdachlosen, die zu Subjekten der Geschichte“ geworden sind.“ Der polnische Künstler Krzysztof Wodiczko zog daraus den Schluß: „Der Künstler muß als nomadischer Sophist in einer migranten Polis aufzutreten lernen – auf ihren neuen Agoren, den Plätzen, Märkten, Parks und Bahnhofshallen der großen Städte.“
Ebenfalls an die „urbane Zirkulations-Scene“, mindestens an die Intellektuellen unter ihnen, wandten sich die französischen Philosophen Gilles Deleuze und Félix Guattari – mit einer ganzen (mehrbändigen) „Nomadologie“ – deren Ausgangspunkt zuvor Michel Foucault in seinen 10 Thesen zur „Einführung in das nichtfaschistische Leben“ formuliert hatte: „Glaube daran, dass das Produktive nicht seßhaft ist, sondern nomadisch!“ Dieser positiven Sicht auf alle „Entsetzten“ (Abgewickelten) – infolge der dritten industriellen Revolution und dem „Zusammenbruch des Sozialismus“ – hielt der selbst einst exilierte polnische Soziologe Zygmunt Baumann das Elend de „Überflüssigen“ entgegen: das Schicksal all derer, die weltweit eine neue Existenzweise suchen – und dabei jedoch nicht mehr wie noch vor 150 Jahren auf sogenanntes „unterbesiedeltes Land“ auswandern können. Noch der US-Präsident Theodore Roosevelt stellte Anfang des 20. Jahrhunderts die fast vollständige Ausrottung der büffeljagenden Indianer durch die meist aus Europa kommenden armen Siedler und Pioniere als einen „gerechten Krieg“ dar: „Dieser großartige Kontinent konnte nicht einfach als Jagdgebiet für elende Wilde erhalten werden.“ Die spätere DDR-Autorin und Indianer-Historikerin an der Humboldt-Universität Liselotte Welskopf-Henrich schrieb als Elfjährige einen Brief an Roosevelt, in dem sie sich bitter über die Vernichtung der Indianer durch die US-Truppen beklagte. Zur großen Überraschung ihrer Eltern beantwortete Roosevelt den Brief – und gelobte Besserung.
Foucault widmete sich Ende der Siebzigerjahre in seinen Vorlesungen den Herrschaftsformen, der Gouvernementalität. In diesem Rahmen kam er vom „Rassenkampf“ gegen Ende des 19. Jhds. auf den damals neuen „internen Rassismus“ und eine politökonomische „Biopolitik“ zu sprechen – die gegen die Anormalen und „Degenerierten“ gerichtet war. Der „moderne Rassismus“ besteht für ihn darin, dass man einen Unterschied zu machen begann, „zwischen dem, was leben, und dem, was sterben muß.“ In Westdeutschland konnte noch in den Fünfzigerjahren ein Mediziner wie Viktor von Weizsäcker, der 1940 die „Gestaltkreis“-Theorie veröffentlichte und die Psychosomatik begründete („Um Lebendes zu erforschen, muss man sich am Leben beteiligen.“), das Recht der Mediziner – sowohl auf „Euthanasie“ als auch auf Menschenexperimente – verteidigen. Dass mit den Nazis und ihrer Ersetzung des Klassenkampfs durch den Rassenkrieg die Biologie quasi Staatswissenschaft wurde, haben die deutschen Mediziner, Genetiker, Psychiater und Verhaltensforscher – vorwiegend darwinistischer Ausrichtung – erst einmal begrüßt. Dies galt jedoch auch – bis auf die Forscher, die emigrierten – für viele antidarwinistische „Ganzheitler“ unter den Naturwissenschaftlern und -philosophen, wie die US-Wissenschaftshistorikerin Anne Harrington in ihrer „Geschichte biologisch-psychologischer Ganzheitslehren: Vom Kaiserreich bis zur New-Age-Bewegung. ,Die Suche nach Ganzheit'“ nachwies.
Der US-Psychiater Robert Jay Lifton zitierte in seinem Buch „Ärzte im Dritten Reich“ Viktor von Weizsäcker mit den Worten: „Es ist nämlich so, dass Hitler nicht nur politische Befehlsgewalt hat, sondern auch der erste Arzt ist.“ Ein anderer „Ganzheitler“ (der im Gegensatz zu den „Mechanisten“ bzw. „Reduktionisten“ stand) – Adolf Meyer-Abich, führte während eines Besuchs in Baltimore 1935 einen Film vor, indem er seinen Zuhörern anhand von Bakterienkolonien das „Führerprinzip“ erläuterte. Noch 1968 brillierte der konservative Ethologe und Nobelpreisträger Konrad Lorenz mit einer Kritik an den damaligen linken Bewegungen, indem er von seinen Beobachtungen an Gänsen aus das Verhalten der revoltierenden Studenten biologisch interpretierte. Noch arger trieb es wenig später der französische Genetiker und Nobelpreisträger André Lwoff. In seinem Buch „Die biologische Ordnung“ verglich er die aufständischen Jugendlichen mit Bakterien: „In Frankreich, im Laufe des Monats Mai 1968, wurde ein bestimmter Typ von Ordnung gestört. Ein Sturm hat die Repressoren beschädigt, die Operatoren-Gene haben die Kontrolle durch die Operons verloren. Neue Moleküle wollten den Platz der alten einnehmen und haben das System der Regulation angezweifelt. Aus alledem resultierten unerwartete Ereignisse, interessante Ereignisse und, um alles zu sagen, sehr bemerkenswerte Ereignisse. Es gibt anscheinend nichts Gemeinsames zwischen einer molekularen Gesellschaft und einer menschlichen Gesellschaft. Man kann trotzdem nicht umhin, frappiert zu sein von einer bestimmten Analogie zwischen der phylogenetischen Evolution der Organismen und der historischen Evolution der Gesellschaften.“
Während amerikanische Faschismusforscher dazu neigen, deutsche Biologen – wie den Darwinpropagandisten Ernst Haeckel (Gründer des Monistenbundes, der sich 1904 in Rom zum „Gegenpapst“ ausrufen ließ); den Biologiepopularisierer Wilhelm Bölsche („Das Liebesleben in der Natur“ 1898) und den antidarwinistischen „Umwelt“-Forscher Jakob von Uexküll (Autor einer „Staatsbiologie“ 1915) – vor allem als „abscheuliche Vordenker“ der Nazis abzuqualifizieren, ist die deutsche Biologiegeschichtsschreibung anscheinend eher daran interessiert, sie hochzuqualifizieren, indem ihr politisches Denken als nicht (mehr!) zur (aktuell gültigen) Biologie gehörend, quasi als ihre Privatsache, einfach unerwähnt bleibt. Das Fach bleibt damit durchgehend „im Wahren“, wie Foucault eine solche Diskursgeschichte genannt hat. Dies gilt für die Fachgeschichte der DDR-Biologen noch immer, sie sind stolz darauf, dass der Wissenschaftsorganisator Hans Stubbe ihnen als einflußreichster Genetiker der DDR die antigenetische „proletarische Biologie“ des obersten sowjetischen Agronomen Trofim Lyssenko als eine „Irrlehre“ vom Leib hielt. Dass er für die Nazis ein wichtiger „Züchtungsforscher“ war, ließ aber auch Christa Wolf in ihrem Stubbe-Porträt für die Zeitschrift „Sinn und Form“ unerwähnt.
Ähnlich verfuhr der sowjetische Schriftsteller Daniil Granin in seiner Biographie des sowjetischen Genetikers Nikolai Timofejew-Ressowski: „Sie nannten ihn Ur“. Der Drosophila-Mutationsforscher stieg ab 1925 in Berlin-Buch zum wichtigsten Nazi-Biologen auf, seine „Ergebnisse und Perspektiven“ veröffentlichte er u.a. in „Der Erbarzt“. Selbst in der umfangreichen „Geschichte der Biologie“ – herausgegeben von der Naturwissenschaftshistorikerin der Humboldt-Universität Ilse Jahn, an deren letzte Auflage sich auch Wissenshistoriker aus dem Westen beteiligten – war man anscheinend daran interessiert, all die eben genannten Biologen zu requalifizieren, indem ihr politisches Denken als nicht (mehr!) zu den Fortschritten des Fachs gehörend, quasi als ihre Privatsache, einfach unerwähnt blieb. Privat ist inzwischen auch noch etwas anderes geworden: nämlich die (staatliche) Eugenik – Euthanasie und Menschenexperimente. Indem jeder nun selbst entscheiden kann: Soll er bzw. sie vielleicht ein „unwertes Leben“ (z.B. mit einem „Gendeffekt“) im Frühstadium abtreiben? Oder soll er oder sie sich z.B. auf medizinischem Wege selbst „wertvoller“ – schöner, intelligenter etc. – machen – notfalls mit neuen Organen von Armen aus der Zweiten und Dritten Welt „gespendet“? In Deutschland ist man aus naheliegenden Gründen bei dieser neuen Eugenik auf privater Basis (noch) etwas zurückhaltender als z.B. in den USA. So warnte hier z.B. der Soziologe Jürgen Habermas 2001 vor den „fatalen Folgen“ der „genetischen Bastelwissenschaft“, wie der Chemiker Erwin Chargaff die moderne Genetik mit ihren pharmakologischen Zielvorgaben nennt.
Für Habermas gilt: „Gott bleibt nur so lange ein ,Gott freier Menschen‘, wie wir die absolute Differenz zwischen Schöpfer und Geschöpf nicht einebnen“. Das „gen-ethische Netzwerk“ der deutschen Genkritiker legte dagegen jüngst nahe, dass sich im Postfaschismus die Biopolitik vom Staat auf den Bürger verlagert – was in ihrem Artikel „Aufstand gegen den Tod“ als ein ständiger Zwang zum „Enhancement“ – zur „neoliberalen Selbst-Optimierung“ – bezeichnet wird: „In den 1980ern und 1990er Jahren verband sich die Idee des biomedizinischen Enhancements eng mit libertärem und neoliberalem Denken. Vielen ihrer Anhänger ging es vor allem um ein ,Enhancement für mich‘ – was auch immer die „biokonservative“ Mehrheit davon halten mochte. Seit der Gründung der World Transhumanist Association (WTA) 1998 und dem Institute for Ethics and Emerging Technologies (IEET) werden transhumanistische Ideen aber zunehmend mit Hilfe klassischer linker, zumindest sozialdemokratischer Argumentationsmuster verbreitet. Neben die Forderung nach einem individuellen Recht auf Enhancement (im Sinne einer Abwesenheit gesetzlicher Verbote) treten zunehmend auch soziale Gleichheits- und Gerechtigkeitserwägungen. ,Enhancement für alle!‘ heißt das neue Leitmotiv. So geht es beispielsweise darum, wie der Zugang zu Enhancements egalisiert werden kann oder wie die entsprechenden Technologien zum Empowerment unterprivilegierter Gruppen beitragen, etwa durch medikamentöse Intelligenzsteigerungen. Nicht zuletzt wird damit der Enhancement-Diskurs von den Ob- zu den Wie-Fragen gelenkt.“
Die slowenische Philosophin Alenka Zupancic, Schülerin von Slavoj Zizek, hat dies bereits 2000 geahnt. In ihrem Buch „Das Reale einer Illusion“ geht es um Kants „Ethik“, die mit der Umwandlung des Sozialstaats in einen Sicherheitsstaat immer mehr in dessen Dienste genommen wird, wodurch sie zu etwas „im Kern Restriktives, eine Funktion“ wird. Möglich wird dies laut Zupancic dadurch, dass man „jeder Erfindung oder Schöpfung des Guten entsagt und ganz im Gegenteil als höchstes Gut ein bereits fest Etabliertes oder Gegebenes annimmt (das Leben etwa) und Ethik als Erhaltung dieses Gutes definiert.“ Das Leben mag die Voraussetzung jeder Ausübung von Ethik sein, aber wenn man aus dieser Voraussetzung das letzte Ziel der Ethik macht, ist es Schluß mit der Ethik. Sie basiere nunmehr auf einer regelrechten „Ideologie des Lebens“. Life-Sciences.
„Das Leben sagt man uns, ist zu kurz und zu ,kostbar‘, um sich in die Verfolgung dieser oder jener ,illusorischen‘ Projekte verstricken zu lassen. Die Individuen müssen sich immer öfter Fragen lassen: Was hast du aus deinem Leben gemacht? Du hast zehn Jahre mit einer Sache verloren, die zu keinem greifbaren Ergebnis geführt hat? Du hast keine Nachkommen? Du bist nicht einmal berühmt? Wo sind denn die Ergebnisse deines Lebens? Bist du wenigstens glücklich? Nicht einmal das! Du rauchst!“ Laut Zupanpancic wird „man nicht mehr nur für sein Unglück verantwortlich gemacht, die Lage ist noch viel perverser: das Unglück wird zur Hauptquelle der Schuldigkeit, zum Zeichen dafür, dass wir nicht auf der Höhe dieses wunderbaren Lebens waren, das uns ,geschenkt‘ worden ist. Man ist nicht etwa elend, weil man sich schuldig fühlt, man ist schuldig, weil man sich elend fühlt. Das Unglück ist Folge eines moralischen Fehlers. Wenn du also moralisch sein willst, dann sei glücklich!“

Österreich-Poller
Positive und Negative Menschenbildner
Die Anthropologie/Ethnologie erforscht – gerne an „Primitiven“ und „Tieren“, was den Menschen ausmacht. Wobei es eine naturwissenschaftliche Anthropologie gibt, die ihn als biologisches Wesen begreift – und eine sozialwissenschaftliche, die u.U. trotzdem nach seinem „freien Willen“ fragt. Dazwischen erstreckt sich die „Kulturanthropologie“, in Deutschland auch „Volkskunde“ früher genannt, der es lange Zeit um die Differenz zu anderen Völkern ging – ebenfalls um der Freiheit willen. „Die Freiheit, die die germanischen Krieger genießen,“ sagte Michel Foucault in seiner Vorlesung 1976, „ist [jedoch] wesentlich eine egoistische Freiheit, eine der Gier, der Lust auf Schlachten, der Lust auf Eroberung und Raubzüge…Sie ist alles andere als eine Freiheit des Respekts, sie ist eine Freiheit der Wildheit…Und so beginnt dieses berühmte große Porträt vom ‚Barbaren, wie man es bis zum Ende des 19.Jahrhunderts und natürlich bei Nietzsche finden wird – den die Nationalsozialisten dann zu ihrem biopolitischen Vordenker erklären.“ Wobei ihre „Transformation aus der Absicht der Befreiung die Sorge um [rassische] Reinheit werden läßt.“
In Deutschland kreierte man unlängst eine „schwarze Anthropologie“ – die vom Marquis de Sade bis zum Psychologen Georg Wagner reicht, der damit unsere Angst vor Zerstörung und Gewalt als eine Angst auch vor der Faszination durch Gewalt bezeichnet. Die „schwarze Anthropologie“ und ihr düsteres Menschenbild ist selten, schreibt „Die Zeit“. „Werdet Selten!“ riet Nietzsche. Dem entgegen steht eine „negative Anthropologie“ – das Hauptwerk des Sozialphilosophen Ulrich Sonnemann, auch „Vorstudien zur Sabotage des Schicksals“ genannt. Der Spiegel faßte sie so zusammen: „Befreiung aus der Abhängigkeit von unbewußten Triebmechanismen – wie Freud laut Sonnemann formulierte oder von ehernen Gesetzen der Menschheitsgeschichte – wie Marx nach Sonnemann annahm – ist nur möglich, wenn die Menschen ein neues ,utopisches Bewußtsein‘ verwirklichen, sich ,anders verhalten‘, ,den Berechnungen sich entziehen, das Unerwartete tun‘. Diese Möglichkeit, unvorhergesehen, ,spontan‘ zu handeln, habe der Mensch durch seine ,originäre Intelligenz‘, die weder meßbar noch vorherbestimmbar noch manipulierbar sei. Ihre Wesenszüge sind die ,Überraschung‘, und der ,Durchbruch durch ,Schranken‘. Solch spontanes, eine konkrete Situation reflektierendes Handeln ist laut Sonnemann nicht triebhaft-impulsiv, sondern intelligent und zugleich moralisch, weil es die ,Einheit von Wahrheit und Wille‘, von Theorie und Praxis intendiert.“ Sonnemanns „Negative Anthropologie“ wird neuerdings von der französischen Aktivistengruppe „Tiquun“ anarchisch weitergesponnen.
Dem ging in Folge von 68 ein wahrer „Ethnoboom“ voraus, aus dem sich hierzulande eine Reihe kompetenter aber „grauer Flanellethnologen“ herausmendelte. Inzwischen sind wir alle Anthropologen, dabei wurde uns jedoch der ethnologische Blick zu einem ethologischen, der nun, zumal mit dem „Erfolg der Biologie“, das „Gespenst einer rassistischen Synthese der Kulturwissenschaften wieder sichtbar werden läßt,“ wie der Ethnologe Thomas Hauschild 1995 befürchtete. Von der anderen Seite stellt sich dieses Problem jedoch ganz anders: Aus der biologischen Verhaltensforschung wurde inzwischen eine feministische Ethologie als Kulturwissenschaft. Nicht nur kritisiert man z.B. im Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig Darwin darin, dass er der Evolution der Kultur zu wenig Beachtung gegenüber der Evolution der Natur schenkte, obwohl doch unsere eigene Evolution gänzlich kulturell geschähe. Darüberhinaus unterscheidet man auch bei immer mehr Tierarten zwischen den Kulturen verschiedener Populationen der gleichen Art. Die Ethologie wird dabei zu einer Ethnologie, die bis zu Individidualbiographien reichen könnte – und sich damit auf dem Weg zu einer „historischen Wissenschaft“ macht.
Was im übrigen auch schon der völkische Ethologe und neodarwinistische Instinktforscher Konrad Lorenz ahnte: Einerseits wollte er versuchen, „aus dem Verhalten von Tieren gewisse, in den tiefsten Schichten menschlichen Seelenlebens sich abspielende Vorgänge dem Verständnis näher zu bringen.“ Gänsewissen ist auch Menschenwissen! Andererseits hat Lorenz „von der Vorstellung nie ganz gelassen, man müsse jeden einzelnen Vogel persönlich kennenlernen, wenn man etwas über die Eigenart des jeweiligen Tieres in Erfahrung bringen will.“
Der sowjetische Psychologe und Psychiater Alexander Lurija bezog das auf Menschen (Patienten), als er sich die (Re-) Konstruktion einer „romantischen Wissenschaft“ zur Aufgabe machte – und dazu ein „ganzheitliches Vorgehen“ für notwendig erachtete (siehe JW v. 14.8.2012).
Auf das Ganze haben es laut Claude Lévi-Strauss auch die heutigen Ethnologen noch abgesehen, wobei sie vom Studium fremder kleiner Völker, die noch im „Authentischen“ leben, zur Erforschung „authentischer Inseln“ in unserer westlichen – im Ganzen „inauthentischen“ – Welt (-Gesellschaft) fortgeschritten sind.
———————————————————————————————————————————————————-

Norwegen-Poller mit Nazis
Acker- und Ökobürger
Auf dem Weg von Swinemüde u.a. über den kleinen Oderhafen Gartz nach Berlin kamen wir an den riesigen Anlagen eines Biogas -und Spritkonzerns vorbei. Gartz, etwas unterhalb von Stettin gelegen, scheint heute nur noch von den Wanderern auf dem Oder-Neiße-Radweg zu leben. Der 1249 gegründete Ort – nun inmitten des Nationalparks Unteres Odertal gelegen – hat eine noch z.T. erhaltene Stadtmauer, im Torwärterhaus wurde 1990 ein Ackerbürger-Museum eingerichtet.
Das interessierte uns, denn diese Form mittelalterlicher Semi-Urbanität könnte unsere postmoderne Zukunft sein: Ackerbürger, heute würde man sagen: Ökobürger, das waren damals die Gartzer, die nicht vom Handel oder Handwerk leben konnten, denen daneben aber auch der Garten hinterm Haus nicht genug zum Leben abwarf, weswegen sie noch einige Äcker und Weiden samt Scheunen und Ställe außerhalb der Stadtmauern unterhielten.
Ähnlich war es bei den Ostfriesen: um z.B. Bürger von Emden zu werden, mußte man mindestens ein paar Ziegen besitzen, notfalls auf Kredit angeschafft, die dann auf dem eingedeichten Land vor der Stadt gehütet wurden. Dazu mußte man sich an Deichwartungsarbeiten beteiligen.
Heute, so hat der Münchner Biologe Josef Reichholf festgestellt, findet bei den Städtern und der Stadtentwicklung, ganz besonders bei den Berlinern, in ökologischer Hinsicht ein „Öffnungsprozeß zur Landschaft hin“ statt. Während „bei den Dörfern die historische Entwicklung bis in die allerjüngste Zeit fast genau umgekehrt“ verlief: Aus der „Eingebundenheit in das Umland wurde eine zunehmend stärkere Trennung; eine Isolation, die durch scharfe Trennung zu den monotonen Maisfeldern oder anderen großflächigen Monokulturen so verstärkt wurde, dass den Dörfern oft ihr Wesenszug abhanden kam“ – vor allem wenn in ihnen auch noch die Viehwirtschaft industrialisiert und in Zweckbauten separiert wurde sowie drumherum riesige Anlagen zur Energiegewinnung errichtet wurden – und werden.

Öko-Poller 1

Öko-Poller 2

Öko-Billard

Öko-ÖPNV

Das Gartzer Ackerbürger-Museum entpuppte sich als eine liebevolle Zusammenstellung von Wohnungseinrichtungsgegenständen aus dem 18. und 19.Jhd., wie sie heute jeder Ökobürger gerne für seine Datsche oder ausgebaute Remise sammelt. An der Kasse kauften wir zur Vertiefung des Ackerbürgergedankens einige Broschüren über die Geschichte der Stadt sowie ein Glas Holunderblütengelee: selbst hergestellt von den Museumsfrauen. Auch diese Nebeneinnahme, der wunderbar frisch schmeckende Brotaufstrich, war in gewisser Weise noch dem Ackerbürger-Gedanken geschuldet.
Wieder zurück in Berlin entdeckte ich im Buchladen ein soeben erschienenes Pamphlet: „Kartoffeln und Computer“ des Schweizer Anarchokommunisten „P.M.“ Und darin findet sich bereits ein ganzes Konzept, ein Plan, für ein Leben als Ökobürger – im Kollektiv: „Gemeinsamer Wohlstand wird in Zukunft zweierlei bedeuten: Zugang zu Land und Zugang zu Wissen – im Grunde geht es also um Kartoffeln und Computer,“ so der Nautilus-Verlag im Klappentext. Dieser „Zugang“ zu Land besteht bei vielen Ökobürgern aus Aneignung: Das begann – in Berlin ebenso wie in Detroit, Havanna oder Peking – mit der „Begrünung“ von Balkonen und Dachgärten bzw. Hinterhöfen, griff auf den öffentlichen Raum über: auf Baumscheiben und ungenutzte Flächen wie Industriebrachen, und dehnte sich schließlich ackerbürgermäßig auf Pachtgrundstücke vor der Stadt aus.
P.M. schreibt: „In den Regionen muss die Verknüpfung von Bauernbetrieben mit städtischen Nachbarschaften organisiert werden.“ Dies geschieht besonders häufig in Berlin, wo die Entvölkerung des Umlands es vielen jungen Leuten ermöglichte, sich dort billig anzusiedeln. Der nächste Schritt war die Iniitiierung halbprivater „Food-Coops“ in der Stadt, in denen nun ihre Agrarprodukte an die Nachbarschaften drumherum verkauft werden. Die Idee ist uralt und hängt mit wirtschaftlicher Verelendung zusammen: So baute Siemens in den Zwanzigerjahren bereits in Staaken an der Heerstraße Häuser mit Gemüsegarten und Ziegenställe, damit die darin lebenden Siemensarbeiter bei vorübergehender Auftrags- und damit Arbeitslosigkeit nicht verhungerten. Bei Danzig machte man nach 1990 den Versuch, arbeitslosen LPG-Arbeitern statt Sozialhilfe Ziegen zu übereignen. Im Endeffekt wird sich die hochtechnisierte Arbeitsteilung mit 40-Stundenwoche, Auto, Komfort-Urlaub und Kranken- sowie Rentenversicherung als eine vorübergegangene Entwicklung in den einst industrialisierten Ländern darstellen. Eine Art Goldenes Zeitalter des Proletariats – das die Hochzeit des Bauerntums ablöste und nun der primitiven Selbstversorgung verbunden mit Hightech-Kommunikation weicht.

Kartoffelbauern einst (im Familienverband, der nur mit Handgeräten ausgerüstet war, dafür jedoch mit reichlich Nachwuchs gesegnet, wie man so sagte. „Familie – das ist wie eine gute noch intakte Maschine, die von der Welt abgenutzt wird, schade sie aufzugeben, aber sinnlos sie neu aufzuziehen. Es gelingt nicht, Mann und Frau müssen jeden Tag das Defizit decken,“ wie der „Strukturalist“ Viktor Schklowski bereits 1925 meinte. Zuletzt konstatierte der Antipsychiater David Cooper 1971 den „Tod der Familie“ – in seinem “ Plädoyer für eine radikale Veränderung“)

Kartoffelvollernter von Samro (Schweiz)

Junge Städter mit Abitur, die sich in der „nicht-kommerziellen Landwirtschaft“ der „Lokomotive Karlshof“ (bei Templin) als Kartoffelernter verdingen – und dabei singen.
Sie bekommen für ihre Mühen einen Teil der Ernte, ein anderer Teil wird über ein „Kartoffelcafé“ in Kreuzberg an Interessierte abgegeben. Die Alltagsforscherin Gabriele Goettle hat die Betreiber des Karlshofs 2010 interviewt: http://www.taz.de/!47299/ Hier einige Auszüge daraus:
„Sie bauen Kartoffeln an und verschenken sie. Sie haben kein karitatives Motiv. Sie wollen durch Aufbau einer nichtkapitalistischen Versorgung eine soziale Kettenreaktion auslösen. Die Mitglieder des Karlshofs sind keine Eigentümer. Er wurde ihnen zur Verfügung gestellt, von der Projektwerkstatt auf Gegenseitigkeit (PAG), einem Netzwerk von Gemeinschaftsprojekten und einzelnen Leuten in Berlin und Brandenburg, das, in Kooperation und mithilfe einer Stiftung, Liegenschaften kauft und leihweise an geeignete Projekte vergibt. Der Karlshof ist eines dieser Projekte.
Eine Schar von Leuten leistet ab und an solidarische Hilfe bei diversen Arbeiten auf dem Karlshof. Besonders zur Kartoffelernte im Herbst kommen für 14 Tage zahlreiche Netzwerkhelfer und Freunde angereist. Sogar die Kinder des benachbarten Waldkindergartens helfen, und auch Kinder aus der Freien Schule Templin, die auch Kartoffeln erhält. Man ist mit verschiedenen landwirtschaftlichen Kooperativen in gegenseitiger Hilfe und, wie es Peter formuliert, „bedürfnisorientiertem Austausch“ verbunden.
Die Wahnwitzigkeit des Unternehmens wird angesichts der alten und reparaturbedürftigen Gebäude und Arbeitsgeräte, des Dieselpreises und der Materialkosten besonders deutlich.
Peter redet ernst, manchmal stockend, wenn er ein Wort auslässt, sagt er manchmal einfach nur ’so‘, oder er lächelt.
‚2006 ist die NKL ja in Gang gekommen, als Versuch, eine alternative Wirtschaftsform zu praktizieren, jenseits vom Markt, mit dem Ziel, sich so weit wie möglich vom Geld zu lösen. Sich anders zu vergesellschaften, denn darum geht es. Es gab von Anfang an relativ viel Feedback von Berlin, auch einen größeren Interessentenkreis. Wir machten damals für diese Idee Propaganda. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe ,Die globalisierte Kartoffel‘, im Café Morgenrot in Berlin, wurde das Konzept vorgestellt. Auch im Café der Agrarwissenschaftler in der Humboldt-Uni und später bei der Vorbereitung des G-8-Gipfels. Im Frühjahr 2006 jedenfalls schickten wir unseren ,Aufruf zur Selbstorganisierung‘ an Hausprojekte, Landprojekte, WGs und politische Gruppen. An 150 bis 200 Menschen erst mal. Wir kamen auf einen Bedarf von etwa 4,15 Tonnen Kartoffeln, die wir auf 0,7 ha produzieren wollten. Bald schon gab es ein gemeinsames Kartoffelkäferablesen. Und dann, im September 2006, der große Augenblick, die Ernte! Es kamen überraschend viele Helfer. 4,5 Tonnen wurden geerntet.
2007 vergrößerten wir die Anbaufläche. 8,5 Tonnen war die Ernte. 2008 waren es schon 15 Tonnen auf 1,5 ha. Und zum ersten Mal hatten wir auch alle Saatkartoffeln aus eigener Produktion, die mussten wir ja anfangs kaufen. Also wir haben zwei Tonnen Saatkartoffeln rein getan und 15 Tonnen geerntet. Und 2009 haben wir auf 2 ha 18 Tonnen geerntet. Das ist doch eine recht gutes Ergebnis, dafür, dass wir keinen Dünger in den Boden geben?!
Aber es ist natürlich nicht das Ziel, immer mehr zu ernten. Wir erheben den Bedarf, und danach produzieren wir. Wir fragen im Netzwerk herum: Wer braucht wie viele und welche Kartoffeln? Der Bedarf pro Nase im Jahr liegt ja so bei 50 bis 55 kg.‘ [Um 1900 war es fünfmal so viel; Anm. G.G.] ‚Wir haben inzwischen verschiedene Kartoffelsorten, festkochende, mittelfeste und mehlige. Sogar rote. Und die werden dann mit dem Hänger nach Eberswalde, Potsdam und Berlin gebracht und eingelagert in Kartoffelkellern; das sind Orte, wo du hingehen und deine Kartoffeln abholen kannst. In Berlin ist es jetzt nicht mehr im Bethanien. Wir machen neuerdings das Kartoffelcafé in Kreuzberg, in der Admiralstraße 17, im Laden der KPD/RZ‘. [Hierbei handelt es sich um die Spaßpartei „Kreuzberger patriotische Demokraten/realistisches Zentrum“; Anm. G.G.)
Wir möchten wissen, was denn eigentlich genau von den Nutznießern der Kartoffeln erwartet wird. ‚Also der Beitrag, den wir erwarten, der wird nicht definiert, wir hoffen auf gute Einfälle. Das kann zum Beispiel Mithilfe sein im Kartoffelcafé. Es gibt eine Menge Möglichkeiten der Mitarbeit und Hilfe. Je nach Zeit und Fähigkeit kann die sporadisch sein oder auch regelmäßiger. Es gibt Leute, die sagen, okay, wir sind Mitglied im Netzwerk. Und es gibt Leute, die machen halt einfach nur so mit. Wir informieren im Internet über den Verteiler, was wir konkret brauchen. Also das kann praktische Hilfe sein, Marmelade kochen, was mauern, oder wenns ein Ingenieur ist zum Beispiel, der kann mit statischem Wissen helfen, mit einer einfachen Konstruktionsskizze für den Bau von einem Silo.
Und die Kartoffeln, die wir verschenken, sollen auch keine Verpflichtung sein, keine Vergütung für vergangene oder künftige Dienstleistungen. Wir wollen eben keinerlei Äquivalententausch, wir wollen nicht den Wert von Kartoffeln oder Leistungen taxieren und verrechnen müssen. Wozu? So müssen wir auch nicht immerzu gucken: Ist das jetzt gerecht oder ungerecht? Wurden wir übervorteilt? Das ist wahnsinnig erleichternd, wenn man das alles mal hinter sich hat!
Es gibt auch Leute, die sich Kartoffeln abholen, ohne direkt etwas für uns oder das Netzwerk zu tun. Es ist einfach so, es gehört mit zum Prinzip der Selbstorganisation, dass man umdenkt und sich überlegt: Was kann ich tun? Das und das wird vielleicht gebraucht, das und das wäre jetzt wichtig, die und die Bedürfnisse hat der andere. Anfangs hatten die Kartoffeln ja so eine Agitpropfunktion, inzwischen sind sie auch Symbol und Beweis dafür, dass es geht, und eine Aufforderung dazu, dass sich andere Produktionsbereiche gründen und selbstständig im Netzwerk engagieren. Das passiert auch.
Gut, während ich hier auf dem Acker herumfuhrwerke, haben andere an der Uni promoviert. Es ist schon ein sozialer Abstieg, wenig Geld, wenig Sicherheit, kein sozialer Status. Das ist vielleicht der Preis, den man in dem Sinne bezahlen muss. Aber das ist eine Sache der Perspektive. Denn wenn ich mir anschaue, wie es mir geht, dann würde ich sagen, ich fühle mich wesentlich besser hier. Es gefällt mir, draußen zu arbeiten, es gefällt mir, wofür ich arbeite. Und diese Freiheit, einfach etwas machen zu können, die habe ich in diesem Kontext mehr als anderswo. Zum ersten Mal bin ich nicht mehr so frustriert, nicht mehr so machtlos‘.“
2011 wollte ich die Leute von der Lokomotive Karlshof interviewen, dazu sollte ich ihnen bei der Kartoffelernte helfen, wozu ich jedoch in dem Moment keine Lust hatte. Anschließend hörte ich, dass ihre Ernte in dem Jahr sehr schlecht ausgefallen sei – nicht zuletzt wegen einer Kartoffelkrankheit. Wie es in diesem Jahr mit der Ernte aussehen wird, habe ich noch nicht rausbekommen können – die Nachrichten über die NKL bei Templin im Internet sind mehr als spärlich, anscheinend hocken die NKLer selbst nach sechs Jahren noch immer lieber auf ihren alten DDR-Traktoren als vor dem Bildschirm. Sogar auf die Gefahr hin, zu verkartoffeln – also sich selbst zu „human vegetables“ zu evolutionieren.
Nein, dem ist nicht so: Von Imma Harms erfuhr ich eben via Email, dass die Lokomotiv-Gruppe sich zerstritten und aufgehört hat. Sie hat es nicht mal mehr geschafft, mehr als die Hälfte der diesjährigen Kartoffeln zu ernten. Es gibt derzeit eine Notmannschaft, die da eingesprungen ist – und die auch den Rest der Kartoffelernte einholen wird. Geteilt hat sich auch das Buchladenkollektiv „Schwarze Risse“, entlang der Genderlinie glaube ich, ihr Ostberliner Laden heißt nun auf alle Fälle „Buchladen zur schwankenden Weltkugel“. Und dann hat sich auch noch das Kleinkollektiv Mohr-Rübner zerstritten – an ihrer Aufarbeitung der „Roten Hilfe“. Dazu werden nun also wohl zwei Bücher erscheinen. Hartmut Rübner stellt sein Buch demnächst im Buchladen „Schwarze Risse“ sowie in der Kneipe „Rumbalotte“ vor.
Erwähnt sei hier aber noch, dass die Aktivisten des „Prizessinnengartens“ am Moritzplatz unverdrossen weitermachen, ihre „nomadische Landwirtschaft“ droht itzo jedoch zu einer seßhaften zu werden, denn das Bezirksamt will sie anscheinend dort weg haben, während sie aber bleiben wollen – und dazu bereits eine kleine Bürgerbewegung initiierten – der Tagesspitzel schrieb kürzlich: „Die Kreuzberger wollen ihren Prinzessinnengarten retten: 17 000 Unterschriften sind bereits für die Rettung zusammen gekommen. Trotzdem ist unklar, wie es mit Berlins Vorzeigeprojekt weitergeht.“ An Internet-Eintragungen über diese nomadische Landwirtschaft ist übrigens kein Mangel! Heute, am 20.9., so erfahre ich dort gerade, findet im Prinzessinnengarten eine „Diskussionsrunde zur Zukunft des Prinzessinnengartens und des Moritzplatzes unter Beteiligung von Politik, Akteuren aus der Nachbarschaft, der Initiative Stadt Neudenken und den urbanen GärtnerInnen des Gartens“ statt. Thema: „Was wird aus dem Prinzessinnengarten – wohin geht das ’schöne und wilde Berlin‘?“
Und da ist da noch nebenan im Kreuzberger Kunstraum Bethanien eine Ausstellung mit dem Titel „Hungry City – Landwirtschaft und Essen in der zeitgenössischen Kunst“ in der die beteiligten Künstler städtische und ländliche Motive zusammenführen. Eine Arbeit – von KP Brehmer – heißt „Kartoffelpreise 1968-1974“, eine andere, wegen der allein es sich schon lohnt, hinzugehen, heißt: „Ich bin gerne Bauer und will es auch bleiben“. Gezeigt werden Videos eines Langzeitprojekts von Antje Schiffers und Thomas Sprenger. Näheres dazu findet man bereits unter: http://blogs.taz.de/hausmeisterblog/2010/04/01/mondscheinbauern/. Gezeigt wird ferner eine Dokumentation von Asa Sonjasdottir über das nach der Wende abgewickelte DDR-Institut für Kartoffelforschung in Groß-Lünewitz. Es hatte 600 Mitarbeiter, einige machten sich nach ihrer Entlassung mit einigen Patenten und einer Firma namens „Norika“ selbständig, wobei sie u.a. dafür sorgen, dass die DDR-Kartoffel „Adretta“ weiter angebaut wird. Für 3 Euro kann man im Kunstraum Bethanien eine Broschüre über das Kartoffelinstitut kaufen. Des weiteren wird in der Ausstellung die Umwandlung von Grünanlagen zu Gemüsegärten in Andernach dokumentiert. In diesem Ort, ebenso wie in Echternach, finden „Springprozessionen“ statt – zwei Schritt vor drei Schritte zurück. Dies ist sozusagen der lokalkulturelle Hintergrund für den Rückbau bzw. die Umwandlung der Grünanlagen iun Andernach. In der Ausstellung sind daneben aber noch andere interessante künstlerische Auseinandersetzungen mit dem Thema „Agrikultur“ vertreten. Und neben dieser Ausstellung im Bethanien „wuchert der Nachbarschaftsgarten ‚Ton Steine Gärten‘ in spätsommerlicher Pracht. Das passt gut,“ schreibt die Berliner Zeitung in ihrer Ausstellungsbesprechung. Darüberhinaus sei hier noch die ökologisch in Umbau begriffene Markthalle in der Kreuzberger Pücklerstraße sowie der Künstler-blog inklusive einer papierenen Zeitschrift von Anke Wulffen „Balkon und Garten“ erwähnt. Außerdem die aus Wien stammende Zeitschrift „Malmoe“, in deren neuester Ausgabe es u.a. um eine kritische Auseinandersetzung mit dem „Gärtnern in der Stadt“ geht, daneben in einem Interview mit der Kulturtheoretikerin Elke Krasny um „Handlungsfähigkeit ergärtnern“. Und dann haben wir da noch den Künstlerinnen-Verein „Land-Kunst-Leben“, der einen Großteil des Schloßgartens in Steinhöfel bewirtschaftet – u.a. mit dem langjährigen Projekt „Wir beeten für Sie!“ Die Berliner Zeitung schreibt über dieses Projekt:
„Die Idee, gestaltete Beete zu vermieten, ist nicht neu, sagt Christine Hoffmann. Gerade in Großstädten wie Berlin gebe es viele dieser Angebote: in Rudow, Wartenberg und sogar auf dem ehemaligen Flughafengelände Tempelhof. „Wir wollen die Leute rauslocken aus der Großstadt“, sagt sie. Der entscheidende Unterschied in Steinhöfel: „Die Leute müssen keine Hacke oder Gießkanne in die Hand nehmen.“
Der Verein Land-Kunst-Leben bewirtschaftet den ehemaligen Schlossgarten in Steinhöfel und veranstaltet jedes Jahr ein Kunstprojekt. Das Gestalten der Beete mit alten Nutzpflanzen und essbaren Blüten, das sei auch eine Kunst, sagt Christine Hoffmann.“
Was sagt uns diese sich derzeit ballende Ladung von Agrarkunst- und -kultur und die um sich greifende Beschäftigung mit Kartoffeln, Äpfeln, Schleimpilzen, Affen, Hunden, Krähen, Augentierchen, Amöben, Kastanienbäumen, Algen, Flechten, Schnecken, Rindern, Katzen, Kindern, sogenannten Primitiven (Naturvölkern) usw.? Schon allein ein Blick auf die Umschläge der ganzen jüngst veröffentlichten Romane, die überhaupt nicht von Tieren oder Pflanzen handeln, zeigt: Entweder haben sie dennoch Titel, in denen ein Tier vorkommt („Der Hals der Giraffe“, „Gerechtigkeit für Igel“, „Der Wurm am Turm“ etc.) und/oder sie wurden mit einem Tier illustriert (davon gibt es inzwischen Hunderte). Meine Vermutung – ausgehend von meiner eigenen „Befindlichkeit“: Immer mehr Leute haben es satt, sich mit Integration, Prekarisierung, Rentenverfall, Privatisierung, Islamisierung, Mohammed-Karikaturen, Banken- und Eurokrisen, Obama und Osama, Tatort-Krimis, Schulmiseren, Copyrights- , Kopftuch- und Beschneidungs-Debatten, Klimakatastrophen, Energieengpässen und -preisen, den Hutu-Rebellen, Putin und Schmutin, Israel, Antisemitismus, Neonazis, Neocons, Neonlicht, Nachhaltigkeit, Öko-Eiern, I-Pads, I-Pots, Club-, Party-, Techno-, Drogen-Probleme und was weiß ich nicht zu beschäftigen, zu schweigen von Gewerkschafts-, Sport- und Parteienpolitiken. Jeder Tier- oder Pfllanzenfilm ist uns da willkommener! Das ist keine „Politikverdrossenheit“, im Gegenteil: diese ganze Scheiße hat nichts mit Politik zu tun – und deswegen will man da nichts mehr mit zu tun haben.

New York-Poller
Kunst und Wissenschaft verwischen
„Seit einigen Jahren scheint es ein neues Lieblingsthema zu geben – die Verbindung von Wissenschaft und Kunst,“ schreibt Michael Hagner auf der Internetseite der Technischen Hochschule Zürich . Diese „Verbindung“ wird vornehmlich „ökologisch“ gesucht. Inzwischen gibt es in Kalifornien fast nur noch „Eco-Artist“ und „Bio-Hacker“. Erstere widmen sich künstlerisch der Natur, letztere experimentieren mit dem „Leben“ anderer. Aus Kalifornien kamen Ende der Achtzigerjahre auch die ersten Öko-Künstler nach Westberlin – auf Einladung des DAAD: Helen Mayer und Newton Harrison, „the leading pioneers of the eco-art movement“ heute genannt. Sie nahmen sich hier nichts weniger als die „Revitalisierung der Spree“ vor, nebenbei hoben sie noch die „Trümmerflora“ in der „Topographie des Terrors“ ins allgemeine Bewußtsein.
Zur selben Zeit etwa zog auch die norwegische Mathematikerin Sissel Tolaas nach Westberlin, wo sie mit „Geruchskunst“ begann. Irgendwann kam sie jedoch künstlerisch nicht mehr weiter,- und beschäftigte sich fortan wissenschaftlich mit Gerüchen. Seit 2006 ist sie Professorin für „unsichtbare Kommunikation und Rhetorik“ in Harvard. Derzeit arbeitet sie gerade im Auftrag einer Geschichts-Ausstellung in Berlin am „Geruch des Zweiten Weltkriegs“ – den man hier ja wegen der immer strenger werdenden Umwelt-Gesetze und -Verordnungen nicht einmal mehr punktuell riechen kann. Bei der Öko-Kunst, wenn sie nicht Forschungsergebnisse schlicht visuell umsetzt, kann es sich um Rückgriffe auf (goethische) „Ganzheitlichkeit“ handeln, was sich im Mitbedenken der „Umwelt“ eines Kunstwerks bereits andeutete, es kann dabei aber auch – angesichts des „Visual Turns“ – darum gehen, neue Sinne für die Kunst zu mobilisieren.
Im Gegensatz zur eher stillen Geruchskünstlerin predigte der dänische Künstler Olafur Eliasson in Berlin geradezu die aktuelle Notwendigkeit von „Öko-Kunst“. Auch außerhalb: So erfreute er z.B. die New Yorker mitten im heißen Sommer mit einem riesigen Wasserfall für 15 Millionen Dollar und an den Afrikanern, beginnend mit den Äthiopiern, die abseits eines Stromnetzes leben, verkaufte er solarbetriebene Leuchtdioden als Lampen. Auch Eliasson spricht von „Ganzheitlichkeit“, meint damit aber seine Verbindung von Geschäft und Kunstwerk.
In Kassel hat unterdes eine Semiamerikanerin die halbe Kunst für die diesjährige „documenta“ ökologisch durchkuratiert: Für die Postfeministin Carolyn Christov-Bakargiev gibt es „keinen grundlegenden Unterschied zwischen Menschen und Hunden“. Das Feuilleton höhnte: „Documenta-Chefin will Wahlrecht für Erdbeeren“ (orf), „documenta ist auf den Hund gekommen“ (dorstener zeitung), „Heftige Kritik an documenta-Chefin“ (giessener zeitung). Die „Akzeptanz“ (derstandard) für so was ist also noch nicht durch. Aber flankiert werden derartige Kunststücke schon mal von immer mehr Wissenssoziologen und Kulturwissenschaftlern, die sich durch die Bank die Metaphern der modernen Biologie vornehmen, gleichzeitig aber auch die Pflanzen, Pilze und Tiere selbst – wobei sie diese aufgrund ihrer literarischen Neigungen jedoch nur allzu oft ebenfalls metaphorisieren.
Umgekehrt holen sich z.B. die Naturwissenschaftler immer öfter Künstler ins Haus. Die Zoologischen und Botanischen Gärten sowie die Naturkundemuseen, weil sie in Zeiten sich „verschlankender“ Staaten um die „knappe Ressource Aufmerksamkeit“ beim zahlenden Publikum buhlen müssen – und dabei zunehmend auf „Topevents“ setzen.
So hat das Naturkundemuseum schon seit Jahren den Schauspieler Hans Zischler verpflichtet, regelmäßig eine schöne Veranstaltung – z.B. über Vilem Flussers Tiefseekrake oder die sexuelle Selektion nach Darwin – zu bestreiten. Der HUB-Professor Thomas Macho, Autor vieler Texten über Tiere und Kurator einer Ausstellung über Schweine, erweiterte seine „Animal Studies“ mit einer Beteiligung an der neuen interdisziplinären Zeitschrift „Tierstudien“, deren erste Ausgabe sich mit „Animalität und Ästhetik“ befaßt. U.a. wird darin die Arbeit mit Tieren als „künstlerische Agenten“ auf dem Theater, in der Architektur und in bildender Kunst (in Kalifornien) thematisiert. „Es ist eine der angenehmsten Eigenschaften aller im Tierstudienheft versammelten Arbeiten, dass sie zuerst nach dem fragen, was man über das Tier weiß,“ schrieb der Biologe Cord Riechelmann in seiner Rezension.
Im „Prinzessinnengarten“ am Moritzplatz, einem der Öko-Vorzeigeprojekte in der Stadt, zeigte die Dänin Åsa Sonjasdotter eine Fruchtfolge lang Ausschnitte aus ihrer Kartoffelkunst: „The order of the potatoes“. Die zwei Betreiber des mobilen Gemüsegartens bezeichnen sich nicht mehr als Gärtner oder Manager, sondern als „Kuratoren“.
Inzwischen gibt es auch bereits „Bienenkünstler“ und „Hummelkünstler“. Für so etwas ist auch die Kreuzberger NGBK immer mal wieder gut. Eingedenk der optimistischen These des Philosophen Vilem Flusser „Das wahre Zeitalter der Kunst beginnt mit der Gentechnik – erst mit ihr sind selbstreproduktive Werke möglich“ beschäftigte sich eine NGBK-Künstlergruppe halbwegs kritisch mit „Genkunst“, vornehmlich aus den USA, eine andere eher konstruktiv mit dem französischen Diktum „Tier-Werden, Mensch-Werden“.
Kürzlich wurde in Berlin die erste Bio-Hackerin – im Think-Tank „Stadtbad Wedding“ – aufgestöbert: Lisa Thalheim. Die Informatikkünstlerin beschäftigt sich laut Süddeutsche Zeitung mit dem Auslesen von DNS-Profilen. „Natürlich würde auch Genmanipulation sie reizen, aber da steht, so lange ihr Labor keine Lizenz hat, das Gentechnikgesetz vor. Die Bewegung der Gentech-Heimwerker steckt in Deutschland noch in den Kinderschuhen“. Das gilt sowohl in quantitativer als auch in qualitativer Hinsicht, aber sie scharrt bereits mit den Hufen.
Während jedoch hierzulande ein „Gen-ethisches Netzwerk“ gegründet wurde (von dem ex-tazler Benny Härlin), das gegen solch eine „Lebenskunst“ argumentiert und mobilisiert, wird in den US-Universitäten auf Sommercamps schon seit Jahren gentechnisch experimentiert, d.h. – in Teams, die international im Wettbewerb (iGem) stehend sogenannte „BioBricks“ z.B. in Bakterien einbauen. Nicht selten wird dabei die „Öko-Kunst“ wissenschaftlich auf den (vielversprechendsten) Punkt gebracht: 2011 gehörte zu den umgesetzten „SyntheticBiology“-Projekten laut spiegel-online „der Abbau von Pestiziden in der Zelle, die Herstellung von Biotreibstoffen, Zellen, die sich selbst umbringen, aber auch zellinterne informationsverarbeitende Netzwerke“.
Anfang August lud die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften auf dem Alten Markt in Potsdam zu einer öffentlichen Disputation über Kunst und Wissenschaft am Beispiel des Schleimpilzes „Neurospora crassa“, der sich währenddessen dort in einem gläsernen Pavillon in etwa 30 Petrischalen munter vermehrte – und dabei von weißen Pünktchen langsam über gelb-orange in schwarze Bänder überging.
Dieser eukariotische Einzeller ist weder Pflanze noch Tier und hat eine kosmopolitische Verbreitung. Er wird weltweit als Modellorganismus beforscht und ist hierzulande als Brotschimmel bekannt. Er hat zwei unterschiedliche „Generationszyklen“, d.h. er kann sich sowohl durch Sporen über die Luft als auch durch geschlechtliche Kreuzung vermehren. 1958 erhielten zwei Genetiker für ihre Forschung mit ihm, die in der Formel „Ein-Gen-ein-Enzym“ gipfelte, den Nobelpreis. „The Revolutionary Neurospora crassa“ ist aber nicht nur ein „Almighty Fungi“, sondern auch ein Zwangscharakter, da er exakt alle 24 Stunden eine neue Generation von (schwarzen) Sporen produziert. Auf eine Verschiebung der Zeitzone reagiert er gleich uns mit einem „Jetlag“, wie norwegische Chronobiologen herausfanden. In Bayern, wo die Gentechnik bereits vollends den Biologieunterricht ersetzt hat, wird den Abiturienten folgende Aufgabe gestellt: „Entwickeln sie mithilfe des Materials die Syntheseschritte zur Aminosäure Methionin bei neurospora crassa.“ Mit dem „Material“ sind mittels UV-Bestrahlung erzeugte Mangelmutanten gemeint, die auf Minimalnährböden verschieden gedeihen. Dabei geht es darum, deren künstlich erzeugte Stoffwechsellücken lückenlos zu beschreiben. Für so etwas bekam man in den Achtzigerjahren noch ein Biologiediplom an den Unis.
Die Berlin-Brandenburgische Akademie, die bereits mit der Akademie der Künste kooperiert, hatte zwar für ihre Potsdamer „ArtFakt“-Diskussion, die in einem sogenannten „Syntopischen Salon“ stattfand, eine Künstlerin – Michaela Rotsch – eingeladen, die sich in Form von „Installationen“ mit dem Schleimpilz beschäftigt; dazu war auch noch ein bayrischer Systembiologe angereist… Ihr Gespräch drehte sich dann aber weniger um Neurospora crassa: Was man zu welchem behufe alles mit ihm anstellt und was er möglicherweise davon hält, sondern eher um „zentrale Fragen“ von Wissenschaft und Kunst: Identität, Komplementarität, Kombinatorik, Umriß, Zwischenraum… Als das Publikum beim Begriff der Identität zu sehr ins menscheln kam, intervenierte eine Physikerin mit dem „Satz der Identität in der Logik“ – A gleich A: „Da raus zu kommen,“ das sei doch „die wirkliche Aufgabe der Kunst.“ Eine Literaturwissenschaftlerin warf lächelnd leise ein: „…Ja, diese Begriffe.“ Ihr Mann, ein Kunsthistoriker, der das letzte Wort hatte, behauptete laut: „Pilze sind immer schon sehr nachdenkliche Leute.“
Mit diesem Begriff – „Leute“ – schien er sich sowohl auf das kleine Volk des Taigajägers Dersu Usala (von Wladimir Arsenjew und Akira Kurosawa) an als auch auf das Volk der Pirahas in Amazonien (von Dan Everett) zu beziehen: Beide Völker benutzen das Wort für Tiere, Pilze und Pflanzen in ihrer Umgebung, um anzudeuten, dass sie die Trennung zwischen Subjekt und Objekt, Natur und Kultur nicht mitmachen wollen – und Abstraktionen abhold sind. Als Schlußwort im Syntopischen Salon war es leider nur utopisch.
(Dafür widmete sich wenig später der Biologe Cord Riechelmann in der neuen Ausgabe des Magazins „Dummy“ über „Leben“ ausführlich den Schleimpilzen – namentlich den Myxogastria, den Protostelia und den Dictyostelia. Und der Kulturwissenschaftler Peter Berz schrieb einen Text über „Die Identität der Amöben“. Die Art ist mal Pflanze, mal Tier, mal Pilz oder nichts von all dem. Sie lebt in zwei unterschiedlichen Formen. Zum einen als einzellige Amöbe, die sich von Bakterien ernährt. Aber wenn die Nahrung knapp wird, entsteht aus einzelligen Amöben ein vielzelliger Organismus. Zehntausende Amöben tun sich zusammen zu einem Schleimpilz, der Fruchtkörper und Sporen bildet, aus denen dann wieder einzellige Amöben entstehen. Man hätte also an keinem Organismus den Begriff der „Identität“ besser in Frage stellen können als gerade an diesem Schleimpilz auf dem Alten Markt in Potsdam.)

Kanada-Poller
Großstädtisches Benehmen
Berlin will partout Weltmetropole werden, gleichzeitig ziehen immer mehr Westdeutsche und Wildtiere in die Stadt. Letztere seien laut Martin Heidegger besonders weltarm, heißt es dazu unter „Weltoffenheit“ auf Wikipedia: „Infolge seiner Weltarmut ist dem Tier das Seiende als Seiendes nicht zugänglich, es ist Heidegger zufolge verwoben in seine Umwelt, bestehend aus einem ,Umring‘ von Trieben, die auf einzelnes Begegnendes hin enthemmen und dazu führen, dass das Tier von der Sache ,hingenommen‘ ist.“ Und weiter: „Damit ist dem Tier ein freies ,Verhalten‘ zum Seienden verwehrt; Verhalten ist nur dem Menschen eigentümlich. Durch die Verbindung von Trieb und seinem Gegenstand ist das Tier in seinem Tun ,benommen‘. Wegen dieser Benommenheit und in Abgrenzung zum menschlichen ,Verhalten‘ sagt Heidegger, das Tier ,benimmt‘ sich.“
Auch die neu zugezogenen Menschen wissen sich meist zu benehmen. Sieht man davon ab, dass sie – wie etwa in Prenzlauer Berg geschehen – des urbanen Lärms wegen hinzogen, dann dort jedoch vehement Ruhe einklagten. Aber wie benimmt sich nun das Tier? Drei Beispiele:
1. Ein männlicher Fuchs, nennen wir ihn Emil, hat sein Revier zwischen dem Görlitzer Park und dem U-Bahnhof. Neulich stand er an der Ampel Manteuffel Ecke Skalitzer. Diese wollte er überqueren. Als die Ampel auf Grün sprang, trat er jedoch zurück und ließ mir den Vortritt.
2. Als ich im Frühsommer das Auto auf dem Parkplatz der Lieper Bucht an der Havel aufschließen wollte, drängte mich eine alte Wildsau beiseite, sprang mit den Vorderfüßen auf den Fahrersitz und durchsuchte die Mittelkonsole nach Essbarem. Da dort nichts lag, verließ sie rückwärts den Wagen, bedachte mich mit einem vorwurfsvollen Blick und zog sich leise grunzend in den Wald zurück – mit ihren acht Frischlingen, die während der Durchsuchung am linken Vorderreifen gewartet hatten. Ihr forsches Benehmen würde ich als durchaus deeskalierend bezeichnen.
3. Im Spätsommer hatte im Humboldthafen ein älterer Höckerschwan einem jungen, der seiner nestbauenden Schwänin zu nah gekommen war, am Stauwehr in die Enge getrieben und dort so heftig attackiert, dass ein Passant die Feuerwehr rief, die ihn jedoch nur bat, weiter auf die beiden kämpfenden Schwäne aufzupassen: „Wenn wir den jungen fangen, wird der noch mehr verletzt und wir auch – und in der Schwanenstation geben ihm die Tierärzte sofort eine Todesspritze. Die wissen dort vor Schwänen nicht ein noch aus. Ständig kommen Leute, die verletzte Tiere bringen: Schwäne, die von Hunden gebissen wurden, Schwäne, die gegen eine elektrische Leitung geflogen sind usw.“. Der Passant tat, wie ihm geheißen: Er blieb stehen und passte auf. Dem Jungschwan gelang es schließlich, aus der Stauwehrfalle zu entkommen, er kam hastig ans Ufer und lief zum Aufpasser, hinter dessen Rücken er sich gewissermaßen versteckte. Damit war er in Sicherheit, wenn auch arg gerupft.
Man könnte sagen, dass der Passant sich zu benehmen wusste, indem er den Jungschwan beschützte. Für diesen gilt jedoch ebenfalls, dass er, der als Wildvogel in die vermeintliche Weltstadt geraten war, inzwischen gelernt hatte, dass man hier jederzeit mit den Menschen rechnen muss, aber notfalls auch kann. Dass er dabei den besagten Passanten wählte, der ein ausgewiesener Vogelfreund war, ist vielleicht auch kein Zufall.
Die drei Beispiele zeugen zugleich von einem „Mangel an Eigenständigkeit“, wie Herbert Achternbusch das mit dem Begriff „Welt“ erklärt: „Die Welt hat sie vernichtet, das kann man sagen. Ein Mangel an Eigenständigkeit soll durch Weltteilnahme ersetzt werden. Man kann aber an der Welt nicht wie an einem Weltkrieg teilnehmen. Weil die Welt nichts ist. Weil es die Welt gar nicht gibt. Weil Welt eine Lüge ist. Weil es nur Bestandteile gibt, die miteinander gar nichts zu tun haben brauchen. Weil diese Bestandteile durch Eroberungen zwanghaft verbunden, nivelliert wurden. Welt ist ein imperialer Begriff. Auch da, wo ich lebe, ist inzwischen Welt. Früher hat man einen Bachlauf nicht verstanden, heute wird er begradigt, das versteht ein jeder. Ein Bach, der so schlängelt. Karl Valentin sagt: ,Das machen sie gern, die Bäch.'“ Auf die 3 Neuberliner (Tiere) bezogen hieße das: Sie haben vor der Welt kapituliert – indem sie in eine „Weltstadt“ gezogen sind, wo sie nun versuchen, mehr recht als schlecht zu überleben. Dümmer werden sie dadurch allerdings nicht. Und für die meisten Altberliner gilt das Selbe.

Afrikanischer Holzkunstpoller in Frauengestalt auf Zebrastreifen mit Protestplakat gegen Klitorisbeschneidung und kackendem Holzlöwen im Hintergrund. Alle Photos: Peter Loyd Grosse
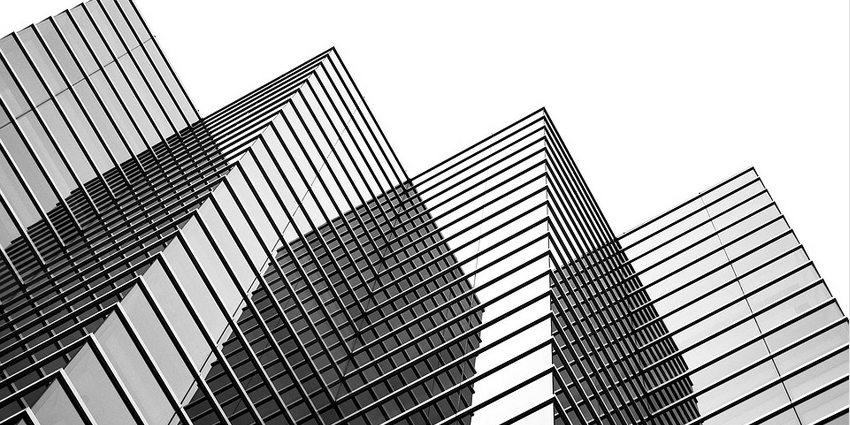



Noch ein Aktivist aus der Hausbesetzerbewegung:
Am Mittwoch, 26. September, 19 Uhr
In der Ausstellung im Kunstraum Kreuzberg/Bethanien
business as usual is not an option: Überernährung und Hunger – Bauernsterben und „Agrarindustrie.“ Vortrag von Benny Härlin (von der Zukunftsstiftung Landwirtschaft)