1. Der mysteriöse Tod von Maos Stellvertreter Lin Biao


Lin Biao, der chinesische Verteidigungsminister und Herausgeber der „Mao-Bibel“, war ein alter Kampfgefährte von Mao tse Tung. Am 13. September 1971 stürzte er mit einer chinesischen Militärmaschine in der Mongolei ab, mit ihm starben seine Frau und sein Sohn sowie sechs weitere Personen. Angeblich, wollte Lin Biao in die Sowjetunion fliehen. Der ehemalige Vorsitzende der maoistischen westdeutschen KPD, Christian Semler, meinte, die Maoisten, aber auch Sinologen im Westen erklärten sich seinen Flug damit, dass Mao nach seinem Tod eine Militärdiktatur unter der Führung von Lin Biao und einer Clique befürchtete, obwohl oder weil er in der Kulturrevolution, die er und Lin Biao einst initiiert hatten, als sie auszuufern drohte, die Volksbefreiungsarmee zu Hilfe geholt hatte, die seitdem in allen Revolutionskomittees mitarbeitete. Erhärtet wird diese Erklärung mit einer etwas poetischen Bemerkung Maos über „die Lockerung des Ecksteines einer Mauer“ – woraufhin er den Oberkommandeur der Pekinger Garnison austauschen ließ und die Zahl der Armeemitglieder im ZK um die Hälfte reduzierte. Lin Biao entschloß sich daraufhin laut Semler 2007 übereilt zur Flucht: „Für einen Putsch wurde nie auch nur der Schatten eines Beweises vorgelegt. Ebensowenig für einen Raketenabschuß seines Flugzeugs. Aber vielleicht hat Lin Biao wirklich mit der Sowjetunion konspiriert, weil er in China ein permanentes Chaos befürchtete.“
Eine ähnliche Version wurde bereits in den 80er-Jahren verbreitet – wahrscheinlich vom CIA. In dem weltweit 1983 veröffentlichten Text eines pseudonymen chinesischen Insiders namens Yao Ming-le wurde der Doppelagent Wu Zonghan als Lin Biaos Kontaktmann zu den Sowjets benannt. Daneben wurden in diesem Buch mit dem Titel „Die Verschwörung – Staatsstreich und Ermordung des Lin Piao“ auch noch die sexuellen Ausschweifungen von Lin Biaos Sohn Lin Liguo – dem eigentlichen Putsch-„Projektplaner“ – ausgebreitet.
Bei seiner und seines Vaters „Ermordung“ bezog sich der anonyme Autor auf das Geständnis eines ihrer Mitverschwörer (die inzwischen großenteils wieder freigelassen wurden): Wu Faxian, Oberbefehlshaber der Luftstreitkräfte. Der behauptete, selbst angeordnet zu haben, das Flugzeug von chinesischen Grenztruppeneinheiten mit zwei mal drei Bodenluftraketen abzuschießen, was dann auch geschehen sei.

Die Masse der weltweit das Ereignis interpretierenden „Chinawatcher“ changierte damals, ab der zweiten Hälfte der Siebzigerjahre, zwischen der Einschätzung des linken schwedischen Maoismustheoretikers Jan Myrdal und der eher bürgerlich-rechten US-Sinologin Roxane Witke. Myrdal begann mit der kurz zuvor erfolgten Verhaftung der „Viererbande“, die angeblich ebenfalls eine putschistische Politik verfolgte: „Sie hatte Lin Biao nahegestanden und mit ihm zusammengearbeitet. Tschiang Tsching [Maos Ehefrau] war auf sein Bestreben in eine außergewöhnliche Positition aufgestiegen. Aber als Lin Biao schließlich von Tschou En-lai entlarvt wurde und ihm nichts anderes übrig blieb als die Flucht, da stellten sich Tschiang Tsching und die anderen flugs als seine Opfer dar“.
Die amerikanische Biographin von Tschiang Tsching, Roxane Witke schrieb 1977: Noch im Frühjahr 1966 beherrschten Lin Biao und Tschiang Tsching gemeinsam die Gewehrläufe („wu“) und die Tintenfässer („wen“). Laut Witke datierte Tschiang Tsching den Beginn von Lian Biaos „verräterischer Wühlarbeit“ auf Mitte 1966. In diesem Jahr hatte er vor dem Politbüro eine der „ungewöhnlichsten Reden in den Annalen der chinesischen Geschichte“ gehalten: „Eine Analyse historischer Staatsstreiche“. Spätestens auf der Plenartagung des ZKs in Lushan begann Lin Biao dann selbst „den zehnten Kampf zweier Linien“. Seine Machenschaften nahmen 1971 noch „an Häufigkeit und Dreistigkeit zu“. Der „zehnte Kampf zweier Linien ist der gefährlichste gewesen“: Lin Biao wollte nicht nur Mao umbringen, sondern auch sämtliche (alten) Genossen des Politbüros, erzählte Tschiang Tsching angeblich ihrer US-Biographin, deren Buch dann kurz nach Maos Tod 1976 bei der Verhaftung von Tschiang Tsching eine wichtige Rolle spielte. 1981 wurde die „Mao-Witwe“ wegen „Verrat“ – dem „elften Kampf zweier Linien“ – zum Tode verurteilt, jedoch nicht erschossen. 1997 beging sie im Gefängnis Selbstmord.
Der schwedische Promaoist und die Harvard-Antimaoistin erklärten uns damals die politische Intrige auf genau entgegengesetzte Weise. Während die chinesischen Kommunisten bis heute bei ihrer Version bleiben, die sie am 26.Juni 1972 kurz nach Verhaftung mehrerer hochrangiger Militärs offiziell herausgaben: Lin Biaos Clique habe einen „konterrevolutionären Staatsstreich“ unternommen, der jedoch von seiner Tochter verraten wurde. Mit seinen engsten Getreuen habe er daraufhin versucht, mit einer gekaperten „Trident Nr. 256“ in die Sowjetunion zu fliehen.
In der FAZ behauptet Petra Kolenko nun: „Tausende Militärs wurden als Mitverschwörer verurteilt.“ Die „Chinawatcher“ gingen bisher von etwa einem Dutzend aus, die zudem, wie der Oberbefehlshaber der Luftstreitkräfte, nach kurzer Zeit freigelassen wurden. Der Grund für die Chinaexpertin der FAZ, auf Lin Biaos Mitverschwörer aus dem Jahr 1971 noch einmal am 6.April 2013 zurück zu kommen, ist eine neue Version von der Flucht Lin Biaos, die kürzlich ein chinesisches Politmagazin veröffentlichte, das von Petra Kolonko als „Sprachrohr reformistisch gesinnter Intellektueller in China“ bezeichnet wird. Sie sprach mit dem Autor, Liu Jiaju, ehemals Redakteur der Zeitung der Volksbefreiungsarmee. Er will nach jahrelangen Recherchen herausbekommen haben, was die vermeintliche „CIA“-Version des pseudonymen „Insiders“ Yao Ming-le bereits in den 80er-Jahren als „Wahrheit“ ausgegeben hatte: Lin Biaos sexbesessener Sohn Lin Liguo sei der eigentliche Putsch-„Projekt 571 Planer“ gewesen. Laut Liu Jiaju habe er als stellvertetender Leiter des Luftwaffenkommandos mit „wenigen Gesinnungsgenossen einen Aufruf“ gegen die Diktatur Maos verfaßt. Sie erwogen ein „Attentat auf den großen Führer“: Maos Sonderzug nach Südchina sollte in die Luft gesprengt werden. Laut Liu Jiaju hatte die kleine Gruppe aber „weder die Mittel noch die Personen“ dafür. Als die Attentatspläne von seiner Schwester Lin Duoduo verraten wurden, holte Lin Liguo mit dem Flugzeug eilendst seine Familie zusammen. Den kranken Vater, Lin Biao, der sich einem Seebad aufhielt, lockte er unter dem „Vorwand an Bord“, dass die Familie sich für eine Weile nach Nordchina zurückziehen müsse, sein Plan war jedoch, in den Süden nach Hongkong zu fliehen. Warum er dann aber doch nach Norden in Richtung Mongolei flog, sei noch nicht ganz geklärt.


Petra Kolonko weiß, dass all das auch schon x Mal von ausländischen „Chinawatchern“ vermutet wurde – seit 1971. Aber noch nie, so sagt sie, wurden solche Spekulationen oder Recherchen in China selbst veröffentlicht, zumal der Autor auch noch davon überzeugt ist, dass der verhinderte Attentäter Lin Liguo „größte Weitsicht bewiesen“ habe, als er Mao als Diktator charakterisierte, und dass es noch heute „viele Elemente der maoistischen Zeit“ gäbe, deren Problematisierung durch die Parteiführung er mit seinem Artikel über Lin Biao anregen wolle. Dabei scheint er an der Geschichte der russischen „Dekabristen“ entlanggeschrieben zu haben: Eine Gruppe Offiziere, die 1825 offen gegen den Zar opponierte und verhaftet wurde, einige der „Verschwörer“ wurden gehängt, andere nach Sibirien verbannt. Alexander Puschkin war mit mehreren befreundet, sein Poem „Eugen Onegin“ handelt von ihrem „Aufstand“.
Die KPCh hatte zunächst – 1974 – in der letzten Phase der Kulturrevolution – eine Kampagne organisiert: „Konfuzius kritisieren – Lin Biao kritisieren!“ Konfuzius stand für ein hierarchisches Denken, das zwischen höheren (Intellektuellen) und niederen (Bauern) Menschen unterschied. Lin Biao wurde als ein Reaktionär entlarvt, der seine wahre Natur hinter einer ultralinken Maske versteckt hatte. In der Ende der Siebzigerjahre von Deng Xiaoping revidierten Geschichte der KPCh, mit der die Kommunisten sich vom Kampf zweier Linien in der Partei verabschiedeten, wurde Lin Biao als „Verräter“ bezeichnet. Und das gilt auch nach wie vor – offiziell.
Zuvor, 1975, war bereits im Westen eine Abrechnung mit der Kulturrevolution erschienen, verfaßt von dem für die chinesische Regierung arbeitenden Auslandschinesen Jack Chen. „Chinas Rote Garden“. Darin heißt es über Lin Biao: Seine Flucht geschah zwischen dem ersten China-Besuch Kissingers und dem ersten Besuch seines Präsidenten Nixon, deswegen veröffentlichte die Regierung erst danach ihre „Analyse der Affäre Lin Biao“. Hätte dessen „Komplott“ 1971 Erfolg gehabt, wäre die „Alte Garde“ laut Jack Chen „durch ein neues ZK und eine neue Regierung unter Lin Biao verdrängt worden“, der Chinas „Schicksal den Sowjetrevisionisten und ihrem ‚Atomschirm‘ anvertrauen wollte“. Die UDSSR würden sogar jetzt noch weiter daran arbeiten, China zu unterjochen. Tschou En-lai nannte Lin Biao einen „bürgerlichen Karrieristen“ und „Landesverräter“. Um seinen schändlichen Einfluß auch nach seinem Tod weiter zurück zu drängen, begann ein Jahr nach seinem Absturz eine Kampagne – mit dem Ziel „Lin Biao kritisieren und den Arbeitsstil verbessern“. Jack Chen ging dieser „Bewegung“ in einer Pekinger Elektrofabrik auf den Grund. Einige der Kader dort berichteteten ihm: „Als die Arbeiter erkannten, was geschehen war, waren sie voller Zorn. Sie sind entschlossen, alle Einflüsse von Lin Biaos Ideen auszurotten“. Dazu gehöre u.a. sein elitärer Arbeits- und Geniebegriff. „Nachdem wir seine reaktionären Ansichten durchschaut und unseren Erkenntnisstand erhöht hatten, verwandelte Bewußtsein sich in Materie…wir erzielten neue Höchstleistungen“. Ein anderer Kader ergänzte: „die Qualität sei ebenfalls gestiegen“. Beide bestanden darauf, daß die Produktionsfortschritte „durch die Kritik an Lin Biao bewirkt worden seien,“ schreibt Jack Chen, der zuletzt noch erwähnt, dass viele Chinesen erst 1971 erfuhren, „daß Lin Biao eine Glatze hatte, weil er nie seine Mütze abnahm, er trug sie sogar mit einem Sturmriemen, um zu verhindern, dass sie ihm vom Kopf gerissen wurde. Was soll man von einem so dümmlich eitlen Mann halten?“ Zum „Verräter“ sei er jedoch erst im Laufe der Kulturrevolution geworden, „die Wendemarke war erreicht“, als er mit den rotgardistischen „Ultralinken“ paktierte (sie wurden auch „Eins-Sechs-Fünf“ genannt – nach dem Datum eines berühmten Rundschreibens der KPCh vom 16.5. 1966, mit dem die Installierung der ersten „Gruppe für die Kulturrevolution“ im ZK angekündigt wurde). Als man die Eins-Sechs-Fünf für den Brandanschlag auf die englische Botschaft verantwortlich machte, deckte Lin Biao sie. Zuletzt wollte er die ganze „durch die Kulturrevolution bewirkte neue Ordnung umstoßen – ein chinesischer Thermidor“. Ein ZK-Mitglied bezeichnete Jack Chen gegenüber den Kampf gegen Lin Biao als „einen der kritischsten“.
1980 besuchte eine Delegation deutscher Schriftsteller die Volksrepublik China, darunter befand sich auch der Hannoveraner Soziologe Oskar Negt. Er veröffentlichte acht Jahre später ein Buch über seine Reise, in dem er an einer Stelle auch auf den Flugzeugabsturz von Lin Biao zu sprechen kommt, wobei er zunächst die Meinung des im Außenministerium für Westeuropa verantwortlichen Direktors Hu Benyao referierte: „Die Kulturrevolution, deren Anfangsaktivitäten in der Phase der Kooperationsaufkündigung durch die Sowjetunion lägen, habe den Revisionismus Chruschtschows zum Angriffsziel gehabt. Es sei zu spontanen revolutionären Kampagnen gekommen, die das Eindringen des sowjetischen Revisionismus in China zu verhindern wußten“. Oskar Negt bemerkt dazu: „Von dieser Ursachenverbindung der Kulturrevolution mit dem Abbruch der Beziehungen zur Sowjetunion höre ich hier zum ersten Mal…Hen Benjao charakterisiert Lin Biao als einen Nachbeter Maos, der schon früh versucht habe, das Erbe Maos anzutreten, Als er befürchten mußte, daß Mao ihm das Vertrauen entzieht, habe er den Ausweg in einem Militärputsch gesucht…Das Ende des Abenteuers sei bekannt: in der äußeren Mongolei sei sein Flugzeug abgestürzt…“
Seit Ende der Achtzigerjahre kamen keine weiteren, neuen Interpretationen des Lin-Biao-Absturzes mehr auf. Selbst nach dem Zerfall der Sowjetunion, wohin die Putschisten angeblich fliehen wollten (wie es vor ihnen tatsächlich mehrere ZK-Mitglieder der chinesischen kommunistischen Partei vor allem in den Vierzigerjahren getan hatten), gelangten keine neuen Erkenntnisse an die Öffentlichkeit. Dafür entwickelte die Mongolei ein Aufklärungsinteresse. Dort war Lin Biaos Flugzeug im Hentiir aimag abgestürzt, wobei sich hartnäckig das Gerücht gehalten hatte,dass es von sowjetischen Raketen abgeschossen worden war. Im Herbst 1991 veröffentlichte als erstes der Mediziner Zuunai in der Zeitung der Bürgerrechtler „Il Tovchoo“ (Historische Fakten) einen Artikel, in dem er die Frage zu beantworten suchte: „Wer saß wirklich im Flugzeug?“ In der Nacht des 13.Septembers 1971 wären zunächst nur russische Offiziere am Absturzort gewesen. Sie hätten bereits viele Flugzeugteile abtransportiert, bevor sie ihre mongolischen Kollegen hinzuzogen. Zu diesen gehörte damals auch der Autor, der am zweiten Tag am Unglücksort eintraf, zusammen mit einigen Geheimdienstlern und Flugzeugingenieuren sowie Vertretern der chinesischen Botschaft in der Mongolei. Die Flugzeugspezialisten waren bereits unmittelbar nach dem Absturz zu Hilfe gerufen worden, nun mußten sie so tun, als stünden sie zum ersten Mal vor den Trümmern der Maschine. Dr. Zunnai untersuchte damals zusammen mit einigen russischen Medizinern die Reste der Leichen. Er ist sich sicher, dass einer der neun Passagiere Lin Biao war, auf dessen Namen die chinesischen Offiziellen vor Ort dann auch gleich einen der Totenscheine ausstellten. Wenig später veröffentlichte ein weiterer Mediziner, I. Sanjaadorj, einen Artikel in der „Il Tovchoo“ (Geöffnete Geschichte) über den Absturz, in dem er die Frage, ob sich Lin Biao tatsächlich in dem Flugzeug befand, erneut aufwarf. Der Autor war damals ebenfalls zum Unglücksort gerufen – und später vom mongolischen Geheimdienst noch einmal dorthin beordert worden. Weil man die sterblichen Überreste an Ort und Stelle vergraben hatte, konnte man sie jetzt noch einmal in Ruhe untersuchen. Zu zehnt machten sich die Experten unter der Leitung eines russischen Generals an die Arbeit, wobei es ihnen primär darum ging, irgendwelche Hinweise auf Lin Biao zu finden. Aber auch nach einer Woche waren sie sich noch nicht sicher. Schließlich nahm der Russe einen der Schädel und einige Knochen an sich und verschwand damit nach Moskau. Man hörte nie wieder etwas davon.Der Rest wurde verbrannt, hinterher übergab man dem chinesischen Botschafter eine Urne mit der Asche. „Damit war meine Aufgabe beendet,“ schreibt I. Sanjaadorj.
Im September 2003 sprach ein Mitarbeiter des mongolischen Presseinstituts, Navaandorj Lkhagvasuren, mit dem Kriminalisten T. Moyoobuu, den man seinerzeit ebenfalls bei der Untersuchung des Flugzeugabsturzes hinzugezogen hatte – noch am selben Tag, den 13. September 1973. In einem Protokoll, dass der Experte anschließend für seinen Vorgesetzten verfaßte, hieß es: „Der Absturz der Maschine wurde nicht durch einen Raketenbeschuß verursacht. Es mußte aus Benzinmangel notlanden. Ein Augenzeuge, der Nachtwächter des nahen Kohlebergwerks ‚Berch‘, sah, wie es unweit der Zeche auf hügeligem Gelände zur Landung ansetzte. Dabei berührte der rechte Flügel einen Hügel, die viermotorige englische Maschine bohrte sich in die Erde und fing Feuer. An Bord befanden sich mehrere Metallkisten mit Dokumenten, die dabei großenteils verbrannten. Von den neun ebenfalls verbrannten Passagieren wurde einer als Frau identifiziert, sie hatte zwei Goldzähne. Daran meinte der chinesische Botschafter die Ehefrau von Lin Biao wiedererkennen zu können. Ein anderer Passagier wurde als Europäer identifiziert. Er war mit einer Pistole des Typs Makarow bewaffnet. Auch die anderen acht trugen geladene Waffen, die teilweise entsichert waren. Da bei einer der Pistolen fünf rote Sterne in den Griff graviert waren, gingen die russischen Experten sowie die Mitarbeiter der chinesischen Botschaft davon aus, dass es sich dabei um die Waffe von Lin Biao handeln müsse“. Auch nach einigen weiteren Untersuchungen, wozu die Überreste der Leichen dann noch einmal wieder ausgegraben wurden, kamen die Russen und die Chinesen zu dem Schluß, dass es sich bei den Passagieren u.a. um Lin Biao und seine Frau gehandelt habe. Die Identität ihres mutmaßlich russischen („europäischen“) Flugbegleiters blieb ungeklärt. Ihr Flugzeug kam aus Südchina und wollte zunächst in Peking landen, um zu tanken, daran wurden sie jedoch anscheinend mit Waffengewalt gehindert, so daß sie weiter nach Norden in Richtung Mongolei flogen, wo ihnen dann das Benzin ausging.

Zuletzt, im Dezember 2007 kam die mongolische Wochenzeitung „Odoo Tsag“ (Die Zeit) noch einmal mit einem ausführlichen Artikel auf das Flugzeugunglück zu sprechen – indem sie einen Text aus der russischen Zeitung „MIR Kriminal“ (Kriminelle Welt) nachdruckte, der von „Analytikern“ der KGB-Nachfolgeorganisation zusammengestellt wurde: Laut „MIR Kriminal“ war es zwischen Mao tse Tung und seinem Nachfolger Lin Biao zum Konflikt über die außenpolitische Orientierung Chinas gekommen. Nach Beendigung des Bündnisses mit der Sowjetunion unter Chruschtschow wollte Mao Tse Tung sich den USA annähern, während Lin Biao wieder den Kontakt zur Sowjetunion suchte. In einer Rede griff er die USA wegen ihrer fortgesetzten Bombardierung Indochinas an, Mao, der neben ihm saß, zeigte durch seine ganze Haltung und Gestik seine Mißbilligung. Er mißtraute sowieso selbst den engsten Mitarbeitern im ZK, darunter auch Lin Biao. Nach dessen Rede wurde ihm klar, dass die Partei sich von Lin Biao trennen mußte.
Nach dessen Absturz in der Mongolei äußerte ein Vertreter des ZK: „Der Verteidigungsminister Lin Biao versuchte bereits auf der zweiten Tagung des Politbüros im April 1970 eine konterrevolutionäre Wendung herbeizuführen. Im März 1971 entwarf er einen Geheimplan, um Mao Tse Tung mithilfe des Militärs zu stürzen, dieser Plan sollte am 8. September 1971 umgesetzt werden. Weil er mißglückte, mußte er fliehen, wobei er die Sowjetunion ansteuerte. 1972 wurden in einer groß angelegten Kritikkampagne alle Fehler und Versäumnisse der Partei in der Vergangenheit Lin Biao angelastet. Er wurde als ein politischer Verbrecher und Überläufer bezeichnet, der heimlich mit der Sowjetunion paktierte.
Der damalige politische Kommentator, der Amerikaner John Macdowell, traf sich nach Lin Biaos Flucht mit Mao Tse Tung und und dieser zeigte ihm einen in der Nacht vom 11. auf den 12. September heimlich in Lin Biaos Villa aufgenommenen Film. Er zeigt den Verteidigungsminister und seine Frau, die im Wohnzimmer sitzen. Sie warten auf einen Anruf. Per Telefon erfährt Lin Biao dann, dass sein Militärputsch gescheitert ist. Daraufhin packen die beiden nervös ein paar Sachen zusammen.
Am Abend des 12. Septembers hält Ministerpräsident Tschou En-Lai eine Rede im Kabinett. Währenddessen tritt sein Sekretär an ihn heran, um ihm mitzuteilen, dass der Leiter des Sicherheitsdienstes eine dringende Meldung zu machen habe. Er meldete, dass Lin Biao und seine Familie sowie einige seiner engsten Mitarbeiter geflüchtet seien. Tschou En-Lai ordnete daraufhin an, das Flugzeug zu stoppen. Trotz dieser schnellen Reaktion gelang es Lin Biao jedoch, bereits kurz nach Mitternacht die chinesische-mongolische Grenze zu überfliegen. Als man das Mao Tse Tung mitteilte, ordnete er an, die Verfolgung aufzugeben. Desungeachtet bestand Tschou En-Lai darauf, weiterhin zu versuchen das Flugzeug von Lin Biao abzuschießen.
Das gelang jedoch nicht, stattdessen machte entweder der Pilot der „Trident“ von Lin Biao einen Fehler oder der Motor der Maschine versagte plötzlich. Auf alle Fälle stürzte das Flugzeug nahe der Kreisstadt Ondorhaan ab und zerschellte. Drei Tage nach dem Absturz trafen Vertreter der chinesischen Botschaft in der Mongolei an der Unglückstelle ein. Sie konnten die verstümmelten Leichen nicht identifizieren. 16 Jahre später veröffentlichte der damalige chinesische Botschafter Sue Wenn seine Memoiren, er kommt darin auch auf Lin Biao und den Absturz seines Flugzeugs in der Mongolei zu sprechen. Der Botschafter und seine Mitarbeiter sollten unbedingt Lin Biao unter den Toten identifizieren, dies wäre jedoch nur noch vage anhand einiger unverbrannter Uniformteile möglich gewesen. Auch die Ursache für den Flugzeugabsturz ließ sich vor Ort nicht befriedigend klären. Einige anwesende mongolische Experten seien von einer mißglückten Notlandung ausgegangen.


Die „MIR Kriminal“ schreibt: „In Wahrheit befand sich Lin Biao nicht im Flugzeug und also auch nicht unter den Toten. Der Geheimplan des Verteidigungsministers habe darin bestanden, einige seiner Mitarbeiter in das Flugzeug zu setzen und in Richtung Sowjetunion fliegen zu lassen, wobei er davon ausging, dass es unterwegs abgeschossen werden würde. Er selbst und seine Familie hielten sich unterdes an einem geheimen Ort versteckt, von wo aus sie zusammen mit einem Piloten am 18. September einen Hubschrauber auf einem kleinen Flugplatz westlich von Peking bestiegen. Dies entging dem Geheimdienst jedoch nicht, der umgehend den Ministerpräsidenten Tschou En-Lai informierte. Und der ordnete dann an, den Hubschrauber zur Landung zu zwingen. Das gelang den Streitkräften auch am frühen Morgen des darauffolgenden Tages in der Nähe der kleinen Ortschaft Xuaiju. Der Pilot wurde nach der Landung erschossen, während es Lin Biao, seiner Frau und seinem Sohn gelang, sich mit einer Pistole selbst zu erschießen.“
Die „MIR Kriminal“ erwähnt abschließend aber noch eine andere Version – die von dem US-Historiker David Rappoport stammt. Danach soll Lin Biao und seine Familie nach dem gescheiterten Putsch verhaftet – und auf Anweisung von Mao Tse Tung in ein Geheimgefängnis gebracht worden sein, wo man die drei wenig später ermordete. Rappoport schreibt, dass Lin Biaos Flucht in die Sowjetunion und der Absturz seines Flugzeugs in der Mongolei sowie auch die erzwungene Landung des Hubschraubers nahe Xuaiju nur Ablenkungsmanöver des chinesischen Geheimdienstes gewesen seien…Damit ist jetzt alles klar!!
2. Der Kriegsgott Mars ruft zu seiner friedlichen Nutzung auf
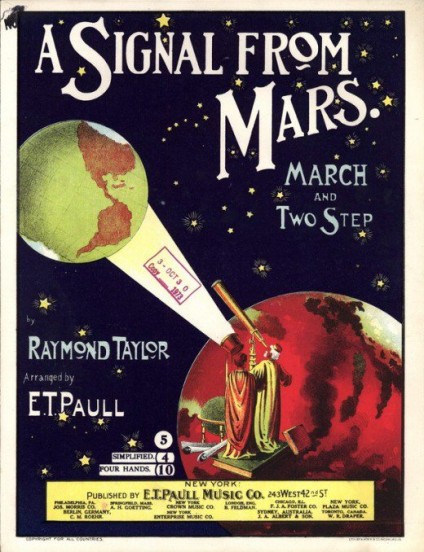
Kurz nach Weihnachten, am 27. Dezember 2012, starb der dienstälteste Mitarbeiter der amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA: ein Schweizer Nachkomme aus einem hinterpommerschen Junkergeschlecht – der Diplomingenieur Jesco von Puttkamer. Bevor er 1962 zur NASA stieß und sich Wernher von Brauns Team anschloß, hatte er sich einen Namen als „Science Fiction“-Autor gemacht. Fortan schrieb er vor allem Sachbücher über den „Aufbruch ins All“ (1969). Sein letztes, kurz vor seinem Tod veröffentlichtes Werk hieß: „Projekt Mars“. Seit 1974 leitete er die „Arbeitsgruppe zur strategischen Planung der permanenten Erschließung des Alls“ in der NASA-Hauptverwaltung in Washington.
Es ging dabei um die Kolonisierung des Weltraums, die ert einmal die Suche nach Planeten mit Lebensmöglichkeiten meinte. Den Anstoß dazu gab, wenn nicht seine eigene Begeisterung für „Science Fiction“, der US-„Futorologe“ Herman Kahn. Mit ihm und den Weltraumkolonie-Ideen der Siebzigerjahre hat sich der Kulturwissenschaftler Claus Pias befaßt. In seinem Aufsatz „Schöner leben“ heißt es über den Futorologen: Der Hintergrund für Kahns „Space-Szenarios“ waren die alarmistischen Prophezeiungen des Club of Rome zu Umweltverschmutzung, Hunger, Ressourcenknappheit und Überbevölkerung 1973. Eine erste „Machbarkeitsstudie“ legte dann 1977 Gerard O’Neill, ein Physiker aus Princeton, vor – mit dem Titel: „Human Colonies in Space“. Er kommt darin zu dem Schluß, „daß es weniger Dreck mache, einen Menschen in den Weltraum zu befördern, als ihn auf der Erde zu lassen.“ Dazu müßte jedoch der „amerikanische Kongreß ein besonderes Gesetz verabschieden, das den Kolonieerbauern den Wunschtraum des Amerikaners erfüllt, nämlich ein schuldenloses Eigenheim, ein Haus in der Weltraumkolonie. Diese Maßnahmen werden die Kolonisierung des Weltraums fördern…Neben allerhand unentfremdeter Arbeit und extraterrestrischem Kunsthandwerk, würde es neue, unschuldige Freizeitvergnügen geben, wie 3-D-Fußball, schwebende Schwimmbäder, meditative Weltraumausflüge oder Sex bei zero-gravity. Offener Raum und Toleranz würden es unterschiedlichen Gemeinschaften erlauben, ‚to do their own thing and build small worlds of their own, independent of the rest of the population‘.“
Claus Pias sieht in diesen Weltraumkolonie-„Visionen“ eine direkte Anleihe bei den aus der Hippiebewegung hervorgegangenen amerikanischen Landkommunen: „Als berühmtestes Beispiel mag man an ‚The Farm‘ denken, die Steve Gaskin 1971 gründete und mit einer Erstbesetzung von über 300 Leuten den Ausstieg aus der Gesellschaft probte, um in unberührter Gegend als autarke, landwirtschaftliche Gemeinschaft zu leben. Was sich nämlich die sogenannten ‚Ecovillages‘ als Agenda setzen – ‚organic gardening and composting; biological waste management; reuse, recycle, rebuild; renewable power systems; egalitarian and open democratic governance‘ – sollte Punkt für Punkt auch für die Weltraumkolonien gelten.“ Laut Pias verwiesen dabei „Technikapologeten wie Zivilisationskritiker“ gleichermaßen auf eine „Humanität“ – die es dort oben „zu gewinnen und zu entfalten gelte“. Dabei kam es zu Konversionen zwischen den Lagern – „wie das berühmte Beispiel von Timothy Leary zeigt, der von chemischen zu elektronischen Drogen und von Roadtrips zu Spacetrips wechselte.“ Als er 1976 aus dem Gefängnis entlassen wurde, sagte er in einem Interview, dass es einen „extraterrestrischen Imperativ“ gäbe: Wir seien dazu bestimmt, im Weltraum zu siedeln. Dazu legte er auch sogleich ein Programm vor – namens S.M.I.L.E.: „Space Migration, Intelligence Increase und Lifespan Extension“. Sympathisanten wie die Ethnologin Margaret Mead sahen darin eine Chance zur Diversität. Hollywood befaßte sich in mehreren Spielfilmen mit den „Space-Colonies“. Jesco von Puttkamer war von 1978 bis 1980 technischer Berater für „Star Trek – Der Film“. Claus Pias schreibt über die Landkommune-Utopien dieses und anderer Weltraumbesiedler: Sie würden „schwerlich den Verdacht abweisen können, dass hinter der versprochenen menschenfreundlichen Pluralität immer schon ein (sich selbst ideologiefrei wähnender) Ingenieur herrscht. So oft und unverblümt das Wort ‘humanity’ im Schrifttum der Kolonisierer fällt, so wenig Vertrauen scheinen sie in dieselbe investieren zu wollen.”
Ab Mitte der Achtzigerjahre ging Jesco von Puttkamer auf Missionsreise – u.a. um Geldgeber für die Weltraum-Siedlungsprojekte zu finden. Dazu organisierte u.a. die Kölner Universität 1987 mit Unterstützung namhafter Sponsoren aus Politik und Wirtschaft für ihn einen Kongreß zum Thema „Weltraum als Markt – Die zivile Nutzung des Weltalls“. Im Jahr darauf lud ihn die Techische Universität Berlin zu einem ähnlichen Thema ein.
Die taz schrieb über seinen Auftritt in der TU: „‚Wir möchten auf die Europäer nicht mehr länger verzichten‘, erklärte der NASA-Projektleiter Jesco von Puttkammer. Der in den USA eingebürgerte Freiherr entwarf mit Hilfe von »Ektas« und Overhead-Projektion eine Vision der ‚Humanisierung des Alls‘, in der altes deutsches Ingenieurdenken, amerikanischer Pioniergeist und New Age-Begrifflichkeit – ‚Netzwerkdenken‘ – einen tibetanischen Gebetsmühlen-Charakter annahmen. Den Einwänden der „Ökos“ hielt er entgegen, ihr Denken sei noch im 19. Jahrhundert behaftet, man habe es nunmehr – in der Verbindung von Technik und Gesellschaft im Weltraum, „Natur ist ja schon da“ – mit einer „Super-Ökologie“ zu tun. Den Feministinnen kam er zuvor: Auch deren Interessen seien bei den Space-Missions bestens aufgehoben. Die Gewerkschafter beruhigte er mit dem Hinweis: ‚Für den Bau der Großraumstation seien jetzt schon 12.000 Arbeitsplätze in Kalifornien entstanden‘. Den um ihre Sicherheiten besorgten Investoren kam er mit der US-Regierung, die sich auf Folgendes festgelegt hatte: ‚1. Verpflichtung und nationaler Wille zur Raumstation, 2. Expansion über die Erdorbits hinaus, 3. Schaffung von Opportunitäten für US-Firmen im All‘.“
Einen Monat später hielt Timothy Leary im Westberliner Tempodrom einen Vortrag zum selben Thema – „Space Emigration“. Die Popsängerin Nina Hagen wollte daraufhin sofort die Erde verlassen.


Als „die Mauer fiel“ gab es jedoch auch hier auf Erden plötzlich genug Abenteuerliches. Die NASA-Weltraumprogramme gerieten darüber fast in Vergessenheit, zudem schrumpfte auch noch die sowjetische Kosmosforschungsprogramme in Baikonur mangels finanzieller Unterstützung immer mehr zusammen. Dort wurden die Raketenflüge zum Teil bereits von internationalen Tabakkonzernen bezahlt – und mußten dafür mit Werbung für die Zigarettenmarke „West“ in den Orbit starten, die ein westdeutscher Punksänger und Maler auf den Raketenkörper malte. Danach zahlte Pepsi Cola fünf Millionen Dollar dafür, dass die noch im All auf der sowjetischen Raumstation MIR verbliebenen Kosmonauten außerhalb ihrer Station eine Pepsi-Dose schweben ließen. Etwas später startete eine russischen Protonrakete von Baikonur aus mit dem Logo von „Pizza Hut“. Mike Rawlings, Chef der weltweit größten Kette von Pizza-Restaurants erklärte dazu: „Wir wollten ein mythisches Symbol, um der Welt zu zeigen, dass unser 41 Jahre alte Pizza Hut Brand revitalisiert wird und mit einem schwindelerregenden Wachstum ins neue Jahrtausend eintritt…Das ist nur ein kleiner Schritt für die Menschheit, aber ein großer Sprung für unsere Erneuerung von Pizza Hut.“ Immerhin werde man 500 Millionen Dollar investieren, um die Restaurants umzubauen und um das neue Image der Öffentlichkeit in einer Werbekampagne zu vermitteln. Die Bemalung der Rakete kostete erst einmal eine Million Dollar.
Florian Rötzer meinte dazu in seinem Internetmagazin „telepolis“, die Kampagne zeige, „dass nun der Weltraum offen ist für die Kommerzialisierung. Vielleicht wird die Raumstation ja tatsächlich zu einem Werbeträger, und wahrscheinlich hofft auch die NASA, mehr Gelder über Werbung zu erhalten. Pizza Hut hat jedenfalls noch weitere Anschläge auf die Aufmerksamkeit vor: Wenn eine Sojus-Rakete die ersten drei Amerikaner auf die sowjetische Raumstation bringen wird, soll die erste Pizza-Party im Weltraum stattfinden. Da Lebensmittel im Weltraum anderes schmecken würden, werde man auch eine neue Weltraumpizza kreiieren: ‚Pizzas sind das beliebteste Nahrungsmittel auf der Erde – und jetzt wird die Pizza von Pizza Hut zum beliebtesten Nahrundmittel im Weltraum werden‘.“
Trotz solch kosmischem Optimismus fehlte auch dem amerikanischen Programm seit dem Zerfall der Sowjetunion schon bald der Schwung – und das Geld. („It is more fun to compete!“) Lustlos wurden privatwirtschaftliche Kooperationen vereinbart und reiche Touristen mit preisgünstigen Angebote in den Weltraum gelockt – “just for fun”. 1998 war diese immer offensichtlicher werdende systemübergreifende Krise bereits in dem Dokumentarfilm des polnischen Regisseurs Maciej Drygas: “Der Zustand der Schwerelosigkeit” von drei ehemaligen sowjetischen Kosmonauten diskutiert worden. K1 meinte damals: “Die Zeit von Gagarin – das war großartig. Die ganze Nation war begeistert. Es ist uns gelungen. Wir sind die ersten!” K2 ergänzte: “Jetzt wollen die Leute dagegen, dass etwas Nützliches bei der Weltraumforschung herauskommt”. K3 präzisierte daraufhin: “Wir haben unser Hauptproblem nicht gelöst. Wir können in den Weltraum fliegen, dort arbeiten und wieder zurückkehren, aber wir haben keine natürliche menschliche Betätigung im Weltraum – im Zustand der Schwerelosigkeit – gefunden. Bis jetzt haben wir keine produktive Tätigkeit dort oben entwickeln können. Ich empfinde das als persönliches Versagen”.
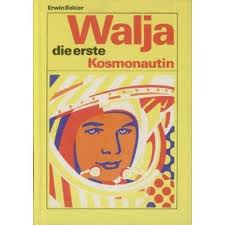

2001 wurde die sowjetische Raumstation MIR mit einem „kontrollierten Absturz“ sozusagen vom Himmel geholt. Am 21. April 2001 jährte sich auch Juri Gagarins Weltraumflug zum 40. Mal. Aus diesem Anlaß trafen sich die Freunde der sowjetischen Kosmosforschung im Berliner Haus der russischen Kultur. Ihr Treffen wurde „überschattet vom Ende der Raumstation Mir”, wie es in den Hauptstadt-Medien hieß. Der DDR-Kosmonaut Sigmund Jähn wünschte der Mir einen gelungenen „Absturz”, begrüßte ansonsten jedoch ihre internationale Nachfolgerin ISS, weil solche Stationen als “Objekt des Stolzes” für die einzelnen Nationen inzwischen zu teuer geworden seien.
Auch Alexander Kaleri war nach Berlin gekommen. Er hatte im Jahr davor, am 15. Juni als Letzter oben in der MIR das Licht ausgeknipst – und den Autopiloten angeschaltet. Jähns damaliger Kopilot Waleri Bykowski hielt statt einer Rede, die er in Moskau vergessen hatte, eine Eloge auf Gagarin – “den Träumer und strengen Ausbilder”. Dessen Autobiografie war kurz zuvor auf Deutsch im Elbe-Dnjepr-Verlag erschienen. Mit Gagarin wurde – folgt man dem Philosophen Emmanuel Lévinas – endgültig das Privileg “der Verwurzelung und des Exils” beseitigt. Man könnte auch sagen: Seit Gagarins Weltraumflug gilt die einstige jüdische “Juxtaposition” für jeden und niemanden mehr. Hinzu kommt, dass in der sowjetischen Kosmonautik die Psychoanalyse überlebte, d.h. jeder Kosmonaut hatte – wegen seiner irren Träume dort oben, über die auch Siegmund Jähn einmal ausführlich berichtete – neben dem Ground-Control-Diensthabenden noch einen Psychoanalytiker am Boden. Mit Lévinas kann man das damit erklären, dass diese letztmalige “Verführung des Heldentums” sich nur “jenseits der Infantilität” verwirklichen ließ. Heldentum und Heimweh sind für ihn die zwei Seiten ein und derselben Wiederentdeckung: von “Welt und Kindheit”.
In den USA erschien ein beeindruckender Bildband “Kosmos” von Adam Bartos, der noch einmal das sowjetische Weltraum-Programm nostalgisch und en détail feierte. In einem Essay schreibt darin die russische Kulturwissenschaftlerin Swetlana Boym, dass sich der sowjetische “Kosmos”-Begriff vom amerikanischen “outer space” dadurch unterscheidet, dass ersterer mit der irdischen Lebenswelt “harmonisch” verbunden ist, während der US-Weltraum so etwas wie eine “new frontier” darstellt. Dies legten auch bereits die Memoiren von Juri Gagarin: “Der Weg in den Kosmos” nahe. Darin heißt es: “Die Familie, in der ich zur Welt gekommen bin, unterscheidet sich in keiner Weise von Millionen anderer werktätiger Familien unseres sozialistischen Heimatlandes. Meine Eltern sind schlichte russische Menschen, denen die Große Sozialistische Oktoberrevolution ebenso wie unserem ganzen Volk einen breiten und geraden Lebensweg erschlossen hat” – der Juri dann bis in den Kosmos führte.
Auf Deutsch erschienen dann – ebenfalls im Elbe-Dnjepr-Verlag – auch noch die fünfbändigen Memoiren des stellvertretenden Leiters des sowjetischen Raketenbau-Programms: Boris E. Tschertok. An einer Stelle heißt es darin, dass trotz wiederkehrender antisemitischer Direktiven von oben (gegen die Kosmopoliten z. B.) „die Juden in der Verteidigungs- und in der Atomindustrie von Stalin und Berija nicht nur gelitten, sondern talentierte Juden sogar beschützt wurden. Sie wurden fast genauso bewacht wie Mitglieder der Regierung.” Tschertok legt nahe, dass auch hinter dem Weißrussen Gagarin viele jüdische Forscher und Techniker standen, dass also auch die Weltraumforschung eine “jüdische Wissenschaft” war, zumindest in der Sowjetunion.
Tschertoks Memoiren beginnen mit dem Einsammeln der ersten versprengten Nazi-Raketeningenieure 1945 durch die Rote Armee, nachdem die Amerikaner sich bereits die Führungsgruppe der “Peenemünder” – um Wernher von Braun – geschnappt hatten. Den Sowjets half dabei der Peenemünder Chefingenieur für Funksteuerung Helmut Gröttrup, dem sie zunächst alle Vollmachten dafür einräumten. Seine Frau Irmgard führte später ein Tagebuch, das sie einige Jahre nach der Repatriierung ihrer Familie in Westdeutschland veröffentlichte – unter dem schönen Titel “Die Besessenen im Schatten der roten Rakete”. Zwar gibt es daran von vielen Seiten inzwischen Kritik – an einigen ihrer “Übertreibungen”, aber dieses Buch verdient es trotzdem oder gerade deswegen, noch einmal wieder neu aufgelegt zu werden, einschließlich der im Anhang abgedruckten “Tarif- und Arbeitsverträge”, die ihr Mann für die etwa 150 deutschen Mitarbeiter entwarf, und die man dann 1946 zusammen mit ihren Familien von Bleicherode nach Moskau verfrachtete.
Dort beginnt das Tagebuch von Irmgard Gröttrup. Sie war nicht nur eine exzentrische Frau, die bald fließend Russisch sprach, sondern auch die Managerin ihres Mannes, überdies Mutter zweier Kinder. Tschertok schreibt, dass sie es überhaupt war, die zuerst mit ihnen, den Russen, verhandelte: “Sie gab uns zu verstehen, daß die Frage, wohin sie gehen, nicht ihr Mann, sondern sie entscheidet”. Auch als ihre Familie 1953 wieder in Westdeutschland eintrifft – und sofort vom CIA verhört wird, wobei man ihrem Mann einen lukrativen Job in den USA anbietet, ist sie es, die entscheidet: “Wir bleiben hier!” Daraufhin mußten sie die Villa, die man ihnen in Köln zur Verfügung gestellt hatte, räumen.

Auch in Bleicherode 1945 stellten die Russen den Gröttrups sofort eine Villa zur Verfügung sowie jede Menge andere Vergünstigungen. “Rückblickend kann ich sagen, daß wir uns in Gröttrup nicht getäuscht hatten,” schreibt Tschertok, der daneben auch die Initiativkraft von Frau Gröttrup bewunderte: So schaffte sie z.B. als erstes zwei Kühe an, um die Ernährungslage der Leitungskader des “Instituts Rabe” sowie der Kinder zu verbessern und zwang überdies immer wieder den für die Versorgung zuständigen Offizier, “defizitäre Produkte” heran zu schaffen. Erst als sie auch noch zwei Pferde kaufte und jeweils ein diensthabender Offizier sie auf ihren Ausritten begleiten sollte, weigerten sich ihre russischen Bewacher – und tauschten die Pferde in zwei Dienstwagen um, von denen sich Irmgard Gröttrup einen sofort “aneignete”. Später nahm sie ihn auch nach Moskau mit, ebenso wie die zwei Kühe. Und nachdem man die in Moskau zentrierten deutschen Raketenbauer in ein Objekt außerhalb der Stadt verlagert hatte, besuchte sie mit ihrem BMW Theatervorstellungen oder traf sich mit ihrem sowjetischen Freund, der als hoher Funktionär in einem Ministerium arbeitete.
Diese selbstbewußte pragmatische Einstellung auf die sowjetischen Lebensbedingungen – als hochprivilegierte “Zwangsarbeiter” mit eigenem Dienstpersonal, die man zuletzt auf die Insel “Gorodomlia” im Seliger-See verfrachtete – verhalf auch ihrem Mann Helmut Gröttrup als Leiter des deutschen Kollektivs zu den “richtigen Ideen” bei der sowjetischen Umsetzung der “Peenemünder Produktionskultur”, deren geistige Arbeiter nicht auf schier kalifornischen Luxus verzichtet hatten, die für die körperlich Arbeitenden jedoch auf mörderischste Versklavung basierte.
Die Anstrengungen von Helmut Gröttrup liefen in der UDSSR darauf hinaus, alle Systeme zu reduzieren – die Rakete zu vereinfachen, mithin “die Peenemünder Linie zu verlassen”, während die sowjetische Seite sich bemühte, alle daran beteiligten Kollektive zu einer “systemartigen” Kooperation zusammen zu fassen. Dabei kam es für die Deutschen, die man mittelfristig sowieso ersetzen wollte, immer wieder zu demotivierenden Entscheidungen. Umgekehrt ließen diese sich aber auch nicht alles gefallen. So notierte Irmgard Gröttrup am 20.6.1952 über ihre Haushaltshilfe: “Ruwa ist frech geworden, ich habe sie entlassen”. Zuvor hatte sie geschrieben: “Ich bin, wie alle, müde, nur noch Anhängsel der Männer zu sein: dieser politischen Objekte”. Ihr Tag sieht so aus: “Zum Strand laufen, Tennis spielen oder den Platz renovieren, lesen, bei Freundinnen sitzen und palavern”.
Dabei kennt sie sich durchaus auch mit der Materie aus, mit der die Männer sich beschäftigen: Bereits 1939 war sie zum ersten Mal nach Peenemünde gekommen, wo sie dann, ähnlich wie die in Ostdeutschland lebende Schriftstellerin Ruth Kraft, als “Rechenmädchen” gearbeitet und später auch ihr erstes Kind bekommen hatte: Ständig unter dem “Rauschen des Prüfstands”. Irmgard Gröttrups Ohr war bald so geschult, “daß ich die einzelnen Brennstufen erkannte”.
Auch auf Gorodomlia errichten die Deutschen bald einen Prüfstand, der ständig rauscht. Ihr Mann arbeitet unermüdlich und versucht nebenbei, um besser mit der russischen Leitung verhandeln zu können, einen “deutschen Verwaltungsrat” zu gründen. Noch nachts werden in den Holzhäusern Reichweiten-Verbesserungsvorschläge diskutiert: “Jochens neue Idee mußte besprochen werden, wir Frauen waren abgemeldet. Ruth griff mechanisch zum Strickzeug. Die beiden Männer – einer so arbeitswütig wie der andere – berauschten sich an ihren Ideen”. Sie hält es oft nicht aus – und als ihr Freund Alexander Petrowitsch mit unbekanntem Ziel aus dem Moskauer Ministerium versetzt wird, läßt sie sich einen Termin beim Minister geben, um die Erlaubnis zu bekommen, ihm nachfahren zu können. Der Minister warnt sie: “Sie sind eine verwöhnte, zarte junge Frau. Sie kommen aus einer bürgerlichen Gesellschaft. Wollen Sie ihre Gesundheit aufs Spiel setzen?” Weil sie uneinsichtig bleibt, liest er ihr aus einem Gedicht von Puschkin vor: “Die Liebe kann warten. Die Liebe ist ewig…” Ein Jahr später notiert Irmgard Gröttrup: “In diesen Frühlingsnächten wird in mir die russische Seele geboren: das Hinnehmen können”.
Auf Gorodomlia fängt sie irgendwann an, einen Raben zu zähmen. Diesen nimmt sie dann auch mit nach Deutschland, wo sie zunächst im Ostberliner Hotel Adlon unterkommen. Wegen des Rabens, der alles vollschiß, mußten sie jedoch das Hotel bald wieder verlassen – und zogen nach Westberlin um. Das behauptet jedenfalls Tschertok in seinen Memoiren. Er war 1992 auf die Spur von Gröttrups Tochter Ursula gestoßen und hatte sie nach Moskau eingeladen. Laut ihrer Tochter erklärte Irmgard Gröttrup dann den CIA-Leuten, nachdem sie das Ehepaar von Westberlin nach Köln gebracht hatten: “daß sie sich ausreichend mit der Raketentechnik in Rußland befaßt haben und jetzt aus Deutschland nicht wieder wegfahren wollen”.

Helmut Gröttrup wurde dann von Siemenseingestellt – und dort schließlich Leiter einer Abteilung von zuletzt 400 Mitarbeitern, die sich mit elektronischen Rechenmaschinen beschäftigte. U.a. kreierte er dabei das Wort “Informatik“. Seine Computerbegeisterung ging so weit, dass er in einem Vortrag vor Hamburger Geschäftsleuten meinte: Die unternehmerische Freiheit sei ein bloßer Irrtum, der auf Informationsmangel beruhe. Um diesen zu beheben, ließ Helmut Gröttrup 1969 zusammen mit seinem Mitarbeiter Jürgen Dethloff einen “Identifikanden mit integrierter Schaltung” patentieren, aus der dann erst die Chipkarte und schließlich die Mikroprozessorkarte wurde, mit der wir alle heute an den Bankautomaten zu unserem Geld kommen. Auch an der Entwicklung dieser Technik war Gröttrup maßgeblich beteiligt – jedoch erst nachdem er die Firma Siemensverlassen hatte. Der Grund dafür war, dass er dort einen jungen Ingenieur zu seinem Stellvertreter ernannt hatte, der wenig später als “sowjetischer Spion” verhaftet wurde. Vor Gericht verbürgte sich Gröttrup für ihn, aber man glaubte ihm nicht, hielt ihn eher selbst für einen sowjetischen Agenten, der schon einmal deutsche Patente an die Sowjets verraten hatte.
Helmut Gröttrup starb 1981 an Krebs, seitdem erinnert sein inzwischen reich gewordener Mitpatentinhaber Jürgen Dethloff immer mal wieder an ihn – im Internet. In der Siemens-Mitarbeiter-Datei existiert er seit seiner “Kündigung” nicht mehr. Irmgard Gröttrup starb 1989. Drei Jahre später notiert sich Tschertok: “Die Tochter war, ohne zu widersprechen, einverstanden, daß ihre Mutter sich sehr viel ausgedacht hatte”. Weil sie ihr Rußland-Tagebuch erst fünf Jahre nach dem Tod ihres Mannes veröffentlichte, hatte sie dazu auch “alle Freiheit der Phantasie”. Es ist erstaunlich, dass sogar Irmgard Gröttrups Tochter diese Meinung vertreten haben soll, denn ihre Mutter veröffentlichte ihr Tagebuch erstmalig 1958 (nicht wie Tschertok schreibt: 1985) – und zwar gleich nach dem “Sputnik-Schock”. Ihr Stuttgarter Verlag bemühte sich damals, wenigstens im Klappentext nahe zu legen, dass die Arbeit der Deutschen in Rußland noch schlimmer als in Peenemünde gewesen sei: “…Wir erfahren von dem technischen und wissenschaftlichen Fortgang der Arbeit der Forscher, dieser ‘Besessenen’, die ohne Rücksicht auf menschliche und politische Probleme einem Ziel dienten: der Rakete”. Von Helmut Gröttrup erschienen etwa zur selben Zeit nur einige “allgemeinverständliche Einführungen” in die Raketentechnik und -physik. Außerdem stammt von ihm wahrscheinlich auch der “kleine technische Exkurs” im Anhang des Tagebuchs seiner Frau, wo außerdem seine sämtlichen Verträge mit den Sowjets abgedruckt wurden. Noch im selben Jahr 1958 interviewte der Spiegel die beiden, wobei Irmgard Gröttrup sich kurz über die anfänglichen Pläne von Helmut Gröttrup in Rußland äußerte: “Mein Mann wollte gleich munter zum Mond!”
Neuerdings, da die Gröttrups sogar aus vielen Archiven verschwunden sind, gibt es ganze Gruppen von neuen Raketenforschern – bei den Historikern und den Kulturwissenschaftlern, wobei einige sich auch mit der “Sowjetisierung der deutschen Fernlenkwaffentechnik” befassen. So werden jetzt z.B. die Memoiren von Tschertok gerade ins Amerikanische übersetzt. Leider mehren sich damit auch jene Stimmen, die Irmgard Gröttrups Buch über “Die Besessenen” als nicht ganz glaubwürdige Quelle abtun.
In Peenemünde, das bis zur Auflösung der DDR der NVA als Marinestandort diente, hatten gleich nach der Wiedervereinigung zwei ehemalige NVAler ein Raumfahrtmuseum eröffnet. Hier konnte man nun quasi in situ deutsche Maenner und ihre Faszination fuer Raketentechnik beobachten. Die Erotik eines fuer den einmaligen Abschuss in den Himmel vorgesehenen Stahlkoerpers macht Ost- wie Westdeutsche nach wie vor gleich kirre. Kurz zuvor hatte Jewgeni Jewtuschenko (in: “Stirb nicht vor deiner Zeit”) noch einmal auf dieses merkwuerdige Objekt maennlich-militaerischer Begierden hingewiesen – und einen am Putsch gegen Gorbatschow beteiligten Afghanistan-Veteran, der zugleich ein bekannter sowjetischer Schriftsteller geworden war, zitiert: “Ich spuerte in der Finsternis an meiner Handflaeche den schneeweissen Frauenkoerper der Kampfrakete. Anfangs war sie noch kuehl, aber je mehr ich sie streichelte, desto waermer und waermer wurde sie, ihre Hueften schienen schwer atmend vor unausgesprochener Leidenschaft zu vergehen, und es schien mir, als wuerde ich auf dem Koerper der Rakete unter meinen Fingerkuppen gleich die Woelbungen der in Erwartung meiner Beruehrung aufgerichteten Brustwarzen spueren.”
Dem US-Schriftsteller Thomas Pynchon kommt das Verdienst zu, als erster den Zusammenhang von Männersexualität und Raketentechnologie herausgearbeitet zu haben: Sein Romanheld, Slothrop, wird noch waehrend der Kämpfe um Berlin auf die Spur der Nazi-Superwaffe (und eines neuen erektionsfähigen Plastematerials) in Richtung Peenemünde gesetzt, nachdem Geheimdienste der Alliierten herausgefunden haben, dass überall dort, wo Slothrop in London mit einer Frau Geschlechtsverkehr hatte, wenig später eine deutsche V2-Rakete einschlug.Was sich wie ein durchgeknallter amerikanischer Roman liest, ist in Wahrheit detailgenaueste Rekonstruktion: Dem ehemaligen Flugzeug-Ingenieur Pynchon stand dafür Archivmaterial zur Verfügung, das erst zwölf Jahre nach Veröffentlichung seines Romans “Gravity’s Rainbow” freigegeben wurde (ihre dokumentarische Bearbeitung durch eine Frau, Linda Hunt, führte 1985 dazu, dass einige nach dem Krieg für die NASA tätig gewesene Peenemünder Raketenforscher entehrt nach Deutschland zurückkehrten).

Der ehemalige Schweizer Jesco von Puttkamer wurde 2004 an der Realisierung des Mond/Mars-Langfristprogrammes der NASA beteiligt, das vom damaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten George W. Bush initiiert wurde. Ab 2007 war er im „Office of Space Operations“ (OSO) in führender Stellung mit der neuen, diesmal „internationalen“ Raumstation „ISS“ befaßt. Die Pläne für eine große, internationale Raumstation gehen bis in die 1980er Jahre zurück. „Die Station war damals noch unter den Namen Freedom bzw. Alpha in Planung. Die ISS befindet sich seit 1998 in Bau und ist zurzeit das größte künstliche Objekt im Erdorbit. Sie kreist aktuell in ca. 400 km Höhe und soll mindestens bis ins Jahr 2020 betrieben werden,“ heißt es auf Wikipedia.
Neben Peenemünde und dem KZ „Dora“ bei Nordhausen gab es auch in Berlin nach der Wende Überlegungen, die Überbleibsel der deutschen Raketenforschung zu verwerten. In Adlershof zeugt von der Peenemünder Raketenforschung noch der inzwischen unter Denkmalschutz gestellte große Windkanal, ferner ein Testlabor für Antriebsaggregate und zwei Werkstätten, die regelmäßig von den „Peenemündern“ genutzt wurden. Zu DDR-Zeiten siedelte man deswegen hier u.a. das Institut für Kosmosforschung an, das nach der Wende als eines von elf Instituten der Akademie der Wissenschaften „positiv evaluiert“ wurde, dann im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt aufging und seitdem Orbitforscher aus Ost und West vereint. Unter anderem bauten sie in Zusammenarbeit mit Zeiss Jena die Kamera für den „Mars-Expreß“, beschäftigen sich mit „Asteroiden-Prävention“ und bereiten sich auf eine neue Mond-Mission vor, denn „der Mond ist schlechter als der Mars erfaßt“. Quasi nebenan auf der grünen Wiese wurde 1998 ein Speicherring zur Elektronenbeschleunigung von der Bessy GmbH errichtet. Das runde Großlabor ist zusammen mit einem Laserstrahl, der nachts sichtbar das Gelände bis über den S-Bahnhof überspannt, eine Art Wahrzeichen des Adlerhofer „Parks“, in dem bis jetzt 7000 Menschen beschäftigt sind. Das Eingangsportal zur altneuen Wissenschaftsstadt sollte eigentlich Albert Speer Jr., der Sohn des für Peenemünde verantwortlichen Naziministers, gestalten, dann entschied man sich jedoch für den Entwurf zweier Studenten, der im Zentrum auf dem neuen „Campus“ realisiert wurde, wo auch die zwei Werkstätten der „Luft- und Raumfahrtpioniere“ stehen, die zu einem studentischen Café und einem Ausstellungsraum umfunktioniert wurden.
Ich schrieb 2009 in der taz: „Dass der Tod von Michael Jackson (“Moonwalk”) und das Jubiläum der ersten Mondbegehung (Armstrong) zusammenfallen, ist natürlich ein schöner Zufall, aber dass die Medien sich seit Tagen wegen dieses “kleinen Schritts” auf dem Mond überschlagen ist mehr als dämlich.“ In der NZZ hieß es zuvor: “Die Gründe für das wiedererwachte Interesse am Mond sind vielschichtig. Neben dem Ringen um die Vormachtstellung im Weltraum spielen handfeste wirtschaftliche Interessen – Stichwort Bodenschätze – eine Rolle. Auch die Wissenschaft meldet sich zu Wort und verweist darauf, dass der Mond trotz den Apollo-Missionen immer noch Rätsel aufgibt. In den kommenden Monaten wird sich zeigen, ob Obama auch in der Raumfahrtpolitik neue Akzente zu setzen gedenkt. Dabei geht es nicht primär um die Frage, ob man zum Mond fliegen soll oder anderswohin. Entscheidend ist vielmehr, ob es Obama gelingt, eine Gesamtstrategie zu entwickeln, die auf breite Zustimmung stösst. Denn ohne gesellschaftliche Geschlossenheit rückt im Weltraum jedes Ziel in weite Ferne – ob es nun Mond, Mars oder anders heisst.“
Es geht also um “gesellschaftliche Geschlossenheit” – deswegen das ganze Mediengedröhne, auch in Europa: „So wäre die europäische Raumfahrtbehörde ESA ohne die Nasa kaum in der Lage, ihre Pläne für eine bemannte Mission zum Mond zu verwirklichen,” schreibt die NZZ.

Das Haus der russischen Kultur in Berlin, das damals von einer ehemaligen Kosmonautin geleitet wurde, lud dazu dann den US-Astronauten Charles Duke und seine Ehefrau Dotty ein. Den beiden ging es primär um ihren Gottesbeweis. “Charlie” leitete den Vortrag mit seinem Spaziergang auf der dunklen, “erdabgewandten Seite des Mondes” und seiner anschließenden Ehekrise ein: “Wenn ich zu Hause war, gab ich meinen Kindern Befehle, als wäre ich ein General, der ich auch tatsächlich war.” Dotty wurde derweil immer depressiver: “Als er vom Mond zurückkam, hatte er sich nicht geändert!” Dazu konnte man für 2 Euro ein Büchlein von ihr erwerben: “Die Gattin eines Astronauten – Von der Traurigkeit zur Freude”. Ihr Mann ist inzwischen Priester in Texas, sein Geld verdient er als Bierhändler – wobei er einer seiner besten Kunden ist, wie der Berliner Kurier schrieb.
Ich unterhielt mich anschließend noch mit dem letzten – ebenfalls religiös gewordenen – US-Kommandanten des Spandauer Kriegsverbrechergefängnisses Eugene K. Bird, der in einem von Albert Speer im Knast entworfenen Haus in Dahlem lebt und Vertreter für Ofenrohrreiniger ist. Er meinte, Martin Bormann habe nach dem Krieg für den CIA gearbeitet und wäre erst 1992 in Argentinien gestorben, einer seiner Söhne sei von Walter Scheel adoptiert worden, und Rudolf Hess, der zuletzt ebenfalls zum Christentum zurückfand, sei von den Westalliierten ermordet worden, was man anschließend mit Sekt gefeiert habe. Der Nazismus, der Wahn von der Überlegenheit einer Rasse, sei im übrigen nicht tot, sondern lebe in Amerika weiter.
Vor allem der Wahn von der Überlegenheit des christlichen Gottes – z.B. gegenüber dem Mondgott “Trival” der Fulbe in Burkina Faso. Immerhin hat dieser noch jeden Ami-Astronauten, der den Mond betrat, durchknallen lassen: Der größenwahnsinnige Ed Mitchell (Apollo 14) behauptet seitdem, Außerirdische hätten ihn zu einem “Guru” ausgebildet. Der Astronaut Jim Irwin (Apollo 15) suchte danach die Arche Noah auf dem Berg Ararat und wurde Wanderprediger. Der Alkoholiker Edward Aldrin (Apollo 12) vergnügte sich oben angeblich mit “Weltraum-Groupies” und schreibt seitdem Sciene-Fiction-Pornos. Der “erste Mensch auf dem Mond” – Neil Armstrong – unterstützte zuletzt die beiden Bush-Präsidenten. Der Astronaut Alan Bean malt seit seiner Rückkehr auf die Erde ununterbrochen den Mond.
Für die Verfilmung des amerikanischen Peenemünde-Romans „Die Enden der Parabel“ von Thomas Pynchon durch den Regisseur Robert Bramkamp, der seine Doku-Fiction dann „Prüfstand 7“ nannte, interviewte ich die einstige „Peenemünderin“ Ruth Kraft, die es nach 1945 in der DDR zu einer Bestsellerautorin brachte.
Die Autorin hatte als technische Rechnerin im Windkanal des aerodynamischen Instituts der Heeresversuchsanstalt gearbeitet und diese Erfahrung nach dem Krieg zu einem Roman verarbeitet, der 1959 im Verlag der Nation erschien.
Das Buch wurde bis zum Ende der DDR 23mal wiederaufgelegt und insgesamt ueber 500 000mal verkauft. 1991 gab es der ehemalige kaufmaennische Geschaeftsfuehrer des Verlags in seinem eigenen Verlag, Vision, neu heraus.Zwar haben viele “Peenemuender” ueber ihre damalige Pionierarbeit Buch gefuehrt: erwaehnt seien Walter Dornberger (von der Autorin “der General” genannt), und sein Direktor, Wernher von Braun (“der Doktor”) – aber Ruth Kraft ist die einzige Frau, die dabei auch noch im Gegensatz zu den maennlichen Autoren, bewusst Fakten und Fiktion vermischte.
Ihr autobiographischer Roman wurde in der DDR, wenigstens anfaenglich, vor allem von Frauen gelesen.”Das Buch war sofort ein Knueller, weil zuvor noch niemand ueber das Thema geschrieben hatte.”
Gleich bei ihrer ersten Lesung in Wolgast wurde Ruth Kraft von einer Mathematiklehrerin angesprochen: “Das war die in dem Roman gewesen, die den spitzen Schrei unter der Dusche ausgestossen hatte. Sie war mir aber nicht boese. ,Aber was du mit dem Buch hier angerichtet hast . . .’, meinte sie.”Die Autorin, Jahrgang 1920, hatte in Torgau das Lyzeum besucht und war dann einer Klassenkameradin nach Peenemuende gefolgt.
Damals wurden gerade in den Arbeitsdienstlagern Maedchen mit Abitur fuer die Heeresversuchsanstalt rekrutiert. Obwohl ohne Abitur stellte die dortige Personalstelle Ruth Kraft aufgrund ihrer guten Mathematiknoten am 1. Maerz 1940 ein. Sie blieb drei Jahre und lernte dabei einige hundert Leute kennen: “beruflich und auf geselliger Ebene. Aspekte, die mir spaeter die ganze Chose am deutlichsten darzustellen schienen, habe ich mir jeweils aus verschiedenen Personen rausgesucht. Wir lebten dort sehr freizuegig und in herrlicher Landschaft. Es bildeten sich Freundeskreise. Viele Maenner, Ingenieure und Wissenschaftler, waren ja Junggesellen und meist vier bis sechs Jahre aelter als die Maedchen. Die Spitzen der Unverheirateten wohnten “Am Platz” – Wernher v. Braun z.B. und sein Stellvertreter Eberhard Rees, ebenso die Erprobungsflieger, zu denen gelegentlich auch Hanna Reitsch gehoerte.
Am Platz befand sich auch das Kasino, das war unser Treffpunkt.Ein Grossteil ihres Buches befasst sich mit den Liebesabenteuern der freiwilligen und dienstverpflichteten Maedchen – auf Partys, Segeltoerns in den Greifswalder Bodden, Ausfluege zum Festland und Rendezvous am Strand.
Dabei gibt es mitunter erstaunliche Parallelen zu Thomas Pynchons Darstellung. Wenn Ruth Kraft (“Eva”) z. B. eine nachlassende Verliebtheit mit Begriffen aus der Raketenforschung beschreibt: “Es war wie in einem Leitstrahl, aber jetzt kam die Umlenkung. Was sie noch vor einem halben Jahr in die Mitte getroffen haette, beruehrte sie gerade so, wie auf ihrem Millimeterpapier die Tangente die Parabel streift.” In dem von Ruth Krafts Roman (“ein fetziger Stoff”) profitierenden DEFA-Film “Die gefrorenen Blitze” (1967) heisst es an einer Stelle: “Die Vernichtung des Gegners wird zur mathematischen Gleichung.”
Realisiert wurde dieser Nazi-High-Tech-Traum freilich erst mit den “intelligenten Bomben” der Amerikaner. In Peenemuende, wo zwei NVA-Offiziere zusammen mit einem Usedomer Geschichtsverein angefangen hatten, ein “Informationszentrum ,Geburtsort der Raumfahrt’” aufzubauen, tauchten die zu “Amerikanern” gewordenen Alten Kameraden schon gleich nach der Wende wieder auf, um dort ihr “Know-how” einzubringen.

Anlaesslich des 50. Jahrestags der Bombardierung Peenemuendes fand in der Kirche von Karlshagen eine Trauerfeier statt. In der Naehe befindet sich eine Gedenkstaette fuer die bei der Bombardierung 1943 umgekommenen Zwangsarbeiter, Kriegsgefangenen und freiwillig- bzw. dienstverpflichteten Deutschen. Mangels genauer Namenslisten hatte die DDR sie anonym aber nach Nationalitaeten getrennt, aufgefuehrt: Hier ruhen 65 Polen, 20 Tschechen, 30 Franzosen usw.Daran hat man bis heute nichts geaendert, der deutschen Toten wird dort jedoch neuerdings mit Namensnennung auf Grabsteinen gedacht.
Initiiert hatte dies eine Gruppe ehemaliger Kriegshilfsdienst-Maiden, die Peenemuender geheiratet hatten und mit diesen dann in die USA gegangen waren. Beim ersten Insel-Treffen des in der BRD gegruendeten Vereins ehemaliger Peenemuender 1991 waren diese “Amerikaner” besonders empoert ueber die mangelnde Pflege der Graeber durch die ehemalige DDR-Regierung gewesen. In der Bombennacht waren auch viele ihrer Freundinnen dort umgekommen. Der Karlshagener Pfarrer versprach daraufhin, sich um die Graeber zu kuemmern.Im Maerz 1943, “kurz nach Stalingrad”, steckte Ruth Kraft “in derart wirklich persoenlichen Konflikten”, dass sie unbedingt von Peenemuende weg wollte.
Ihr letzter Verehrer dort war ein oesterreichischer Testpilot gewesen, den man nach Dresden zu den Junkerswerken abkommandiert hatte. Das “Kraftchen”, wie Ruth Kraft in Peenemuende hiess, wurde am 1. April 1943 in der Wehrkreisverwaltung Stettin angestellt. Sie war fuer die weiblichen Jugendlichen in den Lazaretten, beim Heeres-Sanitaetspersonal und in den Frauenarbeitslagern zustaendig. Als sie die Nachricht von der Bombardierung Peenemuendes, am 18. August 1943, erreichte, fuhr sie – mit einem Dienstreisebefehl – sofort dorthin: “Ab Swinemuende herrschte bereits Chaos. Aber ich kam durch, und nahm an der Generalsbesprechung teil.
Ich habe dann die Belange der Frauen da vertreten. Meine fruehere Abteilung wurde nach Kochel in Oberbayern verlegt. Ich ging zurueck nach Stettin und unternahm in der Folgezeit viele Dienstreisen. Meine Hauptperson, Eva, arbeitet in einer Ruestungsfabrik, ich selbst war jedoch nur als Inspekteurin in solchen Fabriken. Als die Stadt Ende Maerz von der oestlichen Oder-Seite beschossen wurde, verlegte man unsere Dienststelle nach Schwerin, das weibliche Personal kam in die Moltke-Kaserne.”Schon bald wurden sie auch von dort vor den anrueckenden Russen in Sicherheit gebracht – mit Lkw in Richtung Norden, nach Daenemark: Ein Stabsintendant war unser Reiseleiter.
Kiel stand in Flammen, in Luebeck stuermten die Fremdarbeiter gerade das Verpflegungsdepot. In Rendsburg machten wir uns schliesslich selbstaendig, uebernachteten auf Heuboeden.”Sie fanden Arbeit im Krankenhaus. Dann kamen die Englaender. Ruth Kraft gelang es schliesslich, sich bis in ihre Heimatstadt Schildau durchzuschlagen.
In ihrem Haus hatte sich jedoch der sowjetische Stadtkommandant einquartiert: “Verwandte von uns besassen einen Bauernhof, dort haben wir in der Landwirtschaft gearbeitet. Abends sassen wir beisammen und beschaeftigten uns mit Literatur. Mein Vater wurde dann enteignet, meinen Verwandten die Hoefe weggenommen, ich wusste nicht, was werden sollte. Es war eine Flucht in die Literatur.
Man riet mir, nach Leipzig zu gehen, wo sich jetzt in Auerbachs Keller die Intellektuellen aus den KZs und der Emigration treffen wuerden.” Im Winter 1945 kam Ruth Kraft bereits mit einigen “aus dieser Truppe” in Kontakt: Erich Loest und Georg Maurer z.B., in Dresden dann Ralph Giordano, Rudolf Leonhardt und Ludwig Renn. Auch ihren spaeteren Ehemann, Hans Bussenius, lernte sie in Leipzig kennen. Er arbeitete als Regisseur beim Mitteldeutschen Rundfunk.
Ab 1947 schrieb auch Ruth Kraft fuer das Radio – als Freie Mitarbeiterin beim Kinderfunk: “Der junge Goethe” hiess eine ihrer ersten Sendungen.Dennoch wurden in der DDR viele positive Besprechungen nie gedruckt und einen Preis hat sie fuer ihren Erfolgsroman auch nie bekommen, das Buch passte nicht in den realen Sozialismus. Die Antifas waren dagegen. “Ein beruehmter Schriftstellerkollege hat mir einmal gesagt, ich haette damit den Nationalsozialismus verharmlost, auch das juedische Problem. Meine Heldin, Eva, ist naemlich eine, wie es damals hiess, Halbjuedin, die ein HJ-Fuehrer kurzerhand zur Vierteljuedin erklaert hatte, und damit durfte sie in den Arbeitsdienst. Das gab es. Ich bin aber keine Halbjuedin, eine sehr nahe Freundin unserer Familie war jedoch eine, die auch, wie die Eva in meinem Roman, ueberlebt hat. Meine Nachbarin in Babelsberg, Hilde, die Frau von Hans Marchwitza, sagte einmal zu mir: ,Ruth, Sie sind eine grosse Erzaehlerin, aber Ihre Heldin haette untergehen muessen.’” Ihr Roman wurde auch in Amerika gelesen, bei den dortigen “Peenemuendern” vor allem, z.B. in Huntsville, wo Wernher von Braun es “wohlwollend” aufgenommen haben soll. Das erste Nachwende-Treffen der Alten Kameraden fand im Mai 1990 an der Normandiekueste statt, von wo aus die V2-Raketen gen England abgeschossen worden waren.
Im September 1991 lud man aber bereits erstmalig nach Peenemuende ein.
Ruth Kraft traf dort die letzte Sekretaerin des “Raketenbarons”, Dorette Kersten, wieder (sie hatte in Peenemuende einen Leutnant geheiratet und war mit ihm zusammen dem “Von-Braun-Team” nach Amerika gefolgt). Frau Kersten versicherte der Autorin, dass das Buch immer einen “sehr guten Platz” in ihrem Haus haben werde. “Der Doktor”, von Braun, kommt bei Ruth Kraft in der Tat sehr gut weg.
In der DDR hat man ihr denn auch gerade “die positive Darstellung Wernher von Brauns uebelgenommen: Ich haette ihn zum halben Widerstandskaempfer gemacht”, hiess es. Im DEFA-Film “Die gefrorenen Blitze” machte man spaeter statt dessen einen eigensinnigen Triebwerks-Ingenieur zum halben Peenemuender Widerstandskaempfer.
Dem Drehbuch-Autor und MfS-Offizier Harry Thuerk stand dafuer wahrscheinlich der seinerzeit fuer den englischen Geheimdienst zusammengestellte “Oslo-Bericht” ueber die V2 zur Verfuegung, an dem der Peenemuender Ingenieur Kummerow mitgearbeitet hatte.
Er wurde dafuer am 4. Februar 1944 hingerichtet.Sowohl im DEFA-Film als auch bereits in Ruth Krafts Buch wird die Verbindung von Raketentechnik und Atomkraft thematisiert. Im Roman freundet sich Eva mit dem Atomphysiker Tiefenbach an, der “als Kernforscher bei den Raketenbauern nicht am richtigen Platz war”.
Und dann gibt es da noch einen Physiker Leupold, der in Wirklichkeit Max Steenbeck hiess.
Er wurde spaeter von den Sowjets zur Mitarbeit an der Atombombe verpflichtet und war dann der einzige deutsche Wissenschaftler, der bei der anschliessenden Konstruktion einer Neutronenbombe seine Mitarbeit verweigerte (mit einer Art Streik), weswegen er auch zu den allerletzten gehoerte, die 1956 in die DDR repatriiert wurden, wo 1978 seine “Schritte auf meinem Lebensweg” erschienen.
In Peenemuende hatte Ruth Kraft vor allem den Quantenmechaniker Pascual Jordan kennengelernt. Er interessierte sich fuer ihre Gedichte, die sie damals angefangen hatte zu schreiben. Spaeter traf sie ihn noch einmal in Hamburg wieder.Mit Beginn der sechziger Jahre machte sie sich an eine weniger biographisch orientierte Fortsetzung ihres Romans, in dem es ihr vor allem um die Frage der “Verantwortung von Wissenschaftlern” ging. Dazu besuchte sie “als erste deutsche Frau” das sowjetische Atomforschungszentrum Dubna.
Ihr Buch erschien 1965 in der DDR unter dem Titel “Menschen im Gegenwind”.Die Handlung war in der BRD angesiedelt und statt “Eva” spielte der Kernforscher “Tiefenbach” darin die Hauptrolle. Er war aus Amerika zurueckgekehrt und suchte eine Anstellung in der sich gerade zusammenfindenden europaeischen Atom-Industrie.Auch dieses Buch, das in der DDR zehn- mal wiederaufgelegt wurde, erschien nach der Wende im Vision-Verlag.
In einem Nachwort schreibt die Autorin 1993, dass sie ihr Buch vor der Neuauflage “gruendlich ueberarbeitet” habe, d. h. alles “Indoktrinierte” entfernt – es hatte sowieso “dem Buch nur geschadet, dass ich auf alle Fragen eine Antwort zu wissen meinte”. Beim ersten Nachwende-Treffen der Raketenbauer in Peenemuende, 1991, kannten viele nur ihren ersten Peenemuende-Roman, den sie “zu erotisch” fanden.
Auf einer gemeinsamen Bootsfahrt zur Greifswalder Oie, dem frueheren V1- und V2-Probeabschuss-Ort, wo im uebrigen auch 400 der etwa 2000 beim Luftangriff ums Leben gekommenen Zwangsarbeiter verscharrt worden waren, interviewte eine Wendtlaendische Filmgruppe Ruth Kraft: “Das stiess einigen Peenemuendern sehr sauer auf: ,Mein Buch muesste man in die Ostsee schmeissen’, schimpften sie.”
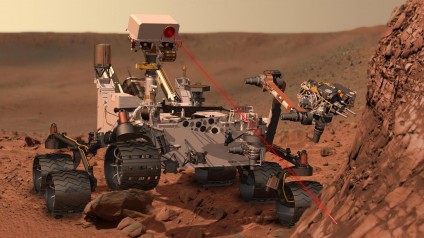
1992 wollte der Bundesverband der Luftfahrtindustrie den ersten erfolgreichen Abschuss einer deutschen Mittelstreckenrakete (V2), am 3. Oktober 1942, spektakulaer in Peenemuende feiern. Ein Staatssekretaer aus dem Wirtschaftsministerium, Riedl, sollte eine Rede halten. Nach Protesten aus dem In- und Ausland musste er jedoch davon Abstand nehmen. Dafuer sprach im Festzelt neben dem Pynchonforscher Friedrich A. Kittler der V1-Mitarbeiter und Testpilot Max Mayer, den Stoltenberg als Raketenexperte ins Verteidigungsministerium geholt hatte: “Er spielt ueberhaupt bei den Peenemuendern eine grosse Rolle. 1992 hatte ich aber zum Tag der Deutschen Einheit noch andere Einladungen, deswegen tauchte ich nur kurz im Hotel Baltic in Zinnowitz auf, wo die Crew wohnte, die Journalisten waren in Karlshagen untergebracht. Weil ich das Goldene Kalb, das A4, wie wir die V2 nannten, nie angebetet habe, konnte ich auch immer offen darueber reden. Bei den alten Peenemuendern gibt es zudem immer noch eine Menge Antisemiten. Das war auch ein Grund fuer die Aversionen gegen mein Buch: dass ich das juedische Problem mit der Raketengeschichte verflochten hatte. Hinzu kommt: Ich bin keine Expertin, ich bin eine Frau und ich war in der DDR zu Hause.”
Dem 3. ebenso wie dem letzten Inseltreffen der Peenemuender blieb Ruth Kraft fern. Dort trat jedoch der ehemalige technische Direktor von Peenemuende, Arthur Rudolph, der mittlerweile als Rentner in Hamburg lebte, erstmalig wieder auf. Durch die Veroeffentlichung von Akten ueber die Kriegsverbrechen der Peenemuender (vor allem in den Harzer “Mittelwerken”, dem KZ „Dora“, wo die V2 serienmaessig von KZ-Haeftlingen zusammengebaut wurde) war Arthur Rudolph, der spaetere hochdekorierte Pershing-Konstrukteur, 1985 aus den Vereinigten Staaten vertrieben worden. Im Sommer 1993 hatte zudem noch ein Osnabruecker Historiker, Rainer Eisfeld, im Koblenzer Bundesarchiv, wo auch noch einige Peenemuender Rechenarbeiten von Ruth Kraft liegen, Unterlagen darueber gefunden, dass Arthur Rudolph schon im Juni 1943 fuer Peenemuende 1400 KZ-Haeftlinge von der SS angefordert hatte. Durch die Bombardierung war es dazu dann nicht mehr gekommen.
In Peenemuende ging nur noch das Vorserienwerk in Betrieb – bis zum Januar 1945, als die gesamte Heeresversuchsanstalt wegen der heranrueckenden Front geraeumt werden musste.Die Sowjets uebernahmen nach Kriegsende im wesentlichen die unterirdischen Harzer “Mittelwerke”, um die herum sie unter der Leitung des Diplomingenieurs Helmut Groettrup und ca. 600 deutschen Mitarbeitern sofort eine neue V2-Fertigung aufbauten: Die sogenannten “Zentralwerke”.
Nachdem die Raketenproduktion in diesem Betrieb erfolgreich angelaufen war und ein Fuenfjahresplan des Obersten Sowjets die Raketen- und Atombombenentwicklung gleichberechtigt nebeneinander zu forcieren vorsah, wurden die “Zentralwerke” am 22. Oktober 1946 mit Mann und Maus nach Russland verlegt. Dabei konzentrierte man die zweite Garde der deutschen Raketentechniker (die erste hatten die Amerikaner in einer “Operation Paperclip” sowie die Englaender eingesammelt) in ihrer Mehrzahl an einem Standort auf der Insel Gorodomlia im Seeliger See. Es gibt darueber mittlerweile einen systematischen Bericht der Historiker Albrecht, Heinemann-Grueder und Wellmann, 1992 unter dem Titel “Die Spezialisten” im Dietz-Verlag veroeffentlicht.Aehnlich gruendliche Recherchen gibt es weder ueber die nach Amerika und England abgewanderten deutschen Wissenschaftler noch fuer die nach 1945 in franzoesische Dienste getretenen, schon gar nicht ueber jene Gruppe deutscher Ingenieure, die im Auftrag von Staatspraesident Nasser an einer aegyptischen Rakete gegen Israel arbeitete. Sie wurde teilweise vom israelischen Geheimdienst Mossad mit Paketbomben dezimiert.Einige Mitarbeiter sollen in den siebziger Jahren in der Abschreibungsfirma von Lutz Kayser, OTRAG (Orbit-Transport-Aktiengesellschaft) eine neue Anstellung gefunden haben. Aufsichtsratsvorsitzender dieses Konsortiums fuer den Bau von “Billigraketen” war der Peenemuender Kurt Debus, sein alter Raketentechniker Richard F. Gomperts wurde Konstruktionschef.
Als Versuchsfeld hatte die OTRAG ein Gelaende in Zaire von der Groesse Oesterreichs erworben, fuer das sie mit dem Staatspraesidenten Mobutu ausserdem eine “freie Uranausbeutung”, “gesperrten Luftraum” und die “Durchfuehrung beliebiger Arbeiten” aushandelte. Gestuetzt auf Geheimdiensterkenntnisse outete 1976 ein Mitarbeiter der New York Times, Szule, die Firma von Lutz Kayser als “ein Unternehmen der Ruestungskonzerne Messerschmitt, Boelkow, Blohm” (die heute zusammen mit der Dornier GmbH als Deutsche Aerospace AG, DASA, firmieren und zur Daimler-Benz AG gehoeren).
Die OTRAG-Experimente beendete spaeter der Buergerkrieg in Zaire. Die DASA gruendete 1990 eine “Deutsche Agentur fuer Raumfahrtangelegenheiten”, DARA GmbH, in deren “Sonderauftrag” der Dornier-Wissenschaftler Dr.
Dieter Genthe 1991 eine Studie “Zur Realisierbarkeit eines Raumfahrtparks/Space Park in der BRD” erstellt hatte.
Diese Studie wurde dann Grundlage fuer eine “Betriebsgesellschaft Raumfahrtpark Peenemuende”, die der Landkreis Ostvorpommern, die Kommune Peenemuende und die Kreissparkasse Wolgast 1994 gruendeten. Zum Geschaeftsfuehrer ernannten sie den amerikanischen Pensionaer Veit Hanssen. Auch die zwei NVA-Offiziere vor Ort, Profe und Saathoff, waren mit von der Partie. Hanssen trennte sich jedoch schon bald von ihnen, weil sie ihm nicht “unbelastet” genug waren (“Ich moechte im Park keine MiGs und DDR-Kriegsschiffe sehen!”).
Dafuer wollte er ein “Astronauten-Trainingscenter” in Peenemuende bauen.Zuvor hatte das Kultusministerium Mecklenburg-Vorpommern noch eine Herrenrunde mit der Begutachtung der DARA-Studie beauftragt: ein knappes Dutzend namhafter Museumsberater und -leiter des In- und Auslands, darunter auch einige Offiziere der Bundeswehrmuseen, sowie den Leiter der KZ-Gedenkstaette “Mittelbau-Dora” im Harz, die das “Space Park”-Konzept einhellig ablehnten: Weder bestehe dafuer eine “bildungspolitische Notwendigkeit”, noch sei Peenemuende ueberhaupt die “Wiege der Raumfahrt” gewesen.
Sie bezeichneten es als “Verdraengung von Geschichte”.In einem Gegenkonzept, verfasst vom Direktor des Berliner Museums fuer Verkehr und Technik, Prof. Guenther Gottmann, sprachen sich die Berater stattdessen fuer einen kleinen “Museums-Park Peenemuende” aus, der an das Otto-Lilienthal-Museum im nahen Anklam angebunden werden solle. Die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern aeusserte sich zu diesem Konzeptionsstreit erst einmal nicht, ebensowenig die Bundesregierung, die bei einer Stellungnahme zum Thema Peenemuende in jedem Fall Proteste aus dem Ausland befuerchtete.
Die kamen im Oktober 1994 dennoch, und zwar initiiert von einer Frau: der Ost-Berliner Historikerin Regina Scheer, die im Auftrag der Bundeszentrale fuer politische Bildung saemtliche Gedenkstaetten Mecklenburg-Vorpommern katalogisiert und dabei auch Peenemuende besucht hatte, wo sie zu ihrem Entsetzen erfuhr, dass dort inmitten der “Waffenverherrlichung” eine neue – allgemeine – Gedenkstelle “fuer die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft” geplant sei, wobei man an erster Stelle auch noch der “Opfer der Vertriebenen aus Pommern” zu gedenken beabsichtigte. Regina Scheer wandte sich daraufhin an die juedische Gemeinde in Mecklenburg-Vorpommern und diese informierte das Simon-Wiesenthal-Center in Los Angeles, wo ein Rabbiner, Abraham Cooper, sogleich eine Presseerklaerung herausgab, in der er die Bundes- und die Landesregierung sowie deutsche Firmen aufforderte, “kein Geld fuer ein Museum zu spenden, das eine Terrorwaffe in den Mittelpunkt stellt, die einst mehr als 2000 Briten und zehnmal mehr Zwangsarbeiter in Deutschland toetete”.Der Zeitpunkt des Protestes war gut gewaehlt, denn kurz zuvor war gerade eine grosse neue Studie ueber Peenemuende und die Operation Paperclip in den USA veroeffentlicht worden.
Der Verfasser, Dr. Michael Neufeld, Kurator im National Air and Space Museum, Washington, wurde dann Mitglied in der Beraterkommission des Kultusministeriums von Mecklenburg-Vorpommern. Das Dara-Konzept für einen Space-Park wurde dann aber doch noch verwirklicht – in Bremen. Die dortige Betreibergesellschaft ging jedoch kurz nach der Eröffnung pleite.
Auf der Webpage des Peenemünde-Objekts, dessen Verwalter nun ein Wehrdienstverweigerer ist, heißt es: “Das Museum Peenemünde ist heute eine internationale Bildungs- und Kulturstätte. Neben Sonderaustellungen sind Veranstaltungen aus den Bereichen Theater, Performance, Musik, Bildende Kunst und Literatur ein fester Bestandteil des Gesamtprojekts.” Dazu gehört auch noch “das größte U-Boot-Museum der Welt”. Ende des Jahres 2009 wurde außerdem vom Land beschlossen, das “Museum Peenemünde” neu zu gestalten, der Nordkurier schrieb dazu:
„Peenemünde, Wiege der Raumfahrt und zugleich ehemaliges Waffenforschungszentrum der Nazis, soll zu einem Ort von internationaler Bedeutung ausgebaut werden. Dafür wird das Land Mehrheitsgesellschafter in einer noch zu gründenden ‚Historisch-Technisches Museum Peenemünde GmbH‘. Der Schritt wurde notwendig, ‚weil das bisher in kommunaler Trägerschaft stehende Historisch-Technische Informationszentrum in seinem Bestand nicht langfristig gesichert war”, sagte gestern Bildungsminister Henry Tesch. Das Kabinett hatte zuvor der Übernahme durch das Land und inhaltlichen Leitlinien einer interministeriellen Arbeitsgruppe unter Federführung des Bildungsministeriums zugestimmt.
Das seit 1991 in Peenemünde bestehende Informationszentrum hatte sich in den vergangenen Jahren mit jährlich 200000 Besuchern hinter dem Stralsunder Ozeaneum zum zweitgrößten Museum des Landes entwickelt. Die Kommune war allerdings mit den anstehenden Investitionen überfordert.
Einer der ersten Schritte nach der Übernahme durch das Land wird die Überwindung des Sanierungsstaus sein. Um die Denkmalwürdigkeit der Anlage zu erhalten, stehen der Gemeinde Peenemünde bis 2011 knapp vier Millionen Euro aus dem Konjunkturpaket II zur Verfügung. Das ehemalige Kraftwerk soll nach Abschluss der Arbeiten vollständig begehbar sein. Von der obersten Etage aus wird dann ein Blick über die gesamte ehemalige Versuchsanstalt möglich sein. Auch Objekte außerhalb des Museums wie der Prüfstand 7, von dem aus die erste Rakete ins All gestartet wurde, sollen für Besucher künftig zugänglich sein. Dagegen wird die bislang noch auf dem Museumsgelände ausgestellte Militärtechnik der NVA an anderen Stellen aufgestellt.
Bereits veranlasst wurde die Überarbeitung der Dauerausstellung. ‚Das Museum versteht sich als ein internationales Forum zur Diskussion über die Verantwortung im Umgang mit Vergangenheit und Technik‘, heißt es in den Leitlinien. Mit Michael Gericke wurde inzwischen ein Geschäftsführer für die künftige GmbH bestellt. Neben dem Leiter sollen noch mindestens zwei Wissenschaftlerstellen auf Dauer eingerichtet werden.“
Jesco von Puttkamer wurde 1996 die Würde eines Doktors der Philosophie ehrenhalber von der Universität Saarbrücken verliehen. Von 1983 bis 2000 war er als Honorarprofessor an der TH Aachen tätig (noch in der letzten Novemberwoche 2012 hielt er dort laut Wikipedia als Honorarprofessor Vorträge vor Studenten). 2009 veröffentlichte er das Buch „Abenteuer Apollo 11: Von der Mondlandung zur Erkundung des Mars“ und in seinem letzten Lebensjahr wie erwähnt sein Vermächtnis: „Projekt Mars“.
Von diesem Planeten aus war 2008 von der Marskamera einer Raumsonde ein Datenstrom zur Erde gelangt, dessen Auswertung „Sensationelles“ zutage brachte: „Nicht der Mensch ist das erste Lebewesen auf dem Mars, sondern eingefrorene Bakterien“: Diese sind nämlich mit Raumsonde „Phoenix“ auf den roten Planeten gelangt, sagen manche Forscher. Sollte sich der Rote Planet erwärmen, könnte dort Leben erwachen. Dies würde den Weg für den Menschen ebnen, hieß es in der „Welt“:
„Phantasien wie die etwa des Jesco von Puttkamer werden mit den Erkenntnissen von Phoenix ein kleines bisschen realistischer. Müssten doch die von ihm angedachten Siedlungen auf dem Mars ‚die Nabelschnur kostspieliger Nachschubtransporte von der Erde auf ein Minimum reduzieren‘, meint der Marsexperte und Chefvisionär der Nasa; es gelte, die ‚Verwendung lokal gewinnbarer Rohstoffe und ein Treibhaus für die Eigenerzeugung agrarischer Produkte zum Grundstein ständiger Besiedlung zu machen‘.
Von Puttkamer der Anfang der 60er Jahre zum Team Wernher von Brauns stieß und mit ihm die Saturn-Rakete für die Apollo-Missionen zum Mond baute, will nun weiter hinaus. Für ihn ist es ein kultureller Prozess, zum Mars aufzubrechen, der zum genetischen Programm des Menschen gehöre, ähnlich wie die Reise des Kolumbus. Er denkt deshalb an Projekte in noch fernerer Zukunft als jene in 25 Jahren mit den ersten ‚Mars-Menschen‘, er sieht den Mars als ‚Heimstätte für einen echten Ableger der irdischen Zivilisation, nicht lediglich einen Außenposten für wissenschaftliche Forschung und Bergbau wie den Mond‘. Natürlich werde die ‚zunehmende Abnabelung von der Erde‘, die er mit der kolonialen und nachkolonialen Geschichte Amerikas vergleicht, ‚viele Generationen dauern‘. Währenddessen aber könnte reger Außenhandel laufen: ‚Mars müsste spezialisierte High-Tech-Produkte, Luxuswaren und nicht örtlich vorkommende Rohstoffe importieren, und sein Export bestünde aus eigenen Gütern oder auch aus den in jeder Pioniergesellschaft frischer sprießender Ideen, Erfindungen und Neuerungen, wie es das Amerika des 19. Jahrhunderts gegenüber der ‚Alten Welt‘ demonstriert hat.‘
Für solch ferne Zukunftsmusik sind gute Nachrichten vom Mars deshalb besonders bedeutsam, weil er auf absehbare Zeithorizonte der einzige Planet ist, der solche Gedankenspiele erlaubt. Ansonsten bietet unser Sonnensystem außer dem sonnennahen und schwer zu erreichenden Merkur sowie der glühend heißen, giftigen, unwirtlichen Venus nur Welten aus Gas. Planeten anderer Sonnensysteme wären mit heute denkbarer Technik nur in Jahrtausende langen Reisen erreichbar. Der Mars dagegen wäre schon in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts von Menschen betretbar gewesen, mit Fortentwicklungen der Apollo-Technik aus der Mondfahrt. Davon sind die Nasa-Experten heute überzeugt.

Andere sind längst da. Christopher McKay, Planetenexperte des Ames-Forschungszentrums der Nasa in Kalifornien, schätzt, dass sich trotz aller Maßnahmen zur Sterilisierung der Mars-Sonden inzwischen etwa 300000 Bakterien oder andere Mikroorganismen von der Erde auf dem Nachbarplaneten aufhalten. Dass sie leben, wäre etwas übertrieben: ‚Sie schlafen, sind in Wartestellung, aufgrund der Temperaturen quasi eingefroren.‘ Sollte der Mars sich erwärmen, oder von Menschenhand gezielt aufgeheizt werden, könnten sie zum Leben erweckt werden. Vorausgesetzt, sie sind nicht unmittelbar dem ungefilterten Sonnenlicht ausgesetzt, das sie auf dem Mars sofort töten würde. Auch wenn sie sich in Nischen niedergegangener Mars-Sonden befänden, würde die kosmische Strahlung, die Metall durchdringen kann, ihnen über kurz oder lang den Garaus machen. Schutz bietet nur der Untergrund.
Tödliche Strahlung, auch die fehlende Luft zum Atmen – es würde noch viele Jahrhunderte wenn nicht Jahrtausende dauern, bis ein Mensch ohne Schutz im Freien auf der Marsoberfläche herumspazieren könnte. Vorher müsste er das ‚Terraforming‘ einleiten, ein Begriff, der es aus der Sciencefiction-Literatur immerhin in konkrete Planspiele von Nasa-Visionären wie Puttkamer, McKay oder dem Mars-Experten der Nasa, James L. Green, geschafft hat. Gemeint ist, den Mars erdähnlich zu gestalten.
Zunächst müsste dafür der Mars aufgeheizt werden, etwa durch einen künstlichen Treibhauseffekt zum Beispiel mittels Kohlendioxid, das auf dem Mars in großem Maße vorhanden ist. Mit großflächig ausgebrachtem Ruß könnte mehr Sonnenwärme absorbiert und das Eis an den Polen zum Schmelzen gebracht werden. Dies könnte ’schnell‘, in wenigen hundert Jahren vonstatten gehen. Doch bis die dann ausgesäten, spärlich sprießenden Pflanzen den für den Menschen nötigen Sauerstoff in ausreichenden Mengen produzieren, könnten mehrere zehn- wenn nicht hunderttausend Jahre vergehen. Bis dahin müsste der Mensch für seine lebensnotwendigen Dinge wie Wasser und Luft ein möglichst perfektes Kreislaufsystem entwickeln, wie es ansatzweise heute auf der Raumstation ISS geschieht.
Über eines allerdings sind sich die Strategen bei der Nasa – bislang – im Klaren: bevor der Mars zur Erde gemacht wird, muss Gewissheit herrschen, dass es kein marseigenes Leben gibt, und seien es auch nur Mikrolebewesen. Sie dürften durch das Terraforming nicht in Gefahr geraten. Dies immerhin hat der Mensch, bei allen Parallelen zwischen Amerika und dem Mars, seit der Fahrt des Kolumbus mit ihren schlimmen Konsequenzen für die Indianer gelernt: Leben in Neuen Welten muss geschützt werden.“
Wie man die auf den Mars geschleppten Bakterien los wird, damit es wieder ein leerer Siedlungsraum wird, ist noch unklar. Aber man bemüht sich, weitere Kontaminationen mit Leben von der Erde erst einmal zu vermeiden. Als 2011 der Mars-Rover „Curiosity“ auf den Roten Planeten geschossen wurde, versuchten die Nasa-Forscher alles zu vermeiden, dass sein Bohrer dort in Kontakt mit Wasser kommt, weil die von ihm mitgeschleppten Mikroben dort überleben könnten. „Das will die US-Raumfahrtbehörde unbedingt vermeiden,“ schrieb die Süddeutsche Zeitung. „Würde der Späher in eine Eisschicht bohren oder sonst einen Kontakt mit Wasser herstellen, könnten die Mikroorganismen darin überleben. Später wäre es umso schwieriger zu entscheiden, ob es ursprüngliches Leben auf dem Mars gibt oder ob es von der Erde eingeschleppt wurde.
‚Wenn das Curiosity-Team Eis findet, müssen wir erst einmal reden‘, hat die Nasa-Beauftragte für den Schutz fremder Planeten, Catherine Conley, verfügt. Andere NASA-Mitarbeiter sprachen von einem kalkulierten Risiko. ‚Das wird aber nicht das grundsätzliche Problem sein, das die Mission zum Scheitern bringt‘, erwartet Ralf Jaumann vom Institut für Planetenforschung des Deutschen Zentrums für Luft und Raumfahrt in Berlin-Adlershof. Die Bohrerspitze sei in einem Reinraum montiert worden; die Nasa könne die Abläufe noch einmal nachstellen, um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie viele Mikroben auf dem Bohrer sind. ‚Und wenn sie auf dem Mars etwas finden sollten, müssen sie die Untersuchung eben noch einmal mit anderen Werkzeugen von Curiosity wiederholen, um ganz sicher zu sein‘.“
Aber dann fanden die Weltraumforscher 2012 Bakterien, die ursprünglich vom Mars stammen könnten – auf der Erde.
Die FAZ schrieb: „ALH84001 heißt der Meteorit, der Forscher vermuten lässt, auf dem Mars hätten Bakterien gelebt. 1984 in der Antarktis gefunden, enthält der Gesteinsbrocken Ketten des Eisenoxyds Magnetit. Kristalle des Eisenoxyds Magnetit liegen in dem Himmelsgestein vor „wie Perlen auf einer Kette“, sagt Imre Friedmann, Forscher am Ames Research Center der Nasa in Silicon Valley und schließt daraus: „Diese Ketten sind organischen Ursprungs.“
Magnetit ist magnetisch. Das heißt, normalerweise würden die Kristalle sich durch die magnetischen Kräfte gegenseitig anziehen und einen Klumpen bilden. Die Kettenform deutet nach Angaben der Wissenschaftler darauf hin, dass die Kristalle in Organismen angeordnet waren, die mittlerweile verschwunden sind.
Kathie Thomas-Keprta vom Johnson Space Center der Nasa hat festgestellt, dass die Magnetit-Kristalle aus ALH84001 denen ähneln, die irdische Bakterien heute bilden. Das trifft laut einer Veröffentlichung zumindest auf einzelne Kristalle zu, die Ketten wurden bisher nicht untersucht. Den Bakterien könnten die magnetischen Kristalle als ‚Kompasse‘ gedient haben. Mit Hilfe der Veränderungen im magnetischen Feld in ihren Körpern konnten sie navigieren.
Der Meteorit ALH84001 wurde wahrscheinlich von einem Asteroideneinschlag aus der Marsoberfläche geschlagen. Dabei strömten vor 3,9 Milliarden Jahren die Bakterien samt Magnetit in das Gestein. Die Tatsache, dass ein relativ kleiner Meteorit, etwa 1,8 Kilogramm schwer, eine große Menge an Magnetit und damit früher an Bakterien enthält, deutet Friedmann zufolge darauf hin, dass auf dem Mars einst große Mengen an Organismen gelebt haben müssen. Zudem scheinen die Bakterien, so sie ihren irdischen Vettern ähnelten, Sauerstoff gebraucht zu haben. Das deutet nach Ansicht der Wissenschaftler darauf hin, dass damals auf dem Mars Photosynthese stattgefunden haben muss. Die Photosynthese beschreibt den Prozess, durch den chlorophyllhaltige Pflanzen mit Hilfe von Sonnenenergie aus Kohlendioxyd und Wasser organische Substanzen bilden. Als Abfallprodukt geben sie Sauerstoff ab.“
Die Thesen von den Bakterien auf dem Mars-Meteoriten werden bis heute kontrovers diskutiert. Es wurden inzwischen auch in zwei anderen Marsmeteoriten, Shergotty und Nakhla, mögliche Relikte von früherem Leben gefunden. „Unter anderem auf diesen Strukturen baut die Theorie der Panspermie auf, nach der das Leben auf der Erde durch Keime aus dem All entstanden ist,“ heißt es dazu auf Wikipedia.
Der Spiegel schrieb: „Die Arbeit eines internationalen Forscherteams um Peter Buseck von der Arizona State University droht nun auch noch diese letzte Verteidigungslinie zu Fall zu bringen. Wie die Wissenschaftler jetzt in den ‚Proceedings of the National Academy of Sciences‘ berichten, sind die vom Meteoriten gelieferten Hinweise möglicherweise ’nicht ausreichend, um die Theorie früheren Lebens auf dem Mars zu unterstützen‘.“
2011 fiel in Marokko ein Marsmeteorit – „Tissint“ – auf die Erde. „Sterngucker.de“ schrieb: „Im September 2012 sorgte eine Publikation über ‚Tissint 2011‘ für starkes Medieninteresse. Prof. Chandra Wickramasinghe gab bekannt, dass er in dem Marsmeteoriten viel Kohlen- und Wasserstoff gefunden habe, deren Produktion im Sonnensystem ausschließlich durch lebendige Organismen erfolgt. Spannend machte seine Publikation, dass auch in früher untersuchten Meteoriten vom Mars fossile Bakterienspuren gefunden worden waren. Weil frühere Funde jedoch vorher sehr lange auf der Erde lagen, wurde in Betracht gezogen, dass die Spuren nicht vom Mutterkörper stammten, sondern erst hier auf den Stein gelangt waren. Die neuesten Entdeckungen in ‚Tissint 2011‘ beweisen möglicherweise, dass der Mutterkörper Mars eine beginnende Evolution besaß. Mutmaßlich könnte der Planet vor mehreren Millionen Jahren Opfer einer gewaltigen Kollision mit einem Asteroiden des Sonnensystems geworden sein, die tief aus seiner Kruste Meteoriten und beginnendes Leben herausschlug.“
Die Wissenschaftler konnten ausrechnen, dass der Meteorit 700.000 Jahre lang durch das All gekreuzt war, bevor er seinen Weg zur Erde fand. Das Besondere: Tissint ist noch frisch und weitgehend unverändert – im Gegensatz zu vielen anderen Meteoriten, die erst spät nach ihrem Einschlag gefunden werden. Dadurch bietet er den Wissenschaftlern ideale Forschungsbedingungen.
Auf „scienceblogs.de“ wurde diese These von Chandra Wickramasinghe kritisiert:
„Es sieht immer mehr so aus, als hätte es früher am Mars tatsächlich Leben gegeben. Das ist die zweite Geschichte über außerirdisches Leben und sie ist vielleicht nicht so spektakulär wie die von Wickramasinghe – dafür aber auch nicht so unseriös! Es geht um eine Entdeckung des Mars-Rovers Curiosity. Der führt derzeit diverse Untersuchungen am Mars aus, unter anderem um herauszufinden, ob es dort früher Leben gab, oder nicht. Es ist gut möglich, dass der Mars früher zumindest primitives Leben beherbergt hat. Wir wissen mittlerweile, dass es dort früher große Mengen an flüssigem Wasser gegeben hat. Und wo Wasser ist, ist Leben nicht weit. Dank der neuen Daten von Curiosity wissen wir nun auch, dass das Wasser genau die richtige Umgebung geschaffen hat, in der sich Leben entwickeln kann!“
Dazu zeigte „scienceblogs.de“ zwei Photos von Steinen: Der linke Stein wurde vom Rover Opportunity fotografiert. [Eine im Juli 2003 gestartete US-amerikanische Raumsonde zur geologischen Erforschung des Mars. Sie landete am 25. Januar 2004 erfolgreich in einem kleinen „Eagle“-Krater – in der Tiefebene Meridiani Planum. Die Schwestersonde Spirit landete am 4. Januar 2004 im „Gusev“-Krater.] Die Untersuchungen des von Rover Opportunity photographierten Steins aus dem Endurance-Krater haben gezeigt, dass es sich um schwefelhaltigen Sandstein handelt. Die Form und die Struktur des Steins zeigen, dass er sich in der Anwesenheit von Wasser gebildet hat. Wasser, das allerdings nicht unbedingt lebensfreundlich war. Es war viel zu säurehaltig und zu salzig und auch die Verteilung der Chemikalien war nicht so, um die richtigen Bedingungen für Mikroorganismen zu schaffen.
Der rechte Stein befindet sich im Gale-Krater und wurde von Curiosity untersucht. Auch dieser Stein hat sich in der Anwesenheit von Wasser gebildet. Die geologischen und chemischen Untersuchungen, die Curiosity durchgeführt hat, ergeben aber ein ganz anderes Bild als beim Endurance-Krater. Curiosity hat den Stein angebohrt und das Material in einem internen Labor analysiert. Dabei wurden Schwefel, Stickstoff, Phosphor, Wasserstoff, Sauerstoff und Kohlenstoff gefunden – alles Elemente, die für die Existenz des Lebens nötig sind. Man fand dort auch Gips, ein Anzeichen dafür, dass das Wasser damals ph-neutral und nicht zu säurehaltig war. Außerdem entdeckte Curiosity verschieden stark oxidierte bzw. nicht oxidierte chemische Stoffe und genau diese chemische Vielfalt können Mikroorganismen ausnutzen, um Energie zu gewinnen.
Es ist also alles da, was man bräuchte, damit Leben existieren kann. Es gab Wasser und das Wasser war nicht zu sauer, nicht zu salzig und enthielt genau die richtige chemische Mischung die auch das Leben braucht. Und wenn wir von der Erde eines wissen, dann: Dort wo Leben existieren kann, dort existiert es auch! Es ist verlockend, das auch auf den Mars zu übertragen. Wenn dort früher die Bedingungen optimal für die Existenz von Leben waren, dann hat das Leben dort auch existiert! Aber leider ist es noch zu früh für solche Aussagen. Die Daten von Curiosity müssen noch geprüft werden. Die Experimente müssen noch wiederholt werden. Und dann muss man immer noch ganz konkrete Spuren des Lebens finden. Das wird noch einige Zeit dauern – aber wenn es auf dem Mars irgendwann mal Leben gab, dann wird es sich nicht mehr lange vor uns verstecken können!“
Das Wissenschaftsmagazin „scienexx“ hatte 2012 eine alternative Erklärung vorgestellt – für das auf dem Mars gefundene Methan , das danach kein Produkt von Bakterien ist:
„Sehr wahrscheinlich ist das Methan in der Atmosphäre des Mars doch kein Anzeichen für Leben auf dem Roten Planeten. Denn das kohlenstoffhaltige Gas entsteht vermutlich nicht biologisch, sondern rein geochemisch – wenn UV-Strahlung die Reste zahlreicher Mikrometeoriten auf der Marsoberfläche zersetzt. Das zeigt ein Experiment von Forschern des Max-Planck-Instituts für Chemie in Mainz und der Universitäten in Utrecht und Edinburgh. Sie bestrahlten die Bruchstücke eines auf die Erde gestürzten Meteoriten unter Mars-ähnlichen Bedingungen mit ultraviolettem Licht. Dabei wurden sehr schnell größere Mengen an Methan frei, die hochgerechnet die in der Atmosphäre des Planeten gemessenen Methanwerte erklären könnten, wie die Forscher im Fachmagazin ‚Nature‘ berichten.“
Um herauszufinden, wie Bakterien eventuell auf dem lebensfeindlichen Mars dennoch existieren könnten, beschäftigten sich einige Forscher mit den Bakterien in sibirischen Permafrostböden. Sie könnten möglicherweise bei der Suche nach außerirdischem Leben hilfreich sein, schrieb das Team um Wayne Nicholson von der Universität von Florida in den „Proceedings“ der US-Akademie der Wissenschaften („PNAS“).
Der Nachrichtensender N-tv berichtete: „Nicholson und seine Kollegen wollten Mikroorganismen aufspüren, die unter extremen Konditionen wachsen können – auch mit Blick auf mögliches extraterrestrisches Leben, etwa auf dem Mars. Der Rote Planet gilt Astrobiologen als vielversprechendes Erkundungsziel. Zum einen, weil er der Erde relativ nah und ähnlich ist. Zum anderen, weil es zunehmend Belege für die Existenz von flüssigem Wasser auf ihm gibt. Flüssiges Wasser gilt als eine Grundvoraussetzung für Leben, wie wir es kennen. Nichtsdestotrotz stellt der Mars mögliches Leben auch vor beachtliche Herausforderungen. So herrschen auf ihm extrem niedrige Temperaturen, geringer Druck, ein Mangel an organischen Nährstoffen sowie ein hohes Maß an kosmischer und Sonnenstrahlung. Seine Atmosphäre besteht zudem zum Großteil aus Kohlendioxid (CO).
Auf der Suche nach Lebensformen der Erde, die eventuell auch auf dem Mars existieren könnten, hatten die Forscher einen wichtigen Anhaltspunkt: Wasser befindet sich auf dem Roten Planeten in gefrorenem Zustand im Boden. Die Permafrostböden der Erde gelten aus diesem Grund als terrestrisches Gegenstück der Marsumgebung. Die Wissenschaftler untersuchten daher Proben dieses Bodentyps aus dem Nordosten Sibiriens.
Nachdem sie im Boden enthaltene Bakterien 28 Tage lang auf einem Nährboden bei normalem Druck und Temperatur wachsen ließen, brachten die Forscher die Kolonien auf neue Nährplatten. Dort wurden sie bei null Grad Celsius und unter verschiedenen Druck- und atmosphärischen Bedingungen 30 Tage lang isoliert.
Sechs Bakterienkolonien waren demnach in der Lage, bei null Grad, geringem Druck und einer CO2-reichen Atmosphäre zu gedeihen. DNA-Analysen zeigten, dass die zähen Organismen allesamt zur Gattung Carnobacterium gehören, einer Gruppe der Milchsäurebakterien.
Permafrost scheine ein vielversprechender Ort für die Suche nach Mikroorganismen zu sein, die unter ähnlichen Druck-, Temperatur- und atmosphärischen Verhältnissen wachsen können wie auf dem Mars, heißt es in den ‚Proceedings‘.“

Wegen dieses ganzen Hin und Hers über Leben auf dem Mars, das mit den zur Erde gesendeten Daten von Curiosity und ihrer Auswertung durch NASA-Forscher 2012 neuen Auftrieb bekommen hatte, interviewte der österreichische „kurier“ Ende 2012 den Astronom Thomas Posch und den Wiener Meteoriten-Experten Christian Köberl – nachdem die Nasa-Wissenschaftler auf einer internationalen Pressekonferenz zurückgerudert waren: Statt Spuren von Lebewesen auf dem Roten Planeten gaben sie lediglich bekannt, der Mars-Roboter Curiosity habe „Hinweise auf organische Substanzen“ entdeckt. „Was wurde tatsächlich entdeckt?“ fragte der „kurier“ die beiden Himmelsforscher:
„Sam, das Messgerät an Bord des Mars-Rovers, hat die Signale von organischen Verbindungen, genauer: Kohlenstoff in Verbindung mit Chlor und Wasserstoff, in Gesteinsproben nachgewiesen. Die Stelle, deren Namen man sich möglicherweise wird merken müssen, heißt „Rocknest“. Ein organisches Molekül, etwa Alkohol oder Formaldehyd, kann ein Hinweis auf ehemaliges mikrobielles Leben auf dem Mars sein, muss aber nicht. Im Weltall bilden sich Kohlenstoffketten häufig durch Strahlensynthese, etwa im Orion-Nebel. Unter den mehr als 100 Molekülen, die man bisher im Weltall gefunden hat, sind viele Kohlenstoffverbindungen. Auch der Eintrag von organischem Material auf die Mars-Oberfläche durch Meteoriten ist denkbar. Zum Vergleich: Auf die Erde gehen laut Posch pro Tag 100 bis 1000 Tonnen kosmischer Materie nieder, auch jene Meteoriten, von denen seit den 1960er-Jahren bekannt ist, dass sie auch organische Moleküle enthalten. Wenn das auch bei der Marsprobe der Fall ist, hätte man nichts anderes gefunden, als das, das es eh überall gibt – und die Enttäuschung der Reporter wäre verständlich.
Gibt es überhaupt Anhaltspunkte für Leben auf dem Mars?
Die gibt es immer wieder, obwohl der direkte Nachweis bis heute fehlt – das Video eines Mars-Bakteriums etwa. 1996 war die Aufregung groß, als Forscher meinten, in einem Marsmeteoriten namens Alan Hills 84001 wurden Fossilien von Nanobakterien gefunden. „Das war auch keine dumme Idee damals“, sagt der Direktor des Naturhistorischen Museums, Christian Köberl, aber weitere Forschungen hätten gezeigt, „dass diese Strukturen auch anorganisch gebildet werden können.“ Also wieder kein klarer Hinweis. Das stärkste Indiz für Leben auf dem Mars ist nach wie vor ein positiv verlaufenes Experiment der Viking-Mission aus dem Jahr 1976. In einer Bodenprobe wurde biologische Aktivität, atmende Organismen gemessen. Das Ergebnis wurde aber zunächst verworfen, weil zwei weitere negativ verliefen, und einfache Ergebnisse in der Wissenschaft nicht zählen. Neuere Befunde zeigen aber Ähnlichkeiten zu Daten über terrestrische Lebewesen: „Dieses alte Ergebnis ist daher nicht so einfach wegzudiskutieren, wie es zunächst schien.“
Wie geht es mit Curiosity weiter?
Der Mars-Rover soll noch vor Weihnachten mit seinem Bohrer den Marsboden untersuchen. Für Anfang 2013 ist die Fahrt zum eigentlichen Ziel, einen Berg namens „Mount Sharp“, geplant. Die Frage nach der Existenz von Leben auf dem Mars bleibt bis auf Weiteres unbeantwortet. In der Mars-Wissenschaft gilt aber ohnehin der Satz: „Absence of evidence is not evidence of absence.“ Soll heißen: Dass etwas noch nicht gefunden wurde, bedeutet nicht, dass es nicht da ist.“
Zurück zu Jesco von Puttkamers „Vision“ einer Koloniegründung auf dem Mars: Sie ist erst einmal zurückgestellt – so lange bis die Existenz von Leben in seinen Anfängen, in Form von Bakterien, geklärt ist. Danach, d.h. wenn es sie dort gab oder gar noch gibt, dann wird man die Frage zu klären haben, ob man dort mit ihnen leben kann. Mit den irdischen Milchsäurebakterien der Gattung Carnobacterium haben wir bereits eine lange Zeit des Zusammenlebens hinter uns – sie sind für uns „nützlich“ bei der Herstellung verschiedener Lebensmittel.
Hinieden auf Erden wurde derweil – seit 1991 bereits – eine Art Marskolonieleben – simuliert: mit dem Projekt „Biosphäre 2“: Ein 1991 für 200 Millionen Dollar erbauter Gebäudekomplex in Arizona, mit dem Ziel, ein von der Außenwelt unabhängiges, in der ursprünglichen Planung sich selbst erhaltendes Ökosystem zu schaffen. Das Experiment sollte beweisen, dass in einem eigenständigen, geschlossenen ökologischen System Leben langfristig möglich ist. Es gilt jedoch nach zwei erfolglosen Versuchen erst einmal als gescheitert. Wikipedia schreibt: „Der technische Aufwand (Pumpen, Filtersysteme, Ventilatoren) dabei war erheblich, da ein komplettes und autarkes Lebenserhaltungssystem geschaffen werden sollte. Die diesbezügliche Verwirklichung von Langzeitreisen im Weltraum oder Weltraumkolonien war als Fernziel ebenfalls Gegenstand des Experiments. In den verschiedenen Biotopen Lebensräume, in denen Lebewesen leben können) wurden außerdem ca. 3800 verschiedene Tier- und Pflanzenarten angesiedelt.
Acht Teilnehmer lebten bis 26. September 1993, genau 2 Jahre und 20 Minuten in dem Glasgebäude mit dem Ziel, vollständig von allen Außenkontakten (Luft- und Materialaustausch) abgeschlossen zu sein, außer vom natürlichen Sonnenlicht und zugeführter elektrischer Energie.
Im Laufe der Zeit ergaben sich Zustände, die das Leben der Bewohner sowie der anderen Lebewesen zunehmend beeinträchtigten. Beispielsweise ergaben sich aus ökologischer Sicht folgende Probleme:
- Der in der Konstruktion verbaute Stahlbeton absorbierte schleichend (über den Umweg CO2 im Pflanzenkreislauf) Sauerstoff. Auch diffundiert Sauerstoff wesentlich schneller aus einer Glaskuppel als Kohlenstoffdioxid, da es ein wesentlich kleineres und leichteres Molekül ist.
- Parasitäre Mikroorganismen im Ackerboden erhöhten die Anteile von Stickstoff bzw. Kohlendioxid in der Atmosphäre.
- Kakerlaken und eine spezielle Ameisenart (Gelbe Spinnerameisen) breiteten sich extrem aus.
Eine zweite Gruppe hielt sich 1994 über sechs Monate lang in der künstlichen Biosphäre auf. Während dieser Zeit wurden mit wenigen Ausnahmen die Luft, das Wasser und die Nahrung für die in ihr befindlichen Menschen von den Ökosystemen erzeugt und wieder aufbereitet. Die Einrichtung befand sich ab 2002 wieder im Besitz des Erbauers, des Öl-Milliardärs Edward Bass. Die Universität von Arizona wünschte, sie von ihm zu pachten und zur Erforschung der Globalen Erwärmung zu nutzen, woraufhin sie der Uni kostenlos zur Verfügung gestellt wurde. Seit 2012 offeriert die Uni Besichtigungstouren zu Biosphäre 2.
Dabei wird den Besuchern der derzeitige Forschungszweck erklärt: „To create a brighter, greener future, researchers at Biosphere 2 recognize that they have to find a way to make their technology widely accessible. We think [the research] will be a compelling way to make progress in making cities more intelligent, more sustainable, improve services and quality of life for the citizens and hopefully renew the environment a little bit. What drives the economy is innovation, not austerity.”
Vorletzte Meldung: Curiosity macht erst mal Pause: „Bis zum 1. Mai will die NASA darauf verzichten, Steuerungsbefehle an den Rover zu senden, da sich der Mars in dieser Zeit von der Erde aus gesehen hinter der Sonne befindet. Damit soll vermieden werden, dass Interferenzen die Übertragungen korrumpieren… Die von Curiosity gesammelten Daten werden über die Raumsonde ‚Mars Odyssey‘ zur Erde gesendet. Der Rover steht jetzt am Rand einer Eisformation des Gale-Kraters.“

Letzte Meldung: Der Rover sei erneut in den Ruhemodus geschaltet worden, teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa am Montag mit. Ursache sei ein neuer Softwarefehler. „Curiosity“ sei aber „stabil, gesund und in ständiger Kommunikation mit den Wissenschaftlern“, hieß es. Voraussichtlich in ein paar Tagen könne der Rover seine Forschungsarbeit auf dem Roten Planeten wieder aufnehmen.
Der Marsrover Opportunity legte seit seiner Landung im Januar 2004 inzwischen 35,65 Kilometer auf dem roten Planeten zurück. Spirit brachte es auf 7,7 Kilometer. Bei Curiosity wurde der Schwerpunkt in den ersten Monaten der Mission nicht so sehr aufs Fahren gelegt, sondern auf das Ausprobieren der zahlreichen Instrumente. Der Rover hat daher bislang nur rund 700 Meter zurückgelegt. Das sollte sich aber bald ändern, wenn er mit der Fahrt zum Zentralberg des Gale-Kraters beginnt.
Allerletzte Meldung: Arte zeigte passend zu dieser ganzen Real-und-Fiktiv-Bakteriengeschichte am 21.April einen Mars-Film, in dem die Marsianer drauf und dran sind, die Erde zu kolonisieren (alle Waffen inklusive Atombombe sind wirkungslos gegen ihre elektromagnetischen Schutzschilder), was sie jedoch schließlich besiegt sind unsere Bakterien: Sie haben dagegen – wie viele südamerikanische Indianerstämme auch – kein brauchbares Immunsystem entwickelt. Der selbe Plot findet sich auch in einem anderen, später gedrehten Hollywood-Film über eine „Mars-Invasion“: der Blockbuster „Krieg der Welten“ . Arte hat gleich eine ganze Reihe Mars-Filme aus Anlaß des Nachrichtenstops von „Curiosity“ kurz vor dem Eissee ins Programm genommen. Auch und natürlich vorwiegend solche, in denen umgekehrt „wir“ den Mars kolonisieren, indem wir erst mal die Marsianer liquidieren. Und zwar erfolgreich. “ Gibt es sie vielleicht doch, die Marsmännchen? Schon jahrzehntelang beflügelt die Vorstellung, dass es Leben auf einem anderen Planeten gibt, die Fantasie der Menschen,“ heißt es dazu im Arte-Programmheft.
Am 3.6.2013 folgte noch eine Bild-Zeitungs-Geschichte:
„Hilfe, mein Mann will zum Mars! Wenn sie sich streiten, sagt sie schon mal: „Ich schieße dich zum Mond.“ Doch dass ihr Ehemann nun wirklich FÜR IMMER auf den Mars aussiedeln will, findet Beate Wieden-Günther (44) gar nicht galaktisch.
So weit würde Wieden-Günther jedoch (noch) nicht gehen: „Ich unterstütze meinen Mann natürlich in seinem Traum. Auch wenn es mir sehr schwer fällt.“ Stephan Günther (45) hat sich für die One-Way-Mars-Mission der niederländischen TV-Firma „Mars One“ beworben (88 000 Bewerber). Die Holländer wollen bis 2023 die erste Zivilisation auf dem Mars gründen. Und Günther will einer der ersten Mars-Menschen werden!
Das Projekt, bei dem 2023 die ersten vier Menschen nach rund acht Jahren Astronauten-Training auf den Mars geschossen werden, wird rund sechs Milliarden Dollar kosten. Die Technik für den Hinflug, Sauerstoffaufbereitung oder die Wohn-Space-Kapseln (50 Quadratmeter pro Astronaut) gibt es bereits.“
Und am 13.8.13 die FAZ-Rezension von Dietmar Dath, live aus einer US-Kleinstadt, über eine US-Weltraumkolonie, deren Security schwer damit zu tun hat, Flüchtlingshorden abzuwehren, die die ruinierte Erde mittels hastig zusammengebauter Shuttle verlassen haben, um in das außerirdische Hightechland zu gelangen, das noch „ökologisch intakt“ ist. Da Dietmar Dath sich gerade in den USA aufhält, hat er vielleicht nicht mitbekommen, dass ausgehend von dem seit 2012 von afrikanischen und arabischen Flüchtlingen besetzten Kreuzberger Oranienplatz ständig weitere Flüchtlinge aus bundesdeutschen „Heimen mit Residenzpflicht“ ins Öffentliche ausschwärmen, auf öffentlichen Plätzen campieren, demonstrieren, Tribunale gegen die BRD veranstalten, in Hungerstreik wie in München treten, Unterstützer mobilisieren wie in Hamburg usw.. Diese „Entwicklung“, die mit „Lampedusa“ markiert werden könnte, nimmt quasi die Sichtweise von Dietmar Dath im US-Kino vorweg – als Non-Fiction auf der Erde. Hier seine Rezension, unerlaubt auf der FAZ kopiert:
Die da oben
Das Jahr 2154 hat ein Rad ab. Es umkreist als riesige Raumstation die ökologisch verhunzte und wirtschaftlich ruinierte Erde. Seine Speichen sind aus einer unzerstörbaren Legierung von technologischer Überlegenheit und ökonomischer Macht geschmiedet. Auf dem Innenrand dieses Rades wohnen die Besitzenden, in geschmacklosen, von Lustgartenpetersilie umstandenen Villen, bestückt mit Hightech-Gesundheitskokons, in denen Leukämie oder Knochenbrüche in Minutenschnelle zunichtegemacht werden. Unten, im Dreck, aus dem wir stammen, wird gearbeitet und gehorcht. Die irdische Verwaltung ist eine Art roboterisierte Polizeifabrikwelt – „Would you like to talk to a human?“, fragt der Kontrollautomat, wenn er seine großzügigen fünf Minuten hat.
Oben, im Götterrad, das der hochnäsige Plünderergeschmack seiner Bewohner „Elysium“ getauft hat, regiert ein ethnoprogressiver Alibi-Kosmopolit, den Faran Tahir so spielt, wie linksradikale Zyniker Barack Obama sehen. Die schweren Entscheidungen (Flüchtlingsfähren abschießen, Konzernchefs in Intrigen verstricken) trifft nicht dieser unseriöse Präsident, sondern seine Sicherheits-Chefin Delacourt – eine Rolle, in der Jodie Foster sich von ihrer kältesten Seite zeigen darf: Auf ihrer Zunge, von der das arrogante Umgangsfranzösisch rollt wie ein vergifteter Schachtelsatz aus obszönen Wahlversprechen, schmilzt auch die weichste Schokolade nicht. Hätten die alten Griechen eine Göttin der Notstandsdiktatur gekannt, Phidias hätte sie aus Foster-Marmor meißeln müssen.
Die Gegenfigur zu Delacourt spielt Matt Damon: kahlköpfig, straff, schnoddrig, mit Ecken und Beulen, ein aus Vollkornstahl gestanzter Malocher im Metallstaub der spätmonopolistischen Militärindustrie. Ein Arbeitsunfall setzt ihn letaler radioaktiver Strahlung aus. Er hat noch fünf Tage zu leben, sieht das aber nicht ein, sondern will nach Elysium, wohin ihn die Aussicht auf eine medizinische Behandlung lockt, die nach der berühmten Formel von Arthur C. Clarke so weit fortgeschritten ist, dass sie sich von Magie nicht mehr unterscheiden lässt.
Mit der in die Enge getriebenen wütenden Energie schierer Selbsterhaltung brennt dieser Max sich also eine Schneise durch die Schichten der dystopischen Klassentorte und strebt entschlossen aufwärts, Richtung Rettung. Eine herzensgute Krankenschwester und alleinerziehende Mutter, die er aus seiner in der Obhut katholischer Nonnen verbrachten Kindheit kennt, ihre schwerkranke Tochter, den einen oder anderen Kriminellen mit goldenem Herzen, böse Söldner und viel entrechtetes und verwahrlostes Volk trifft er unterwegs. Die Perspektive, in der das alles vorgeführt wird – komplett mit klagenden Streichertönen zum Kinderblick in lichte Höhen sowie Actionszenen, die jeden Zusammenstoß von Mensch und Material als irren Proletkult-Clash genießen -, wirkt wie die paradoxe Erfindung eines hollywoodgeschulten sowjetischen Propagandafilms für heute oder die James-Cameron-Überarbeitung des „Bitterfelder Wegs“ im Sozialistischen Realismus (bloß der Traktor und ein Landkind, das Ingenieur werden will, fehlen). Denn der aus Südafrika stammende Regisseur Neill Blomkamp macht linke Filme mit beweglichem, hyperdynamisch technophilem Dekor. „District 9“ (2009) handelte von Rassismus und Xenophobie, „Elysium“ greift sich andere Missstände, um sie mit Blockbusterraketen in den Bombast-Orbit zu schießen.
Das ist so griffig (manchmal aber eben auch: so hölzern), wie sich derlei überhaupt machen lässt – und gefällt, das kennt man schon von Brecht, am meisten da, wo es in seiner plakativen, der gemeinten Sache völlig angemessenen Stumpfheit Typengalerien generiert, die schauspielerischen Tugenden und Einfällen genug Luft lassen, sich geltend zu machen.
Sehr schön führen diesen Sachverhalt in „Elysium“ die böse Frau Foster und Sharlto Copley als völlig wahnsinniger Landsknecht Kruger vor. Noch besser als diese beiden schlägt sich der hibbelige Wagner Moura als Spider: ein Hackergangster, der trotz körperlichen Handicaps auch dann noch munter weiterhackt, wenn Blut, Brandbeschleuniger und Maschinenöl ihn allseits umspritzen, weil zwei mit allerlei Cyborg-Ramsch und Abrakadabra-Steroiden zu Übermenschen aufgerüstete Muskelmonster einander an die Synthesizergurgeln gehen.
2013 ist ein wichtiges, teils gutes, teils gruseliges Jahr für jenen Zweig der filmischen Phantastik, der „Science-Fiction“ heißt: Tom Cruise hat seine Klonierbarkeit im tapferen Selbstversuch bewiesen („Oblivion“), Will Smith seinen Ruf mit verblüffend witzlosem Blödsinn beschädigt („After Earth“), das Raumschiff Enterprise und der laufende Superhelden-Jahrgang sind in bester Verfassung, und fürs letzte Jahresdrittel ist die Verfilmung des hochproblematischen Genreklassikers „Ender’s Game“ angekündigt.
Gehört „Elysium“ in diese Reihe? Ist das, was Blomkamp da gedreht hat, überhaupt Science-Fiction? Der bei der Arbeit verstrahlte Held wird auch unter Menschen Mitgefühl wecken, die schon vergessen haben, unter welchen Bedingungen Bodentruppen im Kernkraftwerk von Fukushima ihre Räumarbeiten leisten mussten. Die Erde als Müllkippe wird alle gruseln, die noch nichts davon gehört haben, dass ein Prozent der derzeitigen Weltbevölkerung buchstäblich im und vom Abfall der Reichen lebt. Und dass Migrationsversuche nach Elysium für einige Unglückliche mit dem Tod enden, mag selbst diejenigen entsetzen, an denen die Nachricht von den unlängst im Mittelmeer ertrunkenen mutmaßlichen Syrien-Flüchtlingen vorbeigegangen ist (die Szene, in der Jodie Foster den Tod jener Elenden anordnet, sorgte in dem amerikanischen Kleinstadtkino, in dem der Rezensent den Film gesehen hat, für ein schockiertes Atemholen bei Teenagern, die an den darauffolgenden Materialschlachten ihre helle Freude hatten). „Elysium“ ist Science-Fiction für Leute, die nicht wissen, dass sie in einer Dystopie leben, die man nicht 2154 nennt, sondern 2013.
Das Ende ist positiv, wenn auch mit bitterer Note: Seht die Ungewaschenen rennen, sie sollen gerettet und getröstet werden – ein Bild der ebenso euphorischen wie bedrohlichen Mobilmachung der Armen, das zu den Schlüsseltableaus unserer Krisenkinozeit gehört, von den Zombiehorden in „World War Z“ bis zum Gruppentanz auf dem Damm zwischen Arm und Reich am Ende von „Beasts of the Southern Wild“.
Die Verlorenen wimmeln, trampeln, besetzen Plätze, wehren sich. Wer weiß, vielleicht werden sie diesmal den Ausgang der Gegenwart finden, der Zukunft heißt.
Nachtrag:
Eine Art „Tropical Island“ nur für die Wissenschaft
Der Geophysiker James Lovelock entwickelte als Berater der NASA zusammen mit der Mikrobiologin Lynn Margulis eine Konzeption von der Erde und ihrer Atmosphäre als eines sich selbst regulierenden „Organismus“: die von ihm sogenannte „Gaia-Hypothese“. Für die NASA lieferte er damit einen komplettes Modell dafür, wie eine Weltraumkolonie, auf dem Mars z.B., existieren könnte. In der Folgezeit wurden etliche technische Voraussetzungen dafür entworfen. 1991 entstand mit Hilfe einer 200-Millionenspende eines Milliardärs ein futuristischer Glaskuppelbau in Arizona: „Biosphäre 2“ – um darin ein von der Außenwelt unabhängiges und gemäß der Planung sich selbst erhaltendes „Ökosystem“ zu schaffen, d.h. eine „Umwelt“, in dem Menschen einigermaßen leben können. Dem Projektleiter John Allen, ein „Synergist“ laut „New Scientist, ging es um eine „holistic notion of the biosphere“. Das Magazin „Discover“ meinte, es sei das interessanteste wissenschaftliche Pürojekt seit Präsident Kennedy zur Eroberung des Mondes aufrief. Allens „Biospherians“ schienen ähnlich heldisch zu sein wie die Astronauten. Über sie heißt es auf Wikipedia: „Acht Teilnehmer lebten bis 26. September 1993, genau 2 Jahre und 20 Minuten in dem Gebäudekomplex, vollständig von allen Außenkontakten (Luft- und Materialaustausch) abgeschlossen, außer vom natürlichen Sonnenlicht und zugeführter elektrischer Energie.“ Dazu 3800 Tier- und Pflanzenarten, wie der Spiegel ergänzte, hinzu kam noch die ausgefeilte Technosphäre, bestehend unter anderem aus Computern, Messgeräten, Pumpen, Filteranlagen, einem Gezeitensimulator für den Ozean und einer Sprinkleranlage für den Regenwald. Im Laufe der Zeit wurde das Leben der Bewohner sowie der anderen Lebewesen zunehmend beeinträchtigt, so dass das Experiment schließlich abgebrochen wurde. Beispielsweise ergaben sich aus ökologischer Sicht folgende Probleme:
- Der in der Konstruktion verbaute Stahlbeton absorbierte schleichend (über den Umweg CO2 im Pflanzenkreislauf) Sauerstoff. Auch diffundiert Sauerstoff wesentlich schneller aus einer Glaskuppel als Kohlenstoffdioxid, da es ein wesentlich kleineres und leichteres Molekül ist.
- Parasitäre Mikroben im Ackerboden erhöhten die Anteile von Stickstoff bzw. Kohlendioxid in der Atmosphäre.
- Das Klimaphänomen El Nino führte zeitweise zu geringeren Ernten aus dem Ackerbau.
Der Spiegel berichtete überdies, dass die acht Menschen sich das Leben in Biosphäre 2 zunehmend unerträglicher machten, kein Wunder, denn zu keiner Zeit dachte man bei dem Projekt an die Notwendigkeit von sozialen Erfindungen, für alle Probleme, auf die man kam, wurden bloß technische Lösungen gesucht:
Die „Biosphärianerin“ Jane Poynter, die gleich zu Anfang einen Teil ihres Fingers in einer Erntemaschine einbüßte, sagte den Interviewern: „Immer wieder packte mich die Angst, den Verstand zu verlieren“. Hätte sie nicht ihre große Liebe, der ebenfalls eingeschlossene Bionaut Taber MacCallum, getröstet, so wäre sie vermutlich durchgedreht, sagt sie. Am meisten jedoch litt die Britin unter der zunehmenden Aggression in der autarken Mini-Welt. „Wir wussten, dass kleine, von der Außenwelt isolierte Gruppen, etwa in der Antarktis oder auf Raumschiffen, sich oftmals untereinander zerstreiten. Dass das auch uns passieren würde, haben wir nicht einkalkuliert „, sagt die Britin, die zu Beginn noch gemeint hatte, nach spätestens zwei Jahren würde kein Mensch sie mehr aus Biosphäre 2 rauskriegen... Die Mannschaft zerfiel in zwei tief verfeindete Fraktionen, die kaum noch miteinander sprachen. Als Poynter dem PR-Direktor der „Biosphäre 2“ per Telefon mitteilte, dass die Bionauten die mitgebrachte Notration aufessen würden, um zu überleben, wäre sie um ein Haar aus dem Glashaus geflogen.
Am unerträglichsten wurde die Situation, als die Bionauten – in ihrem selbstgeschaffenen Verlies von Hunger, Sauerstoffknappheit und Dauerzoff (Asozialität?) gepeinigt – auch noch von der realen Welt attackiert wurden. Denn Anfang 1993, als der Sauerstoffgehalt im Riesen-Terrarium sich auf einem gefährlichen Niedrig-Rekord eingependelt hatte, pusteten die Chef-Konstrukteure der „Biosphäre 2“ tonnenweise Frischluft in ihr Treibhaus – nun war die Seriosität des Projekts endgültig dahin.
„Jetzt ist der letzte Rest an Glaubwürdigkeit aufgebraucht. Das Zwei-Jahres-Projekt der Autarkie sieht nicht mehr nach Wissenschaft aus, sondern gleicht mehr und mehr einem 150-Millionen-Dollar-Gag“, ätzte das „Time Magazine“ im Februar 1993. Die Medien titulierten die Biosphäre als „Disneyland“ und „Touristenfalle“, man warf den Bionauten vor, heimlich Lebensmittel und technisches Gerät ins Innere geschmuggelt zu haben. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich die Nasa sowie führende Wissenschaftler längst aus dem Projekt zurückgezogen.
In einem Science-Fiction-Film aus dem Jahr 1971 war all dies bereits vorweggenommen:
„Lautlos im Weltraum“ ist ein öko-dystopischer (anti-utopischer) Science-Fiction-Film des US-amerikanischen Regisseurs Douglas Trumbull,“ schreibt Wikipedia
„Eine Flotte von Raumschiffen treibt seit mehreren Jahren durchs Sonnensystem, mit der Aufgabe, die letzten Pflanzen und Tiere der Erde als eine Art Arche Noah unter riesigen Glaskuppeln zu erhalten, da auf der Erde inzwischen die gesamte Natur zerstört wurde. Die Raumschiffe tragen die Namen Berkshire, Valley Forge, Sequoia und Mojave.
Der Astronaut Freeman Lowell hat sich mit vollem Engagement und Enthusiasmus dieser Aufgabe verschrieben und versucht seit acht Jahren, die Biotope zu erhalten und zu pflegen. Er versieht seinen Dienst auf dem Raumschiff Valley Forge mit drei weiteren Besatzungsmitgliedern, die seinen Idealismus dem Projekt gegenüber nicht teilen. Sie verabscheuen biologisch angebautes Essen und ernähren sich lieber von synthetisch hergestellten Nahrungsmitteln.
Entsprechend unterschiedlich sind auch die Reaktionen, als die Crews der Schiffe den Befehl erhalten, das Projekt aufzugeben. Die Kuppeln sollen abgesprengt und mit den an Bord befindlichen Atombomben vernichtet, die Raumschiffe zurückbeordert und wieder für kommerzielle Zwecke eingesetzt werden.
Während seine Kollegen in Vorfreude auf die Rückkehr zur Erde damit beginnen, die Sprengungen durchzuführen, wächst in Lowell der Widerstand dagegen. Um die Sprengung der letzten Kuppel zu verhindern, tötet er einen seiner Kollegen, um ihn davon abzuhalten, eine Bombe darin zu platzieren. Danach sprengt er die anderen beiden mitsamt einer Kuppel ab, worin kurz darauf ein Nuklearsprengsatz sein Werk verrichtet. Er ignoriert die Befehle der Bodenstation zur Rückkehr und gibt technische Probleme vor. Eines Tages stellt Lowell fest, dass der Wald in der letzten verbliebenen Kuppel stirbt. Er versucht, die Ursache herauszufinden. Als er zu seiner Überraschung von einer Rettungsmission entdeckt wird, erfährt er aus dem Funkgespräch heraus zufällig, warum der Wald stirbt: Er ist mit dem Raumschiff zu weit von der Sonne entfernt. Lowell schickt die nun mit künstlichem Licht ausgestattete Kuppel als abgeschlossenes Biotop wie eine Flaschenpost in den Weltraum. Dann macht er alle an Bord des Basisschiffs vorhandenen Atombomben scharf und vernichtet damit die Valley Forge zusammen mit sich selbst. Nur der Roboter Dewey verbleibt in der kurz zuvor abgestoßenen Kuppel und pflegt dort die überlebenden Pflanzen und Tiere.“ So lebt „Biosphäre 2“ seit 1971 im Film ohne Menschen weiter.
Es wurden aus dem „Biosphäre 2“-Projekt auf der Erde laut Wikipedia einige wichtige Lehren für weitere Experimente in Vorbereitung auf eine „Mars Colony“ gezogen – u.a.:
- Ein Aquarium mit mehr als zwei Metern Durchmesser braucht bis zu sechs Jahre dauernder Behandlung, bis es nicht ständig aus dem ökologischen Gleichgewicht kippt. Damit war die Versuchszeit zu kurz.
- Auch sollen zu viele Pflanzen und Tiere eingeführt worden sein, von jedem Erdteil mehrere. Eine Idee ist es, zunächst mit wenigen, effektiven Pflanzensorten zu beginnen. Dies bedeutet, mit wenigen Arten die Sauerstoffproduktion und Nahrungsmittelerzeugung zu gewährleisten, anstatt eine eher hinderliche und komplizierende Vielfalt zu schaffen. Beispielsweise sind Hummeln „die gutmütigeren Bienen“ und taugen gut zur Bestäubung, ansonsten könnte man auf Insekten zunächst großteils verzichten, da sich diese zu rasch vermehren wie z.B. die Ameisen.
Nach Abbruch des Experiment übernahm im Jahr 1996 die Columbia University die Verwaltung von Biosphäre 2 und nutzte sie für ökologische Forschung und Lehre. Unter Leitung von Barry Osmond wurden Forschungsergebnisse zur Wirkung von Klimagasen veröffentlicht. 2002 prüfte die Columbia-Universität das Projekt erneut und entschied sich, es Ende 2003 aus Kostengründen einzustellen. Die Einrichtung befand sich ab da wieder im Besitz des Erbauers, des Öl-Milliardärs Edward Bass. 2007 kauftendie Immobilienentwickler aus „Oracle“, die CDO Ranching & Development, LP. , „Biosphäre 2“ für 50 Millionen Dollar. Der Landkreis – Pinal County – kündigte zudem an, 1.500 Wohnungen und ein Themenhotel in der Umgebung zu errichten. Und die University of Arizona ließ verlauten , die Anlage zur Erforschung der Globalen Erwärmung mieten zu wollen. 2011 spendete CDO Ranching & Development die Biosphäre 2 der University von Arizona.
Im Juli 2013 berichtete der „New Scientist“ ausführlich mit einer Reportage vor Ort, was sich nun in diesem Gebäudekomplex in der Wüste von Arizona tut:
Der Direktor der Anlage von 2007 bis 2012, Travis Huxman, meint: „Die frühen Probleme, die sie mit der Atmosphäre hatten, haben uns eine Menge über die „Erd-Systeme“ gelehrt, und darüber, wie das Land und die Atmosphäre zusammenwirken.
Jane Poynter, inzwischen mit ihrem Biosphäre 2 – Liebhaber verheiratet, hat in Tucson die Firma „Paragon Space Development“ gegründet, in der „Life-support systems“ und „spacecraft design“ u.a. für die NASA entwickelt werden.
In der Biosphäre 2 Anlage wurde unterdes der Rotstift angesetzt: die Landwirtschaftszone, nunmehr „Landscape Evolution Observatory“ genannt, ist jetzt mit der Außenluft verbunden, die Regenwaldzone ist ebenfalls außenklimaabhängiger und sie Savannenzone wird weniger beregnet. All das hat die Stromrechnung von Biosphäre 2 von bisher 600.000 Dollar jährlich, um 250.000 Dollar reduziert, der meiste Strom wurde zuvor zum Kühlen verwendet.
10 Jahre sind nun für das neue Forschungsprojekt veranschlagt, einer der Leiter, Peter Troch, hofft, dass dann Biosphäre 2 für die Geowissenschaften das geworden ist, was CERN für die Physiker darstellt.




