Regime-Change
Was dem „New Age“ in den Achtzigerjahren der Delphin als Symboltier war, ist nun in den postgesellschaftlichen Projektwelten der Wolf.
Nach 2001 kam es dabei aber zu einem „Wolfs-Turn“: Aus den Bestien wurden Vorbilder. Das verdankte das Raubtier den Frauen: Hatte schon die Ehefrau das Wolfforschers Erik Ziemen das eine oder andere Wölfchen gesäugt, wandten sich nun einige Frauen ganzen Rudeln zu. Erwähnt seien die Pianistin Hélène Grimaud, die Biologin Gesa Kluth und die Zootierpflegerin Tanja Askani: „Alle drei sind Wölfen begegnet und ihnen verfallen,“ schreibt der Hobbyjäger und „Welt-Redakteur Eckhard Fuhr, der 2014 ein Buch über Wölfe veröffentlichte, die er bezogen auf Deutschland als „Heimkehrer“ bezeichnete, die nun „unser Leben verändern“.
Die Rechtsanwältin Elli Radinger z.B. gab ihnen zuliebe ihren Beruf auf und schreibt seitdem Bücher über sie, zudem ist sie Herausgeberin des halbjährlich erscheinenden „Wolf Magazins“. Darin heißt es z.B. „In Deutschland leben wieder Wölfe. Unser Ziel ist es nicht mehr, die Wölfe vor dem Aussterben zu bewahren. Jetzt müssen wir lernen, sie in unser Leben zu integrieren.“ Elli Radingers Magazin ist also eine Integrationsmaßnahme. Im Magazin 1/2010 erzählt z.B. Shreve Stokton eine „Wahre Geschichte über Liebe, Freiheit und Vertrauen: Mein Leben mit einem Präriewolf“. In ihrem Buch „Die Weisheit der Wölfe“ (2017) geht sie u.a. der Frage nach „Was Frauen und Wölfe verbindet“. Darüber denkt auch die Falknerin Tanja Askani nach in ihren Büchern. Sie zog mehrere Wölfe groß und arbeitet mit mehreren Rudeln im Wildpark Lüneburger Heide. Sie fühlt sich den Wölfen verwandt, empfiehlt deren „Team“-Verhalten aber auch Managern, wenn sie erfolgreiche Führungskräfte werden wollen („jeunes loupes“, wie man dieses Pack in Frankreich vorausschauend nennt). Dass die Autorinnen von Wolfs-Büchern gegenüber Männern die Nützlichkeit von Wölfen herausstreichen, ist üblich, aber Tanja Askani hat darüberhinaus „auf der Basis von umfassendem Respekt und profundem Wissen sowie einer absoluten Präsenz und großen Liebe“ zu diesen Tieren vor allem unser Wolfswissen vermehrt, wie die Psychotherapeutin Rosemarie Kirschmann im Vorwort zu Askanis Buch „Wolfsspuren“ (2004) schreibt. Vielleicht kann sie auch das Verhalten jenes armen Irren erklären, der sich im Sommer 2019 eine gefährlich aussehende Wolfsmaske überstülpte und in München ein elfjähriges Mädchen vergewaltigte?
.

.
Als das feministisch begrüßte Wolfsgeheul hierzulande anhob, gingen bei den sogenannten Mannsbildern alle Alarmlichter an. Die Bild-Zeitung titelte sogleich: „Experten fordern – Schießt die deutschen Wölfe ab!“ Dazu zitierte das Drecksblatt den finnischen Wolfsexperten Nyholm: „30 Wölfe auf 600 Quadratkilometer. Das ist Wahnsinn.“ Ferner seinen finnischen Kollegen Hagelstam: „Hier ist bereits Gefahrenstufe 5 von 7 erreicht. In Stadium 7 reißt der Wolf Menschen.“ Sowie den Russen Danilov: „Die einzige Rettung ist der Abschuß“. Wenig später legte die Bild-Zeitung noch einen drauf – mit Photos: „Wölfe greifen Tierpflegerin im Gehege an – und verletzten sie schwer“. Die FAZ titelte: „Der Kulturkampf um die erste Nachkriegspopulation des Raubtiers spitzt sich zu“.
Der Leiter des Wolfsburger Instituts für sexuell konnotiertes Menscheln, Dr. Salm-Schwader, vermutet bei der Hinwendung der Frauen zu Wölfen, dass ihre Beziehungen zu ihnen deswegen um so vieles attraktiver sind als solche zu Männern, weil sie nur maximal zehn Jahre leben und ihre Pflege, wenn sie alt und klapprig geworden sind, auch nur höchstens ein halbes Jahr dauert, außerdem darf man Wölfe notfalls auch ganz legal töten – „von ihrem Leiden erlösen“, so to speak. Aber Salm-Schwader und sein Institut beschäftigen sich, wie der Name schon sagt, leider immer noch eher mit Beziehungen zwischen Mensch und Mensch, deswegen sind ihre anthropozentrischen Befunde mit Vorsicht zu genießen.
.
.

.
Von Werwölfen, Wölfen, Wolfshunden und Mischlingen
Im Januar 2000 gelang es einem osteuropäischen Wolf, über die Oder nach Deutschland einzuwandern. Er war der erste wieder seit vor 96 Jahren der letzte in Hoyerswerda erschossen worden war. Man nannte ihn Naum, er wurde eingefangen und zunächst in den Eberswalder Zoo und dann in den Wildpark Schorfheide verbracht. Der Tagesspiegel titelte: „Die Angst vor dem Osten oder Sibirien ist unheimlich nah“.
Der Wolf hatte nur drei Beine, vermutlich war er zuvor in Polen in eine Wolfsfalle geraten. Das hinderte ihn jedoch nicht, bei Ossendorf ein Rind zu töten und eine deutsche Schäferhündin namens Xena zu schwängern. Zehn Wochen später machte BILD bereits mit einer großen Story über die Geburt der „Mischlinge“ auf, die nach Meinung von „Wolfs-Experten“ sofort getötet werden müssen, weil sie für immer „unberechenbar“ bleiben. „Wir wollen, dass Naum in Brandenburg bleibt“, erklärte der Präsident des Landesumweltamtes, der auch für die deutsch-polnischen Welpen des Dreibeinigen „Artenschutz“ reklamierte: Sollte es sich tatsächlich um „Halbwölfe“ handeln, dürften sie weder vermarktet noch privat gehalten werden. Ein Gentest werde das klären. Der ergab dann, dass Naum nicht der Vater war.
Die Berliner Zeitung lieferte zunächst zwei Seiten Hintergrundmaterial über den „Todfeind Wolf“ – von Jack Londons „Wolfsblut“ bis zu Hermann Hesses „Steppenwolf“. Dann vermeldete sie die letzten Neuigkeiten über Naum: Der Wolf sei immer noch sehr scheu, habe mehrmals versucht auszubrechen und könne nicht mit seinen dort geborenen Artgenossen zusammengelegt werden, weil einer der Männchen des Rudels sich weigere, „Unterordnung zu signalisieren“. Fast eine RAF-Story. Naum kam daraufhin zusammen mit einer russischen Wölfin in ein eigenes Gehege, wo man ihn nur von weitem mit einem Fernglas besichtigen durfte.
.
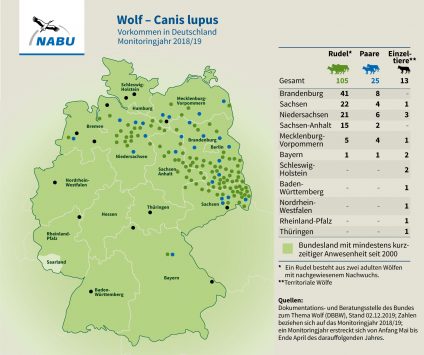
.
Anders jetzt in der thüringischen Kleinstadt Ohrdruf. Dort in der Nähe hatte eine Wölfin in einer Nacht 28 Schafe gerissen. Sie und ihr Nachwuchs, die auf einem Truppenübungsplatz leben, töteten bisher insgesamt 174 Schafe, Ziegen, Kälber und Fohlen. Die Wölfin wurde deswegen von der grünen Umweltministerin zum Abschuß freigegeben. „Es ist weder ein schöner noch ein einfacher Schritt, aber ein notwendiger,“ sagte sie. Die Wölfin hatte sogar mehrere Schutzzäune von Schafherden überwunden, deswegen sei ihr Abschuß gerechtfertigt. Der Naturschutzbund NABU kritisierte den Tötungsbeschluß: Die Schäfer bei Ohrdruf müssen mit Herdenschutzhunden arbeiten. Der Landesvorsitzende der Thüringer Schafzüchter erwiderte: Dann müsse das Land die Kosten für den Unterhalt der Hunde tragen, was jedoch eine EU-Regelung bisher noch nicht zulasse.
2017 hatte sich die „Ohrdrufer Wölfin“ mit einem Hund verpaart und sechs Junge, sogenannte Hybriden, bekommen: vier Weibchen und zwei Männchen. Auf Empfehlung der Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf (DBBW) und mit Genehmigung der Naturschutzbehörde wurden vier der Jungtiere aus „Artenschutzgründen“ erschossen, zwei konnten sich in Sicherheit bringen. Im Sommer 2019 bekam ihre Mutter erneut Junge, diesmal fünf. Eine Aufnahme aus einer Fotofalle in ihrem Revier auf dem Bundeswehrübungsplatz bei Ohrdruf zeige das, teilte das Thüringer Umweltministerium mit. Die Ministerin will diesmal die Welpen lebend mit Kastenfallen fangen lassen. Anschließend sollen sie in den Alternativen Bärenpark Worbis kommen. Aber ihre Mutter soll nun erschossen werden, das hat die Ministerin wie einst die römischen Kaiser mit Daumen runter entschieden.
.
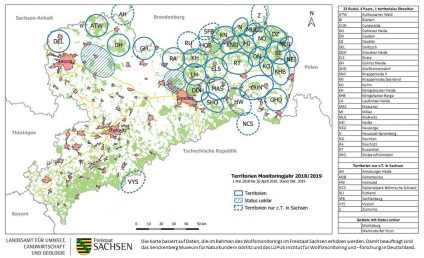
Die Reviere der Wolfsrudel in der Lausitz (Brandenburg und Sachsen).
.
Im Katalog der Ausstellung „Von Wölfen und Menschen“, die das Hamburger „Museum am Rothenbaum Kulturen und Künste der Welt“ (MARKK) 2019 veranstaltete, findet sich ein Beitrag über Werwölfe, denen man in Hamburg im 16. und 17. Jahrhundert, wenn man sie lebend fing, einen Prozeß wegen Hexerei machte. Er endete meist mit ihrer Hinrichtung. Der Werwolf, ein Mensch-Wolf-Hybrid, das ist heute der Problemwolf: ein Wolf-Hund-Mischling oder ein übergriffiger Wolf.
Ein solcher wurde unlängst auch vom schleswig-holsteinischen Umweltminister ausgemacht. Er heißt Dani (offiziell GW924m), hat angeblich 14 Schafe gerissen und soll nun erschossen werden. 175 Hobbyjäger stehen bereit, sie verlangen aber vom Minister, anonym bleiben zu dürfen, denn die Möglichkeit besteht, dass sie von Feministinnen verhext werden oder sich blamieren, vielleicht sogar strafbar machen, weil sie den falschen Wolf abschießen. Auf dem Internetforum „wolfsschutz-deutschland.de“ heißt es dazu: „Es könnte sein, dass Dani abgewandert ist. Ebenso gibt es Indizien dafür, dass sich weitere Wölfe in Danis Gebiet aufhalten. Dabei verspricht Umweltminister Albrecht immer wieder in Interviews, dass der Schießbefehl sofort erlöschen würde, wenn ein weiterer Wolf dort in Erscheinung treten sollte.“ Der NDR meldete: „Der sogenannte Problemwolf hat sein bisheriges Revier in Südholstein offenbar in Richtung Mecklenburg-Vorpommern verlassen.“ Während „Die Zeit“ erst einmal ins Grundsätzliche ging: „Wann ist ein Wolf ein Problemwolf?“ und dazu den „Rissgutachter“ Heiko Richter befragte. „Als auffällig gilt ein Tier dann, wenn es mehrfach eine wolfssichere Umzäunung überwunden hat. Die meisten Schafhalter im Land halten diese Grenze längst für überschritten. Sie zählen schon drei nach ihren Standards gute und trotzdem überwundene Zäune und erwarten eine Reaktion, bevor der Weidejäger die Strategie an seine Kinder weitergeben kann.“
Ironischerweise gilt das umgekehrt auch für seine Beutetiere, die Schafe: So halten z.B. neuseeländische Schafzüchter ein junges Schaf, das gelernt hat, den Riegel des Gatters seiner Weide zurückzuschieben, für besonders klug. Auf die Frage des Schafforschers Jeffrey Masson, wie sie mit solchen klugen Schafen umgehen, antworteten sie: „Wir erschießen sie, damit sie dieses Wissen nicht weitergeben.“
.

Wolfsjäger-Gemütlichkeit
.
Den Neonazis der Partei AfD haben es vor allem auf die Wolf-Hund-Mischlinge abgesehen. Da sie wie ihre Vorgänger vor allem biologisch argumentieren, gehen sie davon aus, dass „wilde Wölfe, die gleichzeitig die DNA von domestizierten Hunden besitzen, keinerlei Scheu mehr vor den Menschen haben und deswegen besonders gefährlich sind,“ wie die Tierschutzorganisation WWF Deutschland auf ihrer Internetseite schreibt. Die rechte Partei hatte das Thema „Angst vor Mischlingen zwischen Hund und Wolf – so genannte Wolfshybriden“ anläßlich einer öffentlichen Anhörung über freilebende Wölfe im Bundestag eingebracht. Der WWF schrieb daraufhin: „Diese Angst ist nicht berechtigt.“ Zwar können Wölfe und Hunde „theoretisch fruchtbare Nachkommen zeugen, weil sie zu derselben Art gehören. In der Praxis ist dies jedoch in Mitteleuropa die große Ausnahme.“ Darüberhinaus gibt es „keine wissenschaftlichen Beweise für die These, dass Wolfshybriden für Menschen besonders gefährlich werden.“
Es gibt eine „Wolfshunde“-Züchterin, Verena Bierwolf, in Schleswig-Holstein, die Klarheit in diese Auseinandersetzung bringen will: „Wolf-Hund-Mischlinge bezeichnet man auch als Hybriden, doch das ist falsch, denn Hybriden sind nicht fortpflanzungsfähig, und die Wolf-Hund-Mischlinge sind es ohne Ausnahme, denn Wolf und Hund sind eine Art. Wolf-Hund-Mischlinge sind die ersten 4 Folgegenerationen nach einer Verpaarung eines Wolfes mit einem Hund. Ab der fünften Folgegeneration haben Sie einen HUND vor dem Deutschen Gesetz! Sie benötigen weder eine Haltergenehmigung, noch eine Cites ab F5!“ Bei den Tieren, die Verena Bierwolf züchtet, handelt es sich ausschließlich um „Wolfshunde“ und nicht mehr um „Wolf-Hund-Mischlinge“.
Anders bei dem US-Philosophen Mark Rowlands, der einen echten Wolf, Brenin, besaß, den er überall mit hinahm. Gegenüber mißtrauischen Zollbeamten bezeichnete er ihn als irischen Wolfshund. An der Universität verteilte er Zettel an seine Studenten: Sie bräuchten keine Angst vor Brenin zu haben, nur sollten sie ihm keine Beachtung schenken und Lebensmittel nicht offen herumliegen lassen. Auf Partys erwies sich „sein Wolf als ‚Mädchenmagnet‘, so dass er sich ‚die übliche mühsame Anbaggerei‘ sparen konnte,“ berichtete der Spiegel.

Wölfchen. Photo: WWF Deutschland
.
Die Verbesserung Osteuropas am Beispiel der Tanzbären
Heinrich von Kleist veröffentlichte 1810 vier Artikel in den „Berliner Abendblättern“ zum Thema Anmut und Reflexion mit dem Titel „Über das Marionettentheater“, darin erzählte er eine Geschichte, die von einem Russland-Reisenden handelt, der in Estland mit einem Tanzbären bekannt gemacht wird, den er als sieggewohnten Fechtmeister mit seinem Rapier herausfordern soll. Der Bär kann jedoch jeden seiner Stiche und Hiebe scheinbar mühelos mit der Pranke abwehren.
In den „Mitteilungen aus baltischem Leben“ (2017) wird Estland noch immer als das „Bärenland“ bezeichnet. In dem kleinen, dünnbesiedelten und waldreichen Land leben rund 700 Braunbären. Sie werden von Jagdorganisationen geschützt – gegen bärenfeindliche Bürger und Wilderer, außerdem behüten sie deren Winterschlaf. 60 Bären dürfen jedes Jahr geschossen werden, hinzu kommen Sondergenehmigungen für den Abschuss von „Problembären“. 2010 gab es 14.000 registrierte estnische Jäger, außerdem wurden 4064 Jagderlaubnisse an reiche Ausländer verkauft. Einen Bären zu erschießen kostet 4000 Euro, ohne Garantie, dass der Schütze auf einem der 4500 Hochsitze auch wirklich einen Bären auf Schussweite zu sehen bekommt. Zudem sind die Ausländer nur an den größten Bären interessiert. Es sind Trophäenjäger.
„Die Bärenjagd ist die Krone der Jagd und ihre Trophäen sind wertvoll,“ schreiben der estländische Umweltminister und ein Wirtschaftswissenschaftler der Universität Tartu (Dorpat) in den „Mitteilungen“ der Baltendeutschen. Zwischen 1991 und 2008 wurden 37 Bärentrophäen mit einer Goldmedaille ausgezeichnet. Die estländischen Bären werden also ordentlich bewirtschaftet. Den zahlungskräftigen Jägern, die früher, wenn sie eine Bärin erschossen, die Junge hinterließ, diese an Zigeuner verkauften, wird auch kein „Zirkusbär“ mehr vor die Flinte getrieben, wie man es angeblich bei einem „alten Generalsekretär der KP Estlands“ tat, der unbedingt einen Bären erlegen, aber dafür nicht tagelang auf einem kalten Hochsitz ausharren wollte.
Heute sind diese z.T. geheizt. „Es gibt inzwischen sogar Abschüsse per Computer,“ schreibt der Münchner Ökologe Josef Reichholf in seinem Buch „Der Bär ist los“ (2007), das ein Jahr nach der Erschießung des seit 170 Jahren wieder ersten bayrischen Bären „Bruno“ erschien. Bruno, offiziell „JJ1“ genannt, weil seine slowenischen Eltern Joze und Jurka hießen und er ihr erstes Kind war, hatte sich aus einem italienischen Naturpark kommend über Österreich nach Bayern durchgeschlagen, was ihm zum Verhängnis wurde, obwohl Bären EU-weit ganzjährig geschützt sind, aber er hatte einige Bienenstöcke aufgebrochen, mehrere Schafe gerissen und Mountainbiker, die hinter ihm hergefahren waren, erschreckt. Daraufhin erklärte ihn die bayrische Regierung zum „Problembär“.
In der Schweiz wurde dann auch noch der „verhaltensauffällig“ gewordene Bruder von Bruno „JJ3“ erschossen. Ihre Mutter Jurka wurde erst besendert und kam 2010 in den „Alternativen Wolf- und Bärenpark Schwarzwald“. Beim modernen „Bearhunting“ per Computer „ist der ‚Schütze‘ mit einem echten Gewehr draußen in der Wildnis über das Internet verbunden und so am Bürostuhl in der Lage, tatsächlich den Bären zu schießen. Das Video dazu wird frei Haus geliefert, das Fell kann als Trophäe erworben werden. Peinlicher kann ein solcher ‚Sieg‘ über das große Tier nicht mehr werden,“ schreibt Josef Reichholf, der den Tanzbären in seinem Buch, das vom Umgang mit großen Wildtieren in Deutschland handelt, nur wenige Zeilen widmet. „Die Vorführung von Tanzbären demonstriert auf andere Weise die Macht des Menschen über das gewaltige Tier,“ heißt es da – und mit einem Tanz hätten die „wiegenden Schritte des gepeinigten Bären nichts zu tun“. Sie sind Reichholf zufolge der „Bärennatur“ gemäß und werden nur „falsch gedeutet“.
.
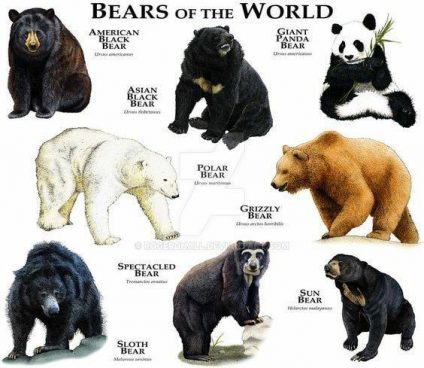
.
Als der Schriftsteller Wladimir Kaminer 2009 zu einer Lesung an die Universität von Tartu eingeladen wurde, erfuhr er dort, dass man im Jahr zuvor einem reichen Jäger aus Deutschland einen Zirkusbären zutreiben wollte. Der Kunde war ungeduldig geworden, weil er tagelang keinen Bären zu sehen bekommen hatte (jeder Tag kostete ihm rund 1000 Euro, die russischen Prostituierten nicht mitgerechnet). Auf die Schnelle kaufte deswegen der Jagdveranstalter einem Zirkus in St.Petersburg einen Tanzbären ab. Man trieb ihn dem Deutschen entgegen, der im Wald auf einem Hochsitz saß. Währenddessen war jedoch eine Pilzsammlerin erschienen, die ihr Fahrrad an einem Baum abgestellt hatte. Als der Bär daran vorbei kam, griff er sich das Fahrrad und fuhr davon – auf Nimmerwiedersehen.
In seinem Gedicht „Der Tanzbär“ hat Gotthold Ephraim Lessing 1759 die Perspektive eines solchen Bären eingenommen: „Ein Tanzbär war der Kett` entrissen,/ Kam wieder in den Wald zurück,/ Und tanzte seiner Schar ein Meisterstück/ Auf den gewohnten Hinterfüßen./ „Seht“, schrie er, „das ist Kunst; das lernt man in der Welt./ Tut es mir nach, wenn`s euch gefällt,
Und wenn ihr könnt!“ – „Geh“, brummt ein alter Bär,/ „Dergleichen Kunst, sie sei so schwer,/ Sie sei so rar sie sei,/ Zeigt deinen niedern Geist und deine Sklaverei.“ Andererseits ist das oben erwähnte Radfahren heute im ökologisch sich überformenden Anthropozän schon mal eine vielversprechende Überlebensstrategie.
In Rumänien wurden die Bären gehegt und gefüttert, vor allem in den Staatsjagdgebieten. Sie waren Devisenbringer. Reiche Trophäenjäger aus dem Westen durften dort schon zu Zeiten des Kommunismus Bären schießen. Die über drei Meter großen behielt sich allerdings Staatspräsident Ceausescu vor. Der Bärenfilmer Andreas Kieling besuchte eines dieser Reviere in Transsylvanien, wo der Jäger und ehemalige Jagdaufseher Ion die Bären noch immer füttert, so dass man sie mit Sicherheit zu Gesicht bekommt. Er will damit in das Geschäft mit dem „Ökotourismus“ einsteigen, sagt er, die Bären also auf eine neue Art und Weise nutzen.
Das wollen auch andere in den osteuropäischen Bärenwäldern: Sich mit Bärenfreigehegen verbunden mit „sanftem Tourismus“ eine Existenz aufbauen. In Kroatien, wo etwa 800 Bären leben, ist es ein Sozialpädagoge, Crnkovic, der zusammen mit den Bewohnern dreier Dörfer und der Forstverwaltung des Naturparks Velebit ein solches Projekt verfolgt. Er zieht bereits fünf verwaiste Bären auf. „Die zunehmende Erschließung des Velebit durch das Anlegen von Forstwegen und Straßen stellt bereits eine weit größere Gefährdung der Bären dar als Jagd und Wilderei,“ schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Obwohl oder weil der jugoslawische Staatspräsident Tito bis zu seinem Tod 1980 wie alle kommunistischen Führer ein leidenschaftlicher Jäger war („Die Jagd ist eine Kunst“ steht auf einer Tafel in einem seiner vielen Jagdhütten), wurde bereits im Juli 1945 ein umfassender Naturschutz beschlossen. In der Präambel heißt es: „Seltene natürliche Vorkommen zoologischer, botanischer, geologischer, paläontologischer, mineralogischer, petrographischer und geografischer Art, unabhängig davon, wem sie gehören und wessen Besitz sie sind, werden in den Schutz der Staates gestellt.“ (Zitiert nach „Nature and the Iron Curtain. Environmental Policy and social Movements in Communist and Capitalist Countries 1945-1990“ – 2019). Mit dem Zerfall Jugoslawiens und seiner Ökonomie weckten jedoch gerade diese „Naturschätze“, die nicht mehr geschützt werden konnten, Begehrlichkeiten bei Armen und Reichen.
Ähnlich war es auch in anderen Ostblockländern. Andreas Kieling war in Rumänien, um Bären zu filmen, er berichtete darüber in seinem Buch „Meine Expeditionen zu den letzten ihrer Art“ (2011). Der ehemalige Jagdaufseher Ion zeigte ihm die Fütterungsanlage, die sich an einer Jagdhütte befindet. Sie wird mit süßen Plätzchen gefüllt und daneben ein totes Pferd aufgehängt, so hoch, dass die Bären sich aufrichten müssen. An einer Meßlatte daneben kann der Jäger dann sehen, ob das Tier groß genug für eine Medaille ist. Wenn ja, kann er es aus der Jagdhütte heraus abschießen. „Nicht sehr sportlich,“ fand Kielings Kameramann.
Das Revier umfaßt 10.000 Hektar Karpatenwald, in dem etwa 50 Bären leben. Sie reißen jährlich 20 Schafe. Neben den Bären an dieser Anlage filmte Kieling vor allem „Müllbären“ in Rumäniens zweitgrößter Stadt Brasov (Kronstadt). Sie halten kaum noch Winterschlaf, weil die Müllcontainer das ganze Jahr über gefüllt werden. Rund um Brasov sollen etwa 150 Bären leben. Einst standen sie unter Ceausescos Schutz und die Bürger respektieren das anscheinend noch immer, zumal die Tiere jetzt EUweit geschützt sind. Seelenruhig geht eine Bärin mit ihren zwei Jungen durch die Wohnanlage eines Außenbezirks zu den Müllcontainern. Sie läßt sich von Kieling berühren. Auch in den Mischwäldern der Karpaten finden die Bären genug Nahrung. Sie sind fast ohne Arg, aber wenn ein Bär zum Problem wird, erschießen ihn die Jäger. Damit nicht auch die Bärin mit ihren Jungen irgendwann erschossen wird, haben lokale Naturschützer bei der Stadtverwaltung durchgesetzt, dass die Container abschließbar gemacht und täglich geleert werden sollen. Aber in der Plattenbausiedlung Racadau sind die Müllcontainer noch bärenfreundlich offen. Laut Südduetsche Zeitung tummeln sich dort mitunter bis zu 40 Bären.
Vorbild für die bärensicheren Abfallbehälter sind die fast 1000 im Yellowstone-Nationalpark aufgestellten Container. Dort leben derzeit 1627 Grizzly- und Schwarzbären. Mit jedem aufgestellten Abfallbehälter verringern sich die Konflikte mit den Parkbesuchern und damit werden dort auch weniger „Problembären“ abgeschossen oder umgesiedelt, wie die Statistik der Parkverwaltung ausweist. „Tödliche Bärenangriffe sind eine absolute Ausnahme – in den zwei Yellowstone-Nationalpark-Teilen starben seit ihrer Eröffnung 1875 bzw. 1910 insgesamt weniger als 20 Menschen durch solche Attacken. Doch Konflikte mit Farmern und Tierhaltern nehmen zu,“ berichtete die Neue Zürcher Zeitung. Die NZZ schrieb 2019 auch noch über einen ehemaligen Russland-Spezialisten der Schweizer Bundeskriminalpolizei, der sich von russischen Behörden zu einer Bärenjagd auf Kamtschatka einladen ließ und dafür nun wegen „Vorteilsnahme“ zu einer Geldstrafe verurteilt wurde.
In Britisch-Kolumbien hat man jetzt die Jagd auf Grizzlybären verboten: Sie sei nicht mehr sozial akzptabel, erklärte der kanadische Minister für Wälder, Länder und natürliche Ressourcen. Für das Verbot hatten sich u.a. die Indianer-Verbände ausgesprochen. Die Regierung schätzt, dass es in der Provinz etwa 15.000 Grizzlys gibt. „Das Verbot folgt einer im August eingegangenen Verpflichtung, die Trophäenjagd auf Grizzlybären zu beenden und die Jagd auf Grizzlybären im Great Bear Rainforest zu verbieten,“ heißt es im Internetportal „whitewolfpack“.
In der Schweiz gibt es Bestrebungen, das Verbot der Jagd auf Luchse, Wölfe und Bären zu lockern, etwa zur gleichen Zeit gab das Amt für Jagd und Fischerei Graubünden 2011 eine Studie „Zum Umgang mit anthropogenen Nahrungsquellen in Bärengebieten“ in Auftrag, sie enthält u.a. Adressen von Herstellern „Bärensicherer Produkte“, dazu gehören auch Abfallbehälter. Solche Produkte testet u.a. das amerikanische „Grizzly & Wolf Discovery Center“ auf „Bärensicherheit“. Die NZZ erwähnt Patti Sowka von der „Living-with-Wildlife-Stiftung“: Sie arbeitet dort mit und berichtete in einem Blog-Eintrag, wie das funktioniert: Die Behälter werden mit Leckereien gefüllt, verriegelt und einer Gruppe in Gefangenschaft lebender Grizzlys ausgesetzt. „Wenn der Container nach 60 Minuten Beissen, Ablecken, Herumrollen, Schlagen, Kratzen oder anderen Versuchen, an den leckeren Inhalt zu gelangen, immer noch standhält, hat er den Test bestanden.“
Um die Braunbären wirklich aus der Stadt und näheren Umgebung von Brasov raus zu bekommen, müssten die Naturschützer sie außerhalb füttern, aber dafür fehlt ihnen das Geld. Stattdessen fingen sie die Bärin und ihre zwei Jungen ein und brachten sie in einem Transportkäfig 100 Kilometer weit weg in die Berge. Die Tiere waren jedoch fast schneller wieder in der Stadt als die Naturschützer. Auch Bärenforscher fangen dort gelegentlich „Müllbären“ mit einer Käfigfalle ein, aber nur, um ihnen Halsbänder mit einem GPS-Sender umzuhängen.
In dem ausführlichen Wikipedia-Eintrag über „Tanzbären“ heißt es, dass sie mitunter in „Tanzbärakademien“ dressiert wurden, um „auf Kommando tanzähnliche Bewegungen auszuführen“, dazu spielte der Bärenführer auf einer Karpatengeige (Gusla), einer Pfeife oder er schlug eine Trommel. „Solche Vorführungen mit abgerichteten Braunbären waren in Europa vom Mittelalter bis in die ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts üblich. Diese inzwischen nahezu überall als Tierquälerei verbotene Praxis gibt es heute noch vereinzelt in Südost- und Osteuropa sowie mit Lippenbären in Indien.“ Ebenso selten seien umgekehrt die „Bärentänze“ der kleinen Völker Sibiriens und Nordamerikas geworden. Dabei kleiden sich die Männer in Bärenfelle und stellen tanzend „eine Einheit von Mensch und Tier her. Im christlichen Europa ging man jedoch schon frühzeitig auf Distanz zu dieser teuflischen Bestie. Erst wenn man sie mit Musik zum Tanzen zwingt, findet eine Transformation von einem magisch-animalischen zu einem kulturellen Wesen statt.“
In den EU-Ländern sind Auftritte von „Zirkusbären“ verboten, aber in Russland, Serbien, Albanien, in der Ukraine und in der Türkei gibt es sie noch. Auch reiche Privatleute halten dort gelegentlich Bären in Käfigen. So besaß z.B. der abgesetzte ukrainische Präsident Janukowitsch auf seiner schlossähnlichen Datscha bei Lwiw (Lemberg) gleich fünf Braunbären: Ein Männchen namens Mischka, ein namenloses Weibchen und drei Junge. Tierschützer versuchen in der Regel, solche Bären freizukaufen oder wenigstens ihre Unterbringung zu verbessern. Bei den Bären von Janukowitsch versuchten das Mitarbeiter der internationalen Stiftung „Vier Pfoten“, die in gewisser Weise auf Bären spezialisiert ist.
Im rumänischen Brasov bekommen die lokalen Naturschützer nun bei den „Müllbären“ Unterstützung von der „World Society for the Protection of Animals“ (WSPA), die dort ein Bärenreservat errichtet. Solche „Bärenparks“ oder „Bärenwälder“ finanziert auch die „Brigitte Bardot Stiftung“. Sie werden dann von der in Österreich gegründeten Tierschutzorganisation „Vier Pfoten“ betrieben. Derzeit „rettet“ diese gerade die letzten Tanzbären Serbiens, d.h. sie werden von den Zigeunern und Roma „freigekauft“ und bis an ihr Lebensende in einer ihrer großen Bärenanlagen betreut. Es ist dies eine Art Halbfreiheit, denn ein Elektrozaun um die Anlage verhindert, dass die Bären aus ihrem Reservat ausbrechen. Dafür bekommen sie drei Mal täglich eine Mahlzeit von den Bärenrettern.
„Vier Pfoten“ ist eine Tierschutz- keine Artenschutz-Organisation. Sie evakuierte auch Bären aus Zoos in Krisengebieten wie Gaza, Mossul und Aleppo und betreibt neben anderen Bärengehegen den 16 Hektar großen „Bärenwald Müritz“ in Mecklenburg. Dorthin sollten auch die Bärin Schnute und ihre Tochter Maxi kommen, die vor über 30 Jahren im Berliner Bärenzwinger geboren wurden und seitdem dort auf Beton lebten. Bevor sich jedoch der Senat entschließen konnte, sie wegzugeben, starb Maxi 2013 und zwei Jahre später Schnute. Die Mitarbeiter von „Vier Pfoten“ konnten jedoch einen Bären aus Albanien, einen aus dem Tierpark Wolgast und fünf aus dem Tierpark Löffingen, die in völlig ungeeigneten Anlagen gehalten wurden, in ihren „Bärenwald Müritz“ überführen.
Der Ökologe Josef Reichholf würde es stattdessen lieber sehen, wenn die Naturschutzorganisationen sich zusammentäten und mit ihren Spendengeldern so große Gebiete für diese und andere Wildtiere kaufen würden, dass sie nicht eingezäunt werden müssten.
Am 14.Juni 2007 trat Bulgarien der EU bei und damit wurde der Beruf des Bärenführers verboten, den dort durchweg Zigeuner ausübten. Sie traten mit ihren Tanzbären auf Jahrmärkten und in Touristenorten auf, auch vor Geschäften und auf Plätzen in Sofia. Die Bärendressur ist nicht besonders subtil und die Unterbringung der Tiere wenig „artgerecht“. Man zog ihnen einen Ring durch die Nase, kettete sie daran an, erhitzte eine Eisenplatte unter ihren Vorderpfoten, so dass sie sich wie Menschen aufrichteten, man fütterte sie mit Weißbrot, Kartoffeln und Süßigkeiten, gab ihnen Schnaps zu trinken und hinderte sie am Winterschlaf, behandelte sie aber dennoch als respektiertes Familienmitglied, die Frauen steckten ihnen Leckerbissen zu, die Kinder spielten mit ihnen, die Väter zogen mit ihnen von einem Badeort zum nächsten. Sie alle lebten von den Auftritten ihrer Bären.
In Polen gab es eine berühmte, vom russischen Zaren geförderte Akademie zur Ausbildung von Tanzbären. Man unterschied zwischen einer harten und einer weichen Dressur, ähnlich wie bei der Raubtierdressur in den Zirkussen. Manche arbeiteten nur mit männlichen, andere nur mit weiblichen Bären. Die polnische Schule machte im Herbst Pause, damit die Bären Winterschlaf halten konnten.
Lange Zeit fingen die Bärenführer sich ihre Tiere im Wald, zuletzt erwarben sie die Bären jedoch von Zirkussen, Zoos und Jägern. Die bulgarischen Kommunisten wollten den Bärentanz anfänglich verbieten, aber viele Parteikader waren im Zweiten Weltkrieg Partisanen gewesen und von Bärenführern vor ihren Verfolgern versteckt worden, die wie so viele bulgarische Zigeuner auf der Seite der Kommunisten standen. Deswegen war das Verbot der Tanzbären politisch nicht durchsetzbar. Und es ging den Zigeunern wirklich besser während der kommunistischen Ära von Todor Schiwkow, einem ehemaligen Schafhirten, der seine Herkunft nicht verleugnete. So sagte er z.B. in einer Rede zur Einweihung einer Fabrik: „Manche sagen, unsere Macht würde wackeln. Die Eier eines Hammels wackeln auch und fallen doch nicht runter.“
.

.
Nach der Wende wurden viele bulgarische Zigeuner, die u.a. in Kolchosen beschäftigt waren, arbeitslos, einige erwarben mit ihrer Abfindung bei der Forstbehörde einen jungen Bären auf „Bezugsschein“, den sie trainierten. Auf die Weise gab es in den Neunzigerjahren mehr Tanzbären in Bulgarien als vor 1990. Die 15jährige Wela war dann so erfolgreich als Tanzbärin, dass sie der Familie von Georgi Mirtschew den Bau eines Hauses mit ihren Auftritten finanzierte. Der Bärenführer kann deswegen dem polnischen Journalisten Witold Szablowski ehrlichen Herzens versichern: „Ich liebe Wela wie eine Tochter.“ Er hatte sie einer „weichen Dressur“ unterzogen, zwischen ihren Auftritten lebt sie auf Mirtschews Hof angekettet an einem Pfahl, „auch im Winter,“ wie Szablowski in seinen „Reportagen aus Osteuropa: ‚Tanzende Bären‘“ (2019) schreibt. Er läßt darin alle Seiten ausführlich zu Wort kommen. Das sind zum Einen die seit der Wende wieder diskriminierten Zigeuner, allen voran die Bärenführer. Und zum Anderen das Gesetz bis runter zum Amtsveterinär und der Ortspolizei. Sie werden angetrieben von der österreichischen Tierschutzorganisation „Vier Pfoten“, die mit Geld von gutbetuchten Sponsoren aus dem Westen ein zwölf Hektar großes Bärenreservat in Bulgarien erwarb, um dort allen konfizierten Tanzbären für den Rest ihres Lebens eine Quasifreiheit zu bieten – ohne Nasenring, mit Veterinär- und Zahnarztbetreuung und Alkoholentzug. Die Mitarbeiter des Bärenreservats entschädigen die Bärenbesitzer finanziell, aber ausdrücklich nicht für ihre Bären, die sie mitnehmen, 27 bis heute, sondern damit sich die Bärenführer einen neue Existenz aufbauen können. Wenn sie sich lange genug weigern, ihren Bären herauszugeben und gut handeln, bekommen sie bis zu 10.000 Euro.
Zwar könnte die Polizei die Tiere einfach wegführen, aber sie ist inoffiziell mit den Bärenführern verbunden und die „Vier Pfoten“-Mitarbeiter lassen sich lieber aufs Verhandeln ein, obwohl das EU-Gesetz auf ihrer Seite ist, „Aushandeln“ sagt man heute auch gerne (statt des früheren „Ausdiskutieren“), um dabei das „unlevel playingfield“ auszuklammern, aber die Bärenführer wissen natürlich, dass ihr Beruf verboten wurde, deswegen können sie höchstens mit ein paar Tricks den Preis für ihre Kapitulation etwas erhöhen. So wie hierzulande z.B. die sorbischen Hofbesitzer, die gegen ihre Vertreibung durch den Brunkohlekonzern Vattenfall klagen. Genaugenommen sind sie jedoch bereits enteignet, das Aushandeln ist bloß ein Demokratiespiel.
Im Falle der Tanzbären sind die „Vier Pfoten“-Mitarbeiter von vorneherein die Sieger in diesem Pseudodialog mit den Bärenführern. „Ich bedaure, dass ich nicht als Bär geboren wurde,“ sagte dann auch der budgetlose Bürgermeister von Belitsa, wo sich das Bärenreservat befindet. Aus bulgarischer Sicht ist das eine Kolonisierung unter tierschützerischem Vorzeichen. Ein Bärenführer soll mit seinem Tanzbären geflüchtet sein und ihn dann erschossen haben, damit er nicht den „Bärenbefreiern“ in die Hände fiel.
„Die drei Tiere der Staniews sind nun die letzten Tanzbären im zivilisierten Teil der Welt,“ sagen die Leute von „Vier Pfoten‘“ – und machen sich mit Polizei, Verwaltungsbeamten, einem österreichischem Tierarzt und einem internationalen Presseaufgebot auf zur Familie des berühmten Bärenführers Dimiter Staniew. Witold Szablowski berichtet: Bei ihm wollen sie „den 19jährigen Mischo, die 17jährige Swetla und die 6jährige Mima abholen“. Die Großfamilie Staniew erwartet sie vollzählig – schimpft, klagt und verweigert ihnen jede Hilfe. Wesselin Staniew geht vor die Tür und sagt den versammelten Journalisten: „Wer Bilder von der Übergabe der letzten Tanzbären oder vom Hausinneren haben möchte, muß 1000 Euro zahlen.“ Der Mitarbeiter von „Vier Pfoten“ weigert sich, diese „Frechheit des habgierigen Zigeuners“ zu übersetzen, zumal die Bärenauffangstation auf Sponsoren und damit auf eine gute Presse angewiesen ist. Aber seine Sorge ist unbegründet: „Der Reporter eines deutschen Fernsehsenders griff einfach in die Tasche, zog das Geld heraus und gab es Wesselin Staniew. ‚Die Deutschen überraschen mich immer wieder,‘“ meinte daraufhin der Übersetzer.
Zwei der Bären lassen sich in die Transportkäfige locken, aber der dritte, Mischo, weigert sich, er stellt sich auf die Hinterbeine und brüllt immer lauter. Schließlich hält es Dimiter Staniew nicht länger aus und schickt seinen 6jährigen Enkel zu dem Bären, der erst einmal lange mit ihm schmust und dann zuerst in den Transportkäfig geht, der Bär hinterher.
Das Kind sollte durch eine zweite Käfigtür rausschlüpfen, blieb aber bei Mischo und schmiegte sich an ihn. Endlich brachte Wesselin seinen Sohn „zur Vernunft“. Er kam raus und ein Mitarbeiter von „Vier Pfoten“ schloß schnell die Tür hinter ihm. Die Bären schrien alle drei und wollten sich aus den Käfigen befreien. Auch Wesselin schrie: „‘Wer quält denn hier die Tiere? Na wer? Bei uns haben sie nie in einem Käfig gesessen‘. Später werden die Journalisten die Aussage des Zigeuners als eine Art Kuriosität darstellen. Er habe die Bären jahrelang gequält, und jetzt schreie er rum. Die Journalisten tendieren dazu, das neue Leben der Bären (im Revier mit eigenem Wäldchen und Schwimmbecken) ausschließlich in bunten Farben darzustellen und kolorieren sogar noch etwas nach. Dagegen schildern sie das alte Bärendasein als eine Serie von endlosem Leid: ‚Die Sklaven endlich in Freiheit‘, schreiben sie z.B..“
Die drei Käfige mit den Bären kommen in einen umgebauten Ambulanzwagen, den „Wohltäter aus dem Westen spendeten, denen das Schicksal der bulgarischen Bären am Herzen lag“. Die Fahrt in Richtung Rila-Geburge dauert Stunden. „dann wird der Bärentraum, von dem die Tiere noch nichts ahnen, Wirklichkeit.“ Dort werden sie aber erst einmal betäubt, damit der Tierarzt sich an sie rantraut, um sie zu untersuchen. Alle drei Bären haben Probleme mit der Haut und mit den Zähnen. Sie haben zu viel Süßes bekommen. Am schlechtesten geht es Mischo, sagt der Direktor des Bärenparks Ivanov: zu hoher Blutdruck und eine schwere Augeninfektion. Ein Augenarzt aus Sofia kann seine Sehkraft retten. Nach einiger Zeit sind die Bären auch vom Alkohol entwöhnt. Als man sie in das Reservat brachte, wußten sie zunächst nicht, was sie tun sollten und „taumelten geradezu vor lauter Freiheit“.
Die Kulturwissenschaftlerin Pelin Günaydin hat sich an der Istanbuler Universität mit der Geschichte der Bärendressur befaßt. Als Kind sah sie einmal einen tanzenden Bären, der sie so beeindruckt hat, dass sie ihre Doktorarbeit darüber schrieb. Witold Szablowski fragte sie, was man den Bären für Kunststücke beibrachte: „Zum Beispiel sagte der Zigeuner: ‚Zeig uns Bärchen, wie die Bauern sich in die Leibeigenschaft begeben‘. Und der Bär machte einen Buckel, ächzte und griff sich an den Kopf. Dann sagte der Zigeuner: ‚Und jetzt zeig uns, wie sie laufen, wenn sie aus der Leibeigenschaft entlassen werden‘. Dann streckte sich der Bär, war voller Energie und bewegte die Beine so, als ob er gehen würde.
Auch den Besitzer von Wela fragte Szablowski: „Ich sagte z.B.: ‚Zeig uns, Wela, wie die Braut die Hand des Bräutigamvaters küsst‘. Und Wela küsste wunderschön die Hände aller Damen, wofür wir, als wir durchs Land fuhren, sehr gutes Geld bekamen. Und als unser hervorragender Fußballer Christo Stoitschkow in Barcelona spielte, sagte ich: ‚Wela, zeig uns, wie Stoitschkow ein Foul simuliert‘. Da legte sich Wela auf den Boden, fasste sich ans Bein und fing an zu röcheln. Einige Bärenführer griffen politische Themen auf. Etwas über Schiwkow, seine Leute, die nächste Regierung. Besonders als Schiwkow gestürzt wurde, gab es Hunderte Witze über ihn.“
Neben solche „Kunststücken“ können Tanzbären auch Kranke heilen. Schon eine Berührung mit ihnen hilft manchmal. Bei Rheuma und Rückenschmerzen setzt sich der Bär auf den Rücken des liegenden Patienten. Daneben gibt es auch Bärenführer, die mit ihren Tanzbären ringen.
.

Bärentherapie in Bulgarien
.
In Polen, wo sich die berühmteste Akademie für Tanzbären befand, wurde die Bärendressur bereits vor dem Zweiten Weltkrieg verboten, aber der Sinto Karol Parno Gierlinski kann sich noch erinnern, dass es bis in die Fünfzigerjahre in dem Troß, mit dem er durch Polen zog, zwei Bärenführer gab: „Die Bären haben weniger getanzt als geheilt. Die Leute in den Dörfern glaubten, dass ein Bär besser ist als der klügste Arzt.“
Die Bären im bulgarischen Tanzbärenpark von Belitsa müssen umgeschult werden. Für den Leiter Ivanov bedeutet das, „ihre Instinkte zu schärfen. Es gibt keine andere Möglichkeit, die Bären in die Natur zurückzuführen.“ Leider haben viele Bären im Park schwere Krankheiten: „Es ist schmerzhaft zu sehen, wie ein Tier, das in der Natur sehr stark ist und nicht einmal einen Schnupfen bekommt, durch den Kontakt mit Menschen an Diabetes, Krebs, Leberzirrhose oder Grauen Star erkrankt. Das, was wir uns antun, tun wir auch ihnen an,“ sagt er.
Die Instinkte wecken, das heißt für Ivanov, „den Sklaven im Bären töten“. Gleichzeitig will er aber auch das Gegenteil: ihre Intelligenz fördern. Indem seine Mitarbeiter z.B. das Futter verstecken: u.a. Nüsse in einer Röhre, wo sie einzeln herausgeholt werden müssen. Mischo zerschlug sogleich die ganze Röhre. Den Parkmitarbeitern ist es lieber, „wenn die Bären ihre Köpfe benutzen anstatt die Muskeln.“ Aber ob so oder so, wenn die Bären zu viele Nüsse essen, werden sie zu dick. Witold Szablowski erwähnt einen Park in Deutschland, „der dem von Belitsa ähnelt, wo ein Bär mit einem immensen Übergewicht lebt.“ Er meint den „Bärenwald Müritz“ in Mecklenburg. Dort leben z.T. Bären aus Zirkussen, also auch Tanzbären, nur dass die im Zirkus oft keine Nasenringe hatten, sondern Maulkörbe für ihre Auftritte umgelegt bekamen. Die von „Vier Pfoten“ aus Zoos „befreiten“ Bären haben dagegen wenig Menschenkontakt gehabt, weil die Tierpfleger in der Regel ganze Reviere mit vielen Tieren versorgen müssen.
Zu den „Instinkten“, die in den Bärenparks geweckt werden sollen, gehören auch die „Triebe“: Mischo umwarb bereits nach wenigen Tagen Swietla, dabei „brüllte er in einem ganz anderen Ton, als er dies sonst tat.“ Ein gutes Zeichen. Ivanov weiß nicht, wohin sich ihr Zurückführen in die Natur entwickeln wird. Wilde Bären würden sofort aus dem Reservat ausbrechen – trotz des Elektrozauns. „Sie sind viel selbstsicherer und kreativer. Vielleicht werden sich eines Tages auch unsere Bären auf den Zaun stürzen, ihn niedertrampeln und in den Wald gehen. Einerseits wäre das ein Erfolg, andererseits aber auch eine Niederlage. Denn in freier Wildbahn würden unsere Bären nicht mal eine Woche überleben.“ Wahrscheinlich, weil sie sich in menschliche Siedlungen wagen würden – nicht um zu tanzen oder zu heilen, sondern weil sie Hunger haben. Und dort würde man sie früher oder später erschießen.
Als Erfolg wird im bulgarischen Bärenpark auch der Winterschlaf gesehen. Wenn sie nicht einschlafen, ist das eine Niederlage. Wenn Swietla der jüngeren Mima einen heftigen Prankenschlag verpaßt, wird diese Aggression, weil zur „Bärennatur“ gehörend, ebenfalls als eine „Art Rückkehr zu den Wurzeln“ [den Instinkten] betrachtet.“ Wenn sie sich dabei allerdings töten, wäre das eine Niederlage: „Das können wir nicht erlauben. Aber wieviel Aggression können wir zulassen?“ fragt sich Ivanov.
Der Park ist in drei Sektoren unterteilt: der erste für die ruhigen, der zweite für die dominanten, der dritte für die aggressivsten Bären. „In jedem Sektor haben sie das Bedürfnis, sich in Dominante und Dominierte aufzuteilen. Das wollen wir nicht…Wir sitzen in unserer Beobachtungsstation und schauen, wie die Bären sich verhalten. Wie viele Aggressionen kömnen wir zulassen? Haben sie schon die Grenze überschritten, oder geben wir ihnen noch einen Moment, um wieder runter zu kommen?“ Im Grund hat ihre langjährige Tanzbärenkarriere sie asozial gemacht und nun müssen sie nacherzogen werden. Die Bärenparkmitarbeiter sind so etwas wie Bewährungshelfer oder Coaches für Start-Upper. Nur dass die Bären früher „ganze Tage für die Zigeuner gearbeitet“ haben und jetzt „den ganzen Tag für sich“ haben: „Die Tiere sind davon völlig überfordert.“ Wenn nun auch alles anders ist, eines ist geblieben: Sie werden auch weiterhin mit dem schädlichen Weißbrot gefüttert – sie davon zu entwöhnen, würde eventuell ihrer Gesundheit noch mehr schaden. Es hat fast den Anschein als tanzten die Parkmitarbeiter nun um die ruhiggestellten Bären herum.
Szablowski erwähnt als Beispiel die Bärin Elena, die 2009 aus Serbien geholt wurde und sogleich „vorbildliche Fortschritte“ gemacht hatte. Aber dann kam der Winter und sie war „völlig durcheinander. Sie wiegte sich ganze Tage hin und her und fraß fast gar nicht mehr – obwohl sie gerade vor dem Winterschlaf am meisten hätte fressen müssen.“ Die Leute von „Vier Pfoten“ überlegten sich alles mögliche. Sie versteckten das Futter, aber da hörte Elena „fast ganz auf zu fressen“. Sie verlegten sie in einen anderen Sektor, aber „das irritierte sie noch mehr“. Sie gruben ihr eine Erdhöhle, „aber auch das half nicht. Da hatte jemand die Idee, eine Hütte zu bauen, die dann mit Blättern bedeckt wurde. Volltreffer: Elena fing an, den Schnee wegzuräumen, hörte auf zu schaukeln, und drei Tage später fiel sie in Winterschlaf.“
Es ging ihr und auch einer anderen Bärin ähnlich wie den Menschen, die in die Wildnis ziehen, aber nicht auf jeden Komfort verzichten wollen. Inzwischen bauen die Parkmitarbeiter jeden Winter fünf oder sechs solche Hütten. „Man kann die Bären nicht einfach rauslassen und warten, dass sie mit allem selbst zurechtkommen. Freiheit, das ist eine hochkomplizierte Sache,“ sagt Parkleiter Ivanov.
(Zuerst veröffentlicht in der Zeitschrift „Abwärts“ (Basisdruck Verlag Berlin, Januar 2020)
.

Bär mit Fidel Castro, Irkutsk 1963
.

Harfe spielender russischer Bär
.
Bärendienste
1998 band man dem Biologen Cord Riechelmann in Bulgarien eine lustige Bärengeschichte auf: Als der KP- und Staatschef Todor Schiwkow einmal auf Bärenjagd gehen wollte, requirierten seine Jäger kurzerhand von einem Zigeuner einen Tanzbären. Dieser Bär wurde Schiwkow dann vor die Flinte getrieben. Dabei entriss er jedoch einem der Treiber ein Fahrrad, schwang sich rauf und radelte davon. 2001 hatte sich diese Geschichte derart ausgebreitet, dass sie – in Lettland – schon auf reiche Jäger aus dem Westen umgemünzt wurde, denen auf einmal Gleiches widerfahren sein sollte. Wladimir Kaminer erfuhr dort etwa vom Leiter des Goethe-Instituts in Tallinn, ein estnischer Förster habe neulich für zwei bayrische Jäger einen Zirkusbären in St.Petersburg gekauft, der sich dann mit dem im Wald liegengelassenen Fahrrad einer Blaubeerensammlerin auf und davon machte, ehe die Bayern ihn erlegen konnten (siehe oben).
Wladimir Kaminer machte daraus sogleich einen Lesebühnentext, der bei dem Berliner Bärenpublikum sehr gut ankam. 2006 griff der Wahlberliner Ingo Schulze diese Geschichte noch einmal auf. In seiner Bärengeschichte kommen der Leiter des Tallinner Goethe-Instituts und seine Frau, „eine bildschöne Argentinierin“, auch vor, daneben aber noch ein Jäger mit Namen Arne, der den Bär persönlich aus St. Petersburg abholte und ihn sogleich dem Autor, Ingo Schulze, und seiner Freundin Tanja vorführte, bevor er ihn zum Einsatz in den Wald brachte, wo der Bär sich dann wie gehabt ein Fahrrad klaute und damit aus dem Staub machte.
Wladimir Kaminer konterte 2007 mit einer neuen Bärengeschichte – frisch von der Internationalen Tourismus Börse, wo sich einige Tourismusmanager aus Russland und den ehemaligen Sowjetrepubliken mit einem deutschen Jagdreiseveranstalter trafen: „Wir haben die Zählung der Braunbären abgeschlossen, 1.500 leben allein in unserem Gebiet“, berichtete ein Beamter aus Tomsk „Davon brauchen wir höchstens ein Drittel, 1.000 Bären können also jederzeit abgeschossen werden. Wir haben Personal, fähige Leute vor Ort, die den Bären innerhalb von 24 Stunden ausstopfen, so dass der Tourist seinen Bären gleich mitnehmen kann“. „Sehr gut!“, sagte der Reiseunternehmer und notierte sich das.
Ein Delegierter aus Kasachstan meinte: „Wir haben eine große Muflon-Population – wilde Bergziegen. Unsere Leute vor Ort können die Tiere ausstopfen, bevor der Tourist wieder geladen hat.“ „Das ist alles schön und gut“, unterbrach ihn sein kirgisischer Kollege, „aber nichts ist spannender als eine Pegasen-Safari.“ Es handelt sich dabei um sehr große, aber auch sehr scheue Murmeltiere. Schon mehrmals waren deutsche Jagdreisegruppen unverrichteter Dinge – betrogen quasi – aus Kirgistan heimgekehrt: Das wusste der Reiseveranstalter, er hakte deswegen nach, ob es bereits ausgestopfte Pegasen gäbe. Das musste der Kirgise verneinen. „Na, sehen Sie?“, sagte der Reiseveranstalter fast triumphierend und beendete das Gespräch mit dem Satz: „Zum Anfang schnüre ich ein Standardpaket aus einer Ziege und einem Bären“.
Die Bärengeschichten dringen nicht nur aus dem Osten, dem Einflussgebiet des russischen Bären, zu uns, sie kommen auch von Süden: Seit der allseits kritisierten Exekution des italienischen Braunbären Bruno durch bayrische Jäger, Grenzschützer, Förster und GSG-9-Beamte kann man hierzulande von einer Bärengeschichtenschwemme sprechen. Die einen wollen Schutzparks für sie haben, die anderen fordern Bären-Management-Pläne (in Analogie zum Brandenburger „Wolf-Management“), wieder andere wollen erst einmal das Leben und Treiben der Braunbären in seinen letzten eurasischen Verbreitungsgebieten erforschen lassen. Sie warnen vor vorschneller Wiedereinbürgerung des Raubtiers. Gleichzeitig werden sofortige Schutzmaßnahmen für die angeblich vom Klimawandel bedrohten arktischen Eisbären gefordert – und in Berlin gibt es – ausgestopft – Knut, den „Weltstar aus Deutschland“ (Vanity Fair).
Der Berliner Bärenwahn ging so weit, dass die Schwarzbären am Tierpark und die zwei lebenden Braunbären in ihrem Zwinger im Köllnischen Park bis zu ihrem Tod Personenschutz bekamen – um zu verhindern, dass sie von militanten Tierschützern befreit werden. Die taz erhielt bereits mehrfach diesbezügliche „Aktions-Bekennerschreiben“. Und der Polizeipräsident warnte die potenziellen Täter öffentlich: „Mit Bären ist nicht zu spaßen!“ Das sei etwas anderes, als weiße Mäuse aus den Labors der FU zu befreien.
.

.
Eisbären in Freiheit und in Gefangenschaft
„Der Eisbär gehört zur Familie der Bären. Dieses größte Landraubtier bewohnt die nördlichen Polarregionen.“ heißt es auf Wikipedia. Wegen der Klimaerwärmung soll es den Polarbären dort immer schlechter gehen. Nicht weil die Wärme ihnen zusetzt, sondern weil ihre Jagd auf Robben an Eislöchern durch den Rückgang an Packeis dadurch erschwert wird. „Bei Gelegenheit erbeuten sie nun auch lebende Delfine, wie Forscher erstmals beobachtet haben,“ berichtete „spektrum.de“, und gelegentlich fressen sie sich laut „Spiegel“ sogar gegenseitig. Daneben stoßen sie auch in bewohnte Gegenden vor. Auf einer WWF-Internetseite heißt es: „Bei den Siedlungen treffen die Eisbären auf Menschen, die mit dem Problem heillos überfordert sind. Gelingt es uns nicht, diese fatale Entwicklung zu stoppen, werden auch die letzten Eisbären bald Geschichte sein.“ Dann gibt es sie vielleicht nur noch in den Zoos, wo man versucht, sie nachzuzüchten.
Wie schon mehrmals in der Zoogeschichte lag der private in Hamburg mal wieder vorn: „Der Höhepunkt im Tierpark-Jahr 2012 war zweifelsohne die Eröffnung des neuen Eismeeres,“ heißt es auf der Internetseite der Stiftung Hagenbeck. Während die zwei Berliner Zoos sich – seit Jahrzehnten schon – nur ein dumpfes Kopf-an-Kopf-Rennen mit einem Eisbär-Baby im Osten und einem im Westen (ohne „neue Eismeere“) liefern. Eigentlich stammen beide Tiere aus dem Osten. Tosca, die Mutter des berühmten Eisbärjungen „Knut“, der den Westberliner Zoo Millionen einbrachte, gehörte der Eisbärendompteuse Ursula Böttcher. Sie hatte sich beim Staatszirkus der DDR von der Putzfrau zur Raubtierdresseurin hochgearbeitet, zunächst arbeitete sie mit Löwen – bis der Generaldirektor sie vor die Wahl stellte: „Entweder übernehmen Sie die alten Bären – oder Sie kriegen eine Hundenummer!“ Zu den alten Eisbären bekam Ursula Böttcher noch etliche junge dazu, am Ende arbeitete sie mit zwölf Tieren – und wurde damit weltberühmt. Ihre Autobiographie diktierte sie dem Germanisten Siegfried Blütchen, das Buch „Kleine Frau, bärenstark“ erschien 1999; im selben Jahr wurden mit dem liquidierten Staatszirkus auch ihre Eisbären von der Berliner Treuhandanstalt verkauft und sie arbeitslos.
Eigentlich wollte der „Circus Busch-Roland“ mit ihrer Bärennummer auf Tournee gehen, auch Zirkus Krone hätte sie gerne für fünf Jahre unter Vertrag genommen und ihre volkseigenen Bären dazu erworben, aber der Treuhand-Zirkusliquidator ließ sich darauf nicht ein, sondern verkaufte die Tiere an Zoos, zwei übernahm der Westberliner Zoo. Ursula Böttcher wurde „aus betriebsbedingten Gründen“ gekündigt: „Nach 47 Jahre Zirkus und einer Weltkarriere mit eineinhalb Zeilen.“ Laut Berliner Zeitung kombinierte der Pressesprecher des „Circus Busch-Roland“, der 1999 vergeblich gegen den Bärenverkauf geklagt hatte: „Des Liquidators engste Liquidierungsberaterin heißt Ursula Klös. Schwiegertochter des früheren Berliner Zoodirektors und heutigen Aufsichtsratsvorsitzenden von Zoo und Tierpark, Heinz-Georg Klös. Ihr Mann wiederum arbeitet in leitender Stellung im Zoo,“ und der Eisbärenkurator „Heiner Klös“ ist der Sohn von Heinz-Georg Klös.
Die Eisbärin Tosca wurde zunächst an den Zoo Nürnberg verkauft, wahrscheinlich nur zum Schein, denn danach kam auch sie in den Westberliner Zoo, wo sie 2006 ein männliches Junges bekam, das sie aber nicht annahm und das deswegen von seinem Pfleger aufgezogen wurde: Knut. Der kleine Bär wurde zusammen mit seinem Pfleger so berühmt, dass der kleine Westberliner Zoo mit ihm erstmalig mehr Besucher zählte als der vier Mal größere Ostberliner Tierpark. Knut starb 2011 – vierjährig, sein Pfleger im Jahr darauf. Der Regierende Bürgermeister ließ verlauten: „Wir alle hatten den Eisbären ins Herz geschlossen.“ Auch der Präsident des Deutschen Tierschutzbundes, Wolfgang Apel, äußerte sich betroffen, zugleich übte er Kritik an der Haltung des Tieres: „Das kurze und qualvolle Leben von Knut zeigt erneut, dass Eisbären nicht in den Zoo gehören, auch wenn sie Knut heißen.“ Der Liquidator hatte zuvor gerade den Verkauf der Zirkus-Eisbären an Zoos mit der Notwendigkeit einer „artgerechten Haltung“ rechtfertigt.
Knuts Leiche kam in das Naturkundemuseum und wurde dort vom Chefpräparator Detlef Matzke ausgestopft: „Knut wird unsterblich,“ titelte der Tagesspiegel. Die japanische Dichterin Yoko Tawada veröffentlichte 2016 seine Biographie „Memoirs of a Polar Bear“ („Etüden im Schnee“): Beginnend mit der Großmutter, die aus der Sowjetunion stammte und nach Kanada emigrierte, wo ihre Tochter Tosca geboren wurde, die dann in die DDR ging, wo sie zunächst im Zirkus arbeitete und dann in Westberlin einen Sohn namens Knut bekam. 2007 hatte bereits ein durch Fake-Interviews in Hollywood bekannt gewordene Journalist ein Interview mit dem damals noch lebenden kleinen Eisbären veröffentlicht – unter dem Titel „Kleiner Knut ganz groß: Der berühmteste Eisbär der Welt im Gespräch mit Tom Kummer“. Es kam aber nichts Neues dabei heraus.
Der jetzige Direktor des Westberliner Zoos, Knieriem, der zugleich Direktor des Ostberliner Tierparks ist (wobei man jedoch den Verdacht haben könnte, das er dessen verdeckter Liquidator ist), teilte 2016 der Presse mit: Der präparierte „Knut wird Artenschutz-Botschafter“. Zur gleichen Zeit, da diese tierverlächerlichende Idee im Westberliner Zoo geboren wurde und die städtischen Gaswerke mit einem Eisbären warben, gebar im Ostberliner Tierpark eine Eisbärin zwei Junge, von denen eines überlebte; es wurde Fritz genannt. Ihn nahm seine Mutter an. Fritz wird deswegen nicht so zahm wie Knut sein. „Die Zeit“ fragte: „Könnte dieses Eisbärenbaby der neue Knut werden?“ Andere Berliner Zeitungen meinten: Das Eisbärenbaby Fritz sei eine Chance für den Tierpark, wenn nicht die letzte. Hoffentlich stimmt diese Einschätzung nicht, denn einen Monat nach seiner öffentlichen Benamung starb „Fritz“, woraufhin die Tierschutzorganisation „Peta den Verantwortlichen vorwarf, rein aus Marketing- und Profitgründen Eisbärenbabys zu züchten und auf einen neuen „Knut-Effekt‘ zu setzen“, heißt es in einer Mitteilung der Tierrechtsorganisation. „Die Haltungsbedingungen in Zoos sind derart unnatürlich, dass ein großer Teil der Eisbärenbabys die ersten Monate nicht überlebt – teilweise aufgrund der mangelhaften Haltungsbedingungen, teilweise aufgrund der schweren Verhaltensstörungen der Muttertiere. Hinzu kommt, dass die Haltung von Eisbären in Gefangenschaft keinen Beitrag zum Artenschutz darstellt, da im Zoo geborene Tiere grundsätzlich nicht ausgewildert werden können.“ Der Schweizer Blick wollte sich so einer populärwissenschaftlichen Sichtweise nicht anschließen und titelte: „Der Eisbären-Fluch von Berlin“. Der Deutsche Tierschutzbund riet: „Zoos sollten auf Eisbären verzichten“. Erwähnt sei noch, dass eine Woche darauf der Eisbär „Tips“ im Osnabrücker Zoo ausbrach, woraufhin er erschossen wurde. Und dass das neugeborene Eisbärenbaby im Münchner Tierpark Hellabrunn einen Namen mit „Q“ bekommen soll, über den die Öffentlichkeit abstimmen wird.
Auf Wikipedia heißt es über die 2010 gestorbene Eisbärendompteuse Ursula Böttcher: „Sie war nur 1,58 Meter groß und die erste und einzige Frau weltweit, die in einer Manege Dressuren mit Eisbären zeigte (die z.T. mehr als doppelt so groß waren). Sie trat dabei mit bis zu zwölf Tieren gleichzeitig auf. Berühmt wurde sie für den sogenannten „Todeskuss“ (der auf einer DDR-Briefmarke abgebildet wurde). Er bestand darin, dass sie einen Eisbären von Mund zu Mund mit einem Stück Fleisch fütterte. In den USA wurde sie als ‚Princess of Bears‚ gefeiert. Sie wurde mit mehreren Zirkus-Preisen ausgezeichnet und bekam den „Nationalpreis der DDR“. In der „Ruhmeshalle“ des „internationalen Artistenmuseums Klosterfelde“ sind einige Requisiten und Fotos von ihr ausgestellt – dazu ihr im Naturkundemuseum ausgestopfter „legendärer Eisbär ‚Nordpol‚“. Als sie einmal beim Tanz mit der Eisbärin „Nixe“ von dieser zu Boden geworfen und in die Schulter gebissen wurde, rettete ihr Assistent ihr das Leben, aber sie machte sofort weiter und ging erst nach der Vorstellung ins Krankenhaus: „Man darf so etwas nicht durchgehen lassen. Wenn das Tier merkt, dass es seinen Willen behaupten kann, ist es für diese Arbeit verloren.“ Ein Dompteur muß über dem Alphatier stehen, das „Superalphatier“ in einer Eisbärengruppe zu sein, ist besonders schwierig, weil Bären in optischer und akustischer Hinsicht extrem ausdrucksarm für uns sind. Dennoch und trotz aller Angriffe und Fehlinterpretationen darf beim Dompteur keine Angst aufkommen. Darin besteht laut dem Zürcher Zoodirektor Heini Hediger „das wesentliche ‚Geheimnis‘ von Ursula Böttcher im Umgang mit den sie hoch überragenden arktischen Riesen.“
Inzwischen befragt man nicht nur Zoos und Zirkusse im Hinblick auf ihre artgerechte Haltung der Tiere. Die Frankfurter Rundschau fragte den für seine Tierdokumentationen geadelten Regisseur David Attenborough, ob seine Arbeits-„Methoden“ denen seines Bruders, des Spielfilmregisseurs Richard, ähneln würden. Attenborough antwortete: „Wir sind vollkommen verschieden. Er erfindet Geschichten, während ich Geschichten filme.“ – Oder filmen lasse. Nachdem er in einem Interview zugegeben hatte, die im Zoo gefilmte Geburt eines Eisbären in eine Sendung eingebaut zu haben, die diese Tiere in der arktischen Wildnis zeigte, war es zu einem „Attenborough-Skandal“ gekommen. Der des Betrugs Bezichtigte verteidigte jedoch nicht nur seine Täuschung, sondern gab gleich noch weitere zu. Die Tierfilmproduzenten sprangen ihm bei: Seine „Eisbären-Methode“ entspreche den „Redaktionsanforderungen“, sie sei „Standard“ bei der Produktion von „Natural History Programmen“. Wahrscheinlich haben wir es bald nur noch mit zusammenmontierten Eisbären zu tun.
.

Ursula Böttcher küsst Eisbär „Alaska“
.
Auf der riesigen fast unbewohnten Doppelinsel Nowaja Semlja zwischen Barentssee und Karasee lebten schon immer Eisbären. Aber zum Einen hat die Klimaerwärmung ihnen inzwischen die Jagd auf Robben im Packeis erschwert, weil deren Eislöcher zum Atmen weniger werden, und zum Anderen sind die menschlichen Siedlungen, wo die Bären in den Abfällen Nahrung finden, in letzter Zeit größer geworden. Heute leben rund 2500 Menschen auf Nowaja Semlja, die meisten gehören der Urbevölkerung, der Nenzen, an, die von der Fischerei und der Pelzjagd auf Polarfüchse leben. Daneben wird Kupfer und Steinkohle auf der Doppelinsel abgebaut und bis 1990 fanden dort 130 Kernwaffenversuche statt. Noch immer sind Teile der Doppelinsel radioaktiv verseucht.
Die Nord- und die Südinsel haben zusammen mit vielen kleineren Inseln eine Fläche von 90.650 Quadratkilometer und eine Länge von 900 Kilometern. Es gibt keine Zählung der dortigen Eisbärenpopulationen aus der Luft, aber allein in der Nähe des Hauptortes Beluschja Guba wurden 52 Eisbären gezählt. Einige Bären würden Menschen „regelrecht jagen“, sagte der Chef der örtlichen Verwaltungsbehörde, Schiganscha Musin. Er lebe seit 1983 auf der Insel, aber so viele Bären habe er noch nie erlebt.
Auf Nowaja Semlja finden sich immer mehr Eisbären ein: „Es sind zu viele Tiere, deshalb haben die Behörden auf der russischen Doppelinsel Nowaja Semlja im Nordpolarmeer den Notstand ausgerufen,“ berichtete die Tagesschau. In Kanada nehmen ihre Populationen dagegen dramatisch ab, dennoch treibt der Hunger die Eisbären auch hier immer öfter in die Nähe von Siedlungen. Auf einer WWF-Internetseite heißt es: „Bei den Siedlungen treffen die Eisbären auf Menschen, die mit dem Problem heillos überfordert sind. Gelingt es uns nicht, diese fatale Entwicklung zu stoppen, werden auch die letzten Eisbären bald Geschichte sein.“ In ihrer Not erbeuten sie nun auch Delfine, wie Forscher erstmals beobachtet haben, und gelegentlich fressen sie sich laut „Spiegel“ gegenseitig.
In der Beauford See in Alaska und im Nordwesten Kanadas ist die Zahl der Eisbären laut WWF seit Beginn des Jahrhunderts um rund 40 Prozent zurückgegangen. 2004 wurden noch 1500 Eisbären gezählt. Zuletzt waren es nur noch 900. Mit Unterstützung des WWF Deutschlands erhoben Wissenschaftler neue Bestandszahlen in der kanadischen Hudson Bay, indem sie Luftaufnahmen anfertigten und auswerteten. Die im „Arctic Journal“ veröffentlichten Zahlen sind demnach im Vergleich zum Jahr 2014 von 943 auf 780 Individuen gesunken. „Jetzt geht es den Eisbären dort auch zahlenmäßig an den Kragen, da die älteren Tiere sterben und weniger Junge nachkommen,“ sagte die Arktisexpertin beim WWF Deutschland Sybille Klenzendorf.
In Russland sind Eisbären ganzjährig geschützt, aber auf Nowaja Semlja erwägt man nun, sie durch Abschüsse von den Siedlungen zu vertreiben. Während der WWF fordert, „dass wir das Tempo beim Klimaschutz drastisch erhöhen müssen. Nur dann haben die Eisbären eine Überlebenschance.“
.

.

Russin füttert Eisbär
.
Leben und Sterben in der Arktis
Beitrag für Nanna Heidenreichs Symposium „Hotspots: Migration und Meer“ in der Akademie der Künste der Welt Köln, der dort 2019 auf Deutsch und Englisch publiziert wurde.
Der aus dem Muschelhandel hervorgegangene Ölkonzern „Shell“ kündigte zum Entsetzen der Umweltschützer den Beginn von Ölbohrungen am Nordpol an. Die arktische Region ist reich an allen möglichen Bodenschätzen. Das gilt vor allem für Grönland. Vielleicht wollte der US-Präsident deswegen diese größte Insel der Welt kaufen. Im Maße sich dort das Eis zurückzieht, drängen ausländische Investoren auf die Insel. 2018 wurden in Grönland 50 Abbaulizenzen für Explorationen von Gold, Diamanten, Kupfer, Nickel und anderen Mineralien vergeben. In Südostgrönland will ein chinesisch-australisches Bergbaukonsortium Uran und Seltene Erden im Tagebau fördern.
Derweil sucht eine russische „Polarexpedition“ in der Arktis mit Mini-U-Booten nach weiteren Ölquellen. Während die ersten russischen Tanker für Flüssiggas aufgrund der Klimaerwärmung bereits das ganze Jahr das Nordpolarmeer durchfahren können. Die „Heinrich Böll Stiftung“ der Grünen spricht von einem „Wettlauf um die Arktis“. Das Studentenforum „unicum“ geht in seiner „Karriere“-Rubrik bereits der Frage nach „Wie wird man…Polarforscher?“
U.a. wird erforscht, wie sehr der zunehmende Plastikmüll die arktische Tiefsee belastet. Die Leiterin des nach dem Polarforscher Alfred Wegener benannten Bremerhavener Instituts zur Erforschung der Polarregion Antje Boetius fordert :„Die Tiefseeforschung braucht mehr Forschungsschiffe“. Während der junge Tierfilmer Andreas Kieling, als man ihn fragte, warum er so an der arktischen Fauna, vor allem an Eisbären, interessiert sei, antwortete: „Ganz einfach – ich mußte mir sehr genau überlegen, wo es eine Marktlücke gab.“
Die Umweltschützer sind aktuell vor allem beim „Klimaschutz“ engagiert, dabei ist ihr „Symboltier“ vielfach der arktische Eisbär, dem durch die Klimaerwärmung und den dadurch verursachten Rückgang des Packeises seine Nahrungsgrundlage, Robben, entzogen wird. In der kanadischen Hudson-Bay kommen die hungrigen Bären bis in die Hafenstadt Churchill, wo es für besonders aufdringliche Eisbären sogar ein Gefängnis gibt. In den sozialen Medien zirkulieren Bilder von halbverhungerten Eisbären. Der Direktor von Zoo und Tierpark in Berlin ließ den junggestorbenen Eisbären „Knut“ ausstopfen und erklärte ihn zum „Artenschutz-Botschafter“.
.

.
Man erinnert sich vielleicht noch an die süßen Robbenbabys auf dem Packeis vor Neufundland, die alljährlich zu tausenden von „Robbenschlächtern“ mit Keulen betäubt wurden, um ihnen bei lebendigem Leibe ihr flauschiges weißes Fell abzuziehen. Die Photos davon gingen 1977 um die Welt. Dahinter stand eine u.a. von Brigitte Bardot beförderte Kampagne gegen die Pelzindustrie. Etliche Staaten beschlossen daraufhin Pelzeinfuhrverbote. Zudem wurde es im Westen generell Konsens: „Pelz ist nicht okay“, was zur Folge hatte, dass die Inuit mit Robbenfellen nichts mehr verdienten.
Im Film der kanadischen Indigenen Alethea Arnaquq-Baril „Angry Inuk“ (2016) ist die entscheidende Abstimmung im Europäischen Parlament über das verschärfte Einfuhrverbot von Robbenprodukten zu sehen: Vor dem Saal standen auf der einen Seite die Tierschützer und verteilten kleine, weiße Robbenbaby-Plüschtiere, auf der anderen standen einige Inuit in ihrer Robbenfellkleidung und versuchten darüber aufzuklären, dass sie gar keine weißen Jungtiere jagen, dass die Robbe für sie das ist, was für die Europäer das Schwein ist, und dass es außer Robben, Wale, Eisbären und Fische keine anderen Nahrungsmittel auf Grönland gibt. Die Inuit ernteten für ihre Aufklärung viele angeekelte Blicke von den EU-Parlamentariern.
Ähnlich war es bei den Walen, die mit zunehmend ausgeklügelter Geschoß- und Verarbeitungstechnik der Walfangflotten an den Rand der Ausrottung gerieten: Hier kam die Rettung durch eine Langspielplatte mit „Walgesängen“, die der Navy-Ingenieur Frank Watlington auf den Bermudas beim Testen eines neuen Unterwassermikrophons zur Ortung von U-Booten aufgenommen hatte. 1970 verkaufte allein „National Geographic“ 11 Millionen Exemplare davon. Seitdem gibt es nicht nur von den besonders gesangsfreudigen Buckelwalen, sondern auch von anderen Walarten Aufnahmen ihrer „Gesänge“. Für die Meeressäuger fielen dabei immer mehr „Walschutzgesetze“ ab. Und Walschützer wie „Greenpeace“ und „Sea Shepherd Global“ jagen inzwischen die letzten Walfangschiffe mit der knappen Ressource Aufmerksamkeit, während immer mehr Walfänger sich zu Guides von „Whale Watchern“ umpositionieren. In den Walschutzzonen sind die großen Meeressäuger inzwischen handzahm geworden, wie der Leiter des Wissenschaftszentrums Umwelt der Universität Augsburg Jens Soentgen in seinem Buch „Ökologie der Angst“ (2018) berichtete.
Eisbären, Walen und Robben ist nicht nur gemeinsam, dass sie in der Arktis leben, lange Zeit von Europäern aus Gewinnsucht gejagt wurden und nun einen gewissen Schutz genießen, es gibt dort auch noch die von der Jagd auf sie lebenden Ureinwohner: Inuit vor allem – in Neufundland, Alaska, Nordostsibirien und Grönland.
1951 besuchte der Mediziner Johan Hultin das Dorf Brevig in Alaska, 1997 flog er noch einmal in den Ort, anschließend berichtete er: „Das Leben hat sich dort grundlegend geändert. 1951 hatten sich die Dorfbewohner noch weitgehend selbst versorgt, viele von ihnen hatten noch die alten Walfang- und Jagdtechniken beherrscht. 46 Jahre später gehörte dies alles der Vergangenheit an, die meisten Menschen lebten von der Sozialhilfe, und so war das Dorf, das immer noch einsam über der eisgrauen See lag, mittlerweile ein trauriger, hoffnungsloser Ort. Die Bewohner hatten ihren Stolz verloren.“
Ähnlich war es auf der anderen Seite der Beringstrasse, auf den Aleuten und in Nordostsibirien, wo die Berliner Filmemacherin Ulrike Ottinger ihren zwölfstündigen Dokumentarfilm „Chamissos Schatten“ (2016) drehte. Mit der Auflösung der Sowjetunion war dort die riesige Walfangflotte stillgelegt worden, auf denen die Arbeiter einen Blauwal in 30 Minuten zerlegen konnten, gejagt wurde er mit Kanonenharpunen, die beim Eindringen Luft in seinen Körper pumpten, so dass er nicht unterging. Die dortigen Küstenbewohner mußten ab 1992 wohl oder übel wieder auf ihre alten Jagdtechniken zurückgreifen, wollten sie nicht verhungern, und so gingen sie mit Gewehren und Ruderbooten mit Außenbordmotor auf Walfang. Ottinger zeigte eine solche Szene, die damit endete, dass die Jäger den Wal zwar töten, aber nicht bergen konnten: Er versank im Meer. Die an der arktischen Küste lebenden Russen sind inzwischen massenhaft ins Inland (zurück-)migriert.
Die als Leiterin von arktischen Tourismusexpeditionen arbeitende Schriftstellerin Birgit Lutz hat mehrmals Inuit-Siedlungen in Ostgrönland besucht, wo an der 2500 Kilometer langen Küste nur noch 2500 Menschen leben und einige Siedlungen völlig verlassen sind, seitdem die Jagd auf Wale und Eisbären fast verboten wurde und die Robbenfelle kaum noch etwas einbringen. Ihrem Bericht gab die auf Spitzbergen umweltschützerisch tätige Autorin den provokativen Titel: „Heute gehen wir Wale fangen…“ (2017). Sie interviewte darin u.a. die auf Grönland geborene dänische Reiseorganisatorin Pia Anning Nielsen: „Seitdem die Jagd keine Perspektive mehr für die Menschen hier ist, sind sie nicht mehr stolz. Jetzt können sie sich nicht mehr selbst versorgen, weil der Preis für die Robbenfelle trotz Subventionierung durch die dänische Regierung zusammengebrochen ist.“ Die letzten Jäger schießen zwar weiterhin Robben, 20-30 pro Tag mitunter, aber vor allem zur Versorgung ihrer Schlittenhunde. Ansonsten verfallen immer mehr Inuit dem Alkohol und von den männlichen Jugendlichen verüben immer mehr Selbstmord. Der Hauptgrund dafür wird in ihrer Erziehung zum Jäger gesehen, das ihnen kein Auskommen mehr ermöglicht. Und dennoch wissen alle Grönländer, die weißen Tierschützer, angefangen mit Brigitte Bardot, haben ihnen zwar ihre Erwerbsgrundlage entzogen, aber deren Öko-Tourismus ist nun vielleicht eine „Chance“.
.

.
Bei Walen und Eisbären werden heute auf internationaler Ebene für die Subsistenzjagd der Inuit Quoten zugeteilt: 2014 wurden von neun Walarten in Grönland 3297 erlegt. Von den Eisbären wurden im selben Jahr 143 erlegt. Deren Felle werden nun immer teurer, bis zu 3000 Euro, weil es eine steigende Nachfrage in China gibt. Birgit Lutz findet es unterstützenswert, dass die Inuit weiterhin Robben und Kleinwale jagen, aber da sie sich auf Spitzbergen bei ihrer Arbeit für den Schutz der Eisbären engagiert, fällt es ihr schwer, in Ostgrönland nun Sympathie für die letzten Eisbärenjäger aufzubringen.
Bei den Fischen haben die Inuit keine Fangbegrenzung, wohl aber die großen Fischfangflotten, die das mit Quoten und bei ihren Netzen mit der Maschenweite regeln, durch die die kleineren Kabeljaus entkommen können. Das ständige Wegfangen der großen hat zur Folge, dass die Fische immer kleiner werden und früher geschlechtsreif. Die Helgoländer Fischforscher vom Alfred-Wegener-Institut haben eine Dependance auf Spitzbergen, wo sie die „Habitate und Migrationen“ von Fischen untersuchen. Wegen der Überfischung und der Klimaerwärmung nehmen die Migrationsbewegungen unter Wasser zu.
Die deutsche und englische Fischereiflotte war im 20. Jahrhundert vor allem davon betroffen, dass es Island nach drei sogenannten „Kabeljaukriegen“ gelang, seine Fischereigrenzen von nahezu Null auf 200 Seemeilen zu erweitern. Die DDR-Fischereiflotte flog wegen der Erweiterung der Fischereizonen 1976 „aus der Nordsee“, wie der Autor eines Buches über „Heringe“ Holger Teschke 2014 schrieb. Inzwischen geht auch den Isländern immer weniger Kabeljau, Rotbarsch und Schellfisch ins Netz, vom ehemaligen Armeleute-Fisch Hering zu schweigen. Dafür wandern jedoch immer mehr Makrelen nordwärts – bis nach Island. Dort werden die Schwärme von isländischen Fischern gefangen. Diese invasive Art ist ihnen also hochwillkommen. Die Fischer in der EU möchten aber auch den Makrelenschwärmen nachfolgen, die isländischen Kollegen sind jedoch schneller. Die EU drohte deswegen Island mit Sanktionen. Der Klimawandel habe das Verbreitungsgebiet der Tiere verändert, verteidigt sich und seine Fischer Islands Fischereiminister: „Große Mengen von Makrelen fallen in unsere Gewässer ein. Das sind gierige Tiere, die auch anderen Arten Futter wegnehmen. Island hat Anspruch auf einen gerechten Anteil von dieser wandernden Art. Das kann niemand bestreiten.“
Ähnlich ist es mit der aus dem westlichen Atlantik stammenden Schneekrabbe, eine Delikatesse, für die Norwegen in der Barentssee, wo die Krabben erst 1996 gefunden wurden, ein exklusives Fangrecht beansprucht und deswegen zwei baltische Schiffe, die dort mit Lizenzen der EU nach der Krabbe fischten, kurzerhand kaperte.
Auch die arktischen Vögel migrieren: So z.B. die Papageientaucher, die immer wieder ihre Nistfelsen aufgeben müssen, weil ihre Nahrung, die Sandaale, wegen des wärmer gewordenen Wassers, abwandern. Dafür wandern einige Arten ein oder kommen wieder – u.a. Mücken, im Südosten Grönlands laufen die Leute mit Netzen auf dem Kopf herum, wie der Gletscherforscher Robert Macfarlane in seinem Buch „Im Unterland“ (2019) berichtet. „Vor 20 Jahren gab es hier noch gar keine Mücken.“
In Ostsibirien kommen aufgrund des tauenden Permafrostbodens Milzbrand-Bakterien wieder hoch – zusammen mit den vor 70 Jahren daran gestorbenen Rentieren. Russische Tierärzte impften vorsorglich Rentiere und Hirten. „Es sind neue Tierarten zu uns gekommen, während alte verschwunden sind, das Jagen wird immer schwieriger,“ berichtete ein Grönländer Macfarlane. Für den englischen Autor zählt die Arktis zu den „vorrangigen Gebieten, in denen das Schicksal des Eises die zukünftigen Geschicke des Planeten bestimmt“.
Da sich dort russisches und amerikanisches Expansionsstreben immer näher kommen, könnte auch der militärische Aufmarsch in der Arktis uns noch schicksalhaft mitspielen, wenigstens, wenn man dem italienischen Arktisexperten Marzio Mian in seiner Darstellung „Die neue Arktis: Der Kampf um den hohen Norden“ (2019) folgt. Die Inuit auf Grönland und in Alaska haben bereits den Untergang ihrer Kultur vor Augen. Ebenfalls 2019 wurde deswegen der Expeditionsbericht des holländischen Verhaltensforschers und Nobelpreisträgers Niko Tinbergen über seinen einjährigen Aufenthalt in Ostgrönland 1932/33 auf Deutsch veröffentlicht, unter dem Titel „Eskimoland. Ein Bericht aus der Arktis“ Damals gab es in der dänischen Kolonie Grönland noch als nomadische Jäger autark wirtschaftendeInuit, wie er schreibt. Sind sind im Gegensatz zu uns, die wir immer mehr zu „Spezialisten“ werden, bewundernswerte „Generalisten“, die alles, was sie zum Leben brauchen, selber herstellen. Das ging so weit, dass sie zwar komplizierte Geräte wie Gewehr, Kamera und Fernglas bewunderten, wenn sie aber erfuhren, dass ihr Besitzer diese Dinge nicht selbst hergestellt hatte, verwandelte sich „ihre Bewunderung in eine Art mitleidiges Schulterzucken.“ Die Feldarbeit von Tinbergen und seiner Frau bestand darin, dass sie mit Hilfe eines Schamanen, bei dem sie wohnten, Grönländisch lernten und im übrigen versuchten, es den Inuit im Alltag nachzutun. Mit Unterbrechungen hat auch die Schriftstellerin Birgit Lutz ein Jahr lang in Ostgrönland für ihr o.e. Buch recherchiert. Ihr zufolge nahm „das Unheil nach dem Zweiten Weltkrieg seinen Lauf mit der Modernisierung Grönlands,“ als die Bevölkerung in die Städte umgesiedelt wurde: 1951 lebten noch fast 70 Prozent der Menschen in Dörfern, 2010 nur noch 15 Prozent. Sie verloren dadurch ihre Jagdgründe, ihres Lebensweise und ihre Dorfgemeinschaften. „Jagdnomade zu sein, wurde verboten, man mußte einen festen Wohnsitz haben.“
Auf der sibirischen Jamal-Halbinsel folgen die dort lebenden Nenzen im Sommer ihren halbwilden Rentierherden nach Norden und gegen Winter nach Süden. Mit dem Ausbau einesriesigen Erdgas-Förderzentrums werden die Wanderrouten der Rentiere erheblich beeinträchtigt und damit ihre Bewirtschaftung durch die nenzischen Hirten, aber es entstehen viele neue Arbeitsplätze. Im Autonomen Kreis der Jamal-Nenzen sind die Löhne inzwischen so hoch wie in der BRD. Die ARD berichtete: „Der Klimawandel macht es möglich: Russland fördert immer mehr Gas am Polarkreis. Inzwischen treffen die nenzischen Nomadinnen und Nomaden auf ihren Wanderungen auf zerstörte Natur und gigantische Industrieanlagen. Doch nicht alle Nenzen sind darüber unglücklich. Denn ihren Kindern eröffnen sich nun auch neue Chancen.“ Auf seiner Internetseite wirbt Gazprom für sein „Megaprojekt Jamal“ aber weiterhin mit einer wandernden Rentierherde. Neben der Halbinsel befindet sich in der Barentssee die Insel Kolgujew, auf der kaum noch Erdöl gefördert wird und die dort lebenden 500 Bewohner mangels Abnehmer auch kaum noch Rentiere züchten, daneben sind auch etliche andere Lebensbereiche vom Rückzug des Staates dort betroffen. Der Schriftsteller Wassili Golowanow hielt sich mit Unterbrechung ein Jahr auf Kolgujew auf. Sein Buch darüber „Die Insel“ erschien 2012 auf Deutsch. Der Autor beschreibt darin, wie die Nenzen dort zuerst durch die sowjetische Politik von ihrer alten Lebensweise abgebracht wurden und wie sie nach Auflösung der UDSSR auf überwunden geglaubte und halb vergessene Wirtschaftsweisen zurückgreifen müssen, während die Insel verwahrlost.
P.S.: Zwei interessante Bücher über die Arktis – eine Reportage und eine Kulturgeschichte – seien hier noch erwähnt, die leider beide den russischen Teil der Arktis etwas vernachlässigen, z.T. aus westlicher Borniertheit und antikommunistischer Einstellung: „Die neue Arktis: Der Kampf um den hohen Norden“ von Marzio G. Mian (2019) und „Die Erfindung des Nordens. Kulturgeschichte einer Himmelsrichtung“ von Bernd Brunner (2019).
.

Rentiernomade auf Kolgujew
.
Waschbären in Deutschland
Mindestens seitdem der Strom der „Wirtschaftsflüchtlinge“ (heute „Refugees“ genannt), nach Lampedusa einsetzte, hat sich der Streit, ob Deutschland ein „Einwanderungsland“ ist oder sein sollte, auf Tiere und Pflanzen ausgedehnt, wenn nicht gar verlagert. Kaum ein Tag, an dem nicht irgendein Massenmedium mit neuen „Erkenntnissen“ über „invasive Arten“ aufwartet und Ratschläge gibt für einen durchaus vernünftigen Umgang mit ihnen. Der TV-Sender Arte schickte mir neulich schon unaufgefordert seinen Film „Invasion der Pflanzen. Gefahr für Umwelt und Mensch“ zu. Das „Neue Deutschland“ veröffentlichte eine ausschließlich der Vernunft verpflichtete Zusammenfassung der Debatte über tierische und pflanzliche Ausländer: „Die Mehrheit der Wissenschaftler ist dabei einer Meinung: Invasive Arten sind in der Summe als kritisch für das Ökosystem anzusehen.“ Dazu scheint für den ND-Autor auch die Menschenwelt zu zählen – ja, vor allem sie, denn als Beispiele erwähnt er einige ausländische Pflanzen, die sich hier, einmal eingeschleppt, unglaublich vermehren – und „Allergien, Hautausschläge“ etc. hervorrufen. Es gibt inzwischen ganze Sondereinheiten – auf Basis von 1-Euro-Jobs, die mit Schutzanzügen anrücken, um sie auszurotten. Die gleichen, für Menschen unangenehmen Pflanzen sind jedoch bei den Bienen äußerst beliebt, weswegen sie z.B. von den Imkern geschätzt werden: Sie protestieren gegen ihre „sinnlose Vernichtung“.
Bei den Tieren werden u.a. die aus Amerika importierten und ab 1929 in Westdeutschland ausgewilderten bzw. 1945 aus einer zerbombten Zuchtfarm in Ostdeutschland entkommenen Waschbären erwähnt: „Sie dezimieren die hier heimische Vogel- und Amphibienwelt.“ Ihnen treten die Jäger entgegen, indem sie regelmäßig eine sogenannte „Bestandsregulierung“ vornehmen. Der Waschbär darf hierzulande ganzjährig gejagt werden. Allerdings muß man jedes tote Tier amtlich registrieren lassen. 2013 wurden allein in Berlin und Brandenburg 20.300 Waschbären „erlegt“. Das Brandenburger Agrarministerium bilanzierte dies als eine Art wirtschaftspolitischen Erfolg: „In nur vier Jahren verdoppelte sich die Strecke…“ Gemeint ist mit diesem Jägerdeutsch-Euphemismus die Zahl der erlegten Tiere, die nach dem Halali vermüllt werden, denn wer will heute noch mit so einer albernen Waschbärmütze mit Schwanz hintendran oder gar mit einem ganzen Waschbär-Pelzmantel herumlaufen? Ersteres trugen nach dem Krieg die verhinderten Trapper, letzteres die ungehinderten Zuhälter.
Auch in den anderen Bundesländern mußten wieder zigtausende von Waschbären dran glauben. Dennoch warnte eine Schweizer Zeitung: „Waschbär ist auf dem Vormarsch Richtung Südostschweiz“. Die FAZ titelte: „Die Rasselbande zerstört alles“, der „Spiegel: „Randale unterm Dach“, und die „Welt“: „Terror-Waschbären richten immense Schäden an“. Die „Zeit“ pries gar die unsere Wälder von diesem Schädling befreienden Jäger als verantwortungsvolle Ökologen – mit der Überschrift: „Von wegen Spaß am Tiere-Töten.“ Im „Merkur“ priesen sich daraufhin die Jäger selbst: „Wir sind Naturschützer“. Darüberhinaus finden sich im Internet mittlerweile hunderte von Seiten über (technische) „Schutz- und Abwehrmaßnahmen“, so dass selbst Nichtbewaffnete gegen die Waschbären aktiv werden können. Daneben findet man aber auch anrührende Feuilletons – z.B. von Rentnern, bei denen eine Waschbärfamilie auf dem Dachboden oder im Kamin lebt. Zuletzt war von einem Waschbär die Rede, der sich auf dem Weihnachtsmarkt in Erfurt betrunken hatte. Alle waren empört, als ein Jäger ihn an Ort und Stelle erschoß.
Der „Anti-Jagdblog“ gibt unter der Überschrift „Jäger erlegen so viele Waschbären wie nie zuvor“ zu bedenken, dass noch einmal so viele alljährlich überfahren werden. Die Tierschützerin Marianne schreibt: „Ja, dieses Brandenburg ist landschaftlich schön, nur leider ist es das Land, mit der größten Dichte an Mördertürmen, Fallen, Kirrstellen, Ansitzen und Mörderpack. Am Rande von Berlin und Potsdam sind die Wälder gespickt mit Blutbader [Jägern] und trotzigen Bauwerken [Hochständen], die den Wildtieren den Garaus machen. Der Minister ist selbst Blutbader und Befürworter der Massentierhaltung. Leider sind die Brandenburger nicht sehr aufgeklärt, aber zum Glück werden die Jagdgegner immer mehr.“ Neben den Jägern und den Wirtschaftsförderern sind es vor allem die Singvogel-Freunde und Besitzer von Obstbaumgärten, die etwas gegen Waschbären haben.
Auf der anderen Seite verhält es sich bei den Waschbär-Forschern so wie bei allen Erforschern von Tierarten: Sie sind von ihren im Grunde harmlosen und ebenso rührenden wie klugen Untersuchungsobjekten derart eingenommen, dass sie sich mit der Zeit gradezu zu ihren Sprechern, Waschbärensprechern, aufschwingen. Dies gilt z.B. für den Biologen Ulf Hohmann und den Tierphotographen Ingo Batussek. Für ihren Forschungsbericht „Der Waschbär“ (2011) beobachteten sie im Sollinger Forst bei Höxter jahrelang den nachtaktiven, gerne auf großen Eichen lebenden Kleinbären mit ihren Nachtsichtgeräten, sie fingen sich welche in Fallen und statteten sie mit Sendern aus oder ließen sie von Diplomstudentinnen großziehen, damit sie das Verhalten dieser halbzahm gewordenen Tiere später auch noch in Freiheit bequem, quasi von Nahem, studieren konnten. Diese Mischung aus Zoo- und Feldforschung wandte bereits Konrad Lorenz erfolgreich bei Graugänsen an, von denen eine, Martina, es zur Berühmtheit brachte.
Den Göttinger Waschbärforschern wurde diese etwas aufwändige Methode von der NDR-Redaktion „Expeditionen ins Tierreich“ finanziert. Die Jungtiere dafür erwarben sie bei einem sauerländischen Waschbärzüchter. Ihre „handaufgezogenen“ Waschbären galten den Forschern schon bald als „Botschafter in eigener Sache“. Im Internet werden heute jede Menge Waschbären angeboten: „albino, blonde, elfenbeinfarbene und naturfarbene“. Auf einer Internetseite fand ich den Hinweis: „Zuerst sollten Sie genau wissen, was Sie sich holen, wenn Sie einen Waschbär kaufen. Wussten Sie, dass ein Waschbär Ihr Anwesen zerstören kann, wenn Sie ihn nicht richtig pflegen? Zum Beispiel ist es bekannt, dass Waschbären Kabeldrähte ausgraben. Außerdem sind sie kaum zu zähmen…“ Das ist nicht unbedingt eine Werbung für den Waschbär als Haustier.
.

.
Selbst die Waschbärliebhaber Hohmann und Bartussek geben unumwunden zu: „Der Waschbär ist kein Haustier und wird es nie werden. Daran ändern auch die Beteuerungen so mancher Tierhändler nichts.“ Das hält sie jedoch nicht davon ab, im letzten Kapitel ihres Buches „Tipps und Tricks zu Aufzucht und Haltung von Waschbären“ zu geben – und sich sogar zu fragen: „Doch als Haustier?“ Dazu heißt es: „Wenn man sich entschlossen hat, Waschbären im Haus zu halten, muss bedacht werden, dass wir für unseren Pflegling fortan seine ‚Waschbärgruppe‘ sind.“ Und das bedeutet u.a., dass wir als „Sparringpartner“ für seine wilden Beiß- und Kratz-Spiele herhalten müssen, dafür sind wir Menschen aber zu dünnhäutig: „Nur ein robuster, im Haus lebender Hund kann diese Aufgabe übernehmen.“ Mit dem Kauf eines Waschbären sollte man sich also am Besten auch noch gleich einen großen Hund anschaffen. Die beiden Waschbärenforscher haben das selbst ausprobiert – und können deswegen lustige Geschichten darüber erzählen. Einen kastrierten Waschbär namens Willi ließen sie fast ein Jahr lang Nachts raus, das sei in einem bewohnten Gebiet jedoch nicht zu empfehlen, meinen sie, denn „die Tierliebe und Toleranz sämtlicher Nachbarn wurde dabei auf eine harte Probe gestellt.“ Am Stadtrand von Berlin sehen dagegen viele Bewohner rot, wenn sie einen Waschbären in ihrem Garten erblicken: Sofort rufen sie einen Jäger an, der ihnen das Tier mit einer Falle wegfängt – und tötet.
In meiner Familie hatten wir immer viele Tiere, dabei wurde kein großer Unterschied zwischen Mensch und Tier gemacht. Heute würde ich auch die Pflanzen da mit einbeziehen, der Vegetarismus ist also keine Option für mich. Beim Waschbären würde ich auch erst einmal – wie die beiden Waschbärenforscher – eine „Inklusion“ ins Auge fassen, wobei mir bewußt wäre, dass Waschbär nicht gleich Waschbär ist. Das Prinzip „Kennst du einen, kennst du alle“ gilt gerade bei Waschbären nicht: Jeder ist auf eine andere Art gewaschen.
Und im übrigen waschen sie ihre Nahrung gar nicht vorm Verspeisen, sondern suchen gerne unter Wasser nach Eßbarem (kleine Krebse z.B..). Dazu haben sie hypersensible Vorderpfoten: „Der Tastsinn ist die unumstrittene Geheimwaffe des Waschbären,“ schreiben Hohmann/Bartussek, „kein anderes Tier reserviert sich für die Interpretation der taktilen Reizimpulse aus den Handflächen so viel Hirnmasse wie der Waschbär.“ Er hat dafür genau „so viele graue Zellen, wie wir für die Reizverarbeitung unseres wichtigsten Sinnesorgans, des Auges, bereithalten.“ Mit der Folge: Wenn Waschbären im Wasser herumtasten „blicken sie ins Leere und wirken dabei merkwürdig abwesend.“ Neben ihrem Tastsinn ist aber auch ihr Geruchssinn „ausgezeichnet“: zwei Sinne, die wir eher vernachlässigen – seit einigen zigtausend Jahren schon. Ein Waschbär wäre in dieser Hinsicht also eine sinnvolle Ergänzung zu uns. Das wollte ich hier nur mal zu bedenken geben – an die Adresse der Gebildeten unter den Waschbärverächtern.
.

Albino-Waschbär. Photo: WWF-Deutschland
.
Schützt das Weißwerden?
In der Tierwelt gibt es abgesehen vom Artensterben einen Trend, in Städten zu leben – mit „Duldungsstatus“, oder zu wandern – invasiv zu werden. Neuerdings gibt es noch den Trend Albino-Werden. Es gibt kaum noch eine Tierart, bei der nicht Albinos geboren werden. Einige Forscher erklären sich das wohlfeil mit der Klimaerwärmung. So beschäftigen sich gleich zwei Studien mit ihrem Einfluß auf Wildschafe: Früher war es günstig, ein schwarzes Schaf zu sein. Das dunkle Fell speicherte mehr Sonnenwärme und es brauchte weniger Futter. Inzwischen bietet das Dunkelsein vielerorts keinen großen Vorteil mehr, mit der Folge, dass sich die hellen Schafe durchsetzen.
Die Klimaerwärmung ist ebenso wie die Albinisierung (auch die von Menschen) ein Phänomen des Anthropozäns. Im Gegensatz zu den hellen Schafen leben die Albinos allerdings nicht so lange und leiden unter ihrem sogenannten „Gendefekt“. „Schuld an ihrem Aussehen ist ein fehlendes Gen,“ heißt es auf „weltderwunder.de“. „Es produziert normalerweise den Hautfarbstoff Melanin. Ohne das Gen kommt es zu einer Stoffwechselstörung der Pigmentzellen, außerdem haben Albinos eine hohe UV-Empfindlichkeit. Nur wenn beiden Eltern das verantwortliche Gen fehlt, können Albino-Kinder gezeugt werden.“ Die „Krankheit“ kann nicht geheilt werden.
Mangels Melanin müssen Albinos die Sonne meiden und haben ein beeinträchtigtes Sehvermögen. Außerdem bekommen sie leicht Hautkrebs. Für in Afrika geborene menschliche Albinos besteht zudem die Gefahr, dass man sie umbringt, weil sie Unglück bringen oder im Gegenteil, weil Teile ihres Körpers Glück bringen. Europäer halten das für Aberglaube, es gibt jedoch Hinweise, dass sie so oder so als Ersatz für weiße Europäer herhalten. Einigen dieser armen Albinos gelingt es neuerdings, im weißen Showgeschäft, als Model z.B., Fuß zu fassen.
Den albinisierten Tieren geht es nicht viel besser: „Im Tierreich führt die weiße Färbung zu erheblichen Einschränkungen der Fitness,“ schreibt „lernhelfer.de“ . Auch sie werden teilweise aus ihren sozialen Zusammenhängen verstoßen, zudem mit ihrer Farbauffälligkeit leicht zur Beute von Raubtieren. Raben von Greifvögeln und Nagetiere von Eulenvögeln z.B.. Auch Trophäenjäger schießen gerne Albinos, bei den meisten Menschen sind sie jedoch noch eine Sensation und Attraktion, sie werden behütet und betätschelt. „Der Markt wird derzeit überschwemmt mit ihnen,“ heißt es auf „Planet Zoo“, in Österreich eröffnete bereits ein „Weißer Zoo“ – nur mit Albinos. Aquarianern wird geraten, Albinos sofort nach der Geburt von den Eltern zu trennen, da diese sie sonst auffressen. Als Züchtungsziel sollte eine solche „Qualzucht“ eigentlich verboten sein.
Es gibt Elch- und Karibu-Albinos in Kanada, Koala- und Känguru-Albinos in Australien (die in den dortigen Zoos täglich mit Sonnencreme behandelt werden müssen), Albino-Wale im Pazifik, Panda- und Tiger-Albinos in China und in Europa Bären-, Wolf-, Wildschwein-, Hirsch- und Reh-Albinos, sowie albinisierte Störe (deren Kaviar weiß ist). Im Internet findet man noch Vogelspinnen- und Maulwurf-Albinos. Als unter der Erde lebende Tiere hätten letztere wie die Grottenolme und Nacktmulche schon längst auf Pigmente verzichten können, jetzt bekommen die Weibchen aber gelegentlich Albinos. Es gehört dies mit zur allgemeinen Verweißlichung der Welt. Das Anthropozän ist im Wesentlichen eine Herrschaft der weißen alten Männer, die bis in alle Ewigkeit und auf allen Planeten den „Fortschritt“ sichern wollen, d.h.: Alles muß verweißlicht werden.
Genetikern der Universität von Georgia gelang es, mit der „Genschere Crispr/Cas9“ in 146 Eizellen bei 21 Eidechsenweibchen eine Genmutation einzuschleusen, die die Anolis-Echsen zu Albinos machte. „Das Überaschende jedoch: ‚Etwa die Hälfte dieser mutierten Echsen hatte die veränderte Genvariante sowohl im mütterlichen wie im väterlichen Allel. Vier der Tiere waren daher echte Albinos mit weißer Haut und rosa Augen, die restlichen fünf waren heterozygot und daher trotz einer mutierten Genvariante im Erbgut normal gefärbt‘,“ berichtete der Teamleiter auf „wissenschaft.de“. Von einer Gen-Mutation auszugehen, ob künstlich oder zufällig entstanden, reicht nicht zum Verständnis des massenhaften „Albino-Wunders“.
Der vor der antigenetischen Politik des „Lyssenkoismus“ in der Sowjetunion nach Sibirien ausgewichene Genetiker Dimitrij Beljajew fing 1959 an, auf einer Pelztierfarm Domestikationsversuche mit Silberfüchsen durchzuführen. Er wollte beweisen, dass man „soziale Intelligenz“ und Zahmheit (die den Tierpflegern die Arbeit erleichtern würde), züchten kann. Einzig, indem man den jeweils zutraulichsten Fuchs eines Wurfs weiter vermehrt, d.h. ohne Kontakt mit ihm aufzunehmen undtrotzdem eine „Selektion auf Kommunikation“ durchzuführen. Nach 35 Generationen und 45.000 Silberfüchsen war Beljajew am Ziel: die Füchse waren domestiziert! Aber sie hatten sich dabei körperlich verändert: Sie hatten Schlappohren, bellten, wedelten mit dem Schwanz und bekamen weiße Flecken – wie so viele Haus- und Nutztiere: von den weißen Labortieren (Mäuse, Ratten) über Hunde und Katzen bis zu den Schlachtvögeln und Rindern.
Als Pelztiere waren die sibirischen Füchse mit ihren weißen Flecken nicht mehr zu gebrauchen. Ludmilla Trut, die Assistentin von Beljajew, der 1985 starb, führte die Zucht weiter, nach dem Zerfall der Sowjetunion mit amerikanischen Geldern. Die zahmen Füchse werden nun in den USA als Haustiere vermarktet, wie sie in ihrem Buch „Füchse zähmen“ (2018) schreibt. Dort heißt es: „Gern hätte Beljajew sein populärwissenschaftliches Buch ‚Ein neuer Freund für den Menschen‘ geschrieben.“ In einem Clip auf Youtube führt ihre Doktorantin Irina Mukhamedshina einen der Füchse an der Leine durch die Stadt: „This Siberian Fox can be your next pet“ (für 5000 Dollar). Ist das der Beginn eines anthropozentrisch injizierten Albinismus? fragte ich einige Biologie Studierende, aber die Albinos waren ihnen noch kein Thema. Wohl aber Füchse. Nicht nur sind es die beliebtesten Wildtiere in der Stadt, auch in den Wäldern passiert es in letzter Zeit immer mal wieder einem Forstangestellten, das sich ihm ein kleiner Fuchs aus einem Wurf nähert und die beiden sich fortan näher kommen, so dass sich eine z.T. jahrelange Freundschaft entwickelt. Es gibt darüber bereits mehrere Bücher von den derart beglückten Forstleuten. Die Füchse bekommen davon keine weißen Flecken, aber vielleicht ihre zahmen Nachkommen. Wenn in der Stadt lebende Füchse zahm werden (im Prinzenbad z.B.), erschießt man sie.
Der Albinismus kann im übrigen auch Pflanzen betreffen – vor allem Cannabis, wie „zamnesia.org“ berichtet. „Bei Pflanzen ist er gekennzeichnet durch einen teilweisen Verlust von Chlorophyll (die Pflanzen ihre grüne Färbung verleihen), sowie von roten und gelben Pigmenten. Dieser Mangel an Chlorophyll beeinträchtigt ihre Fähigkeit zur Photosynthese.“
.
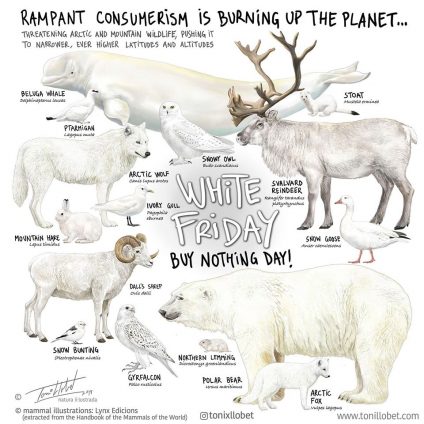
.
Der Gobibär
Man weiß nicht, ob die Absicht der mongolischen Regierung, 2013 zum „Jahr des Gobibären“ zu erklären die internationale Gobibärforschung befördert hat oder ob es umgekehrt war. Fest steht, dass wir heute mehr über den seltenen Gobibär wissen als noch vor acht Jahren: U.a. dass es nur noch 20 bis 60 Exemplare dieses Tieres gibt, das von den Mongolen Mazaalai genannt wird. Sie leben in drei Gebirgszügen der westlichsten Ausläufer der Wüste Gobi – in der nahezu menschenleeren Umgebung der Oasen Baruun Tooroi und Shar Khulsny Bulag. Wegen der Wasserarmut und der unwirtlichen Landschaft finden selbst die genügsamen Ziegen in diesem Gebiet kaum genügend Nahrung zum Überleben. Eine russische Theorie besagt, dass die Tierart als Relikt aus der Borealzeit zu werten ist. Damals herrschten in der Gobi völlig andere Lebensbedingungen. Es gab große Wälder ähnlich der heutigen großen Taigawälder in Sibirien oder der Nordmongolei und das Klima war wärmer und feuchter.
Bei dem Gobibär handelt es sich um eine kleine Form des Braunbären, die heute den zentralasiatischen Isabellbären zugerechnet wird. Diese Bezeichnung bezieht sich auf ihr „isabellfarbenes“ Fell, was auf Isabella von Kastilien zurückgeht. Sie gelobte 1601, dass sie ihr weißes Hemd nicht eher wechseln wolle bis ihr Mann, Albrecht VII. von Habsburg, die Stadt Ostende, die er belagerte, erobert habe. Da die Belagerung drei Jahre, drei Monate und drei Tage dauerte, sah ihr Hemd entsprechend aus.
.

.
Auf „gobibaer.de“ heißt es, dass die „rotbraunen bis sandfarbenen“ Tiere erstmalig um 1900 von zwei russischen Botanikern entdeckt wurde, in ihrem „Feldtagebuch“ notierten sie: „Heute haben wir in den nördlichen Vorgebirgen des Cagan-Bogdo in einem trockenen und breiten Sajr… endlich einen Gobibären zu sehen bekommen. Er lief ohne Hast den Grund des Tales entlang, dunkelbraun, mit Fetzen von längerem und hellerem Haar, das nach dem Haarwechsel an dem dunkelbraunen Pelz hing. Der Bär beschnupperte etwas, war anscheinend auf der Suche nach Nahrung.“
1943 bestätigte ein mongolisch-sowjetisches Forschungsteam ihre Beobachtungen, 1953 gelang es lokalen Wissenschaftlern, ein Jagdverbot für den Gobibären durchzusetzen, 1975 wurde sein Verbreitungsgebiet in einer Größe von 52.000 Quadratkilometern zum Naturschutzgebiet erklärt: „Great Gobi Strictly Protected Area (GGSPA) heute genannt. Dass die kleine Population dennoch weiter abnahm, führen Gobibärforscher auf die Klimaerwärmung zurück, was die dort ohnehin sehr geringen Wasservorkommen weiter verringert. Vertreter der „National Commission for Conservation of Endangered Species“ der Mongolei erwägen eine regelmäßige Zufütterung sowie ihre Züchtung in Gefangenschaft. Der amerikanische Bärenforscher Harry Reynolds, der bereits 2005 zusammen mit kanadischen Biologen ein „Mongolian-American Gobi Bear Project research program“ initiierte, meint jedoch: „Das Wichtigste ist, sie in Ruhe zu lassen. Ihre Lebensweise ist derart prekär, dass die kleinste Störung ihr völliges Aussterben bewirken kann. Sie haben jedoch bewiesen, dass sie sich an extreme Lebensbedingungen anpassen können.“
Der ehemalige mongolische Umweltminister Damdin Tsogtbaatar sieht in den Anstrengungen zum Schutz des Gobibären, die ihren Ausdruck u.a. im „Jahr des Gobibären“ finden, ein Beispiel für einen anderen Umgang mit Tierarten, die wir an den Rand des Aussterbens gebracht haben. Das beinhaltet, dass es die Menschen (Jäger) waren, die die Gobibär-Population derart reduzierten. Der Umweltminister erinnerte in diesem Zusammenhang an die wilden Przewalski-Pferde, die in den Sechzigerjahren in der Mongolei ausgerottet wurden. Nur 12 überlebten – in europäischen Zoos, von wo aus ihre Nachkommen in den Neunzigerjahren wieder in der mongolischen Steppe ausgewildert wurden.
Beim Gobibär halten sich die direkten Beobachtungen bis heute in Grenzen. Es existieren nur wenige Fotos und seit 2004 ein bißchen Filmmaterial – als es gelang, Aufnahmen mit einer automatischen Kamera zu machen. Die sichersten Nachweise lieferte ein amerikanischer Genetiker in den achtziger Jahren, der durch das Auslegen von Drähten an vorher eingerichteten Futterstellen Haare gewinnen konnte. Leider war es aber auch damals nicht möglich, die Tiere direkt zu beobachten. Genetische Untersuchungen erbrachten jedoch einen Beweis dafür, dass es sich um eine eigene Tierart handelt. Zweifelsfrei konnten 13 verschiedene Individuen identifiziert werden.
Über die Lebensweise dieser TieSenckenberg-Museums für Naturkunde in Görlitzre ist noch immer so gut wie nichts bekannt. „Man weiß nicht zweifelsfrei, ob die Bären tag- oder nachtaktiv sind, wo sie überwintern, ob sie in Gruppen leben oder Einzelgänger sind. Selbst über die Ernährungsweise herrscht Uneinigkeit. Während russische Zoologen von einem sich überwiegend von Fleisch ernährendem Tier ausgehen, sehen mongolische Forscher den Gobibären als Pflanzenfresser, welcher als Hauptnahrung Bajuun-Wurzeln (dt. Kleiner Rhabarber, lat. Rheum nanum) im Frühjahr, ansonsten Beeren und andere Pflanzen zu sich nimmt.“ Dieser wilde Rhabarber war einst auch ein begehrtes Nahrungsmittel am Hof von Tamerlan in Samarkand.
Die Internetseite „gobibaer.de“ wird vom Landesbund für Vogelschutz in Bayern geführt, dieser finanzierte auch ein „Schutz- und Informationszentrum für den Gobibären in der Mongolei“, das 2012 eröffnet wurde – zusammen mit der Nationalen Universität der Mongolei in Ulaanbaatar und der Schutzgebietsverwaltung des Großgobi-Naturschutzgebietes, Bayuntooroi.
„Von diesem Zentrum aus sollen konkrete Schutzmaßnahmen zum Erhalt des höchst bedrohten Gobibären gestartet werden.“ Im Vorfeld hatten die deutschen Gobibärschützer 2008 und 2009 bereits zwei „Expeditionen“ in das Verbreitungsgebiet des Gobibärs unternommen:
„Die Expeditionen haben klar gezeigt, dass eine dringende Notwendigkeit besteht, für den Gobibären etwas zu unternehmen. Wir konnten frische Spuren finden, was bedeutet, dass der Bär noch in der Transaltaigobi vorkommt. Wir konnten ferner eine hohe Akzeptanz der örtlichen Bevölkerung und wichtiger Entscheidungsträger in der Mongolei erfahren. Das sind die Voraussetzungen vor Ort, um eine Station aufbauen zu können, die zum Überleben des Gobibären essentielle Voraussetzung sind.“
Bei der Konkretisierung des Projekts waren sich die deutschen und mongolischen Gobibärschützer nicht immer einig: „Wir haben in allen Gesprächen deutlich gemacht, dass es sich bei unserem Projekt um den Schutz des Gobibären in seinem Lebensraum handelt. Etwa 30 km von Bayantooroi entfernt hat eine mongolische Initiative einen anderen Weg zum Erhalt des Gobibären eingeschlagen. Es wurde eine Zuchtanlage gebaut, die aus engen Betonkäfigen bestehen und wo es gelingen soll den gefährdeten Gobibären zu züchten. Dazu sollen wilde Bären gefangen werden und hierher verbracht werden. Da nur wenig über die Biologie der Art überhaupt bekannt ist, die Populationen sehr klein sind und deshalb die Auswirkung von Wildfängen kaum vorhersehbar sind, wird dieses Vorhaben von uns strikt abgelehnt.“
Um weitere Gelder für das Gobibär-Zentrum zu acquirieren, produzierte der bayrische Landesbund für Vogelschutz e.V. einen Film über den Verlauf seiner zwei Expeditionen: „Mazaalai – Auf den Spuren des Gobibären“, man kann ihn als DVD beim bayrischen Landesbund für Vogelschutz bestellen. Auch die Wissenschaftler des Senckenberg-Museums für Naturkunde in Görlitz sind hinter dem Gobibär her, sie forschen schon seit 15 Jahren in der Mongolei.
.

Gobibär im Zoo. Photo: Wikipedia
.
Berlins Pandakottchen
Der Medien- und Besucherrummel um die zwei Pandas im Westberliner Zoo ist peinlich und peinigend. Und das nicht erst seit der neue Direktor den alten Pandaglaskäfig abreißen und für 250.000 Euro eine ganze „Panda-Landschaft“ bauen ließ, um sodann für eine Million Euro jährlich das Pärchen „Meng-Meng und „Jiao Quing“ zu leasen. Dazu gehört auch ihr möglicher Nachwuchs, von dessen gedeihlicher Entwicklung im Mutterleib die Zootierärzte sich nun quasi täglich überzeugen. Ich weiß nicht, ob das im Leasingvertrag steht, aber es wurde jetzt auch noch eine „Expertin für Hormonanalysen“, Pairi Daiza, hinzugezogen, die bereits die Geburt von Pandazwillingen in Belgien begleitet hatte, ferner ein „Fortpflanzungsexperte aus Chengdu“. Schon bei der Befruchtung von „Meng-Meng“ hatte man einen enormen Aufwand getrieben: Zwar besprang „Jiao Quing“ sie mehrmals und auch artgerecht, aber Dr. Thomas Hildebrandt, „Spezialist für Reproduktionsmanagement am Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung“, dem einstigen „Think-Tank“ des Ostberliner Tierparks, ließ das Weibchen überdies auch noch künstlich besamen (Besame mucho).
Ach, das ist alles so widerlich – und nicht erst seit gestern. Als Bundeskanzler Helmut Schmidt 1980 im Rahmen der chinesischen „Panda-Diplomatie“ eine Pandabärin, „Tjen-Tjen“, bekam, die er dem Westberliner Zoo übergab, intervenierte Moskau, „weil Westberlin nicht Teil der BRD war“. Die Bärin starb 1984 und wurde ausgestopft. Dem Ostberliner Tierpark hatte Moskau zuvor kostenlos einen Pandabären geliehen, der dann durch westeuropäische Zoos tourte. Der Tierparkdirektor Heinrich Dathe machte hemmungslos Werbung mit dem armen Reisepanda: Eine junge passionierte Tierfreundin, die von einer unheilbaren Krankheit befallen war, bat ihn, vor ihrem Tod den Panda sehen zu dürfen: „Wir transportierten ‚Chi-Chi‘ daraufhin in einer Kiste und trugen ihn die vier Treppen eines Wohnhauses hoch. Im Krankenzimmer ließen wir ihn frei. Die geistig noch rege Frau war glücklich. Wir legten ihre Hand auf das Fell des kostbaren Tieres [12.000 Pfund!], das sich nicht manierlicher hätte benehmen können,“ erzählte er der Hauptstadtpresse. In den Westzoo kamen als nächstes „Bao-Bao“ und „Yan-Yan“. Sie lebten nicht lange – und wurden dann vom Chefpräparator des Naturkundemuseums Detlef Matzke ausgestopft: „Wenn die Luftfeuchtigkeit stimmt und die Vitrine dicht ist, dann können die beiden locker mehrere hundert Jahre alt werden,“ erklärte er der Presse.
Im Tieranatomischen Theater auf dem Biologie-Campus der Humboldt-Universität stellte der chinesische Künstler An-Chi Cheng im Rahmen einer Ausstellung über „Mensch-Tier-Beziehungen“ einen ausgestopften Pandabären und eine Graphik aus: Sie zeigte vom ersten bis zum letzten verschenkten Pandabär, was die chinesische Regierung in den Jahren ihrer „Panda-Diplomatie“, die 1982 aufgrund weltweiter Proteste von Tierschützern beendet wurde, damit alles erreicht hat, vornehmlich im „Ostblock“: an Verträgen, Handelsbeziehungen usw.. Der ausgestopfte Pandabär im Ausstellungsbereich „Das politische Tier“, ist das, was von Helmut Schmidts „Tjen Tjen“ übrig blieb: Sie starb 1984 an einer Virusinfektion. Ob Detlef Matzke sie auch präpariert hat, weiß ich nicht. In dem Buch von Knut Holm, „Leben und Erbe Prof. Dathes“, erfuhr ich aber noch: 1958, im selben Jahr, da der Ostberliner Tierpark den Pandabären aus Moskau für kurze Zeit übernahm, wurde er auch „Kopfstation“ für Tierexporte aus der Sowjetunion: Große Transporte von Huftieren und Vögeln z.B. wurden in Brest von Tierparkmitarbeitern übernommen, zur Quarantäne nach Berlin gebracht, und von da aus an andere europäische Zoos weitergeleitet.
.

Photo vom „ersten öffentlichen Auftritt“ der beiden im Westberliner Zoo geborenen Pandas, links von ihnen an das Glas gelehnt der Zoo/Tierpark-Direktor, rechts der Gesamtberliner Bürgermeister. Die beiden Apparatschicks verkündeten an diesem Tag die Namen der beiden Tiere: Meng Xiang („Ersehnter Traum“) und Meng Yuan („Erfüllter Traum“). Sie werden die kommenden zwei bis vier Jahre in Berlin verbringen. Anschließend werden die Zwillinge zurück nach China gebracht.
.
Koalabären
So wie die sich ausschließlich von Bambus ernährenden Pandas Chinas Symboltier sind, ist der sich von Eukalyptusblättern ernährende Koale Australiens Symboltier. Er ist ein baumbewohnender nachtaktiver Beutelsäuger. Seine zwei mit spitzen, scharfen Krallen versehene Greifhände mit jeweils zwei Daumen und drei entgegengesetzten Fingern eignen sich gut zum Klettern und Ergreifen von Zweigen. Seine Füße tragen einen krallenlosen Daumen, die zweiten und dritten Zehen sind miteinander verwachsen, so dass sie mit den verschmolzenen Krallen Zecken ntfernen können, unter denen sie häufig leiden. „Charakteristische Merkmale sind eine vorstehende, dunkle Nase und große Ohren, woran man sieht, dass Riechen und Hören in ihrem Leben eine wichtige Rolle spielen. Der Koala hat einen im Verhältnis zu seinem Körper großen Kopf. Das Fell wildlebender Koalas ist verwitterter als das von Koalas in Menschenhand. Der Beutel ist wie bei den Wombats (im Gegensatz zu den Känguruhs) mit nach unten gerichteter Öffnung ausgestattet. Aufgrund des besonderen Ablaufs der Trächtigkeit, Geburt und Jungenaufzucht von Beutelsäugern besitzen Koalas keinen Bauchnabel.“ (Wikipedia)
Koalas waren ursprünglich in Australien weit verbreitet, wurden aber wegen ihres Fells gejagt und dadurch in vielen Gebieten ausgerottet. Sie konnten teilweise wieder angesiedelt werden. Australien steht jetzt in Flammen und über eine Milliarde Tiere sind bereits in den Buschbränden verendet. Vor allem die Koala-Population des Kontinents ist in großer Gefahr. Weltweit stricken die Menschen Pullover und Socken für die durch das Feuer verletzten, aber geretteten Tiere. So viele, dass die Koala-Helfer baten, damit aufzuhören: „Wir haben nicht genug Lagerfläche dafür mehr.“ Rührende Fotos von den Helfern mit ihren geborgenen Koalas gingen um die Welt. Während man von den Waldbränden in Kalifornien arme Leute zeigt, die alles verloren haben oder runtergebrannte Luxusvillen von Prominenten, zeigen die Fotos vom australischen Buschfeuer ausschließlich verbrannte, verletzte oder ermattete Tiere, dazu höchstens noch ihre Retter, denen sie sich dankbar anvertrauen – vornehmlich Feuererwehrleute, die ebenfalls ermattet sind von pausenlosen Einsätzen.
.

.
Brennendes Australien
Die Satellitenbilder zeigen, dass die Buschfeuer die Küstenregionen fast um den gesamten Kontinent herum erfasst haben. Und in diesen Regionen konzentrieren sich alle „Errungenschaften“ der Kolonisation: Städte, Industrie, Landwirtschaft, Tourismuszentren. In Sidney ist die Luftverschmutzung derzeit elf Mal höher als die offiziellen Grenzwerte. Bereits zu Beginn der Trockensaison (von September bis Dezember) war es so heiß, dass Tausende von Flughunde tot von den Bäumen fielen. In diesen Monaten beginnen alljährlich auch die Brände in Australien, Rauchschwaden ziehen über das Land. Ab Januar konnte man bisher den Beginn des Monsuns und Tornados erwarten. Aber noch breiten sich die Buschfeuer weiter aus und die Feuerwehrleute sind überfordert, die Regierung hat ihnen 3000 Reservisten beigestellt. Auch die Flotte der Kriegsschiffe soll verstärkt werden, um vom Feuer Eingeschlossene zu retten. „Vielen bleibt nur noch die Flucht übers Meer,“ titelte „Die Welt“. Es gab bereits Tote.
Vor allem sind bisher eine halbe Milliarde Tiere verbrannt, erstickt oder auf der Flucht vor den brennenden Bäumen und Büschen in einem Stacheldraht verendet. Diese Bilder werden weltweit verbreitet, wie ebenso solche von Australiern, die verletzte Koalas und Känguruhs retten. Überhaupt zeigen die Bilder von der Katastrophe, die einige Wissenschaftler bereits mit der von Tschernobyl vergleichen, vor allem halbverbrannte Tiere, die es nur in Australien gibt, daneben aber auch tote Rinder, Schafe, Kamel und Wildpferde, die einst von den Europäern eingeführt wurden. 16.000 Kamele will man jetzt erschießen, weil sie zu viel Wasser verbrauchen. Andere Experten halten die geschätzte Zahl der toten Tiere für übertrieben. Wieder andere haben anhand der knapper werdenden Wasserreserven des Kontinents errechnet, dass sich Australien bis zur Jahrhundertmitte in eine „Wüstenlandschaft“ verwandelt, wenn alles so weiter gehe wie bisher (man braucht z.B. für das Wachstum von zweieinhalb Avocados 1000 Liter Wasser). Die kanadische Wasseraktivistin Maude Barlow schreibt in ihrem Buch „Blaue Zukunft“ (2014): „Der weltweite Handel mit Nahrungsmitteln ist bei näherer Betrachtung ein Handel mit Wasser.“ Hinzu kommt noch, dass z.B. allein ein chinesischer Konzern jährlich 96 Millionen Liter Wasser aus einer von Dürre betroffenen Queensland Community entnimmt.
Am „Mount Gulaga“ versammelten sich Mitte Dezember die vereinigten Stämme der Aborigines für eine große „Heilungszeremonie“. Als Westler darf man bezweifeln und hoffen, dass sie hilft. Ihre jahrtausende alte Erfahrung mit dem Legen von kontrollierten Buschfeuern überzeugt aber immer mehr, während die Klimaleugner immer kleinlauter werden.
.
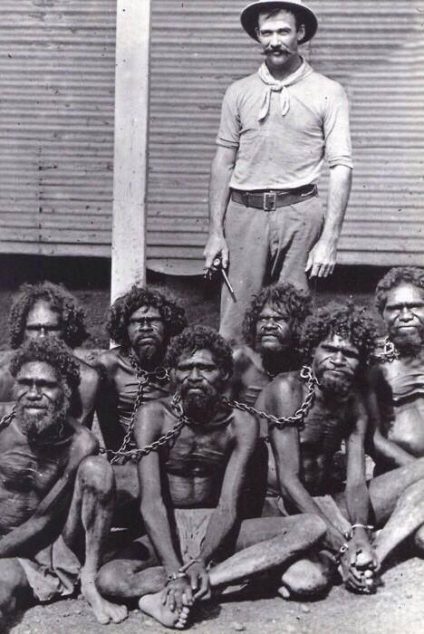
.
In Australien war es noch vor nicht langer Zeit straffrei, einen Aborigines zu töten. Inzwischen herrschen jedoch „politisch korrekte“ Zeiten, auch Multikulti ist noch angesagt, und da sollte man tolerant gegenüber anderen Lebensweisen und Denksystemen sein – möglichst sogar kooperieren, sich vernetzen etc..Während hierzulande das Fortdauern imperialistischer Machtverhältnisse in anderer Gestalt als „postkolonial“ kritisiert wird, deutet in Australien das „Postkoloniale“ auf etwas Überwundenes, auf einen glückhaft empfundenen Bruch hin.
Und natürlich wissen mittlerweile alle, dass die Verbrennung von Land zur Steigerung der Fruchtbarkeit des Bodens beiträgt, man muß das Feuer nur unter Kontrolle halten können. Kontrollierte Buschfeuer reduzieren die unkontrollierten! Es gibt Pflanzen, denen macht ein Buschbrand nichts und andere, die brauchen es sogar, ebenso wie einige Insektenarten. „Schon 3-4 Wochen nach dem Brand zeigen die ersten Bäume wie Messmates oder Mountain Grey Gums wieder die ersten Lebenszeichen. Andere Bäume und Büsche , wie Silver Banksia regenerieren sich dann aus unterirdischen Wurzeln, die Sprösslinge nach oben zum Licht schicken. Vor den neuen Blättern schicken die Bäume erst die Triebe mit den Blüten heraus, die jetzt konkurrenzlos blühen, fruchten und samen können. Die Samen von Akazien, deren Kapseln nach dem Feuer aufplatzten, beginnen zu keimen. Das Aschebett bietet ideale Wachstumsbedingungen,“ teilt ein Australier in einem Internetforum auf die Frage mit, welche Baumarten das Buschfeuer brauchen, um sich zu vermehren. Das gilt für viele Eukalyptusarten sowie für die australischen Banksien, berühmt ist der Grasbaum. Er benötigt „die Rauchgase in der Luft, um seine Samenkapseln öffnen zu können. Dann blüht er und wirft seine Samen auf den durch die Asche frisch gedüngten Boden, für die das Unterholz nun kein Konkurrent mehr ist,“ heißt es auf „geo.de“.
Auf der Internationalen Garten-Ausstellung (IGA) in Berlin 2017 stellten die australischen Landschaftsgestalter Taylor, Cullity und Lethlean (T.C.L) aus Melbourne einen Garten „Cultivated by Fire“ vor, in dem einige mit Buschfeuern lebende Pflanzen wuchsen. Bereits 2001 hatte Helen Verran, eine feministische Wissenschaftshistorikerin an der Charles-Darwin-Universität in der Küstenstadt Darwin im Norden der Northern Territories die Yolngu Aborigines Community dazu bewegen können, einige Umweltwissenschaftler zu einem Workshop einzuladen, um über ihre unterschiedliche Erfahrung mit Buschbränden zu diskutieren. Da stießen zwei Vorgehensweisen, „zwei Wissenschaften“ würde Claude Lévy-Strauss sagen, aufeinander. Und dann sollten die Umweltwissenschaftler und die Aborigines auch noch zusammenarbeiten.
.

.
Bislang war „der Umgang der Weißen mit dem australischen Feuer eine 200 Jahre lange Geschichte der Arroganz. Es wird ausschließlich als Bedrohung erlebt,“ meinte der Leiter des Feuermuseums in Sidney gegenüber dem „Spiegel“. Dass die Kolonialherren in Australien alles so einrichten wollten, wie sie es von Europa her gewohnt waren, wozu auch ihr „europäische geprägter Umgang mit Feuer“ gehört, hält der Erlanger Biologe Daniel Lingenhöhl für eine der Ursachen, die zur jetzigen Buschfeuer-Katastrophe beitrugen, die sich jetzt womöglich noch ausweiten wird. Den Aborigines wurden ihre kontrollierten Buschfeuer immer wieder verboten. Die australischen Umweltwissenschaftler, die es besser machen wollten, hatten bisher vor allem einen Quadratmeter große Versuchsfelder angelegt, die Pflanzen darin bestimmt und gezählt, dann die Quadrate verbrannt und anschließend wieder die Pflanzen, die dort neu hochgekommen waren, bestimmt, gezählt usw…. „Sie stehen dabei in der Tradition u.a. von Linné und Darwin und berufen sich genealogisch auch auf sie – beim Legen ihrer Buschbrände,“ schreibt Helen Verran in ihrem Aufsatz „Ein postkoloniales Moment in der Wissenschaftsforschung: Zwei alternative Feuerregimes von UmweltwissenschaftlerInnen und aboriginalen LandbesitzerInnen“ (in: „Science and Technology Studies. Klassische Positionen und aktuelle Perspektiven“ (2017). Den Aborigines dient das Feuerlegen dazu, „um Wege durch Dickicht und stachliges Gehölz zu schaffen, vorhandene Nutzpflanzen zu fördern und neues Wachstum zu initiieren, Jagdmöglichkeiten zu schaffen und nützliche Pflanzen zum unmittelbaren Verzehr oder Kochen, zur Wärmegewinnung sowie auch für spirituelle Zwecke zu gewinnen. Die Nutzung des zweckgerichteten Feuers folgte bestimmten Regeln, die sich nach dem Vegetationsverlauf und dem Bedarf der Aborigines richteten,“ heißt es auf Wikipedia. In der Diskussion erklärtendiese ihr Vorgehen mit einer alten Verbindung ihres Territoriums mit der Clan- und Familiengeschichte, wobei sie unter dem Recht am Land kein Eigentum im Sinne des deutschen oder römischen Sachenrechts verstehen. Das australische Recht anerkennt inzwischen ihren „anderen“ rechtlichen Bezug zum Landeigentum. Im Norden spielen laut Wikipedia vor allem der „Native Title“ und im Südosten „Landnutzungsrechte“ eine Rolle. 1,1 Mio. Quadratkilometer Land wurden von 1966 bis 1991 den Aborigines zugesprochen, was etwa 15 % der Landfläche des australischen Kontinents sind.
Die gelegten Feuer der Aborigines erstrecken sich in der Landschaft über den gesamten Jahresverlauf. Die meisten Brände sind von relativ geringer Intensität und verbrennen lediglich kleine Flächen, unkontrollierbare Buschfeuer in großem Umfang entstehen dadurch kaum. Dazu gehört, dass rings um den Brand alles gesammelt (Yamswurzeln), geerntet (Schnecken) und gejagt (Känguruhs) wird. Anschließend wird dies alles gerecht unter allen Clanmitgliedern geteilt – abgemessen nach der Nähe bzw. Entfernung im Verwandtschaftsgrad. Manchmal schnappt sich ein Greifvogel, auch Feuervogel genannt, einen brennenden Zweig mit dem er woanders Feuer legt, um ebenfalls Beutetiere aufzuscheuchen.
Den australischen Gartenkünstlern TCL ist der aboriginale Brandansatz, den sie „Fire Stick Farming“ nennen, verständlicher als den Naturwissenschaftlern, deren Analysegeräte allerdings auch nicht zu verachten sind. Die Biologin Margaret Lowman erforschte z.B. das rätselhafte Sterben der australischen Eukalyptuswälder. Die dortigen Naturschützer machten die Umweltzerstörung der Landbesitzer dafür verantwortlich, umgekehrt gingen die Farmer von Pflanzenfressern aus, wobei sie wahlweise an Koalas und Käfer dachten. Schließlich wurde ein die Wurzeln der Bäume angreifender Algenpilz als Hauptursache entdeckt: „Er war mit der an Traktorrädern haftenden Erde von malaysischen Avokadofarmern unwissentlich nach Australien eingeschleppt worden,“ schreibt Margaret Lowman in „Die Frau in den Bäumen“ (2000).
.

Mutter mit Kind gerettet
.
Anti-Anthropozentrismus
Drei mal wurde mir eine neue Sichtweise auf die Welt eröffnet. Das war erstens der Marxismus – die Gegensätze zwischen Kapital und Arbeit, zwischen Proletariat und Bourgeoisie etc., was sich mir dann fokussierte auf die aus der Kapitalanalyse entwickelte marxistische Erkenntnistheorie von Alfred Sohn-Rethel – Hand- und Kopfarbeit, der Warentausch als „social act“, den die Beteiligten mit „private minds“ negieren. Zweitens der Feminismus – der Gegensatz zwischen den Sichtweisen und Phantasien von Männern und von Frauen als Geschlechterkampf. Und drittens – über meine Beschäftigung mit Tieren und Pflanzen seit 2000, ein Anti-Anthropozentrismus – der sich über die selbstverständlichen Lebensäußerungen aufregt, mit der Menschen die von Tieren und Pflanzen übersehen und übergehen – monotheistisch munitioniert.
Bei den Indigenen Amerikas ist die Idee weit verbreitet, das jede Lebensform sich selbst als menschlich (an)sieht. Mit einem solchen totalen Anthropomorphismus entkommen sie witzigerweise dem Anthropozentrismus, wie der brasilianische Ethnologe Eduardo Viveiros de Castro und die Philosophin Deborah Danowski schreiben (in: „In welcher Welt leben? 2019), weil das, was alle von sich selbst sehen, „ihre ‚Seele‘ ausmacht. Demzufolge sieht ein Jaguar, wenn er einen anderen Jaguar anschaut, einen Menschen; aber wenn er einen Menschen anschaut, sieht er ein Schwein oder einen Affen, da dies das von den amazonischen Indios das am meisten geschätzte Wild ist.“ Die beiden Autoren definieren deren „Animismus“ als „ein ‚anthropomorphes Prinzip‘, das fähig ist, sich jenem ‚anthropozentrischen Prinzip‘ entgegenzustellen, das uns als eine der tiefsten Wurzeln der westlichen Welt erscheint.“
Aktuelles Beispiel: Mehrere wissenschaftliche Studien und sogar die Regierungsrichtlinien des Berliner Senats legen nahe, dass die Natur in der Stadt zum menschlichen Wohlbefinden beiträgt und das es zu wenig ist, weswegen „die grüne und soziale Infrastruktur entwickelt“ werden soll. Nicht um ihretwegen, sondern für uns also soll mehr „Natur“ geschaffen werden, das ist Anthropozentrismus für Doofe. Abgesehen davon, dass in Wirklichkeit genau das Gegenteil geschieht.
Schwieriger ist ein Beispiel, das die feministische Biologiehistorikerin Donna Haraway erwähnt („When Species meet“ 2008), im Hinblick auf einen verborgenen Anthropozentrismus zu deuten: „Gesetzt den Fall eine Wildkatze hinterlässt Junge, die von einem Haushalt bestehend aus überqualifizierten, wissenschaftlich ausgebildeten Kriegsgegnern mittleren Alters aufgenommen werden, oder von einer Tierwohlfahrtsorganisation, die eine Ideologie zum Schutz des Wilden und Tierrechte propagiert: Wird das Tier garantiert glücklich werden?“ Wo doch die Wildheit laut Haraway unsere ganze Hoffnung bleibt.
Es wird gesagt, dass viele Tiere (und auch Pflanzen) vom Land in die Stadt gedrängt werden, es sind quasi Flüchtlinge aus der Wildnis, die bedrohlich zusammenschrumpft. Was aber, wenn sie in die Städte einwandern, weil sie hier vor allem weniger von den Menschen verfolgt werden? Der Tierparkgründer Heinrich Dathe erwähnte einmal, das im Tierpark Vertreter von 123 Vogelarten frei leben – als „Selbstversorger“, und das mit Beginn der Jagdsaison im Umland Berlins noch weit mehr Vögel den Tierpark als Schutzzone bevölkern. Englische Primatenforscherinnen haben herausbekommen, dass die Affen am Amazonas durchaus zu unterscheiden wissen, ob die Menschen, die sich ihren Bäumen nähern, zwei harmlose Biologinnen im Safarilook mit Fernglas oder zwei gefährliche Jäger mit Gewehr und Blasrohr sind.
An der Universität Augsburg gibt es ein Wissenschaftszentrum Umwelt, deren Leiter, der Philosoph Jens Soentgen, 2018 ein Buch über die „Ökologie der Angst“ veröffentlicht hat. Das „Anthropozän“, so sagt er, hat als Innenseite die Angst der Tiere. Alle haben Angst vor den Menschen. „Hunger, Durst und sexuelle Begierde, die ebenfalls zentrale Triebe sind, sind Bedürfnisse, die ein Lebewesen, wenn nötig, eine Zeitlang aufschieben kann. Nicht aber die Angst.“
Man weiß, dass die ersten Weißen, die von Menschen unbewohnte Inseln betraten, von den dortigen Tieren ohne Scheu quasi freundlich empfangen wurden, was die Weißen ihnen allerdings nicht gedankt haben. Umgekehrt haben z.B. einige Walarten, die von den Menschen streng verfolgt wurden, heute in Schutzzonen ihre Angst vor ihnen überwunden oder verloren – und kommen sogar an das Schlauchboot der „Whale-Watcher“, um sich anfassen zu lassen. Ähnliches gilt auch für die Gorillas in Ruanda, die fast eine Abmachung haben mit den Nationalpark-Schützern, die regelmäßig Touristengruppen anschleppen, die einen Gorilla berühren und fotografieren möchten. Für diese Führungen bekommen die „Ranger“ Geld, dafür schützen sie die Gorillas vor Wilderern und zerstören deren Fallen.
In der kanadischen Hafenstadt Churchill leben die Leute mit vielen Eisbären, für besonders aufdringliche gibt esdort sogar ein Gefängnis.
Wenn man in Berlin Krähen, Füchse oder Wildschweine füttert und diese dabei ihre Angst verlieren, werden sie erschossen. Auch wenn sie „wild“ geblieben sind, aber die Menschen sie für „zu viele“ halten. Die freie Hansestadt Hamburg leistet sich dafür 71 Stadtjäger. Das ist ein besonders fieser Anthropozentrismus.
.
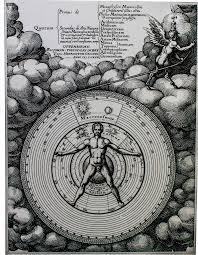
.
Überbevölkerung
Das Wort knüpft – ähnlich wie „Bevölkerungsexplosion“ – an die negative Euthanasie der Nazis, die „Vernichtung unwerten Lebens“, an. Auch die positive Euthanasie ist diskreditiert. Erinnert sei an den US-Genetiker Hermann Joseph Muller, der künstliche Mutationen mittels Röntgenbestrahlung bei Fruchtfliegen erzeugte. Er bekam dafür 1946 den Nobelpreis und wurde 1947 Präsident der „Genetic Society of America“. Muller war zunächst nach Deutschland gegangen, wo er mit dem sowjetischen Ehepaar Ressowski, das in Buch ebenfalls mit Fruchtfliegen experimentierte, zusammenarbeitete. Als kommunistischer Sympathisant zog er auf Anfrage des Genetikers Nikolai Wawilow in die Sowjetunion, wo er ein Institut leitete und seine „eugenischen Träume“ in einen „Plan“ faßte, den er Stalin vorlegte: „Aus dem Dunkel der Nacht“ betitelt. Dieser bestand aus „positiver Euthanasie“, d.h. die Sowjetfrauen sollten alle mit Samen von großen Genies – „wie Darwin und Lenin“ – künstlich befruchtet werden, um das Volk intellektuell und moralisch zu verbessern. Die Frauenverbände und Gewerkschaften protestierten heftig. Muller distanzierte sich zwar von der „negativen Euthanasie“, der deutschen „Aufartung“ („Wahre Eugenik kann nur im Sozialismus verwirklicht werden!“), aber der antigenetisch orientierte „Lyssenkoismus“ trieb ihn dann 1936 doch aus dem Land und zurück nach Amerika, wo er 1939 für den 7. „International Congress on Genetics“ ein neues „Geneticists‘ Manifesto“ vortrug, in dem es darum ging, die komplette Weltbevölkerung genetisch zu optimieren. „Unsere Verantwortung wird dadurch ins Riesengroße wachsen!“
Ein Ableger seiner positiven Euthanasie ist die amerikanische Soziobiologie, die, kurz gesagt: vom Ameisenstaat auf menschliche Gesellschaften schließt, in Deutschland könnte man das kürzlich geschlossene Max-Planck-„Institut für Humanethologie“ dazu zählen, dessen Forschungsansatz schon dem Altnazi Konrad Lorenz in seinem Max-Planck-„Institut für Verhaltensphysiologie“ vorschwebte: „Wir vermenschlichen nicht die Tiere, sondern vertierlichen den Menschen.“
Mit dem Frankfurter Zoodirektor Bernhard Grzimek war Lorenz sich einig, dass die Menschheit sich zu schnell vermehrt und die Natur dadurch gefährdet ist. Heute, mit knapp acht Milliarden Menschen, wird derlei erneut laut. Kürzlich forderte ein EU-Kommissar „Familienplanung in Afrika“ und ein Bevölkerungswissenschaftler verwies auf das vorbildliche China mit seiner „Ein-Kind-Politik“. Ihm war entgangen, dass sie 2015 zu einer „Zwei-Kind-Politik“ erweitert wurde, die nun auch abgeschafft werden soll. Nicht zuletzt, um dem enormen Überhang an Jungmännern entgegenzuwirken, denn die Ein-Kind-Politik haben zu viele Eltern als „Ein-Junge-Politik“ umgesetzt, indem die Frauen vor allem ihre weiblichen Föten abgetrieben haben. Ähnlich ist es in Indien, wo die Krankenhäuser mit den modernsten Apparaten zur pränatalen Diagnostik ausgerüstet sind , um so früh wie möglich einen weiblichen Fötus zu erkennen und abzutreiben. Indische Mädchen sind ihren Eltern zu teuer: „Wer einen Sohn hat, kassiert. Wer eine Tochter loswerden will, muss zahlen,“ so sagt es die „Süddeutsche Zeitung“.
„Leben zu viele Menschen auf der Erde?“ fragte sich „Die Zeit“. Während der „Flüchtlingskrise“ meinte der US-Genetikfan und -förderer Bill Gates, einer der reichsten weißen Drecksäcke, in einem Interview mit der „Welt am Sonntag“: „Wir müssen die Bevölkerung Afrikas reduzieren, wenn wir Europa retten wollen“ (dazu sollen „Impfstoffe“ dienen. Ihm zufolge müssen täglich 350.000 Menschen beseitigt werden, um die Population stabil zu halten). Für die Linke ist dagegen klar, dass, wenn „reduziert“ („depopulated“ – Bill Gates) werden soll, man natürlich bei den Reichen anfangen muß, auch in Afrika, wo jedoch wahrscheinlich die wenigsten Reichen leben. Aber was ist reich? Eine amerikanische Kleinfamilie verbraucht so viel Energie wie ein ganzes indisches Dorf und so viel Wasser wie ein mexikanisches Dorf. Statt einer „Reduzierung“ bräuchte es also eine „Umverteilung“. Das ist aber im Weltkapitalismus nicht ohne Gewalt möglich. Die bürgerlichen Medien in den Industrieländern fragen sich deswegen weiter – vorsichtig: „Wie viel Mensch hält die Erde aus ?“ (MDR) Und „Kann die Welt noch mehr Menschen aushalten?“ (FAZ). Ganze Forschungsinstitute sind damit beschäftigt, dies mathematisch zu bejahen, und andere, es alarmistisch zu verneinen Z.B. der Biologe Matthias Glaubrecht in seinem fast 1000 Seiten dicken Buch „Das Ende der Evolution“ (2019): „Wir sind zu viele!“ Wobei sein „Wir“ ein unmögliches biologisch-evolutionäres ist, kein historisch-soziales.
.

.




