Pilze
Nach den Bakterien sind Pilze die am weitesten verbreitete Lebensform der Erde,“ schreiben die Wissenschaftler des Frankfurter „Instituts für integrative Pilzforschung“. Man findet sie in der Tiefsee und im Hochgebirge, in Gesteinen und im Wasser, auf und in anderen Lebewesen, in Wüsten, Regenwäldern und an den Polen. Es gibt etwa 3,8 Millionen Pilzarten auf der Erde, die meisten sind noch unbekannt.
Die Mikrobiologin an der Jenaer Universität Kerstin Voigt forscht über Jochpilze, es geht ihr dabei um deren Schwanken zwischen Symbiose und Parasitismus. „Rein evolutionsgenetisch sind Pilze dem Reich der Tiere, nicht dem der Pflanzen zuzuordnen“, meint sie. Es sind quasi „stationäre Tiere“. Dabei stellen die von ihr untersuchten Jochpilze entwicklungsbiologisch gesehen innerhalb der Pilze ein Bindeglied zu sich geschlechtlich fortpflanzenden Lebewesen dar. Ihre Vertreter leben parasitisch auf anderen Pilzen, auf Pflanzen und in Menschen mit schwachem Immunsystem. „Die Mechanismen, mit denen die Pilze ihren jeweiligen Wirt dazu überreden‚ sie auf ihm leben zu lassen und nicht gleich zu vernichten, sind die selben, die sie auch zur geschlechtlichen Fortpflanzung untereinander befähigen“, meint die Mikrobiologin. Indem die Urpilze auf Pilzen lebten, also auch ihre nächsten Verwandten ausnutzten, „erfanden sie den Sex. Denn sie begannen untereinander genetisches Material auszutauschen – sozusagen als Gastgeschenk, um den Wirt milde zu stimmen. Damit legten sie zum Einen den Grundstein für ihre eigene weite Verbreitung. Zum Anderen wiesen sie den Weg aus der wenig flexiblen ungeschlechtlichen Reproduktionsmisere hin zur Artenvielfalt höher entwickelter Lebewesen durch geschlechtliche Fortpflanzung.“
Kerstin Voigt geht davon aus, dass die Pilze ihren jeweiligen Wirt „zum Fressen gern“ hatten und ihn daher möglichst lange am Leben erhalten wollten. Der Komponist John Cage hätte dieser fast harmonischen Sicht widersprochen. Er war ein großer Pilzfreund und -kenner. Wenn ihn Depressionen überfielen, zog er sich in eine Hütte im Wald zurück und komponierte. In einem Interview meinte er: „Wenn ich gewußt hätte, wie es im Musikgeschäft läuft, wäre ich Pilzforscher geworden. Inzwischen weiß ich allerdings, dass es auch unter Pilzen wie im Musikgeschäft zugeht.“
.

Foto: Maria Horn
.
Die Sexualität der Pilze ähnelt der von hermaphroditischen Schnecken, insofern die Pilzfäden (Hyphen) sowohl den männlichen als auch den weiblichen Part übernehmen können, wobei ersterer dann nur die Gene und letzterer neben seinen Genen auch das „Fleisch“ heranwachsen läßt, aus dem dann die Sporen reifen.
Immer mehr Pilzarten versucht man zu züchten, aber laut dem englischen Pilzforscher Merlin Sheldrake lassen sich einige nicht „domestizieren“, u.a. weil sie ein zu „kompliziertes Sexualleben“ haben. Er erwähnt dazu die Weißen Piemont-Trüffel, Steinpilze, Pfifferlinge und Matsutake. Weil Pilze im Herbst nach einem Regen quasi aus dem Boden schießen, fragt er sich: „Vermenschlicht man zu stark, wenn man das Durchbrechen eines Pilzes mit den gleichen Worten beschreibt wie die sexuelle Erregung eines Mannes?“
Was ihre Vermehrung angeht, also die Verbreitung ihrer Sporen, bedienen sich einige Pilze der Biolumineszenz, sie leuchten im Dunkeln. Damit locken sie Insekten an, die ihre Sporen verbreiten. Der schwedische Pilzforscher Stefan Olsson erforschte den Herben Zwergknäueling (Panellus stipticus), den er in Glasgefäßen züchtete. Dessen Leuchtkraft war so stark, dass Olsson bei seinem Licht lesen konnte.
Lange bevor die Menschen irgendetwas über Pilze wußten, benutzten sie diese bereits bei ihrer Speise- und Getränkezubereitung: Hefepilze, die bei der Zubereitung von Wein, Bier und Brot unabdingbar sind. In der Luft befinden sich Milliarden winzige Sporen (Samen), u.a. von Schimmelpilzen, die umgekehrt für den Verderb von Lebensmitteln verantwortlich sind, was erst der Chemiker Louis Pasteur experimentell herausfand. Für Brot, Käse und verschiedene Obstsorten sind das vier Schimmelpilz-Arten mit dem Namen Penicillium. Umgekehrt werden viele Käse- und Wurstsorten durch bestimmte Pilze erst besonders aromatisch, diese heißen ebenfalls Penicillium. Zu den Penicilline zählt ferner ein Pinselschimmel, dessen antibiotische Wirkung der Bakteriologe Alexander Fleming entdeckte.
Die meisten Menschen interessieren sich vor allem für die eßbaren Pilze, von denen es jedoch nur wenige gibt. Zur Zeit ist noch Pilzsaison. Je besser die Pilzsaison ausfällt, desto mehr Pilzvergiftungen gibt es auch.
Man muß nicht nur wissen, welche Pilze ungiftig sind, man muß auch ihre möglichen Standorte kennen. Das Bayrische Landesamt für Umwelt schreibt: „Das Wissen um die in Bayern lebenden Pilze ist heute zum überwiegenden Teil in der Hand von ehrenamtlich tätigen Mykologen. Nachwuchs gibt es kaum mehr.“ Und das sei bedauerlich, denn „man darf nicht vergessen, dass es sich beim Erkennen von Pilzen um eine Wissenschaft handelt, bei der man jahrelange Erfahrung und Geländekenntnis braucht, um sichere Bestimmungen durchführen zu können.“
.

Foto: Maria Horn
.

Foto: Maria Horn
.
Der aus Russland stammende Schriftsteller Wladimir Kaminer sieht das anders: „Die Deutschen suchen mit einem Ratgeber nach Pilzen, oft sieht die Pilzabbildung aber ganz anders aus als der Pilz vor Ort. Die Russen sammeln dagegen nach Gefühl. Während der Deutsche zweifelt und oft mit einem leerem Korb nach Hause geht, nimmt der Russe erst einmal alles mit. Seine Erfahrung sagt ihm, eigentlich sind alle Pilze essbar. Manche muss man bloß einige Tage lang kochen, andere stärker salzen, aber essen kann man sie eigentlich alle. Eine gefährliche Lebenseinstellung aus deutscher Sicht.
Man muss allerdings hinzufügen, dass sich die Russen auch öfter an ihren Pilzen vergiften. Die meisten Brandenburger halten nur Pfifferlinge und Steinpilze für wirklich essbar. Dutzende von Pilzsorten, die meine Landsleute gerne essen, nehmen sie gar nicht wahr, z.B. die merkwürdig aussehenden Rothaarpilze und die gar nicht als Pilze erkennbaren Smorchki – die Rotzpilze, sowie die Wolnuschkas, was auf Deutsch so viel wie ‚Aufregungspilze‘ heißt. Die besten Pilze wachsen hier übrigens in der ehemaligen sowjetischen Besatzungszone, überall dort, wo Russen stationiert waren. Anscheinend stehen die Pilze und die Russen in einer mystischen oder gar mycelischen Verbindung. Mein Freund und Nachbar, ein ehemaliger Leutnant der sowjetischen Armee, der sich aus der Armee entlassen, Deutschland jedoch nicht verlassen hat, und hier als Taxifahrer sein Geld verdient, kennt alle geheimen Pilzsammelplätze in und um Ostberlin. Er fährt mit seinem alten Audi immer dorthin, wo er früher mit seinem Panzer herumgefahren ist.
Statt zur Pilzberatung im Botanischen Garten zu gehen, helfen sich die hier lebenden Russen selbst. In der Pilzsaison kommt meine Frau Olga jeden Tag mit einem vollen Korb aus dem Wald zurück, breitet die von ihr als Pilzjägerin erlegten Pilze auf dem Küchentisch aus, fotografiert sie, postet die Fotos auf Facebook und tauscht sich über ihre Erfolge mit den anderen Freundinnen aus, die gleichzeitig mit ihr irgendwo im Wald auf Pilzsuche waren. Im Herbst quillt das russische Internet über vor lauter Pilzfotos.“
.

Russische Pilzverkäufer
.
Ab und zu findet man im Facebook auch deutsche Einträge: Kürzlich z.B. ein Foto von einem Grünen Knollenblätterpilz, darunter stand: „Der hätte für meine ganze Familie gereicht. Er ist der Goldstandard unter den Familienauslöschern.“
Andere Pilze werden als giftig bezeichnet, weil sie halluzinogene Wirkungen hervorrufen, man stirbt daran aber nicht. Diese Pilze, auch „Magic Mushrooms“ genannt, die vor allem zur Gattung der „Kahlköpfe“ gehören, sind in der Berliner Pilzberatungsstelle noch nicht aufgetaucht, ihr Leiter hatte aber schon mit Fällen zu tun, wo jemand mutwillig Fliegenpilze verzehrt hatte, die Vergiftungserscheinungen hervorriefen. Für Rentiere, die vorwiegend von der „Rentierflechte“ leben, sind Fliegenpilze eine Delikatesse und für sibirische Schamanen gut dosiert ein Muß für ihre Geistdialoge und ihr Elch-Werden z.B.. Elche essen im übrigen auch gerne Fliegenpilze.Auf der „biologie-seite.de“ heißt es: „Der ibotensäurehaltige Fliegenpilz produziert den Wirkstoff Muscimol, welcher den Delirantia zugerechnet wird. Auch das Mutterkorn beinhaltet neben anderen (giftigen) Stoffen das psychoaktive Ergin, das neben Muscimol auch von anderen Rauschpilzen produziert wird. Psychoaktive Pilze hatten und haben noch heute bei verschiedenen Völkern eine spirituelle Bedeutung als entheogene (gottbewirkende) Stoffe.“
Ein Biologe und Pilzsammler führte ein Selbstexperiment mit Faltentintlingen durch, aus denen man Tinte machen kann, deswegen heißen sie auch so. Wenn man dazu Alkohol trinkt, „geht der Puls hoch, man ist ganz aufgedreht, und das Gesicht färbt sich rot, nur die Nasenspitze bleibt weiß. Die Dauer der Aufregung hält so lange an wie der Alkohol im Blut zirkuliert,“ berichtete er.
Die Hamburger Künstlerin Gabi Schaffner ließ sich bei ihrer Beschäftigung mit Pilzen in der Mongolei von den „Betrachtungen eines Pilzforschers“ des russischen Dichters Wladimir Solouchin inspirieren; sie meint, dass es eine „Analogie zwischen den Gesetzen und Eigenschaften der Pilzwelt und der Struktur eines ‚untergründigen Denkens’“ gibt, und fragte sich: „Ähnelt ein schöner, giftiger Gedanke nicht einem Fliegenpilz in allem, sogar noch in der Wirkung zwischen Rausch und Brechreiz? Ein ungenießbarer Pilz ist wie ein falscher Gedanke am richtigen Ort.“
Die Analogie zwischen „untergründigem Denken“ und Pilzen, gemeint ist dabei vor allem das aus feinen Pilzfäden (sog. Hyphen) bestehende Mycel des Fruchtkörpers (Pilz) im Erdboden, also im Untergrund, diese Analogie wird besonders gerne von Amerikanern thematisiert, die das Mycel auch als „Netzwerk“ bezeichnen. „Die Pilze können die Welt retten,“ verkündete jüngst z.B. der Pilzforscher Paul Stamets, Inhaber von elf Fungi-Patenten, auf der berühmten „TED Konferenz“, ein internationales Redner-Treffen in Kalifornien, um die Welt alljährlich aufs Neue mit Rettungsideen zu beglücken. Stamets begann seine „Keynote“ mit dem Satz: „Wir alle wissen, dass die Erde Probleme hat, wir sind jetzt in der sechsten bedeutenden Phase der Vernichtung auf diesem Planeten eingetreten.“ Noch jeder Amerikaner hat auch eine Analogie zwischen Computer und Gehirn hergestellt, Paul Stamets, der am „Bioshield-Programm des US-Verteidigungsministeriums“ beteiligt war, mixt alles zusammen: „Ich habe als erster die These aufgestellt, dass das Myzel ein natürliches Internet der Erde ist,“ sagte er.
.

Foto: Maria Horn
.
Der Leipziger Pilzforscher Jochen Gartz gab ein Buch über „Halluzinogene im Sozialismus“ heraus, in dem es sich um Nachdrucke aus Büchern der Volksarmee handelt, in denen die Magic Mushrooms als potentielle Militärkampfstoffe behandelt wurden. Dazu schrieb er: „Durch die Tabuisierung der Halluzinogene mit Forschungsstop in den westlichen Ländern sind diese komprimierten und interdisziplinären Darstellungen auch heute noch eine reiche Fundgrube chemisch/medizinischen Wissens.“
Auch die fürchterlichen Geheim-Experimente mit Halluzinogenen im Westen werden jetzt veröffentlicht. Neben immer mehr Interneteinträgen erscheint demnächst auf Deutsch das Buch des New York Times Mitarbeiters Stephen Kinzer: „Poisoner in Chief. Sidney Gottlieb and the CIA Search for Mind Control“. Nachdem im Koreakrieg 1953 abgeschossene Bomberpiloten im nordkoreanischen Fernsehen Einzelheiten über ihre Einsätze erzählt hatten, war sich die US-Regierung sicher, dass sie von den Kommunisten einer „Gehirnwäsche“ unterzogen wurden, womit die Kommunisten schneller als die Amerikaner gewesen waren. Der neue CIA-Chef Allen Dulles wurde eiligst beauftragt, ebenfalls in dieser Richtung tätig zu werden. Er engagierte den Chemiker Sidney Gottlieb für ein Forschungsprogramm namens „MK-Ultra“, das mit zigmillionen Dollar ausgestattet wurde. Man versuchte es mit Psychodrogen und Reizentzug. Für ihre Experimente nahmen Gottlieb und seine Mitarbeiter anfangs osteuropäische, japanische und deutsche Gefangene, die danach getötet wurden. Dann verlagerte sich das Programm in die USA, an dem sich nach und nach auch Kliniken und Universitäten in Kanada und England beteiligten. Es ging darum, ahnungslosen Patienten und Freiern, die von dafür bezahlten Prostituierten angelockt wurden, LSD in hohen Dosen und andere Medikamente zu verabreichen und ihr Verhalten heimlich zu filmen.
Das 1943 vom Schweizer Chemiker Albert Hofmann für einen Pharmakonzern entdeckte LSD (Lysergsäurediethylamid) ist quasi ein Nachbau des Mutterkorn-Pilzes, der gelegentlich auf Roggen wächst und hochgiftig ist. In geringen Dosen hat er ein psychedelische Wirkung. Mein Freund Mathias Broeckers hat 2006 ein Buch über „Albert Hofmann und die Entdeckung des LSD“ veröffentlicht, auf „broeckers.com“ findet sich ein Interview mit dem Entdecker.
.

Amerikanische Psilocybin-Pilz-Verkäufer
.
Ich habe 1974 einige Monate lang fast täglich einen LSD-Trip geschluckt und dabei ein Buch geschrieben, allerdings nicht über die Wirkung, sondern mit der Wirkung eine Wahrnehmungveränderung angestrebt, damals studierte ich an der Bremer Universität Erkenntnistheorie beim Marxisten Alfred Sohn-Rethel. Einige Freundinnen nahmen zu der Zeit ebenfalls gelegentlich LSD. Die Droge zerstört das Bild, das man sich vom Anderen macht, zum Hässlichen hin, aber es wird dabei auf andere Weise schön und vor allem wahrer. Sich ein Bild von jemandem machen heißt, eine lebendige Beziehung zu zerstören, das bleibt im Alltagsleben und in der allgemeinen Konditionierung auf juvenile Schönheit jedoch nicht aus, deswegen und dagegen LSD.
In Berkeley nahm der Aktionskünstler und Krankenpfleger Ken Kesey während seiner Nachtschichten in einer Psychiatrie LSD – und schrieb danach den großartigen Roman „Einer flog über das Kuckucksnest“. An der Harvard-Universität führten der Psychologe Timothy Leary und seine Mitarbeiter LSD-Experimente mit Studenten durch, dabei ging es ihnen bis zu Learys Entlassung und Flucht um eine hippieske „Befreiung“ vom „American Way of Life“, die Formel dafür hieß „Sex and Drugs and Rock n‘Roll“.
Der CIA ging es bei den ahnungslosen Versuchspersonen, von denen einige noch Kinder waren, um deren geistige Zerrüttung und eine anschließende „Neuprogrammierung“ ihrer Erinnerungen. Etliche landeten dabei für lange Zeit oder sogar für immer in der Psychiatrie. Gottlieb ging 1972 in Rente und betätigte sich als Ziegenzüchter und Umweltschützer, 1975 mußte er vor einem Senatskomitee aussagen. Nach und nach bekommen nun einige seiner Opfer, so sie noch leben, Schmerzensgeld.
Inzwischen dürfen die Wissenschaftler im Westen wieder die „psychedelische Wirkung“ von Rauschpilzen erforschen, u..a. ein Team um den Mykologen Roland Griffith an der John Hopkins Universität. Die Wirkung der halluzinogenen Pilze hält zwar nur einige Stunden an, doch noch ein Jahr nach dem Pilz-Trip konnten die US-Forscher einen persönlichkeitsverändernden Effekt der Pilze feststellen. Die Persönlichkeit werde durch sie vor allem in Hinsicht auf „Offenheit“ dauerhaft verändert, berichtete Griffith in der Fachzeitschrift „Journal of Psychopharmacology“. Dies sei besonders verblüffend, da die „Offenheit“ mit zunehmendem Lebensalter normalerweise abnehme.
Das trifft sich mit meinen Erfahrungen, erwähnen will ich aber hier nur die eines Freundes: Er hatte LSD genommen und ging durch einen Park über eine Wiese, als er plötzlich bemerkte, wieviele Pflanzen und Kleintiere er bei jedem Schritt zertrat oder verletzte. Er blieb stehen und rührte sich nicht von der Stelle, mehrere Stunden lang: bis die Wirkung der Droge nachließ – und er sich – wieder fast im Zustand normaler Gleichgültigkeit – traute, wieder zu gehen und weiter alles platt zu treten.
.

.
Im oberhessischen Vogelsberg, wo ich in den Achtzigerjahren wohnte, suchten wir gelegentlich auf den Waldwiesen, die „Magic Mushrooms“ Psilocybin, Psilocin und Baeocystin, „wobei das Psilocybin mit seiner stabilisierenden Phosphatgruppe die häufigste und beständigste Wirksubstanz unter den dreien hat,“ wie es auf „zauberpilz.com“ heißt. Die „Halluzipilze“ sammelt man jetzt im Herbst. Man muß genau hinsehen, denn sie sind grauweiß und werden nur wenig größer als einen Zentimeter (siehe Foto). Wir haben manchmal Dutzende gefunden – und auch gleich gegessen, die Rauschwirkung war zwar unterschiedlich, aber durchweg sehr schwach, irgendwann verloren wir deswegen das Interesse an ihnen. Es gibt etwa 200 Pilzarten, die Psilocybin produzieren. Die mit der stärksten Rauschwirkung werden heute u.a. in Holland für den Markt gezüchtet wie Champignons. Ein Wissenschaftler meinte einmal zu dem englischen Pilzforscher Merlin Sheldrake: „Psilocybin-Pilze gibt es überall dort, wo sich viele Pilzforscher herumtreiben.“ 1999 veröffentlichte der Drogenexperte Werner Pieper in seinem Verlag „Die Grüne Kraft“ ein Psilocybin-„PilzZuchtBuch“ von zwei Amateur-Pilzforschern.
Eine Gruppe von Wissenschaftlern um David Nutt vom Imperial College London erforschte die Wirkung von psylocibinhaltigen Pilzen: „Da wir von bewusstseinserweiternden Drogen sprechen, gingen wir davon aus, dass die Substanz die Gehirnaktivität ankurbelt. Doch genau das Gegenteil war der Fall“, schrieb er in der Fachzeitschrift „Proceedings of the National Academy of Sciences“. Nicht nur, dass die Droge die Aktivität einer Gehirnregion herabsetzt, auch dass es sich dabei ausgerechnet um den präfrontalen Cortex handelt, verblüffte die Forscher, die den Pilz deswegen als Antidepressivum nutzen wollen, denn Depressive weisen genau in diesem Hirnbereich eine Hyperaktivität auf.
Patienten, die nach der Diagnose einer tödlichen Krebserkrankung an Angstzuständen und Depressionen litten, verminderte Sheldrake zufolge die Verabreichung von Psilocybin „die Mut- und Hoffnungslosigkeit“. Sie beschrieben „überschwängliche Gefühle von Freude, Glückseligkeit und Liebe sowie einen Übergang von Gefühlen der Einsamkeit zur Verbundenheit.“
.

.
Merlin Sheldrake beschäftigte sich in seinem Buch „Verwobenes Leben. Wie Pilze unsere Welt formen und unsere Zukunft beeinflussen“ (2020) auch mit parasitischen Pilzen, die mit Rauschgift „arbeiten“. Nicht wenige dieser von ihm „Neuroparasiten“ genannten Pilze haben es auf die Manipulation von Insekten abgesehen. Der bekannteste ist ein sogenannter „Zombipilz“ mit dem wissenschaftlichen Namen „Ophiocordyceps unilateralis“. Er ist eng mit Mutterkornpilzen und Psilocybin-Pilzen verwandt und auf Rossameisen spezialisiert, die in den Tropen und Subtropen leben. Fällt eine Spore des Pilzes auf eine Ameise, fängt sie an zu keimen. Die Pilzfäden (Hyphen) bohren sich ins Innere der Ameise bis in das Zentralnervensystem und steuern nun ihr Verhalten: Die Ameise klettert auf einen Ast oberhalb einer Ameisenstrasse und beißt sich an der Unterseite eines Blattes in der Blattader fest. Dort hängt sie, während der Pilz heranwächst, bis er fast die Hälfte ihres Gewichts ausmacht, „dann wächst er aus den Füßen der Ameise heraus, verdaut ihren Körper und läßt aus ihrem Kopf einen Stiel sprießen, aus dem die Sporen auf darunter umherlaufende Ameisen herabregnen“, woraufhin „das Spiel von Neuem beginnt“, wie es auf „spektrum.de“ heißt. Man weiß noch nicht, wie es dem Pilz gelingt, „das Gehirn der Ameise vom Körper abzukoppeln und die Muskelkontraktionen direkt zu koordinieren,“ aber es scheint, dass er Alkaloide produziert, ähnlich denen in Mutterkornpilzen, „von denen sich das LSD ableitet, die für die Manipulation des Verhaltens der Ameisen von Bedeutung sind,“ schreibt Sheldrake. Dieser Zombipilz arbeitet also mit Chemie bei seiner Gehirnwäsche.
Ein anderer Zombipilz, „Entomophthora muscae“, aus der Ordnung der Fliegenttöterpilzartigen, hat es auf Fliegen, u.a. auf unsere einheimischen Stubenfliegen, abgesehen, die er infiziert und deren „Geist“ er laut Sheldrake manipuliert: „Die infizierten Fliegen klettern, wo sie sich befinden, hoch hinauf. Wenn sie ihre Mundwerkzeuge ausstrecken und fressen wollen, läßt ein vom Pilz produzierter Klebstoff sie an jeder Oberfläche haften, die sie berühren. Hat der Pilz den Körper der Fliege aufgefressen, wobei er mit den fetthaltigen Teilen beginnt und erst am Ende die lebenswichtigen Organe angreift, wächst er als Stiel aus dem Rücken der Fliege heraus und entläßt Sporen in die Luft.“ Die Pilzforscher entdeckten, dass Entomophthora sich Viren bedient, „um den Geist von Insekten zu manipulieren.“ Er arbeitet also mit einem biologischen Kampfmittel.
Vorwiegend in den USA lebt der Zombipilz „Massospora cicadina“. Er befällt wie sein Name bereits sagt, Zikaden, und zwar ausschließlich die dort in Massen, aber nur alle 13 bzw. 17 Jahre aus der Erde kommenden Zikaden, die der Pilz so infiziert, dass sich ihr Hinterteil auflöst, von wo aus der Pilz dann seine Sporen freisetzt. Die derart infizierten Zikadenmännchen nannte einer ihrer Erforscher „fliegende Salzstreuer des Todes“. Sie werden „hyperaktiv und hypersexuell, obwohl ihre Genitalien längst zerfallen sind, ihr Zentralnervensystem bleibt im Körper während der Auflösung intakt,“ schreibt Sheldrake. Massospora cicadina arbeitet bei seiner Manipulation mit Psilocybin und Cathinon, ein Amphetamin, das auch in den Blättern der orientalischen Katpflanze vorkommt, die gekaut einen leichten Rausch bei Menschen hervorrufen.
Neben den Pilzjägern, die es z.B. mit ihren Hunden auf Trüffeln abgesehen haben, erwähnt Sheldrake die Jagdpilze, die sich u.a. von Fadenwürmern ernähren. Wenn diese „räuberischen Pilze“ spüren, das ein solcher Wurm in der Nähe ist, sagt er, dann werden sie einen „chemischen Köder“ aus. „Manche Pilze lassen ein klebriges Netz wachsen, oder auch Äste, an denen die Fadenwürmer hängen bleiben. Manche bedienen sich mechanischer Mittel und produzieren Hyphen-Schlingen, die sich bei Berührung innerhalb einer Zehntelsekunde aufblasen können und die Beute festhalten. Manche, darunter der in großem ‚Maße angebaute Austernseitling (Pleurotus ostreatus), produzieren Stiele, an deren Spitze ein einziger Gifttropfen sitzt, der die Fadenwürmer lähmen kann. Anschließend hat die Hyphe ausreichend Zeit, um in den Mund des Fadenwurms einzuwachsen und ihn von innen nach außen zu verdauen. Andere Pilze produzieren Sporen, die durch den Boden schwimmen können, von den Fadenwürmern chemisch angelockt werden und sich an sie binden. Nach der Anheftung keimen die Sporen, und der Pilz ersticht den Wurm mit spezialisierten Hyphen, auch ‚Gewehrzellen‘ genannt…Pilze fressen mit dem Myzel. Sie verdauen ihre Umwelt an Ort und Stelle und nehmen sie erst dann auf. Sie schieben ihren Körper in die Nahrung.“
.

Foto: pixabay.com
.
Mindestens so interessant wie die Jagdpilze, die „Magic Mushrooms“ und die Neuroparasiten unter den Pilzen ist das, was der Ökologe Josef Reichholf in seinem Buch „Der tropische Regenwald“ (1990) über Pilze als Symbionten erwähnt: Die ganze Dschungel-Flora und -Fauna ist Reichholf zufolge undenkbar ohne den Pilz. „Basis des Baumlebens“ ist speziell der Wurzelpilz, der sich entweder an den Enden der Baumwurzeln ansiedelt oder sogar in ihnen. Diese „innere oder äußere Mykorrhiza“ bildet die Grund-Symbiose. Dabei übernehmen die Pilzfäden „in großem Umfang die Aufnahme von Wasser und mineralischen Nährstoffen. Sie leiten diese an die Baumwurzeln weiter, von denen sie im Gegenzug vor allem Zucker und Vitamine bekommen. Die Pilzfäden sind viel feiner als die Haarwurzeln der Bäume und kommen deswegen noch an geringste Nährsalzkonzentrationen heran“. Reichholf spricht hierbei von einer „Kooperation“.
Ähnliches wie für die Bäume gilt auch für die Epiphyten (Aufsitzerpflanzen) auf ihnen: „Oben in den Baumkronen brauchen die Orchideen die Keimhilfe von Pilzen“. Und so wie das LSD einer Substanz aus Mutterkornpilzen nachgebildet ist, wird heute von Pflanzenzüchtern auch die Keimhilfesubstanz der Pilze für ihre Orchideen künstlich hergestellt.
Auf dem Urwaldboden sorgen andere Pilze für eine schnelle Rückverwertung der abgefallenen Blätter und abgestorbenen Baumteile, wobei ihnen die Baumwurzeln buchstäblich entgegenkommen: Sie wachsen im Dschungel aus der Erde nach oben – „der eigentlich schon ziemlich ausgelaugten Nährstoffquelle ‚totes Blatt‘ entgegen“. Zusammen sorgen sie dann dafür, dass das Blatt schließlich in seine letzten Reste zerfällt „und keinen Humus hinterläßt.“
Während im tropischen Regenwald auf einen Hektar bis zu 500 Baumarten vorkommen, sind es in den „geradezu monotonen Wäldern“ z.B. Europas höchstens 30 – oft nur ein knappes Dutzend. In den Regenwäldern wachsen die Bäume um so besser, „je weniger Artgenossen in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft“ wurzeln. Dies ist nicht dem Überfluß, sondern dem Mangel geschuldet – für Reichholf ist das der „Kern der Regenwaldproblematik“.
Die dominierenden Tiere sind hier die Blattschneiderameisen und die Termiten – und beide ernähren sich von Pilzen, die sie in ihren Bauten züchten. Also: „Soziale Insekten“ unten (tagsüber Ameisen, nachts Termiten) und „soziale Pflanzen“ oben (Orchideen-Pilz- und Bromelien-Pilz-Symbiosen, wobei noch Insekten und Spinnen hinzukommen).
Die Blattschneiderameisen schleppen Blattteile in ihr Nest, zerkauen sie und lassen darauf einen Pilz aus der Gattung der Egerlingsschirmlinge wachsen, von dessen Hyphengeflecht sie sich ernähren. Ihre „Pilzgärten“ werden gepflegt und von fremden Sporen und Hyphen gesäubert. Von den Hyphen ihres Pilzes beißen sie die Enden ab, um die Bildung von Fruchtkörpern zu verhindern. Anders die Termiten, in Namibia z.B., die von den Hyphen eines „Champignonartigen“ Pilzes aus der Gruppe der „Termitomyces“ leben, dessen Fruchtkörper sie während der Regenzeit aus dem Termitenhügel rauswachsen lassen. Er zählt zu den größten und schmackhaftesten Speisepilzen, die Weißen nennen ihn „Termitenpilz“. Seine Hyphen in den Pilzgärten der Termiten bilden ihre „Verdauungsmaschine. Die Hyphen verdauen das von den Termiten herbeigeschleppte Holzmaterial vor und wandeln es in Zucker und Eiweiß um, von dem die Termiten leben. Die Blattschneiderameisen und ihr Pilz ebenso wie die Termiten und ihr Pilz sind so aufeinander angewiesen, dass sie ohne den jeweils anderen nicht leben können. In den Nestern bzw. Bauten finden ihre Pilze die idealen Lebensbedingungen und werden zudem vor ihren Freßfeinden geschützt.
Die immer feuchtwarme Urwaldluft ist laut Reichholf erfüllt von winzigen Pilzsporen: Schon nach kurzer Zeit ist jeder Gegenstand mit einem Schimmelpilzfilm überzogen. Selbst das Faultier setzt an seinem Fell Pilze und Algen an, von denen sich wiederum die Larven einer kleinen Schmetterlingsart ernähren. Die Faultiere leben meist auf „Ameisenbäumen“ deren hohle Stämme Ameisen beherbergen. Der Baum scheidet „extraflorale Nektarien“ für sie aus, sie wiederum halten ihm Insekten (u.a. Blattschneiderameisen) und andere Feinde vom Leib – noch eine Symbiose. Weitere Exo- und Endoymbiosen finden sich oben in den das Regenwasser auffangenden Trichtern und Blattachseln von Bromelien, die die Flüssigkeit zusammen mit Staubpartikeln und ertrunkenen Kleininsekten durch Bakterien aufarbeiten lassen: „umgekehrte Hydrokulturen.“ Unten im Boden nehmen u.a. Käferlarven die Hilfe von Mikroben an, um die wenigen organischen Abfallstoffe dort zu verdauen.
.

Foto: pixabay.com
.
Für den tropischen Regenwald insgesamt gilt zum Einen: „Der hochgradig geschlossene Nährstoffkreislauf begründet sich auf den Artenreichtum“, zum Anderen: „Die Nutzer tropischer Fruchtbäume müssen weit umherschweifen,“ das gilt für die meisten Tiere sowie auch für die Menschen – die Waldindios, die oft nur in kleinen Gruppen leben. In einigen ihrer Kulturen spielen nicht zufällig „Magic Mushrooms“ eine wichtige Rolle.
Die inzwischen allseits anerkannte Symbioseforschung hat eine wechselvolle Geschichte. „Als eigentliche Urheber der Theorie des symbiogenetischen Ursprungs kernhaltiger Zellen gelten die russischen Biologen Andrej S. Famincym (1835-1918) und Konstantin S. Mereschkowskij (1855-1921),“ schreiben die Autoren des Buches „Evolution durch Kooperation und Integration“ (2014), in der sie die auf Deutsch verfaßten Texte von Famincyn und Mereschkowskij nachdruckten. Die beiden russischen Wissenschaftler entdeckten die Symbiose zuerst bei Flechten, ein Zusammenschluß von Algen und Pilzen. Mereschkowski sah seine „Symbiogenesetheorie“ als Alternative zur Darwinschen Mutations-Selektionstheorie, während Famincyn sie als eine wesentliche Ergänzung begriff.
Auch der Anarchist Fürst Kropotkin neigte in seiner berühmten Schrift „Gegenseitige Hilfe in der Tier- und Menschenwelt“ (1900) zu Famincyns Ansicht. In Russland war Darwin damals in sozialistischen Kreisen überaus populär, weil es nach ihm kein begründetes Hochwohlgeboren mehr geben konnte, dennoch akzeptierten sie sein Konkurrenzprinzip nicht: Dies sei bloß englisches Insel- bzw. Händlerdenken, hieß es – bei den Linken ebenso wie bei den Popen. In der Tat hatte Darwin sein Evolutionsmodell erstmalig auf den Galapagosinseln umrissen, wo die Arten auf kleinstem Raum leben mußten. Ganz anders dagegen in Sibirien, wo Kropotkin forschte – und wo er eher auf Tiere und Pflanzen gestoßen war, die sich in der unendlichen Weite suchten, um gemeinsam leichter zu überleben. Mit der Verbesserung der Mikroskopietechnik, so prophezeite Kropotkin, werde man noch auf eine Fülle weiterer Symbiosen zwischen verschiedenen Lebewesen stoßen.
.

Foto: Maria Horn
.
Ab 1968 machte die amerikanische Mikrobiologin Lynn Margulis damit Ernst – und entdeckte dabei, dass die Chloroplasten in den Pflanzenzellen, die Licht in Sauerstoff umwandeln, ebenso wie die Mitochondrien in unseren Körperzellen, die diese mit Energie versorgen, einst freilebende Organismen waren, die nun als „Organellen“ in den Zellen weiterleben. Durch diese Form einer „friedlichen Übernahme“ entstehe eine Abhängigkeit (z.B. der Mitochondrien von der sie umgebenden Körperzelle), nichtsdestotrotz „ergänzen die miteinander lebenden Wesen sich, so dass aus beiden Partnern mehr als ihre Summe wird.,“ wie es in dem eben erwähnten Symbiosebuch heißt. Der Algenforscher Dieter Mollenhauer schreibt darin: „Irgendwie läßt sich immer feststellen, dass es den beiden prospektiven Symbiosepartnern nicht besonders gut gehen darf, wenn das Zusammenspiel erfolgreich etabliert werden soll.“ Ohne den Pilz hätten es die Algen z.B. nicht geschafft, das trockene Land zu besiedeln. Außerdem versuchen die Symbiosepartner, auch noch mit anderen Lebewesen zu kooperieren: So haben verschiedene Pilze schon früher u.a. „mit Endocytobiosepartnern [Einzeller im Inneren] experimentiert und tun dies offenbar auch weiterhin“.
Kürzlich veröffentlichte das US-Magazin „The Atlantic“ einen langen Artikel über die neueste Entdeckung eines Flechtenforschers – unter der reißerischen Überschrift: „Wie ein Mann aus einer Wohnwagensiedlung 150 Jahre Biologie umstieß“. Der Biologe Toby Spribille hatte herausgefunden, dass viele Flechten überall auf der Welt nicht aus zwei, sondern aus drei Individuen bestehen. Die New York Times titelte: „Two’s a Company, Three’s a Lichen?“ Und schrieb: „In der Schule haben wir gelernt, dass ein Pilz und eine Alge eine Flechte bilden. Nun kommt überraschend heraus, dass es noch einen dritten Symbiosepartner in Flechten gibt: den Pilz Basidiomycete yeasts (eine Hefepilzart).“ Dazu wird der Genetiker John McCutcheon zitiert: „Die Entdeckung dieses Hefepilzes bringt uns die Möglichkeit näher, Flechten im Labor zu synthetisieren.“ Die Zeitschrift „The Atlantic“ entschied sich in ihrem Bericht darüber für einen pädagogischen Schluß: „Dr. Spribille war nicht allein. Für seine Entdeckung brauchte er ein ganzes Team verschiedener Experten. Dies ist ein Thema, das sich durch die gesamte Geschichte der Symbioseforschung zieht: Wissenschaftler müssen kooperieren, um die intimsten Partnerschaften in der Natur aufzudecken.“
Toby Spribille forschte an Wolfsflechten, zwei Jahre nach seiner Entdeckung, stieß er in ihnen auf einen „vierten Partner: eine weitere Pilzspezies,“ berichtet Sheldrake. „Flechten enthalten kein Mikrobiom. Sie sind ein Mikrobiom mit vielen Pilzen und Bakterien neben den beiden allgemein bekannten Mitspielern.“
.

Foto: pixabay.com
.
Je weiter geforscht wird, desto mehr „Partner“ werden in den Flechten entdeckt. So ist es auch bei einem in der Tiefsee an heißen schwefelhaltigen Quellen lebenden Wurm, den die Meeresbiologin Nicole Dubilier seit Jahren erforscht: Er hat weder Mund und Magen noch einen Darm – und kann sich trotzdem ernähren: mit Hilfe von Bakterien im Inneren. Die Bakterien des Wurms gewinnen daraus durch Sulfidoxidation Energie. Für Nicole Dubilier ist dieses Tier ein wunderbares Beispiel für eine Symbiose – für das Zusammenleben von Lebewesen.Und je weiter sie diesen Wurm erforschte, desto mehr Bakterienarten fand sie in seinem Körper. Anfangs waren es zwei, inzwischen sind es fünf.
Auch die Symbiosen von Pilzen mehren sich. Es ist eine Frage des Blicks, um nicht zu sagen, des Forscherwillens. Sheldrake schreibt: „Heute kann ein Fünftel aller bekannten Pilzarten Flechten bilden“. Einige haben es früher getan, aber heute nicht mehr – u.a. der „Penicillum“-Schimmel. „Man kann viele Formen frei lebender Pilze und Algen zusammenzüchten, und immer entwickelt sich zwischen ihnen innerhalb weniger Tage eine Symbiose zum gegenseitigen Nutzen…Indem die Partner ihre Kräfte bündeln, wird der Pilz teilweise zum Fotobionten und der Fotobiont [die Alge] teilweise zum Pilz. Und doch ähneln Flechten keinem von beiden.“ Flechten können einige tausend Jahre alt werden und es gibt rund 160.000 verschiedene Arten. Sie werden nach wie vor zu den Pilzen gezählt.
Die Symbioseforschung hat derzeit Konjunktur. Dazu gehören neben den Studien der Verhaltensforscher über Altruismus und Kooperation bei Landlebewesen, vor allem die kostspieligen Forschungen über Symbiosen in der Tiefsee, wie sie u.a. Nicole Dubilier (Leiterin der Abteilung Symbiose im Bremer Max-Planck-Institut für Marine Mikrobiologie) und Antje Boetius (Leiterin der Forschungsgruppe Mikrobielle Habitate im Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung Bremerhaven) unternehmen. Der Symbioseforschung widmen sich heute weltweit die Biologen – und zwar mehr Frauen als Männer, für Nicole Dubilier ist das kein Zufall: „Ist doch klar, es geht um Kooperation.“ Das gilt auch für viele ihrer Untersuchungsobjekte: Bei etlichen Meerestieren bergen einzig die Weibchen Symbionten in sich, die sie auch nur an ihre weiblichen Nachkommen weitergeben.
Inzwischen macht es eine neue Sequenziertechnik in den Labors möglich, ganze Lebensgemeinschaften und ihre miteinander verbundenen Stoffwechselprozesse quasi auf einmal zu analysieren, d.h. alle Genome in den Proben – vom Meeresboden, aus dem Wasser oder der Luft. Man spricht von „Holobionten“ und denkt dabei z.B. an den Menschen und seine Milliarden Bakterien, Pilze, Protisten in und an ihm und um ihn herum, ohne die er nicht lebensfähig ist, so dass man von einem „Individuum“ nicht mehr reden will. „Im biologischen Sinne gibt es kein Einzelwesen“, wie der Berliner Biologe Bernhard Kegel in seinem Buch „Die Herrscher der Welt“ (2015) schreibt. Einige US-Forscher sprechen von einer wissenschaftlichen Revolution, die „das klassische Konzept einer insularen Individualität transformiert in eines, in dem interaktive Beziehungen zwischen Arten die Grenzen eines Organismus verschwimmen lassen und das Konzept einer essenziellen Identität auflösen“.
Bernhard Kegel hat 1999 auch einen Wissenschaftsroman, „Wenzels Pilz“, veröffentlicht. Er handelt von einem genmanipulierten Pilz, der zur Bekämpfung des Waldsterbens in Norwegen eingesetzt wird – aber dabei außer Kontrolle gerät.
.

Foto: pixabay.com
.
Im tropischen Regenwald mußte man sich schon immer gegen Pilze wehren – „bevor alles verpilzt“. Bei der Körperpflege der Waldindios kommt deswegen „dem Schutz vor Verpilzung eine herausragende Bedeutung zu“, schreibt Josef Reichholf, der im übrigen im Korallenriff einen ganz ähnlichen vom Mangel bestimmten Hang oder Zwang zur Symbiose sieht wie in den tropischen Regenwäldern.
Bei uns im Norden kann ebenfalls einiges verpilzen: z.B. durch den juckenden Hautpilz und den Fußpilz, die beide durch Dermatophyten, Fadenpilze, verursacht werden. Dann die Hausschwämme aus der Familie der Braunsporrindenpilzverwandten, die verbautesHolz zersetzen. Und verschiedene Baumpilze, die noch lebende Bäume befallen. Man spricht dann z.B. vom „Kastanienrinderkrebs“ und vom „Ulmensterben“. Für die „Braunfäule“ ist u.a. der Rotrandige Baumschwamm und der Birkenporling verantwortlich, sie haben es auf die Zellulose der Bäume abgesehen. Für die Weißfäule u.a. der Hallimasch (Armillaria) und der Austern-Seitling, die den Stützbaustoff Lignin abbauen. Merlin Sheldrake erwähnt darüberhinaus noch den Reisbrandpilz, der alljährlich Reis in einer Menge vernichtet, die 60 Millionen Menschen ernähren könnte.
.

Foto: Maria Horn
.
Auf Waldbäumen findet man gelegentlich einen Schleimpilz, der aussieht wie Kotze. Vor einiger Zeit lud die Akademie der Wissenschaften in Potsdam zu einer Diskussionsveranstaltung über Kunst und Wissenschaft – am Beispiel des Schleimpilzes Neurospora crassa, der sich währenddessen dort in einem gläsernen Pavillon in 30 Petrischalen vermehrte und von weißen Pünktchen langsam über gelb-orange in schwarze Bänder überging.
Dieser Einzeller hat eine nahezu weltweite Verbreitung und wird als Modellorganismus viel erforscht. Trifft er auf einen Artgenossen (es gibt fast 1.000 Arten, sie bilden ein eigenes Reich von Organismen, einige gelten als Delikatesse), verschmilzt er mit ihm. Zusammen können sie sich schneller bewegen. „Auf der Suche nach Nahrung streckt er Ausläufer aus, wie Arme. Je größer er ist, desto mehr Arme kann er ausstrecken,“ heißt es auf „swr.de“. Seine Verschmelzung bezeichnet „Die Zeit“ als „die simpelste Form von Sex“, auch die Kerne der beiden Einzeller verschmelzen dabei. „Alle acht Stunden teilen sich nun dessen Zellkerne weiter, ohne dass sich die Zelle selbst teilt. Sie wird größer und produziert Schleim.“ Der Schleimpilz Physarum polycephalum hat laut „wissenschaft.de“ nicht zwei, sondern dreizehn Geschlechter. „Jeder dieser Schleimpilze kann sich mit jedem Geschlecht paaren, außer seinem eigenen.“ Französische Forscher zählten 720 mögliche Paarungsvarianten.
Der Schleimpilz ist zunächst eine „soziale Amöbe“, die sich von Bakterien ernährt. Bei feucht-warmem Wetter klettert sie auf Gräser und Baumstämme, wo sich ihr Schleim zu Stielen und Fruchtkapseln verhärtet und aufrichtet, während ihre Zellkerne sich in Sporen verwandeln, die für eine neue Amöbengeneration freigesetzt werden und sich dann eigenständig Nahrung wie zum Beispiel Pilze suchen. Zu ihren natürlichen Feinden gehören die Schimmelpilze.
Im Labor ernährt man Schleimpilze mit Haferflocken. Sie können lernen und Probleme lösen und sind sehr farbig. Daran kann man die Arten unterscheiden. Aber da sie nicht sehen können, fragt man sich, was die unterschiedlichen Farben sollen.
1958 erhielten zwei Genetiker für ihre Forschung mit ihm, die in der Formel „Ein-Gen-ein-Enzym“ gipfelte, den Nobelpreis. „The Revolutionary Neurospora crassa“ ist aber nicht nur ein „Almighty Fungi“, sondern auch ein Zwangscharakter, da er exakt alle 24 Stunden eine neue Generation von (schwarzen) Sporen produziert. Auf eine Verschiebung der Zeitzone reagiert er gleich uns mit einem Jetlag, wie norwegische Chronobiologen herausfanden.
Die Berlin-Brandenburgische Akademie hatte zwar für ihre Potsdamer Diskussion eine Künstlerin eingeladen, die sich mit dem Schleimpilz beschäftigt; dazu war auch noch ein bayrischer Systembiologe angereist, ihr Gespräch drehte sich dann aber weniger um Neurospora crassa: Also nicht darum, was man zu welchem Behufe alles mit ihm anstellt und was er selbst möglicherweise davon hält, sondern eher um zentrale Begriffe von Wissenschaft und Kunst: Identität, Komplementarität, Kombinatorik… Als das Publikum beim Begriff der Identität zu sehr ins Menscheln kam, intervenierte eine Physikerin mit dem „Satz der Identität in der Logik“ – A gleich A: „Da rauszukommen,“ das sei doch „die wirkliche Aufgabe der Kunst“. Ein Kunsthistoriker behauptete, um wieder auf das eigentliche Thema zurück zu kommen: „Pilze sind immer schon sehr nachdenkliche Leute.“
Dieser Begriff bezog sich anscheinend u.a. auf das kleine fernöstliche Volk der Golde des Taigajägers Dersu Usala (bekannt aus dem Bericht von Wladimir Arsenjew „Dersu Usala der Taigajäger“, der von Akira Kurosawa verfilmt wurde) sowie auf das kleine Volk der Pirahã in Amazonien (über das der Linguist Dan Everett einen Bericht, „Das glücklichste Volk“, veröffentlichte): Beide Völker benutzen das Wort „Leute“ für Tiere, Pilze, Pflanzen und Menschen gleichermaßen, um anzudeuten, dass sie die Trennung zwischen Subjekt und Objekt, Natur und Kultur, nicht mitmachen wollen und darüberhinaus allen Abstraktionen abhold sind. Mit den Worten des brasilianischen Ethnologen Eduardo Viveiros de Castro: Im Westen ist ein „Subjekt“ – der herrschenden „naturalistischen Auffassung“ gemäß – „ein ungenügend analysiertes Objekt, während in der animistischen Kosmologie der amerikanischen und anderer Ureinwohner das Gegenteil der Fall ist: Ein Objekt ist ein unvollständig interpretiertes Subjekt.“
.

.
Der Biophysiker Max Delbrück, ebenso wie der Pilzsammler Karl Berchthold gingen von einer Art Bewußtseinsskala unter den Pilzen aus. Delbrück experimentierte mit dem Pilz „Phycomyces blakesleeanus“, dessen senkrecht wachsende Hyphen berührungs- und lichtempfindlich sind. Er hielt diesen Pilz für „den intelligentesten“. Während Berchthold auf seiner Morchel-Internetseite schreibt: „Morcheln sind die schlauesten Pilze“. Der Schweizer „Morcheljäger“ Heinz Gerber scheint ihm zuzustimmen, in seinem Buch „Faszination Morchel“ schreibt er, dass „die Morchel es wie kaum ein anderer Pilz versteht, sich unseren Blicken und unserem Zugriff zu entziehen. Sie ist eine Tarnkünstlerin ersten Ranges und oft scheint es, als besitze sie Mimikry-Fähigkeiten.“ An anderer Stelle heißt es, dass sie sich sogar (weg)“ducken“ kann. Für den erfahrenen Morchelsucher gilt laut Gerber Ähnliches: ‚Sehen, aber nicht gesehen werden‘“ (um die Morchelstandorte nicht anderen Pilzsuchern zu verraten). Merlin Sheldrake erwähnt in seinem Pilzbuch ferner einen Pilzforscher, der nach einigen Labyrinth-Experten mit Schleimpilzen zu dem Ergebnis kam: „Die sind schlauer als ich“.
Auch der Edelpilz Matsutake, den die Japaner so schätzen, dass sie für ihn Höchstpreise zahlen, scheint sich weg zu ducken. Er wächst außer in Japan nur noch in Oregon – und zwar unter herabgefallenem Laub. Er ist also noch schwerer als Morcheln zu finden. „Oh Matsutake/Die Erregung, bevor man sie findet,“ dichtete der Japaner Yamaguchi Sodo im 17. Jahrhundert. In den industriell ausgewaideten Wäldern des nordwestlichen Bundesstaates wird er von Angehörigen des kleinen südostasiatischen Volkes der Hmong gesucht, die nach dem Vietnamkrieg nach Amerika flüchteten, daneben aber auch von Kriegsveteranen, Naturburschen und arbeitslosen Holzfällern. Alle vereint, dass sie nicht in der Stadt und von Sozialhilfe leben wollen. Die US-Anthropologin Anna Lowenhaupt Tsing schrieb über diese Pilzsammler ein Buch: „Der Pilz am Ende der Welt. Über das Leben in den Ruinen des Kapitalismus“ (2015). Sie hat darin auch die Handelswege von dort nach Japan und die unterschiedlichen Gewinnspannen der am Geschäft Beteiligten nachgezeichnet.
Eine fast analoge Situation fand der Regisseur Bernd Schoch bei den Pilzsuchern in den Karpaten. Es sind großteils Arbeitslose, die während der Pilzsaison im Wald campieren. Ihre Beute versuchen sie zu verkaufen. Zu ihren Konkurrenten beim Pilzsammeln zählen Bären. Schochs Film „Olanda“ über dieses temporäre Soziotop wurde im Oktober 2020 auf einem Pilzsymposion des Hamburger Kunstvereins gezeigt und diskutiert. Anschließend wurde er im Rahmen einer Filmreihe über Pilze in Berlin gezeigt.
.

Foto: pixabay.com
.
Es scheint fast so: Während die Bäume in Massen an Trockenheit zugrunde gehen, die Wälder immer weniger werden und mit ihnen die Pilze, dass sich gleichzeitig Künstler und Wissenschaftler als die letzten Pilzjäger profilieren. Aber noch ist es nicht so weit. Die sächsische Botanikerin Anne-Christine Schmidt, die nur für den Eigenverbrauch Pilze sammelt, schrieb mir: „In dieser Pilzsaison brach im Erzgebirge eine noch nie dagewesene Steinpilzschwemme aus. Das Schlimmste war, dass wir unzählige Steinpilze stehen lassen mussten,weil wir sie nicht mehr tragen konnten. Noch nie zuvor hatten wir mühsam entdeckte Pilze einfach stehen lassen. Doch diesmal gab es keine andere Wahl.“
.

Foto: Maria Horn
.
Auf dem Hamburger Pilzsymposion wurden von der Basler Medienwissenschaftlerin Ute Holl die Begriffe Rhizom und Mykorrhiza ins Spiel gebracht. Das Rhizom ist ein meist unterirdisch horizontal wachsendes Sprossachsen-System, das man auch Wurzelstock nennt. Nach unten gehen davon die eigentlichen Wurzeln, nach oben die Blatttriebe aus. Die von Pilzen gebildeten langen dünnen Wurzeln nennt man Myzel. Als Mykorrhiza wird eine Symbiose zwischen Pilzen und Pflanzen bezeichnet, bei der sich ein Pilzmyzel mit den Pflanzenwurzeln verbindet, um Nährstoffe auszutauschen. „Mehr als 90 Prozent aller Pflanzenarten sind auf Mykorrhiza-Pilze angewiesen,“ schreibt Sheldrake. Einer seiner Botanikprofessoren meinte sogar: „‘Pflanzen haben keine Wurzeln; sie haben Pilz-Wurzeln, Myko-Rhiza‘. Die Wurzeln (rhiza) folgen den Pilzen (mykes) ins Dasein.“ Beim Wiederaufforsten werden heute die Sporen der Mykorrhiza-Pilze unter die Wurzelballen der Setzlinge gleich beigegeben. Sie füttern sich dann gegenseitig. Lynn Margulis nennt das eine „langfristige Intimität von Fremden“.
Bei der Fotosynthese ziehen die Pflanzen Kohlenstoff aus der Atmosphäre, den sie in Form von Zucker und Fetten an die Mykorrhiza-Pilze in ihren Wurzeln weitergeben, von denen sie wiederum mit Phosphor versorgt werden. Da die Pilze sich aber auch mit Hilfe von Säuren und hohem Druck in Gestein bohren können und dabei u.a. Calcium und Siliziumdioxid lösen, versorgen sie „ihre“ Pflanzen auch noch mit diesen Mineralstoffen. Und nicht nur das: Die Mykorrhiza sorgt auch für den Austausch von Nährstoffen zwischen den Pflanzen, sogar zwischen denen verschiedener Arten.
Wieder war es ein russischer Botaniker Ende des 19. Jahrhunderts, der als erster die Vermutung äußerte, dass Substanzen über die Pilze zwischen verschiedenen Pflanzen ausgetauscht werden können. Aber erst 1997 konnte das eine kanadische Doktorandin Suzanne Simard nachweisen, indem sie laut Sheldrake „Paare von Baumschößlingen, die in einem Wald wuchsen, radioaktivem Kohlendioxid aussetzte. Nach zwei Jahren stellte sie fest, dass der Kohlenstoff von Birken auf Tannen übergegangen war, die beide ein gemeinsames Mykorrhiza-Netzwerk besitzen.“ Die Bäume und die Pilze geben jedoch nicht Nährstoffe wahllos an irgendwelche Bäume in der Nachbarschaft ab.
Da die russischen Botaniker und Forstwissenschaftler sich statt auf den Konkurrenzkampf zwischen den Arten eher auf ihr symbiotisches Zusammenwirken konzentrierten, hatten sie viele der diesbezüglichen Forschungsergebnisse, die heute mit modernster Technik nachvollzogen werden, bereits gedanklich vorweggenommen. „Es klingt paradox, aber der Wald braucht den Wald,“ so sagte es einer von ihnen und fügte hinzu: „Sonst stünden viel mehr Bäume einzeln, wo sie sich doch angeblich besser entfalten könnten.“ Der deutsche Förster und Waldbuch-Bestsellerautor Peter Wohlleben wiederholt heute noch einmal viele dieser Erkenntnisse russischer Biologen auf eine ähnlich kluge spekulative Weise wie sie, während die Spekulationen der angloamerikanischen Forscher schnell ins egomanisch Mystische reichen und stark auf wirtschaftlichen Nutzen abzielen.
.

Foto: pixabay.com
.
In den Siebzigerjahren wurde aus dem botanischen Begriff Rhizom ein politischer, propagiert von den französischen Philosophen Gilles Deleuze und Felix Guattari in ihrem Hauptwerk „Anti-Ödipus: Kapitalismus und Schizophrenie 1“ und „Tausend Plateaus: Kapitalismus und Schizophrenie 2“, dem ein Pamphlet „Rhizom“ folgte, auf dem nach einiger Zeit überall in den westeuropäischen Universitätsstädten Aufkleber folgten, die an Wänden und Bushaltestellen verkündeten: „Macht Rhizom! Der rosarote Panther“.
Das war explizit eine Absage an das alte europäisch-darwinistische, d.h. hierarchische Baum- und Wurzeldenken zugunsten egalitärer Organisationsformen (bzw. “Strukturen“ wie man damals und auch heute noch gerne sagt). Kurzum: Das Rhizom war eine Metapher und ein Modell für ein unterirdisch verknüpftes Beziehungsgeflecht von radikal denkenden Linken. In der Botanik hätte ihr Gegner Carl von Linné geheißen, aber die Naturwissenschaft interessierte sie gar nicht.
Dem schwedischen Systematiker ging es im 18. Jahrhundert um eine „Ordnung der Natur“. Der Westberliner Soziologe Wolf Lepenies schrieb über Linnés „oeconomia naturae“ (in: „Das Ende der Naturgeschichte“ 1986): Linné habe darin „eine Ständeordnung der Pflanzenwelt vorgestellt, innerhalb derer die Moose und Pilze die Ärmsten bilden, die Gräser als Bauern, die Kräuter als Adel und die Bäume als Fürsten anzusehen sind. Weiterhin werden von Linné die Botaniker ebenso wie das ‘Heer der Creaturen’ nach militärischen Prinzipien gegliedert. Im Heer der Botaniker sieht Linné sich selbst als General, Jussieu ist Generalmajor, Haller und Gesner müssen jeder mit dem Rang eines Obersten zufrieden sein. Für Siegesbeck gar bleibt nur die Position eines Feldwebels – ein sublimer Racheakt Linnés, der sich bei Haller über die Kritik Siegesbecks an seinem System beschwert hatte.”
In der Linnéschen Ordnung sah der Offiziersliterat und Käfersammler Ernst Jünger einen zu seiner Erhärtung in die Natur projizierten Glauben an die Unantastbarkeit der absoluten Monarchie. So ähnlich sah es 1790 auch schon die Kommune von Paris, die den „Jardin du Roi” kurzerhand in einen Kartoffelacker umzuwandeln trachtete (in Berlin wurde 1945 auf Weisung der Alliierten tatsächlich der Botanische Garten umgepflügt). Die französischen Wissenschaftler hatten diese Gefahr seinerzeit noch mit einer Selbst-Revolutionierung abwehren können: Zum einen gaben sie ihrer Institution eine demokratische Verfassung (alle Professoren sollten in Rechten und Pflichten gleich sein und aus ihrer Mitte einen Direktor wählen), zum anderen benannten sie den Garten in „Museé d’Histoire” um. Zwei Jahre später stimmte der Konvent ihren zwar opportunistischen aber doch irgendwie schon rhizomatischen Vorschlägen zu.
.

Foto: Maria Horn
.
2007 hat die Kunsthistorikerin Julia Voss auch noch den „Stammbaum“ der Arten, den Darwin zeichnete, um seine Evolution von den Amöben ganz unten bis hoch zu den Menschen in der Krone zu verbildlichen, und die der deutsche Darwinpropagandist Ernst Haeckel dann opulent ausmalte, an das aktuelle Denken angeschlossen: Darwins Bleistiftskizze stelle in Wahrheit eine Koralle dar, die einem sich verzweigenden Rhizom ähnelt. Bei dieser quasifeministischen Umdeutung des Evolutionsbildes kam es auch noch sinnigerweise zu einem kurzen Prioritätenstreit mit einem Mann, Horst Bredekamp, der zeitgleich ebenfalls ein ganzes Buch darüber schrieb, dass der Darwinsche Baum des Lebens eigentlich eine rhizomatische Koralle sei.
Bereits im Vorfeld der Pariser Kommune war das Korallenbild en vogue gewesen: In seiner hymnischen Naturgeschichte „Das Meer“ begriff der Historiker Jules Michelet 1861 die Lebensgemeinschaft „Korallenriff“ als Verwirklichung der „Ideale von 1789“. Und der linke Biologe Carl Vogt entdeckte 1866, dass „der Korallen-Polyp Socialist und Communist in der verwegensten Bedeutung des Wortes ist; nur durch gemeinsame Arbeit vieler, engverbundener Thiere kann der werthvolle Korallenstock aufgebaut werden, und diese gemeinsame Arbeit ist nur unter der Bedingung möglich, daß jedes Einzelwesen allen Gewinnst seiner ernährenden Thätigkeit an die Allgemeinheit abgiebt.“
.

Foto: Maria Horn
.
Im Moment des großen Artensterbens haben erneut laut der Kulturwissenschaftlerin Jutta Person „unbekannte Vielheiten Konjunktur“; in den „riffbildenden Korallen“ findet sich dazu „ein geradezu perfektes imaginäres Objekt“. Und mit dem Siegeszug des Internet ist dafür der Begriff des „Netzwerks“ geradezu unwiderstehlich geworden.
Aber die Botaniker und ebenso ihre Begriffs-Metaphorisierer sind inzwischen vom Rhizom zur Mykorrhiza fortgeschritten – und damit bei der Faszination für Pilze, vor allem für deren winzige Pilzfäden, dem Myzel, angekommen. Nicht nur, dass es „Myzel-Korallen“ gibt, diese kleinen in die Pflanzenwurzel reinwachsenden Pilzfäden, die Mykorrhiza also, treffen auf den derzeitigen „Geschmack“ der radikalen Linken, die immer dünner und weniger werden – im Gegensatz zur asozialen Bewegung der konsequenten Rechten (entweder ist man radikal Links oder konsequent Rechts oder eiert dazwischen rum). In anderen Worten: Der Staatsapparat ist ein „Staatsbaum“, der versucht, die Menschen zu verwurzeln, dagegen gilt es, ein „Kriegsmaschinenrhizom“ zu entwickeln. Dieses läßt sich laut Deleuze und Guattari durch sechs Merkmale bestimmen: 1. Konnexion, 2. Heterogenität, 3. Vielheit, 4. asignifikanten Bruch (es kann an jeder beliebigen Stelle zerstört werden und wuchert dennoch entlang seiner eigenen oder entlang anderer Linien weiter), 5. Kartographie und 6. Verfahren, zur Herstellung von Abziehbildern (keine Kopien).
.

Foto: pixabay.com
.
Die dahinvegetierenden Linken verstehen nun unter dem naturwissenschaftlichen Begriff der Mykorrhiza, mit zum Teil riesigen Ausmaßen, ein „World Wide Web“, und unter den sozialen Medien des Internets analog zu den Pilzen ein mögliches symbiontisches Netzwerk, geeignet die ganze Welt zu retten. Auf dem Pilz-Symposion des Kunstvereins wurde dies von der Basler Medienwissenschaftlerin Ute Holl als „Quatsch“ abgetan, wobei sie sich namentlich auf den englischen Pilzforscher unter den (kalifornischen) Weltrettern Merlin Sheldrake bezog, Sohn des Botanikers Rupert Sheldrake, der mit seiner Medientheorie „Morphogenetisches Feld“ bzw. „Morphische Resonanz“ berühmt wurde. Wenn er, der Vater, vielleicht noch das Rhizom hochhielt, dann hat sein Sohn es nun mit der Mykorrhiza, über die er seine Cambridge-Dissertation schrieb, die hier 2020 unter dem Titel „Verwobenes Leben“ veröffentlicht wurde und auf dem Hamburger Pilz-Symposion zum Verkauf auslag.
Das Pilzdenken politisch zu überhöhen, ist zwar von Sheldrake Junior intendiert, aber eben Unfug, für Pilzforscher und solche, die es werden wollen, hat er in seinem Buch jedoch viele wissenswerte Fakten zusammengetragen (u.a. bei Trüffelsammlern). Wir erinnern uns in diesem Zusammenhang an die weisen Worte des Foucaultassistenen Francois Ewald: „Es gibt immer zu viel Deutung und nie genug Fakten. Die Akte durch Deutung sind am Gefährlichsten für die Freiheit.“ Ferner wissen wir vom Bremer Universitätsprofessor Fred Abraham: „If you want to be a highflyer in science you must in Germany be a brillant theorist and in the Angloamerican Zone of Interest a good factgather.“ Nun ist Deutschland inzwischen zwar faktisch so gut wie durchamerikanisiert, aber es gibt noch immer ein paar brillante französische Theoretiker gleich nebenan, Bruno Latour und seine Mitstreiter z.B.., die ganz ohne Mykorrhiza und auch, so viel wir wissen, ohne „Magic Mushrooms“ politisch denken.
.
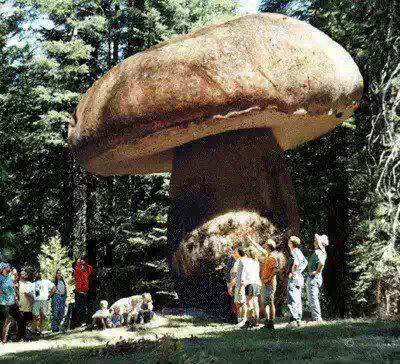
.
Einige Merksätze zum Ende der Saison:
„Laura Winterling erklärt, ‚was man aus der Einsamkeit im Weltraum für Corona lernen kann‘.“ (Berliner Zeitung)
„Im Einklang mit der Zahl wurde alles erschaffen wie auf dem Plan eines Architekten, sowohl die Zeit, die Bewegung, die Himmel, die Gestirne als auch die Zyklen aller Dinge.“ (Nikomachos von Gerasa, 1.Jhd. v. Chr.)
„Folge deinem Instinkt und gewinne eine Million“ (Werbung der Sportwettenkette „Tipstar“)
„Selbstaufklärung zur Befreiung aus fremdverschuldeter Unmündigkeit“ (Graffiti)
„Der Beruf des Schriftstellers ist doch immerhin der einzige, in dem man, ohne sich lächerlich zu machen, kein Geld verdienen kann.“ (Facebook)
Ein Schild „Fotografieren verboten!“ in einem russischen Kunstmuseum. Besucher: „Die Bilder vertragen den Blitz nicht?“ Museumsleiterin: „Nein, das Licht macht ihnen nichts aus, aber die Schnelligkeit“.
„La chatte qui rit – Des Coeurs brisés“
„Alles Fotzen außer Mutti“ (tattoo von Mao Meier)
„Altersarmut kommt nicht in die Tüte!“ (Christa Raddatz, Gründerin von Obstkäppchen e.V. – auf U-Bahnhof-Werbetafeln von „Bild der Frau“))
„Wir geben Obdachlosen ein Gesicht!“ (Schönheitschirurginnen für den Frieden e.V. – auf U-Bahnhof-Werbetafeln von „Bild der Frau“)
„Plätzchenbacken für Ruanda“ (Landfrauentreffen – Plakate in Künzelsau)




Es gibt einen Pilz, von dem man auch am Ende der Saison noch was hat – in Form von nicht ganz billigem Parfum. Der Duftstoff, der mit Hilfe des Pilzes entsteht, heißt Oud. Er ist teurer als Gold. Der Schimmelpilz wächst auf Adlerholzbäumen, die u.a. in Kambodscha gedeihen. Diese Bäume liefern auch ‚Paradiesholz‘ (Räucherholz).
„Alle Adlerholzarten tragen in ihrem Lignin die botanische Besonderheit, ein sogenanntes eingeschlossenes Phloem zu bilden. Dieses ist das primäre Gewebe, welches nach Verwundung und/oder Pathogenbefall ein aromatisches und sesquiterpenreiches Harz (Oleoresin) bildet.
Die Erstbeschreibung erfolgte 1783 durch Jean-Baptiste de Lamarck in Encyclopédie Méthodique.
Das Holz stammt von Bäumen der Gattungen Aquilaria und Gyrinops, deren Kern z. B. vom Pilz Phaeoacremonium parasiticum früher Phialophora parasitica infiziert worden ist. Nicht das Holz selbst wird verwendet, sondern eigentlich dessen Harz, das als Reaktion des Baumes auf
Verletzungen der Kambiumschicht oder einen Pilzbefall (Phomopsis aquilariae und Phomopsis spp. und andere Schlauchpilze, Schimmelpilze) entsteht.
Kultivierungsbemühungen zeigen, dass meist erst Bäume ab einem Alter von 60 Jahren mit der Harzbildung reagieren und es etwa 20 Jahre dauert, bis lohnenswerte Mengen an Harz gebildet wurden.
Nur etwa 7–10 % der Bäume in der Natur weisen diesen Pilzbefall auf. Darum wird in Plantagen durch verschiedene Methoden versucht diese Rate zu erhöhen. Dabei werden die Bäume auf verschiedene Art künstlich verwundet.
Der Duftstoff Oud wurde bereits seit dem Altertum in Indien, Ägypten, Israel und in der arabischen Welt geschätzt und zum ersten Mal um 1500 v. Chr. in altindischen Sanskrittexten erwähnt.[11]
Das ätherische Öl hat möglicherweise eine pheromonartige Wirkung. Das Holz, „Agallochon“ oder „Xyloaloe“ (Aloeholz) genannt, wird von Pedanios Dioskurides (1. Jh.) gegen Schlaffheit, Schwäche und Hitze des Magens empfohlen, sowie bei Seiten- und Leberschmerzen, Dysenterie oder Leibschneiden (Dioskurides I; 21). Es ist identisch mit dem „Ahloth“ der Hebräer, das im Hohelied Hld 4,14 EU (vermutl. 300 v. Chr.) und im Psalm Ex 45,9 EU genannt wird. Bei Plinius (1. Jh.) heißt es „Tarum“ und war eines der wertvollsten Räuchermittel. In China ist es spätestens seit dem 4. Jahrhundert bekannt.
Um das Jahr 2010 entstand ein Trend Oud als Duftnote in westlichen Parfüms zu verwenden. Hierbei werden üblicherweise synthetische Duftstoffe verwendet, deren Geruch mehr oder minder Ähnlichkeiten zu dem von Oud besitzt.“ (Wikipedia)