Weltrevolution
„Während die demokratischen Kleinbürger die Revolution möglichst rasch und unter Durchführung höchstens der obigen Ansprüche zum Abschlusse bringen wollen, ist es unser Interesse und unsere Aufgabe, die Revolution permanent zu machen, so lange, bis alle mehr oder weniger besitzenden Klassen von der Herrschaft verdrängt sind, die Staatsgewalt vom Proletariat erobert und die Assoziation der Proletarier nicht nur in einem Lande, sondern in allen herrschenden Ländern der ganzen Welt so weit vorgeschritten ist, daß die Konkurrenz der Proletarier in diesen Ländern aufgehört hat und daß wenigstens die entscheidenden produktiven Kräfte in den Händen der Proletarier konzentriert sind. Es kann sich für uns nicht um Veränderung des Privateigentums handeln, sondern nur um seine Vernichtung, nicht um Vertuschung der Klassengegensätze, sondern um Aufhebung der Klassen, nicht um Verbesserung der bestehenden Gesellschaft, sondern um Gründung einer neuen.“ (Karl Marx/Friedrich Engels, „Ansprache der Zentralbehörde an den Bund vom März 1850“ – Rundschreiben)
.
Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage, den Kommunismus der Zeitung „Junge Welt“ betreffend: „Die Aufteilung einer Gesellschaft nach dem Merkmal der produktionsorientierten Klassenzugehörigkeit widerspricht der Garantie der Menschenwürde“.
.

Bert Papenfuß
„Nehmen wir an, ich finge mit mir an, was finge ich dann mit mir an, was nicht andere dazugetan ha’m.“
.

Käsefachverkäuferin
„Das Alter spielt keine Rolle, außer man ist ein Käse,“ sagte sie, als er an der Reihe war, bedient zu werden und ihre wiederholte Aufforderung „Der Nächste bitte“ mit der Bemerkung quittiert hatte: „Ich habe Sie gerade nicht gehört, ich werde wohl langsam alt“. Sie hatte einen weißen Kittel an, in dem sie aussah wie eine Zahnärztin. Die Schriftstellerin A.L.Kennedy spricht von einer „Käseärztin“.
.
Schwarze Löcher
Der Religionswissenschaftler Klaus Heinrich sprach in einem Vortrag, den er 1993 in der Psychiatrischen Klinik des Universitätsklinikums Rudolf Virchow der Freien Universität hielt (und der jetzt neu veröffentlicht wurde), über „Sucht und „Sog“. Darin heißt es: „Wir bewegen uns in katastrophisch eingefärbten Untergangs- und Auferstehungsvisionen, damit immer noch in einem großen, kosmisch geweiteten Initiationsraum. Und damit nicht genug: Chaostheorien beschwören die Selbstordnungskräfte der Materie und lassen uns als Nutznießer davon profitieren. Wirklich populär geworden aber ist das Bild – die große Phantasie vom ‚Schwarzen Loch‘. Dies ist die erstaunlichste Schoßmetapher, die wir zur Zeit haben: spur- und zeichenlos saugt es ein und läßt verschwinden, auch die Reizüberbietung der Katastrophenmetapher ist stillgestellt, denn keine Information dringt hier heraus, geschweige, dass ein Geschichtenerzähler, ein kosmischer Aussteiger sozusagen, ihm entkäme.“
Dazu ganz aktuell – die Bild-Zeitung: „Weltallmonster bedroht Erde. Vor zwei Stunden Schwarzes Loch in Erdnähe entdeckt! Verschlingt alles erbarmungslos! Unser Reporter interviewt den Entdecker exklusiv!“
Währenddessen kommt uns die Zeitschrift „Nature“ nichtkatastrophistisch: „Ein Schwarzes Loch in 12 Lichtjahren Entfernung – die Strecke, die Licht in zwölf Jahren zurücklegt. (Licht breitet sich mit knapp 300000 Kilometern pro Sekunde, d.h. mit etwa einer Milliarde Stundenkilometern aus). Das neu entdeckte Schwarze Loch ist nur dreimal so weit vom Sonnensystem entfernt wie unser nächster Nachbar, der Stern Alpha Centauri, und gehört damit zu unserer unmittelbaren kosmischen Nachbarschaft. Die Europäische Raumfahrtagentur ESA hat sofort die Entsendung einer unbemannten Raumsonde angekündigt, die fundamentale neue Erkenntnisse liefern wird. Diese Mission ist ein Generationenprojekt: Bis die Sonde das Schwarze Loch erreicht, werden Jahrzehnte vergehen und wenn dann die ersten Daten zur Erde gefunkt werden, brauchen sie weitere 12 Jahre für den Rückweg.“
Bis das schwarze Loch die Erde verschlingt, werden wir auch Beobachter und Geschichtenerzähler dieses Vorgangs haben – u.a. dank des US-Milliardärs Elon Musk. Dazu heißt es auf „ingenieur.de“: „Der große Wettlauf zum Mars hat längst begonnen. Siedlungspläne, Baustoffe, Polizisten – auf der Erde bereiten sich schwerreiche Unternehmer und Wissenschaftler schon detailliert auf die künftige Kolonisierung des roten Planeten vor.“ Und freiwillige Siedler, die nicht vom Mars zurückkehren wollen und auch nicht können sollen, gibt es ebenfalls bereits – einige Tausend.
Aber vielleicht ist ja auch alles ganz anders: Am 30. November 2020 hieß es im Wissenschaftsforum „spektrum.de“: Wenn „die Masse des Universums in seinem Hubble-Radius so groß ist wie die Masse eines Schwarzen Lochs im gleichen Radius“, dann läßt sich unser ganzes „Universum als das Innere eines Schwarzen Lochs annehmen“, was bedeute, „wir leben in einem Schwarzen Loch“, sind also schon drin. Das konnte Klaus Heinrich 1993 natürlich noch nicht wissen.
Bei ihm heißt es weiter über das Schwarze Loch: „Der sexuelle Phantasiehorizont in dem die Forschung metaphorisch eingebunden bleibt, wird aufdringlich deutlich im sogenannten ‚Keine-Haare-Theorem‘ [des Physikers John Wheeler]: ‚Ein Schwarzes Loch hat keine Haare‘ (das bezeichnet den Umstand, dass die Beschaffenheit des Körpers, aus dessen Zusammensturz es resultiert, keinen Einfluß hat auf die Größe und die Gestalt des Lochs).
Doch so stark ist die Macht der mit Geschlechterspannung verfahrenden Phantasie, dass dieses letzte katastrophische Suchtprodukt – so möchte ich es angesichts seiner Popularität einmal nennen – doch wieder als Schoß und Schlund erscheint, freilich einer, der nur noch in der einen, der zerstörerischen Richtung tätig ist…“
Am Schluß des Vortrags heißt es: „Durch unsere Suchtgesellschaft geht ein uns allen geläufiger Riß, der das Suchtproblem unmittelbar berührt. Die Süchtigen, die sich auf den privaten Trip begeben, Alkohol- und Drogensüchtige, Sex- und Freßsüchtige z.B., sind natürlich Teil der Suchtgesellschaft. Aber es wäre vorschnell, zu urteilen, sie agierten nur deren Probleme aus, steuerten nur eben auf ihre eigene, private Katastrophe zu. Wir werden zu fragen haben, wieweit nicht Süchtige heute eingesetzt werden als Mittel, der Suchtgesellschaft zu entkommen, nicht vor ihr die Augen zu schließen, sondern Sucht der Sucht entgegenzusetzen, ‚aus der Suchtgesellschaft auszusteigen mittels Sucht‘. Sucht, so gesehen, wäre ein erster, noch untauglicher, selbsttherapeutischer Versuch.“ Auch, um die idiotische Angstvorstellung vom Schwarzen Loch los zu werden.
.

Katie Bouman – Informatikerin, der wir das Bild vom Schwarzen Loch verdanken
Eine Meldung (aus Focus): „Wissenschaftler haben das kleinste Schwarze Loch entdeckt, das jemals im All gefunden wurde… Es hielt sich lange versteckt.“
Aus Louise Erdrichs Roman „Schatten fangen“ (2012): Sie lag nackt auf der Couch und war betrunken eingeschlafen. Er ging zu ihr „und öffnete behutsam ihre Knie. Sie zog die Schenkel hoch, dann seufzte sie und ließ sie willenlos auseinanderklaffen. Er trat zurück und fokussierte die Schweinwerfer direkt auf die Stelle zwischen ihren Beinen.“ Der Sohn der beiden flüsterte seiner kleinen Schwester zu: Er „nähert sich dem Schwarzschild-Radius“. Sie wußte bereits, „dass der Schwarzschild-Radius der theoretische Punkt ist, an dem Lichtstrahlen ihre Energie verlieren, während sie versuchen, der gewaltigen Schwerkraft eines Schwarzen Lochs zu entkommen.“ Ihr Vater aber ging zurück an seine Staffelei und malte weiter am Akt seiner Frau. „Die Vulva ist gut geworden, dachte er.“
.

„Mutter Heimat“ in Kiew
.

„Mutter hebt ab“ in Kalifornien
.

„Meine Frau wollte gleich munter zum Mond“
.
Gleichheit
Will uns das amerikanische „Wikipedia“ für dumm verkaufen?: „Gleichheit bedeutet Übereinstimmung einer Mehrzahl von Gegenständen, Personen oder Sachverhalten in einem bestimmten Merkmal bei Verschiedenheit in anderen Merkmalen.“
Wir wissen es doch besser: Die mit der Durchsetzung der athenischen Demokratie erreichte allgemeine „Gleichheit vor dem Gesetz“ (isonomia) hatte bereits Diodoros aus Agyrion im 1. Jhd.v.Chr. als eine Farce bezeichnet, da ohne „Gleichheit des Eigentums“ (isomoiria) durchgesetzt.
Neuerdings hat sich der französische Ökonom Thomas Pickerty mit diesem „Gleichheits“-Begriff beschäftigt. Der Deutschlandfunk interviewte den „Rockstar der Wirtschaftswissenschaft“, der 2014 in seinem 800 Seiten starken „Das Kapital des 21. Jahrhunderts“ Daten aus 27 Ländern über einen Zeitraum von bis zu drei Jahrhunderten untersuchte und dabei nachwies, „dass der Kapitalismus systemimmanent zu einer Verschärfung der Ungleichheit führt. Auch weitere Grundüberzeugungen des Kapitalismus – beispielsweise, dass Steuersenkungen zu Wirtschaftswachstum führen würden – dekonstruierte er.“
Piketty erklärte dazu im Interview, „was ich in meinem Buch als Proprietarismus in der klassischen Ära beschreibe, sagen wir im 19. Jahrhundert und vor dem Ersten Weltkrieg, die Epoche der Ideologie „wenn wir anfangen, die in der Vergangenheit erworbenen Eigentumsrechte anzurühren, dann werden wir ins Chaos fallen“- das führte zum Beispiel zu der Entscheidung, die bei der Abschaffung der Sklaverei in Frankreich, in Großbritannien, in der Welt generell getroffen wurde, Sklavenbesitzer für ihren Eigentumsverlust finanziell zu entschädigen.“
Das war, „sagen wir, der klassische Proprietarismus des 19. Jahrhunderts bis zum Ersten Weltkrieg. Das schlägt heute niemand mehr ausdrücklich vor. Wir befinden uns heute in einer Form des Neoproprietarismus, der insbesondere auf den Zusammenbruch des Kommunismus in den 1990er-Jahren folgte, der eine weichere Form des Proprietarismus darstellt.
Mit anderen Worten, man behauptet nicht, dass man niemals die Ungleichheiten oder die in der Vergangenheit erworbenen Eigentums- oder Machtpositionen in Frage stellen sollte, aber man ist immer noch sehr, sehr misstrauisch gegenüber der Idee, über ein alternatives Wirtschaftssystem nachzudenken, und man hat eine Ideologie entwickelt, die die Organisation der Globalisierung betrifft, die auf der Idee beruht, dass absoluter Freihandel, der freie Kapitalverkehr ohne Bedingungen eine Voraussetzung ist.“
Bei Wikipedia heißt es über den „Proprietarismus“: Dies „ist ein von Thomas Piketty geprägter Begriff für ein politisch-ökonomisches System, das die Ungleichheit der Vermögen vergrößert, sowie eine Ideologie, die auf Eigentumsrechte fixiert ist, diese Ungleichheit fördert und ethisch-moralisch rechtfertigt.“
Hier findet sich auch ein Satz über den „Neoproprietarismus“: „Die Weigerung vieler Ökonomen, über Verteilungsprobleme zu sprechen, fördere laut Piketty die Entwicklung des (Neo-)Proprietarismus und legitimiere die globale Verteilungskrise; diese begrenze das vorhandene Potenzial der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung, indem sie viele Menschen ausschließe.“
Picketty ist davon überzeugt, „wirtschaftlicher Wohlstand kommt in der Geschichte in erster Linie von Bildung, von der Teilhabe möglichst vieler Menschen am wirtschaftlichen, sozialen und politischen Leben und sicherlich nicht von der Hyperkonzentration der Macht bei sehr wenigen Menschen.“ Er denkt dabei an die Handvoll amerikanischer E-Milliardäre.
Picketty ist ein Neolinker: „Ich verteidige die Idee eines partizipatorischen, dezentralisierten, demokratischen Sozialismus, der nichts mit den Staatssozialismen zu tun hat, die wir im Osten im 20. Jahrhundert gesehen haben.“
Er kann sich aber auch durchaus vorstellen: „Die Wirtschaft funktioniert mit der Gründung kleiner und mittlerer Unternehmen, wo Menschen eine Million, fünf Millionen oder zehn Millionen Euro akkumulieren, was schon ein großer Erfolg ist. Das ist nützlich.“
Der Philosoph Jean Baudrillard hat einmal über die Auswirkungen von hartem Proprietarismus und weichem Neoproprietarismus in bezug auf die Linke gesagt: „Die Menschenrechte, die Dissidenz, der Antirassismus, die Ökologie, das sind die weichen Ideologien, easy, post coitum historicum, zum Gebrauch für eine leichtlebige Generation, die weder harte Ideologien noch radikale Philosophien kennt. Die Ideologie einer auch politisch neosentimentalen Generation, die den Altruismus, die Geselligkeit, die internationale Caritas und das individuelle Tremolo wiederentdeckt. Herzlichkeit, Solidarität, kosmopolitische Bewegtheit, pathetisches Multimedia: lauter weiche Werte, die man im Nietzscheanischen, marxistisch-freudianistischen (aber auch Rimbaudschen, Jarryschen und Situationistischen) Zeitalter verwarf.
Diese neue Generation ist die der behüteten Kinder der Krise, während die vorangegangene die der verdammten Kinder der Geschichte war. Diese jungen, romantischen, herrischen und sentimentalen Leute finden gleichzeitig den Weg zur poetischen Pose des Herzens und zum Geschäft. Sie sind Zeitgenossen der neuen Unternehmer, sie sind wunderbare Medien-Idioten: transzendentaler Werbeidealismus. Dem Geld, den Modeströmungen, den Leistungskarrieren nahestehend, lauter von den harten Generationen verachtete Dinge. Weiche Immoralität, Sensibilität auf niedrigstem Niveau. Auch softer Ehrgeiz: eine Generation, der alles gelungen ist, die schon alles hat, die spielerisch Solidarität praktiziert, die nicht mehr die Stigmata der Klassenverwünschung an sich trägt.“
.

Das Rote Frauenbataillon
.

.
Oh, ein Indianer
Franz Kafka hat ihn mit einem Satz abgetan – aber in der Möglichkeitsform: „Wenn man doch ein Indianer wäre, gleich bereit, und auf dem rennenden Pferde, schief in der Luft, immer wieder kurz erzitterte über dem zitternden Boden, bis man die Sporen ließ, denn es gab keine Sporen, bis man die Zügel wegwarf, denn es gab keine Zügel, und kaum das Land vor sich als glatt gemähte Heide sah, schon ohne Pferdehals und Pferdekopf.“
Nein, wenn die jungen Indianer in der Reservaten heute nicht das Auto ihres Onkels kriegen, dann reiten sie noch immer. Meine Gewährsfrau ist die wunderbare deutsch-indianische Schriftstellerin Louise Erdrich, deren Bücher großteils vom jetzigen Leben im Reservat der Ojibwe in Nord-Dakota handeln.
Einige Stämme in Reservaten drumherum sind mit einem Spielcasino ökonomisch erfolgreich geworden, so erfolgreich, dass sie zwecks Ausschüttung der Gewinne bereits Amerikaner suchen, die nur noch zu einem Sechsunddreißigstel zu ihrem Stamm gehören. Die Verwaltung der Akten des Stammes ist zu einer wichtigen Arbeit in den Reservaten geworden. Louise Endrichs Roman „Das Haus des Windes“ handelt von einer solchen Amtsinhaberin.
In den Vereinigten Staaten gibt es 567 Ureinwohner-Gruppen und 326 Reservate. Von den 2,5 Millionen indigenen Amerikanern lebten 2012 laut FAZ etwa eine Million in diesen Selbstverwaltungsbezirken – mit eigenen Gerichten und Polizisten. Bis in die jüngste Vergangenheit haben die Weißen das Reservatsland immer wieder verkleinert, aber 2020 entschied das Oberste Gericht, die Hälfte des Bundesstaates Oklahoma den Indianern wieder zu geben, ein Gebiet größer als Deutschland. 1999 hatte die kanadische Regierung den Inuit bereits ein autonomes Gebiet – Nunavut (Unser Land) – zugestanden, das einem Fünftel der Fläche von Kanada entspricht.
In Alaska haben die vereinigten Indigenen erst den Bau einer Öl-Pipeline verhindert und dann aber befürwortet, weil sie sich davon Arbeitsplätze versprachen. Auch in Louise Erdrichs Reservats-Geschichten geht es vorwiegend um ein nicht zuletzt wirtschaftliches Ausbalancieren zwischen Amerikanischem und Indianischem. Dazu gehört u.a. zur Ankurbelung des Indianer-Tourismus die Anschaffung von immer mehr kleinen Bisonherden in den großen Reservaten. Und prompt finden sich auch wieder alte Geschichtenerzähler ein, die noch Büffel erlegt haben, bevor die Weißen sie alle, vom Zug aus, zu tausenden erschießen konnten. Den allerletzten, eine alte Bisonkuh, will angeblich ein Ojibwe geschossen haben. Sie soll sich ihm regelrecht ergeben haben, um nicht auch noch von den Weißen abgeknallt zu werden.
Ein kanadischer Indianer meinte einmal zu einem Ethnologen, der ihn über die Büffeljagd ausfragte: „Unsere Vorfahren haben die Tiere geheiratet, sie haben ihre Lebensweise kennengelernt, und sie haben diese Kenntnisse von Generation zu Generation weitergegeben. Die Weißen schreiben alles in ein Buch, um es nicht zu vergessen.“ Der Unterschied zwischen Referat und Reservat.
Dazwischen müssen sich heute die Angehörigen der „First Nations“ zurechtfinden. Mit zweierlei Wahrnehmungen, wie der brasilianische Ethnologe Eduardo Viveiros de Castro sie umreißt: Im Westen ist ein „Subjekt“ der herrschenden „naturalistischen Auffassung“ gemäß – „ein ungenügend analysiertes Objekt,“ während in der animistischen Kosmologie der amerikanischen Ureinwohner genau das Gegenteil der Fall ist: „Ein Objekt ist ein unvollständig interpretiertes Subjekt“.
Das heutige Zwischendrin-Stecken ist das (auch biographische) Thema etlicher Bücher von Louise Erdrich. Ich habe mir erst mal nur die 14 gesichert, die bisher ins Deutsche übersetzt wurden. Natürlich thematisiert sie darin auch die Zeit „bis zu dem Jahr, als man uns unsere Grenzen auferlegte. Bis zum Jahr des Reservats“.
Und dann auch die ersten Jahre im Reservat, als es schon bald keine Kaninchen mehr gab, alle gegessen: „Ah, diese ersten Jahre des Reservats, als sie uns einzwängten. Auf wenige Quadratmeiler nur. Wir hungerten, während die Kühe der Siedler sich von dem abgezäunten Gras unserer alten Jagdgründe dick und rund fraßen.“
Noch der 26. US-Präsident Theodore Roosevelt war der Meinung, die Ausrottung der Indianer durch die meist armen weißen Siedler und Pioniere sei ein „gerechter Krieg“ gewesen: „Dieser großartige Kontinent konnte nicht einfach als Jagdgebiet für elende Wilde erhalten werden“.
In Deutschland hatte schon Friedrich der Große „das liederliche polnische Zeug“ mit „Irokesen“ verglichen. Der Generalgouverneur des besetzten Polen Hans Frank bezeichnete darüberhinaus 1942 auf einer Parteiversammlung in Lemberg die Juden als „Plattfußindianer“. Adolf Hitler freute sich etwa zur gleichen Zeit – angesichts der sich entfaltenden Partisanenkriegs im Osten: „Und immer aufknüpfen! Das wird ein richtiger Indianerkrieg werden.“ Dies hielt ihn jedoch nicht davon ab, seinen Soldaten zur moralischen Festigung Karl Mays „Winnetou“-Roman mit auf dem Weg an die Front zu geben. (Im Ersten Weltkrieg packte man ihnen Goethes „Faust“ in den Tornister.)
Der polnische Schriftsteller Ludwik Powidaj hatte bereits 1864 in seinem Essay „Polacy i Indianie“ das Schicksal der amerikanischen Indianer dargestellt und dabei die Frage gestellt: „Welcher Pole wird darin nicht die Lage seines eigenen Landes erkennen?“ Auch die Letten bezeichneten sich unter deutscher Herrschaft als „die letzten Indianer Europas“.
Nachdem Ostelbien kommunistisch geworden war, entstand dort eine ganze Indianerbewegung, die offiziell „Indianistik“ betrieb, d.h. sich dem Studium der Ureinwohner Nordamerikas widmete, die als Pioniere im Kampf gegen den Imperialismus galten. Einige Intellektuelle sahen darüberhinaus aber auch Parallelen zwischen den letzten Indianern und sich: „Wir lebten in der DDR ja auch in einem Reservat.“ Die Welt ist klein, aber das Land der Indianer groß.
.

.
Berufskalender-Girls
Meine Freundin schrieb mir, sie hätte in der 20. KW einige Tage frei. Ich schrieb zurück: Was heißt KW? „Kalenderwoche! Kennst Du das nicht?“ Wann die 20. Kalenderwoche war, mochte ich sie danach gar nicht mehr fragen, sondern googelte. Im „Karpfenkalender“, in dem es um tote Karpfen in den Händen von lebendigen Mädchen in nassen T-Shirts geht, fehlte ausgerechnet der Monat mit der 20. KW. Aber im „Feuerwehrfrauenkalender“ wurde ich fündig. In diesem Kalender findet man pro Monat eine oder mehrere halbnackte Feuerwehrfrauen („zum Feuer anfachen“) zusammen mit allerhand modernen Geräten, die man heute zum „Feuer löschen“ braucht.
Ich war da auf ein ebenso seltsames wie expandierendes Marktsegment bei den „Terminplanern“ gestoßen. Man kennt vor allem den berühmten Pirelli-Kalender – sozusagen die Urmutter aller Pin-Up-Kalender. Dessen Herausgeber, der italienische Reifenkonzern (an dem neuerdings der russische Ölkonzern „Rosneft“ beteiligt ist), will ihn nun, nach 57 Jahren, einstellen, nachdem die Fotografen immer teurer und die Mädchen vor ihrem Auslöser immer berühmter geworden sind. Mehr ist wohl in dieser Minimaltext-Maximalbild-Gattung nicht drin. Oder machte auch diesem Printprodukt das Internet den Garaus?
Nun gibt es aber statt eines Gummikonzern-Kalenders, einen von mehr oder weniger billigen Fotografen und gänzlich unbekannten Mädchen zusammengestellten „Werkstattkalender“, die sich die Arbeiter und Handwerker in ihren Spind hängen sollen.
Ebenso „Baumaschinenkalender“, in denen zarte Mädchen alljährlich auf möglichst massigen Baggern posieren. Ferner Tattoo-Kalender mit komplizierten Motiven auf nackten tätowierten Mädchen.
Und „Boxenluder-Kalender“, in dem sogenannte „Grid Girls!“ posieren: überraschenderweise alle züchtig bekleidet mit einem Regenschirm in der Hand, auch die Hintergründe ihrer Wirkungsstätte (Rennstrecken) sind bewußt unscharf gehalten.
Die Kalender mit „Kackenden Katzen“ und „Kackenden Hunden“ sowie mit „Fickenden Tieren“ lass ich weg, ebenso die mit zu tötenden Tieren: die „Jagdkalender“ – mit „bierernstem Mörderblick“ oder mit „humorvollem Blick auf die grüne Passion“. Auch wenn die zum Abschuß freigegebenen Rehe und Hirschkühe den Betrachter durchaus noch oder schon an grazile Frauen erinnern. Aber das liegt wohl daran, dass viele Adressaten, unter den Jägern, wie der DDR-Dramatiker Heiner Müller mutmaßte, zwar töten, aber nicht ficken können.
Erwähnen muß man noch den „Bauernkalender“, der sich großer Beliebtheit erfreut. Es gibt deutsche, österreichische und Schweizerische „Bauernkalender“, auch „Jungbauernkalender“ genannt, die von den dortigen Verbänden herausgegeben werden – seit Mitte des 19. Jahrhunderts bereits. Man findet darin heute leichtbekleidete Jungbäuerinnen, sie sind umgeben von Ställen, Gärten, Nutztieren, Traktoren, füttern Tiere, drücken ein Huhn an ihr Herz oder zeigen auf dem Heuboden ihren Brüsten die Männer. Es gibt auch Kalender mit Jungbauern, sie posieren durchweg mit freiem Oberkörper.
In dem mir vom Verlag überlassenen „Jungbäuerinnenkalender“ will über die Hälfte der abgelichteten Rural-Models Bäuerin werden bzw. den Hof der Eltern übernehmen und lernt bzw. studiert Landwirtschaft oder Verwandtes. Nun haben die Landmädchen, die im Sommer in der elterlichen oder verwandtschaftlichen Wirtschaft mithelfen müssen, dies schon seit langem leicht bekleidet und zunehmend leichter bekleidet getan: „Wenn ich schon nicht an den Badesee fahren kann, dann will ich mich wenigstens bei der Arbeit ausziehen“. Seinem „Nachruf auf die Kleinbauern“ (sie stellen nur noch 2 Prozent der Bevölkerung) hat der österreichische Sozialforscher Bernhard Kathan deswegen den Titel „Strick, Badeanzug, Besamungssets“ gegeben. Den Badeanzug trug eine seiner Informantinnen immer zur Erntezeit auf dem Feld.
Auf dem Jungbäuerinnenkalenderbild für Juni läßt sich Veronika aus Innsbruck-Land im Bikini vor einen Wasserfall fotografieren. Die Allgäu-Stefanie im Juli vor der Ernte in einem Kornfeld (mit Mähdrescher) und die Schwaben-Stefanie im September nach der Ernte mit Strohgaben auf einem Stoppelfeld. Die jahreszeitliche Folge geht dann – dem bäuerlichen Arbeitsrhythmus folgend – so weiter, dass Heidi im Oktober in Hotpants und mit hohen Absätzen, die ihre langen, schlanken Beine gut zur Geltung bringen, ein Bullenkälbchen am Strick über den Hof zerrt – das wahrscheinlich zum Schlachter soll. Im November mistet Andrea aus Deutschlandsberg einen leeren Stall aus, damit er neu belegt werden kann. Sie ist dabei derart ins Schwitzen geraten, dass sie ihre Felljacke aufgeknöpft hat. Im Dezember schließlich backt Anna in Top und Minirock ihre Lieblingsweihnachtsplätzchen.
Die Vernutzung der Tiere und der erotische Frohsinn, mit dem dies geschieht, kommen in den Jungbäuerinnenkalendern schön zur Anschauung.
.

.
Dreierbeziehungen
Der schwedische Jäger und Tierphotograph Bengt Berg veröffentlichte 1930 ein Buch mit dem Titel „Die Liebesgeschichte einer Wildgans“, das ein internationaler Bestseller wurde. Er lebte an der südschwedischen Küste und hatte dort im Mai 1926 sechs Gänseeier von einer Pute ausbrüten lassen. Als die Jungen schlüpften übernahm er sie, wobei er sie beringte – mit Zahlen von 1 bis 6. Die „Nummer 5“ war die „kleinste, zarteste und schüchternste“, deswegen kümmerte er sich besonders um sie. Sie konnte bald, wie ihre fünf Geschwister, fliegen, zog es im Herbst aber vor, in Südschweden zu bleiben – auf dem Eis in der Bucht vor Bengt Bergs Haus, wo sie sich „eifersüchtig von einem großen kanadischen Gänserich bewachen ließ,“ der nicht fliegen konnte.
Sie flog jedoch im Frühjahr mit einem „jungen Graugänserich herum“. Er durfte dem Kanandaganter nicht zu nahe kommen, d.h. sie und er waren nur zusammen, wenn die „Gans Nummer 5“ aus der Bucht herausflog. Ihr Nest baute sie dann aber „innerhalb der Bucht“. Wenn sie mit dem jungen Grauganter unterwegs war, bewachte der alte Kanadaganter ihr Gelege. Zusammen mit ihm zog sie dann auch ihre neun Jungen groß. Im Herbst flog sie mit ihnen und ihrem Liebhaber in den Süden. Ende Mai des darauffolgenden Jahres war die Gans Nummer 5 mit fünf neuen Jungen wieder in der Bucht.
Sie brachte auch diese fünf zum Hüten dem flügelbeschnittenen Kanadaganter, sobald die Jungen jedoch fliegen konnten, wurden sie vom Liebhaber der Mutter, dem Grauganter, in der Luft beschützt, vor allem gegen Adler. Im Herbst flog sie diesmal nicht wieder in den Süden, sondern blieb mit ihren fünf Jungen beim „großen flügellahmen Gänserich“. Zu Bengt Bergs Überraschung auch ihr jugendlicher Liebhaber. Der alte Kanadaganter versuchte ihn möglichst zu übersehen und der Grauganter machte sich nützlich, indem er bei Aus-Flügen für alle die Seeadler abwehrte.
Anfang Juni des darauffolgenden Jahres kam die „Gans Nummer 5“ wieder in die Bucht zurück – erneut mit fünf Jungen. Auch diesmal brachte sie diese zum Hüten dem Kanadaganter, wenn sie mit ihrem Liebhaber herumflog. Ihre Ménage-à-trois hielt sich, aber „da sie die weitaus klügere war, hing alles von ihrer Überlegung und von ihrem Willen ab. Sie hatte das Vertrauen zu mir, weil ich sie erzogen hatte. Der Kanadaganter folgte, wo er von selbst niemals hingegangen wäre. Und die Kinder – sie folgten und gehorchten ihr, aber nur ihr,“ schrieb Bengt Berg.
Um sich vorzustellen, wie sich diese Dreierbeziehung aus der Sicht der Gans Nummer 5 darstellte, kann man sich vielleicht bei der französischen Feministin Benoite Groult ein Bild machen – in ihrer freizügigen Liebesgeschichte „Salz auf unserer Haut“. Die Autorin lebte an einer Bucht der irischen See und angelte täglich. Sie ist mit einem Schriftsteller verheiratet, hat Kinder mit ihm und daneben einen bäuerlichen Liebhaber, der Kapitän eines Thunfischfangschiffes wird, mit dem sie sich immer wieder an luxuriösen Badeorten trifft. 2018 wurde Benoite Groults irisches Tagebuch posthum von einer ihrer Töchter veröffentlicht: „Vom Fischen und von der Liebe“. Der Kapitän war in Wahrheit ein naiver US-Pilot, dessen große Liebe zu ihr bis zu seinem Tod währte.
Groults Roman löste 1988 einen Skandal aus und wurde dadurch ein Weltbestseller. Auch der mit den nationalsozialistischen Rassentheorie sympathisierende Bengt Berg fand das Verhalten seiner Gans Nummer 5 skandalös, insofern er davon ausging, dass der junge Grauganter der Vater ihrer ersten Kinder war: „Es wäre ja auch ganz gegen die Natur, mit diesem Fremden Mischlinge zu erzeugen,“ meinte er. Erst später fand er kleinlaut heraus, dass der alte Kanadaganter doch ihr Vater sein mußte.
Kann man die Dreierbeziehung der Gans Nummer 5 mit der von Benoite Groult oder auch mit der von Lola Randl, einer in einem brandenburgischen Dorf mit ihrem Mann und ihrem Liebhaber lebenden Schriftstellerin („Der große Garten“ 2019) vergleichen? Wobei das lokale und permanente Arrangement von Randl wohl komplizierter aufrecht zu erhalten ist als das von Groult, die ihren Liebhaber nur ein paar Mal im Jahr traf. Lola Randl verliert darüber aber kein Wort. Möglicherweise kann man das Liebesleben von Schriftstellerinnen und Gänsen gar nicht ohne weiteres vergleichen, dabei klingt noch die Nazi-Biologie nach, die in den USA als Soziobiologie betrieben wird. Beim Tierforscher Konrad Lorenz war das noch fast unschuldig: In einem Aufsatz aus dem Jahr 1940 schrieb er: „Die vorliegende Arbeit soll versuchen, aus dem Verhalten von Tieren gewisse, in den tiefsten Schichten menschlichen Seelenlebens sich abspielende Vorgänge dem Verständnis näher zu bringen.“ Gänsewissen ist auch Menschenwissen. Als ihm damals ein Vorwurf daraus gemacht wird, antwortete er: „Wir vermenschlichen nicht die Tiere, sondern vertierlichen den Menschen“. Als er 1973 den Nobelpreis erhielt, wurde ihm das als Naziideologie angekreidet.
Die Nazi-Biologen arbeiteten jedoch lieber mit „staatenbildenden Insekten“ als mit untreuen Vögeln. Der nationalsozialistische Staatsrechtler Carl Schmitt war sich mit dem sozialdarwinistischen Insektenforscher Karl Escherich, dazumal Rektor der Münchener Universität, einig: Der Ameisenstaat kann „nie ein Rechtsstaat sein“, die sozialen Insekten haben das Problem biologisch gelöst. Und die Nazis machten sich anheischig, es ihnen nachzutun. Denn dieser „Totalstaat reinster Prägung“ sei bei den Menschen „bisher noch nicht erreicht.“ Escherich lehrte 1934: „Das oberste Gesetz des nationalsozialistischen Staates ‚Gemeinnutz geht vor Eigennutz‘ ist im Insektenstaat bis in die letzte Konsequenz verwirklicht.“
Von den Ameisen wird noch immer auf die menschliche Gesellschaft geschlossen, schlimmer noch: Die Soziologen sollen von den Entomologen lernen, wenn sie weiterhin ernst genommen werden wollen. So geht es der nach dem Krieg in den USA entstandenen „Soziobiologie“ nach wie vor um das vergleichbare Sozialverhalten von Tieren und Menschen. Die heutigen „Ameisenpäpste“, die Soziobiologen Edward O. Wilson und Bert Hölldopler, entblöden sich z.B. nicht, zu behaupten: „Ameisen wie Menschen haben die Fähigkeit zum äußersten Opfer“.
Schon der Lehrer von Lorenz, Oskar Heinroth, hatte 1941 – kriegsbedingt – einen Aufsatz mit dem Titel „Aufopferung und Eigennutz im Tierreich“ veröffentlicht. Er leitete damals das Aquarium im Berliner Zoo, bis dieses durch Bomben vollständig zerstört wurde – und er seinen letzten Lebenswillen verlor.
Eine Biosoziologie dagegen läßt leider auf sich warten, also die Auflösung der Biologie in Soziologie oder, mit den Worten von Timothy Morton: eine „Ökologie ohne Natur“. Bezogen auf die Gans Nummer 5 und Groult/Randl könnte man mit der feministischen Biologin Donna Haraway auch sagen: „Es gibt weder die Kultur noch die Natur, aber viel Verkehr zwischen den beiden.“ Die Literaten – vor allem die russischen – gehen schon lange davon aus: Von Tolstoi bis Pasternak korrespondiert die Natur ständig mit den Leidenschaften der Menschen – und umgekehrt. In Joseph Roths Roman „Radetzkymarsch“ sind es vor allem die Gänse, die um den beginnenden Krieg und das Ende der k.u.k Monarchie wissen – und es den Menschen kundtun.
.

.
Die NZZ titelte am 9.Mai 2021: „Die Chinesinnen wollen keine Kinder mehr bekommen. Ihnen ist auch die Lust auf eine Hochzeit vergangen. China steht vor einer demografischen Krise.“ Weiter heißt es: „Chinas Demografie-Experten haben ihre Prognosen geändert. Bisher waren sie davon ausgegangen, dass es erst ab 2030 weniger Chinesinnen und Chinesen auf dem Festland geben wird; nun haben sie diesen Wendepunkt auf das kommende Jahr vordatiert.“
Die New York Times berichtete am selben Tag: „China versucht, Geburten in Xinjiang zu unterdrücken. Die chinesischen Behörden zwingen Frauen in der Region Xinjiang dazu, sich entweder Spiralen einsetzen zu lassen oder sich sterilisieren zu lassen. Damit verschärfen sie ihren Griff auf die muslimischen ethnischen Minderheiten und versuchen, eine demografische Verschiebung zu orchestrieren, die ihre Bevölkerung über Generationen hinweg schrumpfen lassen wird.“
Der österreichische Kurier schreibt: „Wegen Pandemie: Drastischer Geburtenrückgang in den USA erwartet. Forscher haben anhand von früheren Krisen eine Hochrechnung erstellt. Sie gehen davon aus, dass in den USA 2021 rund 500.000 weniger Babys geboren werden.“
Diese Staaten haben ein absurdes Problem: Sie wollen immer mehr Menschen (reinblütige Chinesen die einen, weiße Amerikaner die anderen). Es leben aber bereits 7 Milliarden Menschen auf der Erde, das sind mehr als 26 Milliarden zu viel – an Ressourcenverbrauchseinheiten.
Die ebenso absurde katholische „Tagespost“ schreibt über das Parteiprogramm der Grünen: „Streichung der §§ 218 und 219 aus dem Strafgesetzbuch, die vorgeburtliche Kindstötung als Regelleistung des Gesundheitswesens zuzüglich der kostenlosen Abgabe von Kontrazeptiva – die Liste der Zumutungen, welche die Klima- und Krötenschützer den Bürgern auferlegen wollen, ist für Christen unannehmbar.“
Die indianisch-deutsche Bestseller-Autorin Louise Erdrich hat einen dicken Roman über dieses absurde Problem geschrieben: „Der Gott am Ende der Straße“ (2019). Es geht darin um faschistische US-Fundamentalisten, die alles tun, damit Frauen Kinder gebären. Es werden Prämien gezahlt für Denunzianten, die schwangere Frauen anzeigen. Diese werden bis zur Geburt ihres Kindes inhaftiert, das Kind wird ihnen weggenommen. Andere Frauen werden gegen ihren Willen künstlich befruchtet.
.

.
Sanifair
Die Indiepopgruppe „Blond“ singt: „Sanifair Millionär hat den Highway-Flair“. Ich habe zwei Sanifair-Bildwitze aufbewahrt: Ein Typ geht an einem Mercedes-Geschäft vorbei an dessen Schaufenster ein Plakat hängt: „We accept Sanifair“, dazu das Logo der Firma, der alle Toiletten auf den Autobahnraststätten gehören. Sanifair ist die Tochterfirma des Autobahn-Raststätten-Betreibers „Tank & Rast“. Der Konzern war einst staatlich und wurde dann für 1,3 Milliarden DM verkauft (nachdem er alle Einrichtungen der MITROPA übernommen hatte): an den Finanzinvestor Terra Firma und einem Fonds der Deutschen Bank.
2015 verkauften diese „Tank & Rast“ an ein Konsortium „um den Versicherungsriesen Allianz. Zu der Käufergruppe gehören daneben der kanadische Infrastruktur-Fonds Borealis, der Staatsfonds von Abu Dhabi, ADIA, und die Münchener-Rück-Tochter MEAG,“ meldete die „tagesschau“. „Der Kaufpreis für die 390 Raststätten, 350 Tankstellen und 50 Hotels“ betrug 3,5 Milliarden Euro.“ Jährlich muß „Tank & Rast“ dem Staat Konzessionsgebühren um 17 Mio Euro zahlen, dieser hält dafür die Anlagen für 110 Mio Euro im Jahr instand.
Im Privatisierungsvertrag hieß es 2016: „Die Tank & Rast wird sich bemühen, die unentgeltliche Benutzung von sanitären Einrichtungen ganzjährig durchgehend sicherzustellen.“ Sie bemühte sich aber nicht. Gegen die Kostenpflicht bei Benutzung der Toilettenanlagen ist der Kabarettist Rainald Grebe juristisch vorgegangen – jedoch erfolglos. Unterdes hat sich der Abgeordnete der Partei „Die Linke, Victor Perli, zu einem weiteren Sanifair-Gegner profiliert.
Die Tochterfirma von „Tank & Rast“ „Sanifair“ verwendet statt Toilettenfrauen oder -männern, denen man 50 Cent für die Benutzung der Toiletten bezahlte, elektronisch gesteuerte Drehkreuze, die sich nur mit dem Einwurf von einem Euro öffnen lassen. Dafür bekommt man einen „Wertbon“ in Höhe von 50 Cent wieder. Da man diesen nur an den Raststätten einlösen kann, es dort jedoch so gut wie keine Waren zu diesem Preis gibt, kauft man notgedrungen irgendetwas teureres aus ihrem Angebot und verrechnet den Sanifair-Bon damit beim Bezahlen (Benzin ist davon ausgenommen). „Branchenschätzungen zufolge generiert jeder Sanifair-Bon knapp dreieinhalb Euro Umsatz,“ schreibt Florian Werner.
Auch auf den großen Bahnhöfen sowie in Österreich und in Ungarn gibt es seit einiger Zeit Sanifair-Toiletten. Ebenso in Ketten wie McDonald‘s, WMF, Nordsee und Backwerk.
Mein zweiter Sanifair-Bildwitz mit dem Titel „Tod eines Handlungsreisenden“ zeigt eine Frau, die einem Notar gegenübersitzt, der ihr mit wenigen Worten ein Testament vorliest: „Ihr Vater hat ihnen 3197 Sanifair-Bons hinterlassen.“ Auf Wikipedia ist zu erfahren: „Eine repräsentative Befragung des Marktforschungsinstituts INSA ergab, dass fast die Hälfte der Deutschen diese Gutscheine selten oder nie einlöst“.
Der Berliner Schriftsteller Florian Werner hat in seinem neuen Buch über die Raststätte „Garbsen Nord“ – „eine Liebeserklärung“ natürlich auch ein Kapital über die üblen Machenschaften von Sanifair eingefügt. Ich mochte schon seine Bücher „Die Kuh. Leben, Werk und Wirkung“ und „Schnecken. Ein Porträt“, und kenne die Raststätte „Garbsen Nord“, in der eine Familie bereits in der dritten Generation den Geschäftsführer stellt.
Weil ich auch dieses Buch von Florian Werner mit Vergnügen gelesen habe, hier einige seiner Überlegungen und meine Einwände: Für ihn sind die Autobahn-Rast- und Tankstellen „Nicht-Orte“, die jeder Kunde oder Gast so schnell wie möglich wieder verläßt. Der Autor hat sich dort für seine Recherche allerdings im Autobahn-Motel einquartiert. Er hat nur einen Flaschensammler getroffen, der fast täglich kommt – mit dem Fahrrad, „Garbsen Nord“ ist sein „Revier“.
Es gibt jedoch etliche Jugendliche in Sachsen und in den niedersächsischen Dörfern der Umgebung der Raststätte „Allertal West“ (nicht weit von „Garbsen Nord“ auf der A7), die Nachts, wenn die Kneipen schließen, auf die Raststätte fahren, wo eine nette Frau aus einem der Dörfer arbeitet. Sie nennt sie ihre „Dauergäste“.
Auf einer anderen Raststätte in Hessen, Pfefferhöhe, arbeitete der Verleger Werner Pieper als Koch und der Schriftsteller Uwe Nettelbeck durfte dort in der Küche, jedesmal wenn er nach oder von Frankfurt aus unterwegs war, für seine Frau „Porridge“ zubereiten. Auch er war eine Art Dauergast.
Und von mir und von vielen Freunden weiß ich, dass wir, egal welche Autobahn wir von Berlin aus nehmen, dort immer die selben Autobahn-Raststätten anfahren. Die Pfefferhöhe wurde nebenbeibemerkt 1983 von einer Familie übernommen, es war „das erste privat geführte Rasthaus an deutschen Autobahnen“, wie es auf seiner Internetseite heißt.
Den schönsten Satz in dem Autobahn-Raststätten-Buch sagt „die Rechte Hand“ des Geschäftsführers von Garbsen Nord, die trotz Radiomusik in ihrem Büro ständig die Autobahn hört: „Wenn das nicht mehr wäre, dann sei es, glaube sie, vorbei.“
Man wird sie noch einige Jahre hören, aber mit dem Ende der „Petromoderne“ werden auch wohl ihre einst stolzesten Stützpunkte an den Autobahnen, notgedrungen als vegane Radfahrer-Treffs enden. Der Autor selbst isst schon kein Fleisch und hat auch kein Auto mehr.
Das diesem Ende vorausgegangene Fading-Away der Moderne in die Postmoderne wurde übrigens von dem Philosophen Jean-Francois Lyotard erstmalig erfahren, als er in das Urinal der Universität von Aarhus pinkelte, das danach automatisch per Lichtstrahl spülte.
.

Brigitte Helms
.
Technikgeschichte
„Der Computer ist das erste Werkzeug in der Technikgeschichte, mit dem man keine Bierflasche aufmachen kann,“ meinte Peter Glaser kürzlich auf Facebook. Ich dachte, man kann doch an jeder scharfen Kante und mit jedem harten Gegenstand, einschließlich Wegwerffeuerzeuge, Bierflaschen öffnen, also würde Peter Glaser sich irren, denn so etwas hat eigentlich jeder Computer. Sie wurden ja nicht wie die Radios und Fernseher rund oder eiförmig aus Plastik gestaltet. Bei den anfänglichen riesigen Zentralrechnern konnte man jedenfalls an allen Ecken und Enden seine Flaschen öffnen. Aber vielleicht hat sich dabei mit der weiteren „Entwicklung“ eine psychische Barriere aufgebaut, so dass man nun aus Scheu gegenüber dem potentiellen Humanoid „PC/Internet“ keine Flaschen mehr daran öffnet. Dabei gäbe es selbst in ihren Innereien noch jede Menge flaschenöffnertaugliche Hardwareteile. Aber Peter Glaser denkt vielleicht an die Software, mit diesem „Weapon of Math Destruction“ kann man tatsächlich keine Flaschen mehr öffnen – vom ersten Algorithmus an bereits nicht mehr.
Weil aber Flaschenöffner zu den beliebtesten Werbegeschenken, nicht nur von Brauereien und Getränkegroßhändlern, gehören, zudem immer mehr Arbeits- und Küchengeräte, wie Korkenöffner, auch Flaschenöffner integriert haben (die teuerste Kombination, von Manufactum, kostet 59 Euro) und auch die Souvenirläden, vor allem an der Küste, gerne Flaschenöffner mit Badeortsangabe ins Sortiment nehmen, deswegen gehört der Flaschenöffner heute schon fast zu den kleinbürgerlichen Kitsch-Objekten, die als Erinnerungsstücke gelten, aber gleichzeitig eine Funktion haben. So wie die Muschel als Andenken an Sylt ein Thermometer hat. Der Formen- und Farben-Reichtum dieser Erinnerungsstücke mit Gebrauchswert ist riesig, ganze tropische Muschelpopulationen sind allein der Thermometermuschel-Nachfrage in den Badeorten zum Opfer gefallen. Ganz schlimm wurde es dann noch einmal nach dem Mauerfall, als die Ostdeutschen in Massen solche und ähnliche Souvenirs kauften. Präparierte Fische, wie Knurrhahn und Scholle, mit kleinem Kompaß z.B. Noch heute erfreuen sich unter Landratten die Flaschenöffner namens „Sea-Club“ in Form einer Kapitänsmütze aus Messing (für 6 Euro 8) einer gewissen Beliebtheit, besonders unter Hamburger und Kieler Seglern. Sie werden an die Wand bzw. an die Kajütentür geschraubt und befinden sich deswegen auch bei Windstärke 11 noch an Ort und Stelle.
So wie man beim Computer auf Algorithmen zurückgehen muß, sollte man beim Flaschenöffner auch auf den Kronkorken zu sprechen kommen. Über diese wußte ich zunächst nicht viel mehr als dass Onkel Dagobert in einer Donald-Duck-Geschichte bei einem Südseevolk landete, deren Münzen Kronkorken waren. Aus irgendeinem Grund wurde Dagobert von ihnen beschenkt und zum Dank überschütteten seine Flugzeuge die Insel mit Kronkorken – womit ihre Verwendung als Zahlungsmittel beendet wurde.
Ich nahm an, die Erfindung des Kronkorkens stammt ebenfalls aus den USA, seit dem Wikipedia-Eintrag von 2006 weiß ich nun: Der Kronkorken wurde von dem Erfinder William Painter (1838–1906) aus Baltimore 1892 zum Patent angemeldet. Er nannte seine Erfindung „Crown Cork“ . 1892 gründete er das Unternehmen „Crown Cork & Seal“.
Seine Kronkorken mußten sich anfänglich noch gegen den Bügelverschluß auf Flaschen durchsetzen. Einige Brauereien an der deutschen Küste haben sie noch heute, sie verschließen die Flasche besser als Kronkorken, die eigentlich nur einmal (maschinell) rauf auf den Flaschenhals– und dann (per Hand) wieder runter gedrückt werden, sie sind ein Wegwerfprodukt, wie lange Zeit eigentlich auch die Flaschen, die ihrerseits von Getränkedosen vom Markt verdrängt worden wären, wenn nicht die Regierungen mit verschiedenen Verordnungen eine Koexistenz zwischen ihnen erreicht hätten.
Der heute übliche Kronkorken weist 21 Zacken auf; ursprünglich waren es 24 Zacken. Ein Grund für die Änderung war eine Reduzierung des Flaschenhalsdurchmessers. Die Norm für die Kronkorken dafür lautet: DIN EN 17177. Auf der Internetseite „mb-kronkorken.de/DDR“ findet man alle DDR-Kronkorken, auf denen Reklame für eine Biersorte oder für “Club-Cola“ gemacht wurde. Die DDR hielt sich lange Zeit nicht an die Richtlinien der internationalen Kronkorken-Vereinigung der Glas- und Getränkehersteller, weil sie arbeiterkulturbewußt an den 24 Zacken ihrer Kronkorken festhielt. Mit steigendem Export dann aber doch.
Nach der Wende beeilte sich die Stasiaufklärungs-Stelle des Westens einen videodokumentierten Fall zu veröffentlichen: „Der Technische Direktor des Berliner Brauereien hatte dem DDR-Ministerrat über Probleme des Betriebs mit Flaschenverschlüssen berichtet. Die Stasi beschäftigte sich intensiv mit dem Fall. Die Geheimpolizei witterte Sabotage des Westens.“
2020 klärte die Mitteldeutsche Zeitung jedoch auf: Der letzte Generaldirektor des Mansfelder Kombinats berichtete der Zeitung, dass er „schlaflose Nächte wegen Kronkorken“ gehabt hatte: Die Kronkorkenfabrik des Kombinats kam nicht mit der Produktion für die Brauereien hinterher, zumal der Nachschub an Rohlingen immer wieder stockte und diese zudem oft von schlechter Qualität waren.
Erinnert sei ferner daran, dass Teile des Proletariats, hüben wie drüben, ihr Schlüsselbund am Gürtel trugen, verbunden mit einem Flaschenöffner, manchmal sieht man solche „Prolls“ auch heute noch; an der Stelle hängt jedoch immer öfter ein außen getragenes Smartphone in einem Lederetui – womit wir wieder bei der Verbindung von Computer und Flaschenöffner wären.
.

.
Das Peng-Kollektiv
Das Berliner „Peng-Kollektiv“ hat viel von den amerikanischen „Yes Men“ gelernt. Über diese heißt es auf Wikipedia, sie sei eine „Netzkunst- und Aktivistengruppe, die Kommunikationsguerilla betreibt“. Über ihre antikapitalistischen Einschleich-Aktivitäten, die oft aufwendige Projekte sind, gibt es einen Film. Über die Aktivitäten des „Peng-Kollektivs“ gibt es jetzt ein Buch: „Wenn die Hoffnung stirbt, geht‘s trotzdem weiter“, das ihr Mitgründer Jean Peters schrieb.
Im Theater muß man sich um nichts kümmern als um den Text und wie der Regisseur ihn gedeutet haben will. Das Publikum ist meist stumm und gutwillig. Nicht so bei „Peng“. Da ist das Publikum der Feind, und es ist auch nicht sonderlich gutwillig (auf einer Aktionärsversammlung beispielsweise). Es würde bei dem leisesten Verdacht, da stimmt doch was nicht, reagieren – und u.U. die Polizei holen.
Einmal war es umgekehrt, da simulierte das Peng-Kollektiv eine solche honorige Versammlung, aber der eingeladene Manager eines Waffenkonzerns, dem man einen „Friedenspreis“ verleihen wollte, witterte Unrat und verschwand vorzeitig. Das Kollektiv war ihm (noch) nicht gut genug, um seine „Szene“ zu repräsentieren. Auf ihren Filmen (alle Einschleich-Aktionen werden gefilmt) sieht man: Die Peng-Leute faken „Authentizität“, z.B. bis zu dem Moment, da das Kollektivmitglied J.P. auf einer AfD-Versammlung der Rednerin Beatrix von Storch zwei Torten ins Gesicht wirft – und daraufhin niedergeworfen wird. Die Peng-Künstler benutzen dafür das Wort „Aufklärung“ – und tatsächlich klären sich ihre listigen Projekte am Ende wie die Pointe eines Witzes auf.
Der Kriegstheoretiker Karl von Clausewitz verglich die List mit dem Witz: „Wie der Witz eine Taschenspielerei mit Ideen und Vorstellungen ist, so ist die List eine Taschenspielerei mit Handlungen“. Für das aktionistische Peng-Kollektiv ist das wie Theorie und Praxis. Der gelernte Clown Jean Peters schildert in seinem Buch akribisch die Vorbereitungen einer Aktion, die zugleich immer ein Medien-Coup sein soll. Deswegen ist im Buch viel von „Livestream“, „Knopfkamera“, „Rechenzentrum“, „blogs“ und „mailadressen“ die Rede. Das Eindringen in eine andere, fast geschlossene Welt, liefert am laufenden Band Bilder und Töne, die im Netz dann Nachrichten (News besser gesagt) „generieren“ – wenn das optimal (d.h. wie geplant) funktioniert, einmal als Aktion und dann als Clip im Internet, der sich dort verbreitet, ein „Spreader“ wird. Für die Aktivisten und Sponsoren ist das (auch finanztechnisch) Kunst, selbst wenn es strafbar ist, jemanden zu „torten“ und auch wenn die davon Betroffenen das anders sehen. Das Kollektiv arbeitet zudem oft mit dem Schauspiel Dortmund zusammen.
Denkt man an ähnliche Künstlergruppen in Berlin, wie die „Rollende Road-Show“ der Volksbühne, „Rimini Protokoll“ und das „Zentrum für politische Schönheit“, dann hat es den Anschein, als würde es das Theater (der Grausamkeit), die Bühne, die Techniker und die Schauspieler wie in alten Tagen nach draußen ziehen – in die weite Welt. Vom „Living Theatre“ bis zum „Kreuzberger Straßentheater“ und der Nürnberger Publikationskommune „Peng“ reichte einst das Spektrum. So als wäre es die wahre Herausforderung aller Mimen, waschechte Securitymen auf einer hochrangigen NATO-Konferenz zu spielen – und nicht mehr auf buhlenden Bühnen tagaus tagein.
Das Frankfurter „Bräunungsstudio Malaria“ mit Indulis Bilzenz und Walter Baumann hat das ein paar Mal auf größeren Veranstaltungen gemacht. Sie waren eigentlich jedesmal enttäuscht – darüber, dass die Leute sich ihnen gegenüber allzu willig ausweisten.
Mehr als enttäuscht, deprimiert geradezu, waren damals die Schauspieler des Forum-Theaters am Kurfürstendamm. Wenn sie vor Beginn der Vorstellung an der Bar saßen, jammerten sie: „Heute zum 2436. Mal diese Scheiß-‚Publikumsbeschimpfung‘ von Peter Handke, und nur wegen der dämlichen Berlintouristen.“ Ihre Beschimpfungsarien kamen von Herzen, laufend fügten sie dem Text sogar neue Schimpfworte hinzu. Es wurde trotzdem immer grausamer.
Die Entwicklung des Peng-Kollektivs reichte vom eher spontanen politischen Engagement zur „Medien-Guerilla“ und läuft letztendlich auf einige Tomfilm-Dokumente ihrer künstlerischen Arbeiten hinaus. Damit müßte man eigentlich in die Künstlersozialkasse (KSK) aufgenommen werden. Jean Peters erwähnt allerdings nicht, wie es mit ihren Ein- und Ausnahmen aussieht. Er erwähnt aber mehrmals Greenpeace und arbeitete kurz bei Oxfam. Das Kollektiv hat eine riesige Adressenliste („natürlich digital und gegen Datenklau gesichert“) – Rechercheverbund, die Hedonistische Internationale, Redaktionen (u.a. die taz), Anwälte, Multiplikatoren, Sympathisanten mit Spezialwissen, Location- und Ausrüstungsbeschaffer…Man glaubt gar nicht, wieviel Welt man praktisch erwirbt, wenn man z.B. eine zuverlässige Uniformschneiderin sucht oder irgendein Elektronikteil für eine Schnittstelle zum „Öffentlich-Rechtlichen“.
Einer der „Yes Men“ schreibt über das Buch von Jean Peters: „Endlich wird der Schleier über dem Spektakel des teuflisch cleveren Peng Kollektivs gelüftet.“
.

.
Untergehende Dingwelten
„Von meiner 2016 gestorbenen Mutter sind einige Dinge auf mich gekommen,“ schreibt mein Freund Peter Funken, „ein hölzerner Kochlöffel, blaue von ihr gestrickte Topflappen und ein Brotmesser aus dem Jahr 1960, produziert von der Henkels AG Solingen mit dem Zwillingszeichen, das auf dem Griff montiert ist, sowie einer verblaßten Gravur auf der Klinge: „friodur“ – das ist ein Verfahren, um Stahl besonders haltbar und elastisch zu machen.“ Das Brotmesser ist immer noch voll funktionstüchtig.
2016 kam ein Dingfilm über ein Küchengerät ins Kino, ein Dokumentarfilm aus Suhl: „Kommen Rührgeräte in den Himmel?“. Eine junge Frau kauft in einem Elektronik-Supermarkt ein elektrisches Handrührgerät für 9 Euro 99, wahrscheinlich in China hergestellt. Das Gerät gibt gleich beim ersten Einsatz in ihrer Küche seinen Geist (!) auf. An einem Flohmarktstand erwirbt sie daraufhin ein neues Rührgerät für 20 Euro. Es ist laut Wikipedia ein „RG28“, das im ehemaligen Kombinat VEB Elektrogerätewerk Suhl hergestellt wurde: „Sie ist fasziniert von dem Gerät, das nach über 40 Jahren immer noch einwandfrei funktioniert. Sie begibt sich auf die Suche nach den Menschen, die dieses Gerät in der DDR herstellten. Sie redet u.a. mit Ingenieuren, Journalisten, Theologen, Psychologen, Archäologen, Recyclinghof-Betreibern über unsere heutige Wegwerfgesellschaft, über geplanten Verschleiß und wie sich die Beziehung zu unseren Alltagsgegenständen im Laufe der Zeit geändert hat. Die ständige Frage, die der Film als roten Faden benutzt, lautet: ‚Warum verwehren wir unseren Alltagsgegenständen das, wonach wir uns selbst so sehr sehnen: ewiges Leben?‘“ Gleich am Anfang des Films, den es vielfach im Internet zu sehen gibt, fällt das Wort „Kapitalismus, mehr muß man nicht sagen“.
Mit Lenin hätte man aber auch sagen können: Die Kapitalisten kaufen uns noch unsere Rührgeräte ab, mit denen wir sie verquirlen werden.“ Es kam jedoch erst mal anders, wie wir wissen. Aber wir wissen auch, das chinesische Rührgerät für 9 Euro 99 kommt ganz sicher nicht in den Himmel – sondern auf den Müll. Doch wie ist es mit dem Suhler Rührgerät, das gebraucht 20 Euro kostete – und das im Gegensatz zur DDR anscheinend unkaputtbar ist? Kommt wenigstens dieses Ding in den Himmel?
Man weiß inzwischen, dass man (radioaktiven) Müll nicht auf dem Mars verklappen darf, denn „Mars bringt verbrauchte Energie sofort zurück,“ wie es in der Werbung für diesen klebrigen Ami-Schokoriegel heißt, bei dessen Herstellung die Arbeiter in der Mars-Fabrik jeden Morgen zu Gott im Himmel beten müssen: „Herr, mach Mars zu einer erfolgreichen Marke/Herr, verlaß uns nicht!“ Kein Scheiß! Die weißen christlichen Amis sind so grauenhaft. Die US-Indianer, die Angehörigen der „First Nations“ können darüber nur den Kopf schütteln. Sie gehen eher davon aus, dass in jedem Ding ein Geist wohnt. So bat z.B. ein Sioux-Häuptling, der auf einem Zug der Pacific Railroad Company arbeitete, jedesmal den Geist, der dem VW-Käfer eines deutschen Ethnologen innewohnte, um Erlaubnis, einsteigen zu dürfen.
Und so dachte wohl auch der jüdische Philosoph Spinoza, als er meinte: „Gott steckt in jeder Tomate (Pflanzen, Pilze und Tiere zählen in Europa zu den Dingen). Zudem stellen sie und andere Sachen als Ware die „gesellschaftlichen Verhältnisse“ her, wie Marx schrieb, wohingegen wir als Personen/Produzenten „sachliche Verhältnisse“ eingehen.
Der französische Wissenssoziologie Bruno Latour geht implizit von dieser Annahme aus, dass auch noch im lächerlichsten Ding etwas Geistiges steckt, denn seine Akteur-Netzwerk-Theorie (ANT) versucht sie als „Akteure/Aktanten“ zu begreifen, also als handelnde, die immer öfter an unserer Stelle handeln. Sie sind somit quasi beseelt. Beispiel: Die künstlichen Bodenwellen auf den Fahrbahnen, wo man langsam fahren soll. Weil diesbezügliche Verkehrsschilder nicht nutzten (die Autofahrer fuhren trotzdem schnell), kam man auf diese queren „Speed-Breaker“, über die die Autofahrer jetzt aus egoistischen Gründen (damit ihr Auto heil bleibt) langsam fahren müssen. Man hat ihre fehlende Moral an Ingenieure, Straßenbauarbeiter und Beton delegiert, würde Latour sagen, und das funktioniert auch einwandfrei – aufs Nachhaltigste.
Der Frage, ob DDR-Rührgeräte nun, im christlich verblödeten Gesamtdeutschland, in den Himmel kommen, könnte die freigeistige indische Schriftstellerin Arundhati Roy vielleicht in ihrem Buch „Der Gott der kleinen Dinge“ (1997) bereits beantwortet haben – eher als Spinoza, der Gott vom Himmel auf die Erde – in die Dinge – holte (und deswegen aus der jüdischen Gemeinde von Amsterdam verbannt wurde). Für Arundhati Roy ist dieser (hinduistische?) Gott, einer von vielen, der sich aber speziell um die alltäglichen kleinen Dinge „kümmert“. Wo er ist oder sitzt, sagt die Schriftstellerin nicht. Er ist wahrscheinlich überall, auch wenn es manchmal ihn entschuldigend heißt: „Er kann ja nicht überall sein und sich um alles kümmern.“ Um das handlich orangene Rührgerät „RG28“ kümmerten sich erst einmal aufs Schönste die Filmemacher Reinhard Günzler und Bert Göhler. Sie meinten es ernst, schrieb der Tagesspiegel, denn sie fassten „die Apokalypse in Gestalt einer Müllverbrennungsanlage ins Auge“. Das ist gut gesagt, denn die Apokalypse, das ist Gottes Weltgericht, sein vernichtendes Urteil, und in der Müllverbrennungsanlage werden im Kapitalismus mit wachsender Beschleunigung (aufgrund geplantem Verschleiß) alle „Ressourcen“ der Erde zügig vernichtet.
Der Soziologe Harald Welzer führte auf einer Tagung aus, dass die Ökologiebewegung – inklusive Parteien, Gesetze, Verordnungen, Forschungsinstitute, Lehrstühle, NGOs, Naturschutzbeauftragte Umweltbundesamt- und -ministerien – eine enorme „Karriere“ gemacht habe. Aber, gab er zu bedenken, gleichzeitig werde jedes Jahr „ein neues Weltrekordjahr im Material- und Energieverbrauch“ angezeigt.
.
Der Investor kaufte im großen Stil Aktien des Telefonanbieters Verizon und des Ölkonzerns Chevron, von Anteilen am Covid-19-Impfstoffhersteller Pfizer und am Hard- und Software-Entwickler Apple trennte er sich. Pfizer soll wegen mutmaßlicher illegaler Medikamententests 7 Milliarden an Nigeria zahlen und der Apple-Kurs dümpelt vor sich hin.
.

Weinstein, Epstein, Maxwell in Prinz Edwards Palastgarten
.

Klaus-Dieter in Burgwedel auf der Bundesstrasse 447
.
Querbeziehungen
Der südfranzösische Zoosystemiker Luis Bec hat die Biologie einmal definiert als den Versuch, transversale Beziehungen zu anderen Arten aufzunehmen. Die englische Historikerin Helen Macdonald kam dem nahe, als sie sich einen Habicht zulegte. In ihrem Bericht „H wie Habicht“ (2015), das von ihrem Habicht-Weibchen „Mabel“ handelt, geht es zunächst darum, dass sie mit ihr vertraut werden wollte und dabei wunschgetrieben dahin kam, „ein Habicht zu werden“, was dann nicht gut ausging: „Irgendwas lief schief“.
Vielleicht kann man aber gar nicht eine transversale Beziehung eingehen und zugleich der selbe bleiben wollen. Erinnert sei an Victor Aubertin, der Katzen mehr als Menschen liebte. Er arbeitete 1928 für das Berliner Tageblatt in Rom, wo er eines Tages verschwand. Man fand ihn geistig verwirrt in Trajans Forum zwischen lauter verwilderten Katzen.
Und neuerdings an die französische Anthropologin Nastassja Martin, die auf Kamtschatka den (schamanistischen) Bärenkult einer Gruppe von Wald-Ewenen studierte und während einer Wanderung von einem Bären schwer verletzt wurde. In Paris im Krankenhaus fragt sie sich, ob sie nun „Halb Frau, halb Bär“ sei. Der Lehrer von Nastassja Martin, Philippe Descola, der den „Animismus“ gewissermaßen rehabilitierte, hatte gemeint, „Die Bären machen uns ein Geschenk,“ dieser Satz enthält für die Autorin den Gedanken, „dass ein Dialog mit den Tieren möglich ist.“ Im Krankenhaus soll sie ihre Schmerzen auf einer Skala von 1 bis 10 einordnen, aber sie denkt eher daran, dass sie all die „medizinischen Prüfungen durchmacht, weil es ein ‚Wir‘ gegeben hat“.
Erwähnt sei ferner die finnische Ethnologin und Vogelkundlerin Ulla-Lena Lundberg. In ihrem Buch „Sibirien: Selbstporträt mit Flügeln“ (2003) schreibt sie: „Von Vogelbeobachtern heißt es, sie seien Menschen, die von anderen Menschen enttäuscht wurden. Darin liegt etwas Wahres, und ich will nicht leugnen, dass ein Teil des Entzückens, mit anderen Vogelguckern gemeinsam draußen unterwegs zu sein, in der unausgesprochenen Überzeugung liegt, die Vögel verdienten das größere Interesse.“
Überhaupt mehren sich im Misanthropozän Geschichten von Leuten, die in einer Art Anthropause sich auf ein oder mehrere Tiere (oder auch Pflanzen) einlassen, d.h. konzentrieren. Die Extremfälle, das „Animal Hoarding“, Leute, die z.B. 20 Katzen in einer kleinen Wohnung halten, werden in den USA inzwischen als quasi offiziell „krank“ klassifiziert.
Die von Berufs wegen mit Tieren „arbeitenden“, Biologen und Psychologen z.B., neigen in der Regel dazu, schon aufgrund ihrer Prägung durch das gesammelte Artwissen, sich auf keine konkrete Tier-Beziehung einzulassen und stattdessen die ganze Art zu „lieben“, d.h. zu schützen und ihre Forschung in den Dienst der Arterhaltung zu stellen: „Um eine Tierart zu schützen, muß man sie erst einmal kennen,“ sagen sie.
Der Münchner Ökologe Josef Reichholf meint dagegen in seinem „kritischen Lagebericht zu den Überlebenschancen unserer Großtiere“ mit dem Titel „Der Bär ist los“, den er 2007 veröffentlichte, nachdem man in Bayern den eingewanderten Braunbären Bruno erschossen hatte: „Menschen schützen die Tiere, die sie erhalten wissen wollen, mit dem Herzen und nicht mit dem Verstand. Der Aufschrei der so vielen Menschen, die der Abschuss von ‚Bruno‘ zutiefst getroffen hatte, war und ist verständlich, weil er ihnen ins Herz ging.“
Dies scheint Josef Reichholf auch für die Naturforscher zu fordern, wenn er in einem Interview sagt: „Tiere, auch solche in freier Wildbahn, müssen zu Individuen mit besonderen Eigenheiten werden. Zu lange wurden sie lediglich als Vertreter ihrer Art betrachtet, sogar von Verhaltensforschern. Das machte sie austauschbar und normierte sie zum ‚arttypischen Verhalten‘, aus dem die ‚artgerechte Haltung‘ abgeleitet wurde. Und das ist falsch.“
In seinen Büchern, über Hunde, Eichhörnchen/Siebenschläfer und Rabenvögel macht er es besser – eine Mischung aus Empathie mit einem Tier und den Stand der Erforschung seiner Art, und das eine wird durch das andere bereichert, auch mit manchmal kühnen Thesen. Der Meeresbiologe und Regierungsberater für Meeressäuger, Karsten Brensing geht noch einen Schritt weiter (weg von der objektivistischen Naturwissenschaft), wenn er meint: „Um Tiere besser zu verstehen, ist es notwendig, sie zu vermenschlichen“. Der Erfurter Verhaltensforscher war selbst erschrocken, als er dies das erste Mal öffentlich sagte.
Der Förster und Bestseller-Autor Peter Wohlleben könnte ihm zustimmen, wobei er dabei vor allem aus seiner Walderfahrung heraus argumentiert – und dabei soziologisiert und popularisiert. Er arbeitet an einer Biosoziologie. Dem gegenüber steht die Soziobiologie – eine amerikanische Verhaltensforschung, der die Nazi-Biologie vorausging: In beiden ging und geht es um die Tierforschung als Menschenforschung. Dabei lösen sie die Sozialwissenschaften in Biologie auf, während Wohlleben eher umgekehrt verfährt.
Die Idee einer „transversalen Beziehung“ zu bestimmten Tieren gehört mit zu einer Rehabilitierung des animistischen Denkens. Spricht das für ein nahes Ende der Ära der Petromoderne und seinem Fortschrittsdenken, von der zum Beispiel die Kulturwissenschaftler Alexander Klose und Benjamin Steininger in ihrem „Erdöl-Atlas der Petromoderne“ (2020) ausgehen.
Für den brasilianischen Ethnologen Eduardo Viveiros de Castro ist im Westen ein „Subjekt“ – der herrschenden „naturalistischen Auffassung“ gemäß – „ein ungenügend analysiertes Objekt, während in der animistischen Kosmologie der amerikanischen und anderer Ureinwohner das Gegenteil der Fall ist: Ein Objekt ist ein unvollständig interpretiertes Subjekt.“
Ein kanadischer Indianer erklärte einmal einem Ethnologen, der ihn über die Büffeljagd ausfragte: „Unsere Vorfahren haben die Tiere geheiratet, sie haben ihre Lebensweise kennengelernt, und sie haben diese Kenntnisse von Generation zu Generation weitergegeben. Die Weißen schreiben alles in ein Buch, um es nicht zu vergessen.“ Ich würde hinzufügen: Und um sich nicht zu vergessen, denn schließlich erscheint kein Buch ohne Autorennamen.
Bei den Golde und den Inuit sind es Robben, deren Sprache sie lernen (müssen). Der sowjetische Biologe Sawwa Uspenski war Vorsitzender einer internationalen Arbeitsgruppe zum Schutz der Eisbären. Bei seiner Erforschung der Arktis und ihrer Urbevölkerung gelangte er zu der Überzeugung, dass das Verhältnis der Tschuktschen und Eskimos zu ihrer Umwelt und zu ihren „Ernährern“ (den Robben, Rentieren, Moschusochsen, Walrossen, Walen, Eisbären, Vögeln und Fischen), ihre bescheidene Ökonomie also, ökologisch vorbildlich war, wie er in einem seiner Bücher über die arktische Fauna schrieb, von denen 18 in der DDR erschienen, ein kleines auch in der BRD: „Eisbären“ (1979). Seltsam, dass die dem technischen Fortschritt geradezu verfallenen Sowjets ihm ein derartiges Forschungsergebnis durchgehen ließen. In den frühen Sechzigerjahren registrierte er im Übrigen auf den arktischen Inseln der Sowjetunion schon die Klimaerwärmung und den Packeisrückgang. War das bereits der Anfang vom Ende der Petromoderne?
Im Herbst wird dazu im Kunstmuseum Wolfsburg bereits eine „Retrospektive“ auf diese Dämmerung der Ära Petromoderne eröffnet: „Oil. Schönheit und Schrecken des Erdölzeitalters“. (Da die Kuratoren, Klose und Steininger, die über 1000 Jahre alte Erdölförderung und -verarbeitung der Burmesen bei ihrem globalen Thema ausgespart haben, sei hier auf die „bewegungsmeldungen aus burma“, im blog-eintrag vom 25.9.2007 verwiesen – auf die verwickelte Geschichte des „Burma Oil“.)
Ende 2020 veröffentlichten die beiden Kulturwissenschaftler zudem einen „Atlas der Petromoderne“. Er behandelt die Petromoderne bereits als eine abgeschlossene Ära. Als Leitmotiv für den Atlas gilt: Mit der petromodernen Mobilität war in den letzten 100 Jahren die Idee der absoluten Freiheit und des Überflusses verbunden – und das ist vorbei. Dahinter ging es um die Kolonialisierung der Natur, wobei die Schönheit der menschlichen Kultur darin bestand, dass sie das überschreitet, dass sie alles überschreiten kann. „Das stimmt ja auch, aber nur, weil der Input an fossiler Energie da immer rausgerechnet wurde,“ meint Alexander Klose, der von „Extraktivismus“ spricht, sowie von „Neo-Extraktivismus“, wobei er uns als „Arbeiter“ denkt, die wir am laufenden Band Daten produzieren, die Rohstoff für IT-Konzerne und Geheimdienste sind. Im Atlas heißt das entsprechende Kapitel „Daten sind das neue Öl“. Die Verwertung unserer Daten, das ist sozusagen der Preis der (Internet-)Freiheit.
.

.
Nachtragend zu Luis Becs „Querbeziehungs“-Versuch seien hier noch einige „Regeln“ aus seinem „Handbuch des kleinen Zoosystemikers“ aufgeführt:
„1.6 Jeder Zoosystemiker hat, wie allgemein bekannt, geheime, zoologische Systeme zu entdecken und zu erforschen.
1.8 Zoosystemiker zu sein und es auch bleiben zu wollen, bedeutet also, daß man bereit sein muß, sein ganzes Leben umzuformen. Vom Phantasieleben erzeugte unterschwellige Zoologien lassen explikative mit implikativen Teilfragmenten der Forschung überschneiden.
1.9 Das setzt voraus, daß der auserkorene Gestalter über die nötigen Fähigkeiten verfügt, Zoosysteme und Morphogenesen auf der Basis von handwerklichen, phatasiebegabten, symbolischen, logischen, phantasmatischen, rationalen und methodologischen Aktivitäten aufzubauen.
1.10 überdies muß alles unternommen werden, um in den Augen der Mitmenschen das Erscheinungsbild eines durchschnittlichen und vernunftbegabten Menschen aufrechtzuerhalten.
2.1. Jeder Zoosystemiker, der auf sich hält, sollte – ohne viel Aufhebens – in Form einer fabulierenden Erkenntnislehre auf eine fiktive Zoosystemik hinwirken.
4.2. Er muß stillschweigend und gelassen hinnehmen, von den Wächtern über die ‚Eigenarten‘, den großen Vertretern des Wissens, den bedingungslosen Anhängern des Mythos vom Kunstschaffenden mit dem abgeschnittenen Ohr, von den sehr ehrenwerten Kunstkritikern und sogar von den Medizinstudenten im vierten Semester ausgebuht zu werden.
5.6 Er sollte mit der Fähigkeit begabt sein, Expeditionen in die vagen und konturlosen Zwischenreiche einer atopischen Zoogeographie vorzubereiten.
10.1 Das Paradigma der Tierhaftigkeit des Lebendigen ist das bevorzugte Interventionsgebiet des fortgeschrittenen Zoosystemikers.
10.2. Er muß der inneren Überzeugung sein, daß in der Wiedergabe des Lebendigen die Ganzheit in gedrängter Form dargestellt wird. Das Verhältnis des Menschen zum Tier ist im Verlauf seiner Geschichte nichts anderes als eine Gestaltung, eine dramatische Simulierung der Nichtübertragbarkeit.
10.5. Er muß sich ständig vergegenwärtigen, daß das Paradigma der Tierhaftigkeit insgesamt viel besser durch eine plurale Semantik bezeichnet oder dargestellt wird als durch die wissenschaftlichen Bestandteile einer objektiven Zoologie.“ (Sorgues, 1985)
.

.

.

.
Verspießern
Trotz diverser Distanz-Maßnahmen ließen wir uns neulich zu fünft lang und breit über die sozialen Wirkungen von Corona aus. Dabei kamen wir nicht auf die z.T. erschreckende Ängstlichkeit vieler Leute zu sprechen, deren gerauntes Credo da lautet: „Nach Corona wird nichts mehr so sein wie es war“ – ein ähnliches Mantra wie zuvor das „Wir müssen uns neu erfinden“. Nein, es ging uns um die Verspießerung dank der Pandemie und ihrer Gegenmaßnahmen, denn es schien uns, dass nur die Verheirateten oder Quasi-Verheirateten (Paare mit und ohne Kinder) gute Überlebenschancen haben. Und zwar solche, bei denen der oder die eine noch täglich in einer Firma arbeitet und der oder die andere zu Hause bleibt. Nach Feierabend auf dem Weg in dieses gemeinsame Zuhause ruft er oder sie dann vom Supermarkt aus an und fragt,was für das Abendessen noch eingekauft werden muß, das der oder die Andere dann zu Hause zubereitet. Selbst die modernsten und politisch korrektesten Beziehungen würden sich derzeit auf dieses spießige Minimal-Familienmodell zurückgeworfen fühlen – und gutheißen. Statt Plädoyers für Polyarmorie wird jetzt ein Buch nach dem anderen über Corona veröffentlicht!
Zu diesem erzwungenen Kleinfamilienkonzept fiel einem am Tisch das Buch „Minimum“ des FAZ-Herausgebers Frank Schirrmacher ein. Es war 2006 veröffentlicht worden und galt als ebenso konservativ wie frauenfeindlich. Im Wikipedia-Eintrag über das Buch des mit 54 an Überbewertung gestorbenen FAZ-Medienhypers steht: „Der Titel ‚Minimum‘ verweist auf Schirrmachers Analyse der Folgen der Auflösung der Familie als ‚Keimzelle der Gesellschaft‘ und damit der Schrumpfung sozialer Beziehungen auf ein Minimum. Die soziale Überlegenheit der ‚Überlebensfabrik Familie‘ in Notzeiten lässt sich seiner Argumentation nach besonders mit einem amerikanischen Mythos belegen: der ‚Tragödie der Siedler am Donnerpass‘, wo überwiegend „Einzelkämpfer“ ohne familiäre „Blutsbande“ im Schneesturm zu Tode kamen, Familienmitglieder hingegen überlebten.“
Unter dem Eintrag „Donnerpass“ erfährt man: 1864 machten sich 87 Siedler auf den Weg in den Westen der USA, der Führer ihres Trecks hieß George Donner. Aufgrund einer Fehlentscheidung von ihm wurden sie in den östlichen Bergen der Sierra Nevada vom Winter überrascht. Etwa die Hälfte von ihnen starb, die andere Hälfte überlebte nur deswegen, weil sie Teile der Gestorbenen aßen, darunter die Indianer Luis und Salvador, „sie wurden erschossen“. Zuletzt war nur noch eine Handvoll Siedler übrig.
„Der Donner Memorial State Park nahe dem Ostufer des Donner Lake erinnert an die Katastrophe. Die Stelle, an der die Familie Donner am Alder Creek lagerte, wurde zur National Historic Landmark erklärt.“
Schirrmacher machte aus diesem Irrsinns-Treck ein Plädoyer für die Kleinfamilie, die einzig das Überleben im sozialen (und nun zudem pandemischen) Winter ermöglicht, alle allein oder in Gruppen Lebenden gehen zugrunde. Seine Ehefrau, mit der er ein Kind hatte, Angelika Klüssendorf, ließ sich von diesen kühnen Gedanken jedoch nicht überzeugen und reichte die Scheidung ein. Einige Jahre später schrieb sie über ihre „schwierige Ehe“ und den darauffolgenden „Scheidungskrieg“ einen Roman: „Jahre später“ (2018).
Was Schirrmacher in den Schlußfolgerungen aus seiner Analyse der Siedler-Tragödie am Donnerpass vernachlässigte, war dass die (Ehe-) Paare nur deswegen überlebten, weil sie die Nicht-Verpaarten aßen. Und zwar, wie man heute weiß, indem er oder sie das Fleisch besorgte, während er oder sie dann am Lagerfeuer das Essen zubereitete. Diese aus Europa stammenden Siedler aßen nämlich nichts Rohes.
Damit wäre Schirrmachers Plädoyer für die Kleinfamilie jedoch erst realistisch geworden, wie wir jetzt während der Corona-Restriktionen im Winter 2020/21 sehen. Wobei diese Liebes- oder Ehepaare es jedoch zum Glück nicht mehr nötig haben, auf das magere Fleisch von Singles zurückzugreifen, in den Kühltruhen der Supermärkte finden sie einstweilen noch genügend Hähnchen- und Puten-Filets, Rindersteaks und Lammlachs-Streifen. Auch Fisch, frisch und in Dosen, ist noch genug da.
Man kann sagen: Angelika Klüssendorfs Erzählung über ihre Ehe mit Schirrmacher ist weitaus näher an der Wirklichkeit als Schirrmachers Interpretation der Donnerpass-Tragödie in seinem Buch „Minimum“ – wenn man den Kannibalismus der Siedler nicht als Entspießerung ihres „Go West“-Kitsch ansieht. Über Klüssendorfs Buch „Jahre später“ heißt es auf amazon: Die Autorin entwickelt darin die „Anatomie einer toxischen Partnerschaft. Als Leser wünscht man bis zuletzt, dass sie gelingen möge, und zugleich, dass es endlich ein Ende hat mit den beiden.“ Was dann ja auch der Fall war. Aber immerhin entgingen die beiden dadurch den Durchhalte-„Werten des Bürgertums“ – wie das „info wortbedeutung“ das „Spießertum“ definiert.
.

Guillaume Paoli
„Aus dem Glashaus über dem Staatstheater blickte man über die altehrwürdigen Dächer und fragte sich mit Guillaume Paoli, ob sich die Welt tatsächlich dahingehend verändert hat, dass nur noch global vernetzte (Neu-)Reiche das Sagen haben, während der Rest der Menschheit es verdient, als engstirnige Ewiggestrige verachtet zu werden,“ schreibt die Allgemeine Zeitung.
.
Jagdgeschichten
1.
Der Arzt Robert McCormick war ein Vogelliebhaber , und das hieß im 19. ,und auch noch im 20 Jahrhundert, dass so einer jeden Vogel, den er interessant fand, vom Himmel holte. Er kam vor allem als Schiffsarzt auf einer mehrjährigen Expedition der englischen Admiralität in die Antarktis auf seine Kosten. Während der Reise erschoß er quasi alles, was fliegen konnte, aber auch Pinguine. In seinem Reisebericht rechtfertigte er sein Tun: „Auch wenn es zu meinen Pflichten gehört, diesen ausgesprochen schönen und interessanten Tieren den Garaus zu machen, tut es mir doch in der Seele weh, und jeder Schuß ist von Gewissensbissen begleitet, so sehr liegen mir diese gefiederten Wesen am Herzen.“
Mit ähnlichen Worten haben viele Zoologen, wenn sie alt und anerkannt waren, solche Tötungen rechtfertigt und bedauert. Zuletzt las ich sie bei einem australischen Wissenschaftler (Tim Flannery „Im Reich der Inseln“). Er ging von der Vermutung aus, es müsse noch viel mehr Säugetiere als bekannt auf den Südseeinseln geben – und klapperte sie der Reihe nach ab. Er fing mit Netzen u.a. Flughunde, dabei entdeckte er tatsächlich ein paar neue Arten. Sie kamen ausgestopft in das Sydneyer Naturkundemuseum, hunderte andere waren Forschungsabfall. So wie beim Virenforscher Drosten 5000 Fledermäuse. Solche Fälle sind jedoch selten geworden – so wie fast alle Tiere. Die Biologen gerieren sich heute meist als Naturschützer, wobei sie sich oft auf eine Art konzentrieren, der sie ihre Forscherkarriere verdanken.
Sonst geht es ihnen wie z.B. den DDR-Forschern am Otto-Suhr-Institut der Westberliner FU: Als die DDR verschwand, standen sie plötzlich dumm da – ohne Forschungsgegenstand. In der Biologie heißt es immer: Um eine Art schützen zu können, muß man sie kennen. Das nimmt gelegentlich seltsame Züge an: Wenn z.B. eine karibische Eidechsenart, die weit verbreitet ist, bei einer Feldforschung mit gentechnischem Analyseanteil in „Wahrheit“ aus fünf gleich aussehenden Arten besteht – von denen zwei in ihrem Verbreitungsgebiet vom Aussterben bedroht sind. Und also muß man sie dann doch schützen.
Während die westliche Lebenswissenschaft langsam ihren Objekten nicht mehr das Leben nimmt, vermehren sich die Trophäenjäger. In vielen z.B. afrikanischen Nationalparks sind diese reichen Weißen hochwillkommen, während die Einheimischen eher als Wilderer verfolgt (und in Kenia neuerdings sogar hingerichtet werden sollen). Die Parkverwaltungen, die nicht selten noch mit Weißen besetzt sind, müssen ständig die Waffen ihrer schwarzen Wildschützer verbessern, weil auch die Wilderer inzwischen Nashörner und Elefanten z.B. mit Drohnen jagen. Auch die meisten Sponsoren und Biologen sind Weiße. Die reichen Hobbyjäger argumentieren: „Findet Trophäenjagd unter kontrollierten Bedingungen statt, kann sie für den Bestand einer Wildart sehr nützlich sein,“ so z.B. der Jäger und „Welt“-Redakteur Eckard Fuhr in seinem Buch „Schafe“ (2017). Selbst Verwalter von Schutzgebieten für Tiere ziehen die reichen Trophäenjäger den pauschalurlaubenden Fotosafari-Touristen vor, weil sie viel mehr bezahlen und bedeutend weniger Arbeit machen.
All das ändert nichts daran, dass einzig das Töten zum Verzehr noch sozial tolerierbar ist. Auch wenn immer mehr junge Frauen einen Jagdschein machen und Bücher über ihre „Beute“ veröffentlichen. In den sozialen Netzwerken wird mindestens einmal in der Woche ein Foto gepostet, das ein reiches Arschloch zeigt, das stolz auf oder hinter einem erschossenen Löwen oder Schneeleoparden posiert. Die Fotos sind Steckbriefe mit Namen und Adresse dieser „Tiermörder“.
Das akzeptierte Töten geschieht entweder für den Eigenbedarf oder industriell für den Markt. Die moderne Agrarproduktion steht aber ebenso in der Kritik wie von Naturschützern (u.a. dem Dänen Morten Jörgensen) kritisiert wird, dass man den indigenen Völkern, die von der „traditionellen Jagd“ leben, eine Quote z.B. an Eisbären einräumt: Da ist nichts „Traditionelles“ mehr an der Jagd meint er. „Die Inuit gehen mit hochtechnischen Motorschlitten und wummstarken Gewehren, mit Feldstechern und Spezialkleidung auf das Eis.“
Der Münchner Ökologe Josef Reichholf erwähnt in seinem Buch „Der Bär ist los“ (2007), dass auch die Trophäenjagd sich weiterentwickelt hat: Sie ist heute ein mit viel Geld bezahlter Einsatz moderner Waffentechnik aus sicherer Entfernung. Man könne sogar schon „Abschüsse per Computer“ kaufen. „Der Schütze“ ist mit einem echten Gewehr draußen in der Wildnis über das Internet verbunden und so in seinem Homeoffice in der Lage, „tatsächlich den Bären zu schießen. Das Video wird frei Haus geliefert, das Fell kann als Trophäe erworben werden. Peinlicher kann ein solcher ‚Sieg‘ über das große Tier nicht mehr werden.“ Inzwischen ist noch das Kampfmittel Drohne beim den Trophäenjägern hinzugekommen, das auch für Tierfilmer inzwischen unverzichtbar ist.
2.
Die technische Entwicklung (der Waffen) ist schneller als die kulturelle (der Moral). Es gibt einen Bericht über die grönländischen Inuit von einem Afrikaner: Tété-Michel Kpomassie aus Togo. Das Buch über über seinen 13monatigen Aufenthalt bei grönländischen Familien und Jägern Mitte der Sechzigerjahre hat den Titel „Ein Afrikaner in Grönland“ (1981). Darin ist von der Jagd auf eine Fliege die Rede: In der Schule von Christianshaab (heute Qasigiannguit) gibt es eine Bibliothek, in der „sämtliche Forschungsergebnisse über Grönland“ versammelt sind, der dänische Direktor Kjeld Pedersen lud ihn ein, sie zu studieren. „Eines Tages tötet Kjelds dreijähriger Sohn eine Fliege. Das fällt einem Kind in diesem Land umso leichter, als die Fliegen hier weniger flink als die in Afrika, im Frühling noch schläfriger und schwerfälliger zu sein scheinen. Kjeld sieht daher die Tat seines Sohnes nicht für ein Heldenstück an und bewundert ihn nicht im geringsten, zum großen Erstaunen des Kindermädchens, einer etwa dreißigjährigen Grönländerin, die aus einer Jägersiedlung weiter nördlich stammt und stolz ist auf das Kind, eben weil es eine Fliege umgebracht hat. ‚Das zeigt, dass er ein großer Jäger werden wird,‘ behauptet sie. Wenn man, um ein gewandter Jäger zu werden, in der Kindheit Fliegen getötet haben muß, dann müßte ich zweifellos, so wie alle anderen Afrikaner auch, einer sein…Auf das beharrliche Drängen des Kindermädchens hin beginnen Kjeld und seine Frau, eine dänische Lehrerin, Unmengen Kaffee zu kochen und mehr Kuchen zu backen, als sie es jemals getan haben, um mit dem ganzen Dorf dieses bedeutsame Ereignis zu feiern: ein Kind, das eine Fliege getötet hat! Unermüdlich erzählen die Dorfbewohner einander von dieser Heldentat, finden keine Worte, um den Kleinen zu beglückwünschen, ziehen in Scharen zu Kjeld, um den Jungen zu sehen, dieses Phänomen, und trinken Kaffee bis zum frühen Morgen. Überraschenderweise darf der Held nichts von den Kuchen essen, die zu seinen Ehren gebacken worden sind! In den kleinen Siedlungen nämlich, erklärt uns das Kindermädchen, und alle Anwesenden stimmen ihr im Chor zu, darf der junge Mann, der seinen ersten Seehund erlegt, selber nichts von dessen Fleisch verzehren…Die anderen essen fast alles auf-Während dieser Mahlzeit (der stets ein ‚kafemik‘ folgt – ‚ein ganztägiges und offenes Kaffeetrinken‘ laut Wikipedia), die in Gegenwart des Jägers stattfindet – er sitzt in einer Ecke -, sagt jeder nach jedem Bissen: ‚Wahrhaftig, in meinem ganzen Leben habe ich noch nie einen so köstlichen Seehund gegessen!‘ Dadurch soll der junge Mann lernen, dass er von nun an zuerst an die Gemeinschaft zu denken hat, bevor er an sich denkt, und alles mit ihr teilen muß. Welche schöne Lehre, aber auch welch harte Prüfung.“
Nebenbeibemerkt lehrten die Missionare der Herrenhuter Brüdergemeine den Inuit das „Vaterunser“-Gebet mit einer Variante, die da hieß: „Unsere tägliche Robbe gib uns heute“ – „Brot“ kannten die Grönländer nicht.
Am höchsten angesehen waren bei ihnen die Eisbärenjäger, denn es war gefährlich, dieses größte Landraubtier mit Hunden und einem Speer anzugreifen. Die Inuitforscherin Josephine Peary bemerkt in ihrem „Arctic Journal“ (1893) über einen etwas armen grönländischen Jäger, Ikwa, der sich der Expedition ihres Mannes andiente: „Er trug Hosen aus Robbenleder. Später erfuhren wir, das Hosen aus Robbenleder nur von solchen Jägern getragen werden, die nicht das Glück hatten oder unfähig waren, einen Eisbären zu töten. Im Winter trugen sie dann Hosen aus Hundefell, die zwar genauso warm sind wie welche aus einem Eisbärfell, aber nicht so chic,“ schreibt sie.
Die als Leiterin arktischer Tourismusexpeditionen arbeitende Schriftstellerin Birgit Lutz hat mehrmals Inuit-Siedlungen in Ostgrönland besucht, wo an der 2500 Kilometer langen Küste nur noch 2500 Menschen leben und einige Siedlungen völlig verlassen sind, seitdem die Jagd auf Wale und Eisbären fast verboten wurde und die Robbenfelle kaum noch etwas einbringen. Ihrem Bericht gab die auf Spitzbergen umweltschützerisch engagierte Autorin den provokativen Titel: „Heute gehen wir Wale fangen…“ (2017). Sie interviewte darin u.a. die auf Grönland geborene dänische Reiseorganisatorin Pia Anning Nielsen: „Seitdem die Jagd keine Perspektive mehr für die Menschen hier ist, sind sie nicht mehr stolz. Jetzt können sie sich nicht mehr selbst versorgen, weil der Preis für die Robbenfelle trotz Subventionierung durch die dänische Regierung zusammengebrochen ist.“ Die letzten Jäger schießen zwar weiterhin Robben, 20-30 pro Tag mitunter, aber vor allem zur Versorgung ihrer Schlittenhunde. Ansonsten verfallen immer mehr Inuit dem Alkohol und von den männlichen Jugendlichen verüben immer mehr Selbstmorde. „Für Pia liegt der Hauptgrund dafür in der Erziehung zum Jäger,“ das kein Auskommen mehr bietet. Birgit Lutz findet es unterstützenswert, dass die Inuit weiterhin Robben und Kleinwale jagen, aber da sie sich auf Spitzbergen bei ihrer Sommerarbeit für den Schutz der Eisbären engagiert, fällt es ihr schwer, hier in Ostgrönland nun Sympathie für die letzten Eisbärenjäger aufzubringen. Die auf Spitzbergen an Touristen verkauften Eisbärfelle stammen aus Alaska und Kanada. Derzeit kosten sie bis zu 3000 Dollar das Stück, weil immer mehr reiche Chinesen sie als Bettvorleger kaufen.
3.
Bei der modernen Bewirtschaftung des Waldes ging in der BRD stets Holz vor Jagd. In der DDR war es umgekehrt. Das begann zunächst damit, dass die Rote Armee im sowjetisch besetzten Sektor 1945 ein absolutes Jagdwaffenverbot anordnete. Ab da jagten fast nur noch Offiziere der Roten Armee. „Die sowjetischen Truppen nutzten diesen rechtsfreien Raum und etablierten einen regen Handel mit Wildbret,“ heißt es in Helmut Suters Jagdgeschichte „Honeckers letzter Hirsch – Jagd und Macht in der DDR“ (2018). Nachdem die SED alle Wälder der DDR zu Volkseigentum erklärt hatte, wurden die sowjetischen Jäger irgendwann zu „Wilderern“ und ihre Abnehmer zu „Hehlern“. Zuvor hatte der Geheimdienst der Roten Armee (SMAD) noch versucht, mit Befehlen die Jagd einzudämmen, indem die Zuständigen nur noch „Militärjagdkollektive“ und „Jäger der allrussischen Militärjagdgesellschaft“ zuließen sowie nach Wildtierarten unterschiedene „Schonzeiten“ festlegten, um „die barbarische Ausrottung seltener Tierarten zu verhindern“.
Die Landbevölkerung klagte derweil über eine „Wildschweinplage“. 1949 wurden dagegen „Jagdkommandos“ aus der Deutschen Bereitschaftspolizei aufgestellt, die von der SMAD bewaffnet wurden. Im selben Jahr fand laut Suter „die erste Regierungsjagd“ statt. Nach und nach bekamen auch die Förster Waffen, die neuen „Staatsforstbetriebe“ waren für die „Beschaffung, Kontrolle und Verwaltung der volkseigenen Waffen verantwortlich“. Es wurden „Jagdkollektive“ gegründet, theoretisch konnte jeder Jäger werden, aber damit hatte er noch keine Waffe und kein Jagdrevier. Mit einem neuen Jagdgesetz 1953 „sicherten sich die Politbüromitglieder interessante Jagdgebiete, auch für die SMAD, gegenüber den Jagdkollektiven“. Diese 129 „Sonderjagdgebiete“ wurden immer mehr erweitert, immer stärker geschützt, auch die Volksarmee und die Staatssicherheit bekamen solche Reviere. Gleichzeitig wurden bis in die Achtzigerjahre die „Jagdhütten“ immer üppiger ausgebaut, zu wahren Jagdschlössern, wo einige Minister allein 5 Köche beschäftigten.
„Für das Geschehen in der Schorfheide war in den Fünfzigerjahren Walter Ulbricht verantwortlich.“ Davor war es die SMAD gewesen, davor Hermann Göring und davor die „führenden Würdenträger der Monarchie und der Weimarer Republik. Bereits die Askanier begründeten dort im 12. Jahrhundert eine Tradition der Jagd der Herrschenden. Dass sich in den sozialistischen Ländern nahezu alle Regierenden der Jagd widmeten, geht auf die Tradition der Adels- und der Volksjagd zurück – letzteres vor allem in Russland und Amerika, wo nur wenig Menschen auf einem riesigen Territorium lebten, hinzu kam eine mehr oder weniger ausgeprägte partisanische Vergangenheit. Einer der eifrigsten Jäger war Trotzki, der großen Konflikten in der Partei gerne auswich, um erst einmal jagen zu gehen, noch in seinem Exil auf der Insel Büyükada bei Istanbul verlangte er als erstes von seiner Deutsch-Übersetzerin Angelschnur aus England. Der Zürcher Ethnopsychoanalytiker Paul Parin schreibt in seinem Buch „Die Leidenschaft des Jägers“: Ein „aufgeklärter Mensch jagt nicht“ und auch ein „Jude jagt nicht“ – das sind „gleichermaßen Gesetze abendländischer Ethik. Ich muss mich zu den Ausnahmen zählen“. Parin nahm als Arzt am jugoslawischen Partisanenkrieg teil. Am Beispiel von Milovan Djilas, leidenschaftlicher Angler, Mitkämpfer und Vertrauter Titos, gibt er jedoch zu bedenken: „Später, als Dichter, wusste Djilas: Keine Ausübung der Macht über das Volk, über die Schwachen, bleibt ohne verbrecherische Taten. Wäre es nicht besser gewesen, der eigenen Leidenschaft Raum zu geben und den flinken Forellen nachzustellen…?“
In einem Dokumentarfilm über deutsche Jäger heute meint die Regisseurin: „Jäger wissen viel über den Wald, Wildtiere, Krankheiten.“ Der Zürcher Zoodirektor und Tierpsychologe Heini Hediger meinte dagegen, dass die Jäger wenig zum Wissen über die Tiere, die sie jagen, beitragen. Das Jagen bietet im Grunde wenig Gelegenheit zum Beobachten. Ein Schuß, selbst ein Meisterschuß, ist eben niemals Beginn, sondern stets das Ende einer allzu kurzen und meist nicht sehr vielsagenden Beobachtung.“
Seitdem die „Jagden“ auch auf dem Gebiet der DDR privatisiert sind, hätten die jetzigen „Trophäenjäger“ den Wildbestand noch vergrößert, meinte ein Biologe in Görlitz. Zur Freude der Wölfe, fügte er hinzu, die sich von dem ersten eingewanderten Wolf nach der Wende bis zu den heutigen Rudeln in den Bergbaufolgelandschaften und auf den Truppenübungsplätzen in der Lausitz ansiedelten. Leider gäbe es nicht genug Wölfe. Das sei die allgemeine Meinung der hiesigen Natur- und Umweltschützer.
4.
Fast alle schlesischen Adligen hatten als Hauptinteresse die Jagd, dazu waren sie auch noch höchlichst daran interessiert, dass der Kaiser, Wilhelm II., zu ihnen als Jagdgast aufs Schloß kam. Und der kam jedesmal mit einem so großen Gefolge, dass nur die „Magnaten“ mit den größten Schlössern ihn einladen konnten. In einem der gräflichen Schlösser stand in der Halle eine Glasvitrine mit einem Handschuh darin auf einem Kissen, die Gräfin hatte ihn getragen, als der Kaiser dort Jagdgast war und einen Handkuß angedeutet hatte, ihr weißer Handschuh war dadurch zu einer Reliquie geworden.
Der Sanierer etlicher heruntergewirtschafteter Güter des schlesischen Adels, Alfred Henrichs, beschreibt in seiner Arbeitsbiographie „Als Landwirt in Schlesien“ (die 2003 von der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft DLG veröffentlicht wurde), wie die Kaiserjagd dort vor sich ging: „Zunächst erschienen [z.B. auf dem Schloß des Grafen Johannes von Franken-Stierstorpff, der eine amerikanische „Milliardärstochter“ geheiratet hatte] einige Herren aus der jagdlichen Suite des Kaisers, um die Verhältnisse an Ort und Stelle zu studieren: war das Gelände geeignet, wie war der Wildbestand, wie waren die Schusslisten der letzten Jahre usw.. Auf die Einladung des Kaisers zur Jagd folgten, wenn seine Jagdprüfer ihm positiven Bericht erstatteten, „als nächste Inspizienten kaiserliche Kriminalbeamte, um das Schloss und die Umgebung im Hinblick auf die Sicherheit zu prüfen. Dann rückten Beamte des Hofmarschallamtes an und begutachteten die dem Kaiser im Schloß zugedachten Räume, in unmittelbarer Nähe mußten auch die Zimmer für seine Kammerdiener liegen. Außer seinem Jagdpersonal und den Kriminalbeamten kamen in der Regel auch die Chefs oder deren Vertreter nebst Hilfspersonal der Reichskanzlei, des Zivil-, Militär- und Marinekabinetts mit, die ebenfalls Diener im Gefolge hatten, denn die Regierungsmaschinerie durfte ja nicht stille stehen.
Nun wurden Skizzen vom Jagdgelände angefertigt, in die die einzelnen Treiben, die Stände der Schützen und vor allem die des Kaisers eingetragen wurden. Waren auch diese von Berlin aus genehmigt, dann schickte der Jagdherr seiner Majestät die endgültige Einladung mit Angabe der anderen einzuladenden Gäste. Hierbei behielt sich der Kaiser vor, Streichungen und Änderungen vorzunehmen. Es war auch mitzuteilen, wer die Nachbarstände des kaiserlichen Gastes einnehmen sollte, denn ihre Besetzung galt als besondere Ehre. Am Schluß kam dann noch eine Kommission des kaiserlichen Marstalls, um die Pferde und Wagen zu besichtigen, deren sich der hohe Herr bedienen sollte. Genügten sie nicht, wurden Pferde und Wagen aus Berlin herbeigeschafft. So kam es dann endlich zur definitiven Zusage des Kaisers und zur Festlegung des Jagdtermins. [Woraufhin der „Goldfasanenmeister und der Karnickeldirektor“ informiert wurden, wann und wo sie die mit sehr viel Geld aufgezogenen Tiere frei zu lassen hatten.] Der Fasan spielte in Schlesien eine große Rolle.
Inzwischen setzte sich der Küchenchef des Gastgebers mit der Hofküche in Berlin in Verbindung, um zu erfahren, welche Speisen der Kaiser bevorzuge und wie sie zuzubereiten seien. Der Haus- und Hofmeister erkundigte sich in Berlin, welche speziellen Wünsche der Kaiser für seine Räume habe, die Stellung des Bettes zum Licht, Bettwäsche, Zudecke usw. Dann hatte er zu ermitteln, welche Weine, Zigarren oder Zigaretten der Kaiser bevorzuge usw..
Unmittelbar vor der Jagd waren die Schützenstände, eine Art ebenerdige Kanzeln, für den Kaiser herzurichten, für die es genaue Vorschriften gab. Sie bestanden zunächst aus einer Vorderwand, aus Fichtenzweigen geflochten, und ihre Höhe, breite und Dicke war genau vorgeschrieben. Seitlich schlossen sich zwei Nebenwände an, ebenfalls mit festgelegten Ausmaßen. In die Vorderwand waren zwei Astgabeln einzulassen, auf die der Kaiser die Flinte legen konnte. Auch deren Ausmaße waren genau vorgeschrieben. Sie mußten aus Buchenholz sein, das die sauberste Rinde hat. Der Fußboden der Kanzel war auf einige vorgeschriebene Dezimeter auszuheben, zuunterst mit Schlacke auszufüllen, worauf am Morgen des Jagdtages eine Schicht trockenen Sägemehls kam, damit es keine kalten Füße gab. Die Wege von einem Treiben zum zum anderen wurden mit frischen Fichtenzweigen ausgelegt, und da im dortigen Revier [Buchenhöh des Grafen Johannes] nur wenig Fichten standen, ließ man einige Tage vor dem großen Ereignis mehrere Waggons Fichtenreisig aus dem Riesengebirge kommen.
Wie mir der Wildmeister Urner und der Rentmeister Jendryssek dort sagten, war Wilhelm II., ein Meisterschütze, obwohl er wegen seines verkrüppelten linken Armes nur einarmig schießen konnte. Hinter ihm standen stets zwei Büchsenspanner. Er bekam selbstverständlich den besten Stand und hatte oft die größte Strecke.“ Wenn nicht, korrigierte man die Abschußliste zu seinen Gunsten. Alfred Henrichs erwähnt die Strecke einer fünfköpfigen Jagdgesellschaft des Grafen Schaffgotsch: „2500 Kreaturen“ an einem Tag. Nach seinen Schilderungen der Wirtschaftsweisen des schlesischen Adels kommt er zu dem Schluß: „Diese aristokratische Lebensweise war nur bei einem unendlich niedrigen Lebensstandard der Arbeiterschaft möglich.“
Der schlesische Schriftsteller August Scholtis, der als Jugendlicher zunächst in der Verwaltung des Fürsten Lichnowsky eine Anstellung als Schreiber fand, berichtet in seiner Autobiographie „Ein Herr aus Bolatitz“ (1959), dass „die illustren Gäste des Schlosses sich an späten Nachmittagen auf die Rehbockpirsch zu begeben pflegten“. Der Fürst meinte einmal zu ihm: „Wenn der Kaiser noch mal zur Jagd auf mein Schloß kommt, bin ich bankrott.“
5.
„Die Jagd ist eine Kunst“ – steht in der heute musealisierten Jagdhütte von Marschall Tito nahe Belgrad. Der Psychoanalytiker Paul Parin, der bei den Tito-Partisanen als Arzt arbeitete, war auch ein leidenschaftlicher Jäger und Angler, der bereits als 13jähriger bei seinem ersten tödlichen Schuß auf ein Haselhuhn einen Orgasmus bekam: „Seither gehören für mich Jagd und Sex zusammen“. Dieser Doppelschuß, wenn man so sagen darf, machte ihn zum „Mann: glücklich und gierig“. Vor dem offiziellen Erwachsenenstatus steht aber noch eine sadistische „englische Erziehung“: Bei einer Jagd mit Hunden beging er als junger Treiber so viele Fehler, dass sein gutsherrschaftlicher Vater ihn von seinem Förster auspeitschen läßt – „auf den blanken Hintern“ inmitten der Treiberschar. Die darf ihn sich gleich anschließend noch einmal im Keller des Landschlosses vornehmen, dabei ziehen sie ihn ganz aus. Sein „Papa stand daneben und genoss das Schauspiel“. Anschließend legte sich einer der Burschen nackt neben ihn, „nahm meinen Pimmel in die Hand, steckte ihn in den Mund und fing an zu saugen und mit der Zunge zu streicheln. ‚Er will mich trösten‘, dachte ich und drehte mich so, dass ich seinen Pimmel auch zu fassen kriegte, und steckte ihn meinerseits in den Mund. Es war wirklich ein Trost.“
Das war aber noch nicht die eigentliche „Initiation“. Die kam erst mit 17 – als er seinen ersten Bock schoß. Ein Onkel hatte ihn in seine Jagdhütte eingeladen, als Paul Parin oben ankam, bedrängte dieser gerade mit heruntergelassener Hose seine Haushälterin am Kachelofen. „Komm in zehn Minuten wieder,“ rief ihm der Onkel zu, „dann sind wir mit Vögeln fertig. Dann sind auch die Mädels da, die ich gemietet hab. Sie sind scharf auf dich, haben sie gesagt“. Abends erzählt der Onkel Jagdgeschichten, danach geht der Bub mit einem der drei Mädchen auf sein Zimmer. Erst läßt sie sich von ihm mehrmals mit der Hand befriedigen, dann holt sie ihm einen runter. Anschließend schläft sie sofort ein, er kann nicht schlafen, stattdessen zieht er sich wieder an, schnappt sich sein Gewehr und geht in den Wald, wo er dann von einem Hochsitz aus einen „starken Bock“ mit Blattschuß erlegt. Beim Frühstück muß er alle Einzelheiten erzählen. Auch das gehörte zum „Ritual“.
Seitdem erfaßte ihn „das Jagdfieber immer wieder mit der gleichen Macht wie sexuelles Begehren“. Das ging auch seinem Jugendfreund so: „Dulli war Jude und zeitlebens dem Jagdfieber verfallen. Von seinem liebsten Jagdkumpan an die deutsche Besatzungsmacht verraten, wurde er Widerstandskämpfer und in der titoistischen Republik Slowenien Minister für Jagd und Fischerei“. Ein „aufgeklärter Mensch jagt nicht“ und auch ein „Jude jagt nicht“ – das sind „gleichermaßen Gesetze abendländischer Ethik. Ich muss mich zu den Ausnahmen zählen“. Aber Paul Parin hat von sich selber und vielen anderen erfahren: „Wenn mein Vater nicht seine Jagd gehabt hätte, wären wir Kinder in der strengen und sterilen Familienatmosphäre erstickt“. Deswegen kann er jetzt eher genuß- als reuevoll z.B. seine Jagd auf eine Gazelle in der Sahara und das Forellenfischen in Alaska – als Sucht – beschreiben.
„Sucht heißt, dass der narzisstische Genuß am Morden mit der Jagd weltweit einen Freibrief hat“. Am Beispiel von Milovan Djilas, leidenschaftlicher Angler, Mitkämpfer und Vertrauter Titos, gibt er jedoch zu bedenken: „Später, als Dichter, wusste Djilas: Keine Ausübung der Macht über das Volk, über die Schwachen bleibt ohne verbrecherische Taten. Wäre es nicht besser gewesen, der eigenen Leidenschaft Raum zu geben und den flinken Forellen nachzustellen…?“ Im Russischen gibt es ein volkstümliches Wort für Jagd und Lust: Ochota. Parins eigene „Jagdleidenschaft“ erlosch bald nach dem 84. Geburstag seiner Frau Goldy, am 30 Mai 1995: „An diesem Tag habe ich im Fluß Soca in Slowenien die größte Forelle meiner Laufbahn gefangen“. Anschließend erzählte er seiner Frau, daß er am Fluß einen jungen verwilderten Mann, der ihn beklauen wollte, fesselte – dann hätte er ihn ausgepeitscht bis zum „Flash“, woraufhin sie beide zum Orgasmus gekommen wären. Während Paul Parin diese Geschichte schließlich als eine „Phantasie“ darstellt, ist die Psychoanalytikerin Goldy sich da „nicht so sicher…Kann sein, dass du nicht nur die Riesenforelle erwischt hast, sondern auch einen Gayboy aus Kärnten“. Sie einigen sich darauf: „Es könnte so sein oder auch nicht…Gehen wir schlafen“.
In einer Art Nachwort rühmt Christa Wolf Paul Parins „Lebenskunst und Schreibkunst“, diese im richtigen Augenblick kennengelernt zu haben, hält sie für eine „glückliche Fügung“. Mich hat sein Jagdbuch eher verwirrt. Es ist 2018 überarbeitet neu herausgegeben worden, und heißt jetzt: „Die Jagd – Licence for Sex and Crime“.
.
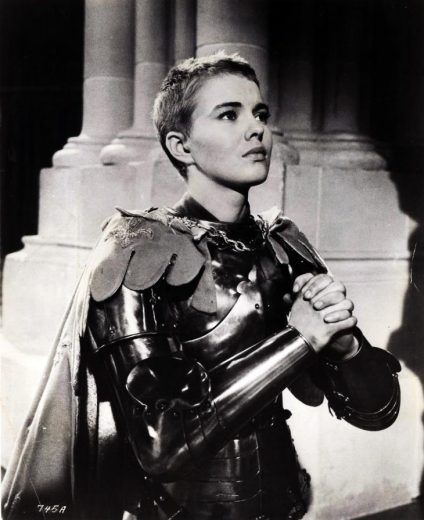
Jean Seberg
.
Kraniche
Refugees Welcome! Die Kraniche gehören wie einige andere Arten zu den Vögeln, die der Damenhutmode wegen abgeschossen werden, aber auch die Bauern setzen ihnen zu, um ihre Getreidefelder zu schützen und dazu die Eiersammler. Kraniche schlafen stehend im Flachwasser und bauen ihre Nester dort auf kleinen Hügeln. Indem sie Schilf umknicken, schaffen sie „Spielplätze“ für ihre Jungen auf dem Wasser. Die Trockenlegung von Mooren und Sümpfen macht ihnen neben den gefährlichen Menschen das Überleben noch unmöglicher. Einige Kranicharten standen bereits kurz vor dem Aussterben – bis man anfing, sie besser zu schützen, umweltpolitisch aktiv für sie zu werden und sie künstlich aufzuziehen, um sie danach auszuwildern.
Im Linumer Teichland (bei Kremmen) rasteten 2020 wieder zehntausende Kraniche. Ende November waren es 2050, die der Kälte noch nicht in Richtung Süden ausgewichen waren. Ein weiteres Vogelschutzgebiet ist der „Duvenstedter Brook“ bei Hamburg, wo einige Paare auch brüten und ihre Jungen aufziehen.
Dort am Rand wohnt der Chemie-Unternehmer und Demeterhof-Betreiber Bernhard Wessling, der in diesem Jahr ein Buch über seine langjährige Kranich-Beobachtung und –Forschung veröffentlichte: „Der Ruf der Kraniche“. Der Autor ist davon überzeugt, dass weder der Zug dieser Vögel genetisch (früher sagte man instinkmäßig) festgelegt ist, noch dass Kranichpaare sich ewig treu sind.
Weil er während seiner fast täglichen Beobachtungen damit haderte, dass man diese Tiere optisch so gut wie gar nicht auseinanderhalten kann, das Beringen der Jungvögel aber ablehnt (da die Kraniche das als einen Angriff werten und das spätere Ablesen der Ringe z.B. vom Hubschrauber aus mit Fernglas allzu umständlich ist), versuchte er es stattdessen mit der Analyse ihrer akustischen Äußerungen. Mit Hilfe von Sonagramen kann er sie nun anhand ihrer „Sprache“ identifizieren und u.a. bei ihren „Duettrufen“ zur Revierverteidigung und nach der Paarung auch ohne Sichtkontakt Männchen und Weibchen unterscheiden. Die sich ständig verbessernde Aufnahme- und Abspieltechnik kommt ihm dabei entgegen.
Kranichfreunde gibt es nahezu auf der ganzen Welt und sie sind national und international organisiert. Weil Weßling mit seiner Firma erfolgreich ins Ausland expandierte, hatte er dort immer mal wieder Gelegenheit, auch andere Arten als die europäischen Grauen Kraniche zu erforschen: in China, Japan, Korea, Kanada und in den USA.
In Nordamerika geht es u.a. um die Wiederansiedlung von Schreikranichen in Wisconsin. Dort in Baraboo ist der Sitz der „International Crane Foundation“ (ICF), sie baut eine Samenbank für Kraniche auf, bis ihr Populationsrückgang aufgrund der Vernichtung ihrer Lebensräume – Feuchtgebiete – gestoppt werden kann. Wessling nimmt an, dass die verschiedenen Kranicharten unterschiedlich „flexibel“ auf veränderte Umweltbedingungen reagieren, dass z.B. „der Kanadakranich der kulturellen und kommunikativen Entwicklung des Grauen Kranichs um einiges voraus ist.“ Was nicht zuletzt heißt, das es ihnen gelingt, menschliche Einflüsse ins Kalkül zu ziehen. Als Beispiel erwähnt Wessling eine Kanadakranich-Familie mit zwei Jungen, die zum Fressen ein Sojabohnen-Feld aufsuchten, das direkt neben einem Schulhof lag. Die scheuenVögel kamen stets pünktlich zum Ende einer Pause, wenn die Schüler in den Klassen verschwunden waren.
Der ICF züchtet Kraniche in Gefangenschaft, u.a. Brolgakraniche und Schwarzhalskraniche, und versucht diverse Kranich-Rastplätze und – Brutreviere als Naturschutzgebiete durchzusetzen. Ihr Gründer, George Archibald, nahm sich einst einen der künstlich ausgebrüteten weiblichen Schreikraniche, Tex, an, der sich in George verliebte. Dieser tanzte daraufhin in jedem Frühjahr den Paarungstanz mit dem Vogel und trompetete danach mit ihm im Duett. Tex legte daraufhin auch Eier, aber es kam nie etwas dabei heraus. George zog deswegen in das Gehege von Tex und nach einem erneuten Paarungstanz führte er Kranichsperma bei ihm ein, dass er vom „Patuxent Wildlife Research Center“ in Maryland bekommen hatte. Es klappte: Tex legte ein befruchtetes Ei und George zog mit ihm dann ein männliches Kücken groß: „Gee Whiz“, woraufhin das glückliche Paar in einer Fernsehshow auftrat und berühmt wurde, was dem ICF viele Spendengelder einbrachte, mit dem sie in mehreren Regionen der Welt Überlebenshilfe für Kraniche leisteten.
Die Schreikraniche brüten im Norden Kanadas und überwintern in Texas und Florida. Dorthin muß man die künstlich ausgebrüteten flüggen Jungen im Herbst bringen – und zwar mit einem Ultraleichtflugzeug (ULF), „Operation Migration“ genannt. Das ist zwar möglich, aber da niemand den Jungkranichen zeigte, wer ihre Feinde sind (Rotluchse, Adler u.a.) und sie zudem auf Menschen geprägt wurden, überlebten im Zielgebiet nur die wenigsten, bevor sie gegen Winterende den Rückflug nach Kanada oder Wisconsin antreten konnten. Hier nun kam Bernhard Wessling ins Spiel, fast gegen seinen Willen, weil es viel Arbeit bedeutete: Er nahm im „Wildlife Refuge“ einer texanischen Insel (Matagorda) jede Menge unterschiedliche Kranichrufe auf, wobei er sich den Vögeln auf 100 Meter nähern konnte.
Seine Tonausbeute stellte er dem ICF zur Verfügung, damit die Pfleger ihre künstlich aufgezogenen Vögel via Megaphon mit den richtigen „Worten“ ansprechen konnten, wenn sie diese z.B. zum Futter locken oder vom ULF-Flugzeug aus zusammenhalten wollten, d.h. mit Rufen, wie sie auch die wilden Kraniche verwenden. In ihrer Aufzuchtstation näherten sich die Mitarbeiter nur in Schutzanzügen bzw. so verkleidet, dass sie von den Küken nicht mit Menschen identifiziert wurden. Die Töne kamen aus Lautsprechern in Kranichattrappen, „aus deren Schnäbel mit einem mechanischen Zug Mehlwürmer vor den Küken platziert werden konnten, wenn die Küken dem Lautsprecher-Lockruf ‚Kommt her, hier ist Futter‘ gefolgt waren. Die Pfleger nannten dieses Gerät ‚Robo-Crane‘.“ Weßling schlug ihnen überdies ein Trainingsprogramm für die Küken vor: „Raubkatzen erkennen und vermeiden“. Für unterwegs mit dem ULF-Flugzeug wählte er sechs Rufe aus: „Aufpassen!“ – „Achtung Gefahr!“- Kontakt, Locktöne – Flugruf „Alles okay, weiterfliegen“ – Warnruf – Duettruf (Revierverteidigung).
Grundsätzlich ging es darum, „herauszufinden, wie wild lebende Schreikranichjunge eigentlich die ihnen gemäße Ausdrucksweise lernen“. Wie sie sich auf ihren Zügen verständigen. Wessling interessiert vor allem die Kultur und die Kommunikation – „das Bewußtsein der Kraniche“. Als er geschäftlich nach Japan mußte, gab der ICF ihm mit auf den Weg, die Mandschurenkraniche auf Hokkaido, die seit 200 Jahren von der nahe an Amur und Ussuri brütenden Festlandpopulation getrennt sind, daraufhin zu untersuchen, ob sie „unterschiedliche Sprachen“ entwickelt haben. Die Rufe der letzteren nahm er in der Demilitarisierten Zone zwischen Süd- und Nordkorea auf. Dort stellte er fest, dass die Mandschurenkraniche auf den „Duettruf eines japanischen Kranichs“ nicht reagierten: „Die beiden Populationen konnten sich nicht mehr miteinander verständigen“.
(Über Bernhard Wesslings Kranichforschung gibt es diverses Filmmaterial – auf youtube.)
.

Kranichforscher Japan
.
„A book a day keeps reality away“
„Weißt du, als mein Papa in dieses Land kam, war er bereits ein gebildeter, belesener Mann,“ schreibt Kai Wieland in seinem Roman „Zeit der Wildschweine“ (2020). Beim Wort „belesen“ blieb ich hängen: Das gibt’s ja auch noch, murmelte ich vor mich hin. Wobei belesen und gebildet fast doppelt gemoppelt ist, wenn man dem Synonym-Wörterbuch folgt, das dafür auch noch „geistreich“, „versiert“, „orientiert“, „informiert“, „kundig“, „gelehrt“ und „eingeweiht“ auflistet. Unter „wissen57“ wird erklärt: „Literarische Bildung, die einst im Zentrum der Curricula der höheren Schulen stand, ist – und leider nicht nur dort – zu einem Fremdwort geworden.“ Liegt das daran, dass im Zuge der Studentenbewegung eine „bestimmte Idee von Bildung“ als „bildungsbürgerlich“ abgetan wurde? Ich erinner mich noch, dass der eher aktionistisch gesonnene Daniel Cohn-Bendit den Germanisten Heiner Boehnke gelegentlich ein „schöngeistiges Arschloch“ schimpfte. Dennoch würde ich sagen, dass in der Studentenbewegung noch extrem viel gelesen wurde, meine Mentoren vom SDS zogen sich z.B. täglich von 14 bis 17 Uhr in ihre WG zurück, um zu lesen und Rudi Dutschke hatte immer eine Aktentasche voll mit Büchern bei sich. Von den Philosophen der Frankfurter Schule und einigen ihrer Studenten kann man sogar sagen, dass sie so belesen waren wie kaum jemand damals und erst recht heute. Die Unbelesenheit scheint eher an der jetzigen Amerikanisiererung der Hochschulen zu liegen, die auf Profitabilisierung des Wissens abzielt – bei Studenten wie bei Wissenschaftlern. So sind in den USA z.B. 80 % aller Biologen zugleich auch Geschäftsführer oder Teilhaber einer Firma. Und der neue US-Präsident hat gerade den Biologen Eric Sander in seine Regierung berufen, um laut Spiegel „den Führungsanspruch der US-Wissenschaft zu verteidigen“. Gemeint ist damit die idiotische Genetik, die zwar ungeheuer produktiv ist, aber ebenso primitiv und dumm – und für ein Verständnis vom Leben eher hinderlich.
In letzter Zeit sind mir immer wieder Leute begegnet, die sich quasi entschuldigten, dass sie so selten zum Lesen kommen. Sie halten sich alle für nicht „belesen“ genug. Aber „gebildet“ waren sie eigentlich, d.h. sie hatten irgendetwas „Gebildetes“ studiert, Literatur- oder Kulturwissenschaft. Für einige bestand das Belesen-Sein darin, lektüremäßig mitzukommen, was jeweils viel und gut besprochen wurde an Romanen und Monographien. Für andere galt, was der polnische Schriftsteller Andrzej Stasiuk antwortete, als man ihn fragte, wen er an den „Gegenwartsautoren“ schätze: Er lese nur Tote, „weil die Lebenden noch nicht fertig sind und man ihnen eine Chance geben muß.“ Was sind z.B. all die Bestsellerlisten-Autoren gegen Joseph Roth oder Stefan Zweig, zu schweigen von Tolstoi oder Platonow?
Bei vielen stapeln sich auch die Bücher über ein „Thema“, das sie verfolgen, Südseeinsel- oder Weltraum-Eroberungen z.B., dementsprechend lesen sie vornehmlich Expeditionsberichte aus dem 18. und 19. Jahrhundert oder alle NASA-Spinnereien. Von den geharnischten Linken hatten viele den Ehrgeiz, alle 43 blauen Bände von Marx und Engel zu besitzen.
Es gab mal eine Zeit, da war der Grad der Belesenheit fast identisch mit der Höhe des Vermögens, das der „passionierte Leser“ dafür ausgeben wollte oder konnte. In den „Flüchtlingsgesprächen“ von Brecht heißt es:„Eine halbwegs komplette Kenntnis des Marxismus kostet heute, wie mir ein Kollege versichert hat, zwanzigtausend bis fünfundzwanzigtausend Goldmark und das ist dann ohne die Schikanen. Darunter kriegen Sie nichts Richtiges, höchstens so einen minderwertigen Marxismus ohne Hegel oder einen, wo der Ricardo fehlt usw.“
Andererseits kam es zu dem Phänomen, vornehmlich bei Frauen, dass ihr „Romanlesen“ (-verschlingen) irgendwann zu einer psychischen Erkrankung erklärt wurde, ebenso „gewohnheitsmäßige Lyrik“.
Das Wort „passionierter Leser“ kommt oft in Kreuzworträtseln vor und dementsprechend oft auch in den Kreuzworträtsellösungshilfen im Internet, wo man dazu auf das Wort „Bücherwurm“ stößt.
Bei den Autoren, die vom Dorf und aus einer Bauern bzw. Arbeiterfamilie stammen, kommt in ihren biographischen Romanen oft die Bemerkung vor, dass es in ihrem Elternhaus nur ein Buch gab, die Bibel oder eins über Pferdekrankheiten. Dass die Oma sie Faulpelz schimpfte, wenn sie in einem Buch lasen. Dass sie heimlich lasen. Dass die Bibliothekarin in der Leihbücherei sie zum Lesen animiert habe usw. Damit wird erklärt, dass sie schon in jungen Jahren von der Hand- zur Kopfarbeit neigten und deswegen irgendwann zu einem „Bücherwurm“ wurden.
Die Situationisten gaben zu bedenken: „Um schreiben zu können, muß man gelesen haben, und um lesen zu können, muß man zu leben verstehen, sonst kommt man nur dahin, die abstrakten Forderungen seiner abstrakten Existenz endlos zu wiederholen.“
.

.
Alle 11 Minuten verliebt sich ein Single über Parship“ heißt es in der U-Bahn-Werbung. Eine andere lautet: „Alle 3 Minuten wechselt ein Raucher zur E-Zigarette“. Gibt es da einen Zusammenhang? Das erste Plakat wirbt mit einem attraktiv lächelnden Mädchen, das zweite mit einem zufrieden grinsenden Mann. Kriegen werden sie sich am Ende aber wohl nicht, denn die meisten Frauen in den Partnersuchdiensten wollen zwar „Abenteuer“ erleben, aber nur mit „Nichtrauchern“.
.
Immas Dingpolitik
Es begann mit Bruno Latour, der die Dinge als handelnde Akteure/Aktanten begriff, inzwischen habe ich schon ein ganzes Regal voller Bücher über die Dingwelt. Laut Latour wird die Moral mehr und mehr an Dinge delegiert – z.B. an die Hotelschlüssel, die man nicht abgibt, weil der nächste Gast sie braucht, sondern weil sie mit so einem dicken Gewicht verbunden wurden, dass man sie schnell wieder los werden will. Man ahnt, dass es mit den zunehmenden, alle Moral aufsaugenden Dingen nicht gut ausgehen kann. Die vielen Dinge machen nicht nur arm, wie der Schriftsteller Peter Mosler meinte, sondern auch asozial!
Die Massai besitzen im Durchschnitt 30 Dinge, die Deutschen 10.000. Der Bischof von Kamtschatka, Venjaminoff, lehnte es 1860 ab, die dingarmen Aleuten zu taufen, „da die Bekehrten dann mit ihrer eingeborenen Moral brechen, die unter ihnen sehr hoch entwickelt ist“ – höher als die der zivilisierten Christen. Die Yanomami-Indianerin, Yarima, heiratete den Ethnologen Kenneth Good und zog mit ihm nach New Jersey, wo sie als Hausfrau mit drei Kindern in einem Reihenhaus lebte. Ihr Ehemann verschaffte sich durch die Heirat mit ihr einen einzigartigen Zugang zur Gesellschaft der Yanomami. Seine Frau verließ ihn und ihre Kinder jedoch nach einigen Jahren – und ging zurück an den Orinoko. Sie hielt es in den USA nicht aus: „Das einzige, was sie lieben, sind Fernsehen und Einkaufszentren. Das ist doch kein Leben“, erklärte sie dem Autor Patrick Tierney (in: „Verrat am Paradies: Journalisten und Wissenschaftler zerstören das Leben am Amazonas“ 2002).
Die taz-Mitgründerin Imma Harms nahm sich 2017 vor, „von jetzt an jeden Tag“ ein Ding weniger zu besitzen. Sie vertritt eine so hohe Moralpolitik, dass die taz der irgendwann nicht mehr entsprach und sie sich auf einen taz-blog zurückzog (für 50 Euro im Monat). Sie trennt sich jedoch nicht von ihrem Besitz, um wieder mehr Moral zu gewinnen, sondern weil sie sich auf ihr „allmähliches Verschwinden vorbereiten muss und will“, wie sie schreibt. Die 71jährige hat zwar nicht vor, demnächst zu sterben, aber sie lebt auf dem Land und ihre wesentliche Tätigkeit besteht im Basteln und Reparieren (auf ebenso hohem Niveau wie ihre Moralpolitik – vor ihrem taz-Engagement war die Informatikerin Mitgründerin der technikkritischen Zeitschrift „Wechselwirkung“). Nun geht sie vorsorglich davon aus, dass sie in zehn bis fünfzehn Jahren zu solchen Arbeiten nicht mehr in der Lage sein wird. Gerahmt wird diese Ding-Reduzierung bei ihr von einem allgemeinen Zug zur Bescheidenheit, d.h. von ihrem Anspruch, immer weniger zum Leben zu brauchen. Fast hört sich das an wie ein geplantes „Fading-Away“, so dass am Ende vielleicht nur noch einige wenige Dinge (Filme und Bücher) von ihrer Anwesenheit hienieden zeugen – als eine Art Existenz-Essenz.
Ist das nicht geradezu eine Anti-Wirtschaftsweise? Wo doch die Lebensgeilheit der meisten Wohlhabenden sich gerade darin zeigt, dass sie immer mehr Dinge anschaffen (bis hin zu Schlössern, Schiffen und ganzen Inseln) – und ihnen zuletzt nichts anderes mehrübrig bleibt, als – zum Glück vergeblich – um ihre Unsterblichkeit zu „kämpfen“.
Über diese Anökonomie, die Imma allerdings nicht so nennt und schon gar nicht moralisiert, hat sie nun im „Aufland-Verlag“ (Oderbruch) „Reflexionen über das Mensch-Ding-Verhältnis“ veröffentlicht: „Dichtung und Heimwerk“ betitelt (wobei sie einiges ihrem taz-blog entnahm). Man erinnert sich vielleicht noch an das Buch von Arundhati Roy „Der Gott der kleinen Dinge“. Es heißt, „er ist der Gott dessen, was verloren geht, der persönlichen und alltäglichen Dinge, nicht der Gott der Geschichte, die die ‚kleinen Dinge‘ grausam in ihren Lauf zwingt.“ Der hiesige Gott steckt dagegen bereits laut Spinoza in allen Dingen (Tiere und Pflanzen sind auch „Sachen“). Zudem stellen sie und andere Sachen als Ware die „gesellschaftlichen Verhältnisse“ her, wie Marx schrieb, während wir als Personen/Produzenten „sachliche Verhältnisse“ eingehen.
Imma Harms bezieht sich in ihren Reflexionen kaum auf solche und andere (Ding-)„Diskurse“, schreibt ihr Verleger Kenneth Anders im Vorwort. Ihre „beinahe pingeligen Analysen“ könnten entmutigen, es gibt darin „Trauer und Komik“, aber noch öfter ist da beim Basteln und Reparieren auch „das Gelingen“. Letzteres könnte sich sogar zu einem „gelungenen Leben“ aufsummieren. Man wird sehen.
.

Erinnerungskultur
.
Wasser nutzen
„Das Wasser spricht zu uns,“ sagen die Feinhörigen. Ich interviewte 2018 einen Hersteller von heilkräftigendem „Wunderwasser“ (den Erfinder von „Bionade“ in Ostheim), habe aber nichts verstanden. Zu mir spricht das Wasser bloß durch elektrische Wasserkocher: Nicht nur, dass es darin schon gleich nach dem Einschalten wenn auch noch leise anfängt zu „reden“, man hört auch hin, achtet darauf, was es zu sagen hat, auch wenn es falsch wäre zu meinen, dass das Wasser im Kocher uns direkt anspricht. Das tut es nicht, obwohl es das eigentlich soll (um uns akustisch den Stand seiner Erhitzung mitzuteilen).
Das Wasser im Kocher pfeift, heult wie starke Winde, zischt, murmelt, knattert vorübergehend, rhythmisiert gelegentlich sogar seine Äußerungen. Dann klingt es wie ein Lied. Ein Blubbern, das immer tiefer wird, nicht gleitend, sondern in Sprüngen. Da weiß man dann, als geübter Nutzer von wer weiß wie vielen Kochern, dass das Wasser gleich siedet, d.h. auf Meereshöhe (Normalnull) 100 Grad erreicht (auf dem Mount Everest ist der Luftdruck dagegen so gering, dass das Wasser schon bei 70 Grad siedet und dann nur noch verdunstet; damit läßt sich kein Tee kochen).
Es ist natürlich das Wasser, das spricht. Der Kocher ist nur sein Echoraum, der allerdings das Wasser von unten her in geräuschvolle Wallung bringt. Das ist seine Aufgabe. Und wie schnell er dabei versagt: Manche Wasserkocher halten nur einige Monate, die billigen.
Wenn das Wasser spricht, dann individualisiert der Kocher die Töne, denn jeder klingt anders beim Erhitzen des Wassers, je nach Material. Manche klappern sogar mit dem Deckel, kurz bevor das Wasser in ihnen kocht. Das macht die Luft, die aus dem sich erhitzenden Wasser nach oben entweicht, sie löst ihre molekulare Verbindung mit ihm.
Stellt man den Wasserkocher unter eine Vakuumglocke und saugt die Luft darunter ab, fängt das Wasser an zu kochen, ohne heiß zu werden. Bei jeder Temperatur hat das Wasser einen bestimmten Dampfdruck. Liegt dieser über dem Luftdruck (wie im Vakuum), siedet das Wasser, wobei es irritierenderweise sogar kälter wird. Noch ungeklärt ist, warum heißes Wasser, wenn man es bei großer Kälte ausschüttet, schneller gefriert als kaltes. Die heißen Tropfen rieseln als Eisregen runter.
Wasser hat ja die wunderbare Eigenschaft, alles zu beseelen – ohne Wasser kein Leben, weswegen auch nicht das Meer die Mutter symbolisiert, sondern die Mutter das Meer. Und dann kommt es auch noch in flüssiger, gasförmiger und fester Form vor, wobei es sich im Gegensatz zu allem Übrigen bei Kälte, als Eis, ausdehnt. Für den Wasserkocher ist das gefrorene Wasser kein Thema, wohl aber das gasförmige, das beim Erhitzen auf den Deckel drückt und aus der Tülle entweicht – und zwar rhythmisch, insofern das verdampfende Wasser pulsierend nach oben schwallt.
Wahrscheinlich ist es auch nicht unwichtig bei der Wassersprache, woher es kommt. In Berlin hatten wir vier Wasser zur Verfügung: Die vier Alliierten hatten in ihren vier Sektoren unterschiedliche Reinheitsgebote für das Brauchwasser eingeführt. Das im amerikanischen Sektor war am meisten gechlort, das im sowjetischen Sektor am wenigsten. Alle Berliner Wasser argumentierten jedoch durchweg kalkhaltig, wenn man so sagen darf. Die Wasserwerke sagen es so: Das hiesige Wasser enthalte „wertvolle Mineralien“, sein „Charakter ist eher hart. Was salopp als ‚kalkhaltig‘ bezeichnet wird. Für den Menschen ist das gut, aber nicht für Kaffeemaschinen, Geschirrspüler und Wasserkocher.“
Der Kalk gehörte einst zum Leben im hiesigen Wasser. Der Berliner Mikropaläontologe Christian Gottfried Ehrenberg entdeckte 1848, dass der Boden hier aus Kieselgur – den Resten winziger hartschaliger Tierchen (Radiolarien) – besteht. Die Hausbesitzer wollten daraufhin entsetzt wissen, ob damit nicht die Gefahr bestünde, dass sich ihre Häuser davon bewegen könnten. Ehrenberg beruhigte sie: „Das tun die so vorsichtig, dass Sie nicht begreifen, warum Ihr Haus eines Morgens an der Elbe steht.“
Ansonsten ist das Berliner Wasser laut den Wasserwerken „naturbelassen und muß nicht gechlort werden“. Es enthält jedoch immer mehr Sulfatanteile (über das gesundheitlich bedenkenlose Maß hinaus) – aus den Lausitzer Tagebauen, deren Wasser die Spree speist, die wiederum die städtischen Brunnen füllt, weswegen die Politiker in Brandenburg und Berlin derzeit „Sulfatgespräche“ führen. Ihnen hat das „Kompetenzzentrum WasserBerlin“ bereits zur „Aufbereitung von Grundwässern mit erhöhtem Sulfatgehalt“ mehrere „innovative Optionen“ vorgelegt. Daneben sind auch noch die Zuflüsse an Eisen ein Problem: Beides macht das Trinkwasser „braun und salzig“, wie die Initiative „Kohleausstieg Berlin“ kritisiert, die den Braunkohle-Tagebaukonzern Vattenfall dafür haftbar machen will (deren „Grubenwasserkläranlagen“, die das Eisen mit „Fällungsmitteln“ rausfiltern, anscheinend nicht reichen).
Eine Weile war es hier im ernährungsbewußten Juste Milieu Mode, sich für die Küche eigene kleine Filteranlagen anzuschaffen. Einige ihrer Besitzer behaupten, dass das gefilterte Leitungswasser im Wasserkocher „schöner klingt als das ungefilterte aus dem Hahn“. Tatsache ist, dass die neuen elektrischen Wasserkocher mit eingebautem Kalkfilter anders sprechen als die alten mit externem Filter.
Vor allem macht es jedoch einen großen (sprachlichen) Unterschied, ob der Wasserkocher ganz oder nur halb voll Wasser ist, denn je größer der Echoraum desto lauter und klarer werden die Töne des sich erhitzenden Wassers. Wenn sehr wenig Wasser im Kocher ist, spricht es in Knallern. Diese hat der Wissenschaftsjournalist Norbert Lossau in einem „Welt“-Artikel erklärt: Da der Wasserkocher „von unten erhitzt wird, erreicht das Wasser am Boden zuerst Temperaturen am Siedepunkt. Irgendwann reicht die Energie aus, um kleine Gasbläschen aus Wasserdampf entstehen zu lassen, die nach oben steigen, wo es noch kalt ist. Im kühleren Wasser kondensiert der Dampf der Bläschen schlagartig. Bei dieser Implosion wird Schall erzeugt.“
Je mehr Bläschen implodieren, desto lauter werden die Geräusche, was bei wenig Wasser im Kocher schnell der Fall ist. Aber irgendwann implodieren sie nicht mehr, dann „herrscht Ruhe“, nach einer Weile wird es aber richtig laut, der Autor spricht von einem „Crescendo“. Es hört sich unangenehm an, zum Glück stellt sich der Wasserkocher dann schnell mit einem lauten Klack aus. Gegebenenfalls erfolgt auch ein schriller noch unangenehmerer Pfeifton – für alle, die einen Wasserkessel auf dem Herd erhitzen, der eine Pfeife auf der Tülle hat, welche durch den Dampfdruck laut wird.
Auf das Klack, mit dem sich der Wasserkocher ausstellt, folgt ein dumpfes Blubbern, das langsam abebbt, bis zur völligen Stille. Auch schön. Aber wenn man z.B. Teewasser heiß macht, hat man jedesmal, wenn der Wasserkocher schweigt, das Gefühl, dass man zu lange mit dem Aufbrühen gewartet hat, denn eigentlich soll man den Tee mit blubbernd kochendem Wasser aufgießen – und nicht mit stillem Wasser. Man soll es jedoch nicht erneut oder gar mehrmals aufkochen, weil jedesmal der im Wasser gebundene Sauerstoff entweicht, der aber für den Teegeschmack wichtig ist, wie mir eine Nordfriesin versicherte.
Ob sauerstoffreiches Wasser anders durch den Wasserkocher zu uns spricht als sauerstoffarmes, kann man nur vermuten. Der Merve-Verlag veröffentlichte 1973 ein Manifest von zwei französischen Physikern, die ihren Wissenschaftskollegen rieten: Hört auf mit der unsinnigen und sauteuren Suche nach dem kleinsten Teilchen, widmet euch lieber der Küche, wo fast alle Vorgänge noch physikalisch ungeklärt sind, selbst das Kochen des Wassers. Das haben sich inzwischen einige zu Herzen genommen, erwähnt sei die Grazer Naturwissenschaftlerin Silke Meier und ihre Diplomarbeit „Kulinarische Physik“.
Ein anderes Problem, chemisch-biologischer Art, ist krank machendes „unsauberes Wasser“, dass Millionen Menschen immer noch zum Kochen benutzen. Daran erinnert an jedem 22. März der „Weltwassertag“.
.
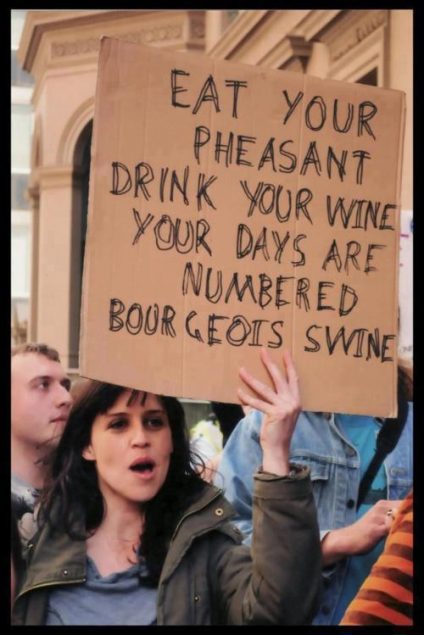
Wladimir Majakowski
.
Affenforschung
Gestern Abend liefen auf Arte gleich mehrere Filme über Schimpansen und Bonobos. Die Affenforschung ist in der Biologie und Anthropologie besonders beliebt. Vor allem die Menschenaffen stehen – darwinistisch gesehen – den Menschen besonders nahe, mit dem Unterschied, dass man straflos alles mit ihnen machen kann, vom Aufbohren ihrer Schädel bis zum mehr oder weniger respektvollen Beobachten ihres Zusammenlebens in Freiheit. So mehrt sich das Wissen über sie. Anders als Hunde wollen die Affen jedoch nichts von uns wissen.
Desungeachtet hielt es der Paläoanthropologe Louis Leakey, der zusammen mit seiner Frau in der kenianischen „Olduwaischlucht“ nach Knochen des „Frühmenschen“ bzw. „Urprimaten“ grub, aus dem sich einst Menschenaffen und Menschen „entwickelten“, für sinnvoll, dass man daneben auch die Lebensweise der heutigen Menschenaffen erforscht.
Da er die westliche Verhaltensforschung für patriarchalisch verblendet hielt und sowieso Frauen mehr Fähigkeiten zum Verstehen des Sozialen zugestand als Männern, schickte er in den Sechzigerjahren drei junge begeisterte „Affenfrauen“ in den Dschungel – nach zehn Jahren wollte er die ersten Berichte von ihnen haben: die Sekretärin Jane Goodall ging nach Tansania zu den im „Gombe Stream National Park“ lebenden Schimpansen; die Ergotherapeutin Dian Fossey schickte er nach Ruanda zu den Gorillas, die in den Bergen der Virunga-Vulkankette leben; und die hippieske, von Orang-Utans begeisterte Studentin Birute Galdikas auf die Insel Borneo in das Reservat von Tanjung Puting.
Ausgehend vom „National Geographic Magazine“, dessen Herausgeber diese drei „Langzeitprojekte“ finanziell förderten, verfilmte man, z.T. mehrmals, auch die Lebensgeschichten der drei Frauen. Der letzte Dokumentarfilm – über Birute Galdikas Arbeit, „Born to be Wild 3D“ – wurde kürzlich auch einer Gruppe freilebender Orang-Utans vorgeführt. Jane Goodall lebt sporadisch noch heute auf ihrer Station am Gombe-Fluß, daneben hat sie eine internationale Tierschutzorganisation gegründet. Weil die tansanischen Regierungsbeamten kein „junges englisches Mädchen ohne europäische Begleitung“ in den Busch lassen wollten, wurde sie zunächst von ihrer Mutter begleitet, die im „Camp“ ein kleines Hospital für die Leute aus den umliegenden Dörfern einrichtete, was Jane Goodall half, von ihnen akzeptiert zu werden. Das Anfüttern der Schimpansen mit Bananen trug dann dazu bei, dass nach einiger Zeit bis zu 45 Tiere ihr Camp aufsuchten, einige regelmäßig. Dazu kam bald auch eine Pavianhorde, die sich zum Bedauern der Schimpansen und Jane Goodalls angewöhnte, „ständig in der Nähe herumzugammeln“. (Während man auf ihrer Station die Paviane weg haben wollte, erforschten ironischerweise die nachfolgenden jungen Affenforscherinnen Paviane, indem sie deren Horden immer näher zu kommen versuchten.) Es dauerte auf Goodalls Station sechs Jahre, bis die 20 Mitarbeiter des Forschungprojekts einen optimalen „Futterplatz“ aus Beton und Stahl für die Schimpansen gebaut hatten. Später kam noch ein zweiter für Touristen hinzu. Dian Fossey setzte sich dagegen schon früh derart rabiat für den Schutz „ihrer“ Gorillas – vor allem vor einheimischen Jägern, die sie Wilderer nannte – ein, dass man sie 1985 in ihrem „Camp Karisoke“ ermordet auffand. Andere Verhaltensforscher und Gorillaschützer führten ihre Arbeit fort. Erst kürzlich kam von dort die Nachricht, dass „drei männliche Gorillas mehrere Fallen zerstört“ hätten – und zwar „äußerst fachmännisch. Die Fallen waren für sie als Erwachsene zwar nicht gefährlich, jedoch war wenige Tage zuvor ein kleiner Gorilla in solch einem ‚Schnappseil‘ zu Tode gekommen, nachdem er sich beim Versuch, daraus zu entkommen, die Schulter gebrochen hatte.“
Die dritte Affenforscherin, Birute Galdikas, lebt heute noch im Wald auf ihrer „Auswilderungs-Station“ für in Gefangenschaft gehaltene oder dort geborene Orang-Utans (über 100 in den ersten 23 Jahren ihrer Forschung). Sie hatte immer wieder gegen „Holzfäller“ zu kämpfen, die ihr „Paradies“ mit Kettensägen bedrohten. Inzwischen ist sie mit einem der einheimischen Parkverwalter verheiratet und hat drei Kinder. „Für mich war die Beobachtung und Rettung von Orang-Utans kein Projekt, sondern eine Aufgabe, eine Berufung, ich wollte sie verstehen, nicht um eine akademische Karriere damit zu machen“, schreibt sie. Sie fühlte sich für das Leben und Arbeiten im Regenwald auch deswegen berufen, weil sie in einem Wald (in Litauen) gezeugt wurde und in einem anderen Wald (in Kanada) aufwuchs. „Meine wissenschaftliche Ausbildung und schlichte Verehrung des Waldes im Verein mit der genauen Kenntnis und den Fertigkeiten der Dajak (den mit dem Wald vertrauten Ureinwohnern]), brachte meine Untersuchung der Orang-Utans ein gutes Stück voran.“
Die drei Frauen ersetzten zwar für verwaiste Jungtiere die Mutter, die wild lebenden Affen beobachteten sie jedoch nur aus einiger Entfernung, wobei sie nach und nach mit einigen vertraut wurden; deren Biographien sind dann auch ganze Kapitel in ihren Büchern gewidmet. „Affen sind viel zu intelligent, um uns für einen der ihren zu halten. Jane, Dian und wir alle, die wir mit wildlebenden Primaten arbeiten, versuchen uns lediglich als harmlose, bewegliche Teile in die Umwelt der Tiere zu integrieren. Schließlich wollen wir ja ihr natürliches Verhalten beobachten“, meinte ein früherer Mitarbeiter von Dian Fossey. Bei den Orang-Utans war diese „höfliche Distanz“ quasi naturgegeben, da sie „Baumbewohner“ sind, wohingegen Galdikas sich als „erdgebunden“ bezeichnet. Einige von ihr aufgezogene Orang-Utans sind in „close contact“ mit ihrer Station geblieben. Einer versuchte einmal eine ihrer Köchinnen zu vergewaltigen, die anderen einheimischen Mitarbeiter von Beirute Galdikas behandelte er als Dienstboten.
Bei ihren ersten Annäherungsversuchen machte Dian Fossey noch Fehler: z.B. trommelte sie auf ihrem Oberschenkel, um das Brusttrommeln der Gorillas zu erwidern, dies hat jedoch eine aggressiv-abweisende Bedeutung. Ebenfalls merkte sie erst nach einer Weile, dass es besser war, sich den Tieren auf allen Vieren zu nähern und nicht aufrecht. Zudem zwang sie sich, selbst bei einem Angriff nicht wegzulaufen, nachdem sich das bei einigen ihrer Studenten als fataler Fehler erwiesen hatte. Nach zehn Monaten hatte sie das Gefühl, eine „unsichtbare Schwelle zwischen sich und den Tieren überschritten“ zu haben: „Peanuts“, ein junges Männchen aus der Gruppe 8 „futterte etwa fünf Meter neben mir, als er plötzlich innehielt, sich umdrehte und mich ansah. Gebannt erwiderte ich seinen Blick. Peanuts beendete diesen unvergesslichen Augenblick mit einem tiefen Seufzer und futterte ruhig weiter.“ Dian Fossey telegrafierte ihrem Förderer Leakey sofort: „Wurde endlich von einem Gorilla akzeptiert.“ Ein Jahr später, 1967, kam sie mit einem männlichen Jungtier ihrer „Gruppe 4“ in näheren Kontakt, das sie „Digit“ nannte und mit dem sie bald sehr vertraut wurde, auch noch, als er zu einem dominanten „Silberrücken“ heranwuchs. Ein Photo von ihm zierte 1972 das Werbeplakat des Touristenverbandes von Ruanda. Als Digit einmal Dian Fosseys Notizbuch nahm und es sorgfältig und vorsichtig studierte, ließ sich nur noch schwer sagen, wer Beobachter war und wer Beobachteter. Anschließend drehte er ihr den Rücken zu, legte sich hin und schlief ein, was ein außerordentlicher Vertrauensbeweis war. Die Szene wurde zum Hauptteil einer Sondersendung der „National Geographic“.
Die zunehmende Aufmerksamkeit der Medien führte u.a. dazu, dass 1997, als der Bürgerkrieg in der Republik Kongo eskalierte und die Gegend um den Zoo von Brazzaville in das Zentrum der Kämpfe rückte, die französische Armee einen Hubschrauber losschickte, um eine Gruppe von Gorillas aus der Kampfzone auszufliegen, dazu gehörte auch ein im Zoo gefangen gehaltener Schimpanse namens Grégoire mit zwei jungen Gefährten, um die sich Jane Goodall gekümmert hatte, mit einer Spende von Brigitte Bardot.
.

Foto: Guillaume Paoli Madrid
.

Misswahl beim US-Geheimdienst NSA
.
Stadt-Land-Fluß
Der Freund eines Freundes, der in Bayern auf dem Land lebt, wollte zu diesen drei Begriffen einen Dorfkongreß veranstalten. Ein paar Gedanken dazu: In der badisch-elsässigen Gemeinde Whyl kämpfte die dortige BI ab 1975 erfolgreich auf vielen sprachlichen und aktionistischen Ebenen gegen den Bau eines Atomkraftwerkes. Die lokale Bornierung, das „Sankt Florians-Denken“, überwanden sie mit der Parole „Kein AKW in Whyl und anderswo“, aber selbst wenn ihr Horizont die BIsierung der ganzen Welt gewesen wäre, also eine soziale Bewegung hin zu einer (globalen) Revolution, dann ist immer noch unklar, ob diese als Lokomotive oder als Bremse verstanden wird.
Wie der Schriftsteller John Berger in seinem Buch über die Bauern – „SauErde“ – herausarbeitete, wird sie auf dem Land eher als Bremse gegen die Verschlechterung der Lebensbedingungen begriffen, in der Stadt dagegen als ein Motor von zum Besseren führende Veränderungen. In der nahezu durchgehend urbanisierten Gesellschaft gibt es nun sone BIs, die etwas (Neues) fordern, einklagen und solche, die etwas Abwehren, wieder Weghaben wollen.
Der niederländische Schriftsteller Geert Mak veröffentlichte 1999 eine mikrosoziologische Studie über das westfriesische Dorf „Jorwerd“, die beispielhaft den „Untergang des Dorfes in Europa“ thematisierte. 2018 hat die Husumer Schriftstellerin Dörte Hansen romanhaft ein nordfriesisches Dorf, Brinkebüll, porträtiert – von der Nachkriegszeit bis heute. Ihre Feldarbeit beginnt bereits mit seinem Untergang – dem „Ünnergang“, wie es da auf Plattdeutsch heißt. Auch mit der Jägerschaft geht es dort zu Ende: „Die Jägerinnen hatten bei der letzten Vorstandswahl die meisten Posten unter sich verteilt“ – und ihren Verein umpositioniert: „Statt Abschüsse zu machen und bei der Treibjagd eine gute Strecke hinzulegen, wurde neuerdings nur noch gehegt, gepflegt, gefüttert. Das Revier verkam zu einem Streichelzoo.“ Aber das Dorf ist noch immer da, es lebt, fortan wird es aber zunehmend simuliert, desungeachtet weckt sein Reenactment (seine Nachstellung) ganz reale (real estate) Sehnsüchte bei den Städtern, die von Naturschutz, Tierwohl, Ökologie und gesunder Luft befeuert sind. Zu diesem „Strukturwandel“, wie man den Prozeß in Brüssel auch nennt, gehören in Brinkebüll die schon fast vergessenen alten Tätigkeiten (wie Schafwollespinnen und -weiterverarbeiten) von einigen aus Berlin in die leerstehende Dorfmühle gezogenen Linken reenacted. Aber nun nicht mehr als Gewerbe, sondern eher als Kunst. Diese neuen Brinkebüller wollen in die Natur; die alten wollen raus aus der Natur, sie haben sich lange genug damit geschunden. Das sei, so Dörte Hansen, das „große Missverständnis“ zwischen ihnen.
Um ein eher geoklimatisches „Mißverständnis“ geht es in dem koreanischen Film „Snowpiercer“ (2013). der aus dem französischen Comic „Schneekreuzer“ einen „kapitalismuskritischen Actionfilm“ machte. Der Autor Raul Zelik widmet ihm in seiner Globalanalyse „Wir Untoten des Kapitals“ (2020) ein ganzes Kapitel. Es geht darin um die Befreiung der letzten Menschen aus einem letzten Luxus-Personenzug, der durch eine Eiswüste dahinrast. Nach einigen blutigen Kämpfen im Bord-Bistro entgleist der Zug beim Notbremsen und sie gelangen ins Freie: „Am Ende des Films sieht man einen Eisbären – vielleicht werden sie jagen können.“
Die Chance, den Bär zu töten, ist in dem Film, der quasi von einer Klimaerkaltung ausgeht, die Hoffnung, im Eis zu überleben, wenn auch auf vorindustriellem Niveau. Zelik dient seine Nacherzählung zur Illustration einer These von Walter Benjamin: „Marx sagt, die Revolutionen sind die Lokomotive der Weltgeschichte. Aber vielleicht ist dem gänzlich anders. Vielleicht sind die Revolutionen der Griff des in diesem Zug reisenden Menschengeschlechts nach der Notbremse.“
Noch vor dem wegschmelzenden Eis forschte der französische Inuitforscher Jean Malaurie. In seinem Bericht „Leben mit den Eskimos“ (1977) fragte er sich: „Wir haben den Fortschritt: in ihren Dörfern, aber ist es ein Fortschritt zurück?“ Gemeint sind die „Grönland-Eskimos“, die sich seit zweieinhalb Jahrhunderten mit den Dänen vermischt und christlich geboren, zu einem „neuen Volk“ wandelten.
Inzwischen sind viele Dörfer teils verlassen, teils siechen darin nur noch einige ihrer letzten Bewohner lethargisch dahin. Man setzt alle Hoffnungen auf den arktischen Kreuzfahrt-Tourismus, dessen Saison alljährlich mit der Klimaerwärmung länger wird.
Ein Freund nannte diese Kreuzfahrer „Amüsierpöbel“, nachdem er von einem Bord-Entertainer erfahren hatte, dass viele Passagiere gar nicht an Land gehen, um diesen oder jenen sehenswürdigen Ort zu besichtigen und Souvenirs zu kaufen. Sie essen, trinken, tanzen, unterhalten sich – und fühlen sich auf dem Schiff optimal versorgt, manche leben bereits ständig auf Kreuzfahrtschiffen. „Ein Dorf der Zukunft“ hat ein Maritimsoziologe solche Schiffspassagen genannt, die keine Passagen mehr sind.
.

Miss Atombombe 1957: Lee Merlin
.

.
Albinos
In der Tierwelt gibt es abgesehen vom Artensterben einen Trend, in Städten zu leben – mit „Duldungsstatus“, oder zu wandern – invasiv zu werden. Neuerdings gibt es außerdem den Trend Albino-Werden. Es gibt kaum noch eine Tierart, bei der nicht Albinos geboren werden. Einige Forscher erklären sich das wohlfeil mit der Klimaerwärmung. So beschäftigen sich gleich zwei Studien mit ihrem Einfluß auf Wildschafe. Das hört sich dann so an: Früher war es günstig, ein schwarzes Schaf zu sein. Das dunkle Fell speicherte mehr Sonnenwärme und es brauchte weniger Futter. Inzwischen bietet das Dunkelsein vielerorts keinen großen Vorteil mehr, mit der Folge, dass sich die hellen Schafe durchsetzen.
Die Klimaerwärmung ist ebenso wie die Albinisierung (auch die von dunkelhäutigen Menschen?) ein Phänomen des Anthropozäns. Im Gegensatz zu den hellen Schafen leben die Albinos allerdings nicht so lange und leiden unter ihrem sogenannten „Gendefekt“. „Schuld an ihrem Aussehen ist ein fehlendes Gen,“ heißt es auf „weltderwunder.de“. „Es produziert normalerweise den Hautfarbstoff Melanin. Ohne das Gen kommt es zu einer Stoffwechselstörung der Pigmentzellen, außerdem haben Albinos eine hohe UV-Empfindlichkeit. Nur wenn beiden Eltern das verantwortliche Gen fehlt, können Albino-Kinder gezeugt werden.“ Die „Krankheit“ kann nicht geheilt werden.
Mangels Melanin müssen Albinos die Sonne meiden und haben ein beeinträchtigtes Sehvermögen. Außerdem bekommen sie leicht Hautkrebs. Für in Afrika geborene menschliche Albinos besteht zudem die Gefahr, dass man sie umbringt, weil sie Unglück bringen oder im Gegenteil, weil Teile ihres Körpers Glück bringen. Europäer halten das für Aberglaube, es gibt jedoch Hinweise, dass sie so oder so als Ersatz für weiße Europäer herhalten. Einigen dieser armen Albinos gelingt es neuerdings, im weißen Showgeschäft, als Model z.B., Fuß zu fassen.
Den albinisierten Tieren geht es nicht viel besser: „Im Tierreich führt die weiße Färbung zu erheblichen Einschränkungen der Fitness,“ schreibt „lernhelfer.de“ . Auch sie werden teilweise aus ihren sozialen Zusammenhängen verstoßen, zudem mit ihrer Farbauffälligkeit leicht zur Beute von Raubtieren. Raben von Greifvögeln und Nagetiere von Eulenvögeln z.B.. Auch Trophäenjäger schießen gerne Albinos, bei den meisten Menschen sind sie jedoch noch eine Sensation und Attraktion, sie werden behütet und betätschelt. „Der Markt wird derzeit überschwemmt mit ihnen,“ heißt es auf „Planet Zoo“, in Österreich eröffnete bereits ein „Weißer Zoo“ – nur mit Albinos. Aquarianern wird geraten, Albinos sofort nach der Geburt von den Eltern zu trennen, da diese sie sonst auffressen. Als Züchtungsziel sollte eine solche „Qualzucht“ eigentlich verboten sein.
Es gibt Elch- und Karibu-Albinos in Kanada, Koala- und Känguru-Albinos in Australien (die in den dortigen Zoos täglich mit Sonnencreme behandelt werden müssen), Albino-Wale im Pazifik, Panda- und Tiger-Albinos in China und in Europa Bären-, Wolf-, Wildschwein-, Hirsch- und Reh-Albinos, sowie albinisierte Störe (deren Kaviar weiß ist). Im Internet findet man noch Vogelspinnen- und Maulwurf-Albinos. Als unter der Erde lebende Tiere hätten letztere wie die Grottenolme und Nacktmulche schon längst auf Pigmente verzichten können, jetzt bekommen die Weibchen aber gelegentlich Albinos. Es gehört dies mit zur allgemeinen Verweißlichung der Welt. Das Anthropozän ist im Wesentlichen eine Herrschaft der weißen alten Männer, die bis in alle Ewigkeit und auf allen Planeten den „Fortschritt“ sichern wollen, d.h.: Alles muß verweißlicht werden.
Genetikern der Universität von Georgia gelang es, mit der „Genschere Crispr/Cas9“ in 146 Eizellen bei 21 Eidechsenweibchen eine Genmutation einzuschleusen, die die Anolis-Echsen zu Albinos machte. „Das Überaschende jedoch: ‚Etwa die Hälfte dieser mutierten Echsen hatte die veränderte Genvariante sowohl im mütterlichen wie im väterlichen Allel. Vier der Tiere waren daher echte Albinos mit weißer Haut und rosa Augen, die restlichen fünf waren heterozygot und daher trotz einer mutierten Genvariante im Erbgut normal gefärbt‘,“ berichtete der Teamleiter auf „wissenschaft.de“. Von einer Gen-Mutation auszugehen, ob künstlich oder zufällig entstanden, reicht nicht zum Verständnis des massenhaften „Albino-Wunders“.
Der vor der antigenetischen Politik des „Lyssenkoismus“ in der Sowjetunion nach Sibirien ausgewichene Genetiker Dimitrij Beljajew fing 1959 an, auf einer Pelztierfarm Domestikationsversuche mit Silberfüchsen durchzuführen. Er wollte beweisen, dass man „soziale Intelligenz“ und Zahmheit (die den Tierpflegern die Arbeit erleichtern würde), züchten kann. Einzig, indem man den jeweils zutraulichsten Fuchs eines Wurfs weiter vermehrt, d.h. ohne Kontakt mit ihm aufzunehmen und trotzdem eine „Selektion auf Kommunikation“ durchzuführen. Nach 35 Generationen und 45.000 Silberfüchsen war Beljajew am Ziel: die Füchse waren domestiziert! Aber sie hatten sich dabei körperlich verändert: Sie hatten Schlappohren, bellten, wedelten mit dem Schwanz und bekamen weiße Flecken – wie so viele Haus- und Nutztiere: von den weißen Labortieren (Mäuse, Ratten) über Hunde und Katzen bis zu den Schlachtvögeln und Rindern. Die Domestizierung verweißt also die Tiere, und vielleicht tritt der selbe Effekt auch bei den Wildtieren jetzt auf, die Albinos gebären, weil der Mensch ihnen zu sehr auf die Pelle rückt.
Als Pelztiere waren die sibirischen Füchse mit ihren weißen Flecken jedenfalls nicht mehr zu gebrauchen. Ludmilla Trut, die Assistentin von Beljajew, der 1985 starb, führte die Zucht weiter, nach dem Zerfall der Sowjetunion mit amerikanischen Geldern. Die zahmen Füchse werden nun in den USA als Haustiere vermarktet, wie sie in ihrem Buch „Füchse zähmen“ (2018) schreibt. Dort heißt es: „Gern hätte Beljajew sein populärwissenschaftliches Buch ‚Ein neuer Freund für den Menschen‘ geschrieben.“ In einem Clip auf Youtube führt ihre Doktorantin Irina Mukhamedshina einen der Füchse an der Leine durch die Stadt: „This Siberian Fox can be your next pet“ (für 5000 Dollar). Ist das der Beginn eines anthropozentrisch injizierten Albinismus? fragte ich einige Biologie Studierende, aber die Albinos waren ihnen noch kein Thema. Wohl aber Füchse. Nicht nur sind es die beliebtesten Wildtiere in der Stadt, auch in den Wäldern passiert es in letzter Zeit immer mal wieder einem Forstangestellten, das sich ihm ein kleiner Fuchs aus einem Wurf nähert und die beiden sich fortan näher kommen, so dass sich eine z.T. jahrelange Freundschaft entwickelt. Es gibt darüber bereits mehrere Bücher von den derart beglückten Forstleuten. Die Füchse bekommen davon keine weißen Flecken, aber vielleicht ihre zahmen Nachkommen. Wenn in der Stadt lebende Füchse zahm werden (im Prinzenbad z.B.), erschießt man sie, jedenfalls bis jetzt noch.
Der Albinismus kann im übrigen auch Pflanzen betreffen – vor allem Cannabis, wie „zamnesia.org“ berichtet. „Bei Pflanzen ist er gekennzeichnet durch einen teilweisen Verlust von Chlorophyll (die Pflanzen ihre grüne Färbung verleihen), sowie von roten und gelben Pigmenten. Dieser Mangel an Chlorophyll beeinträchtigt ihre Fähigkeit zur Photosynthese.“
.

.

.
Spixaras
Man kennt vielleicht diese großen blauen Papageien, Hyazinth-Aras. Auch die Spix-Aras sind blau, mit grauweißen Köpfen, oft etwas verwuschelt. Benannt wurden sie nach dem Sammler ihrer Balgen Johann Baptist von Spix 1819. Sie sind in ihrem Verbreitungsgebiet in Brasilien ausgestorben, 2000 wurde das letzte Männchen gesehen, ein für ihn ausgewildertes Weibchen starb an den Drähten eines Strommastes. Aber in Zoos und von privaten Papageienhaltern werden noch Spix-Aras gehalten. Inzwischen sind es weltweit 160, berichtete „spektrum.de“. Einer kostet etwa 100.000 Dollar.
2011 meldete die Märkische Oderzeitung: „Die letzten Spix-Aras leben in Schöneiche. Sie gehören dort zur wertvollen ‚Reservepopulation‘ des Vereins zur Erhaltung bedrohter Papageien“ – in Volieren, umsorgt von Pflegerinnen, Tierärzten und Biologen, geschützt „hinter Sicherheitstoren und Stahlzäunen, überwacht von Kameras und abgeschirmt von blickdichten Hecken,“ schrieb die Süddeutsche Zeitung 2018. Der Verein mit Namen „Association for the Conservation of Threatened Parrots“ (ACTP“) ist Teil eines internationalen Netzwerkes von „Schutzprojekten“. Ihm gehörten zunächst 7 Spix-Aras.
2011 werden in Schöneiche zwei Spix-Aras geboren – Kiki und Felix. Die Märkische Oderzeitung berichtet: „Das ist unglaublich, schwärmt der Vereinsvorsitzende Martin Guth. Der ACTP beteiligt sich seit seiner Gründung 2006 nicht nur an der Zucht, seine Volierenanlage in Schöneiche ist auch eins von drei Zuchtzentren weltweit; mit den Spenden seiner Mitglieder hat der Verein in Caatinga eine Farm gekauft und dem brasilianischen Staat das Projekt überschrieben. Der ACTP finanziert Schulen, die den Einheimischen vermitteln sollen, warum es nötig ist, Tierarten zu erhalten und Natur zu schützen. In Deutschland arbeitet der Verein eng mit dem Bundesamt für Naturschutz zusammen.“
Der Vereinsvorsitzende Guth war zuvor in der Bau- und Immobilienwirtschaft tätig und züchtet seit seiner Kindheit Papageien. „Ich komm aus‘m Osten. Papageien waren schön bunt,“ erklärt er schlicht. Guth hat einen Münchner Immobilienunternehmer als Kompagnon, Jürgen Dienst: „Er trägt einen Anzug und drückt sich gewählt aus,“ fand die Süddeutsche Zeitung. Die Zuchtanlage in Schöneiche, die als Zoo anerkannt wurde, finanzierten ihm „Großspender“ aus seiner früheren Branche. Höchstens 1000 Besucher dürfen jährlich die Vögel dort besichtigen.
Anläßlich der zwei neugeborenen Spixaras sprach die Lausitzer Rundschau von einem „Papageien-Paukenschlag“. Allerdings hatten die Eltern von Felix und Kiki vor Jahren schon einmal zwei Junge bekommen: „Danach war Vater-Papagei Richie innerhalb des Zuchtprogramms nach Brasilien ausgeliehen worden und sollte dort für Nachwuchs sorgen – vergeblich. Voriges Jahr kam er zurück nach Brandenburg. „Wir haben entschieden, ihn zu seiner früheren Partnerin zu setzen“.“ „Und dann ging es auch ganz schnell.“ Ende 2010 legte das Weibchen Eier. Es schlüpften zwei gesunde Küken. „Das ist ein einzigartiger Erfolg, wo es doch derzeit in der Welt mit der Zucht nicht so erfolgreich läuft“,“ meinte der Geschäftsführer des Vogelparks Walsrode.
2015 wurden in Schöneiche weitere vier Spixaras geboren und Martin Guth schickte zwei Vögel zwecks Auswilderung nach Brasilien. Sie wurden von der brandenburgischen Umweltministerin am Flughafen Tegel medienwirksam verabschiedet.
Von einem „Paukenschlag“ sprach 2019 auch das Magazin „Focus“. Dabei ging es aber um eine streng geheime Operation der Spezialeinheit GSG9 – gegen die „Problemfälle: Kriminelle Clans“, u.a. gegen den des „berüchtigten Clan-Boss“ Arafat Abou-Chaker in Berlin. Der mache Geschäfte mit dem Spixaras-Züchter Martin Guth in Brandenburg, hieß es.
Zuvor hatte die Schweizer „handelszeitung“ berichtet, dass der Schweizer Geschäftsmann „R.M. (Name der Redaktion bekannt)“ im Auftrag von Arafat Abou Chaker und dem Rapper Bushido mehrere „Unternehmen sanierte und abwickelte“. Was die beiden Genannten jedoch bestritten.
Anfang 2000 kaufte R.M.s Firma für „Immobilienhandel und Vogelzucht“ 15 Spix-Aras, etwa ein Fünftel des damaligen weltweiten Bestandes – als „Sacheinlage“ (im Wert von 100.000 Schweizer Franken). 2008 verhaftete man ihn in Rio de Janeiro mit 10 Papageieneiern in den Taschen einer speziellen Weste. Er habe die Eier zum Züchten erhalten, verteidigte R.M. seine „Dummheit“.
Laut „handelszeitung“ ist er „in der Papageien-Szene umstritten“. Man, aber auch die Spixaras, können deswegen froh sein, dass er sich von ihnen inzwischen getrennt habe. R.M. behauptet ebenfalls, seit seiner Kindheit Papageien gehalten zu haben. Drei seiner Spixaras kaufte Martin Guth (für 15.000 Euro), die anderen12 Spixaras erwarb Scheich Saoud Bin Mohammed Ali Al-Thani aus der Königsfamilie von Katar, der ebenfalls ein Zuchtzentrum (das Al Wabra Wildlife Preservation) betreibt.
Die Süddeutsche Zeitung berichtete dann: „Martin Guth führte früher einen Nachtclub und war Schuldeneintreiber. 1996 wurde er zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt.“ Die angloamerikanischen Papageienforscher und Umweltjournalisten wollen ihn am Liebsten erneut aus dem Verkehr ziehen: Ein US-Zoologe nennt Guth einen „Verbrecher“, der „Guardian“ veröffentlicht ein Enthüllungsstück voll mit „haltlosen Vorwürfen“, wie die Süddeutsche Zeitung meint, die dahinter „Neid und Dünkel“ vermutet.
In seinem Buch „Warten auf die Aras“ (2008) schreibt der kanadische Umweltjournalist Terry Glavin: Die Naturschützer, Artenschutzorganisationen und die brasilianische Regierung waren in einem „Dilemma“, um die Spixara-Art zu erhalten, mußten sie eine „Übereinkunft“ mit „einer Handvoll millionenschwerer Exzentriker und von Sammelwut Besessener treffen, die Spix-Aras in ihren Privatzoos hielten.“ Sie waren deswegen gezwungen, „einen Pakt mit dem Teufel zu schließen“. Auch das von der brasilianischen Regierung und diversen Tierschutzorganisationen gegründete internationale Komitee, das diesen „Pakt“ überwachen sollte, bestand laut Terry Glavin aus „einigen zwielichtigen Gestalten“, u.a. dem Amerikaner Tony Silva, der wegen des Schmuggels von Hyazintharas 7 Jahre im Gefängnis saß, und Antonio de Dios, ein philipinischer Millionär, „der in seiner schwer bewachten Vogelzuchtanlage mehrere tausend Papageien, darunter ein halbes Dutzend Spixaras, hielt“, sowie Wolfgang Kiessling, Besitzer des „Disneyland-Zoos Loropark auf Teneriffa“ und zweier Spixaras, der für die Auswilderung 500.000 Dollar zur Verfügung stellte. Guth vermutet hinter dem geballten „Rufmord“ den Präsidenten der „Rare Species Conservatory Foundation“ in Florida Paul Reillo.
Als der Scheich aus Katar „überraschend stirbt“, bekommt Guth von seinen Erben rund 120 Vögel zur Zucht geliehen. „Er hält damit fast alle Exemplare des wertvollsten Vogels der Welt.“ Daraufhin bieten auch „andere Regierungen dem deutschen Wunderzüchter ihre Papageien zur Nachzucht an.“
2019 errichtet Guths Verein für mehr als 800.000 Euro ein Wildtierzentrum auf der Karibikinsel St.Lucia. Dafür durfte er laut Süddeutsche Zeitung „Küken von seltenen Blaumasken-Amazonen aus der Wildnis entnehmen und nach Deutschland bringen. Für viele Experten ein Skandal. Für Guth ‚notwendig. Um den Zuchtstamm zu stärken‘.“
Ende 2018 berichtete der Tagesspiegel über die „engen Beziehungen“ von Martin Guhl zu Abou-Chaker, der ihm u.a. seine „Luxuslimousine“ lieh. Inzwischen hatte sich der „Clan-Boss“ mit seinem Geschäftspartner Bushido überworfen und wurde von diesem beschuldigt, ihn tätlich angegriffen zu haben (Bushido und seine Kinder bekamen daraufhin Polizeischutz). Vor Gericht nannte Bushido laut Spiegel vom Januar 2021 die Zusammenarbeit mit seinem Manager Abou-Chaker einen „Pakt mit dem Teufel, freiwillig sei sie nie gewesen“.
Der Papageienvereinsvorsitzende Guth beteuert, keine Geschäftsbeziehungen mehr zu Abou-Chaker zu haben. Die Bild-Zeitung hatte zuvor berichtet, Bushido und Abou-Chaker „spendeten sehr viel Geld“ an einen „Papageienverein in Brandenburg, dessen Vorsitzender von der Berliner Staatsanwaltschaft ebenfalls zur organisierten Kriminalität gerechnet wird.“ Dazu sagte Martin Guth: „Alles sei sauber, von den Finanzbehörden bestätigt“. Die Süddeutsche Zeitung beruft sich auf Bushido, wenn es um Geld von Abou-Chaker geht: Der hatte vom Regisseur Bernd Eichinger 200.000 Euro bekommen, dafür dass man ihn in dessen Spielfilm über Bushido mit eingebaut hatte – und dieses Geld wurde laut Bushido „irgendwie noch als Spende an einen Papageienverein deklariert oder so“. Guth bestätigte das.
In Schöneiche leben laut „wissenschaft.de“ inzwischen 180 Spixaras. Guths Vereinsorgan „ACTP e.V.“ auf der Spendenplattform „betterplace.org“ teilte mit: „Zum World Wildlife Day, am 3.März 2020, trafen 52 in Berlin gezüchtete Spix-Aras in Brasilien ein. Mit einem eigens für die Vögel und das sie begleitende Team aus Veterinären, Tierpflegern, Biologen, Mitgliedern der brasilianischen Regierung und Kameraleuten gecharterten Flugzeug. Das Gehege befindet sich auf 45 Hektar im geschützten Caatinga-Gebiet. Dort sollen sie in den nächsten Monaten auf ihre Wiederansiedlung und das weitere Leben in freier Wildbahn vorbereitet werden. 2021 soll die erste Gruppe der Spix-Aras in die Freiheit entlassen werden.“
Es gibt inzwischen zwei animierte Familienfilme „Rio“ und „Rio2“, in dem zivilisationsgeschädigte Spixaras die Hauptrolle spielen. Letzterer handelt bereits von den Intrigen und Abenteuern nach ihrer Auswilderung. Um sich davon zu erholen, wollen sie ihren Urlaub in Rio verbringen.
Grundsätzlich kann man vielleicht sagen: Je seltener immer mehr Tierarten werden, desto wertvoller werden einzelne Exemplare – und damit für wohlhabende Sammler (und ihre Schmuggler) um so begehrenswerter. Im „Atlas der Petromoderne: ‚Erdöl‘“ (2021) von Alexander Klose und Benjamin Steininger ist davon die Rede, dass die „Ölprinzen“ vor allem Gerfalken lieben, für die sie bis zu einer Million Dollar zahlen, wobei die aus dem Hohen Norden stammenden weißen Raubvögel das Wüstenklima nur für eine kurze Zeit überleben.
.

Cowboy in Husum
Und Cowgirl in Mecklenburg: Grad empfahl man mir das Buch von Anja Hradetzky: „Wie ich als Cowgirl die Welt bereiste…: und ohne Land und Geld zur Biobäuerin wurde“
.
Meerschweinchen
Der Gründer des Tierparks, der Biologe Heinrich Dathe, schrieb 1936 seine Doktorarbeit über den Penis der Meerschweinchen; auch das erste Tier in „seinem“ Ostberliner Tierpark war 1955 ein Meerschweinchen: „Hansi“. Der Direktor des Westberliner Zoos, der Veterinär Heinz-Georg Klös, schrieb dagegen seine Doktorarbeit 1953 über den Uterus der Meerschweinchen. Während der Münsteraner Zoologe Norbert Sachser, seine Doktorarbeit über „die erstaunliche Fähigkeit der Hausmeerschweinchen“ schrieb, „zwei unterschiedliche Formen der sozialen Organisation auszubilden“: In kleinen Gruppen (z.B. mit drei Männchen und drei Weibchen) bildet sich bei den zwei Geschlechtern ohne großes „Drohverhalten“ eine „lineare Dominanzhierarchie“ aus, wobei das ranghöchste Männchen die Verpaarung mit den Weibchen beansprucht. In Gruppen „von bis zu 50 Meerschweinchen“ tritt „ein weit komplexeres soziales Muster an ihre Stelle“: Sie „splitten sich in stabile Untergruppen auf, die aus jeweils ein bis fünf Männchen und ein bis sieben Weibchen bestehen“. In jeder bilden sich dominante Männchen heraus, die „feste soziale Bindungen zu den Weibchen ihrer Untergruppe haben, die über Jahre bestehen bleiben können. Sie kümmern sich fast ausschließlich um diese Weibchen; nur ihnen gegenüber tanzen sie Rumba, das für Meerschweinchen typische Balzritual.“
In seinem Buch „Der Mensch im Tier“ (2018) erwähnt Sachser ferner den „roten Emil“, ein Alphamännchen in einer großen Kolonie: Wenn man ihn allein in ein fremdes Gehege setzte, geriet er schnell unter Stress, wenn dies jedoch mit seinem „Lieblingsweibchen“ geschah, „stiegen die Cortisolkonzentrationen lange nicht so stark an.“
In den meisten Forschungslaboren werden Meerschweinchen nicht nur unter Stress gesetzt, sondern komplett vernutzt. In dem Buch „Duell zweier Giganten“ (2015), gemeint sind Robert Koch und Louis Pasteur, geht es darum, wie die zwei Bakteriologen die Entdeckung und Bekämpfung von Bakterien (die Tollwut, Tuberkulose, Pest etc. übertragen), durch ihr feindselig-konkurrentes Verhalten voranbrachten. Durch das ganze „Duell“ ziehen sich Meerschweinchen: Sie sind die eigentlichen Hauptpersonen – diese „Prügelknaben der Physiologen“, wie der Entomologe Fabre sie nennt. Kaum bricht in Kairo die Cholera aus, schon packen die Abgesandten von Koch und Pasteur je hundert Meerschweinchen ein und machen sich auf ins finstere Herz der Epidemie. Einer der Forscher wird dort krank: „Gestorben für die Wissenschaft“. Von den vielen Meerschweinchen kehrt keines mehr in seine Heimatkolonie zurück.
Koch mußte anfänglich seine Meerschweinchen noch selbst kaufen, an ihnen erforschte er den Milzbrand-Erreger, Pasteur dann ebenfalls, beide beanspruchten die Priorität; der russische Immunologe am Pasteur-Institut Ilja Metschnikow versuchte zu vermitteln: „Dank dem Franzosen Pasteur wurde die wahre Bedeutung des Milzbrandbakteriums verstanden und dank dem Deutschen Koch wurde dessen Rolle als alleinige infektiöse Ursache dieser Krankheit bewiesen.“ Auch die Gegenmittel werden an Meerschweinchen erprobt, mit dem man sie gegen den Diphteriebazillus impft: „Einige Tiere überleben. Das ist schon ein Sieg.“ Dann werden neue Meerschweinchen herangeschafft: Ihnen werden tödliche Dosen injiziert und wenig später Injektionen mit Serum gegeben, das von den wenigen Tieren stammt, die der Infektionen widerstanden haben. „Die Meerschweinchen überleben“. Aber es ist ein langer Weg vom Ergebnis im Labor bis zur Marktzulassung des Medikaments: Dafür sind „riesige Mengen an Meerschweinchen nötig“ – es fehlt jedoch an Geld. Der preußische Staat hat kein Interesse, die Diphterie (an der jährlich über 1000 Kinder allein in Berlin sterben) zu bekämpfen, er finanziert stattdessen die Forschung an Tetanus, da dies eine große Gefahr für wertvolle Pferde darstellt. Erst vier Jahre später, 1894, bringt die Firma Hoechst ein Serum gegen Diphterie auf den Markt. Der Immunologe Emil Behring, wird damit der erste, den sein Entdeckung reich macht, außerdem adelt man ihn 1901.
Meerschweinchen „dienen“ auch weiterhin in den Laboren – nicht nur als Versuchstiere, auch als lebende Laborgeräte zur Serumproduktion. Darüberhinaus werden sie auch zu Millionen in Kinderzimmern vernutzt. InIrina Liebmanns Roman „Die freien Frauen“ (2004) heißt es dazu: „Ihre Tochter, die war auf einer Matheschule gewesen und hatte Klavier gespielt wie eine Prinzessin, und ihre Tiere hatte sie geliebt, stundenlang mit dem Meerschweinchen beim Arzt gesessen, und dann, weißt du, was, sie hats in den Bauch getreten!“
In den „Zoogeschichten“ von Carl-Christian Elze, dem Sohn des Leipziger Zootierarztes Karl Elze, ist zu lesen, dass er sich immer wieder aufs Neue und einmal sogar auch alle seine Geburtstagsgäste Meerschweinchen im Zoo aussuchen durften. Sie wurden normalerweise an Reptilien und Raubtiere verfüttert. Den von ihm geretteten Meerschweinchen widmet er in seinem Buch mehrere Kapitel. Wenn sie starben, bekam er ihr Fell oder sie wurden sogar ausgestopft und kamen auf ein Regal in seinem Zimmer. Mit den Meerschweinchen, namentlich mit „Lissi 1, 2, 3 und 4“, begann seine „Prägung“ auf Tiere. Er schrieb sogar ein Drehbuch für einen Kurzfilm über eine „Meerschweinchengeburt“, es wurde in sein Buch „Oda und der ausgestopfte Vater: Zoogeschichten“ (2018) mit aufgenommen.
Die Verhaltensforschung ist von der Beobachtung einer Art zu der von Individuen fortgeschritten. Indem die Bundesverfassung der Schweiz Tieren wie Pflanzen eine Würde zugesteht, hat sie über den Artenschutz hinaus (um den “Gen-Pool” nicht zu reduzieren!) den einzelnen Tieren und Pflanzen so etwas wie „Menschenrechte” (im Sinne der Französischen Revolution) eingeräumt. Es geht dabei um die Verbesserung ihrer Lebens- und Haltungsbedingungen – u.a. auch in den Zoologischen Gärten. So dürfen z.B. keine Herdentiere in der Schweiz mehr einzeln gehalten werden – das gilt auch für Meerschweinchen.
Sie werden jedoch weiterhin für alles Mögliche verwendet: „Von der Krebsforschung, über Infektionskrankheiten bis zu toxikologischen Untersuchungen. 2012 wurden 3.721 Meerschweinchen für Hautsensibilisierungstests verwendet,“ heißt es auf „meerschwein-sein.de. „Auch werden Meerschweinchen zur Aus-, Fort-, und Weiterbildung benutzt sowie zur Qualitätskontrolle und Erforschung von Produkten und Geräten. 2007 wurde auch der stark umstrittene Schwimmtest, bei dem die Tiere bis zur Erschöpfung schwimmen müssen, an Meerschweinchen durchgeführt. Der Test mit dem Schweregrad ‚schwer‘ wurde mit 349 Meerschweinchen gemacht. Der Schwimmtest wird in der Depressionsforschung eingesetzt und dient zum Testen von Antidepressiva.“
Auf „justanswer.de” ist von einem eher harmlosen Meerschweinchen-Versuch die Rede: „Ich habe vor kurzem für meine zwei meeris eine Brücke gekauft, um zwei Käfige zu verbinden. Wie schaffe ich es, sie dazu zu bewegen, rüber zu laufen?“
.

Neuland-Brot China 1950
Bei den dort steigenden Erntemengen und dem vielfach praktizierten Trocknen des Getreides im Freien, wurden u.a. die Spatzen für erhebliche Ernteausfälle verantwortlich gemacht. 1958 kam es im Rahmen des „Großen Sprungs nach vorne“ in China zu einer Hygienekampagne, die eine Ausrottung der „vier Übel“ zum Ziel hatte: Ratten, Fliegen, Mücken, Spatzen.
Die ARD erinnerte kürzlich daran: „Mao Tse tung wollte Ernteausfälle bekämpfen und rief zum Krieg gegen die Schuldigen auf, die angeblich zu viel Getreide vertilgten: zum Krieg gegen den Spatz! 600 Millionen Chinesen mußten gegen den gefiederten Volksfeind antreten. Sie veranstalteten einen infernalischen Lärm, um die sensiblen Vögel so zu ängstigen, dass sie so lange in der Luft umherschwirrten, bis sie schließlich erschöpft oder tot zu Boden fielen. Am Ende haben die Chinesen an die zwei Milliarden Tiere erschlagen.“
Aber Maos Spatzenkrieg geriet zum Desaster: „Die Ernteausfälle stiegen dramatisch an, eine große Hungersnot begann. Kein Wunder: Fressen doch
Spatzen sehr gerne Getreideschädlinge! China mußte nun Spatzen importieren – ausgerechnet vom ungeliebten Nachbarn Russland. Für Mao
eine Riesen-Blamage. Bis heute aber ist der Spatz in China rar geblieben.“
Auch wenn daran so gut wie kein Wort wahr ist, soll es hier darum gehen, daran zu erinnern, daß auch in Mitteleuropa die Spatzen „rar“ werden. Nur
bestehen die „vier Übel“ darin, dass die Landwirtschaft immer industrieller wird, dass in Stadt und Land die Hecken gerodet werden,
dass bei Hausrenovierungen die Rankengewächse an den Fassaden runtergerissen werden und dass Nischen sowie Mauerlöcher als Brutplätze
verschwinden. In Bayern und Nordrhein-Westfalen will man den Spatz bereits auf die Rote Liste der gefährdeten Arten setzen.
.
Spatzen
Über die Spatzenbiographie von Gwendolen „Len“ Howards Buch – ‚Birds as Individuals‘ – schrieb der Biologe Julian Huxley: „Der Titel weist bereits auf einen der Hauptpunkte in dem Buch hin, dem die Verfasserin ihr Interesse zugewandt hat.“ – Vögel als Individuen zu erleben – und das über Jahre und Generationen, wobei es u.a. um Spatzen, ging, die von ihr gefüttert und umhegt wurden, und vornehmlich in ihrem Garten lebten, wozu auch das Innere des Hauses gehörte. „Nur wenn die Vögel zutraulich werden und keine Angst mehr haben, kann ein Beobachter hoffen, einen Blick in das Geheimnis ihres Lebens zu tun,“ meint Julian Huxley, der selbst Reiher und (arktische) Tauchvögel erforschte.
Umtriebige Dichter sind dazu selten geeignet: Peter Handke z.B.. Er ist durch die halbe Welt gereist, mit Bus, Zug und Flugzeug, nirgends hielt er sich lange auf, gelegentlich unternahm er kleine Spaziergänge. Seine Aufzeichnungen bestehen aus kurzen Beobachtungen, Aphorismen und Notizen für weitere Buchprojekte (in: „Gestern unterwegs, Aufzeichnungen November 1987 bis Juli 1990“ – 2005). Im Folgenden seine flüchtigen Bemerkungen über Spatzen, für die er eigentlich ein besonderes Interesse hatte:
„Gestern, als es noch nicht regnete, bei trockenem Asphalt, landete neben einem liegenden Platanenblatt ein Spatz, und das Blatt flog davon kurz auf; als ein anderer Spatz landete, rollte von ihm ein Steinchen hin auf das Blatt.,“ am Busbahnhof von Ljubljana, Slowenien 20.Nov. 1987.
„In-der-Welt-Sein (angesichts, ja angesichts, der abgefallenen Blätter jetzt im Morgenlicht von Zadar, mit Alten und Kindern als Passanten, mit Spatzenschreien.)“
„Dubrovnik, Morgendämmerung, Spatzen raschelnd in der Palme.“
„Die Spatzen fliegen unter dem Wind (sie fliegen gerade im Tiefflug über den nassen Boden, lauter schrillend als der Sturm, diesen durchdringend.“ 6.Dez.1987
„Heute, noch in Bitola, gegen Mittag, beim Busbahnhof, dachte ich: ‚Wo bleiben die Spatzen?‘ Und im nächsten Moment landete mir schon einer vor den Füßen, und einen Moment später war der ganze Vorplatz spatzenvoll.“
Im Busbuffet von Florina, Griechenland: „draußen die Spatzen in einem Straßenbusch, der von ihnen, den Unsichtbaren, ruckelte.“
In Dodona: „Spatzen, kleine Fliegen in Stromlinienform.“
In Ioannina: „Die Spatzen und die Farne (die Spatzen hervorschwirrend aus den welken Winterfarnfeldern.“
„Olympia, Morgen, Spatzen.“
Die Startschwelle des Stadions von Olympia, „der etwa 20 Meter langen, aus hellem Marmor, und auf dieser langen Linie saß ein einzelner Spatz, und ein Flugzeug flog hoch darüber – gut, dass die Spatzen sich zu den Trümmerfeldern gesellen.“
In Arkadien: „Eisenhaufen neben den Gleisen, die Schrauben darin wie verrußte Zigarren, samt Spatzen…“
Mykene: „Graues Bruchland, das sich regt und regt und regt: von den grauen Spatzen.“
Gizeh, Ägypten: „die Spatzen auf den Pyramidenblöcken.“
Kairo: „im dicken Stadtstraßenstaub, wie einst auf den ländlichen Feldwegen der beginnende warme Sommerregen; die Beheimatung wieder durch die Allgegenwart der Spatzen.“
„Und in der Dämmerung dann auf dem Platz das wilde Geschrill der sich sammelnden Spatzen in den spärlichen Bäumen…“
An der Bahnlinie Clamart, Frankreich: „Die Stimme aus dem Dornbusch spricht von überallher, aus den Spatzenlauten..“
Tokio, Japan: „Der Schall der ersten japanischen Spatzen vor dem Fenster.“
„Oben auf dem Kastell das Trillern der Spatzen.“ Lissabon, 18.März 1988
„Die Spatzen am Meer als fliegende Fische.“
„Im Finstern des Vormorgens jetzt das Schrillen der ersten Spatzen.“
„Indem du wieder im Dunkeln die Spatzen belauschst, heute am Sonntag kaum übertönt durch die Autos.“
Leòn, Kastilien, 2.April 1988: „Spatz auf dem Zebrastreifen.“
„Spatzen in der Trauerweide, von der Weide das Wort ‚Trauer‘ wegschilpend.“
Arles, Frankreich: „Die Spatzen, wo sind sie heute? Und da sind sie auch schon. Und da waren sie auch schon.“
St. Antonin-sur-Bayon: „Die Spatzen sind mir lieb.“
Salzburg, 3.Mai 1988: „…wenn ein Spatz an mein Fenster kommt, dann schlüpfe ich in seine Existenz und picke im Kies herum.“
Gemona, Friaul: „Mann und Frau sind einander fremder als Mann (oder Frau) und Spatz – sie können sich vielleicht nur über den Dritten, den Spatzen, zeitweise näherkommen?“
Paris, Frankreich: „Auf wie schwachen Beinen wir stehen! – Ja, wie die Spatzen.“
Inverness, Schottland, 6.Jan. 1989: „…gestern Abend das Tausendgeschrei der seltsam großen Spatzen…die Erinnerung an den Sadat-Platz in Kairo vor genau einem Jahr, dort die Spatzen ebenso schreiend in den Bäumen.“
Birmingham, England, 18.Jan. 1989: „Abend, und auch hier die Völkerschaften der dunklen Spatzen mit den hellen Bäuchen, allerwärts auf den Simsen, wie in Inverness.“
Manchester: „Und das Schwarz der dichtgedrängten Spatzen auf den Haussimsen vom Vorabend wiederholt sich jetzt am Morgen an den Schuhreihen in der Auslage eines Schuhgeschäfts…“
Canterbury, England: „Im kahlen, weitverzeigten Vorknospenkirschbaum die Spatzen in Kirschrindenfarben…“
Dover, England: „Mein Stigmagefühl wäre etwa das einer Spatzenform in den Handflächen.“
Tours, Frankreich, 28.Jan. 1989: „In jeder Stadt unterwegs bisher zumindest ein Spatzenbaum; in dem sich die Spatzen am Abend versammeln zum Schlafen, noch bis lang in die Nacht schreiend; der Baum bezeichnet durch Spatzenkotteppiche zu seinen Füßen.“
Frankreich: „Auch in Ille-sur-T`èt die Spatzen nachts in dem einen Baum: sie schwirren wie aus dem Schlaf, wie im Schlaf von Platane zu Platane; …mitternachtlang das Rascheln und Schilpen der Spatzen, neugeborenenhaft, dazu das Geknatter der kleinen Schnäbel, ein Endlosgeknatter und -geschnäbel…“
Cerdagne, Pyrenäen: „…der Schneetag; und ein Spatz pickt vor mir auf dem Weg herum nach den da auftreffenden Flocken, eher Körnern.“
„Als der Sturm wieder einsetzt, wirbelt ein Spatz auf dem Weg auf der Stelle wie ein Blatt.“
Clamart, Frankreich 9.Juli 1989: „Der verwundete Spatz auf dem leeren Parkplatz, berührbar, todgeweiht, dahockend, ‚der Schatten seiner selbst‘: Bewahr wenigstens seine Form (jenes ‚Verschreibt!‘ = schreibt auf!, in den KZs).“
Gemona, Friaul, 18.Oktober 1989: „Ein liebliches Geräusch: das von badenden Spatzen in einer Wasserlache.“
26.Oktober 1989: „Gerumpel der Spatzen in einer welkenden Lärche.“
Soria, Spanien, 20 Dez.1989: „Verb für die Spatzen in den Winterbäumen: sie ‚knospen‘.“
Die Fassade von Santo Domingo: „Sie schubst mich, gibt mir einen Ruck, wie die Spatzen von Soria…“
„Immer wieder: Immer wieder denke ich bei aufschwaermenden Spatzen an Sternbilder (im Bus nach Salamanca).“
Auf der morgenleeren Rambla de Catalunya von Port Bou, „wo nichts unterwegs war als die Spatzen und ein Hund.“
Paris, 7.Juni 1990: „Und wieder erschienen die Spatzen als die Vögel des rechten Moments.“
Chaville bei Paris, 16.Juli 1990: „Am frühen Abend, niemand mehr da als er, betrat er erstmals sein Haus: Prachtvolle Leere. Lesen! Die lila Hortensien im Garten…Das Einfliegen der Spatzen.“
.

Kartoffelkönigin
.

Kartoffeln auf Platz 1
.
Proletarischer Vogel
In Homers „Ilias“ ist davon die Rede, dass es, bevor die Männer in den Kampf gegen Troja ziehen, zu einem „Spatzenwunder“ kam: „Unter des Ahorns Grün, dem blinkendes Wasser entsprudelt. /Sich, und ein Zeichen geschah. /Ein purpurschuppiger Drache, /Gräßlich zu schaun, den selber ans Licht der Olympier sandte, / Unten entschlüpft dem Altar, fuhr schlängelnd empor an dem Ahorn./
Dort nun ruhten im Neste des Sperlings nackende Kindlein, /
Oben auf schwankendem Ast, und schmiegten sich unter den Blättern,/
Acht; und die neunte war der Vögelchen brütende Mutter. /
Jener nunmehr verschlang die kläglich Zwitschernden alle; / Nur die Mutter umflog mit jammernder Klage die Kindlein, /Bis er das Haupt hindreht‘, und am Flügel die Schreiende haschte. / Aber nachdem er die Jungen verzehrt, und das Weibchen des Sperlings; / Stellte zum Wunderzeichen der Gott ihn, der ihn gesendet:/ Denn zum Stein erschuf ihn der Sohn des verborgenen Kronos.“
Dieser Vorfall wird vom Seher Kalchas als ein Zeichen von Zeus erkannt und dahingehend gedeutet, dass die neun von dem Untier gefressenen Spatzen für neun Jahre stehen, die es dauert, bis sie Troja im zehnten erobern werden.
Mit den Spatzen hatte es dann auch Aphrodite, die griechische Göttin der Liebe. In einem Liebesgedicht von Sappho, in dem sie Aphrodite anruft, heißt es: „Aus deines Vaters Haus kamst du auf goldenem Wagen angeschirrt, flink zogen dich die schönen Spatzen über schwarze Erde mit raschem Flügelschlag vom Himmel durch die Luft…“ Der Kulturwissenschaftler Friedrich Kittler erklärte uns dazu: „Die Spatzen ziehen deshalb den Wagen der Aphrodite, weil Spatzen so fruchtbar sind…Spatzen ruckeln und hecken die ganze Zeit, und deshalb sind sie ihre Tiere. Und daran ist nichts Schmähliches. Spatzen werden nicht von der Polizei gejagt.“
Erwähnt sei auch noch der römische Dichter Catull, der dem zahmen Spatzen seiner Geliebten ein Gedicht widmete: „Spatz, Liebling meines Mädchens, /mit dem sie zu spielen pflegt, den sie an der Brust hält, /dem sie die Fingerspitze zu geben pflegt, wenn er danach schnappt, /und den sie zu heftige Bissen anzutreiben pflegt, /Trauert, o Liebesgöttinnen und Liebesgötter/ und (alles,) was es an für Liebe empfängliche Menschen gibt: /der Spatz meines Mädchens ist gestorben, /der Spatz, der Liebling meines Mädchens, /den jene mehr als ihre Augen liebte. /Denn er war süß und er kannte /sie selbst so gut wie das Mädchen seine Mutter, /und er rührte sich nicht von ihrem Schoss, /sondern bald hierher bald dorthin hüpfend /piepste er immerzu alleine sein Frauchen an.“
Nach der griechisch-römischen Verherrlichung des Spatzen als immergeiler Göttervogel gibt es dann eine russische bzw. sowjetische – als „proletarischen Vogel“. Bei Andrej Platonow, der einen Band mit Erzählungen „Die Reise des Spatzen“ betitelte, heißt es in seinem Roman „Tschewengur“ aus den Jahren 1926-1929: „Die Spatzen spektakelten auf den Höfen wie vertrautes Hausgeflügel, und wie schön die Schwalben auch sind, sie fliegen im Herbst in üppige Länder, die Spatzen aber bleiben hier, um Kälte und menschliche Not zu teilen. Das ist ein wahrhaft proletarischer Vogel, der sein bitteres Korn pickt. Auf der Erde können durch lange bedrückende Unbilden alle zarten Geschöpfe umkommen, aber solche unverwüstlichen Wesen wie Bauer und Spatz bleiben und halten aus bis zum warmen Tag.
Kopjonkin lächelte dem Spatzen zu, der es in seinem mühseligen winzigen Leben vermocht hatte, ein großes Versprechen zu finden. Es war klar, daß ihn am kühlen Morgen kein Getreidekorn erwärmte, sondern ein den Menschen unbekannter Traum. Kopjonkin lebte auch nicht vom Brot und nicht vom Wohlergehen, sondern von unbewußter Hoffnung. ‚So ist es besser,‘ sagte er, ohne den Blick von dem arbeitenden Spatzen zu lassen. ‚Sieh an, so klein, aber wie zäh…Wenn der Mensch so wär, dann wär die ganze Welt längst erblüht.“
Auch Tschepurny lobt die Spatzen: „Er ging zum Ziegelhaus, wo die zehn Genossen lagen, aber ihn empfingen vier Spatzen und flogen aus dem Vorurteil der Vorsicht auf den Zaun. ‚Auf euch hab ich gehofft!‘ sagte Tschepurny zu den Spatzen. ‚Ihr seid uns blutsverwandt, bloß Angst braucht ihr nicht mehr zu haben – die Bourgeoisie gibt’s nicht mehr, lebt bitte!'“
Und Dwanow freute sich, als er sah, dass ein „abgemagerter, Not leidender Spatz“ endlich Futter gefunden hatte – und „mit dem Schnabel im sättigenden Pferdekot arbeitete.“
Nirgendwo hat man sich so viele Gedanken über die Spatzen gemacht. Schon bei Puschkin heißt es: „Ich sitze hinter Gittern / im feuchten Knast / unfrei geborener / junger Spatz …“ Iwan Turgenjew schrieb eine Geschichte mit dem Titel „Der Spatz“. In Fjodor Dostojewskis „Aufzeichnungen aus dem Kellerloch“ heißt es, dass er „tatsächlich ohne irgendwelchen Nutzen nur die Spatzen schreckte…“ Der sowjetische Dichter Samuil Marschak, Begründer der „Pionierhäuser“, gab eine Kinderzeitschrift namens „Worobej“ – der Spatz – heraus und Maxim Gorki veröffentlichte eine Erzählung mit dem Titel „Der kleine Spatz“.
Der Dichter Ossip Mandelstam beschrieb in einem Kinderbuch 1925 einige Spatzen, die vor dem geschlossenen Fenster sitzen, einige Leckereien auf dem Tisch sehen und klagen: „Leider nicht für uns das Fest!“
Marina Swetajewa dichtete für Alexander Blok: „Dein Name ist der Spatz in meiner Hand“. „Der Spiegel“ bezeichnete hingegen DichterInnen wie sie als „Spatzen in Stalins Hand“.
In Michail Bulgakows Roman „Der Meister und Margarita“ war das Fenster dagegen offen: „Kusmin tanzte zu den Klängen eines Grammophons. Währenddessen setzte sich das Spätzchen auf das Tintenfaß,…dann flog es mit Schwung gegen das Glas der Gruppenaufnahme,…zerschlug es mit seinem harten Schnabel und flog zum Fenster hinaus.“
Erst mit der Perestroika und der anschließenden Auflösung der Sowjetunion änderte sich die russische Spatzenverherrlichung – gründlich: Tatjana Tolstaja schreibt 1987 in ihrem ersten Erzählband „Sassen auf goldenen Stufen“: „Im schwülen Purpurdickicht des persischen Flieders reisst die Katze Spatzen.“ Der tote Spatz wird feierlich bestattet. „Das Leben ist ewig. Sterben tun nur die Vögel“. Und 1994 heißt es in dem Roman „Wettlauf.Lauf“ von Valeria Narbikova: Während „am Himmel die letzten Individuen fliegen – superexotische Spatzenvögel, weil alle übrigen Spatzen ausgestorben sind“, reisen Petja und Gleb durch ein zunehmend irrealeres Land.
Bereits 2010 meldet der Russischübersetzer Leon Weissmann von den Sperlingsbergen bei Moskau (die bis 1999 Leninberge hießen): „Weit und breit keine Spatzen mehr zu sehen!“ Ähnliches hatte der Literaturwissenschaftler Dimitrij Lichatschow schon während der deutschen Blockade Leningrads 1942 erlebt: „Es gab in der Stadt keinen einzigen Hund mehr, keine einzige Katze, keine Tauben und keine Spatzen.“
.

Kälbermastställe USA
.
Spinozistische Spatzen
Laut Spinoza steht ein Ackergaul einem Ochsen näher als einem Rennpferd, „weil es mit ihm eher gemeinsame Affekte hat,“ wie der Philosoph Gilles Deleuze schreibt. Egal was die Biologen, von Linné bis zu den Artbestimmern (Taxonomen) und den Genetikern, dazu sagen – nämlich, dass die einen Pferde sind (Einhufer) und die anderen Rinder (Paarhufer). Es geht nicht (mehr) um evolutionär entwickelte Physiologien oder um einige alberne Gene, sondern um die Fähigkeit oder Notwendigkeit der Lebewesen, zu affizieren und affiziert zu werden.
Unser Spatz z.B.: Er war aus dem Nest gefallen und ich zog ihn groß. Im Sommer kam er mit aufs Land. Und dort mauserte er sich zu unserem interessantesten Haustier. Bei Spaziergängen flog er voraus, landete aber immer wieder auf der einen oder anderen Schulter und erzählte uns von da aus alles mögliche. Er unterhielt sich gerne mit uns. Im Haus stürzte er sich auf den Frühstückstisch, landete dabei auch mal in der Marmelade – und mußte mühsam gewaschen werden. Auch stürzte er sich gerne auf den dösenden Dackel und zupfte ihm graue Haare aus dem Fell. Mittags schlief er bei meinem Vater auf der Couch, Abends bei meiner Mutter, die sich im Schlaf weniger bewegte. Einmal schlüpfte er nachts unter den Bauch des Meerschweinchens, das ihm daraufhin gedankenverloren einige Flugfedern anknabberte. Der Spatz, den wir Benjamin nannten, konnte danach eine ganze Weile nur noch schlecht fliegen, er blieb aber fröhlich und unternehmungslustig und begleitete uns einfach zu Fuß auf unseren Spaziergängen. Am Liebsten fuhr er im Auto mit, wobei er sich auf die Rückenlehne des Fahrers setzte und sich auf den Verkehr konzentrierte. Monatelang erzählten wir anderen Leuten nur noch Geschichten, in denen er die Hauptrolle spielte. Und er dachte sich fast täglich neue Geschichten aus, die uns begeisterten, auch wenn sie aus seiner Sicht vielleicht schief gingen. Schon bald war er unser beliebtestes Familienmitglied. Wenn einer von uns nach Hause kam, war seine erste Frage: „Wo ist Benjamin?“ „Was macht er?“ Wir kamen zu der Überzeugung, dass er sich als Mensch begriff, Vögel, auch Spatzen interessierten ihn nicht, und der Größenunterschied zwischen sich und uns schien ihm nichts aus zu machen.
Noch klarer wird das Affizieren und Affiziert-Werden bei dem Spatz Clarence, der 12 Jahre mit der Musikerin und Hobbyornithologin Clare Kipps zusammen lebte. Ihr Buch darüber heißt „Clarence der Wunderspatz“ (1956). Die Autorin, die allein in London lebte, entwickelte ein besonders enges Verhältnis zu „Clarence“ – ihrem Spatz, der in den Kriegsjahren, da Clare Kipps im Luftschutz eingesetzt war, in ganz England berühmt wurde, weil er die im Luftschutzbunker sich Versammelnden unterhielt.
Es gibt einen Wikipedia-Eintrag dazu: „Neben einigen anderen Tricks war die Luftschutzkellernummer sehr beliebt: Clarence rannte auf den Ruf Fliegeralarm! hin in einen Bunker, den Mrs. Kipps mit ihren Händen bildete, und verharrte dort reglos, bis man Entwarnung! rief. Noch beliebter waren seine Hitlerreden: Er stellte sich auf eine Konservendose, hob den rechten, durch ein Jugendunglück leicht lädierten Flügel zum Hitlergruß und begann zunächst leise zu tschilpen. Er steigerte dann seine Lautstärke und Furiosität bis zu einem heftigen Gezeter, verlor dann scheinbar den Halt, ließ sich von der Dose fallen und mimte eine Ohnmacht. Clarence wurde zu einer Symbolfigur der von Hitlers Luftangriffen geplagten Londoner und ihres Durchhaltewillens. Er wurde in Presseberichten gefeiert, und sein Bild zierte Postkarten, die zu Gunsten des Britischen Rotes Kreuzes verkauft wurden.“
Clare Kipps Buch wurde von dem Biologen Julian Huxley mit einem Vorwort versehen. Für die deutsche Ausgabe – „Clarence der Wunderspatz“ – schrieb der Biologe Adolf Portmann ein Nachwort: „Vom Wunderspatzen zum Spatzenwunder“ betitelt. Darin versuchte er vorsichtig einige Verallgemeinerungen aus Clare Kipps Aufzeichnungen zu ziehen. Clarence konnte singen, wobei er von der Autorin am Klavier begleitet wurde: „Es mag im Spatzen ein sehr vages allgemeines Erbschema eines Liedes vorhanden sein, das in der Spatzenwelt normal gar nicht ausreift, das aber in neuer Umwelt sich entwickelt. Das würde uns zeigen, wie wenig ‚frei‘ die normale Entwicklung in einer Gruppe ist, wie viele Möglichkeiten eine gegebene Sozialwelt erstickt…Der Gesang des trefflichen Clarence mahnt an schwere Probleme alles sozialen Lebens.“
Clare Kipps schrieb über ihren Spatz: „Er nahm mir nie etwas übel und betrachtete mich von klein auf als seine Erretterin aus jeder Schwierigkeit und Klemme.“
Clarence schlief im Bett der Autorin, an ihren Hals geschmiegt. Einmal wollte eine Freundin von ihr im Bett mit übernachten: „Clarence lief das Kissen auf und ab, schalt und drohte und griff schließlich meine Freundin so wütend an, dass sie als Eindringling gezwungen war, aufzustehen…“
Über seinen Gesang notierte sie: „Der erste Teil oder die Einleitung [seines Gesangs] war ein Ausdruck des Vergnügens, der guten Laune und alltäglichen Lebensfreude, während der zweite Teil, das eigentliche Lied, ein Verströmen reinen Entzückens war. Beide Teile waren gewöhnlich in F-Dur, aber der zweite Teil variierte an Tonhöhe um soviel wie eine kleine Terz, ja nach der Tonstärke.“
Über seine Luftschutzbunker-Nummern: „Wenn er es satt hatte [das Publikum im Luftschutzbunker mit Tricks zu unterhalten], „nahm er eine Patiencekarte in den Schnabel und dreht sie darin zehn- oder zwölfmal herum. Das war glaube ich sein Lieblingstrick, denn er hatte ihn selbst erfunden und vergnügte sich noch jahrelang damit…Leider begann er im Frühjahr 1941 des Lebens in der Öffentlichkeit mit all seinem Glanze überdrüssig zu werden…“
„Es war eine sehr wichtige Grundlage unseres Zusammenlebens, dass wir viele Stunden friedlicher Betrachtung in Stille zusammen genießen konnten. Ich liebe weder Geräusche noch zu viel Musik. Sein Charakter war – abgesehen von seinem wilden Temperament und der Eifersucht – ohne Makel. Es lag nichts Zerstörerisches in seinem Wesen, und nie war er gierig. Ich glaube jedoch nicht, dass er Sinn für Humor hatte.“
Im Kapitel über sein letztes Lebensjahr heißt es: „Das stolze Gebaren, das wählerische Verhalten und der tyrannische Eigensinn waren verschwunden…Er erwies sich als sehr weise – es fiel mir immer schwerer, ihn als einen gewöhnlichen Vogel zu betrachten.“
Während Benjamin für uns ein wunderbarer Spatz blieb, wurde Clarence für die Witwe zu etwas anderem.
Abschließend schreibt Clare Kipps: „Dass seine Intelligenz überragend war, glaube ich nicht. Ich bin klügeren Vögeln begegnet. Was ihn so interessant und reizend machte, war die Fähigkeit, durch das Medium der ungewöhnlichen Umgebung seine Vogelnatur in einer Sprache auszudrücken, die ein menschlicher Verstand begreifen und an der er teilhaben konnte. Und darin war er vielleicht einzigartig.“
.

Weizenfarmer USA
.

Weizenprüfer UDSSR
.
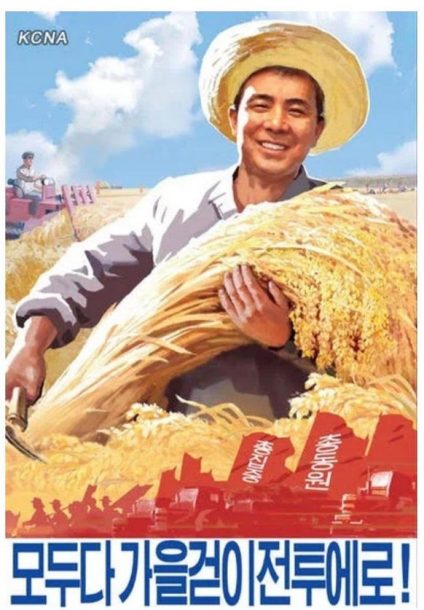
Schnitter China
.
In „Bauern, Land – Die Geschichte meines Dorfes im Weltzusammenhang“ (2020) von Uta Ruge geht es um ein Moordorf zwischen Weser und Elbe. In einem „Zwischenspiel“ ist darin vom Maler Kasimir Malewitsch die Rede, den „alles am Leben der Bauern stark angezogen“ hat. Sein erster „Bauernzyklus“ begann 1915 mit „Rotes Quadrat, Malerischer Realismus einer Bäuerin in zwei Dimensionen“.
.
Kampfstiere
Im Sommer 1985 trat der berühmte „Matador“ (Stiertöter) „El Yiyo“ in der „Plaza de Toros“ (Stierkampfarena) gegen den Stier „Burlero“ (Hohn) an. Nach einem „Adorno“ (der Berührung des Horns) versetzte er ihm mit seiner „Espada“ (dem Degen) den Todesstoß, drehte sich um und nahm den Applaus der Menge entgegen. Der sterbende Stier hinter ihm fiel jedoch nicht, sondern machte in Schmerz und Verzweiflung einen Satz nach vorne, dabei warf er den Matador zu Boden. Die herbeigeeilten „Toreros“ (alle Mitwirkenden in der Arena) konnten Burlero nicht ablenken. „Mit einer letzten Anstrengung durchbohrte er seinen Mörder. Das rechte Horn drang ins Herz des Matadors, und beim Versuch, den Körper in die Luft zu schleudern, konnte er El Yiyo mit seinen schwindenden Kräften nur noch aufrichten. Einen Augenblick lang standen der tote Mann und der tote Stier im Sand der Arena,“ schreibt die von Stieren träumende, aber Hemingways „männliche Betrachtung“ des Stierkampfs ablehnende Schriftstellerin Alison Louise Kennedy in ihrem Buch „Stierkampf“ (2001). „Mit seinem Tod bestätigte ‚El Yiyo‘ eine alte Tradition der ‚corrida‘ (Stierkampf/Lauf/Orgasmus), dass ein Mann, der einen Stier tötet, der schon einen Mann getötet hat, selber von einem Stier getötet werden wird.“ Burlero hatte im Jahr zuvor den Matador ‚Paquirri‘ in Pozoblanco getötet.“ Für den Stier und „El Yiyo“ errichtete man hernach ein Denkmal vor der Madrider Arena „Las Ventas“ (Die Verkäufe).
Die spanischen Kampfstiere stammen von den ausgestorbenen Auerochsen ab. Die Römer kannten sie noch, Julius Cäsar brachte sie in die Arenen. Den Gladiatoren, die mit ihnen kämpfen mußten, gab man ein Schwert und ein blutrotes Locktuch. Zu Cäsar gewandt riefen sie: „Die Todgeweihten grüßen Dich!“ Die Männer im Publikum eilten nach den Kämpfen „erregt zu den vor der Arena wartenden Prostituierten.“ Die spanischen Toreros tragen noch immer ihr Haar wie die Gladiatoren in einem Zopf. Die Matadore polstern ihren Penis ab, der dadurch in der engen Hose besonders groß wirkt. Das männliche Publikum, wenigstens das in Madrid, fährt heute nach dem Stierkampf mit dem Auto zu den halbnackten Prostituierten auf der „Gran Via“ (Gute Möglichkeit).
Die Verbindung von Stier, Sexualität und Gewalt ist uralt: Bekanntlich wurde Europa von Zeus in Gestalt eines Stieres vergewaltigt. Europa gebar daraufhin einen Sohn: Minos, ein Mischwesen: Mensch, Gott, Stier. Als König von Kreta heiratete er Pasiphae (Die für alle strahlt). Ihr „Beinahe-Stier“ Minos genügte ihr nicht, sie verliebte sich in einen echten Stier. Um mit ihm geschlechtlich zu verkehren, konstruierte der erfindungsreiche Daedalus eine hohle Kuhattrappe, in die Pasiphae hineinkroch und sich begatten ließ. Vorbeikommende lachten peinlich erregt.
Noch heute hängen auf einer Bullenstation bei Pasewalk, inzwischen ein Hotel, Schilder mit der Aufschrift „Das Lachen beim Deckakt ist verboten!“ Aus der einstigen Vereinigung von Pasiphae mit dem Stier ging der Minotaurus hervor: eine so ungute Mischung aus Mann und Stier, dass er erst in ein Labyrinth gesperrt und dann von Theseus, „dem Matador und Mörder“, umgebracht wurde.
Die heutigen Kampfrinder in Spanien, Portugal, Südfrankreich, USA und Lateinamerika sind kleiner und eleganter als die Auerochsen des Mythos und der römischen Arenen, sie wiegen nur noch eine halbe Tonne, zudem werden sie von den „ganaderos“ (Tierhaltern), die einst Wert auf aggressive Stiere legten, auf Sanftheit gezüchtet und mit verschiedenen „Tricks“ dahingehend beeinflußt, was den Matadoren ihre „Kunst“ erleichtert. Es gibt sogar Bio-Kampfstiere heute. Die meisten Tiere sind, wenn sie in die Arena gebracht werden, 3-4 Jahre alt, manchmal auch älter, aber gegen Stiere „mit 6 Jahren Lebenserfahrung kämpfen die wenigsten Toreros gerne.“ In Mexiko gibt es Baby-Stierkämpfe: „Baby-Stiere werden in kleine Arenen geführt und dort von den Zuschauern zu Tode gestochen,“ berichtet der Tierschutzbund. Aber auch dort, wo „unblutige Stierkämpfe“ stattfinden, werden die Tiere anschließend getötet. Die Arena ist für alle Kampfrinder (40.000 im Jahr) nur eine schmerzhafte Zwischenstation auf dem Weg zur Fleischfabrik, allerdings haben sie im Gegensatz zu den Mastrindern bis dahin nahezu ein Wildtierleben auf der Weide.
Ganz selten gibt es sogar Stiere, die ein derartig beeindruckend wildes Schauspiel in der Arena liefern, dass das Publikum und der Präsident der Plaza ihnen „das Leben schenken“. Umgekehrt bekommt der Matador, wenn er den Stier besonders elegant aus dem Leben befördert hat, ein oder zwei seiner Ohren. Unlängst verdiente sich in Mexiko ein Elfjähriger seine ersten Ohren. Inzwischen gibt es auch weibliche Toreros. Sie alle träumen davon, ein „überlebensgroßes Leben zu führen“ – mit „lachhaftem und manchmal flüchtigem Reichtum, genug Alkohol, Drogen und sexuellen Ausschweifungen“. Gib acht, worum Du betest – es könnte in Erfüllung gehen, lautet ein Sprichwort. Im spanischen Bürgerkrieg „feierten nationalistische Corridas die Kirche und die Macht der Rechten, republikanische Corridas feierten den Triumph des einfachen Mannes,“ schreibt Kennedy, letztere töteten dann jedoch fast alle Stiere, um damit die Armen zu ernähren.
Nach wie vor gelten vor allem die Stiere aus der “Miura“-Zuchtlinie als „Menschenschlächter“. Wenn ein Stier einen Torero tötet, wird in der Regel seine Mutter geschlachtet, damit sie keinen weiteren Mörder zur Welt bringt. Den Kampfgeist hat der Stier von der Mutter, den Körperbau vom Vater: Ein Widerspruch, denn die Züchter weltweit gehen eigentlich davon aus, dass der männliche Samen die entscheidende Ingredienz ist und die Kuh nur wenig mehr als ein Gefäß. Diese Vorstellung geht weit über die der Stierkampf-Afficionados hinaus: So essen z.B. Fußballer und Footballspieler vor „wichtigen Kämpfen“ gerne Stierhoden zur Stärkung. Da Hoden auf dem Schlachthof als Abfall deklariert werden, ist das illegal. Mit den Sportlern haben die Stierkämpfer gemeinsam, dass sie oft aus der Unterschicht kommen und manchmal schon als Kinder angefangen haben zu üben. Als der spanische Nachwende-Geschäftsführer des Glühlampenkombinats Narva, Jesus Comesana, das Werk von einem Produktions- in einen Servicebetrieb umwandeln wollte – ohne Erfolg, meinte er enttäuscht: „Die Ostdeutschen haben keine Cojones (Stierhoden)!“
In den Berichten der Stierkampf-Journale werden die Kampfrinder als „unberechenbar“, „tapfer“, „klug“ oder „feige“ bezeichnet, A.L. Kennedy hält sie für „unberechenbar und „nicht besonders intelligent, vielleicht manchmal clever, aber sicher nicht klug“. In den Fanzines wird beschrieben, „wie sie vor dem Todesstoß ergeben das Haupt vor dem Matador verneigen und praktisch kurz davor sind, in gepflegtem Kastilisch um den Tod zu bitten“. Angeblich würden die Stiere darauf gezüchtet, „dass sie beim Betreten der Arena wissen, wozu sie dort seien, zum Kämpfen und zum Töten.“
Der Torero Juan José Padilla hat in 23 Jahren über 5000 Stiere getötet und wurde viele Male schwer verletzt, ein Horn ging ins Auge, seitdem heißt er „El Pirata“. „Ich war sieben, als ich zum ersten Mal einem Stier gegenüberstand. Mein Vater wollte immer Torero werden und er hat seine Leidenschaft für die Corrida mit uns geteilt. Ich betrachte den Stier als eine Art Mitarbeiter. Der Stier ist mein Leben, meine Welt ist der Stier. Ich bewundere seinen Mut und sein Verhalten. Das Spektakel Corrida gäbe es ohne dieses Tier nicht. Ich kann total verstehen, dass der Stier angreift. Ehrlich gesagt hege ich überhaupt keinen Groll gegen ihn, der ja nur seinen Job macht. Ich bin auch nicht glücklich oder traurig. Ich mache auch nur meinen Job und der lautet, einen Stier zu töten. Als ‚Profi‘ bestritt ich bisher 1500 Corridas. Ich kann nicht öffentlich machen, wie viel ich pro Kampf bekomme, aber ich kann sagen, dass die Krise leider auch vor dem Stierkampf nicht Halt gemacht hat. Es wird immer schwieriger, Zuschauer anzulocken, und das wirkt sich natürlich auch auf unsere Gehälter aus.“
Das sagte er in einem Interview 2017. Inzwischen hat sich die Krise des Stierkampfs durch die Tierschützer und die Anti-Coronamaßnahmen noch verschärft, in Spanien bekamen die Stierzüchter und Corridaverbände bereits eine finanzielle Unterstützung vom Staat. Auf dem Höhepunkt der „Corona-Krise“ im Juli 2020 erlaubte die Ferieninsel Mallorca erneut den „blutigen Stierkampf“. Die Arena in „Coliseo Balear“ war gut besetzt, davor demonstrierten die Stierkampf-Gegner, sie sprachen von „Barbarei“ und einem „lächerlichen und veralteten Ritual“. Kurz darauf verboten die Anticorona-Maßnahmen alle weiteren Veranstaltungen dieser Art.
Die Pferde, die in der Arena „mitspielen“, wurden früher von ihnen regelmäßig aufgeschlitzt, heute sind sie mit dicken Filzdecken gegen die Stöße der Stierhörner geschützt. Ihnen werden die Augen verbunden. Pferde stehen als Fluchttiere bei Gefahr mit den Vorderbeinen zuerst auf, und galoppieren dann, sich zur Seite werfend, davon. Rinder stehen dagegen bei Gefahr mit den Hinterbeinen zuerst auf, die Hörner auf den Gegner gerichtet, für sie ist ein Angriff die beste Verteidigung.
.

.
Geldbeschaffungsmaßnahmen
Ich erhielt folgende mail:„Gewinnnummer: 662268891132/ Referenznummer: 666475896. Sie haben 1 Mio. € in der laufenden PCH Lotterie vom 16. November 2020 gewonnen. Für Ansprüche geben Sie unten Ihre Angaben ein: Voller Name: .. Wohnadresse: … Geschlecht:.. Beruf:.. Land:.. Mobile: …
Herzlichen glückwunsch! (Verlagsclearingstelle)
Private Universität Witten/Herdecke gGmbH
Alfred-Herrhausen-Straße 50, D – 58448 Witten
Homepage: https://www.uni-wh.de/ Blog: https://blog.uni-wh.de“
Im Internet findet man zur „PCH-Lotterie“ folgenden Eintrag: „Wer auf diese Einleitung eines Vorschussbetruges reingefallen ist, darf sich darauf „freuen“, am Telefon von einer gut geübten Betrügerbande belabert zu werden, damit er eine Vorleistung nach der anderen bezahle – immer schön über Western Union und Konsorten, denn diese „Lotterieveranstalter“ mit ihren Millionengewinnen benutzen keine Bankkonten. Das den Betrügern so zugesteckte Geld wird irgendwo auf der Welt anonym abgeholt…“
Als nächstes kam folgende mail: „Hallo. Ihre E-Mail-Adresse wurde zufällig mit einem „Computer Spinball“ ausgewählt, um eine Geldspende von Katharina Hedwig Muller (KHM Foundations) zu erhalten. Bitte bestätigen Sie den Besitz Ihrer E-Mail, indem Sie sich an katharine@hedwigmuller.com wenden und eine Bestätigungsnachricht senden, um weitere Informationen zu erhalten. Katharina Hedwig Müller. Kontakt: katharine@hedwigmuller.com“
Und dann diese mail: „Herzliche Glückwünsche: Ihre E-Mail hat Ihnen als Community die Summe von 2.000.000,00 € eingebracht Spende von Oxfam Aid, für weitere Informationen kontaktieren Sie uns mit Ihrem Qualifikationsnummer {OXG / 111/461/BDB} so bald wie möglich. Betriebsleiter
Für mehr Informationen: E-Mail: oxfamaidinter@outlook.com“
Dann meldete sich ein Opfer solcher Massenmails: Döndü Timur aus Wuppertal. Er war verzweifelt und brauchte Hilfe, weil er die Absender nicht los wurde. Sie schrieben: „Als erstes möchte ich Sie um Vertrauen bitten in dieser Transaktion, diese ist höchst geheim. Mein Name ist Amichaal Mahilak, ich bin Finanzverwalter des verstorbenen Peter Timur und arbeite als Bankkaufmann in einer Madrider Bank. Es geht um Ihre Mitwirkung, um dieses Geld aus dem Einkommen unseres verstorbenen Kunden zu sichern: 7,3 Millionen Euro. Wir wollen mit Ihrer Hilfe versuchen zu verhindern, dass es beschlagnahmt oder verzollt wird.
All meine Bemühungen, jemand zu kontaktieren, der mit dem Verstorbenen verwandt ist, waren erfolglos. Aus diesem Grund habe ich mich an Sie gewandt. Ich bitte Sie nun um Ihre Einwilligung, sich der Bank gegenüber als Nachfolger Verwandter/Besitzer des Geldes unseres verstorbenen Kunden auszugeben, da Sie den gleichen Namen haben und der Betrag somit an Ihnen ausgezahlt werden kann.
Alle legalen Dokumente, die sie benötigen, um als verwandter Nachfolger meines Mandanten in Frage zu kommen, werden wir Ihnen beschaffen. Alles, was ich von Ihnen brauche, ist eine sichere Kooperation, um diese Transaktion zu ermöglichen. Ich möchte vorschlagen, dass 20 Prozent von dem Geld an eine Hilfsorganisation gegeben und die üblichen 80 Prozent gleichmäßig zwischen uns aufgeteilt werden. Ich versichere Ihnen, dass dieses Ansinnen völlig risikofrei ist. Als Finanzverwalter des Verstorbenen werde ich diese Transaktion erfolgreich durchführen.“
Sein Opfer, Döndü Timur, ging auf diese Offerte ein und erhielt daraufhin eine weitere mail: „Welcome Timur to Reale International Trust Online Banking Services“ – mit einem Kontoauszug über 7,5 Millionen Euro. Herr Timur rechnete sich aus: 80 Prozent davon, das waren 6 Millionen, die Hälfte davon, die er bekommen sollte, waren 3 Millionen Euro. Aber erst einmal mußte er dafür finanziell in „Vorleistung“ gehen – und das nicht einmal, sondern immer wieder aufs Neue. Nicht nur per mail (vom „International Trust ‚Reale‘“), auch telefonisch wurde er immer wieder aufs Neue überredet: Er sollte ja nicht aufgeben, die kleinen Summen, die er vorab geleistet hatte und noch leisten sollte, waren doch so gut wie nichts im Vergleich zu der großen Summe, die auf ihn wartete. Es fehlte auch nicht an Drohungen, weil der Finanzverwalter des verstorbenen Herrn Timur, Amichaal Mahilak, schon so viel Zeit und Mühe in die „Transaktion“ investiert hatte und ja selbst bzw. seine Madrider Bank die Hälfte der 80 Prozent von den 7,5 Millionen Euro haben wollte.
Irgendwann schlug bei Döndü Timur die Gewinnerwartung in Verzweiflung um und er wollte von all dem nichts mehr wissen. Der Finanzverwalter blieb aber hartnäckig.
In einem Telefongespräch mit Döndü Timor riet ich ihm, sich einen Anwalt zu nehmen und/oder zur Polizei zu gehen. Ich wußte jedoch von arbeitslosen Ostlern, die sich, um ihre Abfindung nicht versteuern zu müssen, eine unvermietbare Eigentumswohnung aufschwatzen ließen – zwecks Aufbesserung ihrer Alterversorgung, dass sie sich daraufhin von Juristen und „ihren“ Politikern sagen lassen mußten, sie wären zu gierig und infolgedessen zu unvorsichtig gewesen – und dass man da gar nichts machen könne. Sie hatten zuletzt sogar vorm Reichstag demonstriert.
.

Schachspiel Leningrad 1924
.

Chinesisches Schachspiel Peking 1969
.
Bärendressur
1936 begann in der Sowjetunion eine „Formalismus-Debatte“, bei der man Formalismus und Subjektivismus im Kunstschaffen als antidemokratisch bekämpfte. Stattdessen wurde eine inhaltlich verständliche, volkstümliche Kunst gefordert. Nach dem Krieg kam diese Debatte auch in der Zirkuskunst an, d.h. die Hauptverwaltung für das Zirkuswesen gab den Artisten und Dompteuren Anweisungen, ihre Nummern der Doktrin gemäß umzugestalten. Das betraf auch die Bären von Valentin Filatow, schrieb der Theaterregisseur Alexander Aronow, der mit Filatow zusammen ein Buch über sein „Dompteurhandwerk“ schrieb: „Mit Bären unterm Zirkuszelt“, das 1969 veröffentlicht wurde.
An Bärennummern war in der Sowjetunion kein Mangel, Filatow mußte sich etwas einfallen lassen, wollte er „verdienter Künstler der RSFSR“ werden. Als er 1944 mit seiner ersten Bärennummer vor der Abnahmekommission in Leningrad auftrat, bekam er ein Diplom nebst Prämie und die Erlaubnis, seine Nummer zu erweitern, dazu bewilligte man ihm einen Assistenten und einen Tierpfleger. Mit dem Zirkusregisseur Wenezianow sollte er ein Szenarium ausarbeiten.
Dieser riet ihm, erst einmal über „den Stil des modernen Sowjetdompteurs“ nachzudenken. „Frack und russische Volkstrachten passen da nicht.“ Er sollte seine Nummer mit „moderner Technik aufziehen und einen Anzug im neuen Stil tragen“. Daraus entstand dann die Schau „Valentin Filatows Bärenkindergarten“: Drei kleine Bären liegen in Holzbettchen und werden von einer weißbekittelten Bärin, der Kindergärtnerin betreut, die ihnen Flaschen mit Milch zu trinken gibt, dann kommt der „Bärenerzieher“ Filatow. Als die kleinen Bären satt sind, machen sie Morgentoilette, spielen, sehen sich Bilderbücher an… “Kurz, die ganze Schau zielte auf drollige und lustige Pointen ab, wie man sie in jedem Kindergarten sehen kann.“
Sobald die Nummer stand, fuhren Filatow und Wenezianow damit nach Moskau zur Hauptverwaltung. Diese befand: „die ganz Tierschau sei ‚unnatürlich‘“. Man bezichtigte die beiden des „Formalismus“. Filatow bekam einen neuen Regisseur, Nemtschinski, der ihm vorschlug, seine Nummer „Bärenzirkus“ zu nennen, worin alle Mitwirkenden, Oberstallmeister, Requisiteure, Clowns etc. Bären waren. „Die Hauptsache war gefunden – die Form.“ Der Inhalt bestand dann darin, dass seine 14 Braunbären andere Nummern imitierten oder parodierten: Luftakrobaten, Rollschuhläufer, Radkünstler, Motorradfahrer und für einige Zeit auch Pferdereiter: „Der Bär führte das Pferd am Zaum in die Manege, verbeugte sich zum Publikum. Daraufhin ging das Pferd auf die Vorderhand nieder, und der Bär schwang sich in den Sattel, galoppierte rund um die Manege und stellte sich hoch…“
Seine „Artisten“ waren meist junge Bären, sie trugen ein Halsband und bekamen, da sie in der Manege ohne Schutzgitter auftraten, einen Maulkorb verpaßt, ihr Dompteur hielt sie an einer Leine, durch die ein Stock geführt wurde, um Abstand halten zu können gegen etwaige Tatzenhiebe. Zu seiner Ausrüstung bei den Proben gehörten ferner eine kleine Peitsche und zwei Gläser Honig. Bevor Filatow mit dem „Bärenzirkus“ auf Tournee in den Fernen Osten ging, drehte das Leningrader Studio einen Dokumentarfilm über seine neue Nummer, der auf den Filmfestspielen in Venedig den zweiten Preis bekam.
Im Flugzeug nach Chabarowsk hatten die Bären eine solche Angst, dass sie sich mit ihren Tatzen die Augen zuhielten. Um sie zu beruhigen setzte Filatow sich zwischen sie, die sich schutzsuchend an ihn schmiegten, dabei hatte er nicht weniger Angst als sie. Als die Maschine zur Landung ansetzte, riss er den Mund auf und schluckte, um den Druck auf seine Ohren zu mindern, zu seiner Verwunderung machten die Bären das selbe. Die meisten Bären waren auf der Tournee in der Pubertät, sie „waren gereizt und hinterhältig“, ihr Dompteur war nicht minder nervös, manchmal resignierte er. Auf dem Rückflug nach Moskau gingen die Bären bereits ohne Scheu die Gangway hoch.
Es folgten Tourneen durch Westeuropa. In Brüssel hatte der Direktor des Königlichen Zirkus für Filatows Bären Magermilch eingekauft, aber die Tiere waren Vollmilch gewohnt und weigerten sich, sie zu trinken. In London schrieb eine Zeitung: Filatows Gastspiel müsse verboten werden, „da er zwar erstaunliche Erfolge mit seinen Bären erringt, damit aber zugleich sich wie kein anderer an der Würde der Tiere vergeht.“
In Japan meinten viele Zirkusbesucher, „dass in Filatows Nummern gar keine Tiere auftraten, sondern als Bären verkleidete Menschen. Im Ostberliner Friedrichstadtpalast reicherte der Direktor die Schau des sowjetischen Staatszirkus mit Balletttänzerinnen an. In Warschau auf den 1. Internationalen Zirkusfestspielen bekam Filatows „Bärenzirkus“ eine Goldmedaille.
Die feministische Schriftstellerin Paula Busch trat 1920 das erste Mal in ihrem Zirkus mit einer „Pantomime“ auf, zusammen mit einem Bären, den sie aus vier „Karpaten-Braunbären“ auswählte: Es waren „zum Teil unverschämt lustige Burschen, die nicht ich, sondern die mich dressieren wollten.“
Bären waren ihrer Trainerin Else zufolge gefährlicher als Löwen, sie hatten ihr bereits etliche Wunden an den Beinen zugefügt. Paula Busch suchte sich für das Stück den Bären Peter aus, der dann, weil er Junge bekam, Petronella hieß. Aber erst einmal riss er einem Pfleger die Hosen in Fetzen. Die Zirkuschefin flüsterte „Fräulein Else, offen gestanden: Mir graust vor Peter.“ Sie probte aber tapfer weiter mit ihm.
Er sollte sie anfallen, während sie in sieben Meter Höhe an einen Kulissenberg geschmiedet hing. Dazu schmierte sie ihre Stiefel mit Honig ein, befestigte an jedem Jackenknopf eine Feige und lockte damit Peter an ihr hoch – bis er mit weit aufgerissenem Rachen an ihrer Gurgel hing, wo sich „ein wenig unter dem Halstuch versteckt,“ ein Honigkuchen befand. „Das sah nicht nur grausig aus“, ihr „war auch nicht immer ganz wohl bei dieser Szene,“ die aber später in ihrem „Manege-Schaustück die Sensation des Aktes ‚Eine Nacht in Schnee und Eis mit hungernden Bären‘ war.“ Gelegentlich geschah es, wenn Peter runter zu rutschen drohte, dass er sich an ihren Armen festkrallte und sie seine „zwei Zentner zwischen Himmel und Erde“ festhalten mußte. Mit ihrer Vorführung bewies sie sich, „dass Bären leichter durch Näschereien als durch harte Strafen zu erziehen sind. Ihr Geschmacksinn ist neben dem Geruchssinn am Besten ausgeprägt.“
Manchmal führte Peter die ihm gestellten Aufgaben etwas zu nachlässig aus. Paula Busch schreibt: „Meine Bärenszene war nicht einmal eine Dressurleistung. Sie war eine plumpe Spekulation auf den Gaumenreiz, der seine Befriedigung in der Plünderung meiner wie ein Weihnachtsbaum geschmückten Gestalt fand.“ Für die Zirkusdirektorin war die Arbeit mit Petronella dennoch eine „Lebensbereicherung“.
(Im Sommer liefert der Verlag Peter Engstler/Rhön den zweiten Band „Bären“ in der Reihe „Kleiner Brehm“ aus, der erste befaßte sich mit Eisbären, der zweite mit den übrigen Bären.)
.

Valentin Filatow mit zwei Braunbären in Leningrad
.

Bärenzwinger Berlin 1935, seit dem Tod der letzten zwei Braunbären ist die Anlage ein Ausstellungs- und Performance-Ort vor allem für künstlerische Arbeiten mit Tierthematik.





Interessant, dass die taz inzwischen Kommentare wie Höge hat, die in sozialen Medien unverhohlen USA-Bashing mit Worten aus der rechten Ecke betreiben und stolz RT als Quelle für Grünen-Bashing (egal ob verdient oder nicht) im Profil posten.
Nicht sehr glaubhaft …