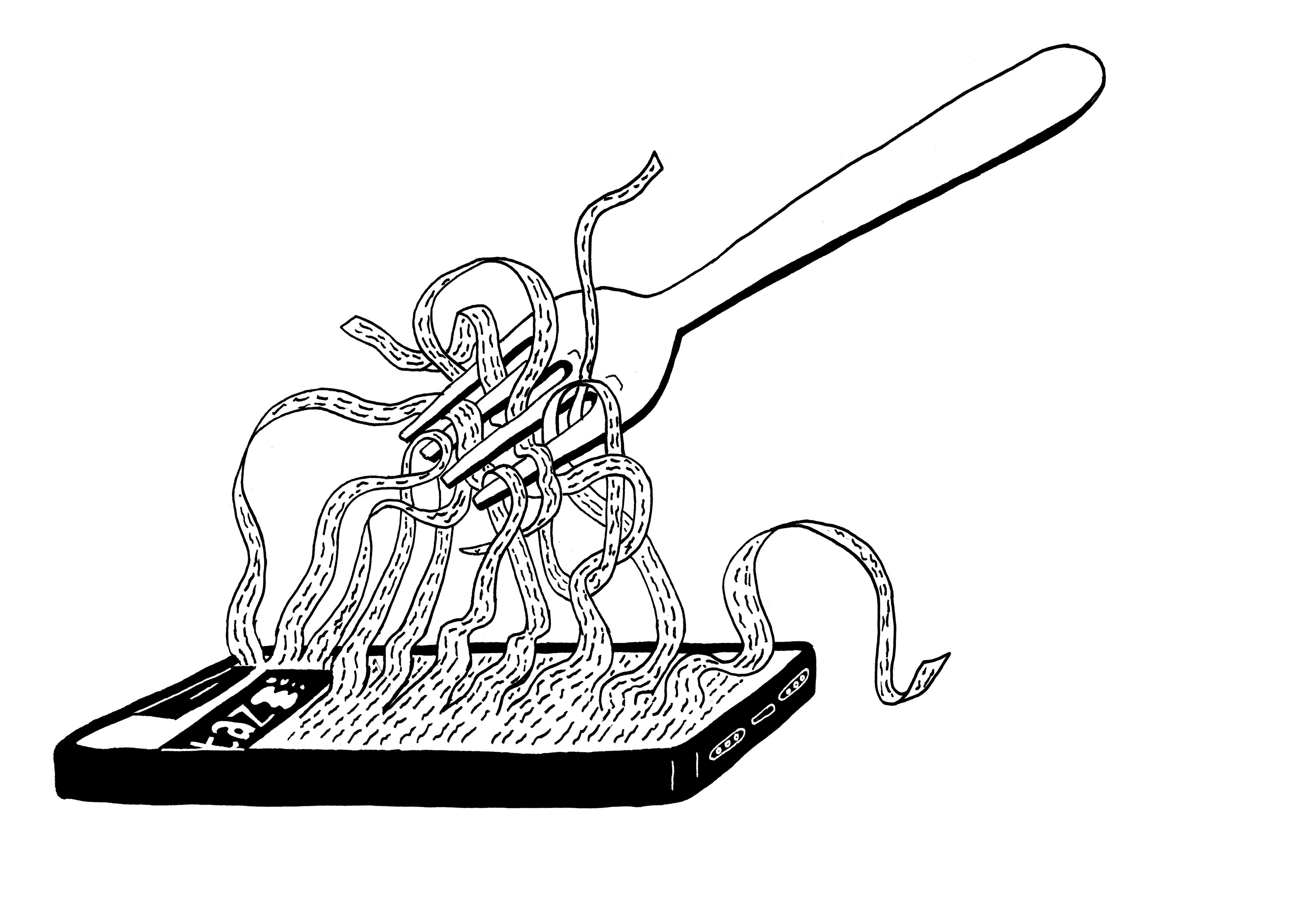Achtundsechzig. Die Achtundsechziger sind bei meiner ersten Begegnung mit ihnen gleich in Massen aufmarschiert, bereits 1967, als großer, dunkler Zug meist schlanker, weil junger Menschen, die in meinen siebenjährigen Augen allerdings große Erwachsene waren, oft bärtig, in gedeckten Farben gekleidet, die nichts riefen, aber mitunter miteinander angeregt sprachen, und die in dichten Gruppen zügig an mir vorbeiliefen, zu meinem Erstaunen mitten auf der Straße, der Potsdamer Chaussee, in Richtung, wie mir irgendwer erklärte, Dreilinden, dem Grenzübergang zur Transitstrecke durch die DDR. Ich stand nicht alleine am Straßenrand und ich muss lange dort gestanden haben. Dass sie jetzt vorbeizögen und dass man sie jetzt sehen könne, war als Nachricht in der Nachbarschaft plötzlich aufgebrandet, worauf wir, einige Kinder und Elternteile aus verschiedenen Haushalten, losliefen, den Weg hinter den Handtuchgärten der Wohnsiedlung entlang bis zur Potsdamer Chaussee, wo er endete und wo sich die Bushaltestelle befand.
Die erste Hälfte bis zu zwei Dritteln des Marsches werden wir verpasst haben, das Spektakel war aber mit den zu Fuß gehenden nicht zu Ende, ihnen folgte eine zwei-, vielleicht sogar dreispurige Autoschlange, in einem schier endlosen Stop-and-Go, das sich nur sehr allmählich wieder in höhere Geschwindigkeiten und größere Abstände verfuhr. Auch hier ist mir noch eine Erklärung im Ohr: Die Marschierenden begleiteten einen erschossenen Studenten bis zum Grenzübergang, die Autos ihn bis zu seinem Heimatort in Westdeutschland, wo er dann beerdigt werde. Den Leichenwagen mit dem Sarg hatten wir nicht gesehen. Wir waren hinzugekommene Schaulustige und am Straßenrand, nicht um dem getöteten Demonstranten unsere letzte Ehre zu erweisen, und nicht, um den Trauernden unsere Anteilnahme und Solidarität zu zeigen. Dennoch kommt es mir vor, als hätte ich niemals rekonstruieren müssen, wer hier zu Grabe getragen wurde, als sei mir der Name Benno Ohnesorg seit jenem Tag ein Begriff und unauflösbar mit dem Bild der von Menschen dunkel gefüllten, breiten Chaussee verbunden.
In meinem Elternhaus gab es Sympathie für die Studenten. Bis wohin sie reichte, weiß ich teils nur allzu gut, teils nur sehr ungefähr. Das 2020 zum Wikipedia-Wissen gehörende „Wenns der Wahrheitsfindung dient“, mit dem ein angeklagter Student vor Gericht der Aufforderung nachkam, sich zu erheben, amüsierte meinen Vater. Ebenso, dass die Anti-Schah-Demonstranten „Schade, Soroya bekommt kein Kind, schade, dass wir nicht bei ihr sind.“ auf die Melodie von „Puppchen, du bist mein Augenstern“ sangen. Details wie diese sind mir im Gedächtnis geblieben, weil meine Eltern über sie sprachen und weil sie sich in ihrer Belustigung über sie einig waren. Dass der witzige Student vor Gericht Fritz Teufel hieß und wer er war, musste ich dagegen nachlesen.
Die Studenten waren aus gutem Haus, die guten Häuser standen in unserer Nachbarschaft. Meinen Schulweg säumten zweistöckige Siedlungsbauten und Reihenhäuser aus den zwanziger und dreißiger Jahren des letzten Jahrhunderts, doch jede Straße nach Norden führte an düsteren oder lichten, verspielten oder pompösen Gründerzeitvillen vorbei, manchmal in weitläufigen, manchmal in etwas engeren Gartengrundstücken gelegen. Der Campus der Freien Universität Berlin befand sich nur aus meiner kindlicher Perspektive weit weg in der Stadt, in Wahrheit führten gewöhnliche familiäre Ausflüge ganz unaufwendig mitten in den Campus hinein, wie die öfter unternommenen ins (inzwischen aufgelöste) Völkerkundemuseum Dahlem oder in den Botanischen Garten. Universitätsangehörige wohnten alle paar Hauseingänge weiter, von meiner Grundschule aus lag an der nächsten Straßenecke ein Studentenwohnheim für ausländische Studierende, Studentendorf genannt.
In Westberlin, westverbandelt und ostumstellt, hatten sich die Schulpolitiker nach 1949 weder für die vierjährige Grundschule nach westdeutschem noch für die (damals noch) achtjährige nach ostdeutschem Vorbild entschieden. Bis heute gehen Berliner Kinder sechs Jahre zur Grundschule, die ältesten Grundschüler sind also um zwölf Jahre alt. Das ist für das Verständnis des Folgenden nicht unwichtig.
Es kann im Sommer 1967 oder im Sommer 1968 gewesen sein. So unbegreiflich traumfern, wie das Geschehen vor meinen Augen abrollte, neige ich dazu, das frühere Jahr anzunehmen. In meiner Schulzeit besagte eine Regel, dass zur großen Hofpause gegen zehn Uhr die 25 Grad erreicht sein mussten, damit es Hitzefrei gab. Das Thermometer, im Hof nahe dem Zugang zum Treppenhaus an einer Ecke in vielleicht ein Meter siebzig Höhe angebracht, wurde an warmen Sommervormittagen von den Fünf- und Sechstklässlern, unter Einsatz aller auf dem Pausenhof verfügbaren Kletterkünste wie Huckepack und Räuberleiter umlagert, gerieben und angehaucht, um es über 25 Grad steigen zu sehen. Doch an diesem Tag, das Thermometer musste die ersehnte Marke längst erreicht haben, hatten die Großen beschlossen zu handeln.
Sie verstellten der aufs Klingelzeichen zum Haus zurückströmenden Schülerherde den Weg, stellten uns Kleinere in Zweierreihen auf und schafften es, einen langen Zug von Schülerpärchen mehrmals in einem großen Kreis über den Hof ziehen zu lassen. Auch einen Slogan hatten sie erdacht und wir riefen ihn gehorsam, während wir ebenso gehorsam marschierten: Hitzefrei, Hitzefrei, fünfundzwanzig Grad im Schatten! Hitzefrei, Hitzefrei, wir schwitzen wie die Ratten! Es war die erste Demonstration, an der ich teilnahm. Ihr Anliegen teilte ich sicherlich. Wie viele danach war sie nur mäßig erfolgreich.
Ihre unmittelbare Resonanz allerdings war ungeheuer. Lehrer und Lehrerinnen stürzten schreiend und mit den Armen fuchtelnd durch alle Hofzugänge, sammelten ihre Schäfchen ein und führten sie in die Klassenräume ab, wo ein gestaffeltes Donnerwetter auf sie hinabging, erst durch die vorwurfsvoll sich grämenden Klassenleitungen, dann durch den Schuldirektor, der es sich nicht nehmen ließ, von Klasse zu Klasse zu gehen, um mit der Faust auf den Lehrertisch zu schlagen, zu poltern und zu verkünden, dass Fürchterliches passieren müsse, wenn wir ihm die Anstifter nicht nennen würden. Ich verstand nichts vom Warum und Wieso; der Untergang des Abendlandes, gewiss, und die Versicherung, dass wir zeitlebens unser Recht auf Hitzefrei verspielt hätten, aber ich kann mich an keinen Wortlaut mehr erinnern. Die Klasse blieb unschuldig brav und stumm, überwältigt vom ausgelösten Aufruhr und dem Pathos der Ermahnungen.
Hitzefrei hat es wenige Tage später doch wieder gegeben. Der Vorfall verpuffte. Es gab unter uns Schulkindern wenig Unterschiede in der Herkunft, abgesehen von pro Klasse ein oder zwei Kindern aus einem nahegelegenen Kinderheim und vereinzelten anderen waren wir durchgehend Bürgersöhne und Bürgertöchter aus Akademikerhaushalten. Unsere Demonstration wird in den Familien unterschiedlich aufgenommen worden sein, nicht in allen wird die Besorgnis über einen kommenden Aufstand, die Herrschaft des Chaos und den schließlich und endlich unvermeidlichen Einmarsch „des Russen“ vorgeherrscht haben. In anderen war die Revolution vielleicht eher ein Spiel, das ohne Gefahr für den späteren gesellschaftlichen Status gespielt werden konnte, solange man es damit nicht übertrieb. Vorstellbar sind sogar Eltern, die stolz auf ihren frühreif rebellischen Nachwuchs waren.
Bei uns zuhause dürfte das Ereignis schlicht untergegangen sein. Die Achtundsechziger-Bewegung hatte Wirkungen auf meine Eltern, aber keine vordergründig politischen. In ihrer, für ihre Generation typischen Erziehung war körperliche Nähe nur beim Sex vorgesehen und der wiederum nur zum Zweck der Familiengründung und ihrer Erweiterung. Aber wie bei allen großen Menschenaffen – ich nehme mich selbstverständlich nicht aus – war auch bei meinen Eltern das seelische Gleichgewicht stark von körperlicher Nähe abhängig. Und das hieß in ihrem Fall, weil für sie körperliche Nähe immer schon Sex war, abhängig von Sex. Die in der Studentenbewegung umlaufenden Konzepte und Verheißungen der freien Liebe bestrickten sie. Für den gemeinsamen oder abwechselnden, regelmäßigen Besuch eines Swingerclubs war die Zeit noch nicht reif. Also besuchten sie die Nachbarn zwei Türen nach links, denen es ähnlich erging. Im Frühjahr 1968 wurde meinem Vater das sechste Kind geboren, die Pfarrersfrau von nebenan gebar ihr drittes.