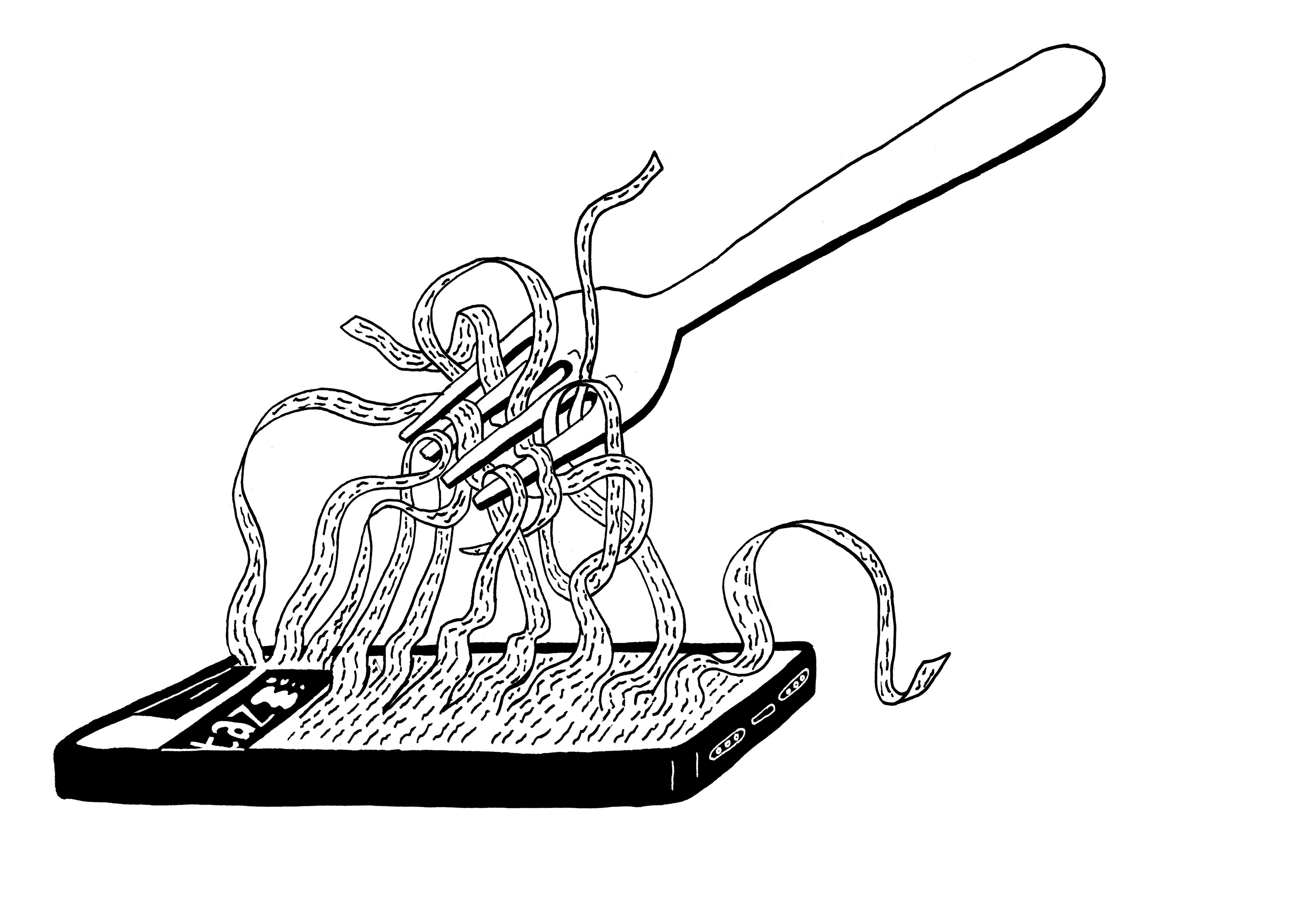Ich bestehe auf dem Lob des Müßiggangs, allen Widrigkeiten zum Trotz, mit Sang und Klang, auf die tagediebischen kleinen Freuden. Gesagt habe ich es und nicht nur einmal. Was wird daraus, in Zeiten eigener und allgemeiner Erwerbslosigkeit? Das eine ist, dem durch Erwerbsarbeit geregelten Leben möglichst viele ungeplante Stunden abzulisten und sich anzueignen, was sie einem geben. Etwas ganz anderes ist es, durch äußere Umstände von allen Verdienstmöglichkeiten weitgehend abgeschnitten zu sein und wie das sprichwörtliche Kaninchen vor der Schlange dem entgegen zittern zu müssen, was einen bestimmt demnächst verschlingen wird. Der Zwang zur Arbeit verursacht Stress nicht nur, wenn ein Arbeitspensum mich erdrückt, sondern erst recht, wenn ich gar keins habe. Alles Gerede und Geschreibe über die doch sehr zu genießende Entschleunigung, die im Frühjahr 2020, Corona sei Dank, zu erleben sei, ist Pipifax. Oder vielmehr lästige Überinformation, denn ich brauche keine Auskünfte über den üppigen Kontostand oder sonst das Niveau der individuellen materiellen Absicherung derer, die so reden oder schreiben. Ich habe andere Sorgen.
Das Gefühl, das sich einstellt, wenn der Arbeitszwang Druck durch fehlende Arbeit ausübt, ist nie und nimmer, nicht einmal für Momente, Erleichterung, endlich einmal Zeit zu haben. Im Gegenteil, nie war der Zeitdruck stärker. Jetzt wirkt er 24 Stunden täglich, weil jeder Tag, den ich essend, trinkend, mich kleidend oder pflegend und endlich schlafend verstreichen lassen muss, Kosten verursacht, die ich später kaum je wieder ersetzen kann. Kein Wunder, dass mir nichts von dem, was ich tue, um mich zu erhalten, noch Spaß macht. Das Bett gähnt mich an, Speis und Trank mäkeln an mir, Pflege wie Kleidung ziehen mich runter. Sie treten mir als Schulden gegenüber. Oder als Demütigung, die ich eines Almosen wegen ertragen muss. Lähmung und Unlust sind das daraus resultierende Gefühl, ich bin mir selbst eine unfinanzierbare Last. Ich betäube mich, stelle mich tot und versacke. Muße habe ich keine.
***
Über Lust kann ich dichten. Über Unlust nur insofern, als sie Unlust an etwas ist, das meiner Lust im Weg steht. Aber wozu sollte ich es überhaupt versuchen, das Gefühl der Antriebslosigkeit und des Verödens im Wartezustand auszudrücken? Endlose Reihen aus Einsen und Nullen versprächen mehr Abwechslung. Ich habe es ein einziges Mal probiert. Und es kam, wie es kommen musste, der Ehrgeiz begann zu kitzeln, die Form zu reizen – am Ende war es Spiel:
Erweiterte Unlustreime
Nehm ich das Dasein rüde hin,
sobald ich etwas müde bin?
Hätt Arbeit, mir bewusstlos, Sinn?
Entgeht der mir, wenn‘ch lustlos bin?
Schlägts mich mit Wucht ins Schräge hin,
wenn aufrecht ich noch träge bin?
Sitz ich im Sumpf (so ahn ich!) drin,
wenn ich fürs Werk zu tranig bin?
Ach, was ich könnte, gäb ich hin!
An nichts. Weil ich behäbig bin.