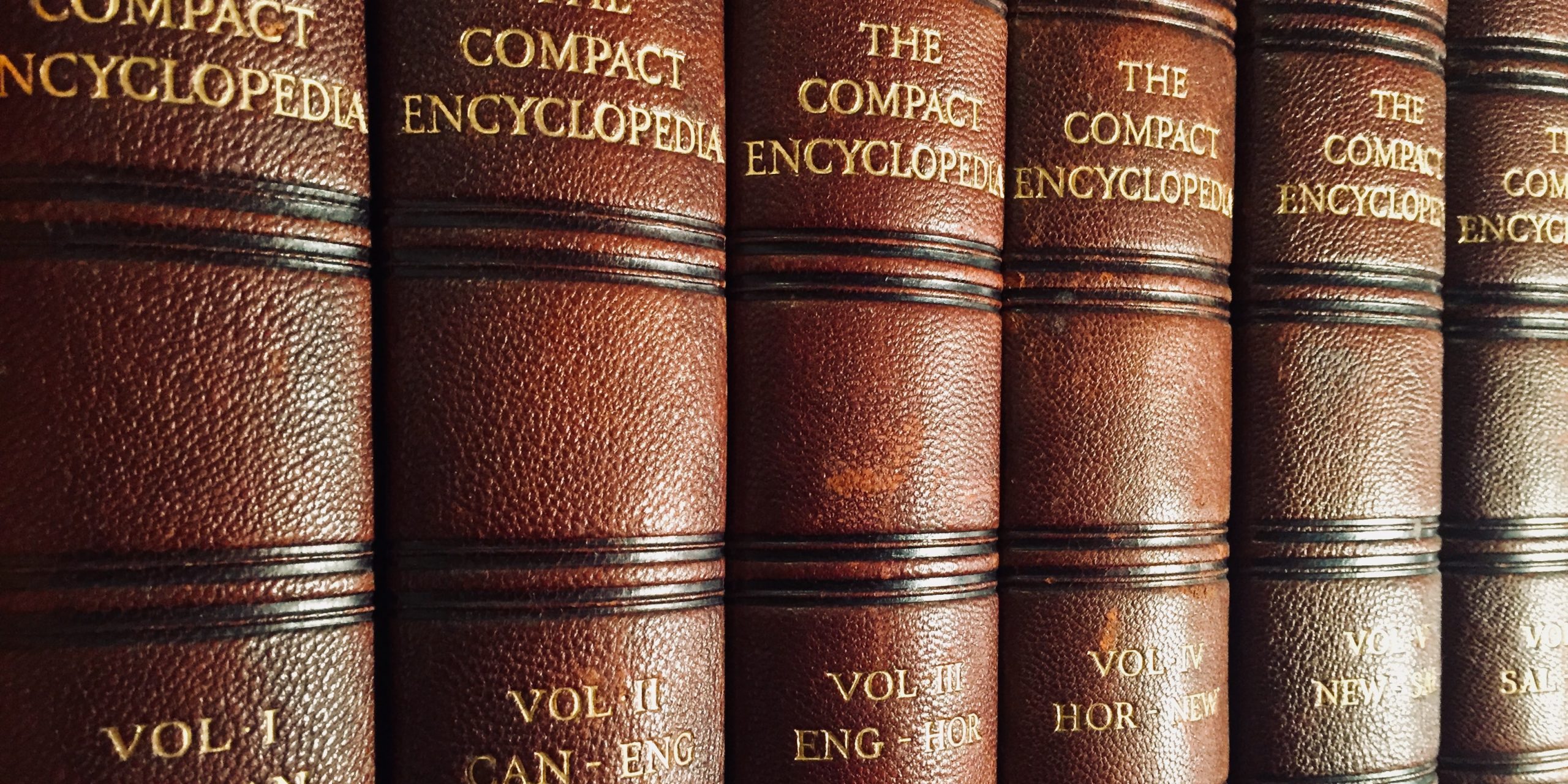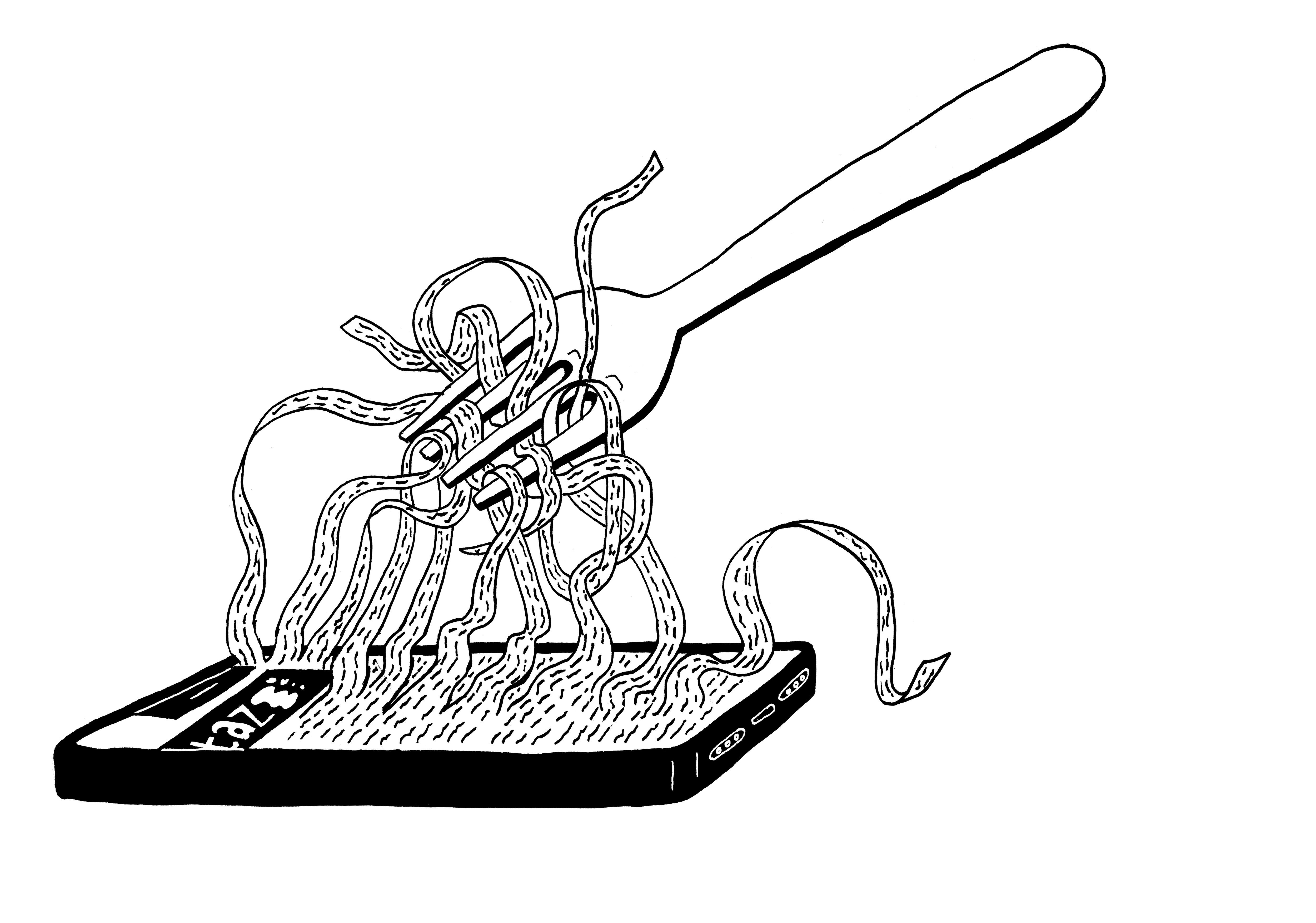Nicht, dass sich bedauern ließe, dass der ehemalige Bundestagspräsident Wolfgang Thierse sich selbst aus der SPD entlassen will. Er mag gehen, der Kapitän, dessen Schiff längst gesunken ist. Doch verweist die Absurdität dieser Konstellation auf ein tieferliegendes Phänomen. Mit der Selbstabschaffung der Sozialdemokratie durch die Agenda 2010 seit Schröder hatte (außer vielleicht Lafontaine) niemand unter den Linksliberalen ein Problem – Thierse gar war einer ihrer vehementesten Verfechter. Nun aber, wo der „dritte Weg“ vollends am Ende seiner Sackgasse angelangt ist, fängt die Parteispitze der deutschen „Sozialdemokratie“ plötzlich damit an, sich in einer neuen Form von Virtual Reality zu zerfleischen – wie aus Ablenkung von der eigenen Neoliberalisiertheit.
Weil dieser Zustand System hat, weist er über die Selbstantiquierung der SPD und deren heutige Scheindebatten hinaus. Derzeit findet eine Reduktion von Politik auf Sprachpolitik statt, die nicht nur problematische, sondern kontraproduktive Folgen fürs linke Projekt der Emanzipation hat. Für dessen Repolitisierung möchte ich ausnahmsweise ein philosophisches Argument anbringen. Es richtet sich gegen die grassierende Tendenz, Sprache als Instanz der Wahrhaftigkeit zu agitieren, die getreue Objektivität der Wirklichkeit verkörpere.
Diesem Sprachfetischismus ist – gerade zugunsten von mehr Sprachsensibilität gegenüber Herrschafts- und Gewaltstrukturen – entgegenzuhalten, dass Realität sich per definitionem nicht restlos in Worte hineinkürzen oder gar in ihr abbilden lässt. Vor dergleichen Manövern hat Adornos Kritik des tauschwertvermittelten Identitätsprinzips ebenso gewarnt wie Foucaults Problematisierung der Machtdiversifizierung durch das „sorgende“ Spotlight der öffentlichen Beichte. Die gemeinsame Botschaft Adornos und Foucaults lautet: Sprache und Sprechen geben die Wirklichkeit nicht wider, wie sie ist, sondern verkürzen notwendig die Senkrechten des signifikat Realen in ihre immer schon signifikante Horizontalität. Wirklichkeit lässt sich insofern nicht von einer Sprache einholen, die sie durchdeklinieren will bis auf den letzten Rest, sondern nur von einer Gesellschaft, die Offenheit gegenüber dem ganz Anderen nicht nur predigt, sondern lebt.
Diese grundsätzliche kritische Einsicht verleugnet schon, wer meint, etwa einen „*“ nach einem Wort setzen zu müssen, um zu signalisieren, dass dieses Wort nicht den Reichtum, die Pluralität, die Heterogenität oder die Konflikthaftigkeit der Wirklichkeit darstelle. Gleichsam wer behauptet, adjektivistisch die eigene Wesensschau aufspreizen zu müssen, indem jedwedes Andere quasi-extern zur Sprachform hinzuaddiert wird, übersieht gerade, dass Sprachformen inhaltlich zwangsläufig unterdeterminiert sind. Das Resultat ist, dass das Sprachlose eingeschmolzen wird ins informatorisch Sagbare, worin es alle interne Spannung seines Darüberhinaus verliert.
Ich würde behaupten: solch freiwillige Selbstverdinglichung konnte erst aus der Schwundstufe postmoderner Theorien entstehen, worin Ontologie keiner epistemologischen Distanzierung mehr bedarf, um sich irrationalistisch zu setzen als einzige Realität. Derartige Verflachung ins Monistisch-Eindimensionale sowohl von Sprache wie von Wirklichkeit mitsamt ihrer Beziehung ist direkt aus dem ‚postmetaphysischen‘ Zynismus der Enttäuschungen seit 1968 erwachsen. Dessen holistischer Positivismus streicht sich seither überschwänglich der technologischen Immersion ein, als gebe es keine Welt jenseits von Affirmation mehr. Dazu nur komplementär ist die rein abstrakte Negation gesellschaftlicher Probleme entlang eines Kataloges des dekalogisch (Il-)Legitimen.
Dagegen wäre mein Vorschlag, Wirklichkeit – statt sie umso mehr in gesellschaftliche Mikrostrukturen hinein zu verkeilen – aus dem massiven Schraubstock der Identitäten zu befreien. Damit einher geht, dass wir keine sprachlichen Behörden zur enzyklopädischen Hybris der Gattungszuordnung brauchen, sondern politische Subversion der Register selbst, in die man uns umso penibler einsortieren will. Offenbar nun sind diese beiden linken Strategien miteinander nicht kompatibel. Darum ist Haltung zu beziehen.
Es kann sich im emanzipatorischen Projekt nicht um einen neuen Universalienstreit zugunsten des Nominalistischen drehen. Alternativ ist ein linker Realismus vonnöten, der Gegenhegemonie zur Realpolitik anstrebt: gegen Kapitalismus, Sexismus, Rassismus und jede andere Art der Diskriminierung, Gewalt und Herrschaft. Andernfalls verfängt sich die Idee von einer besseren Welt im Idealismus einer neo-scholastischen Inquisition, die letztlich nie anders können wird, als sich am Vertikalen des Irdischen zu stoßen – das heißt, als Schuld und Sühne lediglich im Sündenfall zwischen profaner Existenz und Häresie aufzuspüren. Das einzige Schisma jedoch, das so provoziert wird, ist das der Linken selbst, wobei die Bruchstellen ihres Gebrochenseins zu Einfallstoren der Rechten werden. Vielleicht reicht dieses Bild aus als Allegorie eines sprachphilosophischen Arguments für eine Politik, die aus Sackgassen zurückführt, statt sich an deren Enden künstlich-moralistisch um sich selbst zu drehen – und nach außen zu spucken.