Das Leben von Jaime Fernández Negrete ist seit seiner Geburt auf dem Land, über die Zeit in der kommunistischen Jugend, die Studien in Zagreb und Berlin bis zur Professur an der Universität San Andrés in La Paz von wichtigen Ereignissen der bolivianischen Geschichte geprägt… so wie auch das Leben seiner Familie: Vom Chaco-Krieg in den 30er-, der Nationalen Revolution in den 1950er Jahren und später der Verfolgung durch Militärdiktaturen. Während viele politische Umwälzungen zum persönlichen Aufstieg nutzen, verteilte sein Vater das geerbte Land und baute als Lehrer und später auch Schulgründer aus einfachen Verhältnissen heraus ein neues Leben auf. Jaime Fernández Negrete selbst nutzte mit Fleiß und Umsicht die Chancen, die sich ihm und seiner Familie boten. Dabei war und ist er bis ins Alter weltoffen, sozial und politisch aktiv geblieben: Sei es für chilenische Flüchtlinge in Berlin oder für einen respektvollen und gleichberechtigten Umgang unter den verschiedenen Kulturen Boliviens.
Von Jaime Fernández Negrete

Ich bin 1944 in Arampampa im Norden von Potosí an der Grenze zu Cochabamba geboren. Es liegt auf einer Hochebene. Damals hat es sogar eine kleine Landepiste gegeben, die schwedische Missionare benutzt haben. Mein Urururgroßvater väterlicherseits war in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Steuereintreiber für Bilbao, das heute in mehrere Provinzen aufgeteilt ist. Die Provinzhauptstadt damals war San Pedro de Buenavista. Das Amt wurde zu jener Zeit an den Meistbietenden versteigert. Aber nicht alle haben ihm die Abgaben bezahlt. So hat er deren Land konfisziert und dann an zugewanderte Mestizen verkauft, um die Steuersumme aufbringen zu können. Und vermutlich hat er selbst dabei auch Land für sich behalten, um es dann weiterzuvererben. Er gehörte der Liberalen Partei an und zahlte dafür, dass die Leute die Partei hochleben ließen.
Der Chaco-Krieg als nationaler Schmelztiegel und Saat für die Revolution
Als die Nationalrevolutionäre Bewegung MNR im Jahr 1952 an die Regierung kam, studierte mein Vater José Napoleón Fernández Navia Lehramt in Sucre. Schon im Alter von vier Jahren war er Waise geworden und dann bei der Großmutter aufgewachsen. Mit 19 Jahren zog er in den Chaco-Krieg. Die ganzen vier Jahre war er Soldat dort. Bis dahin wurde Bolivien von einer kleinen oligarchischen Minderheit spanischer oder kreolischer Abstammung regiert. Sie stellten auch die Offiziere. Aber die Truppe bestand aus Indigenen und in der Mehrheit Mestizen. Viele Indigene fühlten sich nicht als Teil der bolivianischen Nation. Vor allem Aymara in der Hochebene flohen in die Berge, um sich der Einberufung zu entziehen.

Mit meinem Vater zusammen hatten sich drei indigene Freunde aus seinem Heimatdorf Charcamarcavi zum Wehrdienst gemeldet, um zu Männern zu werden, wie es hieß. Doch nach nur fünf Monaten in der Kaserne in La Paz begann der Krieg. „Wofür hast du uns hierher gebracht, Patrón“, sagten die Indigenen zu meinem Vater. Sie redeten ihn immer noch als ihren Herrn an, weil er der Grundbesitzer war. „Sie werden uns im Krieg töten.“ Er dagegen sprach von der Verteidigung des Vaterlandes. Am Ende wurden er und Timoteo als sein Helfer zusammen zu einer Luftabwehreinheit abgeordnet. Wenn keine feindlichen Flugzeuge auftauchten, spielten sie Schach. Die beiden anderen landeten in einem anderen Regiment und dann in paraguayischer Kriegsgefangenschaft. Im Krieg war der Wassermangel das Hauptproblem.
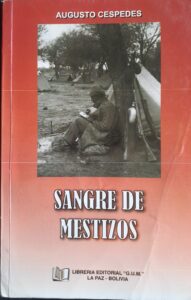
Wenn die Indigenen, die sich auskannten, die Mestizen mit Wasser versorgten, führte das zu einer hohen Bindung, die schließlich zur nationalrevolutionären Bewegung führte (siehe auch das frühere Interview auf latinorama zu dem neuesten Film „Die alten Soldaten“ von Jorge Sanjinés, der eine ähnliche Geschichte erzählt). Die Reichen waren ja nicht als Soldaten in den Krieg gezogen, hatten immer irgendwelche Vorwände gefunden oder stattdessen ein öffentliches Amt oder höchstens einen Bürojob im Militär übernommen.
Landverteilung und Neuanfang in der Stadt
Mein Vater, der im Chaco seinen Kriegsalltag mit den Indigenen geteilt hatte, wurde dann Gründungsmitglied der MNR. Die MNR beschloss dann die Agrarreform, damit diejenigen das Land besitzen, die es auch bebauen. Mein Vater teilte seinen Landbesitz unter den indigenen Bauern auf und behielt nur noch das Haus seiner Mutter in Arampampa und einen Gemüseacker am Fluss.

Als ich zwei Jahre alt war, ist meine Familie nach Cochabamba umgezogen, aber wir sind immer wieder vor allem in den langen Sommerferien in Arampampa gewesen, um Kartoffeln, Mais und anderes anzubauen, von dem sich die Familie über das Jahr ernährt hat. Dort habe ich auch Quechua sprechen gelernt. Damals gab es noch keine Straße. Wir benötigten zwei Tage, um die mehr als 70 Kilometer dorthin mit Pferd oder Maultier zurückzulegen. Kaum hatten wir den Caine-Fluss überquert, sprach ich Quechua, weil dort nur diese einheimische Sprache gesprochen wurde, und auf dem Rückweg nach Cochabamba entsprechend Spanisch.

Zum Medizinstudium nach Jugoslawien
Nach dem Abitur habe ich ein Medizinstudium begonnen. Mein Vater (der auch eine Schule in der armen südlichen Zone von Cochabamba gegründet hat, die unter dem Namen „Yugoslavia“ bis heute funktioniert) war mit dem damaligen Botschafter von Jugoslawien befreundet und besorgte mir und meiner Schwester Mary ein Stipendium zum Studium in Jugoslawien. So bin ich schon nach einem halben Jahr mit zwei weiteren Bolivianern nach Zagreb gezogen.
Das war 1965. Die ersten Monate musste ich aber erst einmal die Sprache lernen, bis wir dann 1966 in der Universität aufgenommen wurden. Ich bestand aber nicht genügend Prüfungen.

So musste ich im dritten Jahr das Studium abbrechen. Ich hatte jugoslawische Freunde in Berlin, die sagen, dass es leicht sei, Arbeit zu finden. So entschloss ich mich dorthin zu gehen. Zunächst einmal um Geld zu verdienen und Deutsch zu lernen. Zunächst habe ich als Küchenhilfe, später als Barmann und schließlich als Koch in der Pizzeria „Santa Lucia“ gearbeitet. 1971 habe ich mich dann an der Freien Universität und dem Lateinamerika-Institut zum Soziologie-Studium eingeschrieben und abends bis ein oder zwei Uhr nachts in einem italienischen Restaurant gekocht. Tagsüber hatte ich deshalb Zeit zum Studieren. Ich hatte schon immer ein Interesse an sozialen Fragen. In meiner Schulzeit war ich bereits Mitglied der kommunistischen Jugend gewesen.
Berlin hat mich gut behandelt
Und wenn ich schon kein guter Arzt würde werden können, wollte ich wenigstens ein guter Soziologe sein. Berlin hat mich anständig behandelt. Gewiss gibt es Momente der Diskriminierung, wenn sie dich schlecht Deutsch sprechen hören, aber das scheint mir noch in Ordnung, wenn man dich als Mensch respektiert. Ich wohnte in der Nähe der Gedächtniskirche am Breitscheidplatz, die an die Bomben aus dem Weltkrieg erinnerte.
Die Spaltung in West- und Ostberlin ist mir stark im Gedächtnis geblieben. Wenn wir nach München oder Prag wollten, mussten wir durch die DDR fahren. Wir hatten auch Freunde in Ostberlin, die wir häufiger besuchten. Darunter ein Pärchen. Sie war aus dem Osten, er aus Westberlin. Eines Tages lud mich der Freund in seine Wohnung in Westberlin ein. Er habe eine Überraschung. Und hinter der Tür tauchte das Mädchen aus dem Osten auf. Er hatte sie in einem VW-Käfer herausgeschmuggelt.
„Tötet mich, ich werde meine Kinder nicht verraten“
1996, als ich bereits verheiratet war und drei Kinder hatte, bin ich noch einmal mit Frau und Kindern nach Berlin zurückgekommen. Ich wollte ihnen zeigen, wo ich gelebt hatte. Das sah alles sehr anders aus. Nach Zagreb bin ich nie zurückgekommen, wohl aber nach Slowenien, weil meine Schwester damals noch dort wohnte. Fünf von uns acht Geschwistern haben eine Zeit in Europa gelebt. Drei von ihnen im Exil, weil sie 1971 als Studierende die (linksgerichtete Militär-) Regierung von Juan José Torres gegen den Putsch des Generals Banzer verteidigt hatten. Zuerst lebten sie noch im Untergrund, dann flohen sie nach Chile. Doch nach dem dortigen Militärputsch von Pinochet ging es weiter nach Europa. Sechs Monate lang haben sie damals meinen Vater ins Gefängnis gesteckt, damit er verrät, wo sich seine Kinder aufhielten. „Tötet mich“, sagte er damals, „ich werde sie nicht verraten“. Er war damals schon erblindet. Deshalb war mein kleiner achtjähriger Bruder, der ihn überall hin begleitete und sich nicht von ihm trennen wollte, zusammen mit ihm im Gefängnis.
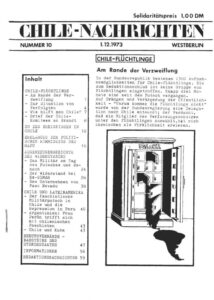
Verhandlungen mit Willy Brandt nach dem Militärputsch in Chile
Nach dem Militärputsch 1973 in Chile lernte ich in Berlin Leute aus dem Solidaritätskomitee kennen. Wir organisierten Veranstaltungen, um Geld zu mobilisieren und den deutschen Staat zu überzeugen, mehr Flüchtlinge aufzunehmen. Ich hörte in dem Restaurant auf und begann, für ein Jahr im Hendrik-Kraemer-Haus (einem Wohnheim und Begegnungszentrum der niederländischen ökumenischen Gemeinde) zu arbeiten. Mit den 1500 Mark im Monat konnte ich gut leben. Als der damalige Kanzler Willy Brandt nach Berlin kam, suchten wir ihn zu dritt im Hotel auf. Weil ich der einzige Lateinamerikaner war, sprach er mich direkt an. Ich antwortete ihm, dass die Bundesregierung mehr politisch Verfolgte aus Chile retten und nach Deutschland bringen solle. Er sagte zwei Flüge mit jeweils 300 Passagieren zu. Die Bedingung war, dass wir für ihre Aufnahme und Unterbringung sorgen würden. Als die Flugzeuge ankamen, haben wir die Chilenen und Chileninnen in Privatunterkünften in Berlin selbst und in Westdeutschland untergebracht.

Mein Studium in Berlin verlief derweil erfolgreich. Nach Bolivien zurückzukehren war damals ohnehin schwierig wegen der Diktatur des Generals Banzer. Ich war ja auf der Suche nach einer gerechteren Gesellschaft noch Mitglied der kommunistischen Jugend. Die hatte anders als die Parteiführung 1967 die Guerilla des Che Guevara unterstützt. Viele junge Kommunisten waren an der Seite des Che gestorben. Von den übrig gebliebenen gab es einen erneuten Versuch einer Guerilla in Teoponte, der ebenfalls gescheitert ist. Die Älteren aus der Führungsebene der kommunistischen Partei aber auch der sozialistischen Partei hatten Recht behalten. Statt auf die Guerilla-Taktik hatten sie auf einen Volksaufstand vor allem zusammen mit den Gewerkschaften gesetzt, um zu einer Volksregierung zu kommen. Mit der Agrarreform hatten die Kleinbauern anders als in Kuba ja ihr Land erhalten. Auch wenn die Produktion gering war, hatten sie kein Interesse an den Vorschlägen des Che Guevara.
Rückkehr nach Bolivien noch während der Banzer-Diktatur
Ich war zwar die ganze Zeit im Ausland und an den Guerilla-Aktivitäten nicht beteiligt, aber erst als 1975 meine Mutter in Bolivien schwer erkrankte, habe ich die Rückkehr riskiert. Ich hatte ein Rückflugticket nach Europa. Doch dann entschloss ich mich, mein Soziologie-Studium an der staatlichen Universität San Andrés von La Paz zu Ende zu bringen. Zum Glück haben sie eine ganze Reihe meiner Scheine aus Berlin dafür anerkannt. Nach dem Abschluss zwei Jahre später folgte dann noch ein Master in Anthropologie. 1979 (nach der zwischenzeitlichen Rückkehr der Demokratie) bekam ich eine Professur in Sozialanthropologie an meiner Universität. Die habe ich dann fast drei Jahrzehnte lang ausgeübt. Nach dem Militärputsch von García Mesa 1980 wurde die Universität einige Zeit geschlossen. Ich zog zu meinen Eltern nach Cochabamba, ich hatte ja noch meine politischen Bezüge. Aber danach ging es wieder in La Paz weiter.
Mehrmals war ich auch Direktor des Anthropologiestudiengangs. Mein Schwerpunkt war das Studium der Quechua und Aymara, aber auch der Guaraní. Mich interessierte nicht nur die Frage, wie es zu dieser ethnischen Vielfalt in Bolivien gekommen ist, aber auch, welche Gemeinsamkeiten zu finden sind, um sich auch als Bolivianerinnen und Bolivianer sehen zu können. Man neigt ja immer zuerst dazu, die eigene ethnische Identität gegenüber der Kultur der anderen zu betonen. Das ist zwar normal, aber es wird zum Problem, wenn das Andere abgelehnt oder gar gehasst wird. Und das wird dann in der Politik ausgenutzt, um die eigene Basis zu vergrößern. Dagegen habe ich mich immer verwandt. Wir sind alle Bürger*innen dieser Welt und müssen mit den gleichen Rechten zusammen leben.

Professor an der Universität und Generalsekretär der Sozialistischen Partei
Die Debatten waren diesbezüglich manchmal schwierig, zum Beispiel mit den Kataristen (indigene politische Bewegung). Das Haus, in dem ich heute wohne, ging früher nur bis zum ersten Stockwerk. Die ganze Familie hat es aufgebaut. Unten war ein Laden und im ersten Stock das Wohnzimmer und eine Küche, in der ein junge Aymara für uns kochte. Den Laden hatte ich zum Büro der Sozialistischen Partei von Marcelo Quiroga Santa Cruz (beim Militärputsch 1980 ermordeter Intellektueller und Politiker) umfunktioniert. Diese Partei, der ich inzwischen angehörte, war eine Abspaltung der Kommunisten. Ich war Generalsekretär. Wir suchten damals – etwa 1997, 1998 – ein Bündnis mit den Kataristen des Mallku (Autoritätsbezeichnung der Aymara) Felipe Quispe. Während einem Treffen sah er die junge Schwarze Frau, die uns in der Küche half. „Mit dir werde ich kein Bündnis eingehen“, sagte Quispe sofort zu mir, „du beutest meine Schwester aus“. Ich entgegnete ihm, dass er ihre Geschichte doch gar nicht kenne. Ihre Eltern seien gestorben und wir hätten sie deshalb früh in unsere Familie aufgenommen. Dort habe sie die Schule bis zum Abitur besucht. Nur die Aufnahmeprüfung zum Agronomiestudium habe sie nicht bestanden. Ich hätte mich für sie beim Dekan eingesetzt, aber das habe sie nicht gewollt. Felipe Quispe stand einfach auf und verließ die Sitzung. Ich denke, diese Ressentiments müssen ein Ende haben. Alvaro García Linera, der damalige Weggefährte von Quispe und spätere Vizepräsident nährt immer noch solchen Hass in der Bevölkerung. Ich suche dagegen die Verständigung.

Ich wünsche mir eine harmonische Gesellschaft ohne Gewalt, Diskriminierung und Revanchismus
Dabei ist die Präsidentschaft von Evo Morales auch ein Produkt der Nationalen Revolution. Damals haben seine Eltern ein eigenes Stück Land bekommen. Das war vermutlich zu klein, weswegen Morales ja auch nach Argentinien und später in den Chapare migriert ist. Gewiss hatte die Mittelschicht weiter die politischen Zügel in der Hand. Aber zu der Mittelschicht gehörten auch Mitglieder der kommunistischen oder der sozialistischen Partei. Es war die politische Korruption, die Evo Morales schließlich mit der „Tausendjährigen Koka“ als Schlachtruf an die Macht gebracht hat, auch wenn in seiner Region daraus vor allem Kokain hergestellt wird. Seine Basis in den Tropen von Cochabamba sind vorwiegend Mestizen, die dort gesiedelt haben. Aber dass ohnehin die Mehrheit der Bolivianerinnen und Bolivianer Mestizen sind, wollen sie nicht hören.
Immerhin hat der von der MAS angeführte Prozess des Wandels erreicht, dass die indigene Bevölkerung sich nicht mehr ihrer Kultur schämt. Aber die umgekehrte Diskriminierung ist auch nicht in Ordnung. Oder die Menschen spanischer Herkunft als Feinde anzusehen. Evo Morales sieht sich immer noch als Opfer von Diskriminierung aufgrund seiner indigenen Wurzeln. Aber war er nicht 14 Jahre lang Präsident Boliviens? Da muss er doch zulassen können, dass auch andere an die Regierung kommen. Da gibt es doch genug Indigene oder Mestizen, so wie Evo Morales selbst ja auch einer ist. Aber so wie der MNR sich in den 1960er Jahren aufgespalten hat, so bricht auch jetzt die MAS auseinander, weil auch dort die Korruption Einzug gehalten hat. Allerdings ist die Opposition noch viel fragmentierter und viele dort haben durchaus Sympathien mit der MAS.

Heute habe ich mich aus der Politik zurückgezogen, in der ich ein halbes Jahrhundert lang aktiv war. Aber in der ganzen Zeit habe ich gelernt, dass ich jede Diktatur ablehne, egal ob von rechts oder von links. Wie alle anderen Menschen will ich frei sein und selbst entscheiden. Schon in Ex-Jugoslawien habe ich die Unzufriedenheit der Menschen mit dem damaligen System gespürt. Und als es in Deutschland zur Wiedervereinigung kam, war ich froh. Denn auch bei den Freunden, die wir in Ostberlin besucht hatten, war die Unzufriedenheit zu spüren gewesen. Vom Kommunismus bin ich zum Sozialismus und dann zum Humanismus gekommen. Ich wünsche mir ein harmonisches Zusammenleben einer Gesellschaft ohne gewaltsame Konflikte und ohne Revanchismus.
Dank gilt Noemi Stadler Kaulich aus Cochabamba und Jan Dunkhorst vom FDCL in Berlin für Unterstützung zu diesem Porträt.





Wow!
Was für ein absolut wundervolles Porträt.
Bitte mehr davon.
Danke!!