Maria Cecilia Chacón Rendón wurde 1980 in Cochabamba geboren. Internationale Bekanntheit erreichte sie als erste Verteidigungsministerin Boliviens. Der baldige Rücktritt hing mit ihrem Engagement für die Umwelt zusammen: Ordnungskräfte hatten am 25. September 2011 den Protestmarsch indigener Organisationen gegen den Bau einer Überlandstraße mitten durch das Indigene und Naturschutzgebiet Isiboro Sécure (TIPNIS) gewaltsam aufgelöst. Fast exakt 12 Jahre später haben wir die Juristin und Politikwissenschaftlerin, Mitbegründerin des Instituts für Urbanismus und Dozentin für Umwelt- und Agrarrecht an der Universität Franz Tamayo in La Paz, nach ihrem Werdegang, ihren Erfahrungen und den Chancen für Umweltpolitik im heutigen Bolivien befragt. Anlass war das Erscheinen ihres Handbuches zum Umweltrecht. 
Woher kommt ihr Interesse für den Umweltschutz?
Ich liebe die Natur. Als Kind war ich bei den Pfadfindern. Es gab Zeltlager und wir verbrachten viel Zeit im Grünen. Meine Großmutter ist eine Liebhaberin der Gärten. Auch wegen ihr haben wir viele Pflanzen zu Hause. Seit meinem sechzehnten Lebensjahr habe ich mich mit anderen besorgten Jugendlichen zusammengetan. Wir haben die Wochenendbeilage „Das dritte Auge“ für die Tageszeitung Opinión geschrieben, um Debatten unter den Jugendlichen anzustoßen. Die Beilage hatte nicht lange Bestand. Trotzdem bin ich dankbar, dass sie uns diese Möglichkeit gegeben haben. Manche von uns wurden dadurch auf den Weg des Journalismus gebracht. Einer ist Regionalabgeordneter in Cochabamba, ein anderer Forscher und Universitätsdozent, es gibt Filmemacher… und ich habe während meines Jura- und Politikstudiums dann Kontakt zu sozialen Organisationen bekommen. In Cochabamba hatte der sogenannte Wasserkrieg im Jahr 2000 große Auswirkungen.
Der Wasserkrieg von Cochabamba
Damals wehrte sich eine ganze Stadt und Bauernorganisationen der benachbarten Gemeinden erfolgreich gegen die Privatisierung der Wasserversorgung durch den Bechtel-Konzern. Gehörten sie damals zu den Jugendlichen auf den Barrikaden?
Nein, ich war am studieren. Die Bewässerungsbauernorganisation von Tiquipaya und die Nachbarschaftsorganisationen des ärmeren südlichen Teils von Cochabamba, die damals nicht an das Wassernetz angeschlossen waren, gaben mir aber später die Möglichkeit, mit ihnen zu arbeiten. Ich konnte ihre Vertreter*innen bei den Verhandlungen unterstützen und meine Examensarbeit zum Thema schreiben. Es war immer eine Stärke des Aktionsbündnisses für das Wasser in Cochabamba, Fachpersonen einzubeziehen, um ihre Forderungen juristisch oder technisch zu untermauern. So wurden die Wasserversorgung und die Bewässerungssysteme, als ich 2003 dazu kam, auch zu meinem Arbeitsschwerpunkt. Da wurde gerade über die Gründung eines regionalen Wasserbetriebs in Colcapirhua und Tiquipaya verhandelt. Das war konfliktbeladen, weil dafür die Organisationen der Bewässerungsbauern aufgelöst werden sollten. In Cochabamba ist es dazu nicht gekommen, wohl aber im bolivianischen Chaco und im Norden von Potosí.
Wie kamen sie nach La Paz?
Über das Cochabambiner Aktionsbündnis zum Wasser wurde ich Ende 2004 von den Nachbarschaftsorganisationen in El Alto eingeladen. Ich sollte sie bei den Verhandlungen mit der Regierung gegenüber der Firma Aguas del Illimani unterstützen. Deren Gebühren waren für viele ärmere Familien zu hoch und die Reichweite der Leitungen war zu gering.
Die Firma war damals im Besitz des französischen Suez-Konzerns und wurde so wie in Cochabamba Aguas de Tunari (Bechtel) dann auch wieder in die öffentliche Hand überführt. 2006 wurden sie dann Kabinettschefin im Wasserministerium, um später Direktorin für multilaterale Beziehungen im Außenministerium zu werden. Dort haben sie sich unter anderem dafür eingesetzt, dass die Vereinten Nationen den 22. April zum „Internationalen Tag der Mutter Erde“ erklärt haben.

Lobby für die Natur bei den Vereinten Nationen
Zusammen mit Pablo Solón und anderen haben wir auch erreicht, dass das harmonische Zusammenleben mit der Natur auf die Agenda der Vereinten Nationen gesetzt wurde. Das Generalsekretariat hat eine Webseite geschaffen, auf der seit 2010 jährlich auch die Fortschrittsberichte der Staaten veröffentlicht werden: „Harmony with nature“. Das ist vielleicht nicht so bekannt. Und noch sind die guten Praktiken Ausnahmen. Aber es zeigt, dass auch Länder die nicht wie Bolivien die Rechte der Mutter Erde formal anerkannt haben, in der Praxis Gletscher, Flüsse etc. als Rechtssubjekte sehen und Maßnahmen durchführen, um ihr Entwicklungsmodell nachhaltiger zu gestalten. Das macht jenseits der formalen Beschlüsse etwas Hoffnung.

In Bolivien hat man den Eindruck, dass das Ziel des harmonischen Lebens mit der Natur in den Hintergrund rückt. Für die Wasserversorgung zum Beispiel wird viel Zement eingesetzt, statt naturnahe Methoden der andinen Agrarkultur anzuwenden. Und die Projekte werden stark von oben herab geplant.
Das ist je nach Region unterschiedlich. Selbst hier in dem stark urbanisierten Achocalla bei La Paz gibt es noch gemeindebasierte Kleinbewässerungssysteme. Allerdings will der städtische Wasserversorger EPSAS dort auch die Kontrolle über die Quellen übernehmen. Damit sind die Anwohner*innen nicht einverstanden. Das ist wie damals in Tiquipaya im Wasserkrieg. Andernorts werden die traditionellen gemeindebasierten Bewässerungssysteme zurückgewonnen. Dabei wird auch das Recht der Pflanzen beachtet, mit Wasser versorgt zu werden, ohne dass die Menschen davon einen direkten Nutzen hätten. Es wurden Studien durchgeführt, um das traditionelle Wissen zurückzugewinnen. Vor Ort sind diese Methoden auch noch lebendig. Es ist aber richtig, dass die Regierung mehr auf Baumaßnahmen fokussiert ist, einen technokratischen Ansatz hat und die andine Sichtweise und die traditionellen Wasserrechte und Kenntnisse vernachlässigt. Seit dem Inkrafttreten der neuen Verfassung 2009 ist man in der Wasserfrage programmatisch nicht mehr vorangekommen.
Keine Fortschritte beim Wasserrecht seit der neuen Verfassung
Wie ist das zu erklären?
Ein Teil derer, die das damals vorangebracht haben, haben die Regierung verlassen. Andere sind in neue Funktionen gewechselt. Und im Augenblick ist niemand dafür da. Auch hat die Regierung die Sprecherinnen und Sprecher der Basisorganisationen, die sich um die Thematik gekümmert haben, kooptiert. Statt einem respektvollen Umgang wurden Klientel-Beziehungen aufgebaut. So werden auch keine Forderungen mehr gegenüber dem Staat laut. Seit dem Inkrafttreten der Verfassung gab es keine Gesetze, die die Verfassungsartikel in Bezug auf das Wasser konkretisiert hätten. Das noch gültige Wassergesetz 2066 aus dem Jahr 2000 widerspricht in mehreren Punkten der Verfassung. Die erlaubt zum Beispiel keine Konzessionen an Privatunternehmen für die Wasserversorgung.
Sie selbst sind im April 2011 dann im Alter von gerade einmal 30 Jahren Verteidigungsministerin geworden. Beim Amtsantritt haben sie angekündigt, sich in Koordination mit anderen staatlichen Instanzen für die Konsolidierung des Guten Lebens in Harmonie mit Mutter Erde einsetzen und gegen die Zerstörung der natürlichen Ressourcen vorgehen zu wollen. Gerade einmal fünf Monate später sind sie wegen dem Konflikt um den geplanten Straßenbau durch den TIPNIS zurückgetreten. Wie sehen sie das heute im Rückblick?
Das Straßenbauprojekt im TIPNIS als Scheidepunkt
Es war die Wegscheide der Abkehr der Regierung von den Anliegen der indigenen Völker. Schon vorher hatte es Konflikte gegeben. Doch der Versuch, den Straßenbau ohne die rechtlich vorgeschriebene vorherige Konsultation und gegen den Willen der Indigenen gewaltsam durchzusetzen, gab die neue Marschrichtung der Regierung vor. Als ich zurückgetreten bin, habe ich tatsächlich noch gehofft, dass die Regierung ihre Position überprüft und ihr Handeln korrigiert. Aber das Gegenteil ist passiert. Sie bekräftigte ihre falsche Entwicklungsideologie und setzte ihre Vorstellungen gegenüber den indigenen Gemeinden unter Verletzung ihrer Rechte durch. Es gab keine Kompromisse mehr. Ich und andere nach mir, die die Regierung intern oder auch öffentlich kritisiert haben, wurden des Verrats bezichtigt. Die Reihen wurden geschlossen, Personen mit indigenistischen Positionen wurden ausgeschlossen und der Entwicklungswahn beschleunigt. Selbst der damalige Außenminister scheint Opfer dieser Flurbereinigung geworden zu sein. Er wurde als Generalsekretär zum ALBA-Bündnis geschickt. Erst 2019, als Evo das Land verlassen hatte, kam er zurück, um die Partei wieder zusammen zu führen und für die Wahlen wieder die Basisorganisationen ins Boot zu holen.

Später sind sie auf der Liste der Gruppierung Sol.Bo des Bürgermeisters Revilla zur Stadträtin von La Paz gewählt worden.
Die Stadtverwaltung von La Paz schien mir von außen eine der effizientesten in Bolivien gewesen zu sein. Von innen hat man aber gesehen, dass nach 20 Jahren Stadtregierung etwas ähnliches wie im MAS geschehen ist: Man gewöhnt sich an die Macht und die schlechten Sitten machen sich breit. Die fehlende Erneuerung scheint mir das Hauptproblem.
Umweltpolitik auf lokaler Ebene
Gleichwohl haben sie während der fünf Jahre versucht, den Umweltschutz voranzubringen. Das steht zumindest in der Kurzbiographie ihres Buches.
Die Hauptkritik ist immer die fehlende Umsetzung der Normen. Aber es gibt auch Gesetzeslücken, die wir geschlossen haben. Etwa zum Schutz des Baumbestandes bei Baumaßnahmen. Auch gab es keine Regelungen, wie die Bodennutzung verändert werden kann. Es gab nur Gewohnheiten, die sich in der Praxis durchgesetzt hatten. Und gerade wenn Baumbestand oder Flussufer in Bauland umgewidmet werden, erhöht das den Treibhauseffekt. So wie in der Kurve von Holguín, die zum zentralen Stadtpark gehört. Als geschützte Zone ist eine andere Nutzung nicht zulässig. Zudem gab es eine private Aneignung öffentlichen Raums, die irregulär zustande kam.

Geplant war ein Geschäfts- und Kongresszentrum. In dem Fall war neben den Investoren die Stadtverwaltung selbst treibende Kraft. Aber in der Regel sind es Landbesetzungen, die später durch den Druck der neuen Bewohner*innen nachträglich legalisiert werden.
Beides kommt vor. Aber in beiden Fällen ist die Stadtverwaltung zuständig. Und die Veränderungen des Nutzungsplans sind ein großes Geschäft und verleiten deshalb zu Korruption. Wenn du ein Ufer hast, das 3 USD pro Quadratmeter wert ist und es in Bauland umwandelst kostet es dann 300 USD. Und diesen Gewinn streicht nicht das Munizip ein. In anderen Stadtteilen sind die Gewinne noch höher. Man spricht meist von dem Verlust der Tropenwälder, die in Ackerland umgewandelt werden. Aber in einer Stadt, in der es ohnehin wenig Grünflächen gibt, ist die Wirkung einer Umwidmung auch heftig. Die Luftreinigung wird beeinträchtigt, die Heimstatt von Vögeln geht verloren.

Der Montículo in La Paz – Refugium für Pflanzen und Vögel
Auch wenn die Bäume hier gegenüber vernachlässigt und bereits geschädigt sind, und letzte Woche zehn Bäume gefällt wurden, kommen auf den „Montículo“ Drosseln, Tauben, Turteltauben, Bischofstangare, Bergkarakaras (eine Falkenart)… und sogar einen Adler habe ich schon gesehen. Hinzu kommen Zugvögel, die hier Wasser trinken und Nahrung aufnehmen. Eine Stadt benötigt solche Grünzonen. In ganz La Paz gibt es nur drei davon. Fünf Qudaratmeter Asfalt gibt es in La Paz pro Einwohner, aber nur drei Quadratmeter Grünflächen.

Es heißt, dass 15 Quadratmeter Grünfläche pro Person nötig sind. Im Viertel Tejada Sorzano kämpft die Nachbarschaft um ein kleines Dreieck von weniger als 100 Quadratmeter Größe, wo die Alten etwas Sonne tanken und Kinder spielen können, da es sonst kein Grün gibt. Aber jeden Tag gehen Bäume bei Unfällen oder Baumaßnahmen verloren.
Welche Möglichkeiten hatten sie als Kommunalpolitikerin?
Es gibt seit den 1980er Jahren kommunale Bestimmungen, die den Baumbestand als schützenswert eingestuft haben. Selbst wenn der Baum auf deinem Grundstück steht, brauchst du die Genehmigung, um ihn abzuholzen oder zurückzuschneiden. Aber für Baumaßnahmen fehlten wesentlich detailliertere Angaben über das Vorgehen. Die haben wir verabschiedet und Informationsbroschüren dazu erstellt. Die haben auch in Cochabamba und Santa Cruz Verwendung gefunden.

Trotzdem hat die Stiftung Patiño beim Bau ihres neuen Kulturzentrums in La Paz drei völlig gesunde Bäume gefällt. Als sie eine Auszeichnung für die Architektur bekommen sollten, habe ich mich dagegen ausgesprochen. Denn eine gute, moderne Architektur berücksichtigt die Natur.

Dafür gibt es auch in La Paz Beispiele. Die Bank Ecoofuturo hat in Obrajes zum Beispiel drei Bäume innerhalb des neuen Gebäudes einbezogen und bewahrt. Die hätten zumindest ein Lob verdient.
Wir haben auch ein Wäldchen mit 25 exotischen Baumsorten unter Schutz gestellt.

Und wir haben eine Anordnung erlassen, die die Stadtverwaltung dazu verpflichtet, Unterlagen nur noch doppelseitig zu kopieren. Damals hat das Munizip umgerechnet knapp 2,3 Millionen Euro im Jahr für Papier ausgegeben. Aber der schwierigste Teil war, diese Anordnung auch umzusetzen. Sie ist stieß auf erheblichen Widerstand. So begann die Hauptarbeit für uns eigentlich erst, als die Anordnung bereits erlassen war. Aber wir haben so die Papierkosten deutlich reduzieren können. Ich weiß allerdings nicht, wie es in der heutigen Stadtverwaltung aussieht.
Das Handbuch zum Umweltrecht soll vor allem der Ausbildung der neuen Generationen dienen. Wenn sie an ihre Studierenden denken, welche Hoffnung besteht, dass die bolivianische Justiz, die einen miserablen Ruf hat, besser wird?
Das hängt von den einzelnen Personen ab. Viele werden sich anpassen, dafür sind das Bildungswesen, das kein kritisches Denken fördert, und die Justiz wie geschaffen. Die Menschen sind nicht gewohnt, viel nachzudenken und haben Angst, sich kritisch zu äußern. In der Regierung wirst du kaum Mitarbeitende finden, die ihren Vorgesetzten widersprechen. Aber ich sehe unter den Studierenden auch ein paar, die anders sind. Vielleicht werden sie die Justiz nicht umgestalten können. Aber wenigstens können sie in die Auseinandersetzungen gehen, die für ihre Rechte zu führen sind.

Ich nehme vor allem unter den Jugendlichen eine große Sensibilität für die Natur, das Wasser, die Tiere wahr. Das gab es so vor zwei oder drei Jahrzehnten noch nicht. Unsere Themen waren Demokratie und Menschenrechte.
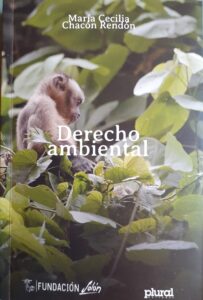
Wenn wir heute über Umweltrecht reden, dann kommt immer auch die Sprache auf die Tiere, die die jungen Leute zum Beispiel von der Straße aufgelesen haben. Es sieht so aus, dass heute die Tierrechte mehr Menschen auf die Straße bringen als die Menschenrechte. Diese Tierliebe lässt sich auf den Rest der Natur übertragen. Einen Tiger wirst du dir nicht als Haustier holen und vielleicht nie zu Gesicht bekommen, aber die Situation eines Straßenhundes mag dich auch für die Zerstörung des Habitats des Tigers sensibilisieren, oder dass er wegen seiner Klauen gejagt wird. Allerdings sind viele Jugendliche auch sehr pessimistisch und deprimiert. Aber zumindest werden sie nicht im Strom mitschwimmen.

Ein richtungsweisendes Gerichtsurteil…
Vor kurzem gab es das Urteil eines Provinzrichters, der wegen der Vergiftung von Mensch und Natur durch Quecksilber den Stopp der Goldproduktion im Amazonasgebiet von La Paz angeordnet hat.
Es hat in den letzten sechs Wochen drei solcher Verfahren gegeben. Und eines davon war die Klage des Verbandes der indigenen Völker im Tiefland von La Paz, die Schutz vor den Bergwerksaktivitäten am Beni-Fluss eingefordert haben. Anfang August wurde die Klage eingereicht und es wurden provisorische Schutzmaßnahmen angeordnet. Schon einen Monat später wurde das Urteil gefällt. Auch der Fluss sei ein Rechtssubjekt, und deshalb müssten die Behörden die Genehmigungen für Bergwerke in der Region suspendieren.
Was wird passieren? Wird man ihn entlassen, oder sein Urteil in höherer Instanz einkassieren?
Ich glaube nicht, dass der Richter ausgetauscht wird. Aber es wird sehr schwer werden, das Urteil umzusetzen. Denn dafür müsste die Regierung Maßnahmen ergreifen. Und die Regierungspartei hat ihre Vereinbarungen mit den Bergwerkskooperativen, die ein wichtiger Bündnispartner der MAS sind. Wenn sie nicht mehr als 5% Steuern zahlen wollen, dann zahlen sie auch nicht mehr, selbst wenn wir anderen 15,5% zahlen müssen. So wird es nun darum gehen, auf die Regierung Durck auszüben. Die Umsetzung des Urteils wird nicht ohne Polizei und Militär, nicht ohne finanzielle Mittel und vor allem politischen Willen gehen. Und selbst wenn sie die Region räumen, müsste sichergestellt werden, dass sie die Woche drauf nicht wiederkommen.

Woher den Optimismus nehmen?
Eigentlich gibt es schon lange Verpflichtungen der Regierung aus dem internationalen Abkommen von Minamata zum Quecksilber. Das ist bereits 2017 in Kraft getreten.
Und seitdem hat es große Rückschritte in der Frage gegeben. Immer mehr Quecksilber wurde importiert, die Bergwerkswirtschaft bekam freie Hand. Die Regierung redet davon, die Nutzung des Quecksilbers bei der Goldgewinnung zu regulieren. Dabei müsste sie sie verbieten.
Woher nehmen sie dann ihren Optimismus in Bezug auf das jüngste Gerichtsurteil?
In einer Zeit, wo die Justiz so stark den Interessen der Regierungspartei unterworfen ist, ist ein solches Urteil zwar eine Überraschung, aber eine gute Nachricht. Damit sind wir ein Stück weiter gekommen und können darauf aufbauen. Die Situation wird sich nicht von heute auf morgen klären, aber es gibt Hoffnung.
Fußnote: Wer mehr von Cecilia Chacón auf Spanisch lesen will, kann dies auf ihrem Blog „La chispa adecuada“ tun.



