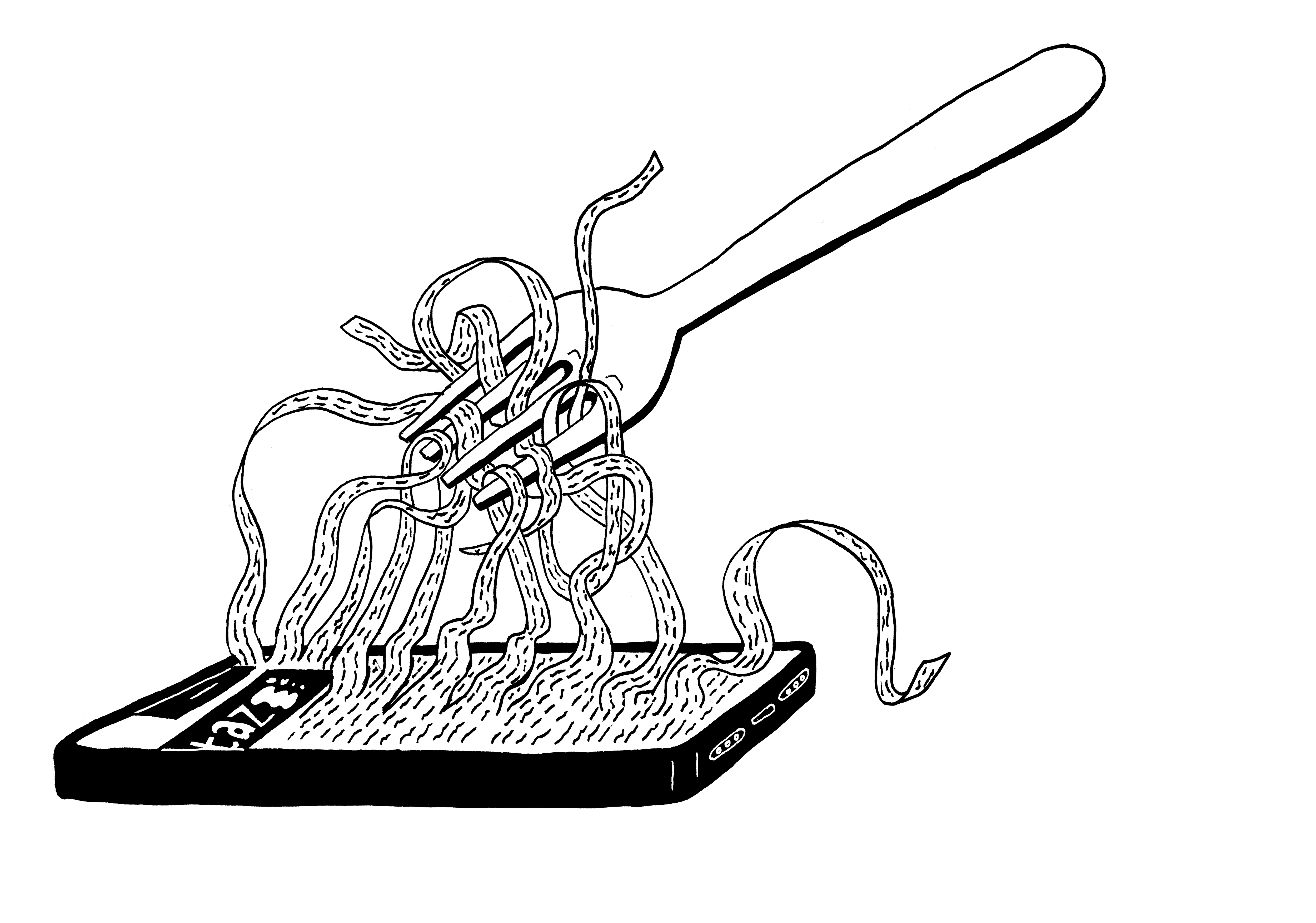Schon einmal etwas von den “Vereinigten Staaten von Kailasa” gehört? Die haben ihren Sitz in den USA (Los Angeles) und präsentieren sich als Vertretung von zig Millionen Hindus sowie als Koordinierungsinstanz von weltweit über hundert indigenen Nationen. Ebenfalls haben sie nach Angaben auf ihrer Webseite eine eigene Hymne, planen eine eigene Bank, erteilen auf elektronischem Weg sogar Pässe. Und ganz offensichtlich verfügen sie über eine Menge Kapital. Dennoch blieb im Jahr 2019 der Versuch erfolglos, in Ecuador auch an Land zu kommen.
Ende 2023 wurde dann ein hochrangiger Mitarbeiter des paraguayischen Landwirtschaftsministeriums entlassen, nachdem der eine gemeinsame Absichtserklärung mit dem vermeintlichen Staat unterzeichnet hatte. Ende 2024 gab es erste Hinweise in Bolivien, dass Kailasa mit indigenen Völkern im Tiefland Verträge zur Nutzung ihres Landes geschlossen hatte. Nach anfänglichem Desinteresse in Politik und Medien hat sich der Fall diesen März mit einer Veröffentlichung der Journalistin Silvana Vincenti in der Tageszeitung El Deber zu einem handfesten Skandal entwickelt.
Als Staat proklamiert wurde Kailasa im Jahr 2019 von dem indischen Guru Nithiananda Paramashivanam. Der damals 41-Jährige war gerade aus Indien geflohen. Dort war der Versuch gescheitert, ein Gerichtsverfahren gegen ihn wegen sexualisierter Gewalt niederzuschlagen. Nithiananda bestreitet die Anschuldigungen bis heute und begründet seine damalige Flucht mit politischer Verfolgung. In ihrem Online-Programm vom 21. März diesen Jahres beschreiben sich die Mönche und Nonnen des „Souveränen Ordens von Kailasa“ als indigene Hindugemeinschaft. Die sei auch heute in Bolivien wieder Opfer falscher Beschuldigungen von anti-Indigenen und hinduphoben Medien bzw. einem rassistischen „Deep State“.
Der wiederum habe sich nie für die Probleme der indigenen Gemeinden interessiert. Und Kailasa habe kein Stückchen Land von Indigenen in Bolivien gekauft, wie es in der Presse gestanden habe. Sie, die „International Organization of Kailasa”, hätten mit den Baure und Cayubaba aus der Provinz Beni und den Esse Ejja aus Pando nur Vereinbarungen zur humanitären Hilfe getroffen. Und dabei hätten sie alle Gesetze und die Verfassung des Plurinationalen Staates von Bolivien respektiert. Sie berufen sich dabei auch auf Artikel 289 der bolivianischen Verfassung, in dem es um die Selbstbestimmung und eigene Institutionalität der autonomen indigenen Territorien geht.

Übertragung von Land für 1000 Jahre
Tatsächlich steht im Vertragstext von Kailasa mit den Indigenen direkt nichts von Kauf, aber auch nichts von humanitärer Hilfe. Es ist von der Überlassung des Landes für einen Zeitraum von 1000 Jahren gegen eine jährliche Geldzahlung die Rede. Eine automatische Verlängerung des Pachtvertrages ist dabei inbegriffen. Allerdings präsentieren die Youtuber von Kailasa bereits am nächsten Tag einen Vertragsausschnitt, in dem auch von der Übertragung der Ländereien an Kailasa die Rede ist. Dies und die erste Geldzahlung, argumentieren sie, solle laut Vereinbarung erst nach der Ratifizierung des Vertrages durch die bolivianische Regierung geschehen.
Sie betonen auch, dass die Unterschriften unter den Verträgen von einer Notarin beglaubigt wurden und vom Außenministerium mit einer Apostille versehen worden seien. Doch all das bedeutet noch nicht, dass die Verträge selbst verfassungskonform wären. Rein humanitäre Hilfe, wie noch am Vortag behauptet, müsste ohnehin ohne Gegenleistung erbracht werden. Die Verträge sprechen dagegen explizit von der Nutzung der Luft, sowie der Ressourcen auf und unter der Erde durch Kailasa. Dabei werde dem Orden die vollkommene Souveranität und Autonomie in Bezug auf administrative, kulturelle, religiöse, wirtschaftliche Aktivitäten in dem Territorium zugesagt. Das Dokument ist auf Seiten von Kailasa von ihrer „Exzellenz, der Botschafterin Brenda Jung“ unterschrieben.
Zumindest das Anrecht auf die Bodenschätze ist dem bolivianischen Staat vorbehalten und kann von keiner indigenen Nation vergeben werden. Im konkreten Fall geht es um 60.000 Hektar gegen eine jährliche Zahlung von 108.000 US-Dollar bei den Baure, um 31.000 Hektar der Cayubaba für jährlich 55.000 US-Dollar und weitere 31.000 Hektar de Esse Ejja für 28.000 US-Dollar pro Jahr. Was nach viel Geld für die benachteiligten indigenen Gemeinden und ihre gar nicht so zahlreichen Mitglieder klingt, sind jedoch selbst für bolivianische Pachtverhältnisse niedrige Summen. Bei den Esse Ejja nicht einmal 1 US-Dollar pro Jahr und Hektar.
Wie konnte es zur Vertragsunterzeichnung kommen?
Auch in Bolivien haben Kailasa-Delegierte im Vorfeld Kontakt zu öffentlichen Stellen gesucht, die ihnen als Türöffner dienen können. Die eigene Homepage listet dafür ein paar Empfehlungen oder Vereinbarungen mit zumeist lokalen Autoritäten andernorts auf. Auch von der Anerkennung durch die Vereinten Nationen ist die Rede. Es bezieht sich auf eine Teilnahme an zwei Anhörungen. Doch die seien laut Presseabteilung des UN-Hochkommissariats für Menschenrechte öffentlich gewesen. Und die Beiträge von Kailasa seien wegen fehlender Relevanz nicht in die Dokumentation aufgenommen worden, wie die BBC im März 2023 berichtete.
In Bolivien sind inzwischen eine ganze Reihe Sprecher und Sprecherinnen indigener Organisationen bekannt geworden, mit denen Kailasa Kontakt aufgenommen hatte. Die Organisation veröffentlichte auch zahlreiche Fotos vom Besuch eines Parlamentsabgeordneten aus der Beni-Region in ihrem Sitz in Los Angeles während eines Festes, den Austausch von Flaggen und Geschenken eingeschlossen. Herbert Taboada, der aus der Oppositionsfraktion Comunidad Ciudadana wegen Zusammenarbeit mit der Regierung ausgeschlossen worden war, bestätigte seine Teilnahme. Die Fotos von dem Treffen seien jedoch vom 26. Feburar diesen Jahres, sprich nach der Vertragsunterzeichnung, bei der er keinerlei Rolle gespielt haben. Sein Besuch bei dem Kumbh Mela-Fest von Kailasa habe sich eher zufällig bei einer Reise ergeben.
Zufällig sei auch die Botschafterin von Kailasa bei einem Kongress der regierungsnahen NGO Cidob in Santa Cruz aufgetaucht, so deren Koordinator, Justo Molina. Doch Kailasa veröffentlichte ein offizielles und von Justo Molina unterschriebenes Einladungsschreiben, in dem auch explizit auf die erwartete Anwesenheit von Luis Arce Catacora hingewiesen wurde. Die Einladung sei eine plumpe Fälschung, so ein Rechtsanwalt der regierungsnahen CIDOB. Die Überreichung eines Buches von Kailasa an den bolivianischen Präsidenten wird jedoch nicht bestritten. Das Foto ist inzwischen viral gegangen.

Aktuelle Situation
Gegenüber der Tageszeitung El Deber räumte Justo Molina ein, dass Kailasa schon drei Jahre im Land sei. Inzwischen hätte die Gruppe 20 Wohnungen auf den Territorien der Baure, Cayubaba und Esse Ejja angemietet, mit denen sie nun auch die Verträge unterzeichnet hätten. Erst jetzt würden die lokalen indigenen Autoritäten sich von den Verträgen distanzieren. Sie seien nicht dazu bereit, für ihre Unterschrift einzustehen, kritisiert Molina.
Basisorganisationen der Cayubaba distanzierten sich in einer Video-Botschaft am 21. März inzwischen von den Unterzeichnern der Verträge. Sie selbst hätten deren Inhalt nicht gekannt. Nicht die Gemeinden seien das Problem, meint auch der regierungsunabhängige Dachverband der Tieflandvölker Cidob (Orgánico) in einer Stellungnahme. Das Problem seien die Zentralregierung und all die ausländischen und inländischen Akteure, die mit dem Ziel kooptiert worden seien, das kommunitäre und familiäre Leben in den indigenen Territorien zu zerstören. Der Dachverband fordert die Regierung auf, das Gesetz gegen Landbesetzungen und Bodenspekulation anzuwenden und ihrer Schutzaufgabe nachzukommen. Diese Verträge, bei denen die individuellen und kollektiven Rechte in den indigenen Territorien zur Verhandlung stünden, seien nicht akzeptabel.

Der für die Cayubaba zuständige Ortsbürgermeister von Exaltación in Beni holte nach dem Medienwirbel Polizei zur Hilfe, um drei Mitglieder von Kailasa irischer Nationalität festnehmen zu lassen, die sich in seiner Gemeinde aufhielten. Auch forderte er von ihnen die Vorlage der Verträge. Seitdem bekomme er Drohungen aus dem In- und Ausland. Einen Tag später wurden mindestens 15 weitere Mitglieder von Kailasa in einer Pension in der Millionenstadt Santa Cruz festgenommen. Ihre Touristenvisa, seien ausgelaufen, so die Migrationsbehörde. Kailasa bestreitet dies und beschuldigt stattdessen die bolivianischen Behörden, die grundlegenden Menschenrechte ihrer Mönche und Nonnen zu missachten. Es sei Gewalt angewendet worden und sie hätten keinen Kontakt zu ihren Anwälten. Es ist ein Vorgehen, das nicht dadurch besser wird, dass es in Bolivien üblich ist.
Spielt der CO2-Emissions-Zertifikatshandel eine Rolle?
Der Fall sei jedoch nur das „Sahnehäubchen auf der Torte“ der Bodenspekulationen und Landbesetzungen, in die Regierungsstellen tief involviert seien, meint die Journalistin Silvana Vincenti. „Mädchen, du weißt nicht, mit wem du dich angelegt hast“, drohte ihr per Telefon Pedro Guasico, der den Vertrag im Namen der Baure unterzeichnet hatte. Kurz darauf entschuldigte sich Guasico mit dem Argument, er sei bei dem Anruf betrunken gewesen. Aber Antworten von der Agrarreformbehörde, dem Außenministerium, des Informationsministeriums und anderer staatlicher Stellen, die sie zum Fall angefragt hatte, bekomme sie nicht, so die El-Deber-Journalistin. In ihrem jüngsten Beitrag vom 23. März zitiert sie aber Miguel Vargas. Für den Direktor des privaten Zentrums für juristische Studien und Sozialforschung Cejis steht die jüngste Öffnung Boliviens für den CO2-Emissions-Zertifikathandel inZusammenhang mit dem Land-Deal. Der Artikel 32 im Gesetz zum Schutz der Mutter Erde, der den CO2-Zertifikatshandel verbietet, war auf Antrag der Regierungspartei MAS vom Verfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt worden. Er beeinträchtige das Recht auf eine gesunde Umwelt und widerspräche internationalen Abkommen (zum Thema siehe auch dieses Interview mit der Senatorin Cecilia Requena).

Aber so wie Kailasa erklärt Miguel Vargas gegenüber El Deber, gebe es bereits eine Reihe anderer Personen, Organisationen, Stiftungen oder Projektplanungsfirmen, die sich derzeit um Verträge mit den Vertretungen indigener Territorien bemühten. So in Monte Verde, Lomerío, dem Indigenen und Naturschutzgebiet Isiboro Sécure (TIPNIS) oder dem Multiethnischen Territorium (TIM II) in Beni und Pando. Adolfo Chávez von der regierungsunabhängigen CIDOB habe schon zuvor Hinweise darauf auch von Gesprächspartner*innen der Cayubaba, Baure und Esse Ejja bekommen, berichtet die Journalistin Vincenti.
Wenn man ihnen Dollars verspreche, so habe Adolfo Chávez gesagt, würden die langfristigen Folgen für die indigenen Gemeinden leicht vergessen. Einen Dollar Miete und mögliche 70 US-Dollar Entschädigung über CO-Zertifikate für einen Hektar Wald klingt bei über 120.000 Hektar tatsächlich nach einem verheißungsvollen Geschäftsmodell. Auch in der Region Guarayos und bei den Guaraní in der südlichen Chaco-Region hatte es Vorklärungen gegeben. Insgesamt soll es laut Infobae um 480.000 Hektar gegangen sein. Kailasa wehrt sich jedoch explizit gegen den Vorwurf, mit CO2-Zertifikaten Geld verdienen zu wollen. Im Gegenteil, sie wollten die Wälder nur schützen und verhindern, dass andere damit Geschäfte machen, hieß es auf ihrer Youtube-Plattform am 22. März.
„Mir macht das Schweigen der Regierung Sorgen“
Inzwischen ist klar, dass die Verträge von Kailasa mit den Indigenen nicht rechtsgültig sind. Aber das ist auch bei den Kooperationen von indigenen Gemeinden und Kooperativen mit ausländischen Bergwerkskonzernen im Goldsektor häufig der Fall, ohne dass die Regierung oder Gerichte dem Einhalt gebieten würden. Im Fall Kailasa mache ihr vor allem das Schweigen der Regierung Sorgen, meint die Journalistin Silvana Vincenti nun in einem Radio-Interview mit ihrer Kollegin Maggy Talavera. Nach der Veröffentlichung ihres Beitrags in El Deber habe es eine ganze Woche gedauert, bis das bolivianische Außenministerium in einer knappen Presseerklärung kund tat, Bolivien habe keine diplomatischen Beziehungen zu Kailasa, das zudem völkerrechtlich von niemanden als Staat anerkannt sei.
Jedoch gebe es keine Aufklärung über die Rolle der staatlichen Stellen, keine Erklärung für das Foto des Präsidenten mit Brenda Jung auf seiner Facebook-Seite… Am 23. März schließlich äußerte sich Yamil Flores, Minister für ländliche Entwicklung: Es liege keine Anzeige gegen Kailasa wegen illegaler Aneignung von Land vor. Der Fall werde jedoch von Amts wegen untersucht. Die Verträge seien in jedem Fall nichtig und die Regierung habe nichts dergleichen unterstützt. Die festgenommenen Mitglieder von Kailasa aus China, Indien, Schweden, USA, Deutschland, dem Vereinigten Königreich, Irland und Portugal hätten die aufenthaltsrechtlichen Bestimmungen nicht erfüllt, weil sie als Tourist*innen eingereist waren. Inzwischen sind sie ausgewiesen.