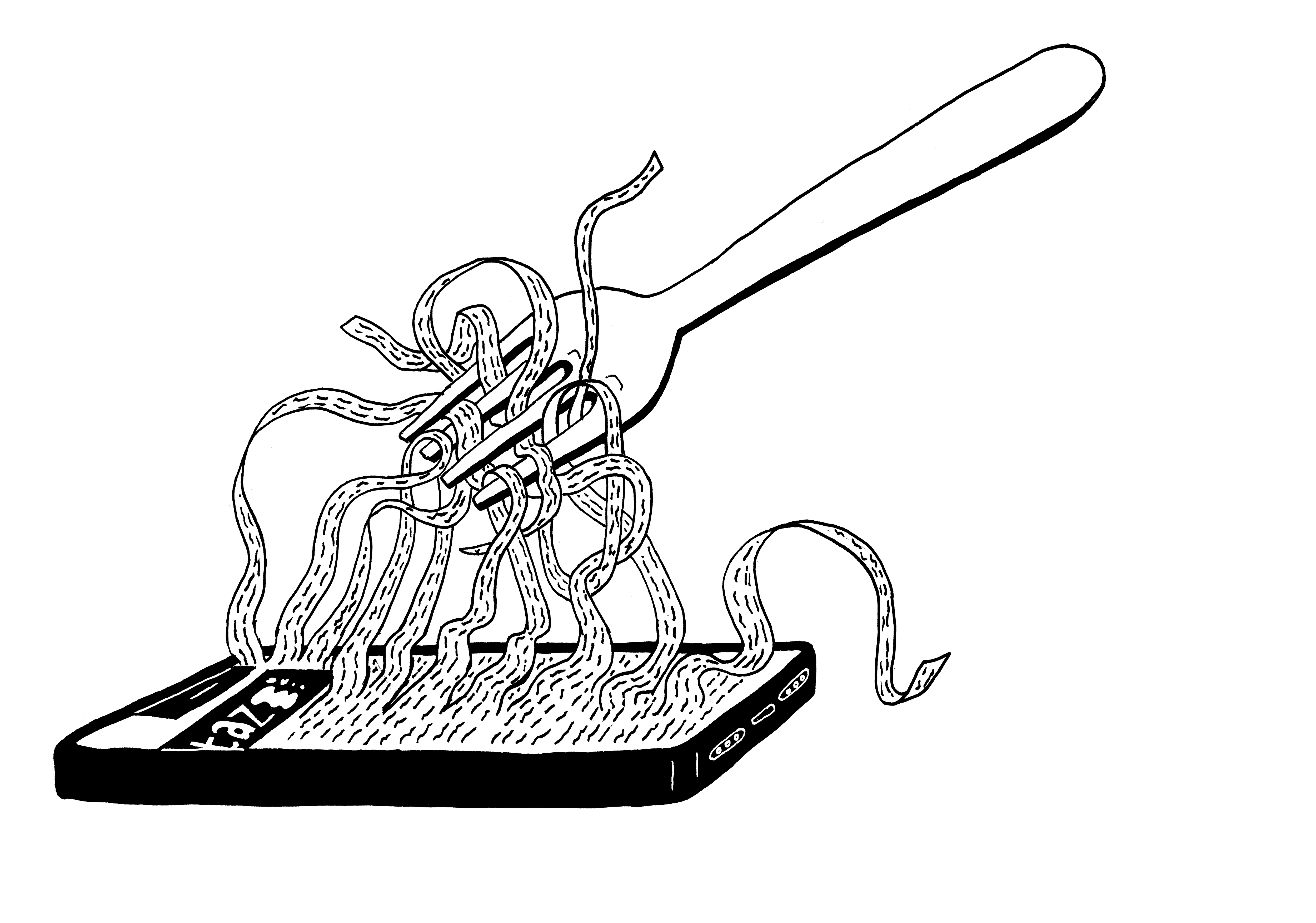Mit bislang nicht einmal drei Prozent der Wählerintention bei der jüngsten Wahlumfrage des TV-Senders Red UNO (siehe auch diesen Beitrag) sieht die regierende „Bewegung zum Sozialismus“ (MAS) geringe Chancen, an der Macht zu bleiben. Präsident Luis Arce Catacora betonte derweil in einem seiner wenigen Interviews mit Jimena Antelo vom TV-Sender RTP, nicht nach Umfragen zu schielen und die richtigen Entscheidungen für die Lösung der wirtschaftlichen Probleme Boliviens getroffen zu haben. Nach der Bewilligung neuer Auslandskredite durch das Parlament sind die Warteschlangen an den Tankstellen kürzer geworden, aber nicht verschwunden. Die Inflation steigt, die Reallöhne sinken ebenso wie die Einschätzung der Kreditwürdigkeit bei den Rating-Agenturen. So ähnelt manche Regierungsentscheidung eher einem Schlussverkauf für die eigene Klientel.
Ein Beispiel: Im Stil eines Donald Trump wurde per Dekret 5390 im Mai die „integrale Nutzung“ der Forstreservate des Landes angeordnet. Bislang waren die Waldreservate gemäß Forstgesetz und Verfassung ausschließlich für nachhaltige forstwirtschaftliche Aktivitäten des Staates zugelassen. Die Ingenieursvereinigung von Santa Cruz kritisiert in der Zeitschrift Nómadas, dass das Dekret nun mit schwammigen Formulierungen und dem Begriff „integral“ weitere Nutzungsmöglichkeiten eröffne: Unter anderem die Umwandlung von bislang geschützten Waldgebieten in landwirtschaftlich genutzte Flächen. Das war allerdings selbst ohne Dekret bereits Praxis. Mit neuen Planungsinstrumenten und dem Mandat der Einbeziehung lokaler Gemeinden werde zudem die nachträgliche Legalisierung und Titulierung illegaler Landbesetzungen möglich. Denn mit „lokalen Gemeinden“ seien Neuansiedlungen gemeint.

In einer Stellungnahme vom 25. Juni fürchten auch die zivilgesellschaftlichen Komitees zur Verwaltung der Naturschutzgebiete des bolivianischen Tieflands, dass das Dekret die Bodenspekulation und damit weitere Entwaldung befördern werde. Dies auch in indigenen Territorien. Die Umweltschützer*innen fordern die Regierung daher auf, das Dekret zu annulieren.
Zivile Bündnisse bremsen Landbesetzungen
Noch zählen die Landbesetzer*innen auf die Rückendeckung der Regierung. Doch in der Sorge, dass das Geschäft nach den Wahlen ein Ende haben könnte, habe es in den letzten Monaten vermehrt Treffen von ihnen in der Chiquitanía, Guarayos und der Provinz Cordillera gegeben. Das berichtet Erwin Melgar, der die von Landnahme betroffenen indigenen Gemeinden in diesen Tieflandregionen von Santa Cruz begleitet. Die Folgen: Erneut habe es in den letzten Monaten in den indigenen Territorien Guarayos, Monte Verde, Bajo Paraguá, Turubó Este und im Norden von Charagua illegale Landnahmen gegeben. Ebenso in den Naturschutzgebieten Noel Kempff Mercado, Kaa Iya, im Tal von Tucavaca und im Park Santa Cruz la Vieja.

Und genau um die Legalisierung solcher Besetzungen gehe es im umstrittenen Dekret 5390. „Doch die Komitees zur Verteidigung des Landes in der Chiquitanía, in Guarayos und bei den Guaraní haben es in all diesen Fällen erst einmal geschafft, dass die Landbesetzer in ihre Herkunftsregionen oder die nächstgelegenen Städte zurückgekehrt sind“, berichtet der Soziologe.
Agroindustrie und Viehfarmer als Nutznießende
Ob Landbesetzer und Bodenspekulanten tatsächlich einen Regierungswechsel zu fürchten haben, steht auf einem anderen Blatt. Haben sie doch bislang eng mit der Exportagroindustrie des Tieflands kooperiert, spricht besetzte und zerstörte Waldflächen weiterverkauft. „Anfangs ging es wirklich um Landlose“, räumt die Investigativ-Journalistin Silvana Vincenti ein. „Aber ich habe mit den sogenannten Interkulturellen und Landlosen geredet. Man benutzt ihre Namen und Dokumente, aber am Ende verbleibt das Land in den Händen von Agroindustriellen oder Viehfarmern. Viele sind aus Brasilien oder auch Mennoniten (traditionalistische plattdeutsch sprechende Religionsgemeinschaft, die sich seit den 1950er Jahren in Bolivien angesiedelt hat). Selbst Parteimitglieder der MAS an der Basis sind empört“, hat Vincenti in Interviews erfahren. Ein Beispiel sei die Besetzung des Landgutes Las Londras (siehe diesen früheren Beitrag auf Latinorama).

Während der waren Angestellte, Polizisten und sogar Journalist*innen von bewaffneten Besetzern in Geiselhaft genommen und gefoltert worden. Obwohl die Täter bekannt sind, sind sie vier Jahre nach den Ereignissen noch auf freiem Fuss. Das Strafverfahren wurde ein ums andere Mal verschoben. Unter anderem, weil die Strafverfolgungsbehörden von den Opfern verlangten, den Tätern die Vorladungen zu übergeben, obwohl die auch später noch mit Waffen aufgetreten sind, um sich der Strafverfolgung zu entziehen. „Mitten während des Skandals stellten wir fest“, sagt Vincenti, „dass das Landgut, das innerhalb der Forstreserve von Guarayos liegt, bereits von einem brasilianischen Konsortium (CRESUD) international zum Kauf angeboten wurde.“ Es seien nicht so sehr die Mitglieder der Basis, sondern die Partei-Elite, die die Geschäfte mit dem Boden machen würden, so Vincenti.
Am 11. Juli musste die Polizei erneut bei einer Landbesetzung auf dem Gut Santa Rita in der Nähe von Las Londras eingreifen, um mindestens 20 Arbeiter und deren Chef zu befreien, auf die von Landbesetzern geschossen worden und die in Geiselhaft genommen worden waren. Seit Juli vergangenen Jahres ist es bereits das fünfte Mal, das Fremde auf dieses Landgut eindringen, das ebenfalls in einer Waldreserve liegt, weswegen auch die Besitzrechte noch ungeklärt sind. Laut Anwalt der Betreiber der Farm lägen gegen zwei der Besetzer, Sprecher der Siedlerorganisation, wegen vorangegangener Angriffe auf Polizisten Haftbefehle vor, die nie umgesetzt worden seien, berichtet die Tageszeitung El Deber. Die Siedlerorganisation, die sich selbst „Interkulturelle“ nennen, sei in Santa Cruz längst eine kriminelle Vereinigung, meint der Anwalt (siehe auch diesen früheren Beitrag auf Latinorama) verallgemeinernd. Und weil deren Sprecher bei den kommenden Wahlen auf der Liste der Regierungspartei für einen Posten als Senator kandidiert, forderte der Innenminister der Regierung die Presse auf, den Fall nicht zu politisieren und die Interkulturellen nicht zu stigmatisieren.

Parteienkonsens beim Extraktivismus
Andere kaufen sich in die Agroindustrie ein. So wie Präsidentensohn Rafael Ernesto Arce Mosqueira (siehe diesen früheren Latinorama – Beitrag). Aber ob Neureiche oder alte Oligarchien: Die Agroindustrie wird angesichts des Devisenmangels und dem steigenden Haushaltsdefizit im Wahlkampf praktisch von allen Parteien hofiert. Zwar äußerte sich der Kandidat Samuel Doria Medina auf einem jüngsten Forum des Agrarverbandes von Santa Cruz klar gegen Landbesetzungen. Doch wie alle anderen relevanten Aspiranten auf das Präsidentenamt – Andrónico Rodríguez eingeschlossen – sprach er sich für die Ausweitung der Exporte und für die von den Monokultur-Betrieben geforderte unbegrenzten Genehmigungen für Gentechnologie in der Landwirtschaft aus, um die Produktion zu steigern. Gentechnisch verändertes Saatgut ist bis auf Ausnahmen laut „Gesetz zum Schutz der Mutter Erde“ bislang noch verboten. Wenn Produktionssteigerung im Konflikt mit der Bewahrung der Natur stehe, so Doria Medina vom Bündnis Unidad, dann werde er sich für Produktionssteigerung entscheiden.
Gentechnik als Alternative zur Entwaldung?
Ein von den Verfechtern der Gentechnologie vertretenes Argument: Gentechnologie werde die Produktivität steigern und weitere Abholzungen überflüssig machen. Obwohl bislang in Bolivien kein einziges gentechnisch verändertes Saatgut für die Maisproduktion genehmigt sei, werde bereits bei 80% der Aussaat gentechnisch verändertes Saatgut verwendet, gibt der Umweltökonom Stasiek Czaplicki zu bedenken. Und bei der Soja, wo es bereits Genehmigungen gibt, sei es nicht weniger. Trotzdem seien die Erträge nicht gestiegen, so Czaplicki, der auch Alternativen aufzeigt. Nur ein Viertel der Sojaproduzenten düngen dagegen das Land. Eine Produktionssteigerung sei ihnen gar nicht so wichtig, hätten Vertreter der Branche ihm gegenüber geäußert. Das größte Geschäft werde mit der Bodenspekulation gemacht, vermutet Czaplicki.
Die unendliche Geschichte des Lithiums
Geht es nach der Regierung, dann sollen auch zwei große Verträge zur Lithiumausbeutung noch vor den Wahlen über die Bühne gebracht werden. Bei deren Aushandlung war ein anderer der Präsidentensöhne beteiligt, ohne eine öffentliches Amt auszuüben. Und es spricht wenig dafür, dass dies ein ganz uneigennütziger Gefallen für seinen Vater war. Derweil sinken die Weltmarktpreise. Aber nicht nur die Sorge, dass Bolivien angesichts künftiger alternativer Batterie-Technik auf seinem Lithium sitzen bleiben könnte, führt zur Eile, sondern auch die bevorstehenden Neuwahlen.

Seit Ende letzten Jahres liegen die Verträge mit dem chinesischen CBC-Konsortium und der russischen ROSATOM dem Parlament zur Genehmigung vor, argumentiert die Regierung. Doch seitdem die Entwürfe veröffentlicht wurden, gibt es auch heftige Kritik. Die betroffenen indigenen Gemeinden am Salzsee von Thunupa beklagen die fehlende vorherige Befragung und die fehlenden Umweltstudien, vor allem was die Auswirkung auf die Wasserversorgung der Dorfgemeinden betrifft. Dies solle nach Vertragsunterzeichnung noch geschehen heißt es von Regierungsseite. Denn man wisse ja noch gar nicht, wo genau gearbeitet werden solle.
Der Ökonom Milton Lérida, der die Gemeinden begleitet, weist zudem darauf hin, dass die geplante Technik noch keineswegs erprobt und auch kein Technologie-Transfer vorgesehen ist. Im Gegenteil, die Rechte an der Technologie verbleiben bei den Konzernen und für die geplante Nutzung soll ebenfalls ein Entgelt erhoben werden. Auch seien die vereinbarten Steuern und Abgaben für die betroffenen Regionen minimal kalkuliert, so Lérida. Frühere Verhandlungen mit anderen Firmen waren trotz besserer Konditionen am fehlendem Technologie Transfer, an fehlenden Verpflichtungen zur Industrialierung oder Weiterverarbeitung im Land, aber vor allem an den niedrigen Abgaben gescheitert (siehe ila475 Lithium in Bolivien). Alles Forderungen, die auch die vorliegenden Verträge nicht erfüllen. Hinzu kommt, dass die russische zu ROSATOM gehörende Uranium One beim Ausschreibungsverfahren wegen fehlender Voraussetzungen zunächst nicht berücksichtigt worden war. Erst nach einem Besuch des Präsidenten Arce in Sankt Petersburg und der Lieferung von Dieseltreibstoff durch Russland, wurden sie wieder in das Portfolio aufgenommen.
Der Präsidentschaftskandidat der Regierungspartei, Eduardo del Castillo, verspricht ein vorheriges Lithium-Gesetz, das mindestens 17% an Royalties festlegen soll. Doch die Regierung besteht auf der jetzigen Unterzeichnung der Verträge durch das Parlament. Und die verpflichten Bolivien dazu, die laut Bergwerksgesetz derzeit gültigen 3 Prozent Abgaben später nicht zu erhöhen. Die Investitionen und Betriebskosten der beiden Multis werden als zu Weltmarktkonditionen zu verzinsender Kredit behandelt, der später mit Lithium in Sachleistung abbezahlt werden soll. Ob es irgendwann überhaupt zu Gewinnen kommen wird, die versteuert werden könnten, bleibt also offen. José Carlos Solón von der Stiftung Solón verweist zudem darauf, dass die unverbindlichen Referenzpreise des Vertragswerks bei dem dreifachen des aktuellen Weltmarktpreises für Lithium kalkuliert wurden. Der aktuelle Weltmarktpreis würde die geplanten Kosten nicht decken, so die Stiftung in einer Stellungnahme.

Dass der Parlamentspräsident in einer tumultartigen Nachtsitzung auf einer geheimen statt namentlichen Abstimmung bestand, hat das Vertrauen auch nicht gestärkt, dass es um künftige Deviseneinnahmen für Bolivien und nicht um Partikularinteressen geht. Oppositionsabgeordnete hatten behauptet, Geld für die Bewilligung der Verträge angeboten bekommen zu haben. Da die Regierung keine namentliche Abstimmung zulassen wollte, wurde die Sitzung erst einmal vertagt.
Während die Politik streitet, dringt der Goldbergbau vor
Und während Treibstoffmangel, Inflation, Korruptionsfälle und der Wahlkampf die Gemüter bewegen, versuchen Goldschürfer im Stillen, noch Konzessionen von der Bergbaubehörde zu bekommen, oder direkt illegal mit der Ausbeutung zu beginnen. So wie es bei 90% der Betriebe am Madre de Dios-Fluss der Fall ist. Und bei den übrigen 10% wurden die Konzessionen ohne die vorgeschriebene vorherige Befragung der ansässigen indigenen Gemeinden erteilt, wie Jimena Mercado von der Umweltnachrichtenagentur ANA am 7. Juli berichtet. Ähnlich sieht es im Norden von La Paz aus. Dort hatte ein Gericht im September 2023 den Stopp jeglicher illegaler Bergbauaktivitäten in den dortigen indigenen Territorien angeordnet, sowie die Bergbaubehörde zu vorherigen Befragungen bei der Vergabe von Konzessionen verpflichtet. Doch nichts dergleichen sei passiert, kritisierte jüngst der Dachverband der indigenen Gemeinden dieser Region (CEPILAP) mit einer neuerlichen Eingabe vor Gericht.

Der Zusammenschluss der Goldkooperativen hat sich zwar inzwischen offiziell für die Kandidatur des MAS-Dissidenten Andrónico Rodríguez ausgesprochen, der in den Umfragen bessere Werte erzielt als der Kandidat der Regierungspartei. Doch die Regierung scheint ihre bisherige Klientel nach wie vor auf Kosten der indigenen Gemeinden und der Natur vor der Erfüllung der gesetzlichen Pflichten zu schützen. Ähnlich wie die Landbesetzer und Landspekulanten im Tiefland. Und obwohl sowohl der Kandidat der MAS und bis vor kurzem noch Innenminister Eduardo del Castillo als auch der Dissident Andrónico Rodríguez im Wahlkampf derzeit Präsident Arce für alle wirtschaftlichen Probleme verantwortlich machen und eine Anpassung des Wirtschaftsmodells versprechen, wird hinter den Kulissen durchaus verhandelt.
Das hat allerdings noch nicht dazu geführt, dass wie früher massiv Staatsangestellte zu den Wahlkampfveranstaltungen abkommandiert werden. Vermutlich ist die Bereitschaft dazu auch geringer als früher, wo die Entlassungsdrohungen noch real waren. Denn selbst bei einem erneuten Zusammenschluss der diversen Fraktionen der MAS, ist ein Wahlsieg im August oder bei Stichwahlen im Oktober keineswegs garantiert.