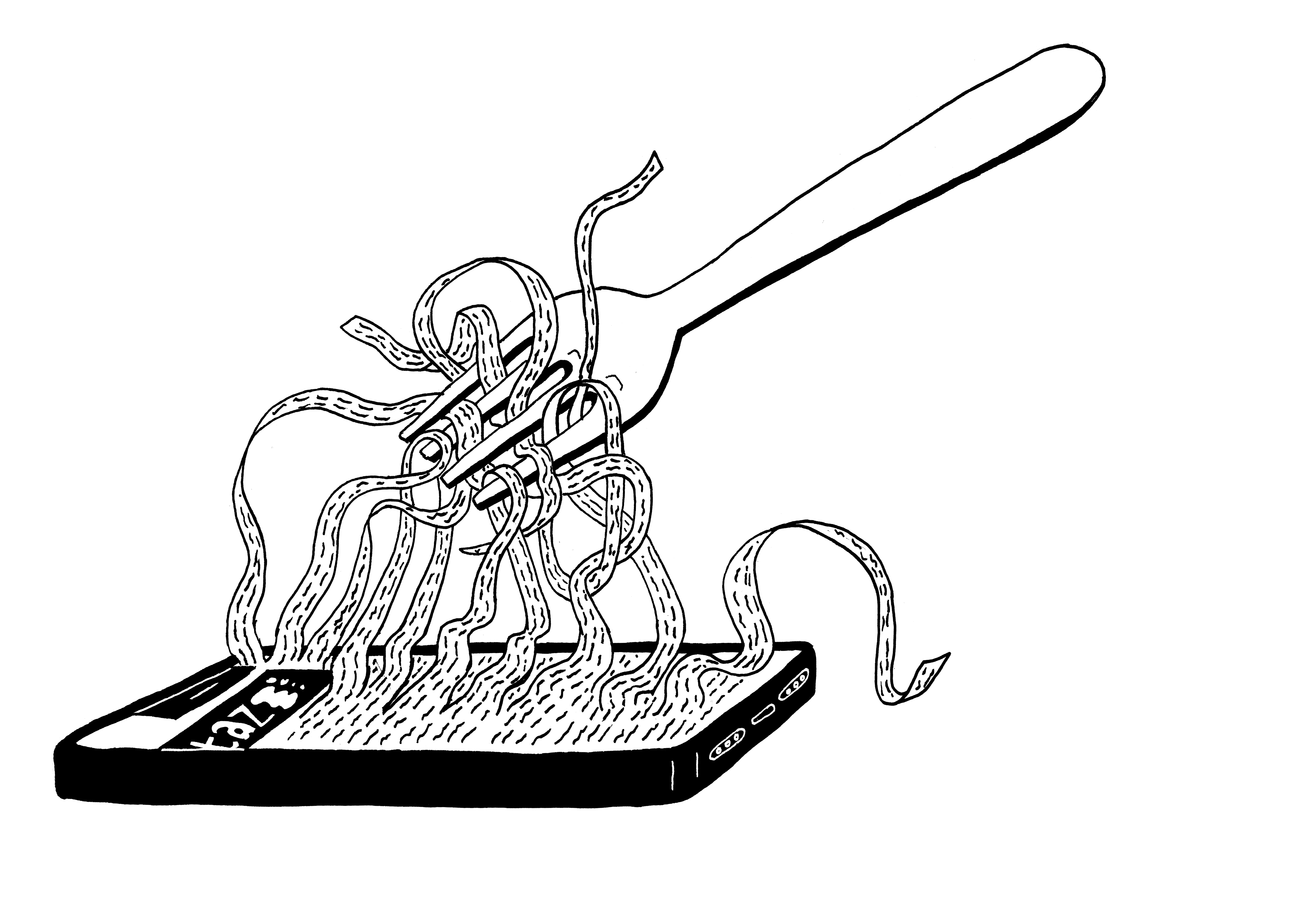2011, ich war jung, unreif, abenteuerlustig und noch nicht so abgezockt und schlitzohrig wie später, hatte ich begonnen, mit akademischen Arbeiten mein Geld zu verdienen. Damals waren hoffnungsvolle Tagediebe aus der ganzen Welt in das vermeintliche Mekka Berlin gezogen, um Erfahrungen zu sammeln, sich zu finden oder durchzustarten. Aus späterer Sicht war es eine relativ ruhige Zeit. Das Wort Hipster wurde noch nicht derart einfallslos durch alle Münder gezerrt, ebenso wenig wie der Flüchtling. Die AfD gab es noch nicht und der Bürgermeister der Bundeshauptstadt war schwul; und all das war gut so. Obgleich sich schon zu Beginn des zweiten Jahrzehnts des dritten Jahrtausends sowohl der gemeine Hipster als auch das antiquierte Denken der 1930er Jahre in gleichem Maße unangenehm abzeichnete.
Wie viele andere auch kam ich nach Berlin, weil ich mehr vom Leben wollte – was auch immer das bedeuten mochte. Davon überzeugt, dass ich dieses Mehr zu Hause, in meinem kleinen Kaff an der Ostsee, nicht haben konnte, floh ich. In Wahrheit flüchtete ich aber aus einem anderen Grund, und zwar vor den zwischenmenschlichen Beziehungen, die während des Erwachsenwerdens in die Brüche gegangen waren und darauf warteten, wieder zusammengeflickt zu werden. Ein niederer Grund sich zu verpissen, aber ich musste einfach raus, weg von den 3.600 Seelen meiner Ortschaft, in der es unmöglich war, den anderen aus dem Weg zu gehen. Es war wie bei den zufallsverdammten Simpsons; immer die gleichen Figuren auf der Straße.
Dass ich nicht genau wusste, weshalb ich überhaupt ging, schob ich später meinem damaligen Alter in die Schuhe. Es war ein Alter, das verzweifelt darum rang, Identität zu finden, was bedeutete, dass alles Sonstige um einen herum vergessen wurde.
Wieso Berlin? Ganz einfach; bei uns im Fischerdorf gingen die wildesten und somit für Mittzwanzigjährige reizvolle Geschichten über die Hauptstädter herum, und wie ich herausfinden sollte, waren sie alle wahr. Es war von Clubs die Rede, in denen man problemlos alle möglichen Drogen kaufen könne und die mehrere Tage hintereinander geöffnet hätten, von besetzten Häusern, in denen man kostenlos übernachten könne, wenn man keinen Schlafplatz fand, und darüber, dass man jeden Tag in der Woche feiern könne, die ganze Nacht lang, an unzähligen Plätzen, und dass man Fremde auf der Straße ansprechen und sich an Ort und Stelle mit ihnen verbrüdern könne.
Bedachte man, dass ich ein erlebnishungriger Jungspund war, in dessen Dorf sich nachts bestenfalls Nachbars Lumpi bemerkbar machte, war es kein Wunder, dass mich die Hauptstadt zunehmend lauter lockte.
*
Bis bald, euer Nirgendsmann