
Es ist eine Hass-Liebe, die der Berliner zu seinem Berlin Festival pflegt. Jedes Jahr wird aufs neue rumgemaunzt, dass der Sound scheiße war, dass das Booking nicht cool genug war, dass zu viele elektronische Acts gespielt hätten, dass zu wenig elektronische Acts gespielt hätten, dass die Urbanität nicht so richtig durchschlägt, dass man die Wiese des Tempelhofer Feldes nicht nutzen kann etc pp. – und doch kommen jedes Jahr wieder mehr Zuschauer als im Jahr davor…
Auch in diesem Jahr bleibt das Fazit ein entschiedenes „nun ja!“. Grundsätzlich bin ich immer noch davon überzeugt, dass ein Festival im Flughafen Tempelhof das Potential hat, wirklich außergewöhnlich zu sein. Aber dem Berlin Festival ist es immer noch nicht gelungen, die architektonischen Gegebenheiten für sich positiv zu nutzen – im Gegensatz zum Melt! Festival, dessen Landschaft des industriellen Verfalls mit Baggerdinosauriern dermaßen markant und einprägsam ist, dass wohl jedem sein „erstes Melt“ in Erinnerung bleibt, entwickelt das Berlin Festival @ Tempelhof selten mehr Charme als eben ein Festival auf asphaltiertem Grund in Hangars, das auch an irgendeinem Flughafen für Easy-Jet-Maschinen im Frankfurter Hinterland stattfinden könnte. Vielleicht sollte man doch dazu übergehen, den Bau selbst zu nutzen, die Eingangshalle zum DJ-Dom umzubauen, die Nazireste aus dem Gebäude rocken.

Was man dem Berlin Festival bisher allerdings jedes Jahr zu Gute halten musste, war ein durchdachtes Booking – leider hat die 2012er Ausgabe hier zum ersten Mal nachgelassen. Aus kommerziellen, Techno-Touristen-nach-Berlin-lock-Gründen ist Kalkbrenner nachzuvollziehen, dass aber The Killers die prominenteste Band sein sollen, die man für den anderen Tag als Headliner gewinnen konnte, kann ich fast nicht glauben.
Wäre der Freitag abend zudem ein Mixtape gewesen, ich hätte dem Kompilator das eine oder andere Wörtchen mit auf den Weg gegeben, ist doch eine Reihenfolge Tocotronic -> Sigur Ros –> The Killers gelinde gesagt absurd.

Tocotronic überraschten mit einem sehr geradlinigen Greatest Hits – Set, das zu Beginn mit „Freiburg“, „Jugendbewegung“, „Ich bin viel zu lange mit Euch mitgegangen“ und „Sie wollen uns erzählen“ gleich vier ihrer Meisterwerke des adoleszenten Menschenhasses abfeuerte. Natürlich besteht hier die alte Undertones-Gefahr, deren „Teenage Kicks“ mit Ende 50 auch etwas weniger überzeugend (dafür mehr creepy) als mit 19 klingt. Doch ist „Sie wollen uns erzählen“ mit Rick McPhail an der Gitarre beispielsweise gar noch gewachsen, wuchtiger, schärfer als die Originalversion von vor 15 Jahren!
So spielten sich Tocotronic zurecht quer durch ihre Bandgeschichte bis sie ganz am Ende noch ein Ausrufezeichen setzten und „17“, den selten live präsentierten Albumcloser ihrer vielleicht besten Platte „K.O.O.K.“, dem Festivalpublikum vorsetzten. Was angesichts eines zum Großteil instrumentalen elfminütigen Stücks über – laut von Lowtzow – „den Tod“ gegenüber dem Berliner Feierpublikum ein schönes fuck you ist.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=aIsvNVJ0HW0[/youtube]
Als zweiter Höhepunkt des Festivals müssen Franz Ferdinand genannt werden, die noch einmal unterstrichen, dass sie allen Bloc-Party- und Maximo-Park-Comebacks zum Trotz eben doch die beste Band der Class Of 2003/2004 waren. Die drei präsentierten neuen Songs zeigen allerdings weniger eine Weiterentwicklung der bisher von Album zu Album elektronischer gewordenen Songstrukturen, sondern mehr eine Rückkehr zum Postpunk des Debüts, in Teilen gar mit deutlichen Mod-Anleihen eine Reise in eine noch weiter zurück liegende Vergangenheit.
Erstaunlich überzeugend waren die Songs der mild gefloppten jüngeren Alben, insbesondere „Can’t Stop Feeling“ mit seinem „I Feel Love“ – Zitat und ein beeindruckend tribalistisches „Outsiders“ als Setcloser. Ganz in Percussionlaune versammelte sich gegen Ende des Songs alle vier Schotten zu einem wilden Getrommle: Franz Ferdinand – giving four-person-drum-solos a good name since 2012.

Während Franz Ferdinand also einen – im besten Sinn – hochprofessionellen Auftritt lieferten, konnte man Kate Nash bei einer öffentlichen Selbstdemontage zusehen. Zwar hat Miss Nash seit ihrer Beziehung zu Über-DIY-Verfechter Ryan „The Cribs“ Jarman bekennderweise eine Vorliebe für Frauen-Punk-Bands und auch schon auf dem letzten Album Riot-Grrrls-Anleihen eingeschmuggelt, aber dieser reine Schrammelpunkgitarren-Auftritt war dann doch verblüffend. Als wollte sie alle Popdämonen ein für alle mal exorzieren und jeden vor den Kopf stoßen, der Nash noch vom ersten Album kannte. Bezeichnend in ihrem Hass auf alles und jeden, dass sie selbst schlechten Ventilatoren einen Song widmete („the next song is for the shit fans“), ihr Soundmixer seinen Job völlig verfehlt hat und so die geplante Noise-Attacke auch noch viel zu leise war, was den misslungenen Auftritt abrundet. Pussy Quiet statt Pussy Riot also, wie man andernorts zu recht schrieb.
Einem kommerziellen Selbstmord zuzusehen hat aber wenigstens noch etwas Berührendes (blame it on Doherty-Sozialisation!), manchmal Erhabenes, denn wenigstens kämpft und faucht und röhrt Miss Nash als würde sie der nächste Morgen einen feuchten Kehricht scheren!
Was dagegen aber hipsters new favourite band, die Friends aus dem Prenzlauer Berg New Yorks, Brooklyn, lieferten, war so langweilig, dass man schon wieder selbst fuchtig werden konnte. Eine Band mit zwei, drei wirklich tollen Songs, die beinah ausschließlich auf der Vorarbeit von New Yorker Postpunkheroen wie ESG und Liquid Liquid beruhen – die von der Band aber live wirklich jeglicher Schärfe oder gar Funkyness beraubt werden – von einer dahinter stehenden Haltung ganz zu schweigen.
Das Ego von Sängerin Samantha Urbani ist auf einem Planeten, auf den ihre Songs nicht kommen werden, wenn sie weiterhin ihre Stimme gnadenlos in den Mittelpunkt mischen lässt und die Basslinien wie die Percussion, das ursprüngliche Herz dieser Lieder, zu unwichtigen Begleitelementen degradiert, die nur der Performance der Sängerin zu dienen haben.
Das ist ein Auftritt, der das Hass-Liebe-Pendel eindeutig in eine Richtung ausschlagen lässt. (Christian Ihle)
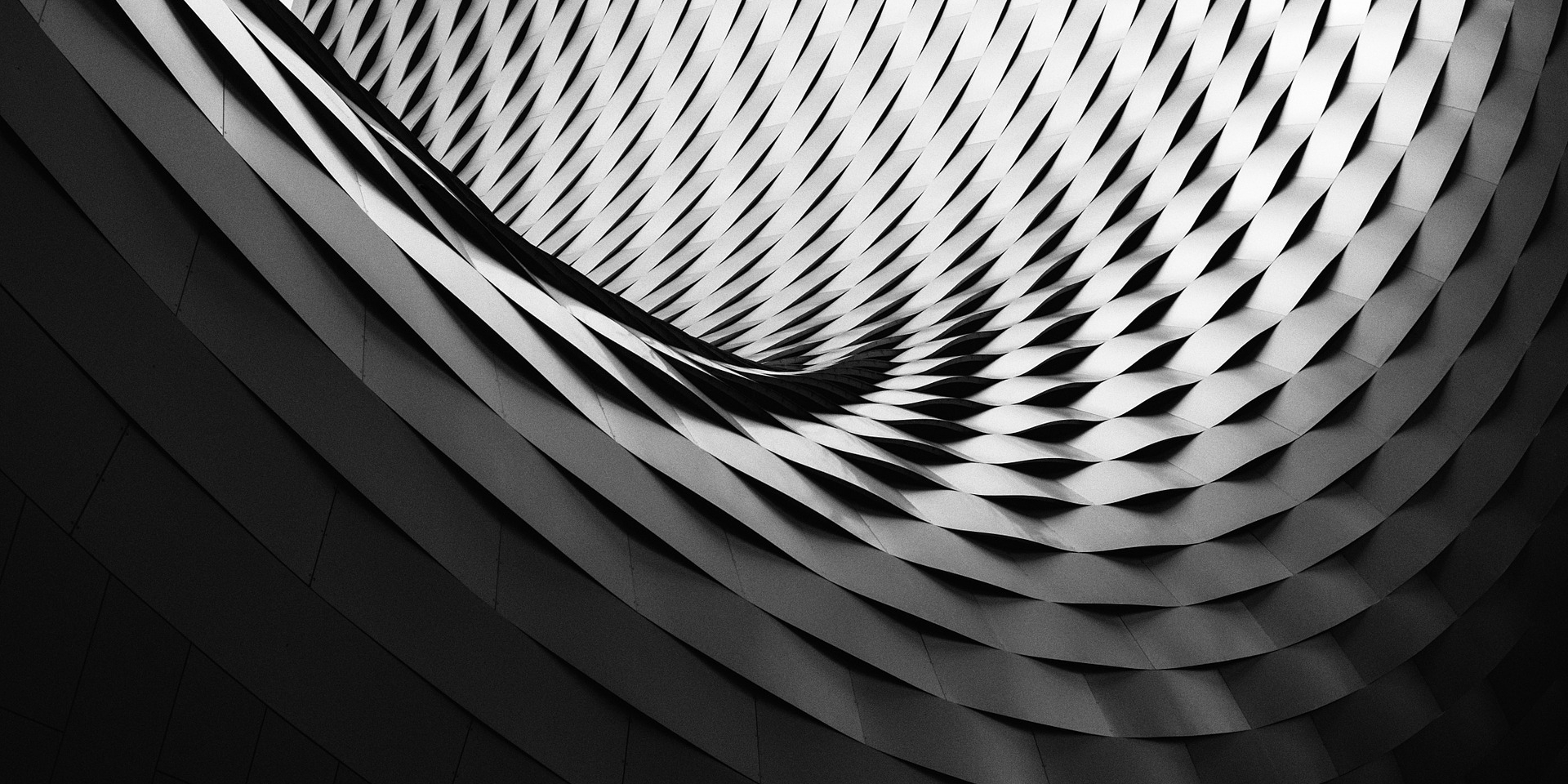



Auszug aus dem Urban Dictionary zu Kate Nash:
shit hit the fan
1. Used primarily to describe a set of circumstances where events became inflamed to a point that control was lost.
2. An idiomatic expression used to convey that something disastrous has occured.
3. A term used when a situation goes from bad to worse. (When there is shit that stinks…thas bad. When shit hits a running fan, flings it all over the place, and spreads the wafting stank…thas WORSE!).