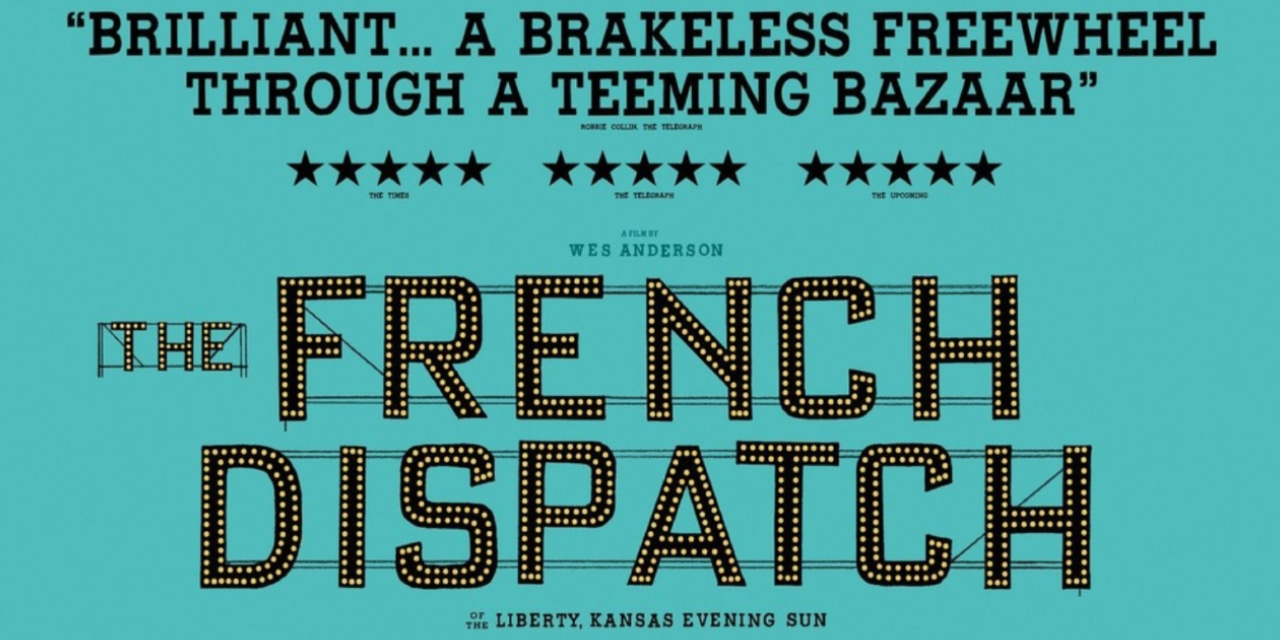Ich muss ehrlich zugeben, dass ich im ersten Drittel große Zweifel hatte, ob neben wunderbarem Styleoverkill hier auch ein bisschen Content zu finden wäre, ist „The French Dispatch“ doch eine Anthologie mit nur wackeligem Zusammenhang: Anderson bebildert die letzte Ausgabe des (fiktiven) „The French Dispatch“ – Magazins, das natürlich eine einzige große Verbeugung vor dem ‚New Yorker‘ ist, dem besten journalistischen Magazin der Welt.
So erzählt Anderson kleine und große Geschichten – von einer Fahrradfahrt durch das französische Städtchen Ennui-sur-Blasé (auch Wes ist nicht vor platten Scherzen gefeit) bis zu einer Entführung des Sohns eines Polizeichefs – und bettet diese in die notdürftige Rahmenhandlung der Produktion der letzten Magazinausgabe ein.
Im Grunde waren Wes-Anderson-Filme schon immer eine Ansammlung von kleinen Ideen und großen Skizzen, von kuriosen Momenten und weirden Charakteren, die nur mühsam in einen größeren dramaturgischen Bogen gefasst waren, sondern vor allem von seinen drei großen S gestützt wurden: Style, Sound und Charme.
Dass Anderson nun die Idee einer durchgehenden Handlung komplett aufgibt, kann man also konsequent finden. Nach einem eher schwachen Beginn (Owen Wilsons Radfahrt als Klischee-Franzose) findet Anderson aber in seinen Groove und kommt spätestens bei der bezaubernd-verfremdeten Nacherzählung der Studentenrevolte des französischen Mai ’68 völlig zu sich. Wie er hier eine Anderson’sche Version einer Godard’schen Revolution erfindet, ist so wunderbar, dass meine größte Kritik an „The French Dispatch“ nur sein kann, dass er aus dieser Idee keinen ganzen Spielfilm entwickelt hat.
Diese smarte, wilde, witzige, poetische („in a good way“) Kurzgeschichte wollte ich nie enden sehen.
Und Jarvis singt dazu „Aline“.