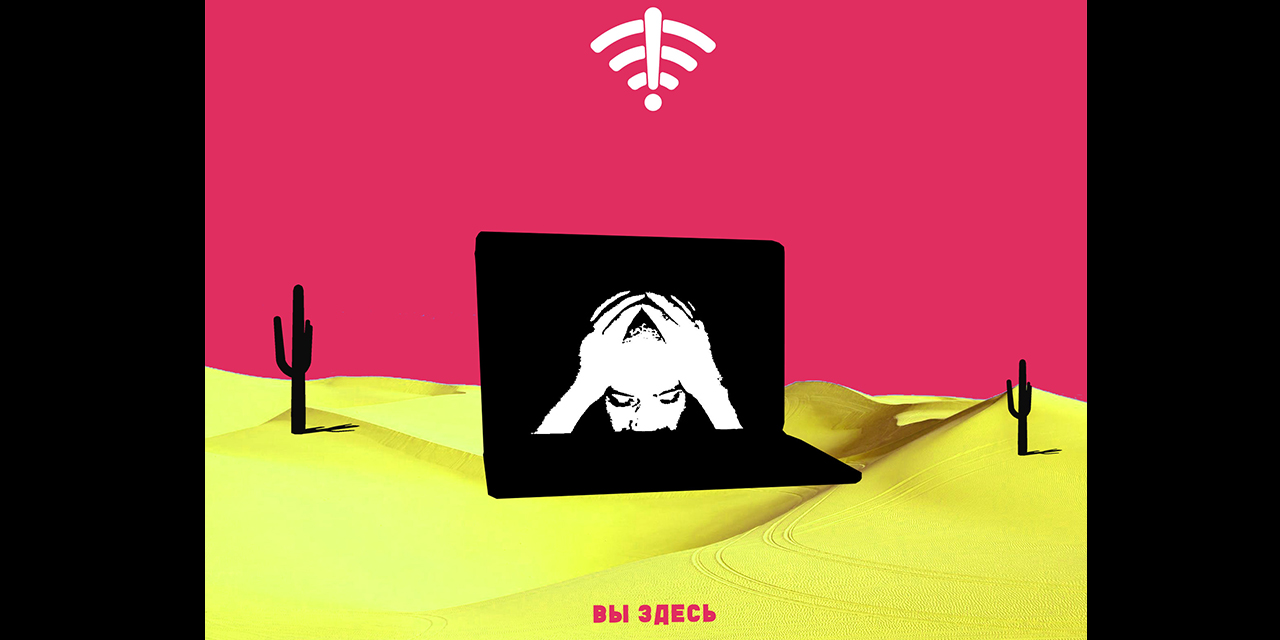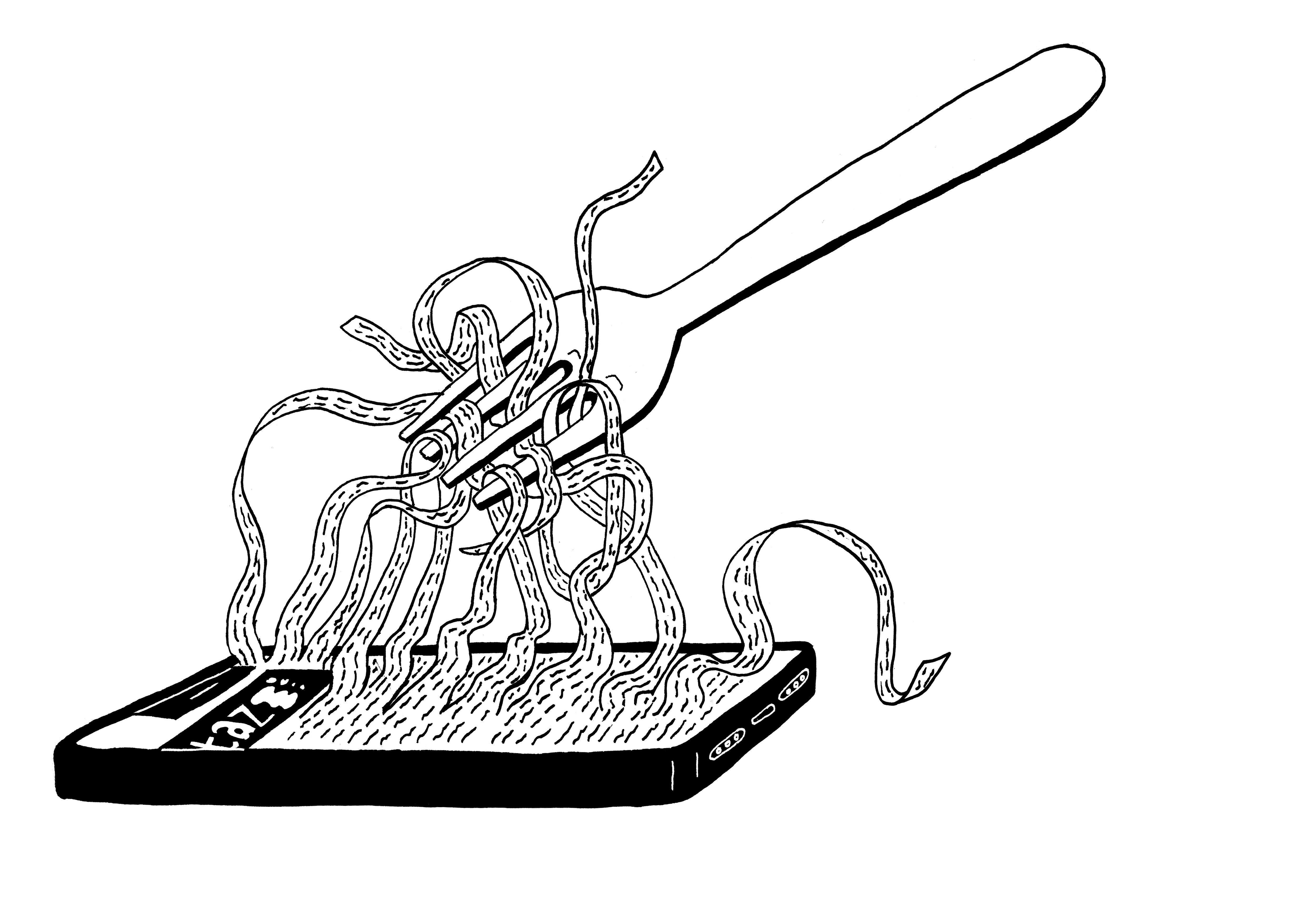Triggerwarnung: Vorsicht, dieser Text enthält Einsamkeit: ein Tag im Leben eines Ichs, das durch die Stadt flaniert.
Ich bin alleine, aber nicht einsam. Oder doch? Was ist genau der Unterschied?
Ich bin hineingeworfen in die Wirklichkeit und versuche, ihren Ansprüchen gerecht zu werden. Sie will trainiert werden wie ein Muskel. Oder gestreichelt werden wie eine Katze. Beides fällt mir schwer und ich hoffe, sie gibt sich zufrieden mit meinen schüchternen Versuchen.
Ich bin voreingenommen wie die Suchmaschine, in der ich zuletzt „best coffee“ eintippte und schäme mich für die Orientierung an Zahlen, wische den Gedanken aber wieder weg, so wie Tilda Swinton in Memoria eigentlich keine Figur spielt, sondern eine Atmosphäre oder Traumlandschaft.
Die graduelle Befreiung der Charkiw-Region beweist, dass wir niemand dem Feind überlassen. Sagt der ukrainische Präsident Volodymyr Zelenskyy der New York Times.
Vom System rannehmen lassen
Es gibt etliche Geschichten darüber, warum Menschen einsam sind. Die meisten haben mit Freiheit zu tun. Meine und deine und eure und unsere und die US-amerikanische Freiheit wird am Bildschirm verteidigt. In der U-Bahn laufen ständig Trailer von „Top Gun Maverick“. Tom Cruise spielt wieder mit, da ist er auch schon, wie er im Kampfjet-Cockpit plötzlich das Steuer nach oben reißt und dabei das Gesicht verzerrt. Dann eine Frau, die Liegestütze macht. Dann wieder Cruise, wie er mit seinen flachen Händen und nacktem Oberkörper ins bauchhohe Wasser schlägt und irgendetwas schreit.
Warum macht der sowas? Einen Propagandafilm über das soldatische Prinzip drehen, das gezieltes Töten von Feinden und danach den guten Fick mit einer wie er aussehenden Frau heroisiert? Vielleicht ist das ja richtig so. Vielleicht sollten alle nach Cruise‘ Chuzpe streben: unterwürfiger Sub sein, der sich gerne rannehmen lässt vom System, dem er Treue schwört.
Ich bin vor allem der Musik treu: der schönen, der hässlichen, der lauten und der leisen, der heftigen und der schmeichelnden, und allem dazwischen. Ich spiele ein zweistündiges DJ-Set im The Lot Radio in Brooklyn, beginne es mit dem Ethio-Jazz Klassiker „Tezeta“ von Mulatu Astatke, direkt gefolgt von einem brandneuen Tune von 400 Bliss, dem neuen Duo von Moor Mother und DJ Haram.
Zwischendurch laber‘ ich ins Mikrofon und hoffe, witzig, zumindest unterhaltsam zu sein. Zwei Stunden stehe ich alleine im Studio, ein kleiner Container, der mit Aufklebern und subkultureller Bedeutung aufgeladen ist, sende abstrakte Sounds, düstere Beats, Spoken Word in den anonymen Äther. Es kommt nichts zurück. Nur ein lila Herz via Instagram von einer Person, die ich nicht kenne und das ich erst später sehe und mit einem roten Herz beantworte.
Korreliert Zärtlichkeit mit der Quantität oder der Qualität von Emojis?
Die Musik im Studio: super laut. Als ich das Radio verlasse: extreme Stille. Den restlichen Tag verbringe ich mit der Aufnahme von Interviews mit Kulturschaffenden aus marginalisierten Communities und DIY-Szenen sowie Fieldrecordings.

Irgendwie aufgewühlt
Vorgestern 27 Likes für einen Post erhalten. Heute nur 3. In diesem Imbiss in Chinatown Manhattan, wo ich geniale Dumplings esse, weiß davon niemand. Für die Gäste bin ich nur physisch real, nicht digital. Das ist beruhigend.
Abends kehre ich zurück zu The Lot Radio. Die süße Person beim Empfang erzählte mir mittags, abends sei der Innenhof ein schöner Ort zum Abhängen. Ich weiß, was sie damit meinten. Auch ich habe keinen Bock mehr auf den choreografierten Dauerkonsum dieser Stadt. Allerdings ist es genauso laut, höre es schon von weitem, das grelle Konzert der Stimmen. Mittags war noch Stille, jetzt sind alle Tische belegt von all diesen schönen und linken und lässig gekleideten. Ihre Stimmen erzeugen diesen typischen Dauerlärm US-amerikanerischer Gesprächskultur: irgendwie aufgewühlt, irgendwie undynamisch, irgendwie immer gleich laut.
Ich glaube, ab 21.19 Uhr sind die Dramen des Alltags bereits austariert, Höhen und Tiefen planiert zu ausgemschmückten Erzählungen aus dem eigenen Alltag. Alle mit vollem Einsatz bei den Versuchen, ein Narrativ aufrechtzuerhalten. Ich sitze in einer Ecke, nippe am alkoholfreien Seltzer, sehe eine schöne Person und denke: Darüber will ich mit dir diskutieren und über deine tolle Trainingsjacke, auf der in großen Lettern Mountain Dew und mehrere Automarken steht und rechts neben mir isst ein Mann ein Plunderteilchen und trinkt Kaffee. Die Frau links neben mir ist ganz aufgerieben, als ihr Gegenüber erzählt, wo es überall schon aufgetreten ist, bei Lollapalooza und so weiter.
Ein Bro-Game
Nach 58 Minuten habe ich genug. Das Schweigen des Ichs im Gebrüll des Kollektivs. Ich gehe weiter. In einem Park, groß wie acht Fußballfelder und hell wie am Tag, spielen Leute Baseball. Wusste gar nicht, dass Baseball soviel herumstehen und am Arsch kratzen bedeutet. Meistens wird der geworfene Ball direkt gefangen oder nur so weit geschlagen, dass der eigene Spieler schon nach einer Station wieder stehen bleibt. Manchmal gelingt ein Schlag und es kommt kurz zu einem nervösen Gerenne und Gewerfe und Gebrülle. Ich glaube, Baseball ist ein Bro Game. Fast alle Spieler sind weiß und entsprechen den Normen eines Cis-Mannes.
Schnell woanders hin, in die Queer Bar, wo Regeln fluide und Normen temporär sind. Städte als Schule von Komplexität.
Tschüß.