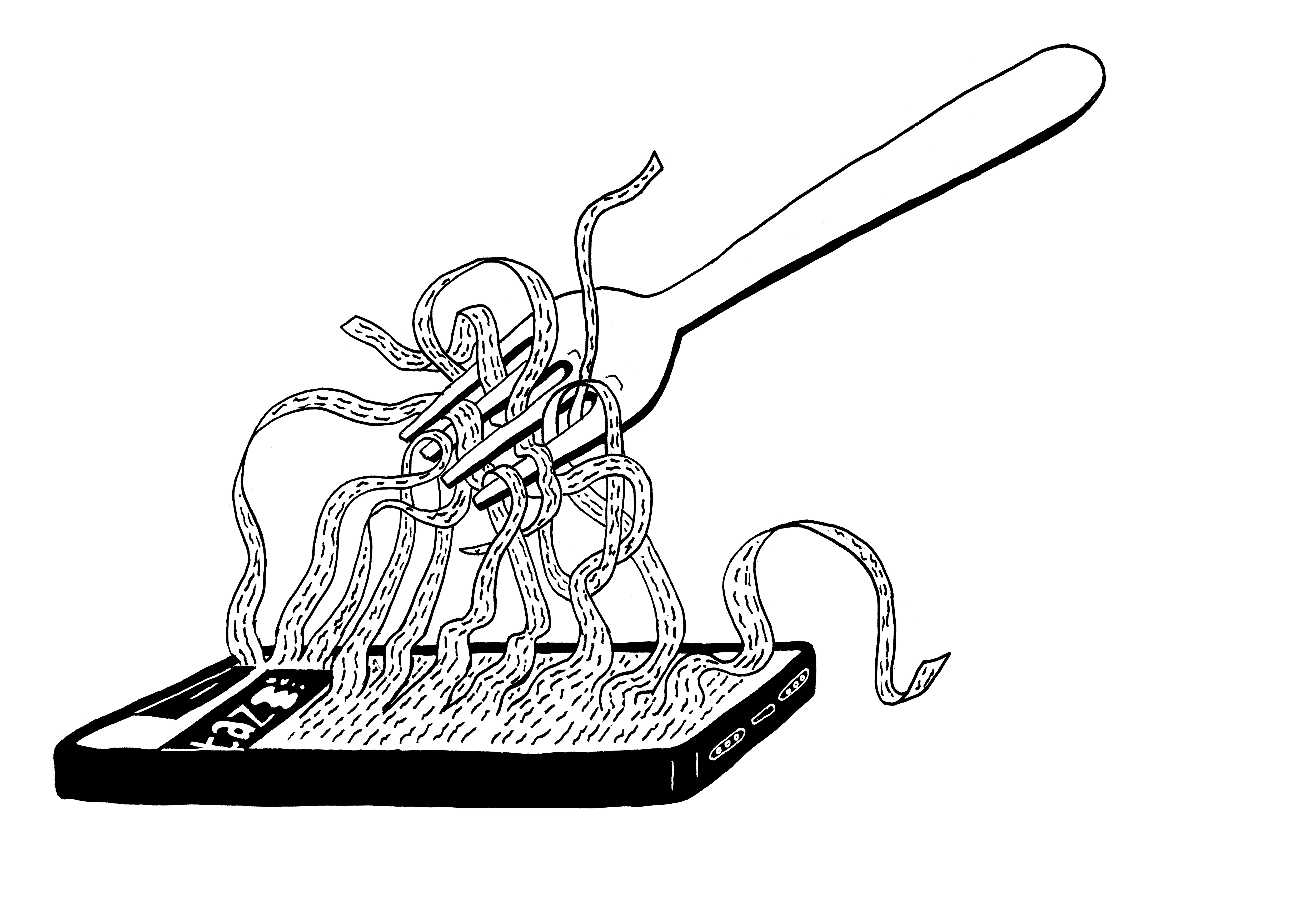Der Bär flattert in südöstlicher Richtung.
Am 4. November 2004 starb im Alter von 45 Jahren unsere Freundin Tine Plesch an einem septischen Schock. Tine war seit der im Jahr 2000 erschienenen ›Gender‹-Ausgabe Mitherausgeberin der Buchreihe ›Testcard‹ und arbeitete als Journalistin für das unabhängige Radio Z.
Tine Plesch, Women in Rock Music: Times, They Are A-Changing?
(Vortrag in Kassel im Rahmen von Pop und Mythos, 1999)
Moral,Politik und Popkultur sind ein schwieriges Geschäft. der eigene Weg findet sich an den crossroads, den Kreuzwegen: dort, wo Sex, Musik und kritisches Bewusstsein aufeinandertreffen. Wie also können sich Frauen in der Popkultur – ob als Konsumentinnen oder Produzentinnen – verorten?
Vor gut zwanzig Jahren hat sich die us-amerikanische Autorin und Professorin Ellen Willis, damals Journalistin für Musik und andere soziokulturelle Fragen bei der New Yorker Village Voice zu genau diesem Thema Gedanken gemacht.
Sie, die sich als politische Person, als Linke und als Feministin begriff, sah sich in Widersprüchen gefangen – zum Beispiel im Hinblick auf ihr Verhältnis zur feministischen Musikszene Ende der 70er:
„Warum gefiel mir so wenig Musik aus dem Bereich der Frauenkultur? Feministische Musik hatte zwei Tendenzen. Die eine war eine frauenspezifische Version politischen Folks mit allen Vorzügen und Schwächen dieses Genres: Einfachheit, Intimität, Gemeinschaftsgefühl, andererseits Sentimentalität, Phrasen, Engstirnigkeit. Die zweite Tendenz veranlasste mich vollends zum Weghören: glatte, technisch versiert gespielte Musik, von Rock beeinflusst, aber im Grunde konventionlle Popmusik. Anscheinend doch das Produkt einer abweichenden Kultur, schien mir diese Musik sich auf einer Ebene mit der Oberflächlichkeit der meisten weissen Popmusik zu befinden.“ [1]
Das weitaus schwierigere Problem war aber ihr Verhältnis zu Punk: Musik, in der Ellen Willis durchaus misogyne Tendenzen entdeckte – als wäre ein Publikum, das auch aus den sogenannten „einfachen Leuten“ bestehen sollte, mit Hilfe von frauenfeindlichen Sprüchen einfacher zu erobern. Und als Ellen Willis herauszufinden versuchte, ob „Bodies“ von den Sex Pistols ein Song gegen die Abtreibung war, entdeckte sie Schlimmeres:
„Es war ein Ausbruch von Ekel vor der menschlichen Physis, ein Ekel, der auf Frauen projiziert wurde, weil sie Kinder kriegen, Abtreibungen haben und „abstossend blutiges Chaos sind“ – der sich aber letztendlich gegen den Sänger selbst richtet: „Ich bin kein Tier,“ brüllt er in einer Geste sinnlosen Protests und seine eigenen tierischen Laute strafen ihn Lügen. Es war ein unerhörter Song, aber ich konnte ihn nicht einfach als grässlich abtun. Die extreme Position der Ablehnung zwang mich, mir einzugestehen, dass mir solche Gefühle nicht fremd waren – nur erkannte ich im Unterschied zu Jonny Rotten, dass der Ekel, nicht der Körper, der Feind war. Und genau da war der Widerspruch: Musik, die ihre Anliegen – Wünsche, Liebe, Hass – mutig und aggressiv vertrat, so wie das guter Rock´n´Roll tat, brachte mich dazu, das auch zu tun – auch wenn der Inhalt frauenfeindlich war, Sexualität verabscheute, in einem gewissen Sinn anti-menschlich war. Die Form aber machte mir Mut für meinen Kampf um Freiheit. Andererseits machte schüchterne Musik mich auch schüchtern, egal welche wichtige Politik sie verhandelte.“[2]
Ähnlichen Problemen mag eine begegnen, wenn sie sich beispielsweise die neue Iggy Pop-CD anhört, oder dem plüschigen Altherrencharme vom gar nicht so alten King Rocko Schamoni begegnet; wenn der Lieblingsclub zur Musik von wiederveröffentlichten, als superkultig geltenden Schulmädchen-Film-Soundtracks tanzt und gar noch Oben-Ohne-GoGo-Girls für Stimmung auf dem Tanzboden sorgen sollen oder wenn die beste Freundin in der Rockbitch-Sex-Bühnenshow freigesetzte sexuelle Energie und damit emanzipatorisches Potential sieht.
Was hat sich in 22 Jahren verändert?
Die von Willis angesprochene feministische Musik oder Musikszene, über die breit und öffentlich diskutiert wird, gibt es so auch in den USA nicht mehr. Labels wie Olivia Records oder Redwood Records, die sich während der heissen Phase der zweiten Frauenbewegung gegründet hatten, existieren zwar nach wie vor, aber wer immer auch dort veröffentlicht – wir in Europa erfahren es nicht, jedenfalls nicht über die uns allgemein zugänglichen Kanäle. Auch das Michigan Women´s Music Festival scheint wohl immer noch stattzufinden – aber, meinen Formulierungen ist anzumerken, wie vage meine Informationen sind. Es haben sich separatistische Strukturen etabliert, die zwar in sich zu überleben scheinen, in denen auch diskutiert wird – z.b. ob die Punkrockerinnen Tribe8 mit ihrer kathartischen Dildo-Kastrationsshow auftreten dürfen. Für die interessierte europäische Beobachterin ist diese Szene jedoch erstmal unzugänglich. Und kein noch so angesagte Popmagazin, das vor Bewußtsein und Style aus allen Nähten platzen möchte, findet eine Zeile für das ehemaligen Riot-Grrrl-Strukturen entstammende Ladyfest.
Ein Problem bleibt aber ironischerweise gleich: das, was auf den üblichen Frauendiscos, Frauenfesten für Heteras und Lesben an Musik gespielt wird, ist oft immer noch aus den von Ellen Willis genannten Gründen unanhörbar – auch wenn es sich gar nicht mehr um feministische Musik handelt, sondern um gnadenlosen Kommerz, der dieselbe alte Frage aufwirft: Handelt es sich hier noch um dissidente Kultur? Derweil schlägt die etablierte Lesben-Separationskultur zurück und wendet sich z.b. gegen musikalische Dissidentinnen in den eigenen Reihen.
Verändert haben sich in 22 Jahren vor allem zwei Dinge:
1. Der sexuelle Befreiungsaspekt von Rockmusik hat durch die Diskussion sexueller Machtverhältnisse an Attraktivität verloren und sich spätestens mit Aids vollends erledigt. (Da helfen auch die selbsternannten Befreierinnen geknechteter weiblicher Sexualität namens Rockbitch nichts – nur Peaches löst mit ihrer Mischung aus Trash-Funk plus Sex´n´Roll dieser Tage im Herbst 2000, da ich diesen Aufsatz durchsehe, allenthalben Begeisterung über die zur Show getragene Sexyness aus. Aber mensch muss wohl ein Konzert sehen, um Peaches wahrhaft zu würdigen. Allzuviele Bilder in Magazinen, die sich, wie das CD-Cover, auf die Gürtellinie konzentrieren, sprechen derweil für sich…) Während Frauen entweder ihren Weg durch die traditionellen Bilder machen oder versuchen, neue zu erfinden, z.B. Girls werden, sind auf der Männerseite klinisch saubere Boygroups zu finden, seltsame Schlagersänger, und unprätentiöse Jungs mit bravem Kurzhaarschnitt und karierten Hemden, die mit ernsten Mienen an elektronischem Gerät rumpfriemeln. Von düsterer bis lächerlicher Faszination unter diesem Aspekt sind allenfalls noch Gangsterrapper und gothic/dark wave-Anhänger, während eine in allen Bereichen entmystifizierte, veräusserlichte Sexualität zum inszenierten Akt verkommt.
2. Feminismus ist ein Schimpfwort geworden, mit dem sich Frauen, egal ob auf oder vor der Bühne, nicht identifizieren mögen. In Vergessenheit gerät dabei leider die Diskussion der 80er/90er unter Feministinnen, die aus dem Unsinn eines einheitlichen Feminismus-Begriffs, der hauptsächlich von weissen bürgerlichen Heteras geprägt worden war, durchaus differentes geschaffen hatte. Abgesehen davon, dass es jeder frau freisteht, sich vom Feminismus etwas mitzunehmen, ihn eigenständig zu interpretieren. In gewissem Sinne ist dies auch geschehen, genauso wie alle von den Errungenschaften des Feminismus zehren, sie als selbstverständlich ansehen, ohne sie als feministisch benennen zu wollen.
Judith Butlers Begriff von Gender, also sozialem (!) Geschlecht als Konstrukt (i.e. willkürlich und damit veränderbar) bot neben einer bedenkenswerten Theorie eine schöne Spielweise, auf der sich allerlei intellektuelle Männer und Frauen tummelten – an Politik und Praxis änderte sich jedoch wenig, was nicht nur an Butler liegt, sondern daran, dass Abstraktion und alltägliche Arbeit zwei Dinge sind. Ausserdem schien auf Diskurssebene und in Magazinartikel, die die eine oder andere taffe Businesswoman featureten, das Spiel schon gewonnen – dass das wahre Leben mal wieder nicht hinterherkam, entging den Diskutierenden.
Diffamiert als anachronistischer Kampfbegriff humorloser, zwanghaft ungeschminkter, möglichst lesbischer Frauen in lila Latzhosen verschwand der Feminismus in der Versenkung entnervender Diskussionen. Leider – oder typischerweise – wurden ausgerechnet die Hardcore-Separatistinnen bzw. jene, die allen andern besonders gerne Vorschriften für korrektes feministisches Denken, Verhalten und Aussehen machen wollten, als Feministinnen und damit als Vertreterinnen des wadenbeissenden Bösen ausgemacht, mit dem tolerante und am Weiterdenken interessierte Frauen und Männer nix am Hut haben wollen. Vom Feminismus übrig blieb in den Augen der Allgemeinheit ein politisch verbrämter Rigorismus, der einer Zensur sehr nahe ist und mehr an die Erziehungsmethoden gestrenger Eltern in den 50er Jahren erinnert.
Einige der von mir als höchst schwierig empfundenen Diskussionen der letzten Jahre – z.B. über Katharina-Rutschky-und-Wiglaf-Droste-und-Kindesmissbrauch – zwischen Feministinnen, Linken, Autonomen und Undogmatischen, Subkultur-Veranstaltern usf. führe ich auch darauf zurück, dass die Rebellion gegen bürgerliche Enge, Moral und Konvention der 60er und frühen 70er und eben auch die sexuelle Rebellion zum Teil gar nicht mehr nachvollziehbar sind – und wenn sich ihrer innerhalb der Linken erinnert wird, dann als oft genug politische Geschichte – also Rudi Dutschke und die RAF, während die emotionalen Aspekte vergessen sind. Bei älteren 68ern fällt zuweilen ein Hautgout aus Misogynie und Sexismus auf…
Was vom Feminismus blieb, war oft genug hausbacken und angestrengt, hiess hinsetzen bei Konzerten und bitte keine laute Band und keinen fetten Bass, nannte sich „Frauen machen Musik“ (ach, können die das auch?!), und orientierte sich zum Teil stark an kapitalpatriarchalen Vorgaben, ohne es zu merken: Frauen machen jetzt auch im Mainstream-Musikgeschäft mit. Und das fast ganz oben! Toll!
Nur cool war das nicht – es war vielmehr weitab vom sonstigen Geschehen in der . alternativen, nicht rein kommerziellen – Musikszene.
Daran haben auch Riot Grrrl und die kurzfristige Regenbogenkoalition aus Heteras, Lesben und Punk-infizierten schrabbeligen Gitarren mit ganz klar frauenidentifizierten und frauenspezifischen Anliegen nichts geändert. Interessant ist, wie schnell Riot Grrrl wieder vom Erdboden bzw. aus den Seiten der Popzeitschriften verschwand: Allerdings hatten die Beteiligten selbst einen Pressebann ausgerufen, da allzuviele Informationen verfälscht wiedergegeben wurden, Vertrauen missbraucht wurde oder die Berichterstattung nur allzu vertrauten Konventionen folgte, d..h. die Mode in den Vordergrund stellte oder Anführerinnen suchte, die es nicht gab.
Die Riot Grrrls hatten es geschafft, ihre Bewegung in der Subkulturebene zu halten. Trotz einiger interessanter Versuche neuer Strategien im Umgang mit den Mainstream-Medien war es ihnen dennoch nicht gelungen, per Ausschluss die Kontrolle über die Berichterstattung zu behalten. Norma Coates meint dazu:
„Indem Riot Grrrl in der Subkultur verankert blieb, behielten die Riot Grrrls eine gewisse Kontrolle über das Selbstverständnis der Bewegung. Aber die Konsequenz ist Kontrollverlust über die Darstellung in genau den Medien, die sie meiden. Durch den Verlust der Kontrolle über die eigene Repräsentation verstärken sie letztlich ihre Positionierung an den geschlechterdefinierten Rändern der Rockmusik – und damit auch die anderer Musikerinnen.“[3]
Die Mainstreampresse schrieb also, was sie wollte und dann schrieb sie nichts mehr. Die Bands haben sich inzwischen aufgelöst bzw. neu formiert und veröffentlichen nach wie vor Tonträger, die durchaus zugänglich sind. Symptomatisch erscheint, dass allenfalls Sleater Kinney als einzige überlebende Band auf einem grösseren Indie-Label (Matador) auf Interesse stösst. Auch Le Tigre, das neue Projekt der Videokünstlerin Sadie Benning, der Graphik-Künstlerin Joanna Fateman und der Ex-Bikini Kill Musikerin Kathleen Hannah, macht in vielen Musikmagazinen die Runde. Die Team Dresch Nachfolge-Bands The New Team Dresch Version Beta 5 und The Butchies werden ebenso totgeschwiegen wie die Sleater Kinney Seitenprojekte The Subdebs und Cadallaca.
Anlass zur einen oder anderen Diskussion bot da dann eher die als Band firmierende Sex-Showtruppe Rockbitch – die zum Teil ernster genommen wurde, als sie es meiner Meinung nach verdient haben: Letztlich geht es Rock Bitch genau wie den zeitweise als Power Girlies apostrophierten Spice Girls nur um´s clevere Absahnen in einer kapitalistischen Welt („Keep on fucking in a free world…“). Mit irgendeiner Variante feministischer Denkweisen hat beides nichts zu tun: Während die Spice Girls der Beweis dafür waren, dass Anpassung ans patriarchal-kapitalistische Modell schlicht lohnend ist, liessen uns Rock Bitch immerhin noch einmal einen Blick in den Abgrund jener real existierenden Doppelmoral werfen, die wir längst in einer Parallelwelt geglaubt hatten: Polizeikordons und kirchliche Kanzelworte gegen eine Show, die sich nicht gross von dem unterscheidet, was kommerzielle Fernsehkanäle in Talkshows besprechen lassen oder nächtens an Filmen darbieten. (Eine Doppelmoral übrigens auch, die letztlich zur Demontage der bundesdeutschen Spicegirls Tic Tac Toe führte)
Nicht, dass wir uns falsch verstehen: Subversiv ist das Sexspektakel m.e. nicht, das Rock Bitch liefern, die sich übrigens darauf berufen, die wahren Überlebenden rebellischer Sex´n´Drugs´n´Rock´n´Roll-Zeiten zu sein. Ob die sexuelle Selbstbestimmung von Frauen darüber erfolgen kann, dass Frauen auf einer Bühne vögeln, pinkeln, faustficken etc. und nebenher noch gar nicht mal so schlechten Hardrock spielen – nun, das muss jede/r selbst herausfinden. Abgesehen davon ist es in einem mir vorliegenden Interview (das von der Zeitung, die es in Auftrag gegeben hatte, nicht veröffentlicht wurde, da der Zeitung dann auffiel, dass sie eine Familienzeitung sei…) das einzige männliche Bandmitglied, das sich ausführlich über vornehmlich weibliche Sexualität auslässt….
„Sex sells“ heisst ein alter Spruch und wie sagte es einst der Manager von East 17: „Schliesslich sind wir nicht im Musikgeschäft, sondern im Sexgeschäft tätig.“
Nun gut, denkt ihr: a) Warum soll Feminismus unbedingt an einen linken Diskurs gebunden sein – ist es nicht okay, wenn wenigstens einige wenig Frauen teilhaben am allzu ungleich verteilten Reichtum dieser Welt? Nun, in gewisser Hinsicht ist dagegen nichts einzuwenden, doch für diese Position bin ich als eingeschworene Vertreterin von Subkultur die verkehrte Person.
Oder ihr denkt b) Mit dieser Welt des Kommerz und deren Frauenfeindlichkeit haben wir doch gar nichts zu schaffen, bei uns im Indie-Pop-Diskurs, in der Hamburger Schule, in der Club-Szene – da sieht´s doch ganz anders aus. So anders, wie z.b. in Sarah Khans Roman „Gogo Girl“, in dem die Frauen in der Indie-Popwelt genau da verortet sind, wo sie meistens wirklich vorkommen: Hinterm Tresen, an der Kasse, beim Merchandising – defacto in korrekt ironischer Übertreibung als Gogo Girls. Die Schulbank der Hamburger Schule hat wahrlich fast keine Frau gedrückt (Die Braut haut ins Auge werden hier nicht eingeordnet, Luka Skywalker wird wenn, dann mittlerweise als DJ rezipiert und Elena Lange von Stella/TGV wurde zumindest anlässlich der DebutCD von vielen Meinungsmachenden als Hype empfunden). Auch in der vieldiskutierten bundesdeutschen Hiphopszene – ob Spass oder politsch – ist fast keine Rapperin zu finden. Was in entsprechenden Artikeln in fortschrittlichen Popmagazinen auch niemanden interessiert. (Cora E. und Aziza A oder Brixx werden, wenn, als Ausnahmen, als eigene Topics diskutiert, nicht als Teil einer Szene).
Die Soziologin Angela McRobbie stellte 1994 anhand der Durchsicht von Teen-Magazinen allerdings auch fest, dass bestimmte, gerade in diesen Magazinen konstruierte/verstärkte Bedeutungen wie z.b. die Verbindung/Gleichsetzung von „Weiblichkeit“ mit „Romanze/Liebesgeschichte“ sich aufzulösen beginnen und „Weiblichkeit“ nicht mehr das direkte Gegenteil von „Feminismus“ sei: etliche, via Feminismus erkämpfte Errungenschaften und Gefühlsstrukturen seien in dieses neue Verständnis von Weiblichkeit eingeflossen. Allerdings existiere dieses neue Verständnis immer noch innerhalb einer vom Konsum geprägten Kultur. [4]
In der Rave Nation hat sich laut McRobbie trotz dieser Veränderungen, trotz Aufweichung von Macho-Verhalten und trotz nicht-sexueller Konnotation nackter Körper die Arbeitsteilung der Geschlechter mitsamt recht konventionellen Schönheitsanforderungen erhalten.
„Die Organisatoren von Raves … sind meist älter, männlich und haben Erfahrung mit Promotionarbeit; oft haben sie als DJs in kleinen Clubs oder bei illegalen Radios angefangen. Ihre Freundinnen helfen an der Kasse, hinter der Bar oder sie machen Promotion, indem sie Flyer in Clubs verteilen. Die Ravekultur reproduziert dieselbe Arbeitsteilung der Geschlechter, wie sie nicht nur in der Popindustrie üblich ist, sondern in den meisten Arbeits- und Angestelltenverhältnissen.“[5]
1992 noch wurde in der britischen Zeitschrift New Musical Express diskutiert, ob Musikerinnen in der Jungswelt Rockmusik überhaupt einen Platz finden könnten oder ob sie nicht unausweichlich in eine marginalisierte Rolle hineindefiniert würden. Weshalb, so ein Diskussionsteilnehmer, sie lieber in der Welt eigener Strukturen bleiben sollten. Wohin das führte, haben wir ja am Medienumgang mit Riot Grrrl gesehen.
In ihrem 1995 erschienenen Buch The Sex Revolts – Gender, Rebellion and Rock´n´Roll[6] stellten Joy Press und Simon Reynolds gleichfalls fest, dass die musikalischen Unterströmungen interessanter sind: da, wo sich unter dem Gewand der Freiheit und Revolte die reaktionären Haltungen verbergen, die subtileren Frauenfeindlichkeiten, die Komplizenschaft der Rebellen mit dem Patriarchat – und all das findet sich bei Iggy Pop wie bei Mick Jagger, bei Nick Cave wie bei Blixa Bargeld. Das heisst nicht, dass deren Musik deshalb keinen Reiz hätte – ihre Attraktion liege gerade in der psychosexuellen Dynamik des Ausbruchs, einem Protest gegen einengende Konventionen der bürgerlichen Gesellschaft, der sehr wohl in frauenfeindliche Haltungen und Handlungen münden kann. Die Energie der Musik kann mann oder frau trotzdem geniessen: entweder ohne sich der Unterströmungen bewusst zu sein – oder ohne dieser Unterströmung zuzustimmen.
Womit wir einerseits wieder bei der eingangs zitierten Ellen Willis sind und uns aber auch Norma Coates zuwenden können, die ihren 1997 erschienenen Essay „(R)evolution now? – Rock and the Political Potential of Gender“ mit den Worten beginnt „The Rolling Stones trouble me“ und sich folglich fragt, ob der Klang der Rebellion phallisch codiert ist. „Es geht darum, die Vorstellung von Rockmusik als Gender-Technologie zu untersuchen, die in der und durch die Rockformation „Männlichkeit“ konstruiert.“[7]
Coates verweist darauf, dass Rockmusik als „authentisch“ gelte, während Popmusik der Ruf des „Künstlichen“ anhafte. Als Folge werde „Rock“ als männlich“, Pop als „weiblich“ aufgefasst.
Zwischendrin bemerkt: Die Pop-als-Medium-politischer-Subversion-Diskussion Anfang der 80er hat den Pop zwar intellektualisiert, sich aber bezeichnenderweise nicht grundlegend mit den Geschlechtercodierungen befasst. Jochen Distelmeyer benutzte in einem Interview mit der Vfn. diese binäre Aufteilung übrigens als Argument in der Auseinandersetzung um die Pop-Melodien der letzten Blumfeld-CD „old nobody“. Die weiche, poporientierte Musik des neuen Albums sei eben nicht „hart, authentisch, mackerhaft“…..
Ob nun Label wie „angry young women“ für rockende Musikerinnen benutzt werden oder ob Liz Phair nach Erscheinen ihres Albums Exile in Guyville zumindest visuell sofort auf ihren Platz verwiesen werden musste, indem sie auf dem Cover des Rolling Stone nur mit einem winzigen blauen Slip bekleidet abgebildet wurde, in weiches Licht getaucht, das bei den potentiellen Käufern (Käuferinnen?) der Zeitschrift eher pornographische Assoziationen hervorrufen sollte. Hier schlägt jeweils die Maschinerie der konventionellen Bilder zu, marginalisiert oder vereinnahmt die Künstlerinnen unter altbekannten Vorzeichen.
Dies ruft das bereits zitierte Argument aus der Diskussion im New Musical Express ins Gedächtnis, dass es für Frauen in der Rockmusik eben keinen Platz gebe.
Interessanterweise wird – ausser in Fachzeitschriften und da nicht immer frei von altbekannten Sexismen über Frauen im Heavy Metal ganz und gar kein Wort verloren. Da Heavy Metal als unpolitisches, oft konservatives und generell diskursfeindliches Gebiet gilt, ist das einerseits kaum verwunderlich, andererseits treffen die Musikerinnen auf ganz ähnliche Probleme wie anderswo in der rocking free world: wie z.b. die Gitarristin Jennifer Batten, die bei diversen Heavy Metal Bands einsteigen wollte, jedesmal nicht etwa wegen mangelnden Könnens, sondern wegen ihres Geschlechts abgelehnt wurde und die mittlerweile in Michael Jacksons Truppe mitspielt. Diese Musikerinnen völlig aussen vor zulassen, erscheint mir ziemlich arrogant.
In der vom Frankfurter Frauenmusikbüro herausgegebenen Musikzeitschrift Melodiva (derzeit als Printmedium bis auf Sonderausgaben eingestellt) wurde unlängst der Begriff „Frauenband“ diskutiert: vielen Musikerinnen erscheint er als überflüssig, als Zuweisung, die nicht in ihrem Sinne ist, da z.b. als „feministisch“ überpolitisiert, als Bonus – ich beachte diese Band nur, weil sie aus Frauen besteht, nicht weil mir ihre Musik gefällt – oder Malus – für Frauen spielen die ja echt gut! – ; ein Begriff also, der mit dem tatsächlichen Können der Musikerinnen ebensowenig zu tun hat wie mit dem Musikgenre, dem die „Frauenband“ sich verschrieben hat. Musik wird so in unzulässiger Weise als gleichsam geschlechtliche Verlängerung definiert und damit werden auch Auftrittschancen manipuliert („ihr könnt am Frauentag hier spielen“). Eine von vier befragten Autorinnen plädierte für die Beibehaltung des Wortes Frauenband als notwendigen Kennzeichnungs- und Kampfbegriff.
Norma Coates plädiert – entgegen eventuellen Erwartungen – dafür, Bezeichnungen wie „Women in Rock“ als übertreibende Marker im Sinne einer politischen Nützlichkeit weiterzuverwenden, um Rockmusik als umkämpften Bereich darzustellen, um die Musikerinnen überhaupt in die Rockmusik hineinzuschreiben, und um bestimmte Fragen weiter zu stellen: Warum heisst es nicht „Männer in der Rockmusik“? Warum sprechen wir extra von Frauen? Meint „Frauen in der Rockmusik“ nur die Musikerinnen oder alle, die im Business tätig sind? Was heisst Frauen in Bezug auf Rockmusik? Etc.
Die Frauen müssten genannt werden, um nicht hinter unsichtbaren Grenzen zu verschwinden, Fragen destabilisierten letztlich die Geschlechtercodierung der Rockmusik, meint Coates: Nennen wir sie nicht, verstärken wir nur die unausgesprochene, quasi natürliche Wahrnehmung von Rockmusik als männlich. Women in Rock – die Musikerinnen, das Publikum, die Journalistinnen, die Promoterinnen, die Artists & Repertoire Managerinnen, die Technikerinnen und Theoretikerinnen – können den Ausdruck „Women in Rock“ benutzen, um die Frauen in die Rockmusik hineinzuschreiben.
Vielleicht erscheint dieses Argument unerwartet in einer Zeit, in der auch engagierte Frauen das böse F-Wort nicht in den Mund nehmen: mit einem Feminismus, der die zu Beginn angedeuteten Bedeutungen angenommen hat (Männerhass habe ich, glaube ich, vergessen zu nennen) wollen auch Frauen nicht allzu innig in Verbindung gebracht werden, die sonst durchaus deutliche Statements abgeben wie das folgende:
„Unsere männlichen Mitmusiker halten ihre Bands nach wie vor streng monogeschlechtlich, und so herrscht in der Popkultur ein ähnlich ausgewogenens Geschlechterverhältnis wie in der KFZ-Meisterinnung und in der Astronautenszene. Es muss endlich den letzten „Indie-Kavalieren“ und superaufgeklärten Popkulturspezialisten ein seltsames Gefühl beschleichen, wenn er bei den wichtigsten Dingen des Lebens immer nur von männlichen Kumpels umgeben ist, er muss endlich merken, dass mit ihm etwas nicht stimmt, nicht mit den Frauen, die es in seiner Szene angeblich nicht gibt.“ [8]
Jede Musikerin vom Sampler „Stolz und Vorurteil“, mit der ich gesprochen habe, steht hinter den oben zitierten Worten; aber keine möchte mit dem Begriff Feminismus in allzu enge Verbindung gebracht werden. Er steht im Verständnis dieser Musikerinnen für engstirnige, verbissene, männerausschliessende Intoleranz, und damit der Freiheit künstlerischer Arbeit entgegen. Sich feministisch zu nennen würde auch bedeuten, dass die Musik unter diesem Aspekt rezipiert werden würde, die Musikerinnen nicht als Musikerinnen ernstgenommen werden und das wäre eine weitere Einengung. Gleichzeitig, das geht wohl nicht, um es frei nach Max Goldt zu sagen.
Hinter den wenigen supererfolgreichen Frauen im Musikgeschäft – Madonna, Tina Turner etc. – stehen viele Musikerinnen, die kaum Beachtung finden. Die Tatsache, dass es 1997 mehr weibliche als männliche Interpreten in die Charts geschafft haben, mag als Zeichen gewertet werden, ist aber m.E. nicht unbedingt ein Indikator realer Veränderung. Dazu müssten wir die Songs und die Images der Bands – oder sind es eher Sängerinnen? – unter die Lupe nehmen. Während die einen „neue Frauenpower“ mit Tori Amos, Amanda Marshall, Meredith Brooks und Alanis Morrissette feiern, beurteilt die Musikjournalistin Ann Powers genau diese Entwicklung negativ: mit dem Erfolg dieser Musikerinnen, die eher romantische Liedermacherinnen seien, sei auch die Zeit der aggressiven lauten Frauenrockbands vorbei. Touché: für die neuen Alben von L7 oder den Lunachicks interessiert sich wirklich niemand und wann haben wir als letztes etwas von Babes in Toyland gehört?
Ein Fazit gibt es nicht, denn die Frauen in der Musik verorten sich m.E. fest zwischen den Stühlen: zwischen dem Willen zur Veränderung und der verweigerung starrer Rigorismen, zwischen Spass an der jeweils interessanten Musik und Analyse der Widersprüche, zwischen Innen und Aussen, ohne tragfähige eigene Strukturen und ohne feste Verankerung in der etablierten Presse zwischen „mainstream“ und „alternative“: aber mit vielen engagierten Einzelnen. Um nochmal Norma Coates zu zitieren: Es ist notwendig, die Frauen in die Musik hineinzuschreiben, um festgefügte Bedeutungen aufzubrechen, den Männerclub Musik in Frage zu stellen – aber ohne in die alten Muster zu verfallen: d.h. auch der Begriff „Frau“ muss geöffnet werden, durchlässig gemacht werden und darf nie unreflektiert benutzt werden.
Weitermachen ist angesagt: den Blick fest auf die bestehenden Verhältnisse gerichtet, aber auch in die Vergangenheit, denn das Wissen um die immer noch nur bruchstückhaft zugängliche Geschichte der Frauen in der Musik, ein gewisser Hauch von Kontinuität erleichtert vielleicht den Weg in die Zukunft.
[1] „Why did I like so little of of the women´s culture music I had heard? The feminist music had two tendencies. One was a women´s version of political folk music, which replicated all the virtues (simplicity, intimacy, community) and all the faults (sentimentality, insularity, heavy rhetoric) of the genre. … The other tendency actively turned me off: it was a slick, technically accomplished, rock influenced but basically conventional pop. … Supposedly the product of a dissident culture, it struck me as altogether compatible with the blandness of most white pop music.“
in: Ellen Willis, „Beginning to see the Light“, in: „Beginning To See The Light“, 1992, S. 89ff
Alle Übersetzungen v.d. Vfn.
[2] „It was an outburst of loathing for human physicality, a loathing projected onto women because they have babies and abortions and are a ‚fucking bloody mess‘ but finally recoiling against the singer himself: ‚I´m not an animal!‘ he bellowed in useless protest, his own animal sounds giving him the lie. It was an outrageous song, yet I could not simply dismiss it with outrage. The extremity of it disgust forced me to admit that I was no stranger to such feelings – though unlike Johnny Rotten I recognized that the disgust, not the body, was the enemy. And there lay the paradox: music that boldly and aggressively laid out what the singer wanted, loved, hated – as good rock´n´roll did – challenged me to do the same, and so, even when the content was anti woman, antisexual, in a sense antihuman, the form encouraged my struggle for liberation. Similarly timid music made me timid, whatever ist ostensible politics.“ op.cit.
[3] „….the movement [was left] willingly and willfully subcultural. Although in doing so riot grrrls themselves retain some control over self-definition of the movement, this strategy ultimately results in a loss of control over representation of the movement in exactly those mainstream publications that they avoid. By losing control over their own representation, they thus reinforce their, and by association, other women´s position on the gendered margins of rock. „
Norma Coates. (R )Evolution Now? Rock and the political potential of gender. In: Sheila Whiteley ed. „Sexing the Groove“, London, Routledge, 1997. S. 55.
[4] Angela McRobbie, Shut Up + Dance, in McRobbie, „Postmodernism & Popular Culture“, 1994
[5] „Rave organizers …tend to be older, male and with some experience in club promotion, often starting as DJs in smaller clubs and in illegal radio stations. Girlfriends help on the till, work behind the bar, or else do ‚pr‘ by going round pubs distributing flyers. The rave culture industry thereby reproduces the same sexual division of labour which exists not just in the pop industry but in most other types of work and enployment.“ In: Mc Robbie, 1994, S. 170
[6] Joy Press/Simon Reynolds. The Sex Revolts – Gender, Rebellion and Rock´n´Roll. Serpent´s Tail, 1995
[7] „to consider rock´s role as a technology of gender, one which constructs „masculinity“ in and by the rock formation“, Coates, op. cit., S. 52
[8] Christiane Rösinger, Beiheft zum Sampler „Stolz und Vorurteil“, Flittchen Rcords, 1999