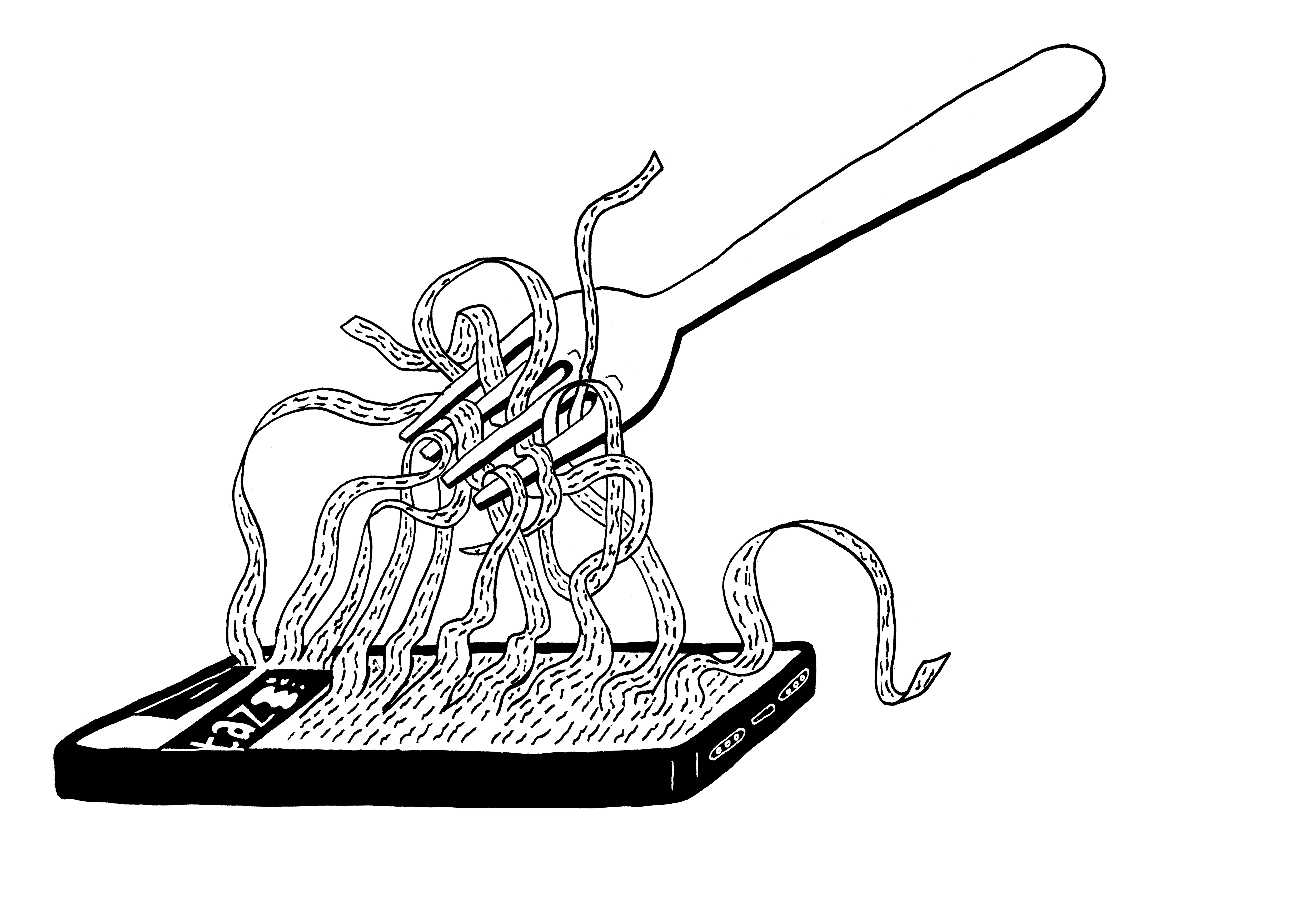Der Bär flattert in nordöstlicher Richtung.
2. Teil: Vom Einfachen, das schwer zu machen ist
Götz von Olenhusen: Haben wir nicht gestern gelernt, daß 1968 und MÄRZ die Geburtsstunde der Postmoderne gewesen sind?
Schröder: Der literarischen Postmoderne. Die Postmoderne ist inzwischen ein weites Feld und im wesentlichen schon Historie. Die Begriffskarriere des Wortes hat sich in der Realität, um bei der Architektur zu bleiben, zu Fassadenzuckerbäckereien zerlaufen und so auch in der Literatur. Tatsächlich ist der Begriff von Leslie Fiedler zum ersten Mal im Freiburger Symposium …
Götz von Olenhusen: … ‚Für und wider die zeitgenössische Literatur‘ am 29./30.Juni 1968 in der Alten Universität mit Erich Heller, Peter Heller, Leslie A. Fiedler, Reinhard Baumgart, Hilde Domin, Hans-Werner Cohen und Martin Walser …
Schröder: … benutzt worden als Begriff, und damit hat er die Erweiterung von Literatur gemeint über den traditionellen Kanon hinaus. Erweiterung auf andere Felder wie Comics, Musik und das, was man gemeinhin Trivialliteratur nannte. So hat das Leslie Fiedler definiert. Insofern ist der MÄRZ Verlag, weil er solche Autoren verlegte, die man postmoderne nennen kann, weil er dieser Haltung gefolgt ist, der erste deutsche Verlag der Postmoderne und ist auch der letzte geblieben. Denn es gibt keinen anderen, der so gearbeitet hat, und auch soviel Glück hatte. Ein Verleger ist ja auch angewiesen auf Leute, die einem solche Sachen ins Haus bringen. Die muß er finden, Leute wie Brinkmann und Rygulla, die solch ein Bewußtsein transportieren. 1969 haben sie dann ‚ACID‘, die große Anthologie der Postmoderne, herausgegeben, in der bereits etablierte Namen wie William S. Burroughs, Frank O’Hara, Leslie A. Fiedler, Seymor Krim, Marshall McLuhan, Parker Tyler, Andy Warhol und Frank Zappa neben circa fünfzig unbekannten aus der neuen amerikanischen Szene auftauchten, darunter Joe Brainard, Charles Bukowski, John Giorno, Gerard Malanga, Harry Mathews, Ed Sanders und Anne Waldmann. Brinkmann und Rygulla brachten das an, ich habe sie gewähren lassen, und nicht zu vergessen: Man braucht als Verleger ja auch die Kohle! Die machten wir mit Pornographie. Das darf nicht unterschlagen werden, in das weite Spektrum der Postmoderne gehört für Leslie Fiedler auch Pornographie. Aber das ist ein anderes weites Feld, das können wir jetzt nicht auch noch beackern. Sicher ist, es gibt gute Leute, auch heute noch, und ein guter Verleger muß solche Autoren gewähren lassen, ihnen Möglichkeiten bieten.
Götz von Olenhusen: In einem Vortrag gestern ist der Bogen sehr weit gezogen worden, angefangen von Marx über Nietzsche bis hin zu noch anderen Göttern und Halbgöttern, ich weiß nicht bis hin zu wem noch alles?
Schröder: Das kommt daher, weil wir beide hinter dem Vortragenden auf der Bühne saßen, da haben wir nicht alles mitgekriegt.
Götz von Olenhusen: Doch! Das apollinische Prinzip, davon war die Rede …
Schröder: Nietzsche und das apollinische Prinzip? Ich glaube, ich höre wirklich auf dem einen Ohr nicht mehr gut. Spaß beiseite. Wir sprachen eben über Brinkmann, der war Avantgardist, auch im Negativen. Er hat das sehr deutsche Wutbuch ‚Rom, Blicke‘ geschrieben, in dem er einen halbverdauten Nietzsche präsentierte, womit man Nietzsche Unrecht tut. Dennoch war das innovativ, hier findest du Positionen, die später Botho Strauß einnahm, wohin sich auch Handke potentiell entwickelte. Also ich weiß nicht, ob man Brinkmann dafür loben soll? Beliebig ist dieses ‚den Eimer einfach drunter halten‘ ja auch nicht, wenn man schon mal bei dem Bild bleibt, unters Euter oder ein Stück weiter hinten.
Götz von Olenhusen: Zu ‚Schröder erzählt‘: Das ist konzipiert als Serie, alle drei Monate von den Aficionados sehnlichst erwartet, als Fortpflanzung von ‚Siegfried‘ sozusagen, mit einer ganz eigenen literarischen Machart und Qualität — sei es nun autobiographie romancée oder literatursoziologisches Sachbuch. Wird das einmal enden? Und was kommt danach?
Schröder: Die laufende Serie endet mit der vierzigsten Folge. So war es von Anfang an konzipiert, bevor wir mit der ersten Folge ‚Glückspilze‘ anfingen. Und zwar nicht beliebig, weil vierzig so eine schöne Zahl ist, sondern weil Barbara und ich ein Konzept hatten, entwickelt an der Chronologie des autobiographischen Materials, das bis ins Jahr 2000 reichen wird. An diese autobiographischen Geschichten sind Aktualitäten und Assoziationen angeklammert, die beim Erzählen entstehen. Das ist der Grund, warum wir den Fron dieser Tonband-Abschreibe-Arbeit noch auf uns nehmen. Denn du mußt wissen, zwischen erster Fassung und den diversen Redaktionen besteht inzwischen ein Verhältnis 1 : 10. Das heißt, jeder Folge mit fünfzig Seiten gehen sechshundert Seiten Manuskriptzustände voraus, die Barbara und ich redigiert haben. Deswegen lesen sich die Texte auch anders als zum Beispiel ‚Siegfried‘ — das Buch wurde im Verhältnis 1 : 1 produziert. Eine Haltung, die man damals so hatte, dokumentarisch, man erzählte, schrieb es ab und Schluß. So wie ich damals ‚Siegfried‘ Ernst Herhaus erzählte, so erzähle ich es immer noch Barbara, neben uns steht das Tonband, insofern also kein Unterschied. Dann aber werden die Bänder abgeschrieben, und es folgt diese mühselige Bearbeitung. Wenn der Text dann fertig ist, liest er sich so, als sei er gerade frisch erzählt worden. Es ist halt immer wieder das alte Lied vom Einfachen, das schwer zu machen ist. Diese Technik des Erzählens, obwohl sie mühselig ist, hat sich für uns als sinnvoller erwiesen, als sich gleich vor den PC, die Schreibmaschine oder das leere Blatt Papier zu setzen und die Geschichte runterzuschreiben. Denn bei der Verfertigung der Gedanken beim Reden entsteht mehr assoziatives Material, als wenn du schreibst. Ich will jetzt nicht das Sprechen und Schreiben gegeneinander in Konkurrenz setzen, aber für uns ist diese Methode die bessere. Ich merke immer wieder, daß mir beim Reden viele Formulierungen und Assoziationen einfallen, die sonst nicht aufs Papier gekommen wären. Und was das Ende von ‚Schröder erzählt‘ angeht: Wenn wir noch alle Sinne beisammen haben, werden wir mit der vierzigsten Folge nicht aufhören, sondern danach etwas äußerlich und inhaltlich sehr Ähnliches machen, nur die Gewichtungen im Text werden sich ändern. Laß dich überraschen! Aber es ist ja auch schön für die Subskribenten und für uns, daß wir irgendwann mal sagen können: Jetzt hören wir mit vierzig Folgen auf und fangen bei eins wieder an.
Götz von Olenhusen: Gutes Stichwort, zurück zum Anfang, zum Musealen, zum Archiv. Deine Technik, deine Mittel sind einige Jahrzehnte alt. Hat das seinen Ursprung in den 60er Jahren? Hat eine Literatur, die autobiographisch, dokumentarisch und soziologisch-sachbuchartig ist, die sich selbst dabei nicht ausspart, etwas mit 68 zu tun?
Schröder: Zunächst einmal zur literarischen Einordnung: Natürlich gibt es große Vorbilder, Jules Vallès, die Goncourt-Tagebücher oder Samuel Pepys und auch die Memoiren von Casanova. Andererseits gab es noch nie so eine Erzählmanier. Deswegen fällt es dem Feuilleton so schwer, mit dieser ungewöhnlichen ‚Textsorte‘, wie die Germanisten es nennen, fertig zu werden. Das soll denen auch schwerfallen! Es soll sogar mir schwerfallen, zu definieren, was genau wir da machen. Und es fehlte ja gerade noch, daß ich jetzt selber beginne zu dekonstruieren, was ich erzähle. Wenn ein Autor das tut, ist er langweilig, also erledigt. Was das Genre angeht, dazu will ich mich nicht auslassen. Es ist die Aufgabe von Literaturwissenschaftlern sich darüber herzumachen und ihre Essays oder Dissertationen zu schreiben. Mich geht das überhaupt nichts an! Zum zweiten Teil deiner Frage: Mit 68 hat ‚Schröder erzählt‘ nur bedingt etwas zu tun, insofern als gewisse 68er Ereignisse in Literatur und Politik, gegen den musealen Strich gebürstet, durchaus darin vorkommen.
*
Damit sollte eigentlich das Interview und das kleine einstündige Gespräch nach einem opulenten Hotelfrühstück und vor dem Besuch der Hohenecker Antiquariatsmesse in Ludwigsburg sein Ende haben. Doch er wäre nicht Jörg Schröder, wenn er nicht noch etwas nachzutragen hätte.
Schröder: Albrecht, mach doch die Kiste nochmal an, diese Zitate sind mir eben zur Textproduktion eingefallen: „Das Tonband ist Gottes kleines Spielzeug“, sagt Paul Bowles. Und William S. Burroughs schreibt: „Mit dem Tonbandgerät kannst du mehr über das Nervensystem erfahren und größere Kontrolle über deine Reaktionen gewinnen, als wenn du zwanzig Jahre im Lotussitz verbringst, oder deine Zeit auf der Couch des Psychoanalytikers verschwendest.“ Das sind Aussagen, die ich aus der Erfahrung mit meinen eigenen Tonbandtexten bestätigen kann.
Götz von Olenhusen: Ich hatte gestern ein zwiespältiges Erlebnis, als ich hörte, wie der „Jüngling im Trevira-Anzug“ sich sozusagen mit Hölderlin vernetzte und zugleich mit der 68er Bewegung, ich spreche von Michael Rutschky in seinem Jubiläumsvortrag.
Schröder: Keine Glanzleistung, das ist wahr, und sonderbar, weil Rutschky sonst ein Meister der Leichtigkeit ist. Aber gestern hatte er etwas Bleiernes in seinem Trevira-Jackett, schleppte offenbar die Bleigewichte dieser Marbacher Schiller-Institution mit sich rum. Das war eine für ihn untypische, verkrampfte Rede, die mich eher an einen DDR-Autor denken ließ. Wenn ein Autor aus der alten DDR diese Rede gehalten hätte, würde ich sagen: „Gut, fuffzig Jahre DDR — was bleibt einem übrig? — da muß man so reden.“ Dem hat die Lockerheit gefehlt.
Götz von Olenhusen: Mein Eindruck war, er sprach weit entfernt vom Material und auch weit entfernt von der eigenen Erinnerung.
Schröder: Weißt du, was ich mir vorgestellt habe? Als ich den Titel seiner Rede las ‚1968 — Der deutsche Jüngling wandelt von Hölderlin zur Soziologie‘, da war ich sicher zu wissen, wen er meint. Ich dachte, er hat Vesper nochmal gelesen. Apropos „nochmal“! Neulich fragte mich ein junger Rezensent: „Sag mal, ‚Die Reise‘, muß man den ollen Kram denn nochmal lesen?“ Das war ja eine direkte Frage zu 68. Dem habe ich geantwortet: „Was heißt hier nochmal?! Du hast das Buch doch überhaupt nicht gelesen, sonst würdest du einen solchen Quatsch nicht fragen. Du hast vielleicht ‚Die Reise‘ als Mediensubstrat wahrgenommen, kennst sie aber gar nicht, sondern nur ‚Hitlers Kinder‘ und den ganzen Schamott, der von irgendwelchen Literatursoziologen, nicht nur von deutschen, als Ableitungsbegriffe erfunden wurde.“ Natürlich ist ‚Die Reise‘ immer noch das beste Buch zu 68, mit allen seinen Schründen und dem Geröll. Und das sage ich als einer, der das Buch in- und auswendig kennt, weil ich es nämlich herausgegeben und mich über ein Jahr lang mit der Redaktion beschäftigt habe. Aber nein, da kommt dieser Rutschky mit seiner Abkehr von Hölderlin! Und ich hatte mir vorgestellt: Der raffinierte Kerl hat sich einfach diesen Vesper nochmal vorgenommen, das Buch von vorn bis hinten gelesen. Und jetzt rezensiert er Bernward Vesper, diesen Hölderlin-Adepten, den gebrochenen Deutschen, der sich als ein Hölderlin phantasierte.
Götz von Olenhusen: Den Vesper hat er gar nicht erwähnt. Ich dachte schließlich, er spricht nur von sich selbst.
Schröder: Na, eben! Ich war enttäuscht, weil ich dachte, da hat endlich jemand begriffen, daß dieser Jüngling Vesper eigentlich der Hölderlin der 68er Bewegung ist. ‚Die Reise‘ muß man nämlich nicht nur lesen, um etwas über die 68er zu lernen, sondern um auch etwas über die Dumpfheiten zu erfahren, aus denen sich die Entwicklung bis 68 speiste. Darüber ist leider nicht geredet worden. Da habe ich ihn überschätzt, den Rutschky, deshalb kommt mir seine Rede wie eine von Ingo Schulze vor, der durch die Alltagsruinen der alten DDR stolpert.
(AGvO / JS)