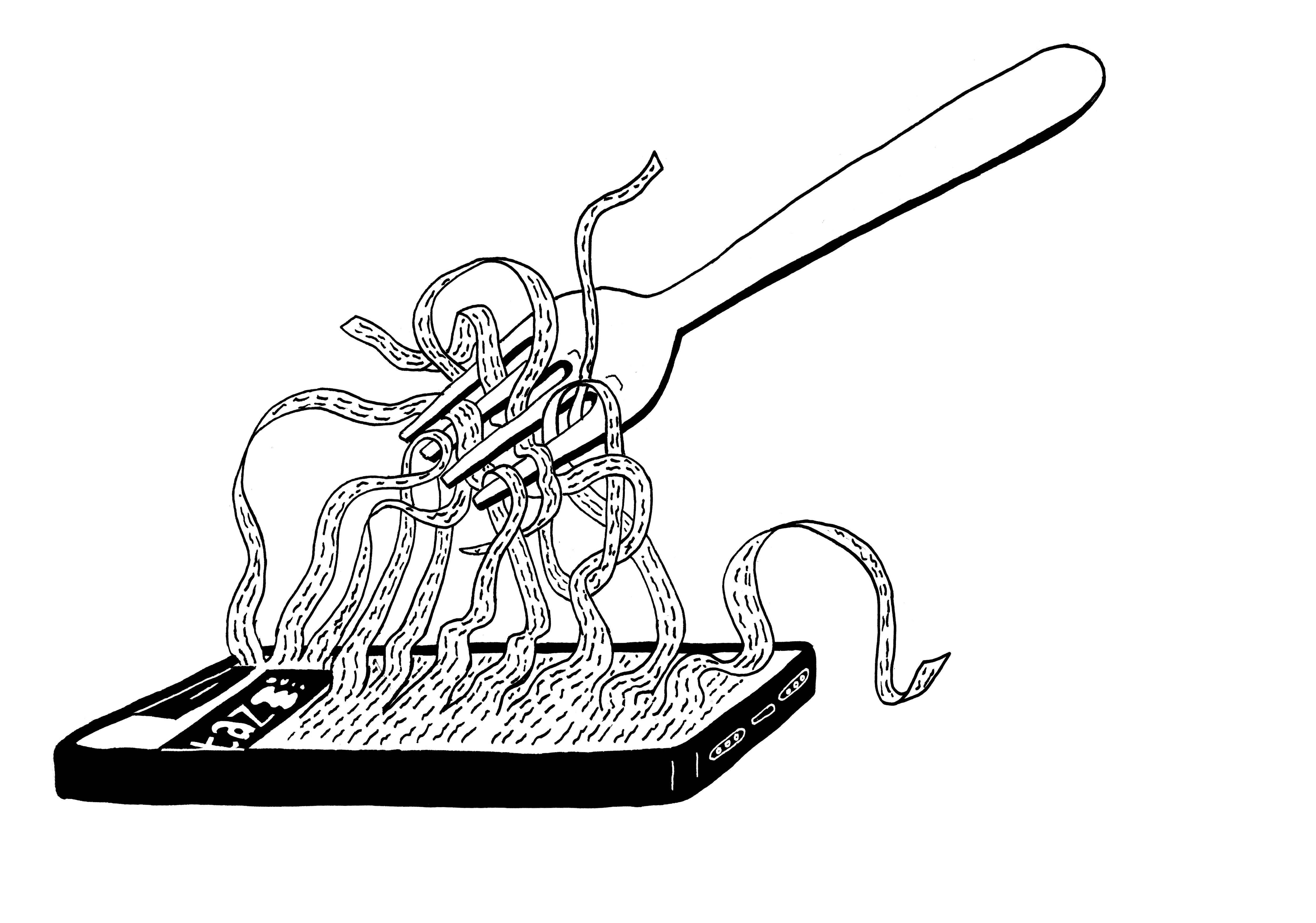Claus Peymann, der entmachtete Heimkehrer, inszeniert „König Lear“ in Stuttgart und füllt den Saal mit Luft aus vergangenen Tagen – Über Macht, Wahn und Erzähltheater
Ein „Theaterkönig“ ohne Land, nachdem er das Berliner Ensemble verlassen hat, inszeniert auf der Bühne des Stuttgarter Staatstheaters „König Lear“ ohne Land. Die Parallele ist offenbar. Der achtzigjährige Claus Peymann, der zum Schwergewicht des deutschen Theaters gehört und über fünf Jahrzehnte die Theaterwelt als Regisseur mitgestaltet hat, ist wieder zurück in Stuttgart, wo er seinerzeit als Schauspieldirektor von 1974 bis 1979 zur Legende gekürt wurde.
Ebenso wie damals, als er offen mit der RAF sympathisierte und zu einer Zahnspende für die in Stammheim einsitzende Gudrun Ensslin aufrief, ist er nun wieder mit viel Furore in die Stadt am Neckar, die von Mercedes und Porsche regiert wird, zurückgekehrt. In einem Interview mit der Stuttgarter Zeitung erklärte er kürzlich, dass „Stuttgart eine beschädigte, eine menschenfeindliche Stadt“ sei. Das Ungeheuer der Stadt – Stuttgart 21 – kommentierte er mit den Worten, „dass die grüne Administration, der Oberbürgermeister und der Ministerpräsident, nicht in der Lage sind, den Bürgern diese noch Jahre dauernde Zumutung zu ersparen, ist eine Schande.“ Wo er Recht hat, hat er Recht. Wenigstens traut sich einer aus dem Theatermilieu, das sich sonst gerne hinter dem glitzernden Banner der Kultur verschanzt, die Wahrheit zu sagen. Schnell ist ein Streit mit dem amtierenden Ministerpräsident, Winfried Kretschmann, entbrannt, ein Streit, an dem die Stuttgarter Schwaben großes Vergnügen haben, was sich in den Artikeln der Stuttgarter Zeitung wiederspiegelt. Ein Theater im Theater hat sich angebahnt, ehe das Staatstheater seine Pforten für „König Lear“ geöffnet hatte.
Kurz skizziert: Mit einem offenen Brief Kretschmanns auf das genannte Interview wies dieser die „Theaterlegende“ darauf hin, sich an das „Volk“ zu wenden, da dieses 2011 unter Polizeiknüppeln und Reizgas in einer Volksabstimmung für das milliardenschluckende Projekt gestimmt hatte. Darauf schoss Peymann giftig zurück. Mit Blick auf den alten Oberbürgermeister, Manfred Rommel, der 2013 verstorben ist, schrieb er Kretschmann ebenso im offenen Brief, ob dieser – wie Rommel – naiv und einfältig sei. Hinter Rommels Einfalt habe sich aber ein hochintelligenter und hochmoralischer Mensch verborgen. In Richtung Kretschmann fügte Peymann mit Theaterraffinesse hinzu: „Und bei Ihnen, lieber Herr Ministerpräsident, was steckt hinter Ihrer Einfalt? Einfalt?“ Ob darauf eine Antwort folgen wird, bleibt abzuwarten. Jedenfalls ist der Clinch zwischen Theater und Politik eröffnet.
Doch kommen wir nach dieser Einleitung zur Arbeit Claus Peymanns, die im Stuttgart der 70er viermal zum Theater des Jahres gewählt wurde, von denen neun Inszenierungen beim Berliner Theatertreffen gastierten, was bisher seine Nachfolger nicht übertroffen haben: zu „König Lear“ in der laufenden Spielzeit.
Die Geometrie der Macht
Die große, techniklastige Bühne des Staatstheaters wurde zu einer schwarzen, zum Publikum schrägliegenden Guckkastenbühne zusammengeschrumpft. An ihren drei Seiten waren je glasige Klapptüren befestigt, die die Figuren auf die Bühne wie Murmeln rollten, um wieder in ihnen wie Murmeln zu verschwinden. Im Schnittpunkt der Diagonalen hing angelschnurgleich ein frei schwebender Hacken in ca. zwei Meter Höhe, an den König Lear nach dem alleszermalmenden „Nichts!“ der Cordelia seine Krone zum Zeichen seines Machtabtritts hing. Diese Krone blieb bis zur Schlussszene am Hacken und symbolisierte fortwährend den geometrischen Charakter von politischer Macht: Macht ist das Schirmzentrum allen Geschehens. Um das Zentrum herum: ein weißer Kreis, also der enge Zirkel der Macht. Das war die Bühnengestaltung von Karl-Ernst Herrmann, der die Macht auf ihre symmetrischen Formen reduzierte. Überdies fielen die Kostüme der Schauspieler auf, die Margit Koppendorfer gestaltet hat. Die in einer Mischung aus schwarz und dunkelgrün oder dunkelrot gekleideten Schauspieler, deren Gesichter bleich bepudert waren, erinnerten an machthungrige Protofaschisten, die auf den Zusammenbruch des Systems lauern, um bei Stunde Null selbst die Macht zu ergreifen. So sieht die Psychologie der reaktionären Unterwanderer unserer Zeit aus.
Auf diesem Erscheinungsrahmen erhebt sich das späte Werk Shakespeares wie eine Götzendämmerung, die in seiner Dichte und poetischen Kraft Intrigen, Lügen, Kämpfe, Rache, Willkür, Tyrannei, Wahnsinn und Erotik vereint, wie man es sonst heute nur vielleicht aus langbändigen Buchreihen aus dem Science-Fiction-Genre wie „Game of Thrones“ oder Serien wie „Vikings“ kennt. Peyman wollte „einfach nur Lear“ spielen, wie es wortkarg im Programmheft heißt, und eines hat er bewiesen: er stand zu seinem Wort, wie ein Katholik zu einem biblischen Dogma. Wort für Wort, Regieanweisung für Regieanweisung, so wie es Shakespeare vor 400 Jahren vorgegeben hatte, hat Peymann die Tragödie in einer knapp vierstündigen Aufführung ins 21. Jahrhundert ge-tragen (nicht über-tragen!). Zwar war das Schauspiel handwerklich nahezu perfekt ausgeführt, aber das starre Festhalten an das Dogma, den reinen Shakespeare spielen zu müssen, verlieh der Aufführung eine auratische Langatmigkeit, der nicht zu entkommen war. Dem hauptsächlich grau- und weißhaarigen Publikum, das seinen Lieblingstrommler aus den 70ern nicht vergessen hat, muss man zumindest für seine Geduld und seinen Sitzfleisch würdigen. Denn Altes altförmig auf die Bühne zu bringen, kann nostalgische Faszination wecken, wie beim Publikum, aber es wird nicht die Stoßkraft haben, um einen Stilbruch zu schaffen. Gerade von solchen Stil- und Formbrüchen lebt das große Kunstwerk, wie schon Adorno feststellte, indem der Stoff derart in Konflikt mit der Form tritt, dass der Künstler dem Stoff im entscheidenden Augenblick Vortritt gewährt – statt der Form, die den Stoff unter ihren Zwang werfen will. Das Erste ist ein Stilbruch, grandios, skandalös, umstürzend; das Zweite ist eine Stilstarre, konservierend, zwanghaft, museal. Diese Stilstarre klebte der Inszenierung an, wie ein Kaugummi an der Schuhsohle, obwohl Momente des Umbruchs provoziert wurden. Das Stück hat wenig gewagt und riskiert, wo gerade das Wagnis und das Risiko Durchgangsmomente zur erfolgreichen Aufführung sind; nämlich zum Theaterskandal, das Kulissen lüftet und verborgene Fenster öffnet. Peymann hat es sich, gemessen an seiner Erfahrung und seinem Wissen, leicht gemacht. Die Inszenierung war klassisches Erzähltheater mit großem Schatten.
„Einfach nur Lear“ spielen
Nehmen wir zunächst die Spiel- und Sprechweise: die Bewegungen waren nüchtern, teilweise ernüchternd. Bewegungen wirkten mechanisch als wäre man ins 20. Jahrhundert zurückgefallen, wo die Technik von heute dynamisierende Möglichkeiten eröffnet. Doch Peymann hat sich offenbar für einen technischen Minimalismus entschieden; keine Musik, kaum akustische und visuelle Effekte, sieht man von den Schlaglichtern nach der Pause ab, die die Tragödie beschleunigten. In der Fassung Shakespeares steht beispielsweise „Sturm“ und die Aufführung hatte tatsächlich den Mumm, Blitz und Donner, also einen Sturm durch Lautsprecher ins Publikum zu schallen, so als stünde man auf einem britischen Feld, das von Regengüssen überschüttet wird. Obwohl gerade diese Szene einen Höhepunkt im Stück darstellt, nämlich wo König Lear mit seinem Narren und dem verkleideten Kent durch einen Sturm zieht und der Sturm metaphorisch den Wahnsinn und Jähzorn Lears widerspiegelt, hält hier die Aufführung starr an den Buchstaben, die Shakespeare schrieb, fest. Klar: „einfach nur Lear“ spielen. Aber wäre an dieser Stelle, mit Blick auf die gesamtgesellschaftliche Ohnmacht der progressiven Akteure unserer Zeit, nicht etwas anderes geboten? Vielleicht eine Projektion? Vielleicht Musik? Vielleicht so etwas Rahmensprengendes wie „Killing in the Name!“ von Rage Against The Machine? Ich denke schon, auch wenn Peymann hier klar widersprechen würde.
Oder denken wir an die Intrige Edmunds gegen seinen Bruder Edgar, die Nebentragödie um den wankelmütigen Gloster: hier initiiert Edmund einen Verrat seines Bruders gegen seinen Vater und drängt Edgar zur Simulation eines Kampfes. Bei Shakespeare ist die Rede von „Degen.“ Was geschieht in der Peymann-Inszenierung? Edmund und Edgar kreuzen ihre Degen und fechten. Tatsächlich, Peymann kümmert die hochmodernisierte Schnellfeuerwaffe o.d. im 21. Jahrhundert nicht, die beim fünfsekündigen Anhalten des Abzugs ein kleines Dutzend Menschen niedermäht; er ist am Degen interessiert. Er lässt Edmund und Edgar fechten. Das ist heutzutage mehr als klassisch; das ist überklassisch, anachronistisch, Vergangenheit, Tod, albern. Aber klar doch: „einfach nur Lear“ spielen, statt Transposition.
Nehmen wir noch ein drittes Beispiel: Denken wir an den Schlussakt der Tragödie, wo der Krieg zwischen Frankreich und den Töchtern Lears stattfindet. Hier steht Schwarz auf Weiß bei Shakespeare mehrmals „Sirene,“ dann geht es Schlag auf Schlag und – üblich bei einem Stilbrecher wie Shakespeare – alle gehen zugrunde. Ehe sie ahnen, dass sie untergehen, sind sie bereits in die Falle ihrer Einfälle getreten und beginnen wie am Bein gefangene Bären zu grölen. Was macht Peymann? Er lässt tatsächlich Sirenen durch die Lautsprecher schreien. Wäre auch hier nicht etwas anderes mit Blick auf den Zeitkern jedes Kunstwerks geboten, ein Zeitkern, den das Theater berücksichtigen muss, will es nicht wie die Oper in die weißen Wolken schulterklopfender Idealismen abheben? Wäre beispielsweise statt Sirenen nicht eine Projektion über Militärzüge, über Bomber in Syrien, über Atomteste auf dem Meer geboten? Oder rein akustische Stücke, die durch die Lautsprecher gejagt werden und an Kriegsbomben, Panzergeschosse, Artillerie, Hubschrauber und Kampfjets erinnern? Aber vielleicht würde Peymann mir auch an dieser Stelle widersprechen, obwohl ich beim besten Willen kein Freund von techniküberladenen Inszenierungen bin; aber durchaus ein Freund der Piscatorischen Anwendung technischer Produktivkräfte auf Höhe der Zeit unter einer Bedingung: Effizienz. Wie dem auch sei, ich fordere hiermit kein Spektakeltheater, das durch Technik Inhalt überschattet, ich fordere ein klassendramatisches Zeittheater, das zeitgemäß die Technik in die Ökonomie eines Stücks einbringt, um Shakespeares Ausruf im „Hamlet“ zu erfüllen: „Weniger Kunst, mehr Inhalt!“
Doch ich höre wieder das Echo des Programmheftes mit Blaulicht herannahen: „Einfach nur Lear“ spielen. Chapeau!
Verfremdung durch Silbensprache
Der Renaissancemensch in Shakespeare zeigt sich in seinen Werken vor allem in jenen Momenten, wo er den Banalitäten in der Menschenordnung die ernsthaften Masken niederreißt. Der Vorgang ist hierbei oft derselbe, auch in „König Lear.“ Auf dem Standpunkt der Natur, die keine Unterschiede unter Menschen kennt, zertrümmert er die Unterschiede unter Menschen, die von ihnen durch Macht, Gewalt, Symbole usw. gemacht werden. So wird ein König ein Narr und ein Narr ein König; so wird ein intriganter Bastard ein Fürstensohn und ein Fürstensohn ein bastardmäßiger Intrigant; so wird ein Mann zu einer Frau und eine Frau zu einem Mann; so wird ein Mensch zu einem Wurm und ein Wurm zu einem Menschen. Shakespeare erkannte, dass die Diversität der Identitäten keinem Naturgesetz folgt, sondern aus gesellschaftlichen Machtverhältnissen entspringt. Identitäten sind fungible Rollen, weil sie Etiketten sozialer Verhältnisse sind, die die Klassengewalt den Individuen aufdrückt. Die Waffe Shakespeares ist dieselbe, die alle Renaissancemenschen gegen die schändlichen Tyranneien des dunklen Mittelalters der Kirchen erhoben hat: die Natur. So parodiert Shakespeare die Menschen seiner Zeit, indem er den Egalitarismus der Natur gegen die Hierarchie der Klassengesellschaft stellt.
Diesen Rammbock der Renaissance bringt Peymann entgegen oben erwähnter Kritik ausgezeichnet in Szene, nämlich durch die Sprechweise der Schauspieler, der dieselben eine adäquate Geste folgen lassen. Diese Sprechweise ist eine Art Silbensprache, worin jedes Wort ihren Silben und inhärenten Brüchen nach aus der Zunge der Schauspieler gerollt wird. So entstehen faszinierende Momente eines Brechtischen Verfremdungseffekts, wo Aussprüche sich wie Nieten ins Hirn des Publikums beißen. Nachdem beispielsweise Gloster ödipusgleich seine Augen verloren hat und wider Wissen von seinem abgestoßenen Sohn Edgar wie eine Antigone bei der Hand durch das Land geführt wird, sagt derselbe Gloster mit epischer Anmut: „Es ist der Fluch der Zeit, dass Verrückte, die Blinden führen.“ In solchen Augenblicken spürt das Publikum, dass das Stück sich über sich selbst erhebt und in die Wirklichkeit übergeht. Denn werden wir nicht auch von Verrückten geführt, wir Blinden? Das ist hervorragend, und klar ist, dass solche Momente auf die erfahrene Regiearbeit Peymanns zurückgehen.
Nichtsdestotrotz gehen solche Momente, ohne es beabsichtigt zu haben, aufgrund der objektiven Beschaffenheitsmerkmale eines nach oben hin klassenzugehörigen Publikums, zuweilen in eine zynische Leere – auch wenn jene Momente durch die Regie perfekt platziert wurden. Dabei denke ich vor allem an ein Augenblick, wo der wahnsinnig gewordene König Lear mitten in einem Moment melancholischer Selbstbesinnung sagt: „Not ist eine wunderbare Kunst; sie macht das Geringste kostbar.“ Dieser Ausspruch beispielsweise ist von entwaffnender Ironie, gerade weil ein König ihn sagt. Ich saß in den vorderen Reihen, d.h. in den Reihen der wohlsituierten Bildungsbourgeoisie. In mir pflückte der Ausspruch affektiv eine Frucht des Zorns ab. Neben mir jedoch saß eine alte Dame. Ich kannte sie nicht, aber ich sah ihre Reaktion auf den Reiz, eine affektive Reaktion, durch die ihr Triebwerk ihren Verstand überführte: sie seufzte selbstherrlich ein grinsendes „Ha!“, so als hätte sie gedacht, sie müsste mal wieder eine Diät machen, damit ihre Figur sich gemäß ihren ästhetischen Vorstellungen optimiere. Die abgepflückte Frucht des Zorns in mir verdarb in Sekundenschnelle und hinterließ einen unsäglichen Ekel, der auf meinen Hautporen kroch. Das zeigt: Richtige Verfremdungseffekte beim falschen Publikum degenerieren zu rein kulinarischen oder moralischen Appellen. Beim falschen Publikum hilft kein Vernunftappell. Hier hilft nur artistischer Schock, d.h. Entsetzen. Sonst überschlägt sich Edmunds Klugheit, „Das Schlimmste kehrt zum Lachen“, in: Das Lachen kehrt zum Schlimmsten.
Noch ein Wort zu den Schauspielern
Alle Schauspieler haben durchweg geglänzt. Besonders Lea Ruckpaul hat eine wunderbare Figur und Gestik, Sprache und Härte, Naivität und Intelligenz in ihrer Doppelrolle als Narr und Cordelia gegeben. Doch ausgerechnet die Titelrolle, König Lear, hat wenig überzeugt, wo doch Peymann hierfür extra seinen langjährigen Freund und Mitstreiter Martin Schwab aus dem Wiener Burgtheater hat kommen lassen. In Martin Schwab, ein exzellenter Melodramatiker, wie es in den Feuilletons heißt, steckte kein Lear.
Lear ist von brutaler Launenhaftigkeit und archaischer Energie. Er ist ein tolstoianischer Selbstverleugner, der nicht zur Ruhe kommen kann, weil er Unruhe stiftet. Er ist ein lavaspeiender Vulkan, der befiehlt und flucht und schimpft und lacht und weint. Er ist ein königlicher Anarchist. All diese Attribute seiner Figurenstruktur hatten bei Martin Schwab etwas Lasches und Gedehntes. König Lears dämonische Rastlosigkeit hat sich bei Martin Schwab als mitteleuropäische Gemütlichkeit enthüllt. Schwab war zu sanft, zu gütig und zu weich für die Härte Lears. Daher wirkte Lear durchweg saftlos, wie aus Wasser gezogenes Papier, statt ein stämmiger Baum von ungeheuren Verästelungen und Verzweigungen zu sein, der in graue Wolken reicht.
Und dennoch, um auf Peymanns Zeit im Stuttgart der 70er Jahre zurückzukommen: das hauptsächlich grau- wie weißköpfige Publikum hat pflichtgemäß die Peymann-Ovationen nach dem Schlussakt, teilweise stehend, wie in einem geübten Epilog geleistet. Damit wird die „Theaterlegende“ aus Stuttgart zufrieden sein. Viel Applaus ist er seit jeher gewöhnt. Aber geht es uns, den nein-sagenden Erneuerern und Rettern des Theaters, das wie keine andere Kunst alle Kunstformen in sich vereint, heute wirklich nur um Applaus?
Foto: Thomas Aurin