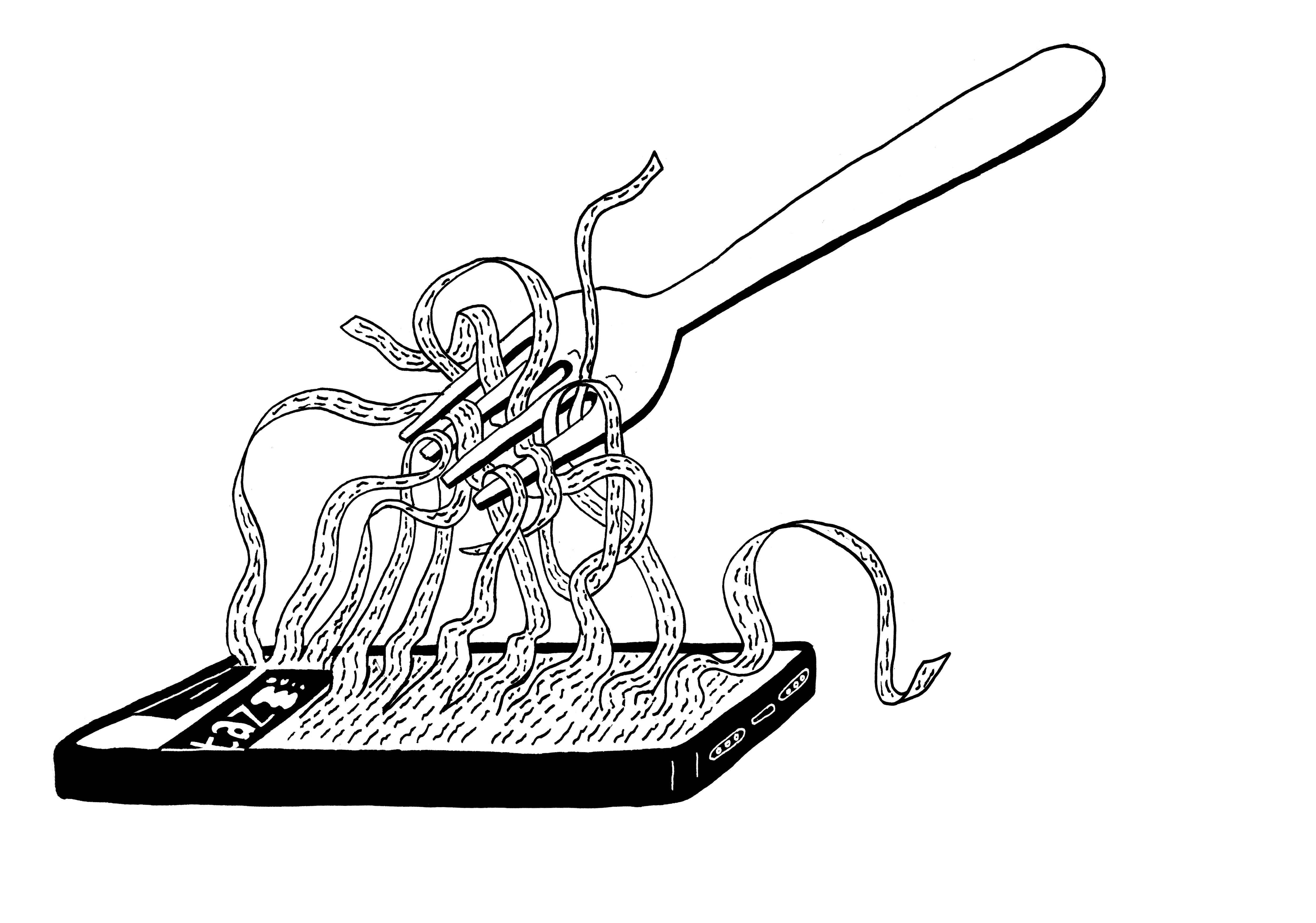Eins steht für die endende Theatersaison fest. Die Pandemie drückt viele Theaterkünstler auf die Knie und erschwert nicht wenigen die berufliche Perspektive, ganz besonders dem aktuellen Abschlussjahrgang aus Regie, Schauspiel und Dramaturgie. Und doch scheint es, dass die coronabedingte Verlegung der Bachelorabschlussinszenierung ins Freie dem Regiestudenten Maximilian Pellert ganz gelegen kam.
Statt auf der elektrisch beleuchteten Bühne der Akademie für darstellende Kunst Baden-Württemberg wurde die von Juliane Logsch (abschließende Dramaturgie-Studentin) erarbeitete Bühnenfassung des Romans »Vor dem Fest« (Saša Stanišić) auf einer Weidelandschaft in Pflugfelden aufgeführt – mit großer Unterstützung der gesamten Ortsgemeinschaft. So wurde das Leben der ostdeutschen Fürstenfelder in der brandenburgischen Uckermark in die dörfliche Beschaulichkeit des Südwestens und den baden-württembergischen Wohlstand überführt. Allein diese Tatsache hat Kontraste sichtbar gemacht, die die Studenten aufzugreifen verstanden.
Eine Nacht des magischen Realismus
„Sei heldisch!“, mit diesen Worten, die nahezu melancholisch und anonym aus einem mehrstimmigen Echo eines kollektiven Unbewussten tönten, begann und endete die Aufführung. Es geht um ein Dorf, das zugleich traurig ist, weil es seinen Fährmann verlor, und sich auf das morgige Fest freut, obwohl niemand so recht weiß, was gefeiert wird. Zuvor muss jedoch die Nacht ausgestanden werden. Eine Nacht, in der die Gegenwart geschichtet wird mit der Vergangenheit. Die Mythen aus den Annalen der Dorfchroniken verweben sich mit dem Zement der Realität und das ewige Sein des Volkstümlichen verschmilzt mit dem Sein der ewigen Veränderung. Diese Nacht wurde als eine Nacht des magischen Realismus aufgeführt. Das natürliche Bühnenbild, bestückt mit einem blauen Himmel, lianentragenden Strommästen, kriechenden Wolkenfetzen und schwebenden Vögel, zerrann unterm Licht der untergehenden Sonne mehr und mehr im Auge des Betrachters in ein Ölgemälde. In dieses Gemälde flohen die Schauspieler hinein, als würde sie ein Pinsel führen.
Während sich ihre Körper im grünen Horizont verkleinerten, bäumte sich der Geist der Figuren durch ihre Stimmen per Mikrofon und Lautsprecher in totaler Präsenz vor dem Publikum auf. Das hatte den auratischen Verfremdungseffekt, die geschichtliche Ferne des Gegenwärtigen hautnah erscheinen zu lassen. „So eine Nacht ist das“ gewesen, eine zauberhafte, atmosphärisch aufgeladen.
Niederlage und Zukunft der Besiegten
Aufeinanderfolgend, mit sanften Übergängen, zeigte sich dem Publikum das widerspruchsvolle Leben der Fürstenfelder. Da war zum Beispiel Herr Schramm, ehemaliger Leutnant der NVA, nach der Wende Förster, dann arbeitslos. Obwohl er in der DDR Offizier war, wurde ihm in der BRD die Offiziersrente verweigert, sodass er sich dann und wann als Schwarzarbeiter verdingen musste. Verbittert von den Enttäuschungen und Verweigerungen der Verhältnisse streitet er manisch mit einem Zigarettenautomaten, bis er die Pistole zieht und einen Schuss auf den Automaten abfeuert, um endlich eine Zigarette rauchen zu können. Doch vergebens – er findet sich wieder als Besiegter der Geschichte. Kim Biele hat die Ernüchterung und Wut eines Gekränkten, der zu stolz ist, seine Kränkungen preiszugeben, mit viel Verstand und Herz verkörpert.
Dann war da noch Frau Kranz, die Malerin des Dorfes, die vier politische Systeme erlebt hat und die Geschichte des Dorfs mit Farbe dokumentiert. „Wer malt uns“, tönt es aus den Lautsprechern, „wenn Frau Kranz nicht mehr malt?“ Lily Frank hat den Gestus der verbitterten Künstlerin mit emphatischer Sinnlichkeit in dem Gehen einer knöcherigen Oma einzufangen gewusst – die Schulter zur Seite kippend, einen Buckel aus den zusammengezogenen Schulterblättern herausholend und ein Bein dem anderen nachziehend, als würde sie jeden Augenblick umfallen. Als sie in weiter Entfernung mit ihrem knallroten Regenmantel und der ebenso knallroten Anglermütze im hohen Gras stand wie eine dornige Rose und gleichzeitig mit schnoddriger Stimme aus den Lautsprechern ihre Geschichte der Zeichnung von sechs Frauen erzählte, welche sie noch auf der Leinwand kämmen und kleiden würde, verdichtete sich die Schönheit des Poetischen mit der Kälte des Politischen und hinterließ ein angenehmes Unbehagen. Dieser Moment war angenehm, weil das Denken dem Publikum überlassen wurde; zugleich war er unbehaglich, weil das Denken sinnlich zum Denken aktiviert wurde. „Wie geht das; das Böse im Menschen malen?“, fragt Frau Kranz und Lily Frank zeigte, wie es schauspielerisch zu meistern ist.
Schließlich haben auch die anderen Schauspielstudenten (Silva Bieler, Clara Luna Deina und Nils Eric Müller) die Entfremdungserfahrungen der übrigen Dorfbewohner in der Wiederkehr des neoliberal neuformierten Kapitalismus lebhaft und in unverkennbarer Zerrissenheit dargestellt. Außerdem wurde die Aufführung vom Anfang bis zum Schluss durch subtile und den Krimi-Faktor steigernde Töne von Luis Schöffend (Tongestalter) begleitet. Sie stärkten die Wahrnehmung der dramatischen Fabel, die das Regiekonzept gelungen ins Zentrum der Arbeit rückte, nämlich wie der Strukturwandel einer ostdeutschen Industrie in eine brandenburgische Ruine durch die Treuhandanstalt das Leben der Betroffenen zerklüftet und zerstört hat. Heimat, das wurde deutlich, ist nicht Erde oder ein Diesseits eines Maschendrahtzauns. Heimat ist der andere, der dir die Hand reicht. Ganz folgerichtig hört man also im letzten Drittel der Aufführung die eindringlichen Fragen: „Wer zieht mit der Harke Rillen zum Säen der Saat / Wer gibt den Schwachen ein Denkmal / Wer schreibt die alten Geschichten“.
Obwohl die Aufführung zum Schluss hin etwas ihre Dramatik mit einer weitschweifenden Schussszene einbüßte und zuweilen eine Hypotrophie des Alltäglichen die Sicht auf die Zusammenhänge versperrte, hat der sternenklare Abend in unmissverständlicher Weise die Notwendigkeit ins Bewusstsein gerückt, die Kämpfe und Niederlagen wie die Kämpfe und die Perspektiven der Besiegten dramatisch zu verhandeln. Theater ist dazu imstande, auch auf einer Weidelandschaft, mit Humor, mit Trauer, mit Ernst, mit Hoffnung. Das haben die Theatermacher von morgen bewiesen.