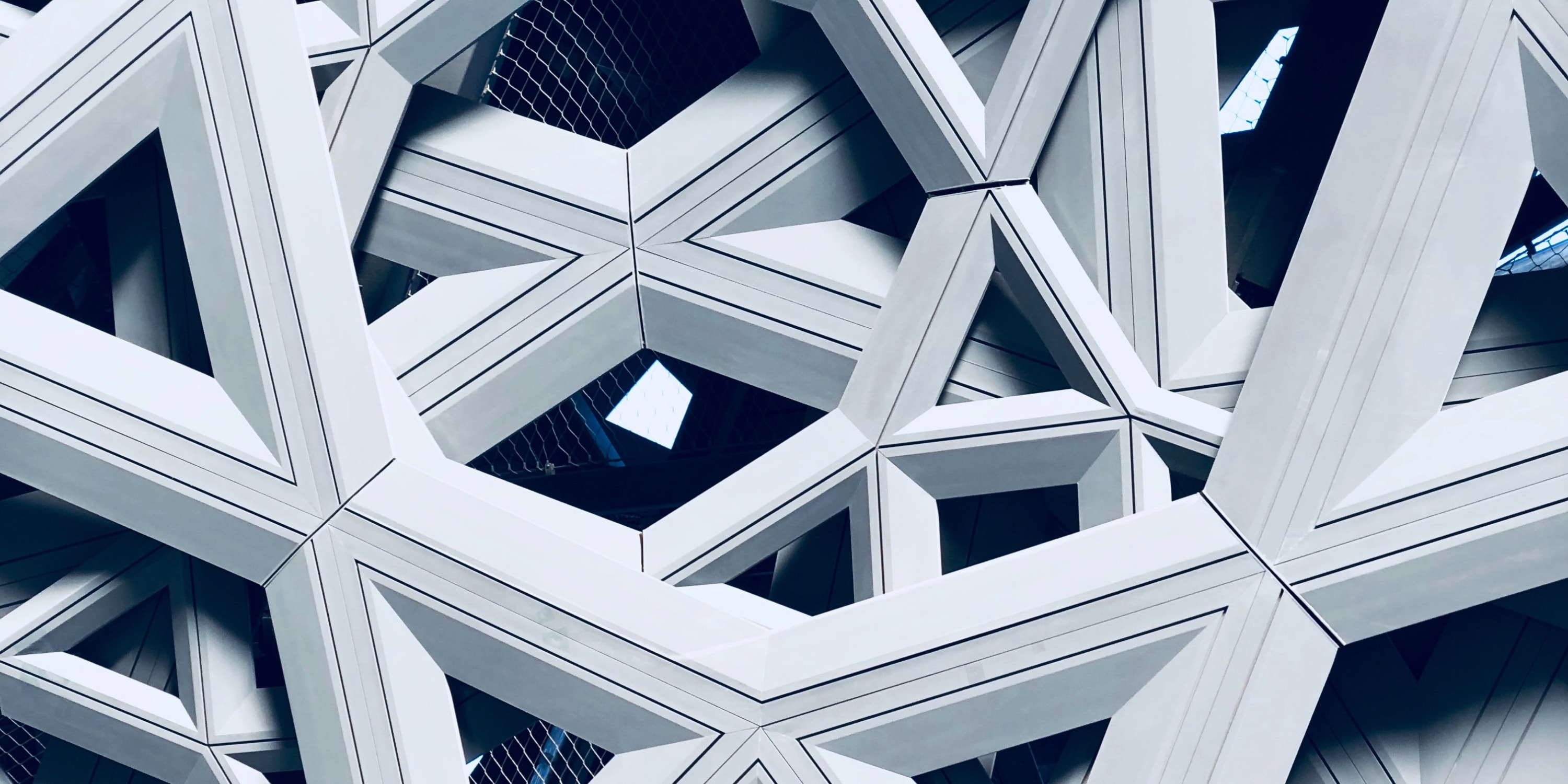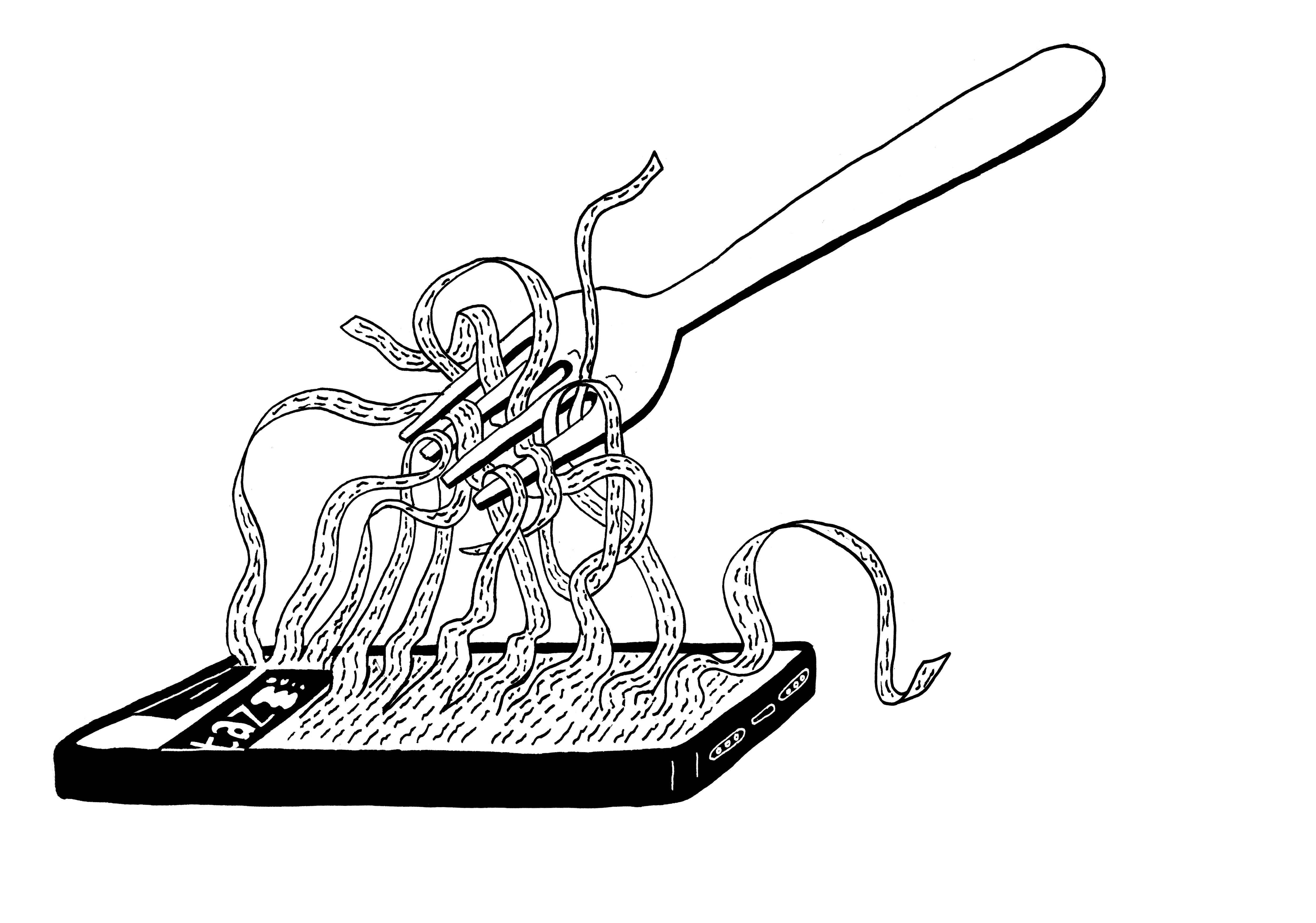Im Gefängnis kann ein Roman oder ein Gedicht zum Asyl des Geistes werden, zu einem politischen Rückzugsort, wo der Geschlagene Durchhaltevermögen schöpft und sich für den Kampf wieder aufrichtet. Das bezeugen schriftliche Erzeugnisse politischer Gefangener, allen voran die „Briefe aus dem Gefängnis“ von Rosa Luxemburg. Aus Liebe zur Literatur verwandelte sie sich in ihrer Haftzeit von 1915 bis 1918 selbst zu einer leidenschaftlichen Dichterin. Zweifellos gehört das Bändchen seither zur Bibliothek der Weltliteratur.
Dilemma der Weltgeschichte
Am 4. August 1914 hatte die SPD-Reichstagsfraktion den Kriegskrediten zugestimmt. Die SPD-Führung schloss mit dem Kaiser einen „Burgfrieden“, in dem sie auf Forderungen und Streiks während des imperialistischen Weltgemetzels verzichtete. Anschließend brach die Sozialistische Internationale geräuschlos zusammen und Ende Juli 1914 begann der blutige Weltkrieg. Im selben Jahr wurde Rosa Luxemburg zu einer Gefängnisstrafe wegen „Aufforderung zum Ungehorsam“ verurteilt. Angesichts von Krankheit und seelischer Erschütterungen war ihr der Strafantritt bis zum 31. März 1915 bewilligt worden. Dennoch wurde sie am 18. Februar 1915 plötzlich verhaftet, dabei wollte sie am Tag danach gemeinsam mit Clara Zetkin nach Holland reisen, um dort Vorbereitungen für den internationalen Frauenfriedenskongress zu treffen. Ein Jahr später wurde sie entlassen und veröffentlichte die Broschüre »Die Krise der Sozialdemokratie«, worin sie mit der „bürgerlichen Gesellschaftsordnung“ und der SPD abrechnet, deren reaktionäres Wesen der Krieg offenbart habe. Neben der genialen Polemik gegen den reformistischen Käse der SPD-Führung konstatiert sie, dass das „Dilemma der Weltgeschichte“ sich zugespitzt hat: „entweder Triumph des Imperialismus und Untergang jeglicher Kultur (…). Oder Sieg des Sozialismus“. Die Broschüre, so der Freund Paul Frölich, „wurde zum Rüstzeug Tausender illegaler Kämpfer.“
Schon drei Monate später wurde sie als „Schutzhäftling“ aufgrund ihrer antimilitaristischen Arbeit und ihrer unerschrockenen Haltung als Revolutionärin aus dem Verkehr gezogen. Die Haftzeit dauerte bis zum 9. November 1918. Während dieser Zeit, zwischen den kalten Wänden der Gefängniszellen in Berlin, Wronke und Breslau, schreibt sie heimlich Briefe an ihre Freundinnen. Die eindrucksvollen „Briefe aus dem Gefängnis“ sind ein poetisches Zeugnis tiefster Humanität und unerschütterlicher Verbundenheit mit allem Lebendigen. In ihnen verdichtet sich das Leben der Revolution, das kein trostvolles Warten, kein schonenden Aufschub, nur den Gegenwartsvollzug im Hier und Jetzt will, zur Poesie.
Ohne Weltanschauung keine realistische Literatur
„Was ich lese? Hauptsächlich Naturwissenschaftliches: Pflanzengeographie und Tiergeographie“, schreibt Rosa Luxemburg 1917 aus Wronke an Sonja Liebknecht. Aber das ist nicht alles. Darüber hinaus verschlingt sie unzählige Romane und Gedichte, bittet ihre Freundin immer wieder um neue Literatur, „vielleicht etwas von Th[omas] Mann“ oder wegen ihrer „Studien über Shakespeare“ Geschichten des italienischen und spanischen Dramas, bis sie zuletzt ihre Freundin fragt: „Wie stehen Sie selbst zu Shakespeare?“ Neben solchen Bitten lässt sie sich Abschriften von Gedichten schicken, verweist in Bezug auf die fatalistische Wehmut ihrer Freundin auf Madame Chochlakowa von Dostojewskis »Brüder Karamosow«, dankt Hölderlin für eine Reisebeschreibung oder begeistert sich ebenso über Eduard Mörikes Scherzgedichte, über Arno Holz‘ »Phantasus«, über Johann Schlafs »Frühling« wie über ein entdecktes Gedicht von Hugo v. Hoffmannsthal, den sie sonst „gar nicht“ mag, ihn „gesucht, raffiniert, unklar“ findet, „ihn einfach gar nicht“ versteht.
In vielen Briefen sind auch aphoristische Kommentare eingepflegt, die ihre innere Ergriffenheit zur Literatur widerspiegeln. So bemerkt sie, dass »Der reiche Mann« des englischen Schriftstellers John Galsworthy „brillant“ ist, während ihr der Roman »Weltbrüder« vom selben Autor „freilich viel weniger gefallen“ hat, „weil die soziale Tendenz dort mehr überwiegt. Im Roman schaue ich nicht nach der Tendenz, sondern nach künstlerischem Wert.“ Galsworthy sei „derselbe Typ wie Bernard Shaw und auch wie Oscar Wilde, (…) ein sehr gescheiter, verfeinerter, aber blasierter Mensch, der alles in der Welt mit lächelnder Skepsis betrachtet.“ Ein wirklicher Künstler aber „ironisiert nie über seine eigenen Geschöpfe.“ Als Beispiel einer Satire großen Stils erwähnt sie »Emanuel Quint« von Gerhart Hauptmann, „die blutigste Satire auf die moderne Gesellschaft“, aber „Hauptmann selbst grinst dabei nicht; er steht zum Schluss mit bebenden Lippen und weit offenen Augen, in denen Tränen schimmern.“ Luxemburg ist der künstlerische Realismus in einem Roman wichtiger als die Hervorhebung der sozialen und politischen Tendenz.
Was ist das Entscheidende für solch einen Realismus? Obwohl sie nicht gegen die Dichter ihrer Zeit voreingenommen ist, gibt Luxemburg in einem Brief 1917 zu, dass sie irgendwann „zu Goethe und Mörike zurückgekehrt“ sei. Sie schreibt: „Es ist wahr: ich fürchte bei ihnen allen ein wenig die meisterhaft vollendete Beherrschung der Form, des poetischen Ausdrucksmittels und das Fehlen einer großen, edlen Weltanschauung dabei. (…) Sie geben gewöhnlich wunderbare Stimmungen wieder. Aber Stimmungen machen noch keine Menschen.“ Mit anderen Worten: Ohne Weltanschauung, die jedes Detail der Erzählung wie ein hintergründiger Dirigent zum Ganzen strukturiert und in ein Sinnzusammenhang mit der menschlichen Gattungsgeschichte verwebt, keine realistische Literatur. Unter einem mangelnden Weltbegriff leidet noch heute die zeitgenössische Literatur, die sich nicht selten in Identitäten verliert. Aber Identitäten machen noch keine Menschen.
Rosa Luxemburgs Büffelerzählung
Mitte Dezember 1917 in der Gefängniszelle in Breslau schreibt Luxemburg an ihre Freundin selbst eine kurze Erzählung von weltliterarischem Rang: Die Erzählung vom Büffel, der die Peitschenhiebe der Soldaten duldet „mit einem Ausdruck in dem schwarzen Gesicht und den sanften schwarzen Augen“. Es ist ein Gleichnis zur Lage der Ausgebeuteten und Unterdrückten, die heute ebenso wie damals an der bürgerlichen Klassengewalt blutet, als Rosa Luxemburg für die soziale Emanzipation kämpfte und schließlich in Schmerz, in Ohnmacht, in Sehnsucht mit Goethes »Faust« in den Händen hinterrücks von Henkern ermordet wurde.
Rosa, für das Leben der Revolution bürgt die Literatur, auch nach deinem 150. Geburtstag.