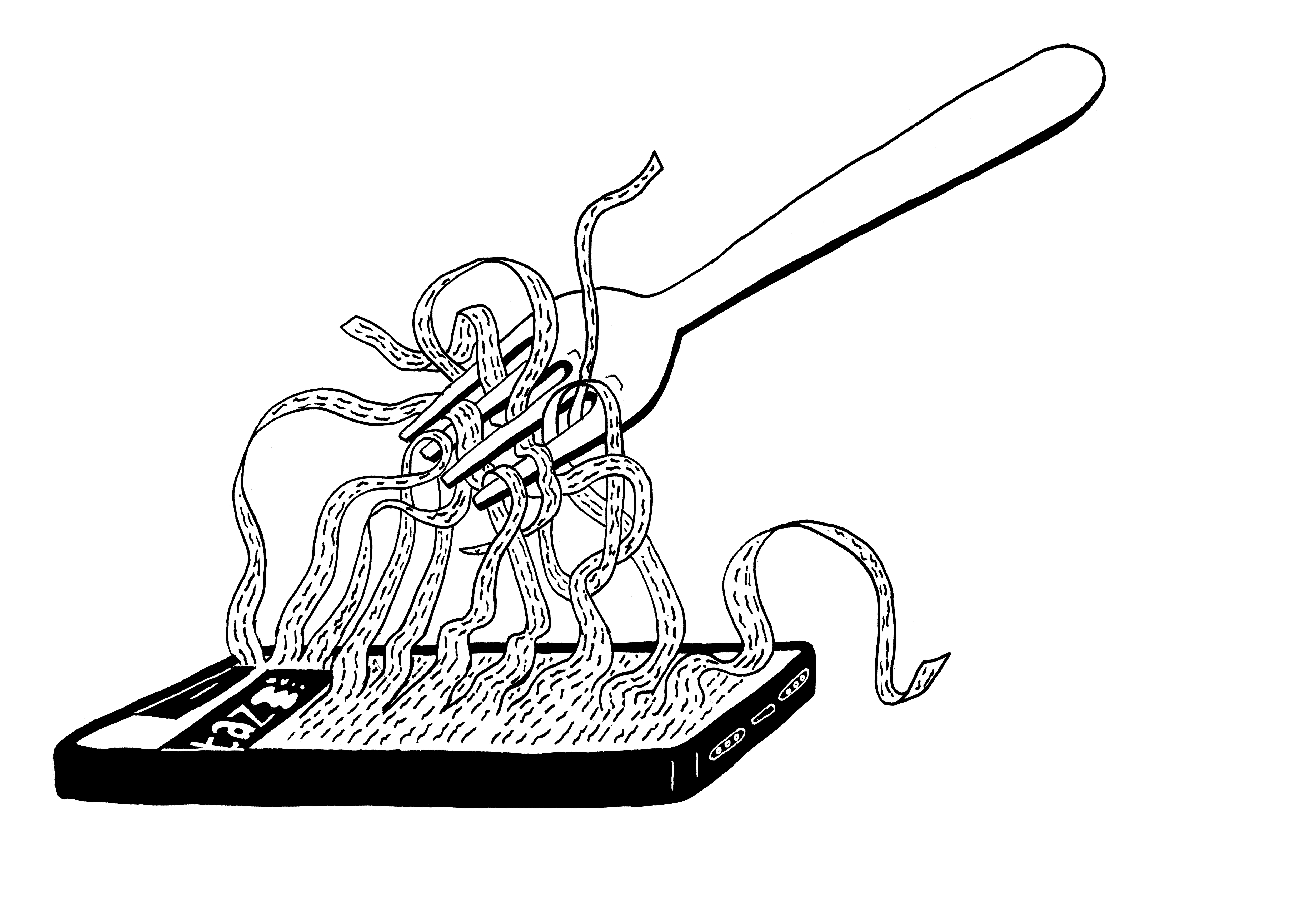Bevor es mit dem am 23. Juni angekündigten Text1 weitergeht, ein aktueller Einschub:
1. Der Dietz-Verlag postete heute morgen – aus Anlaß des 40. Todestages des einigermaßen linken Juristen und Politikwissenschaftlers Wolfgang Abendroth (02.05.1906 – 15.09.1985) – bei bluesky: Abendroth sei
„einer der einflussreichsten Staatsrechtler Deutschlands [gewesen]. Früh unterstrich er, dass der Kapitalismus NICHT im dt. Grundgesetz eingeschrieben ist, sondern es offen für andere Wirtschaftsweisen ist“
(https://bsky.app/profile/karldietzberlin.bsky.social/post/3lyuhegnvoz2r).
2. Ich konnte mir nicht verkneifen, etwas zu beckmessern und merkte an:
„Naja – ‚einflußreich‘ nun nicht gerade: ‚nachdem ihm der Vorstand der Vereinigung [der deutschen Staatsrechtslehrer], dem Abendroth selbst noch angehörte, die Übertragung des Korreferats zu Ernst Forsthoffs Erstbericht zu diesem Thema [‚sozialer Rechtsstaat‘] verweigert hatte.‘
d-nb.info/103280159X, S. 708.“
(https://bsky.app/profile/theorie-als-praxis.bsky.social/post/3lyuhrf5vi222)
„1. Eine Sache (mit der Abendroth recht hatte) ist:
‚dass der Kapitalismus NICHT im dt. Grundgesetz eingeschrieben ist‘.
2. Eine andere Sache (die Abendroth NICHT im Blick hatte):
Wie soll die Überwindung des Kapitalismus bei Einhaltung von Artikel 15 Satz 2 GG funktionieren können?
‚Für die Entschädigung [für die Vergesellschaftung von Produktionsmitteln etc.] gilt Artikel 14 Abs. 3 Satz 3 und 4 entsprechend.‘
www.gesetze-im-internet.de/gg/art_15.html.
Artikel 14 III 3, 4 GG: ‚Die Entschädigung ist unter gerechter Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und der Beteiligten zu bestimmen. Wegen der Höhe der Entschädigung steht im Streitfalle der Rechtsweg vor den ordentlichen Gerichten offen.‘
www.gesetze-im-internet.de/gg/art_14.html.“
(https://bsky.app/profile/theorie-als-praxis.bsky.social/post/3lyuhy46i6s22 ff.)
2. Da die Sache durchaus nicht nur linkssozialdemokratische JuristInnen betrifft, sei hier ergänzend betont: Es ist
-
sowohl juristisch-positivistisch
-
als auch gesellschafts- und geschichtswissenschaftlich-materialistisch
und
-
folglich auch politisch-strategisch
zentral, drei Fragen zu unterscheiden:
a) Was ist rechtmäßig?
b) Was ist möglich?
Und:
c) Was ist richtig?
3. Demgemäß differenziert sollten auch die Antworten ausfallen:
a) Nicht alles, was rechtmäßig ist, ist auch möglich.
b) aa) Nicht alles, was rechtmäßig ist, ist auch (politisch) richtig – sollte allein schon deshalb gemacht werden, weil es nicht rechtswidrig ist.
bb) Es ist aber auch nicht alles (politisch) falsch, was rechtswidrig ist. Vielmehr kommt es unter herrschaftlichen und ausbeuterischen gesellschaftlichen Verhältnisse ziemlich häufig vor, daß
-
‚Dinge‘ (Verhaltensweisen), die politisch richtig sind, rechtswidrig sind
und
-
‚Dinge‘ (Verhaltensweisen), die rechtmäßig sind, politisch falsch sind.
(Ist es nötig zu betonen, daß politische Richtigkeit keine Wahrheits-Frage ist, die sich objektiv [bewiesen] beantworten, sondern allenfalls begründen läßt?)
c) Auch das (Un)Mögliche und (Un)Richtige sind zu unterscheiden.
Allenfalls fallen das Unmögliche und das Unrichtige insofern zusammen, als es müßig ist, das ist Unmögliche zu wollen.
4. Wie bereits gesagt: Nicht nur linkssozialdemokratische JuristInnen neigen dazu, diese drei Ebenen nicht akkurat zu unterscheiden, sondern zu vermengen. Bereits bei früherer Gelegenheit stellte ich die These auf:
„Ein […] pragmatisches (um nicht mit Mao zu sagen: praktizistisches2) und unreflektiertes Verhältnis zum Recht und einen solchen (sowohl juristisch als auch politisch) opportunistischen Umgang mit dem Recht gibt es m.E. nicht nur in der (reformistischen) Gewerkschaftsbewegung, sondern – mit anderen politischen Vorzeichen – auch in der linksradikalen oder sich als linksradikal verstehenden Szene: ‚Zur Sicherung der eigenen Interessen wird Bezug genommen auf alle Rechtsnormen, unabhängig davon, ob diese Rechtsnormen politisch bekämpft oder erkämpft wurden.‘3 Es wird nach jedem Strohhalm gegriffen.“
(„Rechtsform und politischer Kampf“ – Strategische Dilemmas der „Linken“ [21.03.2023], S. 17)
„Mag auch der gewerkschaftliche Umgang mit dem Recht weitgehend von Legalismus und der von Linksradikalen dagegen weitgehend von Rechtsnihilismus geprägt sein, so sind sich doch beide Seiten in einem Rechtsvoluntarismus einig: ‚Der eigene Wille und laut-tönende Rhetorik werden es schon richten.‘ (Voluntarismus zu lat. voluntas = Wille; Voluntarismus = Auffassung, der Wille sei derausschlaggebende Faktor)“
(ebd., S. 18 f.)
Literatur:
Wolfgang Abendroth, Das Grundgesetz. Eine Einführung in seine politischen Probleme, Neske: Pfullingen, 1966; Inhaltsverzeichnis: https://d-nb.info/454535791/04.
ders., Antagonistische Gesellschaft und politische Demokratie. Aufsätze zur politischen Soziologie, Luchterhand: Neuwied/[West]berlin, 1967; Inhaltsverzeichnis: https://d-nb.info/454535775/04.
ders., Das Abtreibungsurteil des Bundesverfassungsgerichts, in: Kritische Justiz 1975, 121 – 128; https://doi.org/10.5771/0023-4834-1975-2-121.
ders., Arbeiterklasse, Staat und Verfassung. Materialien zur Verfassungsgeschichte und Verfassungstheorie der Bundesrepublik hrsg. u. eingel. von Joachim Perels, EVA: Frankfurt am Main / Köln, 1975; Inhaltsverzeichnis: https://d-nb.info/760003483/04.
Ulrich K. Preuß, Wolfgang Abendroth (1906 – 1985), in: Peter Häberle / Michael Kilian / Heinrich Wolff (Hg.), Staatsrechtslehrer des 20. Jahrhunderts. Deutschland – Österreich – Schweiz, de Gruyter: Berlin/Boston, 2015, 703 – 714.
Peter Römer, Demokratie als inhaltliches Prinzip der gesamten Gesellschaft. Wolfgang Abendroths Beitrag zur Verteidigung demokratischer Positionen in der Bundesrepublik Deutschland, in: Demokratie und Recht 1981, 123 – 136.
ders., (Hg.), Der Kampf um das Grundgesetz. Über die politische Bedeutung der Verfassungsinterpretation. Referate und Diskussionen eines Kolloquiums aus Anlaß des 70. Geburtstags von Wolfgang Abendroth, Syndikat: Frankfurt am Main, 1977: Inhaltsverzeichnis: https://d-nb.info/780018923/04.
ders., Vom Frieden des Rechts und vom Kampf der Klassen. Zur Aktualität von Wolfgang Abendroths Rechts- und Gesellschaftsanalyse, in: Demokratie und Recht 1986, 16 – 26.
1 „Auf die Frage, inwieweit die drei von ak genannten Beispiele bereits Faschismus-/Faschisierungsindizien sind, werde ich in den nächsten Tagen in einem separaten Text eingehen.“
Die Sache ist etwas länger geworden und hat deshalb etwas länger gedauert als gedacht… 😉 – neugierige LeserInnen können dort: https://theoriealspraxis.substack.com/p/zum-vorgehen-der-reichsregierung schon mal einen kleinen Vorgeschmack bekommen.
2 Siehe: http://www.infopartisan.net/archive/maowerke/MaoAWI347.htm.
3 Uwe Günther, Thesen zum gewerkschaftlichen Umgang mit dem Arbeitsrecht, in: Detlef Hensche / Martin Kutscha (Hg.), Recht und Arbeiterbewegung. Zum Gedenken an Wolfgang Abendroth, Pahl-Rugenstein: Köln, 1987, 156 – 163 (157); https://web.archive.org/web/20201230041533/http://antikaprp.blogsport.eu/files/2016/10/guenther_thesen_z_gew_umgang_m_d_arbrecht.pdf.