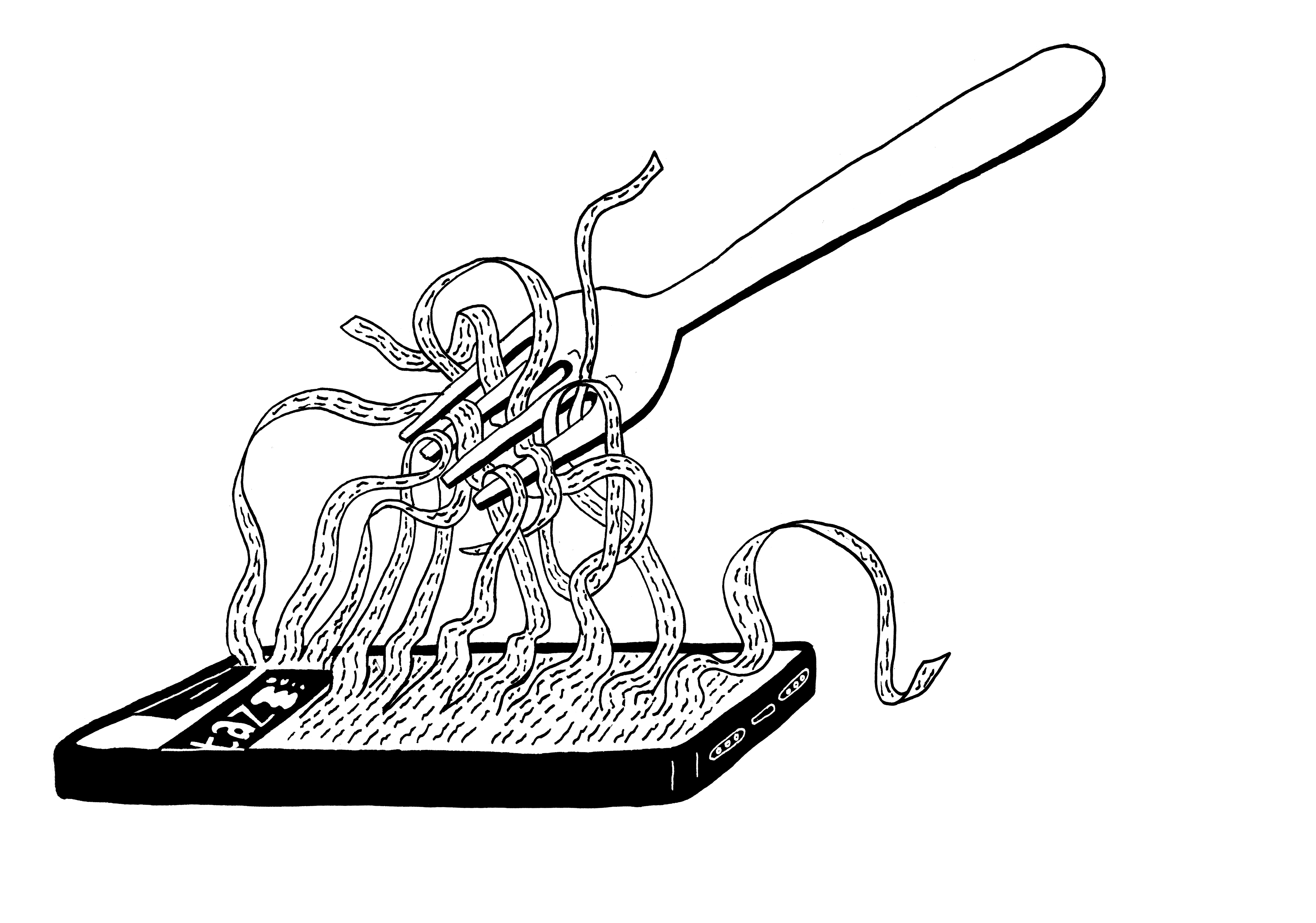Der Gebildete ist in der Verdrängungsgesellschaft längst eine komische Figur. Die akademischen Intellektuellen verfehlen durch die bereitwillige Anpassung an ihre marktökonomische Vernutzung das Geistige. Also muss der Essayist Alfred Goubran, der das sagt, mit »Sprachgeweben gegen die Vernutzung angehen und eine lebendige Gegenwart erzeugen«.
Die Gedanken dieses Schriftstellers klettern in breiten Gegensatzgrätschen über schroffe Wände: Fähigkeit/ Unfähigkeit, Kenntnis/ Wissen, Leid/ Schmerz. Der Geist ist für ihn – im Widerspruch zum Intellekt – eine Gedankenausübung, die das Denken ausdehnt, während sich der Intellekt als kognitive Leistung bloss vorhandenen Strukturen anpasst.
Wie dehnt der Geist das Denken aus? — Das geschieht so: Definition berechtigen den Autor dazu, eine Existenzaussage zu machen. So heisst es zum Beispiel an einer Stelle des Essays: »In der Verdrängungsgesellschaft wird das Unvollkomene als Fehler aufgefasst«, und: »Fehler kann man beheben, Mängel ausgleichen. Die Vervollkommnung wird zum Ziel«.
In wenigen Sätzen wird hier aus der Zuschreibung einer Eigenschaft (der Reparabilität des Fehlers) ein Telos der Verdrängungsgesellschaft abgeleitet. Und nach den Regeln dieser Topik meint Goubran, es könne nicht nur ausgesagt werden, was etwas ist, sondern auch dass es ist.
Dieser Argumentationsstil kennzeichnet den Essay Schmerz und Gegenwart als rhetorisch. Er bringt Sprache nicht etwa als Sprache und damit als mögliche Welt zur Geltung; er verwechselt die Sprache mit der Kulturwirklichkeit. Ein Sophist würde sagen, dass es keine Wahrheit gibt, sondern dass nur eine Vielfalt von Sprachspielen existiert und dass das Sein unerkennbar bleibt. Goubran aber will in seinen Ritzungen das Wahre aus sprachlichen Autoritätsformen bergen.
Das ist eine in der Literatur der Gegenwart bereits selten gewordene Position. Sie ist historisch von einigem Interesse, denn Goubrans Hinwendung zur Essayistik erinnert gewissermassen an die ursprüngliche Einheit von Wort und Ton, von Musik und Sprache; er vollzieht in seiner Arbeitsbiographie jenen wirkmächtigen Prozess noch einmal nach, der am Beginn der westlichen Kultur stand.

Um das zu erklären, muss ich noch einmal ausholen. Blicken wir auf die Antike zurück. Bei den Griechen waren Ton und Sprache noch nicht in der Weise voneinander getrennt, wie es heute üblich ist. Texte wurden – wie auch in der hebräischen Lithurgie – grundsätzlich laut gelesen und halb gesungen. Diese Einheit begann mit der Entstehung einer rein sprachlichen Prosa ab dem 4. Jahrhundert vuZ auseinander zu fallen. In der Folge mussten für das sakrale Wort eigene Regeln und verbindliche Notationsweisen gefunden werden, um es zum Singen zu bringen. Wir wissen, was daraus folgte: der Aufstieg der europäischen Kunstmusik.
Quasi im Gegenzug dazu wurde der Sprache von Sophisten und Rhetorikern, von Naturwissenschaftern, die man heute Vorsokratiker nennt, und von Philosophen ein eigenständiges Leben eingehaucht. Ein Leben neben der Poësie. Getrennt von der innigen Beziehung zur Ausdruckskraft des Gesangs machten diese Denker, Schwätzer und Redner die Sprache monotoner und ausdrucksärmer, Eindeutigkeit und Stimmigkeit der Aussage konnten verloren gehen, jedes Wort konnte nun auch böswillig umgedreht und gegen die Intention der Sprechenden gewendet werden.
Die Diskurskultur der Griechen pflegte eine enorme Abneigung gegen Fremdsprachen, doch sie entdeckte die inneren Bezüge der Wortbedeutungen, ritt auf ihnen herum wie eine Artistenschule. Die Diskurskultur stellte eine abstrakte Begriffswelt in einem Raum mit eigenen Gesetzen her, in heutiger Sprechweise: semantische Netze.
Als die Pythagoreer ein mathematisch genau quantifizierbares Tonsystem entwickelten, in dem sich gesetzmässig Wohlklang erzeugen liess, machten das die Eggheads der griechischen Antike zum Vorbild für alle Wissenschaften. Um zum Beispiel die heillos verknüpften Begriffe des Seienden und des Nichtseienden aufzulösen, suchten Philosophen die Verknüpfung von Wahrheitsaussagen als den Zusammenklang von zugrundeliegenden Begriffen, die auseinander gelegt werden müssen. Die westliche Kosmologie baut ihren gesamten theoretischen Erkenntnisapparat seither auf dieses System von gleichberechtigten Grundbegriffen auf.
Goubran nimmt etwa den Begriff Verdrängung her; er fragt, was für sie, die Verdrängung, Leistung und Wert besitzt und verknüpft die Fragestellung mit dem Gegensatz von Individuum und Kollektiv. Unter der Lupe des Soziologen beobachtet er dann, dass, wer in der Verdrängungsgesellschaft zuviel von sich zehrt und sein Leben nicht ausreichend auf die Ausbeutung anderer baut, den Exekutoren des Systems suspekt ist. In diesen logischen Schritten gelangt Goubrans Sprecheinsatz zum Begriff der »unmässigen Selbstverdrängung«. Der kennzeichnet nun einen Sachverhalt, der von der Verdrängungssociety als »unsozial« bewertet wird.

Wir haben es in dieser Essayistik also, wie bei den Griechen, mit dem Bemühen um eine universalen Sprache zu tun, die das Denken endgültig von allen Doppeldeutigkeiten säubert und befreit. Doch, Achtung: Der Text kann Sprache als Herrschaftsinstrument letztlich nicht entmachten; ihre Demokratisierungsabsicht und ihre Forderung einer allen zugänglichen Bildung mit der Aussicht auf Chancengleichheit verpufft grossteils zugunsten einer Rede, die eine neue Fremdheit produziert. Vor unseren Augen entsteht im theoretischen Diskurs ein Denkkonstrukt, über das sich kognitive Abhängigkeitsmuster entwickeln und an dem sich Distinktionsbedürfnisse des Autors und seines Milieus entfalten.
Goubran ist also mit seinem Spracheinsatz gegenüber den Mängeln der Begriffsprache ähnlich machtlos wie es die Philosophen gegen den Rhetoriker und die Aufklärer gegenüber der Romantik waren. Was sich an seiner Essayistik erkennen lässt, ist dass er bei seinem Versuch, genaue Aussagen über die Gegenwart zu machen, den Ursprung unserer gespaltenen Kultur noch einmal aus sich selbst gebiert. Goubran denkt beim Schreiben an ein Jenseits der eigenen Vernunft. Darum kann er entschlossen Nein zur Verdrängungsgesellschaft sagen und dabei zugleich das unvermeidliche Ja zur Sprache als Diskursmacht in Kauf nehmen.
© Wolfgang Koch 2020
Abbildungen: Admont, Foto © Marie Obermayr 2020
Alfred Goubran: Schmerz und Gegenwart. Ritzungen, 120 Seiten, Braumüller Verlag 2019, ISBN-10: 3992002543, 15,- Euro