Die verholzte Pflanze Baum besteht laut Wikipedia aus einer Wurzel, einem darauf emporsteigenden, hochgewachsenen Stamm und einer belaubten Krone.
.
Vor dem Hindu-Tempel in Neukölln wird ein “Ficus religiosa” gepflanzt, ein Feigenbaum. Die Inder haben ein besonderes Verhältnis zu Bäumen und (heiligen) Hainen. Um es näher kennen zu lernen, leistete die Tochter einer Freundin, Maya, ihr ökologisches Jahr am Fuß des Himalaja ab, wo sie sich am Widerstand von Waldbewohnern beteiligte, die sich gegen das Fällen “ihrer” Bäume wehrten. Zuletzt ketteten sie sich an die Bäume an. Ihre Mutter war von Mayas Widerstands-Schilderungen so begeistert, dass sie ihren Job in einer Werbeagentur kündigte und nach Indien zog. Sie ist jetzt in dem Alter und in einer ähnlichen Situation wie der indische Psychoanalytiker Sudhir Kakar, als der in seiner Autobiographie: “Die Seele der Anderen – Mein Leben zwischen Indien und dem Westen” schrieb: “Nach der Scheidung von meiner Frau begann für mich ‘Vanaprastha’, der ‘Rückzug oder die Abreise in den Wald’, die dritte Lebensstufe, auf der man sich nach und nach aus rein familiären Dingen zurückziehen und für die größere Gemeinschaft engagieren soll. Es ist ein Wechsel von der Praxis der ‘Lebenskunst’ (so würde ich ‘Dharma’ in diesem Kontext übersetzen) hin zur Weitergabe dessen, was man als Wesentliches dabei gelernt hat…”
Der Schweizer “Blick” meldete kürzlich: “Ungewöhnliche Aktion zum Tag der Umwelt: In einem nepalesischen Wald haben sich über 2000 Menschen versammelt, um Bäume zu umarmen. Ziel der Gross-Aktion: Den Weltrekord im Bäume-Umarmen zu brechen und damit ins Guiness-Buch der Rekorde zu kommen.”
Die Junge Welt berichtete am 23.9. aus Indien über die weltweit am Sonntag zuvor organisierten Demonstrationen gegen den „Klimawandel“: „…Auf der Abschlußkundgebung in Neu-Delhi sprach Ritu Asrani, eine Überlebende der Überflutung in Jammu und Kaschmir. Wie mehr als 80000 Landsleute hat sie alles verloren, ihr Dorf versank wie 2500 andere unter der Wasserwalze. Ritu war noch immer erschüttert über das Erlebte. Sie stimmte der Menschenrechtsaktivistin Vandana Shiva zu, die kürzlich kritisiert hatte, daß Politiker und Medien solche Ereignisse gewöhnlich als »Naturkatastrophen« kommentieren. In den meisten Fällen seien Überflutungen, Erdrutsche und ähnliche Vorkommnisse jedoch von Menschen verursacht, die »im Namen von Entwicklung« Raubbau an der Natur betreiben, Flußauen bebauen, Staudämme errichten und Wälder vernichten.
Vertreter der indigenen Bevölkerung aus dem Bundesstaat Madhya Pradesh berichteten über ihren Kampf gegen Bergbauunternehmen, die für ein Kohlebergwerk Wälder roden, Dörfer abreißen und die Lebensgrundlage von über 14000 Menschen zerstören wollen…
Indien, so machte eine wissenschaftliche Studie des »Intergovernmental Panel on Climate Change« deutlich, gehört zu jenen 50 Staaten, die vom Klimawandel besonders gefährdet sind. Dem Land drohen eine weitere Verknappung der Wasserressourcen, ein Rückgang der nutzbaren Ackerflächen und dadurch eine Gefährdung der Landwirtschaft und damit der Nahrungssicherheit für Millionen Menschen.“
.
Rana Dasgupta schreibt in seiner Reportage über “Delhi – Im Rausch des Geldes” (2014) u.a. über die Korruption im Zusammenhang der “Commonwealth Games 2010” in Delhi: “Die vielen tausend Bäume, die gepflanzt wurden, um die scharfen Kanten von so viel neuem Beton zu kaschieren, sind längst verdorrt, so als sei nie geplant gewesen, dass sie die Spiele überdauern.” In einer Straße mit kleinen Handwerksbetrieben im Stau stehend sieht der Autor, dass “die Pumpe am Straßenrand ununterbrochen in Betrieb ist. Mit Eimern, Flaschen und Plastikkanistern strömen die Menschen zu ihr hin. Daneben steht eine ausladende Pappelfeige, um die herum Shiva- und Durgastatuen aufgestellt sind. Eine große Frau mit entblößten Brüsten sitzt darunter und brabbelt vor sich hin.” In einem Gespräch erfährt er – über die neue Mittelschicht und ihre Asozialität: “Neulich war in meiner Strasse eine Hochzeitsfeier, und die haben vor meinem Haus ein Festzelt aufgebaut. Ein Baum stand im Weg, und sie haben ihn kurzerhand gefällt, bloß um ihr Zelt aufzubauen. Sie haben einen in vierzig Jahren gewachsenen Baum für eine einzige Feier gefällt. Die begreifen überhaupt nichts.”
.

.

.
In einem Artikel über den im “Kaschmir-Konflikt“, der sich 2002 zu einem Atomkrieg auszuweiten drohte, erwähnte die in Neu-Delhi lebende Autorin Arundhati Roy kurz ihren Mann: “Er schreibt gerade ein Buch über Bäume. Es gibt darin ein Kapitel über die Befruchtung von Feigen, wie jede Feige von ihrer spezialisierten Feigenwespe befruchtet wird. Es gibt fast 1.000 verschiedene Arten von Feigenwespen. Alle diese Feigenwespen würden atomisiert sein – wie mein Mann und sein Buch.”
Der indische Feigenbaum (Ficus benghalensis) dient in Indien vielerorts als Dorfmittelpunkt. Er kann sich zu einem ganzen Hain auswachsen. Der Banyanbaum, wie er dort auch heißt, wächst laut ‘academic.ru’ “epiphytisch auf einem beliebigen Wirtsbaum, der zunächst keinen Schaden nimmt, da der Banyan kein Schmarotzer ist. Er sendet Luftwurzeln aus, die sich mit der Zeit zu einem dichten Netz entwickeln. Haben die Wurzeln den Boden erreicht, kommt es zu einem Wachstumsschub, da die Pflanze nun nicht mehr ausschließlich auf das Substrat, das sich auf dem Wirtsbaum angesammelt hat, angewiesen ist. Mit zunehmendem Wachstum wird der Wirtsbaum erdrückt und stirbt schließlich ab. Die Bezeichnung “Banyan” geht auf banyas, hinduistische Händler am Persischen Golf, zurück. Diese versammelten sich unter bestimmten Bäumen; der Name wurde von Europäern auf die Bäume übertragen.”
Der Südasien-Korrespondent der FAZ, Thomas Ross, hat 1991 ein schönes Buch über Indien veröffentlicht, in dem der Subkontinent im wesentlichen durch den Konflikt eines Dorfes im Bundesstaat Bihar mit der Staatsmacht erklärt wird. Die Dörfler wehren sich gegen den Bau eines Staudamms. Er würde vielleicht für das Bruttosozialprodukt Bihars gut sein, aber sie würden einen Teil der Felder verlieren und sogar ihren Feigenbaum. “Der Tod des heiligen Baumes. Ein Bericht aus dem innersten Indiens” heißt das Buch, in dem der Autor mit Empathie die spirituellen Versammlungen unter dem Banyan-Baum schildert, auf denen die Dorfbewohner sich für ihren Widerstand Entschlußkraft holten. „Für die Bewohner des Dorfes war das Banyanbaum eine Verkörperung des ewigen Lebens, wuchs er nicht ununterbrochen, dehnte sich weiter und weiter aus…“ Ihr Widerstand begann mit der Nachricht, das die Regierung ihre Staudammpläne verändert habe, nun sollte auch der Platz ihres heiligen Banyanbaumes überflutet werden: “Nach einer alten indischen Tradition im Kampf für Bäume und Wälder banden sich die Freiwilligen an die Stämme.” Der Widerstand endete dann auch am Banyanbaum – in einem “Blutbad”.
Staudamm- oder Brunnen-Bau, darum ging es in dem Konflikt, d.h. um “Große Technik aus der Stadt oder Kleine Technik aus dem Dorf,“ oder „Stadtwissenschaft gegen Waldwissenschaft,“ wie Ross schreibt. Im widerständigen Dorf gibt es einen Sannyasi: „Indien sei im Wald geboren,’ sagt er“. Die indische Kultur war als „aranya samskriti“, als „Waldkultur“ bekannt, sie sei „allezeit mit dem Wald verbunden“. Die „westliche Stadtwissenschaft, sagte er weiter, will die Natur unterwerfen, die indische Waldwissenschaft hingegen sucht die Harmonie mit ihr.“ Er wollte nicht glauben, „dass die Waldwissenschaft auch in Indien längst der Stadtwissenschaft gewichen ist.“
In seiner Reportagesammlung “Bombay Maximum City”erwähnt der Autor Suketu Mehta einen Slum, der “unter hoch aufragenden Banyan-Bäumen” errichtet wurde. In Bombay wird andauernd eine Straße, ein Platz oder ein Viertel offiziell umbenannt; “die Bezeichnungen der echten Stadt werden, ähnlich wie die Veden, mündlich weitergegeben. Viele Viertel Bombays sind nach den Bäumen und Wäldchen benannt, die es früher dort gab.” An anderer Stelle erwähnt der Autor einen “Mandelbaum vor dem Kinderzimmer” in seiner Wohnung, “der uns eines Morgens mit einem leuchtend roten Blatt zwischen all den saftig grünen Blättern überrascht…” Als er aus dem Ausland zurück kommt, registriert er, “wie der Banyan-Feigenbaum, der an der Bushaltestelle Schatten spendet, gewachsen ist.” Eine Nachtclub-Tänzerin erzählte ihm, “wie sie ihren eigenen Körper und dessen Freuden entdeckte. Die Mädchen im Dorf waren keine Unschuldsengel; sie hatten Sex mit Auberginen, intime Beziehungen zu Bäumen.”
Über die „Naxaliten“, eine Art maoistische Waldguerilla, veröffentlichte die Schriftstellerin Arundhati Roy nach einem Besuch bei ihnen im Wald ein Buch, das auf Deutsch “Wanderung mit den Genossen” heißt. Ein Rezensent schrieb: “Roy ist mit den Genossen durch die Wälder Dandakaranyas marschiert, hat Gespräche geführt, mit ihnen getanzt und ihre Lieder gesungen. In jeder Zeile des Textes spürt man den Stolz jener Kämpferinnen und Kämpfer, die ihr Leben riskieren für den Traum einer anderen Gesellschaft.” Der Wald ist 60.000 Quadratkilometer groß, in ihm gibt es tausende Dörfer, in denen Millionen Menschen leben. Roy schreibt: “Jedes Dorf hat eine Gruppe von Tamarinden-Bäumen, die es beschützen, wie eine Umklammerung durch riesige, wohlmeinende Götter. Süße Bastar-Tamarinden.” Die Autorin wurde im Wald zu einem “Fan der Tamarinde”. Die Walddörfer wurden immer wieder von Forstbeamten überfallen: “Sie brachten Elefanten mit, um die Felder niederzutrampeln und streuten im Vorübergehen Babool-Samen (von Duft-Akazien), um den Boden unbrauchbar zu machen.” Die Naxaliten haben ein “Dschungel-‘Ressort'” eingerichtet, selbst die Regierung mußte zugeben, “dass der Wald im Naxal-Gebiet zugenommen hat.” Die Dörfler wandten sich von den Dorfhäuptern (Mukhias) ab und der maoistischen Partei zu: “Sie boten ihm auch nicht mehr den Ertrag ihres ersten Tages des Mahwa-Pflückens oder das selben von anderen Waldprodukten an.”
Beim Mahwabaum handelt es sich um den Milchsaft führenden “indischen Butterbaum”. Seine Samen liefern die Phulwarabutter (Choorie), ein talgartiges, weißes Fett, das bei 49° schmilzt, nicht leicht ranzig wird und zu Seife, ferner als Brennmaterial, und auch medizinisch verwendet wird. “Wir lagern außerhalb des Dorfes Usir unter riesigen Mahwa-Bäumen,” schreibt Arundhati Roy an einer Stelle. An einer anderen erwähnt sie, dass jemand ihr die erste reife Frucht des Tendubaumes pflückte. “Sie schmeckt wie Chickoo (ein natürliches Kaugummi aus dem Breiapfel- oder Sapotebaum.” Beim Tendubaum (auch Ceylon-Ebenholz genannt) verwendet man die Blätter als Tabak für die zigarettenähnlichen Bidis). Der Sapotebaum hat apfelgroße, grünschalige Früchte deren Fruchtfleisch schokoladenbraun, sahnig und mild im Geschmack ist.
Während Arundhati Roy mit den Genossen durch den Wald wandert, haben die Mangi- und die Chironji-Bäume zu blühen angefangen. Der Chironji Baum gehört zur Anacardiaceae Pflanzenfamilie. Das Chironji Öl wird aus diesem mittelgroßer Baum extrahiert. Dieser Laubbaum wird bis zu einer maximalen Höhe von 20 Metern. Chironji Bäume gelten den Waldvölkern als die besten Bäumen, um die leeren oder blanke Waldflächen aufzuforsten. “His seeds are used as a cooking spice,” heißt es auf Wikipedia, “after the hard shell is cracked, the stubby seed within is as soft as a pine nut.” Die Dorfbewohner von Kudur übergeben Arundathi Roy “eine Liste über 71 Arten von Früchten, Gemüse, Hülsenfrüchten und Insekten, die sie aus dem Wald gewinnen und auf den Feldern anbauen – mit samt den Marktpreisen. Es ist auch eine Karte von ihrer Welt.” 2004 veröffentlichte V.S.Naipaul bereits einen Roman über diese indische “Guerilla”: “Magische Saat”. Es ist dies der zweite Teil einer fiktiven Biographie eines Inders namens Willie Chandran, die erste hieß “Ein halbes Leben”. Der zweite Teil besteht vor allem aus Willies siebenjährigen Aufenthalt bei den Naxaliten im “Teak-Wald”. Er ist das genaue Gegenteil von Arughati Roys Bericht über ihre Wanderung mit einigen Naxaliten durch ihr befreites Gebiet: bösartig und dumm, aber die darauffolgenden Kapitel, die in England spielen, sind noch bescheuerter. Und statt von Bäumen ist meist vom Wald die Rede: “Wir waren immer in den Wäldern unterwegs”, heißt es z.B. an einer Stelle, an einer anderen ist von “schattenspendenden Paternosten- und Flammenbäumen am Straßenrand” die Rede.
Wie die PKK haben die Naxaliten inzwischen eine eigene Frauenorganisation, mit 90.000 eingeschriebenen Mitgliedern. Den Anfang machte eine ältere Indigene, die sich in Form eines Liedes beklagte, dass es bei ihnen, den Maadiya, Sitte ist, dass die Frauen nach ihrer Verheiratung barbusig herumlaufen müssen – dies wollten sie nicht mehr. Die kämpfenden jungen Frauen tragen jetzt nicht selten einen Bubikopf, das bedeutet “Maoistin”. Sie sind damit dem Tode geweiht, wenn sie Polizisten, Soldaten oder Sondereinheiten in die Hände fallen. Wie bei der PKK gehören zur Frauenmiliz auch viele junge Mädchen, die es zu Hause nicht mehr aushielten und weg wollten: “In unserem Dorf war es z.B. den Mädchen nicht erlaubt, auf Bäume zu klettern,” erzählte eine.
Arundhati Roy wandert zuletzt mit ihrer Naxaliten-Truppe durch das Tal des Indravati-Flusses – zu einer Protestkundgebung im Dorf Kudur, auf der es um die Frage geht, wie man den Bau eines Staudamms dort in der Nähe verhindern kann: “Der Bodhghat-Damm wird das gesamte Gebiet überfluten, durch das wir tagelang gewandert sind. Den ganzen Wald, die ganze Geschichte, alle die Geschichten. Mehr als 100 Ortschaften.” Die Autorin hatte zuvor im Bundesstaat Gujarat den beinahe fertigen Sardar-Sarovar-Stausee gesehen, auch dort gab es eine Bewegung gegen den Staudamm-Bau. Alles, was sie befürchtet hatten, ist inzwischen eingetreten: Man hat die Leute verjagt, die versprochenen Kanäle wurden nicht gebaut und es gab kein Geld. “Es gab eine Zeit, wo man glaubte, dass große Staudämme die ‘Tempel des modernen Indiens’ seien [wie Nehru sie nannte] – aber das war falsch, wenn auch vielleicht verständlich.” Aber heute muß man feststellen, “dass große Staudämme ein Verbrechen gegen die Menschheit sind.” (Und die weltweit größten befinden sich noch in der Planung – in China, Indien, Nicaragua usw.)
Die Naxaliten bzw. einer ihrer Aktivisten stellte sich auch in dem widerständigen Dorf von Thomas Ross ein. Er sprach beim Alternativvorschlag „Einrichtung eines Tiefrohrbrunnens“ von einer „Kleinen Dorftechnik“, die im Gegensatz stünde zur „Großen Stadttechnik“ der Staudammverehrer. Und meinte: „Die Städte haben sich gegen die Natur abgeschottet.“ So lockere z.B. der Holzpflug, den noch heute Millionen und Abermillionen indische Bauern benutzen, den Boden nur, während der mit dem Traktor gezogene Tiefpflug das millionenfache Mikrobenleben in der Erde vernichtet. Wenn man dem Ökologen Josef Reichholf folgt, dann geschieht hierzulande genau das Gegenteil wie in Indien: Dass die Dörfer sich mehr und mehr gegen die Natur abschotten, während die Städte sich ihr öffnen. Es sind jedoch dort wie hier vorwiegend junge Mittelschichtsangehörige, die sich für den Natur- und Umweltschutz engagieren – und radikalisieren.
Auch die politisch engagierte Arundathi Roy gehört noch dazu, weswegen einige Marxisten, die in einem Slum von Bombay politisch arbeiteten, sie 1999 als Privilegierte abtaten. In Roys berühmten Roman “Der Gott der kleinen Dinge”, der in dem Dorf im Bundesstaat Kerala spielt, in dem sie aufwuchs, kommt im übrigen auch ein “Stauwehr” vor, der aus dem Fluß vor ihrem Geburtshaus eine Kloake machte, dafür aber den Bauern höhere Erträge ermöglichte: “Mehr Reis für den Preis eines Flusses.” Einen Banyanbaum gab es in ihrem Dorf natürlich auch.
Ross’ und Roys Bücher sind gewissermaßen lokale Tiefenbohrungen, Einen Überblick über “Indien – Marktmacht, Hindunationalismus, Widerstand” heute gibt ansonsten das gleichnamige Buch von Dominik Müller, das soeben im Verlag “Assoziation A” erschienen ist. Zuvor war im selben Verlag bereits ein Indienbuch von Elina Fleig, Madhuresh Kumar und Jürgen Weber erschienen: “Speak Up! Sozialer Aufbruch und Widerstand in Indien”. Es besteht in der Hauptsache aus Interviews mit indischen Aktivistinnen. Ein Kapitel thematisiert “Den Kampf um den Wald”, ein anderes “Den Kampf gegen Staudämme im Narmada-Tal”. Beide von Deutschen veröffentlichte Bücher sowie das von Georg Blume und seinem FAZ-Kollegen über Indien geschrieben offenbaren aufs allerdeutschlichste deren Sichtweise auf Indien, indem sie das Land nach unseren gängigen sozialen Topoi abscannen: Arbeiterkampf, Feminismus, Gendertrouble, Schwule, Öko, Gewaltfreiheit, keine Korruption, saubere Marktwirtschaft usw. All das langweilt fürchterlich: Schönheit findet man doch nur im Überraschenden – oder nicht?!
(Erwähnt sei hier dennoch: Anja Flach, die von 1995 bis 1997 in den fast baumlosen kurdischen Bergen bei der Frauenguerilla der PKK mitkämpfte; sie schreibt 2003 in ihrem zunächst vom BKA konfiszierten Bericht “Juyaneke din – ein anderes Leben”: “Eins hat mir sehr gefallen: Ein Walnussbaum und eine Traubenrebe haben panische Angst, wenn die Guerilla kommt, sie fürchten sie mehr als die Soldaten, ganz zerfleddert sehen sie aus. Ein Kommandant kommt und verbietet, die Bäume anzurühren – ja, langsam setzt sich so eine Haltung durch, Naturschutzguerilla.” )
Wenn man vom heiligen Banyanbaum, der bengalischen Feige spricht, muß man auch den Bodhibaum erwähnen, die Pappel-Feige (ficus religiosa), unter der Buddha erleuchtet wurde. In der Tempelarchitektur Sri Lankas wurde es laut Wikipedia üblich, “eigens Bodhi Gara genannte offene Gebäude um einen lebenden Bodhi-Baum zu errichten, der jeweils ein Ableger des wahren Bodhi-Baums in Anuradhapura sein muss. Auch in Tempelanlagen Südostasiens, beispielsweise den Wats in Thailand, ist meist mindestens ein Bodhi-Baum zu finden, der zum Vesakh-Fest während des Vollmondes im April oder Mai im Mittelpunkt von Riten steht.” Alle Feigenbäume leben in Symbiose mit einem Insekt.
Bei solch einem Zusammenwirken gibt es “die verrücktesten Formen gegenseitiger Abhängigkeiten,” heißt es in einem Text des “Schweizerischen Zentrums für Bienenforschung”, “auf die Spitze getrieben haben es dabei Feige und Feigenwespe.” Bei der Feigenfrucht handelt es sich genaugenommen um Blütenbehälter, es gibt sie an zwei Baumtypen: die männliche “Bocksfeige” entwickelt nur ungeniessbare Feigen mit männlichen sowie mit sterilen, kurzgriffligen weiblichen Blüten. Der weibliche Feigenbaum bildet dagegen ausschließlich “Essfeigen” mit fruchtbaren, langgriffligen weiblichen Blüten. Das Weibchen der Feigenwespe “dringt in den engen Eingang der männlichen Feige ein, oft fallen dabei sogar Flügel und Fühlerteile ab, und legt seine Eier in die kurzgriffligen weiblichen Blüten.” Durch die Eiablage bilden sich aus den Blüten Gallen. Zuerst schlüpfen die Männchen aus ihnen – und begatten die jungen Weibchen, “die noch geschützt in den Blüten harren.“ Wobei die Männchen die Blütenstände anschließend nicht mehr verlassen. Durch die Löcher, die sie in die Feige bissen, um zu den Weibchen zu kriechen, gelangen jedoch die befruchteten Weibchen mit Pollen beladen ins Freie, um die langgriffligen weiblichen Blütenstände der echten Feigen anzufliegen und zu bestäuben. Zur Eiablage müssen sie dann jedoch wieder eine männliche Brutfeige aufsuchen, damit daraus Nachkommen werden können. “Verirrt sich ein Weibchen in eine weibliche Feige, werden die Blüten zwar großzügig bestäubt, da die Griffel aber zu lang zur Eiablage sind, bleiben Nachkommen aus,“ schreiben die Schweizer Bienenforscher. Für Wikipedia sind dagegen nicht die Griffel der Blüten zu lang, sondern die “Legebohrer der Weibchen zu kurz” – um den “Fruchtknoten zu erreichen”. Kurz gesagt: Wenn ein befruchtetes Weibchen eine weibliche Feige anfliegt, wird diese befruchtet, aus ihren dort eventuell auch noch abgelegten Eiern wird aber nichts. Wenn sie dagegen eine männliche Feige anfliegt, ist es umgekehrt.
Dies gilt jedoch nicht für alle Feigensorten, was die Sache noch komplizierter macht. Man unterscheidet im Westen drei Typen: 1. die „Adria-Feige“ – ihre Früchte entwickeln sich ohne Bestäubung und enthalten daher auch keine Kerne. Um bessere Erträge zu erzielen, werden sie sozusagen künstlich befruchtet, mit einem Verfahren, das man „Kaprifikation“ nennt (von caprificius – „wilder Feigenbaum“ auf lateinisch), dabei werden Zweige dieses männlichen Baumes in den weiblichen Feigenbaum gehängt, damit die ausschlüpfenden Wespenweibchen die Blütenstände bestäuben. „Dieser schon von Theophrast und von Plinius beschriebene Gebrauch hat sich in vielen Gegenden bis zum heutigen Tage erhalten,“ schreibt Oskar von Kirchner in: „Blumen und Insekten“. 2. die „Smyrna-Feige“ – sie trägt nur Früchte, wenn sie von der Feigenwespe bestäubt wird. Diese Erfahrung mußten kalifornische Obstbauern machen, nachdem sie Smyrna-Feigenbäume importiert hatten: Erst als sie auch noch Feigenwespen dazu erwarben, trugen die Bäume Früchte. 3. die „San Pedro Feige“ – dabei „handelt es sich um einen Zwischentyp. Die Früchte der ersten Haupternte wachsen komplett ohne Bestäubung, bei der zweiten Ernte erfolgt hingegen eine Bestäubung wie bei der Smyrna-Feige,“ heißt es im „lexikon huettenhilfe.de“.
Schon Georg Wilhelm Friedrich Hegel ging 1830 in seiner Vorlesung “Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse”, als er auf “Die vegetabilische Natur” zu sprechen kam, auf die Feige und die Feigenwespe ein. Für ihn war es noch “eine berühmte Streitfrage in der Botanik, ob wirklich bei der Pflanze erstens Sexualunterschied, zweitens Befruchtung wie bei den Tieren vorhanden“ sei. Er ging indes von der Geschlechtslosigkeit der Pflanzen aus, selbst bei den Zweigeschlechtlichen, “weil die Geschlechtsteile, außer ihrer Individualität, einen abgeschlossenen, besonderen Kreis bilden.” Zudem sah er für ihre “Begattung”, d.h. Bestäubung der Blüten, keine Notwendigkeit, es ist etwas “Überflüssiges: Luxus”, denn die Pflanzen können sich z.B. auch durch Ableger, Sprossen usw. vermehren. In bezug auf die “Reife der Frucht” bei den weiblichen Feigenbäumen, die von der Gallwespe befruchtet werden, folgte er in seiner Darstellung dem Biologen Franz Schelver, der meinte, es käme dabei auf das Verletzen der Frucht durch das Insekt an – und nicht auf den von ihm übertragenen Pollen. Da diese Kaprifikation “nur gegen das Klima notwendig“ sei. Noch 1894 verstand das Brockhauslexikon unter Kaprifikation das „Anstechen“ der Feigen durch die Wespe, um ihre Eier hineinzulegen. Der Botaniker Hermann Graf zu Solms-Laubach hatte jedoch schon 1885 den genauen Befruchtungsvorgang entdeckt und beschrieben – das „Anstechen“ oder „Einritzen“ der Frucht war nicht der Punkt. 2012 kam aber der israelische Botaniker Daniel Chamowitz (in seinem Buch „Was Pflanzen wissen“) noch einmal darauf zurück: „Die alten Ägypter schlitzten [vor der Ernte] ein paar Feigen auf, um die Früchte eines ganzen Baumes reifen zu lassen,“ schrieb er. Und dies geschah, weil sich dadurch ein Pflanzenhormon, Ethylen, „das für die Reifung der Früchte zuständig ist,“ verbreitet.
Hegel hatte seinerzeit die Schelversche Feigenschlitztheorie dahingehend ergänzt, dass “in unseren Gegenden, wo der männliche Baum und das Insekt fehlen, die Samen der Feigen nicht vollendet werden.” Letztlich wollte er jedoch mit seinem Feigenbeispiel auf etwas ganz anderes hinaus: “Die Verstäubung ist für sich selbst Zweck der Vegetation, – ein Moment des ganzen vegetativen Lebens, welches durch alle Teile geht und endlich für sich selbst durchbrechend, nur die Absonderung seiner Erscheinung in den Antheren [Staubbeuteln] erreicht.” Anders gesagt: Da die Blüte selbst ein Moment des “Fürsichseins” ist, kann die Pflanze als Ganzes “nie eigentlich zum Selbst kommen”. Nicht erst die Befruchtung ihrer Blüten, sondern ihr bloßer Wachstumsprozeß ist bereits “Produktion neuer Individuen”. Dennoch oder gerade deswegen ist für Hegel, mit Heidegger gesprochen, die Pflanze irgendwo zwischen dem weltlosen Stein und dem weltarmen Tier angesiedelt. Auch der heiligste Banyan-Baum.
.
Dazwischengeschoben:
.
Die F.R. überschrieb am 9.10.2014 einen Artikel mit “Mission Impossible”. Es ging darin über Nikita Dhawan, Professorin für Politikwissenschaft, sie verlässt die Frankfurter Goethe-Universität, die ihr keine Festanstellung geben wollte. Die Inderin erforscht, wie sich europäische Normen und Vorstellungen durch den Kolonialismus global durchgesetzt haben. Sie fordert, die deutschen Hochschulen zu dekolonisieren. Vom Kolonialismus geprägte Denkmuster seien bis heute vorherrschend, wenn sich die Forschung mit den Ländern des globalen Südens beschäftigt, sagt Nikita Dhawan. Wie sich das antikoloniale Denken gegen den imperialistischen Westen seit dem Seesieg der Japaner im Krieg gegen die Russen 1905 bis heute artikulierte, hat der indische Schriftsteller Pankaj Mishra in seinem Buch “Die Revolte gegen den Westen und der Wiederaufstieg Asiens – Aus den Ruinen des Empire” nachgezeichnet. Die wichtigsten Stimmen daraus finden sich in meinem blog-eintrag “Ursprünge des europäischen Denkens” vom 10.4.2014. Mishra zitiert u.a. den indischen Ministerpräsidenten Nehru, für den der gravierenste Eingriff der englischen Kolonialmacht in Indien darin bestand, dass sie das Agrarsystem zerschlugen, Privateigentum und Großgrundbesitz einführten. Über die darauffolgende indische Dynastie der “Nehrus und Ghandis” lohnt es sich im übrigen, Tariq Alis dickes Buch darüber zu lesen. Zwar kommen Bäume darin so gut wie nicht vor, außer die im Garten der Nehrus in Delhi und “dichte Palmwälder” hier und da, aber man erfährt dort, dass der Atheist Jawaharlal Nehru, als er 1964 starb, auf einem hinduistischen Scheiterhaufen verbrannt wurde, der aus Sandelholz bestand. “Der Sandelbaum ist eine Heilpflanze aus der Familie der Schmetterlingsblütengewächse, hierzulande findet er in Tee Verwendung”, heißt es auf “paradisi.de”. Zu Ghandis Asketismus zitiert Ali einen Abgeordneten der Kongreßpartei: “Es kostet uns eine Menge Geld, Ghandi arm zu halten.” (Es mußte z.B. immer frische Eselsmilch für ihn bereit stehen)
Auf die Spuren von Gandhi, der sich für den Schutz von Bäumen stark machte, hat sich auch der ehemalige Indien-Korrespondent der taz, Bernhard Imhasly, begeben. Sein Reisebericht hat den Titel “Abschied von Gandhi?”. Darin scheint mir noch weniger von Bäumen die Rede zu sein. In Ahmedabad übernachtete er in einem verdreckten Hotel “direkt neben der wichtigsten Gedenkstätte des ‘Vaters der Nation'”. Dennoch ärgerte er sich nicht lange, “das erste Licht, das durch die beiden Mangobäume im Garten strömte, stimmte [ihn] versöhnlich.” Als er eine Organisation von Frauen aus den unteren Kasten, die Self-Employd Women’s Association (SEWA), besucht, erklärt eine der Aktivistinnen ihm die Struktur ihrer großen Organisation. Weil er nicht mehr mitkam, sagte sie: “ich verdeutliche es ihnen anhand des Wachstums eines Banyan-Baumes, aus dem schließlich ein ganzer Wald wird: “In Andhra Pradesh, so lernen Schulkinder in Indien, wächst der größte Banyan-Baum der Welt, mit einem Durchmesser des Blätterdachs von über hundert Metern.” Beim Besuch eines Büros der “Bewegung zur Stärkung der Landarbeiter” in Devdungri bemerkt Imhasly: Vor dem Gebäude “lud lediglich ein schattiger Neem-Baum zum Verweilen ein.”
.
Der Neem-Baum ist laut “heilkraeuter.de” ein indischer Straßenbaum, der in einer einzigartigen Kombination von Inhaltsstoffen, die gegen Insekten und Krankheitserreger wirken, sich selbst und auch die Menschen schützt. In Deutschland heißt er auch “Niem-Baum”, er liefert Bestandteile von Kosmetika. In Sohangarh hatten die Dörfler es mit juristischen Mitteln geschafft, einige hundert Hektar Land, das der Maharadscha trotz Bodenreformgesetze nicht rausgerückt hatte, überschrieben zu bekommen: “Der Staat gab sogar einen Zuschuß für die Bewaldung und eine Mauer um das Land. ‘Heute bezieht das Dorf sein Feuerholz aus diesem Wald,’ sagte mir Lal Singh stolz.” Als Imhasly den Barden der Naxaliten, Gaddar, trifft, singt dieser ihm ein Lied über die Opfer der staatlichen Killertruppen (“Greyhounds” genannt): “Wo bist du? Kommst du wieder zurück? Soll ich dich als Jamun-Baum finden?” Der auch Jambun genannte Laubbaum gehört zur Familie der Myrtengewächse. Er hat essbare Früchte und dient auch medizinischen Zwecken. Im Gespräch mit Gandhis Enkel Ramu meinte dieser zum Autor: “Die Ureinwohner haben Anrecht auf die Nutzung der Wälder, gleichzeitig müssen diese geschützt werden.”
.
Imhaslys Nachfolger als taz-Korrespondent in Indien war Georg Blume. In diesem Jahr veröffentlichte er zusammen mit dem FAZ-Korrespondenten Christoph Hein eine deutlich-deutsche Anklageschrift gegen Indien. An einer Stelle kommt darin der Bauer Azad Singh aus Zentralindien zu Wort, u.a. meinte er zu den beiden Autoren: “Wir haben die Bäume abgeholzt, dafür Dieselmotoren und Fabriken aufgebaut. Das Gleichgewicht ist gestört.” Dies sagt er im Zusammenhang mit dem allindischen Wasserproblem, dem Staudammbau und den alljährlichen Unwägbarkeiten des Monsun. Genaueres über diese “Wasserproblematik” in Indien und Pakistan erfährt man allerdings in dem 2014 erschienenen Weltwasser-Bericht des norwegischen Hydrologen Terje Tvedt, der auf Deutsch schlicht “Wasser” heißt, und als eine “Reise in die Zukunft” bezeichnet wird. Tvedt geht es in diesen Kapiteln insbesondere um die “Wasserpolitik” von Indien, Pakistan und China, wo alle großen indischen Flüsse entspringen. Bäume aus der Region habe ich keine in seinem feinen Buch gefunden. Dafür erwähnt V.S.Naipaul in seinem dritten Buch über “Indien: Land des Aufruhrs” (1990) eine Autofahrt durch den Bundesstaat Karnataka. An der Landstrasse hatten “ein Forstamt Gruppen von Eukalyptusbäume gepflanzt.” Sie spendeten “viele Kilometer weit erfrischenden Schatten”, waren dabei aber so erfolgreich gewesen, dass man sie schließlich alle umsägte: “Nach neuesten Erkenntnissen war der Eukalyptusbaum ein mörderisches Gewächs, das nach Feuchtigkeit gierte und den Acker, neben dem es stand, eher austrocknete als schützte.”
.
In seinem zweiten Indien-Buch, “Indien- eine verwundete Kultur”, bestehend aus den Eindrücken und Gesprächen während zweier Reisen durchs Land 1977 und 1984, notierte ich mir den Satz: “Hier hatte einmal Wald gestanden, aber gegen Ende der Dürre, es herrschte Hungersnot, hatte man ihn gefällt, weil man Holzkohle brauchte.” An anderer Stelle heißt es dort: “Armut erklärte nicht, warum es nirgends Bäume gab.” Aber vielleicht “Machtlosigkeit”? Kurz zuvor hatte ich in den “Indischen Reisebriefen” des Biologen Ernst Haeckel an seine Frau daheim (1901) von der “Ausrottung der Wälder” durch die englische Kolonial-Macht gelesen.
.
Naipaul zuliebe faßte sein Hindi-Dolmetscher ein feministisches Buch der indischen Dalit-Autorin Mallika zusammen, in der sie eine Geschichte erzählte, “worin der Baum selbst dem Holzfäller, der nur ein Axtblatt und keinen Stiel hatte, seinen Ast gibt.” An mehreren Orten seiner “Rundreise” durch Indien erwähnt Naipaul Sandelholzverwendungsarten, außerdem offene Feuer, in denen “Kampfer” verbrannt wird. Dabei handelt es sich wahrscheinlich um das Holz des Kampherbaumes (cinnamomum camphora), der 2000 Jahre alt werden kann. Das aus seinen Blättern gewonnene Kampfer gilt in Japan als Aphrodisiakum. In Arabien dient es medizinischen Zwecken. Heute wird es auch synthetisch hergestellt. Dem Kampferbaum dient sein Duft der Abwehr von Parasiten, diese olfaktorische Waffe wirkt auch auf uns segensreich.
Beim tiefblauen Farbstoff Indigo dachte man in Nordeuropa lange, er stamme vom indischen Indigobaum, dabei wurde die “Indigopflanze” schon in der Antike im Westen eingebürgert – und als “Färberwaid” hier angebaut. Heute wird der Farbstoff synthetisch hergestellt, Anfang des Zwanzigsten Jahrhrhunderts waren die englischen Tuchmacher jedoch noch ganz scharf auf das Original-Indigo, so dass sie den Anbau der ähnlich wie Raps gelb blühenden Pflanze, die zu den Hülsenfrüchtlern zählt, in ihrer indischen Kolonie forcierten. Auf seiner Gandhi-Recherchereise kam der Schweizer Autor Bernhard Imhasly in den Ort Motihari, den Gandhi einst zu seinem “Hauptquartier während seiner Indigo-Kampagne” gewählt hatte, die zu einem wichtigen Meilenstein auf dem Weg in die Unabhängigkeit Indiens wurde. Bernhard Imhasly erwähnt ferner, dass das Geburtshaus von George Orwell sich in Motihari befand (sein Vater war britischer Kolonialbeamter gewesen).
Mit der englischen Kolonisierung Indiens und der Provinz Burma beschäftigte sich George Orwell in seinem 1935 veröffentlichten Roman “Tage in Burma”. Vorangestellt hat er ein Motto von Shakespeare: “…In dieser unzugangbarn Wildnis/Unter dem Schatten melanchol’scher Wipfel…” Orwell Junior war fünf Jahre als Kolonialbeamter in Burma tätig gewesen, das die Engländer von Indien aus verwalteten, und lernte dort die brutalen rassistischen Kolonialmethoden kennen und hassen. Sein Roman spielt in einem Ort namens Kyauktada in Oberburma nicht weit von Mandalay. Getrennt von den Engländern lebten die Eingeborenen in einem Teil des Ortes, der “größtenteils zwischen grünen Hainen von heiligen Bobäumen versteckt war.” Bei dem Bobaum handelt es sich um die Pappel-Feige (Ficus religiosa). Die Burmesen sind mehrheitlich Buddhisten. Die Fischer z.B. werden verdammt, weil sie Fische fangen und töten, nicht aber die, die sie essen, denn die Fische sind dann ja schon tot.
Der Club der Engländer war von allerhand Blumen umgeben: u.a. von “riesigen Petunien, groß wie Bäume. Einen Rasen gab es im “Clubgarten” nicht, aber ein Gebüsch von einheimischen Bäumen und Sträuchern – goldgelbe Mohurbäume wie große Sonnenschirme mit blutroten Blüten, gallig grüne Krotons, gefiederte Tamarindenwedel.” Der “Kroton (Codiaeum variegatum), auch Wunderstrauch oder Krebsblume genannt, ist eine Pflanzenart, die zur Gattung Codiaeum innerhalb der Familie der Wolfsmilchgewächse (Euphorbiaceae) gehört. Viele Sorten sind Zierpflanzen in tropischen Parks und Gärten.” (Wikipedia) Der Mohurbaum oder Flammenbaum gehört zu den Johannisbrotgewächsen innerhalb der Fmilie der Hülsenfrüchtler, er wird auch Flamboyant genannt. In Jiddu Krishnamurtis “Ein Leben in Freiheit” heißt es an einer Stelle: “In dieser kargen Gegend, im Chittoor-Distrikt von Andhra Pradesh, in der es nur selten regnet, leben nicht viele Menschen. Tamarinden und Mohurbäume spenden Schatten und bieten ein farbenprächtiges Bild. Es war heilige Erde, punyasthal, wo jahrhundertelang Mystiker und Heilige gelebt und gelehrt hatten, deren Körper dort beerdigt wurden, um die Erde zu weihen.”
Über den englischen Club in Kyauktada schreibt Orwell: “Die Räume hatten mit Teakholz getäfelte Wände, die nach Erdöl rochen…” Der “Teakbaum (Tectona grandis) ist eine Pflanzenart aus der Familie der Lippenblütler (Lamiaceae). Heimisch ist er in den laubwerfenden Monsunwäldern Süd- und Südostasiens. Der Teakbaum liefert ein sehr wertvolles Holz und zählt zu den wichtigsten Exporthölzern des asiatischen Raumes. Die deutsche Bezeichnung Teak leitet sich über das Englische von Malayalam ab.” (Wikipedia)
Zwar sind die Clubmitglieder, es gibt nur eine Handvoll, nicht mit Erdöl, sondern im nahen Urwald mit dem Fällen und dem Abtransport von Teakholzbäumen beschäftigt, aber das Erdöl, das mit Brunnen aus der Erde geholt wird, spielt seit über 1000 Jahren eine wichtige Rolle in Burma. Und nach der Eroberung Burmas durch die Engländer auch für sie, denn mit ihrer Burmah Oil Company konnte der Marineminister Churchill die englische Flotte von Kohle auf Öl umstellen. Es ist Ausdruck kolonialen Denkens, wenn wie in den meisten Büchern über Erdöl gesagt wird, dass erst die Amerikaner im 19.Jahrhundert in Texas anfingen, Erdöl zu fördern. Siehe dazu: http://blogs.taz.de/hausmeisterblog/2007/09/25/bewegungsmeldungen-aus-burma/. Daneben spielt seit jeher auch das Teakholz eine wichtige Rolle: In Nordburma werden die Teakbäume noch heute massenhaft gefällt, mit Elefanten an die nächste Straße gezogen und dann mit LKWs nach China exportiert. Das selbe gilt für das in Indonesien illegal geschlagene Teakholz, das ebenfalls heimlich über Burma nach China verkauft wird.
.
Für den Ostberliner Elefantenpfleger Patric Müller hat die Situation in Burma etwas Paradoxes, wie er mir in einem Interview sagte: “Die Teakholzwälder werden massiv abgeholzt, das gibt jedoch den Elefanten Arbeit – und somit Schutz. Wenn es aber gelingt, den Handel mit Tropenholz einzudämmen, dann verlieren die Mahuts ihren Arbeitsplatz und die Elefanten ihre Daseinsberechtigung.”
.
Die Hauptfigur des Burmaromans von Orwell, Mr. Flory, “ging im Schatten der heiligen Bobäume [Die Pappel-Feige – Ficus religiosa, auch Buddhabaum, Bodhibaum, Bobaum oder Pepul-, Pepal-, Pipul- oder Peepalbaum genannt] die Basarstraße hinunter.”
Er stritt sich gerne mit dem indischen Arzt im Ort, mit dem er befreundet war. Ihm sagte er: “Glauben Sie, dass meine Firma z.B. ihre Holzverträge bekommen könnte, wenn ds Land nicht in der Hand der Briten wäre? Oder die anderen Holzfirmen oder die Ölgesellschaften oder die Grubenbesitzer und Pflanzer und Händler?” Der Arzt erwiderte: “Aber was würde aus den burmesischen Wäldern werden, wenn die Engländer nicht hier wären? Sie würden unverzüglich an die Japaner verkauft werden, und die würden sie ausrauben und zerstören. Statt dessen werden sie in ihren Händen tatsächlich verbessert.” Flory will natürlich nicht leugnen, “dass wir dieses Land in gewisser Hinsicht modernisiert haben.” Aber er sieht es bereits kommen, dass irgendwann alles verschwunden sein wird: “Wälder, Dörfer, Klöster, Pagoden. Überall auf den Hügeln eine Villa neben dem anderen. “Und alle Wälder abrasiert – zu Pulpe zermahlen für die ‘News of the World’ oder zu Grammophongehäusen zersägt. Aber die Bäume rächen sich, wie der alte Mann in der ‘Wildente’ von Ibsen sagt.”
Flory ging in den Dschungel. “Zuerst war es niedriger Busch mit dichtem, verkümmertem Gestrüpp, und die einzigen Bäume waren halbwilde Mangobäume, die pflaumengroße, terpentinhaltige Früchte trugen.” Der Weg endete an einem Fluß. Um Ufer “stand ein riesiger, abgestorbener Pyinkado-Baum mit Girlanden von spinnenartigen Orchideen…” Am englischen Friedhof standen gleich mehrere große “Pyinkado-Bäume”. Der Pyinkadobaum, auch Eisenbaum genannt, “kommt aus Südostasien und ist ein hoher Baum mit borkiger Rinde. Diese Feroniella kann sehr alt werden, hat gelbliche Blüten und bildet essbare, apfelgrosse Früchte aus. Sie hat glänzende, grüne, gefiederte Blätter, aus deren Blattachsel je ein Dorn wächst.”
Mr. Flory gelangte schließlich ins Nachbardorf, es hieß “Nyaunglebin – die vier heiligen Bobäume.” Während der Zeit der “Holzgewinnung” lebte Mr. Flory im Dschungel im Holzfällercamp. Dort gab es neben Arbeitselefanten eine kleine Eisenbahn, “mit der die Teakstämme zum Fluß geschafft wurden.” Aber die Bahn war kaputt, ein Elefant krank und die Kulis waren desertiert, “weil ihre Opiumration herabgesetzt worden war.”
Am Straßenrand unweit des Gefängnisses von Kyauktada “lagen die Bruchstücke einer steinernen Pagode, die durch die starken Wurzeln eines Bobaumes Risse bekommen hatte und eingestürzt war.” Außerhalb des Ortes an einem Teich wuchs ein anderer “Heiliger Bobaum, ein zwei Meter dicker abgestützter Stamm…Die Luftwurzeln dieses Baumes bildeten eine natürliche Höhle, in der klares, grünliches Wasser gurgelte. Oben und ringsum wehrte das dichte Laubwerk dem Licht und machte den Ort zu einer von Laub eingeschlossenen grünen Grotte.” Auf der Jagd kommt Mr. Flory zusammen mit einer jungen Engländerin an einem “weißdornartigen kleinen Baum” vorbei, vor dem ihre Treiber knien. “Was machen diese Männer?” fragt die junge Frau. “Nur ein Opfer für die Götter des Ortes…Sie beten zu dem Baum, damit er uns Glück bringt,” antwortete er. Später spazieren die beiden am Tennisplatz neben dem englischen Club vorbei, wo ein “großer Jasminbaum” steht. “Der Jasminbaum (auch Indischer Korkbaum, Millingtonia hortensis) ist die einzige Art der Gattung Millingtonia in der Familie der Trompetenbaumgewächse (Bignoniaceae). Der Gattungsname ehrt den britischen Botaniker Thomas Millington. Der Jasminbaum wird 8 bis 25 Meter hoch.” (Wikipedia)
Mr. Flory sah sich bereits mit der jungen Engländerin verheiratet: “Er sah seinen Salon, nicht länger schlampig und junggesellenhaft, mit neuen Möbeln aus Rangun und einer Schüssel von rosaroten Bobaumzweigen wie Rosenknospen auf dem Tisch.” Aber im sozusagen letzten Moment kam es anders…”Als er den Weg zum Club hinaufschritt, blies ein Windstoß durch die Pisangbäume, wirbelte die abgerissenen Blätter auf und brachte einen Geruch von Feuchtigkeit.” “Der Pisangbaum nähert sich hinsichtlich seines Wuchses und Anstandes den Palmen, er erzeugt eine Frucht, die an Feigen erinnert,” heißt es auf “academic.ru”. In seiner Heimat Indien wird er dann auch als Feigenbaum kultiviert. Seine Früchte sind in Größe, Farbe und Geschmack verschieden – am ehesten einer Gurke ähnlich. Ihr Saft ergibt ein weinartiges Getränk. Die Blätter dienen als Tischtuch, Servietten und zum Einwickeln, an manchen Orten werden damit auch Dächer gedeckt. Aus dem Stamm läßt sich eine Art Flachs ziehen. Der ganze Baum dient den Elefanten als Nahrung.
.
Erwähnt sei hier noch der ebenfalls in Indien geborene englische Schriftsteller Rudyard Kipling und sein Roman “Kim”. Er handelt von einem englisch-indischen Straßenjungen namens Kim, der sich einem tibetischen Wandermönch anschließt und gleichzeitig vom englischen Secret Service in Indien, “Ethnologischer Dienst” genannt, zu einem Spion ausgebildet wird: “Sie werden spionieren und vermessen und Karten zeichnen, natürlich.” Mit dem Mönch wandert er zunächst die von den Engländern angelegte “große Heerstrasse” entlang, “die das Rückrat von ganz Hind” ist. Zum größten Teil war sie “von vier Reihen Bäumen beschattet”. Kipling erwähnt nicht, ob es sich dabei um Eukalyptusbäume handelte, die die Engländer aus Australien importiert hatten. Später kommt sein Kolonialheld mit seinem tibetischen Guru auch in den Himalaja, wo sie durch riesige Nadelwälder, Rhododendren und “farrengefiederte Eichenwälder” wanderten, die schließlich Bambus und Palmen wichen. Kiplings Roman erinnert ein bißchen an die “Canterbury Tales”, die ebenfalls eine Pilger-Rahmenhandlung haben. Für die Kulturwissenschaftlerin Eva Horn hat Kiplings Buch aus dem Jahr 1901 einige Bedeutung als früher Spionage-Roman aus der Zeit des “Great Games”, wie sie in ihrem Buch “Der geheime Krieg. Verrat, Spionage und moderne Fiktion” ausführt.
.
Es gibt in Indien seit mindestens 2500 Jahren eine Religionsgemeinschaft, die eine radikale Form der Gewaltlosigkeit praktiziert und heute 10 Millionen Anhänger hat, aufgeteilt auf 84 Sekten: die Jainas. Sie haben ihren gesamten – oftmals nicht unwesentlichen Besitz – weggeben, z.B. Tierheimen gespendet,und ziehen besitzlos umher, sorgsamst darauf bedacht, kein Lebewesen zu töten, sie treten nicht einmal in eine Pfütze, weil sie dabei irgendwelche Kleinstlebewesen gefährden könnten und dazu noch “die Einheit des Wassers zerstören.” Im Süden gehen sie oft nackt, im Norden sind sie meist mit zwei Tüchern bekleidet, wobei sie solche aus Seide bevorzugen, weil bei ihrer Herstellung nur “zweisinnige” Wesen umkommen, während bei der industriellen Stoffherstellung eventuell “fünfsinnige” Wesen – Arbeiter und Arbeiterinnen – zerstört werden. Auch dem Glauben an Gott, als eine der wichtigsten weltlichen Tröstungen, haben sie abgeschworen, wie Suketu Mehta in seinem Buch “Bombay. Maximum City” schreibt, der eine fünfköpfige Jaina-Familie, die für den Rest ihres Lebens getrennte Wege geht, interviewte und von einer “jainistischen Version des Marxismus” spricht.
.
Die Familienmitglieder verließen die Stadt (Bombay) und zogen übers Land, durch die Dörfer, wo trotz der Zerschlagung des Gemeindeeigentums und der Einführung des Privateigentums durch den englischen Kolonialismus noch Gemeinschaften existieren. Die Jainas sind gegen Elektrizität und vor allem gegen den steigenden Strom- und Wasserverbrauch der Städte, weswegen sie gegen Staudämme sind, “denen Dörfer zum Opfer fallen”. Der Vater der Jaina-Familie, Sevantibhai, möchte sich von der Stadtseite auf die Seite des Dorfes schlagen.” Er bezeichnet das Bitten um Nahrung nie als Betteln, sondern als “gocari, das Grasen der Kuh, die immer nur einige Halme frißt, nie aber das ganze Büschel.” Er grast deswegen täglich mehrere Häuser ab. Die Bettler lehnt er ab. Auch kritisiert er den Fortschritt beim Anbau von Feldfrüchten: “Das Grundnahrungsmittel war Hirse, die zwischen dem Gras für die Kühe wuchs. Heute baut man Weizen an, das nicht im Gras gedeiht, und man muß die Rinder von den Weizenfeldern fernhalten.” Sevantibhai will endlich ein Leben ohne Sünde führen – weg vom immer mehr und immer mehr. Er putzt sich auch keine Zähne mehr, “weil es ja dem Töten von Bakterien dient.” Auf seinen Wanderungen durch die Dörfer de Gujarat denkt Sevantibhai über die großen Fragen nach, dazu gehört auch, “in welchem Ausmaß unsere Spezies Gewalt ausübt.” Er ist gegen den Bau des “Narmada-Staudamms” (der angeblich ein Segen für Gujarat werden soll), weil der Stausee die Fischindustrie fördern wird, die Fische tötet.
.
Ein interessantes Porträt eines jainistischen Börsenmaklers findet sich in Naipauls drittem Indienbuch. Dieser erfolgreiche Jainist, Papu, dem die “Idee der Reinheit” dabei gefällt, sieht die jainistischen Geschäftsleute auf dem Rückzug vor den neuen Businessmen – mit “Killerinstinkt”, den sie als Vegetarier zum Glück nicht hätten, das mache sie aber über kurz oder lang den “Nichtvegetariern” gegenüber unterlegen. Er wohnt in einem Haus mit lauter Vegetariern, was den Wert ihrer Immobilie erhöht, und möchte mit 40 aussteigen aus dem Beruf, um sich der Sozialarbeit zu widmen: Seiner Meinung nach lassen sich alle sozialen Probleme auf ökonomische zurückführen. Naipaul hat ihn mehrmals interviewt.
.
Einer der ersten namentlich bekannten Jainisten lebte zur gleichen Zeit wie Buddha (im 6./5. Jahrhundert v.Chr.). Der junge Literaturkritiker und Verlagslektor Pankaj Mishra, angeblich der “Entdecker von Arundhati Roy”, zog sich 1990 in ein Himalaja-Dorf namens Mashobra zurück, um sein Buch “Unterwegs zum Buddha” zu schreiben. Zunächst fuhr er mit dem Zug nach Simla, das ein englischer Artilleriehauptmann gründete, indem er auf einem Bergrücken “Zedern und Eichen fällen und ein Cottage errichten” ließ. Als Mishra in Simla den Bus dorthin bestieg, fuhr dieser bald in einen großen Zedernwald ein. Auch das Zimmer in dem Häuschen, das er dort mietete, war aus Zedernholz gebaut – “als dieses noch reichlich und billig zu haben war.” Hinter seinem Haus zogen sich “Kiefernwälder ins Tal.” Sein Vermieter sprach wenig und wenn, “dann unweigerlich über die Verwüstungen, die die moderne Zivilisation in der Natur anrichtete…Die Entwaldung der Berge verursachte nicht nur Erdrutsche, sondern auch schreckliche Überschwemmungen in der Ebene.”
.
Von Mashroba aus unternimmt der Autor mehrere Reisen – auf den Spuren des Buddhismus quasi, der ihn schließlich bis nach Kalifornien führt. Auf dem Weg mit Regionalzügen und Bussen nach Lumbini, dem Geburtsort von Buddha, kommt er an Hainen von Mango- und Tamarindenbäumen und Teiche, Oasen von Schatten und Kühle, vorbei.” Bei seinem ersten Besuch in Lumbini, als Student noch 1985, sah er dort einen mit Gebetsfahnen behängten großen Sal-Baum. Unter diesem hatte Buddhas Mutter, Maya, den Erleuchteten einst geboren, wie die Schrift ‘Nidanakatha’ berichtet. Dort im Tempel gibt es ein Steinrelief, das zeigt, “wie sie sich mit der rechten Hand an einen Ast des Sal-Baums klammert.” Und dieses war wiederum Vorbild für Millionen bunte Kitschbilder.
.
“Der Salbaum wächst als aufrechter Baum und erreicht Wuchshöhen von bis zu 35 m. Er gilt als langsam bis mittelschnell wachsend (wird etwa 100 Jahre alt) und besitzt ein hartes Holz. Es ist eine bedeutende Baumart im Norden des indischen Subkontinents. Dort ist er waldbildend (Salwald) und somit eine Form der Monsunwälder. Das Holz des Salbaumes ist durch das Harz und die faserige Struktur schwierig zu bearbeiten und wird vor allem für den Hausbau, für Brücken, Paletten, Waggons, Telefon- und Strommasten und als Gleisunterlage verwendet. Von daher besitzt es einen bedeutenden wirtschaftlichen Wert. Das weißliche, opalisierende Harz wird zum Abdichten von Planken benutzt und bei hinduistischen Zeremonien als Räucherwerk verbrannt. Die Blätter dienen als Teller oder Körbe für Speisen. Die gefalteten Blätter mit etwas Kurkuma oder einigen Reiskörnern gelten auch als Einladung zu einer Hochzeit. Das aus der Destillation gewonnene Öl der Blätter wird für die Parfümherstellung benutzt oder um Kau- oder Rauchtabak zu parfümieren. Auch die ölreichen Samen werden vielfältig verwertet. Das Öl, oder Sal-Butter, enthält vor allem Stearinsäure und Ölsäure und wird unter anderem für die Seifen- und Kosmetikproduktion verwendet und dient als Lampenöl. Es ist auch als Zusatz bei der Schokoladeherstellung erlaubt. Salbutter wird gehärtet als pflanzliches Vanapastighee verkauft oder illegal zum Strecken von echtem Ghee (geklärte Butter) verwendet. Der Ölkuchen der ausgepressten Samen ist reich an Tanninen (6-8 %) und wird Rindern mit bis zu 20%igem Anteil ins Viehfutter gemischt, bei Schweinen und Geflügel sind 10 % Zumischung problemlos möglich.” (Wikipedia)
.
1987 reiste Mishra nach Kaschmir, er kam dort durch eine Landschaft mit Pappelalleen, die sich endlos an Apfelhainen und Reisfeldern entlang hinzog. Das Dorf, in dem er übernachtete, lag in einer zwischen Kiefern, Wallnussbäumen und Platanen eingebetteten kleinen Senke. Buddha wurde bis in 3., 4. und 5. Jahrhundert nur symbolisch durch Fußabdrücke, einen Baum, ein Rad oder einen leeren Thron dargestellt. Und irgendwann wurde der Buddhismus in das hinduistische Pantheon integriert, deswegen gab es z.B. in der alten Stadt Bodh Gaya in Bihar, wo Buddha, “unter einem Pipal oder indischen Feigenbaum sitzend, die Erleuchtung erlangt hatte,” keine einheimischen Buddhisten mehr, höchstens ab und zu noch welche aus Burma. Sie erzählten später einem in Burma stationierten englischen Vermessungsbeamten von dem Ort – und so erfuhr man erst durch ihn Ende des 18.Jahrhunderts von der indischen Herkunft des Gautama.
.
Als Mishra 1985 Lumbini mit dem Bus wieder verläßt, hat dieser an einem “Banyan-Hain” eine Panne, Mishras Geist haftet unterdes weiter an der Säule, die der nordindische Herrscher Ashoka zu Ehren von Buddha in Lumbini errichten ließ, an dem Tempel, von dem es nur noch Ruinen gab, und an “dem großen Baum”. Es fiel ihm schwer, sich die einstige Umgebung des Ortes vorzustellen: “wo heute Reisfelder und ein paar Bäume waren, hatten einst dichte Wälder gestanden.” Monsunwälder. “Die Wälder des Indus-Ganges-Beckens ließen sich niederbrennen und die in ihnen lebenden Tiere erlegen. Diese Triumphe der menschlichen Bedürfnisse über die Umwelt sind eines der zentralen Themen des altindischen Epos ‘Mahabharata’.” Zur Zeit der Geburt von Buddha waren schon viele Wälder der Ebene in Acker- und Weideland umgewandelt worden. In Shravasti, der Hauptstadt von Koshala, verbrachte Buddha später viele Regenzeiten in einem “Mango-Hain, den ihm ein reicher Kaufmann geschenkt hatte.”
.
Mishra erwähnt die “Chhandogya-Upanishad”, die noch vor der Geburt des Buddha abgeschlossen wurden. Darin erklärt ein Vater seinem Sohn die ganze Welt anhand der “Frucht des Nyagrodha-Baumes”. Damit ist der “ficus indica” gemeint. Als er mit einem Kommilitonen dessen Eltern, die Gutsbesitzer waren, besuchte, sah er in der Dämmerung zunächst nur “die Umrisse einer großen Tulsi-Pflanze” [indisches Basilikum], vor der die Mutter seines Kommilitone am nächsten Morgen betete. Sein Kommilitone erzählt ihm: In der Dorfschule früher “hielt der Lehrer seinen Unterricht unter einem großen Pipal-Baum [Pappel-Feige, Ficus religiosa] ab, wir saßen vor ihm auf dem Boden mit Tafel und Kreide auf dem Schoß.” Wenn seine Cousins aus der Stadt zu Besuch waren, hatten sie Spaß daran, “mit Steinen nach den Mango- und Tamarindenbäumen zu werfen.” Wenn die Reisfelder abgeerntet waren im Herbst, “standen die Pipal-Bäume mit ihren ausladenden Kronen und ihrem breiten Schatten selbstsicherer denn je in der unendlichen Ebene.”
.
In seiner Hütte in Mashobra las Mishra nur eine Zeitung gelegentlich: den “Kesari”. Er erfuhr darin von “religiösen Unruhen, den massenhaften Abschlachtungen niedrigkastiger Hindus, den Hungersnöten, den durch große Staudammprojekte verursachten Umweltkatastrophen, den Korruptionsskandalen.” In den “Nianakatha” las er, dass nicht lange nach der Geburt des Buddha ein Aussaatfest im Ort seines Vaters, Kapilavastu, stattfand. Alles war prächtig geschmückt. “In der Mitte seines Feldes erhob sich ein großer Jambul-Baum” [Syzygium cumini, auch Rosenapfel genannt]. “Eine Laubbaumart aus der Familie der Myrtengewächse. Er wird aufgrund der essbaren Früchte sowie für medizinische Anwendungen in den Tropen kultiviert.” (Wikipedia) In einer der Reden Buddhas heißt es: “Ich erinnerte mich, dass ich einst, als mein Vater…beschäftigt war, im kühlen Schatten eines Rosenapfelbaumes saß und dort mich frei fühlte von Wünschen und Sorgen…”
.
Eines Nachts verließ Buddha seine Frau und sein Vaterhaus auf einem Pferd und mit seinem Diener. Am andern Morgen hielt er an einem “Mango-Hain” an, schickte seinen Diener mit dem Pferd nach Kapilavastu zurück und verbrachte “die erste Woche seiner neu gewonnenen Freiheit” in diesem Hain. Acht Jahre später kehrt er nach Kapilavastu zurück, blieb jedoch außerhalb der Stadtmauern – “im Schatten eines gewaltigen Banyan-Baumes in einem von ‘shramanas’ [Jainas] frequentierten Hain.” Buddha wanderte anscheinend von Hain zu Hain. U.a. kam er nach Uruvela in Bihar, heute: Bodh Gaya – dem wichtigsten buddhistischen Wallfahrtsort. “Ein Teil der Wälder, in denen der Buddha verweilte, ist seither verschwunden.” Der Fluß glitzert jedoch noch immer “zwischen den Schatten der Palmen und Tamarinden.”
.
Dann kam die Nacht, da “setzte sich der Buddha unter einen Pipal-Baum, gelobte, nicht eher wieder aufzustehen, als bis er die Erleuchtung erlangt haben würde, und begann zu meditieren.” Durch ihr “Zittern und Aneinanderreiben erzeugen die Blätter des Pipal [Pappelfeige] einen leisen, beruhigenden Gesang, bis der ganze Baum mit seiner flimmernden und funkelnden Laubkrone wie ein eigenständiges lebendiges Wesen erscheint.” Aus einem ähnlichen Grund liebt man hierzulande auch die Silberpappel-Bäume, meine Freundin Katrin Eissing z.B…Die Silberpappel gehört jedoch zur Familie der Weidengewächse.
.
Buddha erreichte unter dem Pipal in Bodh Gya eines Nachts den Zustand, den er “Nirvana” nannte – “Verwehen”. Seine erste Predigt hielt er dann in einem “Wildpark”, der heute “Sarnath” heißt. Einmal saß er unter einem “Ashoka-Baum” und erzählte seinen Zuhörern anhand von dessen Blättern in seiner Hand ein Gleichnis. Der Ashoka-Baum – “Saraca asoca – ist eine Pflanzenart innerhalb der Familie der Hülsenfruchtgewächse. Die natürliche Heimat ist der Indische Subkontinent. Die Sanskrit-Bezeichnung ashoka bedeutet ‘ohne Sorgen’. Saraca asoca wächst als immergrüner, aufrechter kleiner Baum und erreicht Wuchshöhen von maximal 8 bis 12 Meter. Er verzweigt sich früh; seine Äste bilden eine weitausladende Krone aus.” (Wikipedia)
.
Pankaj Mishra besuchte sodann Benares, wo er eine Motorrikscha nahm, dessen Fahrer in eine Allee einbog – “eine lange schnurgerade Straße, die zwischen Mango- und Tamarindenbäume entlangführte.” Von Benares ging es weiter nach Shravasti, “wo der Buddha von einem reichen Kaufmann einen Hain geschenkt bekommen hatte, der dann 24 Jahre lang sein bevorzugter Aufenthaltsort während des Monsuns” war. “Languren schnatterten in den Bel-Bäumen und sprangen sogar hinüber auf den alten Pipal, der, von einem Gitter umgeben, in einer Ecke stand.” Der “Belbaum oder Schleimapfel wird auch Bengalische Quitte (Aegle marmelos) genannt, es ist eine Pflanzenart aus der Familie der Rautengewächse (Rutaceae). Dieser Baum trägt aromatische Früchte. Nachdem die sehr harte Schale mit einem Messer entfernt wurde, wird die Frucht frisch als Obst gegessen. Sie schmeckt entfernt apfelartig, ist aber recht sauer. Der Saft wird zu Süßspeisen, Marmelade oder Chutney verarbeitet. Die jungen Blätter werden als Gemüse oder Gewürz genutzt. Aus Blüten und Rinde lässt sich duftendes Öl gewinnen. Die klebrige Substanz aus den Früchten wird gelegentlich als Kleber genutzt. Früchte, Blätter, Blüten und Rinde werden auch medizinisch genutzt. Im Hinduismus ist der Belbaum dem Shiva heilig. Seine dreigeteilten Blätter werden mit Shivas Dreizack verglichen und häufig Shiva geopfert, ebenso die Frucht.” (Wikipedia)
.
In Rajagriha, der Hauptstadt von Magdha, hielt der Buddha dem König eine Lehrrede, worauf dieser ihm einen “Bambus-Hain” schenkte, der sich in seinem Lustpark befand. In London spazierte Mishra durch einen Park, wo er “inmitten einer Gruppe von Eichen stehen blieb – so stämmig diese Bäume, so ganz verschieden von der hageren Nervosität der in Indien verbreiteten Art.”
Buddha wurde über 80 Jahre alt, auf einer seiner Wanderungen “machte er im Mango-Hain der berühmten Kurtisane Ambapali Station.” Nachdem sie ihn bewirtet hatte, schenkte sie ihm den Hain. Auf einem seiner letzten Wanderungen rastete er in einem Dorf namens Pava in einem Mango-Hain. Dieser gehörte einem gewissen Chunda. Buddha erlitt dort einen Schwächeanfall. Kurz danach erreichte er einen Sal-Hain von Kushinagara. Dort starb er, als er sich auf die Seite legte, “rieselten von den Sal-Bäumen Blätter herab.”
.
Zurück zum Dorfmittelpunkt Baum: Die Geschichte des indischen Dorfes und seines Banyanbaums ähnelt den “Geschichten aus Burkina Faso: Im Schatten des Baobab” von Anne Wenkel. Der Baobab-Baum bildet hier den Mittelpunkt der Gemeinschaft, wo die Geschichten und Märchen erzählt werden – und z.B. der kollektive Gedanke reift, das es ein kleiner Brunnen ist, was sie brauchen – und kein industrielles Großprojekt, das schon im Vorfeld Korruption und Gewalt bringt. Ein alter Mann sagt bei Ross: „Wir brauchen keinen Staudamm. Den will vielleicht eure Wissenschaft, aber den will die Natur nicht.“ Ein anderer meint: „Wenn jedes Bauernhaus in Indien Strom bezieht, dann geht Indien zugrunde. Wir würden alle Ressourcen erschöpfen und die Natur zerstören.“
Anderswo lautet die Formel dafür: “Regional, saisonal, ökologisch und fair!” Dies wurde am Wochenende auf dem Agrikulturform der Stiftung Partnerschaft mit Afrika, in den Kreuzberger “Prinzessinnengärten” formuliert – von kritischen Landwirten aus Cotonou (Benin) und Berlin-Brandenburg. Ungeklärt blieb dort allerdings, ob auch für Benin das gilt, was der polnische Auslandsreporter Ryszard Kapuscinski berichtete: “In Afrika sind die ersten Stunden der Nacht die geselligste Zeit. Keiner will da allein sein. Allein sein? Das ist ein Unglück, ein Fluch. Man versammelt sich um den großen Mangobaum in der Mitte des Dorfes.”
Die Deutsche Welle meldete 2011: “Kenias ‘Mutter der Bäume’ ist tot. Sie hat ihrem Namen alle Ehre gemacht, indem sie sich für die Aufforstung riesiger Waldflächen in Kenia und 13 anderen afrikanischen Ländern verantwortlich erklärte. Über 35 Millionen Bäume sind unter ihrer Schirmherrschaft gepflanzt worden.“
Ein bißchen klingt das baumzentrierte Gemeinschaftsgefühl der Inder und Afrikaner auch noch in Erwin Strittmatters dreibändigem Roman „Der Laden“ über Bohsdorf in der Lausitz an, wenn er darin die alte Dorflinde thematisiert, die irgendwann einem Einkaufsladen der HO weichen mußte und dieser dann einem Supermarkt, der schließlich dicht machte. Dem “halbsorbischen” Schriftsteller Erwin Strittmatter ging es ähnlich wie dem friesischen Soziologen Ferdinand Tönnies, der sich gedanklich zwischen “Gemeinschaft [immer älter werdende Dorflinde] und Gesellschaft” [immer größer werdende Lichtung] situierte. “Die Lichtung des Seins” – eines der “Schlüsselworte” für Heidegger. Dazu heißt es bei einem Heideggerinterpreten: “‘Lichtung’ verweist auf ‘Licht’, ‘Licht’ auf ‘Sichtbarkeit’ und ‘Sehen’, auf jenes ‘Sehen der Phänomene’, das Heidegger untrennbar mit dem Sagen und dem Hören verknüpft.” In den noch existierenden Gemeinschaften geschieht das “Sagen und Hören” unter einem (heiligen) Baum, in den Gesellschaften auf einer “Lichtung” (bei Regen auch schon mal in Lichtspielhäusern).
Die Japaner haben anscheinend einen Mittelweg gefunden. “Jeder liebt Bäume,” schreibt Ben Richmond, “aber die Japaner folgen dieser natürlichen Zuneigung mit unerreichter Gründlichkeit. 1982 hat das japanische Ministerium für Land-, Forstwirtschaft und Fischerei einen eigenen Begriff für den Zustand geprägt, ‘mit dem Wald eins zu werden und seine Atmosphäre aufsaugen’: Shinrin-yoku. Wörtlich übersetzt: ‘Waldbaden’. Doch Shinrin-yoku ist nicht nur ein griffiger Slogan, sondern auch dieGrundlage einerrenommierten Forschungsrichtung. In diesem weiten Feld wird untersucht, wie das Ausmaßsein muß, damitschon ein einfacher Waldspaziergang gesundheitsfördernd wirken kann. Auf uns Menschen haben nicht nur Waldspaziergänge beruhigendeAuswirkungen, sondern sogar bereits Fotos von Wäldern. Die japanischen Forscher haben quantitativ bestimmt, wie lange wir in der Natur verweilen müssen, um uns besser zu fühlen. Eine von japanischen Forschern im Jahr 2009 in 24 Wäldern durchgeführte Studie mit dem Titel ‘Die physiologische Wirkung von Shinrin-yoku’ lieferte eine überzeugende Auflistung derVorteile desWaldaufenthalts: ‘Senkung der Cortisol-Werte, der Pulsfrequenz, des Blutdrucks sowie der Sympathikus-Aktivität, während die Aktivität unseres parasympathischen Systems zunimmt.’ Schon nach 20 Minuten im Wald begannen die Probanden sich merklich zu entspannen.” Richmond fügt hinzu: Für ihre Hunde galt jedoch eher das Gegenteil – im japanischen Wald.
Im sibirischenWald sind jedoch auch Menschen, mindestens Nicht-Sibirier, angespannt, wie der von dort stammende sowjetische Dichter und Sänger Jewgeni Jewtuschenko in seiner Biographie “Der Wolfspaß” berichtet. Er macht sich darin über seine städtischen Freunde aus Westrussland lustig, die, wenn sie mit ihm einen sibirischen Wald betraten, plötzlich ganz ängstlich wurden – und überall Gefahren vermuteten.
Aber selbst sibirische Völker, die an eine beseelte Natur, wie die z.B. Nenzen, glauben, ist der Wald “zu voll” Sogar die Taiga-Selkupen am Fluß Tas schützen ihren fest bebauten Sommerplatz mit einem Holzzaun vor Waldgeistern, sie wollen “raus aus dem Wald” – auf Gelichtetes? Dennoch vergessen auch die Selkupen nicht, sich an ihren heiligen Plätzen für all das bedanken, was der Wald ihnen “gab”- Elche, Auerhühner, Bären, Zobel, Hechte und andere Fische, dazu Beeren sowie Feuerholz.
Uns geht es auf der wachsenden Lichtung Berlin ganz anders. Auf dem langen Gang vom Eingang des U-Bahnhofs Hallesches Tor zum Bahnsteig beklebte man die Wände mit einer Waldtapete, damit der Gang nicht so leer und trist wirkt. Als die taz ein Stück weiter an der Friedrichstraße acht Bäume (zwei davon Eschen) auf ihrem neuen Baugrundstück fällen lassen wollte, gab es Proteste. “Hände weg von unseren Bäumen!” hieß eines der Flugblätter.
.
Ein Auszug aus der internen Diskussion:
.
Am Samstag um 13 Uhr gibt es Proteste gegen die Baumfällung auf dem “Ein neues Haus für die taz”-Gelände. Darüber wird sicherlich auch nicht berichtet…
.
Das taz.film-Team (wir machen die Filme rund um den Neubau) ist schon
seit längerem mit AnwohnerInnen im Gespräch und bereitet einen Film zum
Thema vor. Wir werden auch am Samstag filmen.
.
Wir sind ein Unternehmen, das jeden Abend 69.378 Zeitungsexemplare auf totes Holz druckt und dann mit Lieferwagen flächendeckend in der gesamten Republik verteilen lässt. Wer wirklich etwas für die Umwelt erreichen will, der sollte sich nicht an ein paar Bäume ketten, sondern unsere Druckereien blockieren.
.
Wie wertvoll der Baum oder die Bäume sind, um die es hier geht, kann ich nicht beurteilen, aber Stadtgrün hat einen sehr lokalen Nutzen, den kannst du schlecht gegen einen Forst irgendwo anders aufrechnen.
.
Wundert dich das im Kontext dieser ganzen Neubaubesoffenheit? Mich nicht. Immerhin geht es um die Zukunft der Z… äh, Marke.
.
Gibt’s nicht eine Verordnung in Berlin, die Bauherren dazu verpflichtet, jeden Baum einer bestimmten Größe, der einem Neubau weichen muss, durch eine Neupflanzung zu ersetzen?
.
Keine Ahnung, aber im Rahmen der Aufwertung zum “Kreativquartier” wird auch der Besselpark erweitert. Sieht man hier auf der Karte: http://tinyurl.com/l742xxo – rot markiert ist das taz-Grundstück mit den acht Bäumen, die für uns sterben. Grün ist die tote Betonbrache, die zum Park wird.
.
Ich werde als Ausgleich einen Ficus irgendwo ins Gebäude stellen. Mindestens einen.
.
Nein, bitte nicht. Den gießt dann wieder keiner. Wir haben zwar im vierten Stock Neubau extra jemanden, die sich der ganzen halbvertrockneten taz-Zimmerbäume annimmt – mit Hingabe, aber diese Pflanzen-Notaufnahmestelle ist jetzt schon überbelegt.
.
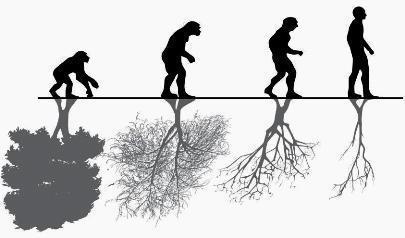
.
Baum/Holz
Seit mindestens einer Million Jahren hantieren die Menschen mit Feuer. Seit etwa 400 000 Jahren beherrschen sie es und können es entfachen, wenn es nötig ist. Der zivilisatorische Weg vom Rohen zum Gekochten führte über das Verbrennen von Holz und das Vernichten von Wäldern. Während man sich in Indien unter, um oder an einem Baum versammelt, festigt anderswo das Lagerfeuer die Gemeinschaft. Die US-Anthropologin Wiessner beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit den Lagerfeuergesprächen der !Kung, die in Namibia und Botswana als Jäger und Sammler leben. In der SZ heißt es über ihre Forschungsergebnisse: „Die Inhalte der Gespräche unterschieden sich je nach Uhrzeit. Bei Tageslicht teilten die !Kung vor allem ökonomisch relevante Informationen etwa zur Jagd, beklagten sich über Widrigkeiten des Lebens und missliche Situationen und tratschten über Verfehlungen anderer !Kung. Witze, Geschichten und andere Themen fanden hingegen wenig Raum. Das war an den Abenden am Lagerfeuer ganz anders: Mehr als 80 Prozent der Gespräche beinhalteten Geschichten; Tratsch, Gejammer oder Themen des Tagwerks fanden im Schein der Flammen hingegen sehr wenig Beachtung.“
Die Dr. Silvio Wodarz Stiftung teilte mit, dass die Trauben-Eiche zum Baum des Jahres 2014 bestimmt (gewählt?) wurde. Die F.R. meldete: Der “Überlebenskünstler” Feld-Ahorn ist der Baum des Jahres 2015. Er sei ein “robuster ‘Kleiner Bruder’ des Spitz- und Bergahorns. Seine Blätter zeigen jetzt im Herbst ein “strahlendes Goldgelb”, seine Früchte bilden die “beliebten Ahorn-Propellerchen”.
Das Thema „Bäume“ drängte sich mir quasi auf, indem ich in letzter Zeit aus irgendeinem seltsamen Grund beim Gehen ständig hochkucke – auf Bäume. Dabei entdeckte ich u.a., dass viele Straßenbäume in Pankow und Kreuzberg große Haselnuß-Bäume sind, von denen ich immer angenommen hatte, dass sie eher zu den Niedriggehölzen zählen. Um sie herum lagen kiloweise Nüsse. Einige Rentner sammelten sie in Tüten, ich eine handvoll. Sie waren klein und hart, schmeckten aber nussig. Später mußte ich mir sagen lassen, unsere Haselnüsse wachsen auch nur als Sträucher, bei den kleine Haselnüsse tragenden Bäumen an der Straße handelt es sich um den “türkischen Haselnußbaum”.
Dann stieß ich fast auf Schritt und Tritt auf die südostasiatischen Götterbäume, als Jungpflanze bilden sie Gebüsche und im Alter sehen sie gelegentlich wie Palmen aus. Gerne wachsen sie durch Lücken zwischen Fußwegen und alten Mauern. Auch lieben sie es, sich durch Hecken zu kämpfen: bis man sie sieht, sind sie schon über einen halben Meter groß. In Berlin wird der Götterbaum laut Wikipedia bereits seit 1780 als Zierpflanzen kultiviert.In China nennt man ihn “Baum des Himmels”. „Wild wachsende Götterbäume sind heute in den Innenstädten der größeren deutschen Städte häufig; sie traten jedoch erst nach 1945 verstärkt auf Trümmerflächen auf. Der Invasionsbiologe Ingo Kowarik führt dies darauf zurück, dass vor 1945 offene Flächen verhältnismäßig selten waren und diese zu intensiv gepflegt wurden, um den Aufbau einer spontanen Population zu ermöglichen. Der Götterbaum ist relativ resistent gegen Salz, Trockenheit und Herbizide und toleriert den von urbanen Luftverunreinigungen ausgehenden Stress oft besser als viele andere Stadtbäume. Aber aufgrund seines Status als invasive Pflanzenart sollte der Götterbaum nicht angepflanzt werden. Der hemerochor nach Europa verbrachte Götterbaum wird zu den hundert problematischsten invasiven Arten in Europa gerechnet (“100 of the worst”). Einmal etabliert, ist der Götterbaum nur mit großem Aufwand wieder zu entfernen, da er ungewöhnlich widerstandsfähig gegenüber Trockenheit, Schnitt und Herbiziden ist. In einigen Staaten, wie zum Beispiel in Österreich und der Schweiz, wird der Götterbaum bereits aktiv an der Ausbreitung gehindert, so in Basel, wo er entlang des Rheinufers systematisch beseitigt wird. Die Bekämpfung des Götterbaumes hat im Mittelmeerraum bereits hohe Kosten verursacht, da er nach dem Schnitt rasch wieder austreibt und dichte Bestände bildet. Als wirksamste Methode empfehlen sie nach Auswertung einer fünfjährigen Studie, die Bäume zu fällen und den Austrieb mit Glyphosat (von Monsanto) zu behandeln. In Nordamerika wurde der spezialisierte Rüsselkäfer Eucryptorrhynchus brandti getestet, um den Götterbaum biologisch zu bekämpfen.“
In dem Pflanzengeschichtsbuch von Heiderose Häsler und Iduna Wünschmann „Berliner Pflanzen – Das wilde Grün der Großstadt“ heißt es, dass der Götterbaum rund 150 Jahre brauchte, um sich hier derart zu integrieren, dass er sich vermehren wollte und auch konnte. Und das geschah ausgerechnet im Frühjahr 1945 , als ganz Berlin in Schutt und Asche lag. Da legte er plötzlich los – und zwar so heftig, dass man ihn heute auch in Berlin als Unkraut begreift. Seine Bekämpfung hier nützt aber nur wenig, zumal die bezirklichen Gartenbauämter z.T. von 40 Mitarbeitern auf 4 „gesundgeschrumpft“ wurden – und die Arbeit nun zum großen Teil von privat angestellten Langzeitarbeitslosen zu Billiglöhnen erledigt wird, die die Stadt-Flora vor allem bekämpfen – mit technischen Mitteln, d.h. mit Motorsäge, Laubgebläse, Baumschredder. Manche Straßenbäume sehen danach nur noch wie riesige Poller aus. Derzeit sind es vor allem die Triebe am Fuß der Linden in den Straßen, auf die sie es abgesehen haben.
Die Barbesitzerin Erika Mayr, Vorsitzende des Imkervereins Charlottenburg/Wilmersdorf, schrieb ein Buch über „Stadtbienen“. Darin erklärte sie u.a., warum es in Berlin besonders viele Imker (mit einem eigenen „Stadthonig“-Vetrieb) gibt: Nicht nur stehen hier viele Straßenbäume, bei der Baumauswahl ließ man sich nach dem Krieg auch von einem Gärtner und Imker aus Potsdam beraten – und der, Karl Förster, wählte gute Trachtbäume aus, deren Blütezeiten unmittelbar aufeinander folgen: Kastanie, Ahorn, Robinie und Linde… „Deshalb liegen die Erntemengen der Stadtimker auch deutlich über denen der Landimker.“ Von Mitarbeitern aus den Berliner Grünflächenämtern erfuhr die Autorin, dass sie mittlerweile nur noch wüßten: „Birken verursachen Schmutz und Autos werden von den Blattläusen der Linden ganz klebrig.“
Ein drei bis fünf Meter hoher Straßenbaum kostet mit Pflege rund 1200 Euro. Berlins Stadtbäume wie Eichen, Rosskastanien und Platanen leben oft nicht lange. „Sie brauchen viel Wasser,“ schreibt die Welt. „Dazu kommen Belastungen durch Abgase, weniger Nährstoffe durch kleine natürliche Bodenflächen, weniger Licht, Streusalze und Hunde-Urin.
Seit Jahren gibt es einen stetigen Baumverlust in der Stadt,“ der aus Kostengründen nicht mehr durch Neuanpflanzungen ausgeglichen werden kann, stattdessen hofft die Stadt auf Sponsoren und initiiert schon mal kleine Crowdfunds, die immerhin so erfolgreich sind, dass die Hauptstadtpresse melden kann: „Neuer Stadtbaum gepflanzt.“
„An der Humboldt Universität empfehlen Wissenschaftler deshalb Bäume, die dem Klimawandel besser gewachsen sind. Seit 2010 haben sie rund 80 Baumsorten geprüft. In Versuchen versorgten sie einige frisch gepflanzte Bäume optimal, andere aber setzten sie einem moderatem oder akuten Trockenstress aus. Außerdem untersuchten sie die Anfälligkeit für Krankheiten und Schädlinge. Die Tests gehören zu einem gemeinsamen Forschungsprojekt von HU und dem Innovationsnetzwerk Klimaanpassung Brandenburg Berlin.
In einem ersten Ergebnis sind unter anderem Kugel-Blumeneschen aus Ungarn, der amerikanische Amberbaum “Worplesdon”, die Kobushi-Magnolie aus Japan und das chinesische Rotholz besonders gut für Neupflanzungen in Berlin und Brandenburg geeignet. Die Erlenart “alnus spaethii” kommt zum Beispiel auch als Alleebaum infrage: Sie hat eine kegelförmige Krone, ledrig dunkelgrüne Blätter und trotzt dem Wetter durch Frosthärte, Hitzetoleranz, Windfestigkeit und hohe Salzverträglichkeit. Der „stern“ zählte jüngst einige tierische Einwanderer auf, danach kamen die hier eingeschleppten und sich frei vermehrenden entweder aus China (Wallhandkrabbe, Laubholzbockkäfer, Tigermücke) oder aus Amerika (Waschbär, Gelbfußtermite, Nandu), zwei weitere „Neozoen“ wanderten gewissermaßen auf natürlichem Wege ein: Schwarzmund-Grundel und Zebramuschel vom Schwarzen Meer. Die Experten sind sich laut „stern“ nicht einig: Der Rostocker Ökologe Ragnar Kinzelbach meint: „Die europäische Tierwelt ist widerstandsfähig genug, um mit Zuwanderern langfristig zurechtzukommen.“ Die Experten im ständigen Ausschuß der Berner Konvention zum Artenschutz behaupten jedoch: „Neozoen stellen bewiesenermaßen eine Bedrohung für die Artenvielfalt dar.“ Ähnliches gilt für die eingewanderten Pflanzen (Neophyten).
Das Internetforum „Stadtnatur“ schreibt über eine: „Von einigen in die Ecke der invasiven Neophyten gestellt, ist die Pseudoakazie (auch „Gewöhnliche Robinie“ genannt) genau genommen gar kein Neueinwanderer, sondern ein Spätheimkehrer. Es gab sie noch im Miozän (vor etwa 30 Mio.Jahren) auf dem europäischen Kontinent, ehe sie die vorletzte Eiszeit von hier vertrieb.
Jörg Parsiegla ergänzt in einer Rezension des Buches von Heiderose Häsler und Iduna Wünschmann: „Berliner Pflanzen -Das wilde Grün der Großstadt“: „Multikulti unter den Berliner Pflanzen war bereits angesagt, als der Begriff noch gar nicht existierte – zum Beispiel die nordamerikanische Robinie, benannt nach ihrem französischen “Importeur” Jean Robin (1550 bis 1629) – oder das Indische Springkraut, das 1839 den Umweg über England nahm. Ganz zu schweigen von Rucola, dem beliebten italienischen Salat, der massenhaft in der Stadt wächst. Interessant sind auch die Einreisewege der Pflanzen. Einige wurden bewusst als Zier- oder Nutzpflanzen ins Land geholt, andere kamen als blinde Passagiere zusammen mit Waren und Saatgut. Es gibt Alteingesessene unter den Pflanzen und Neubürger, auch solche, die mal nur kurz vorbeischauen. Von den über 2.000 wildwachsenden Pflanzen, die jemals in Berlin registriert wurden, haben sich rund 1.400 etabliert – etwa 15 Prozent sind unwiederbringlich verloren, fast ebenso viele (vor allem heimische) vom Aussterben bedroht. Doch Grund zur Panik besteht, laut den Autorinnen, kaum: ‘Nur etwas mehr als eine Handvoll der Neubürger macht wirklich Probleme’, allen voran die Ambrosia.“
Die Berliner Zeitung erwähnte in ihrer Rezension des Berliner Pflanzenbuches folgende Geschichte: „Dass rund ums Kanzleramt mit Kifferhanf, dem hochgiftigen Stechapfel und dem Bittersüßen Nachtschatten die haluzinogensten der rund 1 400 in Berlin beheimateten Arten zu finden sind, gibt zu denken. Verantwortlich für das Auftreten dieser Rauschpflanzen sind aber weniger parlamentarische Rauschdrogenanbauer als die langjährigen Baustellenbrachen.“
Zu dem „Unkraut“ – chinesischer Götterbaum – sei noch hinzugefügt, das er hier ständig für den nordamerikanischen Essigbaum gehalten wird. Diese Strauchart wurde laut Wikipedia „um 1620 in Europa eingeführt und ist wegen ihrer ausgeprägten Herbstfärbung ein weit verbreitetes Ziergehölz. Die Blätter werden gelb, später orangefarben und im Oktober leuchtend karmesinrot. Ihr deutscher Name Hirschkolbensumach wie auch der englische Name staghorn sumac beruhen auf dem kennzeichnenden Merkmal der Art: den kräftigen, braunen und filzig behaarten jungen Trieben, die an ein mit Bast bewachsenes Hirschgeweih erinnern.“ Ein 1 Meter hoher Essigbaum kostet in den Baumschulen rund 50 Euro, ein 2 Meter hoher Götterbaum die Hälfte. Was Essigbaum und Götterbaum eint, ist, dass bei beiden wegen ihrer Triebhaftigkeit empfohlen wird, ihre Wurzelballen mit Betonwänden zu umgeben, so dass sie sich nicht unterirdisch fortpflanzen (ausbreiten) können. Ähnliches gilt auch für Robinien und Bambus. In einem Ratgeber-Forum schrieb eine Frau: “Gibt es irgendein Mittel gegen Essigbäume? Das Feld um unser Grundstück hat sich zu einem fast undurchdringlichen Urwald entwickelt – unser Garten bedarf fast unentwegter Beobachtung und Pflege, um die vielen Triebe dieser Bäume auszurupfen – bei längerer Abwesenheit haben wir im Nu eine Katastrophe. Das nervt. Kennt jemand ein Mittel?” Andere berichten Ähnliches über Götterbäume.
In ihrem Buch über “Berliner Pflanzen” haben Heiderose Häsler und Iduna Wünschmann über den Götterbaum herausgefunden: Einige dieser “angenehmen Schattenspender” (Ailanthus altissima) stehen auf dem großen Platz vor dem Fernsehturm. Sie entwickeln im Frühjahr unzählige Rispen voller unscheinbarer grüngelber Blüten, aus denen sich Samen mit Flugblättern, ähnlich denen des Ahorn, entwickeln. Der Götterbaum ist zweihäusig getrennt-geschlechtlich, d.h. die männlichen und die weiblichen Blüten befinden sich auf verschiedenen Bäumen. Fehlte es ihm hier bis zur Verwüstung Berlins 1945 an Insekten seit 1780, um seine Blüten zu befruchten? Oder standen die privat importierten teuren Götterbäume so weit auseinander, dass sie nicht zueinanderfinden konnten, Peter Joseph Lenné pflanzte sie z.B. in das Palmenhaus auf der Pfaueninsel. In der Alten Schönholzer Strasse steht heute einer, der sich ein vornehm palmenartiges Aussehen gegeben hat. Möglich wäre es auch, dass immer nur männliche oder nur weibliche Götterbäume hier angepflanzt wurden. Sie können sich jedoch auch alleine – über Wurzeltriebe – vermehren. Bis zu drei Meter können seine Triebe im Jahr unterirdisch vorankommen. Ailanthus ist genügsam, ihm genügt trockener Sandboden. Seine plötzliche Vermehrungsinvasion 1945 in der Reichshauptstadt (der “Topographie des Terrors”) erklärt sich aber vielleicht eher dadurch, dass diese sozusagen am Boden lag. Was eine botanische Version der “Schwache-Dörfer-Starke-Wölfe”-Theorie wäre.
Inzwischen gilt der Götterbaum in Mitteleuropa als “aggressiver Neubürger, der, damit er nicht Heimisches verdrängt, immer wieder beseitigt wird.” In Wien kam man ihm 1856 intellektuell. Da wurden dort für eine geplante Seidenindustrie Ailanthus-Spinner – ein schöner brauner Schmetterling aus China – eingeführt, dessen Raupen von Götterbaumblättern leben. Nach ihrer Verpuppung läßt sich aus ihrem Kokon sich eine Seide – die sogenannte “Eri-Seide” – herstellen, haltbarer und billiger als die übliche,” schreiben Häsler und Wünschmann, Wikipedia fügt hinzu: “In Indien werden die Puppen gegessen, in Nepal als Hühnerfutter verwendet.” Weiter heißt es dort über den “Götterbaum-Spinner” aus der Familie der Pfauenspinner, über die sicher Nabokov ein paar Worte verloren hat: “Die Art wurde zur Gewinnung von Seide weit verbreitet und ist daher auch in Teilen Europas, Nordafrikas, im Nahen Osten und im Osten Nordamerikas anzutreffen. Im südlichen Europa findet man die Art an klimatisch günstigen Orten, wo Götterbäume als Zierpflanzen angepflanzt wurden oder verwildert sind.” Es folgt eine ganze Reihe Orte, vom Gardasee über Paris bis Zentralslowenien, wo der Ailanthus-Spinner (Samia cynthia) jeweils zwischen größeren Ansammlungen von Götterbäumen umhergaukelt. Bestätigt wird das auf der Internetseite von “schmetterling-raupe.de/art/cynthia_samia”, wo es über diesen “großen Falter, der in Europa (noch) recht selten ist,” heißt, dass es sich dabei um eine “hier inzwischen in mehreren getrennten Populationen” handelt. Ob diese als Schmetterlinge auch den Pollen der männlichen Blüten zu den Stempeln der weiblichen Blüten des Götterbaums tragen, wird damit nicht gesagt. Es heißt dort nur, dass er sich “durch die Ausbreitung seiner Hauptfutterpflanze und infolge klimatischer Veränderungen in Ausbreitung befindet.”
Im Sinne des Biosophen Ernst Fuhrmann kann man wohl dennoch davon sprechen, dass der Götterbaum und der Ailanthus-Spinner in einer engen Beziehung leben, auch wenn letzterer vielleicht nicht zur Befruchtung der Baumblüten beiträgt, sondern nur seine Raupen sich von den Blättern ernähren läßt, anscheinend ausschließlich, sonst würde der Ailanthus-Spinner bei seiner Verbreitung nicht der “seines” Götterbaums (bis in die Städte) folgen…Ach, es sind diesbezüglich noch viele Fragen offen. Vielleicht wissen die Züchter mehr, es gibt verschiedene Internetforen, auf denen sie ihre Erfahrungen austauschen. In Gefangenschaft geben sie den Raupen dieses Nachtfalters (“der nach dem Schlupf nur noch zwei Wochen lebt, um sich zu vermehren”), gelegentlich auch Linguster, immergrünen Kirschlorbeer oder Flieder zu fressen. Ähnlich wie mit dem chinesischen Götterbaum-Spinner verhält es sich im übrigen mit dem japanischen Eichenseidenspinner hierzulande. Kann man es so sagen: Diese beiden Nachtmotten sind, da sie als Raupe ausschließlich vom Götterbaum leben und wie alle Saturniidae danach keine Nahrung mehr zu sich nehmen quasi eine Verlängerung dieser Pflanze in die Luft…Ein Spaß, den der Baum sich etliche Blätter kosten läßt?
P.S.: Auf dem taz-Grundstück an der Friedrichstrasse steht auch ein ausladender Götterbaum. Er hat es geschafft sozusagen aus eigener Kraft, um sich herum ein ganzes Wäldchen zu bilden.
.
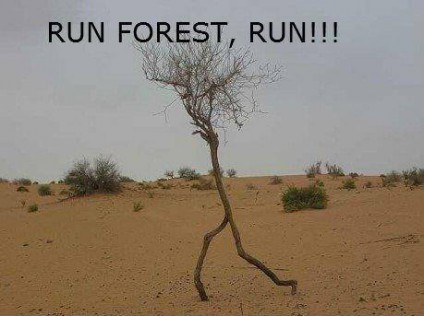
Baumfrevel
0. Dem Gärtnerehepaar Domain in Horno, das den Baggern des Braunkohlekonzerns Vattenfall nicht weichen wollte – und vor Gericht klagte und klagte, ließ der Konzern kurzerhand die Obstbäume in seinem Garten umsägen. Anschließend behauptete man, dass die Fremdfirma es aus Versehen getan hätte. Nun steht auf alle Fälle mit einer möglichen neuen Landesregierung in Brandenburg ein Aus für den Braunkohleabbau an, Vattenfall versucht angeblich, sich seines Braunkohlekonzerns durch Verkauf rechtzeitig zu entledigen. Aber das schönste Lausitzer Dorf Horno und die wunderbaren Obstbäume der Domains sind längst weggebaggert.
1. Im Theodor-Wolff-Park in Friedrichshain/Kreuzberg stieß der Technische Leiter des Grünflächenamtes auf einen Baum, dessen Stamm von Unbekannten wahrscheinlich mit einer Axt oder einer Machete auf das übelste traktiert wurde. Wahrscheinlich mit dem Ziel, die etwa 20 Jahre alte Linde zu fällen. Es sei schon schlimm genug, dass Wände beschmiert oder Bänke herausgerissen werden, meint Adalbert Klees. “Aber sich an einem ausgewachsenen Baum, einem Lebewesen, auf diese Art zu vergreifen, ist der Gipfel dessen, was ich bisher gesehen habe. Hier sind durchgeknallte Zeitbomben unterwegs.”
2. Erneut sind Bäume im Landkreis Göttingen Ziel einer Giftattacke geworden. Nachdem es zuletzt in Gleichen und Rosdorf zu derartigen Anschlägen gekommen war, hat es jetzt drei Erlen in Geismar erwischt. Wieder bohrten Unbekannte die Stämme an und injizierten eine Substanz, an der die Bäume zugrunde gingen.
3. Mit Benzin im Stamm versucht jemand, diesen stattlichen Baum zum Absterben zu bringen. Das Bohrloch im Stamm ist deutlich sichtbar. Fotos (2): Frey zurück vergrößern weiter Bad Salzungen – Wer macht so etwas? Und vor allem: Warum? Mindestens zwei stattliche Bäume wurden am Haad angebohrt und in die Löcher Benzin gekippt. Bernhard Frey, Nabu-Mitglied und Mitglied im Naturschutzbeirat, ist diesem Hinweis nachgegangen. “Die Bäume, eine Linde und eine alte Eiche, sind kerngesund”, berichtet er. Im unteren Teil der Stämme befinden sich tatsächlich Bohrlöcher. Es riecht nach Benzin, auch der Stamm ist von der Flüssigkeit verfärbt. Bernhard Frey hat das Umweltamt informiert. Und die Presse. “So etwas muss an die Öffentlichkeit gebracht werden”, meint er. Es empört ihn, dass jemand den gesunden Bäumen, die keine Gefährdung darstellen, so etwas antut.
4. München: Nach der illegalen Fällung von einigen Bäumen beschädigten bislang Unbekannte weitere Bäume. Diese wurden jedoch nicht gefällt, sondern die Rinde durchschnitten, so dass die Versorgung der Bäume nicht mehr gewährleistet ist. Die Baumstämme hatten einen Umfang von gut einem Meter. Es wurde Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Gegen die illegalen Baumfällungen hatte der Bezirksausschuss (BA) 19 Anzeige erstattet. Der Bauunternehmer, der die Bäume gefällt hatte, bekam nun einen rechtsgültigen Bußgeldbescheid.
5. Baden-Baden, Lichtental – Schwer geschädigt wurde laut Stadt-Pressestelle in den vergangenen Tagen ein Baum in der Lichtentaler Allee. Der Stamm des Spitzahorns, der erst vor zwei Jahren als Spenderbaum mit persönlicher Widmung am südlichen Ende der Klosterwiese gepflanzt worden war, wurde von Unbekannten so eingesägt, dass der Baum keine Überlebenschance hat. Das Gartenamt erstattete Anzeige und pflanzt in Kürze einen Ersatzbaum am selben Standort.
6. Unbekannte haben einen Ahornbaum in Eich angesägt und dabei so schwer beschädigt, dass er gefällt werden musste. Am Morgen des 07. Juli wurde an dem Ahorn, der an der Verbandsgemeinde Eich stand, festgestellt, dass der Stamm rundherum fast bis zur Stammmitte angesägt worden war. Es blieb nichts anderes übrig, als die Feuerwehr zu verständigen, die den Baum fällte. Zeuge hat Baumfrevel vielleicht beobachtet Ein Zeuge hatte einen Tag zuvor zwei Personen an dem Baum gesehen. Als er sie fragte, was sie dort machen, rannten sie weg. Der entstandene Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.
7. “Derartige Taten sind unverständlich. Da wurde doch ein Baum am Kirchplatz mit einem Beil bearbeitet. In Brusthöhe hat ein unbekannter Täter den Baum ca. 4 cm tief – wohl mit mehreren Axthieben – traktiert. Ein Abschrammen mit einem PKW oder KW scheidet aus. Ein großer Stein verhindert nämlich das Befahren des Seitenstreifens, in dem der Baum steht. Ob sich der Baum nach entsprechender Behandlung wieder erholen wird, muss abgewartet werden. Geschädigt wurde die Gemeinde Windhausen. Sie wird sicherlich Anzeige gegen Unbekannt erstatten.”
8. Nach einer Phase relativer Ruhe hat ein Mitglied der Baumschutzinitiative Westhoven die Stadt Köln über einen neuen Fall von Baumfrevel am Porzer Leinpfad informiert. Ein oder mehrere Unbekannte sägten dort vier neu gepflanzte Pappeln ab. Der Schaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro. Im März vergangenen Jahres war eine Serie von über 20 Baumfreveln plötzlich abgerissen. Vorher hatte die Stadt Köln jeden Fall bekannt gemacht, die örtliche Polizei eingeschaltet und eine Belohnung von 1.000 Euro ausgesetzt. Aus gegebenem Anlass weist das Amt für Landschaftspflege und Grünflächen darauf hin, dass die Böschung zwischen dem Leinpfad und den höher gelegenen Häusern städtisches Gelände ist und Rodungen der Büsche dort verboten sind.
9. Das Tiefbau- und Landschaftsplanungsamt Treptow-Köpenick hat am 18.10.2013 festgestellt, dass im Grünzug zwischen Ottomar-Geschke-Straße und Spindlersfelder Straße sechs Bäume mutwillig durch bisher unbekannte Täter mit der Axt gefällt bzw. abgeschlagen wurden. Es wurde Anzeige bei der Polizei erstattet, der finanzielle Schaden beträgt ca. 10.000,00 Euro.
10. “Das bringt ja das Faß zum Überlaufen – nachdem in der Stadt Salzburg (und auch im Bundesland Salzburg) von der Politikerriege kollektive Arbeitsverweigerung betrieben wird wenn es um die Verkehrspolitik geht (die Stadtbahn ist beschlossen und harrt nach wie vor seit 2 Jahrzehnten auf die Errichtung), nachdem also Stillstand herrscht, der nur von zeitweiligen autofreundlichen und daher menschenfeindlichen Nonsense-Aktionen wie der neuen Verkehrsregelung in der Griesgasse unterbrochen wird, wurden nun in einer Gegend, wo es nur mehr staut, stinkt und lärmt auch noch Bäume gefällt. Wie zu hören ist, ist dafür wieder einmal der pseudogrüne Stadtrat Padutsch von der “Bürgerliste” verantwortlich, der ja offenbar schon u.a. für die Vernichtung der herrlich blühenden japanischen Kirschbäume vor dem Landeskrankenhaus verantwortlich zeichnet – bei Strassenumgestaltungsarbeiten vor einigen Jahren verschwanden diese herrlichen Bäume plötzlich, nichts blüht dort mehr im Frühling, die Politiker haben eine Asphaltwüste hinterlassen. Ähnlich wie am Hanuschplatz, wo die herrlichen Magnolien verschwanden.”
.
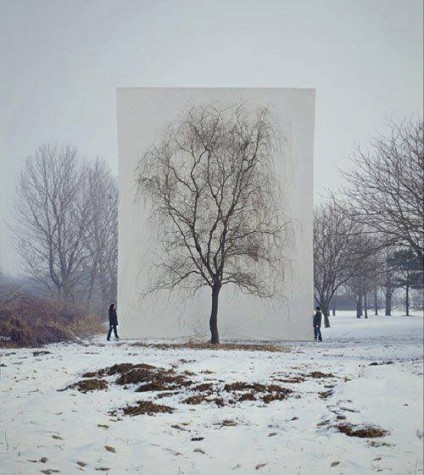
Photo: Livia Klingl
.

Gemälde von Caspar David Friedrich.
.
Den Alleebäumen danken
Die Alleebäume könnte man als Vorläufer der Straßenbegrenzungspfähle (Poller) bezeichnen. Man pflanzte sie, damit die Benutzer der Straße im Falle eines schlechten Zustands derselben nicht einfach auf die Felder oder Wiesen daneben auswichen. Noch heute sieht man in der Mongolei z.B., wo einfach querfeldein gefahren wird, dass riesige Flächen der Steppe dabei zerstört werden.
Ein Kriminalbeamter, der für Versicherungsbetrügereien im Großraum Berlin verantwortlich ist, erzählte mir, daß er neulich einen ganzen “Familienverband”, bestehend aus ehemaligen LPG-Mitarbeitern, am Stadtrand hochgehen ließ. Einer der Männer hatte laufend Unfälle mit Gebrauchtwagen fingiert, indem er mit 40 Kmh gegen irgendwelche Alleebäume gefahren war – seine Frau saß immer neben ihm. Vor Gericht erklärte sie: “Was mein Mann aushält, das halte ich auch aus!” Der Kriminalbeamte meinte: “Ob Sie es glauben oder nicht, den Alleebäumen ist nie was passiert. Die sind robust – besonders die im Osten, an denen seit der Wende fast täglich junge Leute mit ihren Westautos verunglücken. Die Alleen sind bereits voll mit Kreuzen und Mahnmalen. Damit habe ich aber direkt nichts zu tun: Das ist ja kein Versicherungsbetrug, wenn diese jungen Leute in ihren Toyotas sich mit überhöhter Geschwindigkeit um einen alten Alleebaum wickeln”.
Diese Alleen wurden in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts von immer mehr Herrschern in Europa angepflanzt – nicht zuletzt auch deswegen, damit ihre ihnen teuer gewordenen Soldaten im Schatten marschieren konnten. In Rußland ordnete Katharina die Große die Baumbepflanzung der Landstraßen an. Dort wurden dann auch die nach Sibirien Verbannten auf diesen Alleen transportiert bzw. unter Bewachung in Marsch gesetzt. Und noch Jahrhunderte später gedachten die Verbannten, wenn sie im Ural ankamen, der großen Katharina für ihre fürsorgliche Alleenbeschattung – mit einem Dankesgebet.
In Preußen ließ Friedrich Wilhelm I. im großen Stil Alleebäume anpflanzen. Während sie jedoch im Westen nach und nach den Straßenverbreiterungen, – begradigungen und Sicherheitserwägungen (zuletzt vor allem des ADAC) zum Opfer fielen, blieben sie im Osten – wie so vieles – nahezu unverändert erhalten, ja, sie erholten sich dort sogar von den letzten Kriegsschäden. Und seit der Wende werden auch noch weitere Alleen mit Bäumen bepflanzt bzw. Lücken in den Baumreihen zügig wieder gefüllt. Dafür werden sie jedoch auch- aus Versicherungsgründen – schneller wieder gefällt als früher.
Im Berliner Raum wurden die Bäume für die Alleen von den 1949 enteigneten “Späthschen Baumschulen” geliefert. Diese Firma war 1720 von einem Christoph Späth gegründet worden, zunächst als Obst- und Gemüsegärtnerei in Kreuzberg. Bis zum Ende des 19.Jahrhunderts wurde daraus dank der preußischen Alleebaum-Programme die “größte Baumschule der Welt” – mit zuletzt 800 Mitarbeitern. Zu DDR-Zeiten waren es noch 250.
Nach der Wende bekam der Alteigentümer Dr. Manfred Späth, ein Beamter, der einer Erbengemeinschaft vorstand, seinen Familienbetrieb zurück, der inzwischen noch einmal weiter an den Stadtrand – zwischen Britz und Johannisthal – gerückt war, wo er den Ostberlinern fast den Botanischen Garten in Steglitz ersetzte. Zumal der 1877 angelegte Schaugarten der Späthschen Baumschulen dann auf fünf Hektar zu einem Arboretum ausgebaut wurde, den die Humboldt-Universität verwaltete. Zwar gibt es in Pankow auch noch einen “Botanischen Volkspark”, aber den kannten nur wenige, er war nach dem Krieg zunächst zur Zentralstation der Jungen Naturforscher “Walter Ulbricht” erklärt worden und wurde dann ebenfalls der Humboldt-Universität zugeschlagen. Nach der Wende kam er in die Verwaltung des Bezirks, der die dortigen Hochgewächshäuser wegen Baufälligkeit schließen ließ, jetzt will man sie jedoch renovieren – und den Volkspark überhaupt attraktivieren.
Eher das Gegenteil passierte mit den “Späthschen Baumschulen”: Erst einmal mußten sie wegen des Ausbaus der Stadtautobahn A 113 einige Hektar abgeben, wobei wegen der Abgase jetzt auch die Qualität der Jungbäume in unmittelbarer Nähe der Autobahn gefährdet ist. Es ist deswegen vor Gericht noch eine Entschädigungsklage gegen den Senat anhängig. Außerdem wurden aber auch noch die kommunalen Dienstleistungen in Berlin immer teurer, so daß der Betrieb jetzt z.B. allein für die Straßenreinigungsgebühren vier mal so viel bezahlt wie für die Pacht seiner Flächen am Treptower Baumschulenweg, wo die Baumschule insgesamt 36 Hektar bewirtschaftet.
Der Umzug der “Späthschen Baumschulen” nach Ketzin ist mit einem weiteren Personalabbau verbunden – 16 Mitarbeitern wurde bereits gekündigt. Man will jedoch die Firmenzentrale in Treptow belassen, auf den frei werdenden Flächen soll ein Pflanzengroßmarkt – “mit bis zu 100 neuen Arbeitsplätzen” – entstehen.
Die Alleebaum-Schulen sind heute ähnlich arbeitsteilig organisiert wie das staatliche Schulsystem: In der Grundstufe wird das Saatgut vermehrt und Jungpflanzen produziert. In der Mittelstufe bezieht man von überall her Jungware, die dann – “halbfertig” – mit einem Stammumfang von 8-10 Zentimeter und einer Höhe von 2-3 Metern an die Oberstufe verkauft wird. Zu diesen so genannten Hochbaumschulen zählt auch der Späthsche Betrieb, der seine Ware in Deutschland, Holland und Kanada einkauft. Oftmals handelt es sich dabei um Bäume – Ahorn und Wildkirsche beispielsweise, die man als “Unterlage” mit einer Okkulation veredelt hat, wobei dann nur noch dieser aufgesetzte Trieb kultiviert wird. Als Absatzmarkt ist dem einstigen preußischen Monopolisten Späth bloß noch Berlin und Brandenburg geblieben, aber man will sich – bedrängt von den westdeutschen und holländischen Baumschulen und bedroht von den Sparmaßnahmen der Kommunen – wenigstens in Ostelbien weitere Marktanteile sichern.
Seit einiger Zeit breitet sich in den US-Staaten Kalifornien und Oregon das “Eichensterben”, dort “Sudden Oak Death” genannt, aus. In den Achtzigerjahren kam es bereits in Berlin zu einem “Eichensterben”. Dieses war jedoch der Frosteinwirkung geschuldet, vor allem an den Wurzelanläufen, während die kalifornische Eichen-Krankheit von einem Pilz namens “Phytophthora ramorum” hervorgerufen wird, den man hierzulande vor allem bei den Tomaten als “Kraut- und Braunfäule” und bei der Kartoffel als “Kraut- und Knollenfäule” kennt. Im 19. Jahrhundert löste er in Irland die “Große Hungersnot” aus, die wiederum eine Massenauswanderung der Bevölkerung nach Amerika zur Folge hatte – und in der englischen Kolonie Irland selbst einen erstmaligen massenhaften Einsatz von unsinnigen ABM-Projekten.
In Kalifornien trat der Pilzbefall zuerst in der Gegend von Big Sur bei den so genannten “Showcase Trees” auf, so nennt man dort die besonders schönen und großen Bäume auf den Grundstücken der Milliardäre, die den eigentlichen (Millionen-)Wert ihrer Grundstücke ausmachen. Inzwischen sterben aber auch Blaubeer-Sträucher, Philodendron, Lorbeerbäume, der großblättrige Ahorn und zwölf weitere Pflanzenarten an Phytophthora ramorum. Zudem breitet sich die Pilzseuche trotz Quarantänezonen immer weiter nach Osten und Norden aus. Im September befiel sie bereits die ersten Redwood- und Tannen-Kulturen in den Hauptanbaugebieten der Weihnachtsbaum-Industrie, die allein einen Umsatz von mehreren Milliarden Dollar jährlich verzeichnet. Zwar arbeiten die US-Biologen fieberhaft an einem Gegenmittel, aber bisher noch ohne Erfolg. Schon stehen etliche kalifornische Baumschulen wegen der zunehmenden Zahl von Verkaufsbeschränkungen für die Bäume aus ihrer Region vor dem Ruin. Was die deutschen Importe aus Kanada betrifft, so besteht nach Auskunft das Berliner Pflanzenschutzamtes noch keine akute Gefahr. Dafür würden die Pflanzenbeschau-Richtlinien der EU bzw. die Pflanzenbeschau-Verordnung sorgen, die gegebenenfalls Einfuhrbeschränkungen vorsehen. Es werden bei den Importen auch schon Kontrollen im Hinblick auf den “Sudden Oak Death” durchgeführt – und bei bestimmten Herkünften zusätzliche Unbedenklichkeitsbescheinigungen eingefordert. Jeder Baum- oder Pflanzensamenimporteur braucht sowieso ein Internationales Pflanzengesundheitszeugnis für seine Ware, und, wenn sie aus dem Inland bzw. dem EU-Binnenmarkt kommt, einen “Pflanzenpaß” für jeden Baum und jeden Strauch. Mit diesem Instrumentarium meint man, auch fürderhin die deutschen Alleebäume vor dem tödlichen Pilzbefall aus Amerika bewahren zu können. Alle diesbezüglichen Fäden laufen bei der Biologischen Bundesanstalt in Braunschweig zusammen, d.h. in deren Abteilung für nationale und internationale Pflanzengesundheit, die darüber laufend auf ihrer Homepage “www.bba.de” berichtet.
Auch die “Späthschen Baumschulen” haben eine eigene Homepage – für ihr umfangreiches Alleebaum-Angebot. Beim “Sudden Oak Death” verläßt man sich jedoch einstweilen noch auf die Pflanzenschutzämter. In den USA befürchten einige Biologen indes, daß die Pilzseuche vielleicht erst in etlichen Jahren wirklich flächendeckend ausbricht, so wie bei der Kastanienkrankheit und der holländischen Ulmen-Krankheit, die 50 Jahre brauchten, um auszubrechen. Der “Sudden Oak Death” wurde vor sieben Jahren erstmalig beobachtet. Aber bevor noch die ersten Pilzsporen hier gesichtet werden, hat schon ein allgemeines Baumbangen eingesetzt, das sich hier und da sogar schon gegen die staatlichen Umweltschützer formiert. Anfang Oktober z.B. am Stuttgarter Platz in Berlin, wo eine Bürgerinitiative zusammen mit der Polizei in letzter Minute das Fällen von drei Bäumen verhinderte, die zuvor von der grünen Stadträtin zu einem “Sudden Death” verurteilt worden waren, weil sie angeblich wie aus heiterem Himmel ihre “Standsicherheit” aufgegeben hätten. Insgesamt geht es dort um etwa 100 Bäume – die der Standortverlegung des Bahnhofs im Weg stehen. Speziell um den Erhalt der Alleebäume kämpft auch die Vereinigung der deutschen Landesdenkmalpfleger. In ihrem neuesten Bericht (Nr.8) druckten sie einen “Alleenerlaß” aus dem Jahr 1841 ab, in dem der preußische König sich beklagte, dass so viele Alleebäume überflüssigerweise bei Straßenbaumaßnahmen gefällt werden. Er befahl deswegen, “daß Lichten und Aushauen prachtvoller Alleen künftig” zu unterlassen. Die Landesdenkmalpfleger merkten dazu an: “Möge das königliche Vorbild, welches offensichtlich im 19. und frühen 20. Jahrhundert Schlimmeres verhindert hat, Richtschnur auch für das 21. Jahrhundert sein”.
.

Deutsche Baumallee mit zusätzlichen Pollern. Photo: mediaservice.de
.

Lieferanteneinfahrt zu den königlichen Gutshöfen in Oslo.
.
Apfelkriege
Am Bodensee und im Alten Land bei Hamburg hat die Apfelernte begonnen. Jetzt pflücken dort wieder die Polnischen Saisonarbeitskräfte zu Dutzenden im Akkord – im Alten Land vorwiegend die Sorten Elstar, Jonagold und Boskoop. In Ostdeutschland gibt es ganze Alleen mit Obstbäumen- deren Äpfel auf die Straße fallen, wo sie so gut wie niemand aufsammelt. Aber das soll sich ändern. Die Apfelbäume sollen wieder gepflegt und einzeln verpachtet werden. Die Initiative “Mundraub” stellte sogar eine interaktive Deutschlandkarte ins Netz, die zeigt, welche Apfelbäume wo abzuernten sind.
Mit der Ökologiebewegung entstand ein neues Interesse am Apfel und an alten Apfelsorten. In der DDR gab es dafür “Pomologen”. Einer, Dr. Brudel – im Obstanbaugebiet Werder wohnend, wird bereits seit Jahren ständig zu Vorträgen im Westen eingeladen. Die wissenschaftlichen Anstrengungen zur Obstbaumverbesserung im Osten gehen auf den russischen Eisenbahner und Gärtner Iwan W. Mitschurin zurück. Ihm gelang es u.a., kälteresistentere Obstsorten zu züchten, so dass auch in Sibirien Apfelbäume gedeihen können. Stalin erklärte ihn daraufhin zum Volkshelden und übergab ihm ein großes Obstanbau-Versuchsgut. Nach seinem Tod machte man aus dem “Mitschurinismus” eine ganze “proletarische Biologie”, die gegen die “bürgerliche Genetik” ins Feld geführt wurde. Aber diese Schweinebande war leider zäher als die Sowjetunion. Von der heroischen Anstrengung im Ostblock sind heute nur noch einige “Ausgewählte Schriften” von Mitschurin übrig, üppig illustriert mit gemalten Apfelbildern. Außerdem gibt es in den Archiven noch einen Film über seinen Garten: “Die Erde soll blühen!” – mit Äpfeln so groß wie Fußbälle. Ähnlich üppig illustriert mit gemalten Äpfeln, aber noch teurer ist das kürzlich in der Reihe “Naturkunden” des Verlags Matthes & Seitz erschienene Buch über Äpfel von Korbinian Aigner, das sich sogar in linken Buchläden wie blöd verkauft. Derweil versuchen die Bayern einem “Korbiniansapfel” zum Durchbruch auf dem Obstmarkt zu verhelfen: Der wegen “Beleidigung des Führers” 1934 ins KZ Sachsenhausen eingelieferte Priester Korbinian Aigner hatte im Lager angefangen, Äpfel zu züchten, die er K1, K2, K3, K4 nannte – und auch malte. Seine Apfelbilder wurden vor einiger Zeit in München ausgestellt. Nach seiner Freilassung befand er einzig K3 als gut genug, um weitergezüchtet zu werden. Nach dem Tod des Pfarrers 1960 benannten seine Pomologenfreunde die Sorte in Korbiniansapfel um – er konnte sich jedoch nicht durchsetzen, denn damals wurden gerade mit Hilfe von EG-Prämien in Höhe von 50 Pfennig pro Baum 5 Millionen Apfelbäume gefällt: Den Verantwortlichen schwebte dabei im Endeffekt ein EG-weiter “Einheitsapfel” vor. “Golden Delicious” hieß dann dieses Scheißding. Ungeachtet dessen gibt es heute in Deutschland (wieder) rund 2000 Apfelsorten – und immer noch finden die Pomologen weitere.
Wenn man will, kann man derzeit von einem Apfelkrieg sprechen – Mitschurin gegen Korbinian, die EU gegen die Postsowjetunion, vor allem geht es dabei um Polen gegen Putin, denn wegen des sich hochschaukelnden Handelsembargos traf es die polnische Äpfel, die massenhaft nach Russland exportiert wurden, besonders. Die polnischen Apfelbauern reagierten darauf mit einer Kampagne: “Polen eßt einheimische Äpfel!” – Und zeigt damit den Russen, was für ein Genuß ihnen nun entgeht. Bald warb auch der deutsche Landwirtschaftsminister Christian Schmidt für einheimische Äpfel – mit dem Spruch: “An apple a day keeps the Putin away!” Laut Spiegel forderte er die Bevölkerung wegen des russischen Lebensmittel-Embargos auf, die davon betroffenen Produkte selbst zu essen. Obst könne man “zu Beginn am frühen Morgen” und “fünfmal am Tag” essen – in verschiedenen Variationen; “chefkoch.de” empfiehlt z.B. “Russische Apfeltorte” – und verrät ein Konzept mit Korbinian-Äpfeln. So gut wie niemand berichtet derzeit über die Situation der russischen Apfelbauern, denn auch bei denen ist jetzt Erntezeit und wegen des von der EU angezettelten Handelskrieges ist auch ihnen ein großer Teil des Absatzmarktes für ihre – wenig lagerfesten – Äpfel weggebrochen. Zwar nimmt der Chinese auf die Schnelle wenigstens einen Teil der Ernte ab, aber was tun mit der Hauptmasse? Auch hier ruft die Presse nun die Bevölkerung auf, wie verrückt Äpfel zu essen; die Iswestija empfiehlt ihren Lesern verschiedene Zubereitungsarten, darunter ist witzigerweise ebenfalls eine “Apfeltorte” – aus Mitschurin-Äpfeln.
Gewinner des Apfelkriegs ist Weissrussland, das nun polnische Äpfel, aber auch alle anderen EU-Produkte importiert, sie als “weissrussische” umdeklariert und mit gutem Gewinn nach Russland weiterverkauft. Auch die anderen Apfelanbauregionen der Welt – Südtirol, Südafrika, Neuseeland, Chile, Kalifornien – wittern Morgenluft. Den deutschen Apfelanbauern macht neben dem russischen Embargo noch die chinesische Exportoffensive Sorgen: “Chinesisches Obst ist groß im Kommen”, unken die hiesigen Händler. China ist der weltgrößte Apfelproduzent, jeder zweite Apfel wächst dort – meist sind es süße Fujis aus den nordöstlichen Provinzen. Die Chinesen produzieren 22 Mio Tonnen im Jahr, die Deutschen unter 1 Mio. “Jetzt drängt China auch noch auf den Biomarkt und macht den Ökobauern aus Deutschland Konkurrenz. Ausgerechnet mit der Deutschen Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit hat das Land ein Ökosiegel entwickelt,” empört sich der Spiegel. Der Sprecher des Ökoverbands “Naturland” deutet bereits eine zweite Front im Apfelkrieg an: “Äpfel aus China werden einen Kulturkampf auslösen”, prophezeit er, denn China liegt wie Deutschland auf der Nordhalbkugel, die Äpfel werden also zur gleichen Zeit geerntet.
Übrigens werden dort in einigen Regionen die Blüten der Apfelbäume nicht von Bienen, sondern von Menschenhand bestäubt. Eine mühsame Arbeit, denn jeder Apfelbaum muß mehrfach besucht und betupft werden, weil seine Blüten nie alle zur gleichen Zeit aufnahmefähig für den Pollen sind. Markus Imhoof und Claus-Peter Lieckfeld schreiben in ihrem Buch zum Film “More Than Honey”: “Dass im Sichuan-Tal nicht Arbeitsbienen, sondern Arbeiter Blüte um Blüte bestäuben, wirkt auf den Betrachter wie ein erschreckender Ausblick auf künftige Zeiten.” Es hat jedoch nichts mit dem Bienensterben zu tun und wird auch schon lange von den Obstbauern praktiziert, “weil die Anatomie der kleinen, in ganz China verbreiteten Asiatischen Honigbiene, ‘apis cerana’, nicht zu der Blüte jener Apfelsorte paßt, die dort von altersher angebaut wird.” Diese Sorte gilt in China als besonders schmackhaft – die Äpfel sind aber auch besonders teuer. Und demnächst gibt es sie auch hier – für unsere Kriegsgewinnler.
Das Appel&Ei-Feuilleton erwähnt bei diesem Thema gerne die drei schwerbewachten Äpfel der Hesperiden, die Herakles einst stahl. Er schenkte sie Athene, die sie aber in den Garten zurückbrachte. So kam niemand zu Schaden. Anders beim berühmten Apfelbaum im Paradies, das sich ebenfalls am Mittelmeer befand. Wenn man den Kibbuzniks am See Genezareth glauben darf, gleich hinter ihren Ländereien. Das Problem bei dieser Standortbestimmung ist jedoch: Erst die Israelis legten dort Apfelplantagen an. Ihre Apfelbauern auf den Golanhöhen und in Galiläa sind in diesem Jahr nebenbeibemerkt schwer enttäuscht, “denn ihre Ernte des Starking-Apfels wurde durch die bis zu 45 Grad Celsius erreichende Hitzewelle fast vollständig zerstört,” wie “israelheute” meldet. Früher wuchs dort nicht das Rosengewächs Apfel (Malus Mill.) sondern Granatapfelbäume (Punica granatum). Aus ihrer Frucht läßt sich das Verhütungsmittel “Hesperidin” gewinnen. Deswegen spricht man auch vom “Baum der Erkenntnis”. Und es ist klar, warum die Bibelautoren meinten, mit so einem aufklärerischen Wissen dürfen die Leute auf keinen Fall im Paradies bleiben. Draußen bekamen sie dafür später ein “Oekumenisches Liederbuch” in die Hand gedrückt – mit der unmißverständlichen Aufforderung “…heute noch einen Apfelbaum pflanzen.” Die Ernährungsberater versicherten ihnen daraufhin flugs: “An Apple a Day keeps the Doctor away!” Mehr als 30 Vitamine, wichtige Spurenelemente und wertvolle Mineralstoffe wie Phosphor, Kalzium, Magnesium und Eisen trägt ein durchschnittlich großer Apfel in und unter seiner Schale. Und ein großer Baum trägt 1000 Äpfel, damit kommt man gut über den Winter. Angeblich helfen sie auch gegen Depressionen und Zukunftsängste: 1985, ein Jahr vor “Tschernobyl”, veröffentlichte der TV-Aufklärer Hoimar von Ditfurth einen Bestseller mit dem Titel “So laßt uns denn ein Apfelbäumchen pflanzen. Es ist soweit.” Sein Buch beginnt mit den Worten “Endzeit…es steht nicht gut um uns” (Atomkrieg, Umweltzerstörung, Bevölkerungsexplosion, unfähige Politiker etc.).
Erst mit der Elektronik für jederman kam wieder Hoffnung auf, wobei man diese erneut “Apple” nannte. Der US-Computerkonzern scheute sich nicht, den Namen samt Apfel quasi von der Londoner Plattenfirma “Apple Corps” zu klauen, die 1968 von den Beatles gegründet wurde. Der Siliconvalley-Startup verteidigte sich damit, dass die Kunden die beiden Logos schon zu unterscheiden wüßten. “Pferde stehlen, Äpfel schälen – das war Babuschka!” sang damals der tschechische Russenknecht Karel Gott.
.

Apfelbaum. Photo: streuobstwiesen.org
.
Äpfel gegen Arbeitsplätze
.
Das größte norddeutsche Obstanbaugebiet, das Alte Land bei Hamburg, wird besonders von der expandierenden Hansestadt bedroht, die dort in der Elbemarsch vis à vis von Blankenese, Umgehungsstraßen, Autobahnen und Zubringer plant, das Süßwasserwatt Mühlenberger Loch bereits für ein Flugzeugauslieferungszentrum des Airbus-Konzerns zuschüttete und das Dorf Altenwerder bis auf seine Kirche schliff – um Platz für neue Industrieansiedlungen und Hafenausbau zu schaffen.
Als dann aber der im nahen Finkenwerder ansässige Airbus-Konzern auch noch ankündigte, wegen eines neuen Modells, den A 380, seine Start- und Landebahn verlängern zu müssen – quer durch das Obstanbaugebiet “Rosengarten” bis kurz vor die barocke St.Pankratiuskirche von Neuenfelde, und dazu auch noch den Landesschutzdeich verlegen wollte, da war das Maß voll: 230 Obstbauern und Sympathianten organisierten sich in einer Klägergemeinschaft – gegen die drohende Enteignung der Ländereien.
Sie bildeten ein “Netzwerk” von Arbeitsgruppen, die sich mit einzelnen Aspekten des Planfeststellungsbeschlusses und den Argumenten des Hamburger Senats sowie des Airbus-Konzerns auseinandersetzten, u.a. ging es dabei um eine “Lex Airbus”, mit der die Hansestadt den Flächenbedarf des EU-Flugzeukonzerns im “öffentlichen Interesse” enteignen wollte. Sonst seien nicht nur “Arbeitsplätze” in Größenordnungen gefährdet, das Prestige der ganzen Nation stehe dort quasi auf dem Spiel. Hinterfüttert wurde dies mit dem Argument einer “Wachsenden Stadt” und ihrem notwendigen (Tiger-)”Sprung über die Elbe”. Der CDU-Bürgermeister Ole von Beust erklärte dazu, dies bedeute “mehr Qualität”, die wiederum in “mehr Quantität” umschlage, d.h. in noch “mehr Hamburger”. Das hanseatische Oberverwaltungsgericht verbot ihm dann jedoch solch dialektischen Unsinn: Die Obstbauern atmeten auf! Ihre Ländereien durften nicht enteignet werden. Die Freude über das Urteil währte jedoch nur kurz, denn nun wurde die hansestädtische Presse aktiv, die einen Obstbauern nach dem anderen als reichen, egoistischen Forschrittsfeind vorführte. Gleichzeitig bot die Stadt diesen immer mehr Geld pro Quadratmeter. Wer es ablehnte, wurde sofort an die Presse weiter geleitet. Bei der Neuenfelder Kirchengemeinde, der ebenfalls ein Grundstück im “Rosengarten” gehört, versuchte man es mit kirchlichem Druck von oben. Und der Airbus-Konzern ging sogar so weit, seine Belegschaft mit der Gewerkschaft zusammen zu einer “Protestdemonstration” auf einer Wiese am Obstbaugebiet zu formieren: Arbeitsplätze gegen Äpfel! Dergestalt von allen Seiten angegriffen verkauften einige Obstbauern dann doch ihr Land.
Am Nordrand des “Rosengartens” wurden inzwischen bereits die ersten Häuser platt gemacht. Es waren dabei regelrechte “Knebelverträge” zustandegekommen, in denen bei einem Flächenverkäufer z.B. gleich noch das Grundstück seiner Tochter mit einbezogen wurde. Diese blieb dann auch trotz “Verkauf” der Klägergemeinschaft als Aktivistin erhalten. Eine andere, die Bioobstbäuerin Gabi Quast, bekam zusammen mit elf anderen Leuten ein kleines “Sperrgrundstück” geschenkt. Dort stellten sie eine Meßstation auf, die den Lärm und die Verunreinigung der Luft durch Flugbenzin messen soll und deswegen schon mal Daten sammelt – bevor es wohlmöglich doch noch mit dem Bau der Landebahnerweiterung losgeht. Ende 2004 verkaufte ausgerechnet der Obstbauer Cord Quast sein großes Stück Land im Rosengarten. Die Bild-Zeitung jubelte: Aus Freude trage nun jeder Hamburger ein Cord-Quast-Hütchen. Quast war zuvor einer der engagiertesten Neuenfelder Obstbauern gewesen, der auf Versammlungen oft das Wort ergriffen und die hansestädtischen Journalisten eigenhändig von seinem Hof vertrieben hatte. Seine plötzliche Wandlung vom Kläger zum Verhandler erklären sich die Sprecherin der Klägergemeinschaft, ihre Anwälte, der ehemalige Neuenfelder Pastor und der Leiter des Obstbau-Versuchs und -Beratungszentrum in Jork mit dem großen Druck, dem er ausgesetzt war, nicht zuletzt auch in seiner Familie, wobei gleichzeitig betont wird, dass er auch nach Verkauf seiner Flächen im Rosengarten immer noch einen existenzfähigen Hof besitze, zudem seien seine zwei Töchter mit Obstbauern verheiratet, deren Land nicht von Airbus beansprucht wird. Und als Vorsitzender des Sommerdeichverbandes Rosengarten spiele er auch weiterhin eine wesentliche Rolle im Geschehen. Etwa Zwanzig Hektar reichen derzeit für eine auskömmliche Hofstelle im Alten Land, die hanseatische Landwirtschaftskammer geht aber bereits von zukünftig 40 Hektar aus. Da es keine Expansion, sondern nur noch eine Schrumpfung der Obstanbauflächen dort geben kann, bedeutet dies eine weitere Konzentration auf immer weniger Obstbauern im Alten Land.
Die hier vom Oberverwaltungsgericht zurückgewiesene “Lex Airbus”, mit der ein Konzern Ländereien enteignen lassen wollte, ist kein Einzelfall: Anderswo ziehen allerdings meist die Individualrechte vor den Gerichten den kürzeren – gegenüber einem vermeintlichen Allgemeinwohl, das immer öfter mit “Arbeitsplätzen” begründet wird. Zwar sind beide Rechte grundgesetzlich geschützt, es hat dabei jedoch eine Umgewichtung stattgefunden, seit Gründung der Bundesrepublik – wenn man z.B. von den ersten SPD- und CDU-Parteiprogrammen nach dem Krieg ausgeht, in denen angesichts der “Mitschuld” der deutschen Großindustrie und der weitreichenden sowjetischen Enteignungen ostdeutscher Betriebe und der dort sofort durchgeführten Bodenreform ebenfalls die “Verstaatlichung der Schlüsselindustrien” mindestens der “Banken” im Westen gefordert wurde. Zuletzt, ab 1967, wurde nur noch die Forderung “Enteignet Springer” laut. Und so wie es hierzu zwei Konzeptionen gab: Die einen wollten den Medienkonzern verstaatlichen, die anderen ihn “dezentralisieren” – so unterscheidet der Soziologe Claus Offe zwei Versionen von Gemeinwohl: Die eine dient zur Verteidigung der Rechte der kleinen Leute; mit der anderen argumentieren die Machteliten. In diesem Zusammenhang wird gerne an die Teststrecke im Raum Boxberg erinnert, die Daimler Benz bauen wollte und wogegen sich ab 1979 ein wachsender Widerstand entwickelte. Hier wollte die baden-württembergische Landesregierung mit einem “Flurbereinigungsverfahren” Ackerland für den Autokonzern enteignen. Zehn Jahre dauerte diese politisch-juristische Auseinandersetzung, die mit dem “Boxberg-Urteil” des Bundesverfassungsgerichts für die Bauern siegreich endete.
Von ähnlicher Bedeutung war zuvor die erfolgreiche Besetzung des Bauplatzes für ein Atomkraftwerk in Whyl, deren 30. Jahrestag man dort gerade feierte. Der Bürgermeister der Gemeinde Weisweiler Oliver Grumber erklärte dazu: “Wie vor 30 Jahren sind Weisweiler Bürgerinnen und Bürger auch heute noch dabei,” d.h. sie engagieren sich seitdem für die Nutzung regenerativer Energiequellen. Mit ihrem Widerstand hob die Anti-AKW-Bewegung an, die sich 1985 im Kampf gegen den Bau einer Wiederaufbereitungsanlage (WAA) im bayrischen Wackersdorf fortsetzte, wobei die Kernkraftgegner von weither anreisten. Erst kürzlich erklärte der damalige SPD-Landrat des betroffenen Landkreises Schwandorf Hans Schuierer: “Für unsere Region war das eine furchtbare Zeit. Wenn man sich vorstellt, wie viele Strafverfahren gegen friedliche Demonstranten liefen. Doch der fünfzehnjährige Kampf hat sich gelohnt. Wir haben an dem Standort, wo die WAA errichtet werden sollte, inzwischen ein Industriegebiet und somit einen guten Tausch gemacht. Anfangs versprach die Betreibergesellschaft DWK 3200 Arbeitsplätze in der WAA, später 1600, dann 1200. Im Industriegebiet haben wir heute ca. 4000 Arbeitsplätze. Und dann muß ich ganz ehrlich sagen: Wir haben diese Autonomen gebraucht. Denn die Regierung hätte uns noch zehn Jahre um den Zaun tanzen lassen”.
Vielleicht werden auch die Bauern in und um das wendländische Gorleben einmal so über ihre mehr oder weniger militanten Sympathisanten reden, mit deren Unterstützung es ihnen bis heute gelungen ist, immer wieder gegen die Einlagerung von Atommüll in einen unterirdisches Salzstock, “Nukleares Entsorgungszentrum” (NEZ) genannt, zu protestieren, indem sie jedesmal die so genannten Castor-Transporte massiv behinderten. Hierbei greift auf der anderen Seite auch noch das Bergrecht, das im Falle eines nationalen Energieversorgungs-Interesses Enteignungen und Zwangsumsiedlungen erleichtert. In Gorleben ist Graf von Bernstorff ein Großgrundbesitzer und damit dort laut Spiegel “die Schlüsselfigur”. Ihn hat man zwar aus der CDU ausgeschlossen und vor allem einzuschüchtern sowie auch zu korrumpieren versucht, wie er das Winken mit viel Geld nennt, aber bisher habe es noch keine “konkreten Hinweise auf Enteignung” seiner Ländereien gegeben, er würde aber so oder so fortfahren, Widerstand zu leisten.
Das ist im nordrhein-westfälischen Braunkohletagebau Garzweiler II anders: Hier werden gerade mit Hilfe des Bergrechts und nach erfolgreichen Verhandlungen 18 Dörfer und Weiler mit hunderten von Bäume sowie ein Drittel der Stadt Erkelenz zerstört – und etwa 8000 Menschen umgesiedelt. Mit ihrem Widerstand erreichten sie nur einigermaßen respektable Abfindungen, aber die Argumente ihres Gegners, in diesem Fall der RWE-Konzern, tragen auch nicht mehr weit, denn im Zuge der Deregulierung des Energiemarktes und der Umweltschutzbedenken der EU gegenüber der Braunkohlenverstromung ist die Abbaggerung von Dörfern immer weniger mit einem nationalen Versorgungsinteresse zu begründen – und stößt deswegen auf immer stärkeren Widerstand.
Dafür scheinen die Gerichte jedoch dem Arbeitsplatz-Argument zunehmend mehr Gewicht bei zu messen – besonders im fast deindustrialisierten und von hoher Arbeitslosigkeit betroffenen Osten, wo den Braunkohlebaggern des schwedischen Konzerns Vattenfall demnächst die brandenburgischen bzw. sächsischen Orte Heidemühl, Schleife, Trebendorf und Heuersdorf ganz oder teilweise zum Opfer fallen, außerdem das Naturschutzgebiet Lakomaer Teiche. Zerstört wurde auch das denkmalgeschützte sorbische Dorf Horno, dessen Bewohner schon zu DDR-Zeiten angefangen hatten, sich gegen ihre Enteignung und Umsiedlung zu wehren. 1997 machte dem jedoch ein von der SPD-Landesregierung verabschiedetes “Hornogesetz” ein Ende, das dann vom Landesverfassungsgericht als verfassungskonform anerkannt wurde – trotz des zuvor für die sorbische Minderheit in der Landesverfassung festgeschriebenen Schutzes ihres “angestammten Siedlungsgebietes”. Zuletzt lebte dort nur noch das Gärtnerehepaar Domain und ihr Mieter Michael Gromm – inmitten einer Ruinenlandschaft, aber sie kämpfen immer noch. Der Obstgärtner Domain mußte sich vom Vattenfall-Anwalt vor dem Bergamt sagen lassen: “Lassen Sie Ihre Scherze, sonst ziehen wir andere Saiten auf!” Domain blieb jedoch auch beim letzten Vattenfall-Angebot – 450.000 Euro – standhaft: “Ich gehe notfalls bis vors Bundesverfassungsgericht!” Aber Anfang 2006 gab er dann doch auf und ließ sich als letzter umsetzen.
Bis auf einen einzigen Widerständler wurde ebenso bereits das Dorf Diepensee am Rand von Berlin abgeräumt. Dort soll demnächst der neue Großflughafen Schönefeld gebaut werden, ein Gericht verhängte jedoch Mitte April 2005 einen einjährigen Baustopp: “40.000 Jobs in Gefahr!” titelte die Bild-Zeitung prompt. Solch vereinsamte “letzte Aufrechte” wie in Diepensee gibt es im übrigen auch in “Altenwerder” und bei “Garzweiler II”.
Massenhaften und militanten Widerstand gab es Anfang der Achtzigerjahre gegen den Bau der Startbahn West des Frankfurter Flughafens, er reichte jedoch auch nicht aus. Jetzt formieren sich dort erneut die “Startbahngegner”, denn noch einmal soll hier der Flughafen erweitert werden, wobei ihm diesmal die Siedlung Zeppelinheim zum Opfer fällt. Aber auch andere Gemeinden von Offenbach bis Bischofsheim sind betroffen. Einer ihrer Wortführer ist der CDU-Bürgermeister von Neu-Isenburg Oliver Quilling: “Die Südbahn wäre für uns der Super-GAU,” meint er, “die Stadt würde mittig überflogen”.
Bereits ausgebaut wird derzeit trotz Proteste und Friedensdemonstrationen der US-Militärflughafen Spangdahlem bei Bitburg in der Eifel. Hier drohte man den Grundstücksbesitzern mit dem “Gesetz über die Landbeschaffung für Aufgaben der Verteidigung” von 1957. Nachdem einige Prozesse verloren gegangen waren, nahmen viele Landwirte die angebotenen Entschädigungen an. “Die Menschen sind eingeschüchtert und zermürbt,” erklärte der Sprecher der Flughafengegner – der Nebenerwerbslandwirt Hans-Günther Schneider. Aber einige solidarische Gruppen, grüne Ortsgruppen z.B., “kämpfen” noch weiter. Ende März 2006 war der brandenburgische Luft-Boden-Schießplatz “Bombodrom” bei Wittstock wieder einmal Ziel des Ostermarsches, auch hier hat ein Gericht per Bescheid der Bundeswehr die weitere Nutzung fürs erste untersagt.
Ähnlich wie beim Hamburger Obstanbaugebiet Altes Land gestaltete sich die Situation im Stuttgarter Gemüseanbaugebiet Filder, das vom Bau einer neuen Messe bedroht wird. Die “Schutzgemeinschaft Filder” kämpft hier schon seit zehn Jahren. Einer der sechs klagenden Bauern, Walter Stäbler, gab inzwischen auf und verkaufte sein Land an die Messeplaner. Sein Übertritt von den Klägern zu den Verhandlern sei besonders bitter, meinte die Sprecherin der Schutzgemeinschaft Gabi Visitin, weil Stäbler einer ihrer engagiertesten Mitstreiter war. Die aus 40 Gemeinden und Organisationen bestehende Schutzgemeinschaft klagte durch zehn Instanzen – bis sie im Juli 2004 vor dem baden-württembergischen Verwaltungsgerichtshof verlor. Dem Mannheimer Gerichtsentscheid kommt bundesweite Bedeutung zu, denn er stützt das 1998 vom baden-württembergischen Landtag verabschiedete “Messegesetz”, das Enteignungen und Sofortvollzug der Baumaßnahmen speziell für die Messe möglich macht. Bisher waren Zwangsenteignungen nur erlaubt, wenn das Allgemeinwohl dem privaten Interesse übergeordnet werden konnte, was für Bauvorhaben zur Landesverteidigung, zur notwendigen Verkehrswegeverbesserung und zur Versorgung mit Strom, Gas und Wasser galt.” Und bei der Verkehrswegeplanung verlangten die Gerichte in der Vergangenheit nicht selten eine Änderung zugunsten einer oder mehrerer Grundeigentümer, die partout nicht weichen wollten und sich als Einzelkämpfer hartnäckig durch die Instanzen geklagt hatten.
Angesichts des seit Mitte der Siebzigerjahre wachsenden Widerstands gegen umweltzerstörende Großbauprojekte griffen die höchsten Gerichte zunächst zu einer Reihe flankierender Maßnahmen – gegen die Protestierer und Blockierer. Eine davon war 1988 das Verbot von Sitzblockaden durch den Bundesgerichtshof. Der ehemalige Bundesverfassungsrichter Martin Hirsch ließ es sich – wiederum aus Protest dagegen – nicht nehmen, wenig später schon an einer Sitzblockade gegen das “Giftgaslager Fischbach” bei Pirmasens teil zu nehmen – mit der Begründung: “Das Urteil ist verfassungswidrig. Im Gesetz steht ausdrücklich, dass eine solche Sitzblockade nur strafbar ist, wenn sie verwerflich ist, d.h. wenn man nur einen privaten Zweck verfolgt. Aber der Gesetzgeber, und dazu habe ich als Bundestagsabgeordneter damals selbst gehört, hat ausdrücklich hineingeschrieben, dass das Motiv, weswegen jemand blockiert, eine Rolle spielt. Und der BGH hat jetzt erstaunlicherweise entschieden, dass dieses Motiv überhaupt keine Rolle spielt bei der Verurteilung, sondern höchstens bei der Strafzumessung. Das ist ein glatter Kunstfehler.” Ein inzwischen verstorbener Aktivist gegen das Giftgaslager hat den solidarischen Richter Hirsch da korrigiert: “Es ist wohl eher eine Frage des Kräfteverhältnisses, wenn man so will, des ‘Zeitgeistes’.”
Das mußten auch die Bauern auf der nordfriesischen Halbinsel Eiderstedt erfahren, die sich geradezu in einem “Krieg” wähnen. Sie kämpfen dort jedoch nicht gegen vermeintlich arbeitsplatzschaffende Bauvorhaben, sondern im Gegenteil: gegen die sukzessive Ausweitung Eiderstedts zu einem Flora-Fauna-Habitat-Gebiet, das ihnen in ihrer landwirtschaftlichen Arbeit immer mehr Einschränkungen auferlegt. Sie haben sich dagegen in einer “Interessengemeinschaft ‘Rettet Eiderstedt'” organisiert, der vor allem die in Schleswig-Holstein mitregierende Partei der Grünen ein Dorn im Auge ist. “Die Grünen aber wissen,” schreibt die FAZ, “dass eine harte Haltung im Streit um Eiderstedt bei der grünen städtischen Klientel vor allem in Kiel mehr Stimmen bringt, als bei den wenigen Landwirten in Eiderstedt verlorengehen.” Einer der Bauern in Eiderstedt sagte es so: “Diese hauptberuflichen Umweltschützer sind schlimmer als die Grafen einst!”
Aber die Betroffenen werden auch immer professioneller: Im Alten Land z.B. läßt sich die Klägergemeinschaft von der Hamburger Anwaltskanzlei Mohr vertreten und die ausgescherten “Verhandler” von der Societät Günther. Beide sind zur Kooperation untereinander verpflichtet. Umgekehrt ließ sich die Interessengemeinschaft für den Erhalt der Lakomaer Teiche in Brandenburg erst von den Hamburger “Verhandler”-Anwälten beraten und nunmehr von der Kanzlei der Klägergemeinschaft. Diesbezüglich einen guten Ruf genießt daneben auch die Berliner Kanzlei De Witt, Müller-Wrede. Auf ihrer Internetseite heißt es: “Aufgrund vielfältiger und langjähriger Erfahrungen bieten wir Beratung in strategischen und taktischen Fragen” sowie auch über “die Wirkung in der Öffentlichkeit”. Siegfried de Witt war u.a. lange Zeit Anwalt der Boxberger Bauern sowie dann auch der Gemeinde Horno, die zuletzt parallel zu ihrem Widerstand verhandelte. Die drei jetzt noch im zerstörten Dorf Ausharrenden lassen sich vor Gericht und Bergamt u.a. von dem in Frankfurt/Main ansässigen Anwaltsbüro Philipp-Gerlach & Teßmer vertreten. Diese weisen auf ihrer Homepage gleich auf eine ganze Reihe eigener Veröffentlichungen zu “Lärm- und Luftauswirkungen beim Flugverkehr”, zum “Bundesverkehrswegeplan”, zur “Landschaftserhaltung”, zu “Verbandsklagen gegen Tagebau-Zulassungen”, zu “Habitat und Vogelschutzrecht” und generell zum Thema “Natur und Recht” hin. Die schnell wachsende Zahl von Klienten für diese Kanzleien deutet darauf hin, dass angesichts der hohen Arbeitslosigkeit Politik, Presse und Justiz immer bereitwilliger werden, den Industriekonzernen bei ihren Expansionsplänen zuzuarbeiten, d.h. die ihnen dabei im Weg oder in der Einflugschneise wohnenden kleinen Leute beiseite zu räumen, was nicht zuletzt auch mit der zunehmenden “Standortkonkurrenz” der Kommunen zusammenhängt.
“Im Mittelpunkt steht der Mensch, aber genau da steht er im Weg,” so sagte es der ehemalige VW-Vorständler Daniel Goeudevert. Beizeiten bereits hatte sich dieser (globalen) Managersicht gegenüber der Ethnologe Claude Lévy-Strauss für ein Denken und Planen auf “authentischem Niveau” ausgesprochen: Weil diese Gesellschaft die Individuen auf auswechselbare Atome reduziere und sie zugunsten des Profits zentraler, anonymer Gewalten enteigne, dürfe man gerade jetzt nicht mehr das “Niveau des Authentischen” verlassen. Und dieses existiere nur in “konkreten Beziehungen zwischen Einzelnen: Auf authentischem Niveau liegt z.B. das Leben in einer Gemeinde”, wo keine abstrakten Entscheidungen, sondern solche von konkreten Individuen getroffen werden, “deren kollektives Leben auf einer authentischen Wahrnehmung der Wirklichkeit beruht: auf Wahrheit. Eine globale Gesellschaft beruht dagegen auf Menschenstaub”.
Im Alten Land ging es so weiter, dass für den Bau der Airbus-Landebahn ein “Planänderungsverfahren” eingeleitet wurde, gegen den die Bürger 470 Einwendungen geltend machten. Auf der anderen (Elbe-)Seite kam das Oberverwaltungsgericht Ende Mai bei einer Klage gegen den alten Plan zu dem Urteil, dass fürderhin auch bei solch “mittelbar gemeinnützigen Vorhaben” (von Unternehmen) die Betroffenen mehr erdulden müssen als “normal” – Fluglärm z.B., deren oberster Grenzwert für Wohngebiete bei 55 Decibel (dbA) liegt, den das OVG nun jedoch auf 61 bis 62 Decibel hochschraubte. Gegen diese “überraschende” juristische Wende und den neuen Begriff “mittelbar gemeinnützig” wollen die Anwälte der Klägergemeinschaft in Revision gehen.
Ende Juli 2006 demonstrierten die Obstbauern aus dem Alten Land erst einmal in Hamburg. Das Hamburger Abendblatt berichtete anschließend: “Anwohner fürchten den Tod einer ganzen Region – und den Verlust ihrer Existenzen. Die Airbus-Landebahn, gleich zwei Autobahnen (A 20 und A 26) durch das bislang geschlossene Anbaugebiet, die Umgehung des verkehrsgeplagten Finkenwerder: Unter den Bewohnern, egal aus welchem Ort im Alten Land, wächst die Angst. Gestern trugen die Bauern ihre Angst in die Hamburger City: Mit etwa 150 Treckern und Anhängern tuckerten sie von Neuenfelde bis vor das Hamburger Rathaus. ‘Bäume blühen nicht auf Beton’ und ‘Angst hinterm Deich’ hatten die bodenständigen Obstbauern auf ihre Plakate geschrieben. ‘Der Senat zerstört, was uns gehört’, fürchten viele von ihnen. Anders als noch in den Vorjahren präsentiert sich das Alte Land mittlerweile als Einheit im Protest gegen die Senatspläne in Sachen Airbus und Autobahnbau. ‘Im Alten Land ist in der Not das Zusammengehörigkeitsgefühl gewachsen’, sagt Gabi Quast vom Schutzbündnis Elbregion e. V. ‘Die Solidarität untereinander ist deutlich zu spüren. Das wird auch der Senat merken.’ Grund für den neuen Zusammenhalt der Altländer: ‘Die Bedrohungen sind weitaus konkreter geworden’, so Gabi Quast.”
Die Proteste und Klagen der Obstbauern im Alten Land waren dann auch insofern nicht ganz erfolglos, als die projektierte Start- und Landebahn schließlich nur in einer verkürzten Version gebaut wurde: Mitte Juli 2007 konnte der Wirtschaftssenator von Hamburg offiziell die auf insgesamt fast 3,3 Kilometer verlängerte Piste im Stadtteil Finkenwerder an “Airbus Deutschland” übergeben. Die zusätzlichen 589 Meter Betonbahn kosteten der Stadt 38 Mio Euro. Einige Tage später startete auf ihr bereits die erste Maschine. Sie flog nach Toulouse, wo noch einige Systemtests durchgeführt werden sollen, bevor man die A 380 an die “Singapore Airlines” ausliefert. “Dies ist ein weiterer Meilenstein für uns und ein tolles Gefühl”, sagte die Airbus-Sprecherin nach dem Start, während einige Dutzend Airbus-Mitarbeiter um sie herum Beifall klatschten. Der Hamburger Staatsrat Gunther Bonz erklärte: “Über zehn Jahre Planung, Auseinandersetzungen, Prozesse und eine termingerechte Baurealisierung liegen hinter diesem für Deutschland so wichtigen Großprojekt. Wir können dem Unternehmen EADS/Airbus nunmehr die notwendige Infrastruktur zur Verfügung stellen, um im weltweiten Wettbewerb der Standorte die erforderliche Leistungsfähigkeit aufzuweisen.”
Bislang wurden nach Unternehmensangaben 159 Exemplare des “leisen Riesenvogels” bestellt, der dann aber wohl doch lauter als geplant starten, fliegen und landen wird. Die Bürgerinitiative “Deutscher Fluglärmdienst” hat jedenfalls nach den ersten Probeflügen Meßwerte bis zu 80 Dezibel ermittelt, was vom Konzern jedoch dementiert wurde. Das Hamburger Oberverwaltungsgericht kam ihm Anfang 2007 bei einer der Klagen der Obstbauern gegen die Landebahnerweiterung entgegen. Der neue dort aus dem Richterärmel geschüttelte Begriff “mittelbar gemeinnützig” signalisierte den Klägern, dass die Hamburger Pfeffersäcke und ihre Wasserträger alles tun würden, um die Hansestadt und damit die ganze Nation nach vorne zu bringen – noch größer, noch lauter, noch dreister. Und auch immer tiefer – die Elbe nämlich, weil die Schiffe immer größer werden und man den Güterumschlag im Hamburger Hafen in den nächsten zehn Jahren verdoppeln will. Dagegen hängen nun ebenfalls im Alten Land lauter Protestplakate: “Keine Vertiefung der Elbe!” – denn dadurch wird der Deichschutz, der bereits durch die Airbus-Landebahnerweiterung reduziert wurde, noch prekärer. Die Altländer bleiben also widerständig. Das “Hamburger Abendblatt” (der Springerpresse) mobilisierte dagegen am 8.8.2007 die Volksmeinung: “Alle Gegner der Startbahnverlängerung dürften auf Grund der mittlerweile wochenlangen intensiven, durchaus differenzierten und kritischen Berichterstattung und der hohen Anzahl der Startbahnbefürworter in der Bevölkerung und nahezu der gesamten Parteienlandschaft bemerkt haben, daß die Zeit reif ist, ihre wohl eher ideologisch bedingte Haltung kontra Airbus aufzugeben. Statt dessen verharren sie im Zustand immer wiederkehrender Faktenverleugnung und scheinen im Grunde verirrt im fortschritts- und technologiefeindlichen Gedankengut. Hier helfen womöglich keine weiteren Diskussionen. Überzeugungsarbeit mittels Argumenten scheint sinnlos.”
.
P.S.: Für die wochenend-taz vom 11.10. interviewte Plutonia Plarre den Besitzer einer kleinen Süßmosterei in der Uckermark. Er klagte über die schlechte Apfelernte 2014 gerade in Nordbrandenburg. Anderwo spricht man jetzt von einer “Apfelschwemme”.
P.P.S.: Bei Matthes & Seitz erschien gerade Henry Thoreaus kleine Schrift “Lob der Wildnis”, im letzten Kapitel befaßt er sich ausführlich mit Apfelbäumen- in Vergangenheit und Gegenwart. An einer Stelle heißt es darin: “Das Zeitalter der wilden Äpfel wird bald vorüber sein. In Neuengland wird diese Frucht wahrscheinlich aussterben.” Thoreaus berühmteste, auf eigene Erfahrungen basierende Schrift “Walden” oder “Leben in den Wäldern” diente schon oft und in mancherlei Hinsicht als Vorbild. Sei es, dass der Titel “Walden” einer Kneipe in Berlin als Name dient oder dass der berühmte UNA-Bomber, Theodor Kaczynski, sich in den Wald zurückzog und dort in einer Hütte lebte, die der von Thoreau nachempfunden war. Sie wurde nach Kaczynskis Verhaftung abgebaut und für das Gericht noch einmal aufgebaut. Später baute sie dann der Leipziger Künstler Lutz Dammbeck für die Aachener Ausstellung “Bagdad-Jerusalem-Aachen” nach, wo sie im Aachener Dom platziert wurde. Auch Thoreaus Hütte, die ihm seinerzeit 28 Dollar gekostet hatte, wurde mehrmals nachgebaut: Zunächst in den USA – als Museumsstück, in Berlin baute der Bildhauer Tobias Hauser dieses Exemplar vor einigen Jahren nach, er ging danach regelrecht auf Tour damit. Die taz interviewte jetzt einen Lebenskünstler namens Simon Baumeister, der sich von Thoreaus “Leben in den Wäldern” dergestalt inspirieren ließ, das er in einen Wald zog – in eine kleine Hütte aus vorgefundenen Pflanzenteilen. Er spricht von einem “Freiraum”. Eine Polizeirazzia hat er bereits überlebt. Ähnliches gilt auch für den vielverfolgten österreichischen Tierrechtsaktivisten Martin Balluch, der mindestens 100 Tage im Jahr in einem Wald oder einer Tundra verbringen muß, mit seinem Hund (Kuksi) , wenn beide in der Stadt nicht unglücklich werden wollen. Sein darüber kürzlich erschienenes Buch heißt: “Der Hund und sein Philosoph”. Der studierte Philosoph hat zwischen den Erzählungen über Kuksi das Tierrecht von Kant bis Hilal Sezgin aufbereitet. Am nächsten kommt seinem Buch das von Mark Rowlands “Der Philosoph und der Wolf”. Dieser amerikanische Philosophiedozent legte sich einen jungen Wolf zu, den er überall mit hinnahm, auch in seine Vorlesungen, mit der Zeit vereinsamten die beiden und zogen erst nach Irland, dann nach Frankreich, wo Rowlands, weil er für seinen Wolf beim Laufen nicht mehr schnell genug war, noch zwei Schäferhunde erwarb. Die vier lebten ebenfalls in einer Art von Wald. Und wenn sie nicht gestorben sind…Seltsam, bei diesem ähnlichen Inhalt der beiden Bücher, der sich schon in den Titeln äußert, dass Martin Balluch ausgerechnet das Buch von Rowlands nicht mit in sein Literaturverzeichnis aufgenommen hat, ich hab noch mal gekuckt. Im übrigen lese ich gerade in der “Politischen Theorie der Tierrechte – ‘Zoopolis'” von Sue Donaldson und Will Kymlicka den Satz: “Diesen Einwand nehmen wir Ernst.”
.
.

Nutzforst
.

Regenwaldreste
.
In den Wald hineinsehen
Der französische Semiologe Roland Barthes unterschied die Metasprache, die in der Stadt gesprochen wird, von der Objektsprache – auf dem Land. “Die erste Sprache verhält sich zur zweiten wie die Geste zum Akt: Die erste Sprache ist intransitiv und bevorzugter Ort für die Einnistung von Ideologien, während die zweite operativ und mit ihrem Objekt auf transitive Weise verbunden ist.” Zum Beispiel der Baum: Während der Städter über ihn spricht oder ihn sogar besingt, da er ein ihm zur Verfügung stehendes Bild ist, redet der Dörfler von ihm – gegebenenfalls fällt er ihn auch. Und der Baum selbst? Wenn der Mensch mit einer Axt in den Wald kommt, sagen die Bäume: “Sieh mal! Der Stiel ist einer der Unsrigen.” Dies behaupten jedenfalls laut John Berger die Waldarbeiter in der Haute-Savoie.
Wenn man dem Augenschein und den Neodarwinisten glauben schenkt, dann herrscht auch unter den Bäumen ein ständiger Konkurrenzkampf (um Nährstoffe, Licht, Bakterien, Pilze usw.). Die russisch-sowjetischen Forstexperten sahen das jedoch – symbiotisch gestimmt – ganz anders: “Es klingt paradox, aber der Wald braucht den Wald,” so sagte es einer von ihnen und fügte hinzu: “Sonst stünden viel mehr Bäume einzeln, wo sie sich doch angeblich besser entfalten könnten.” Der in den Dreißiger und Vierzigerjahren führende Agrarbiologe der UDSSR Trofim D.Lyssenko empfahl deswegen bei der Wiederaufforstung gleich die Anpflanzung von Bäumen in “Nestern”. Er begründete dies sehr revolutionsromantisch: “Erst schützen sie sich gegenseitig und dann opfern sich einige für die Gemeinschaft”. Der Forstwissenschaftler G.N. Wyssozki ging nicht ganz so weit, aber auch er unterschied zwischen vegetativem Freund und Feind: Damit z.B. die Eiche gut wachse, dürfe man sie nicht zusammen mit Eschen und Birken anpflanzen, sondern sollte sie “von Freunden umgeben” – Büsche: Weißdorn, gelbe Akazie und Geißblatt z.B.. Laut dem Wissenschaftsjournalisten M. Iljin lehrte uns bereits der Gärtner Iwan W. Mitschurin, “dass sich im Wald nur die verschiedenen Baumarten bekämpfen, aber nie die gleichen”. (Wenn das stimmt, dann ist es im tropischen Regenwald genau andersherum.) Der russische Wald wird von der Steppe bedroht. Deswegen riet Lyssenko: aus Eiche (Wald) und Weizen (Feld) Verbündete gegen sie zu machen. Seinen Vorschlag begründete er quasi partisanisch: “Wenn einer zwei andere stört, dann lassen sich diese beiden stets, mindestens für einige Zeit, gegen ihren gemeinsamen Feind verbünden.”
Aus dieser (allzumenschlichen) Wahrnehmungsnot hat der baltische Biologe Jakob von Uexküll eine Tugend gemacht: Es gibt keinen Wald als objektiv festlegbare Umwelt, sondern nur “einen Wald-für-den-Förster, einen Wald-für-den-Jäger, einen Wald-für-den-Botaniker, einen Wald-für-den-Spaziergänger, einen Wald-für-den-Holzleser” und, so dürfen wir hinzufügen: einen für Partisanen, Eulen, Eichhörnchen, Ameisen etc.. “Jede Umwelt ist eine in sich geschlossene Einheit, die sich aus der Selektion einer Reihe von Elementen oder ‘Merkmalsträgern’ aus der Umgebung konstituiert,” so faßt Giorgio Agamben die Uexküllsche Umweltlehre zusammen, die dieser u.a. am Beispiel der “Weltbilder” von Zecken und Stichlingen entwickelte, wobei er zu dem Schluß kam: “Die Heimat ist ein reines Umweltproblem”. Ein Satz, der mir immer sehr eingeleuchtet hat, wie ebenso der, dass auch Pflanzen ständig mit “Bedeutsamkeit” konfrontiert werden. Daraus folgt eine ganz andere “Zeichenlehre” als die “Codes” der angloamerikanischen Genetiker. 1929 gründete Uexküll in Hamburg ein “Institut für Umweltforschung”, heute ist der “Pionier der theoretischen Biologie” zusammen mit dem “Vitalismus” in Vergessenheit geraten. Wie dieser wandte er sich gegen den “Mechanizismus”, der bei allen Tierhandlungen und Pflanzenäußerungen bloß Ursache-Wirkungs-Schemata gelten läßt. Bei Uexküll ist jedes Lebewesen erst einmal “Subjekt”. Das eröffnet uns einen Zugang zu ihm, der sich forschend vertiefen läßt, wobei man jede “Psychologisierung” vermeiden sollte. Dies haben insbesondere die Philosophen Gilles Deleuze und Félix Guattari beherzigt, indem sie nicht mehr vom Subjekt ausgingen, sondern von (libidinösen) Strömen.
Mehr Anerkennung als Uexkülls “Umwelt”-Forschung hat in den letzten Jahren, vor allem in den USA, die frühe Symbioseforschung der russischen Botaniker des 19. Jahrhunderts gefunden, die teilweise explizit “antidarwinistisch” argumentierten: Beginnend mit Andrey S. Famintsyn, der bereits 1907 einen Aufsatz über “Die Rolle der Symbiose bei der Evolution von Organismen” veröffentlichte, wobei er sich vor allem auf Flechten bezog, die aus einer Verbindung zwischen einer Alge und einem Pilz bestehen, sowie auch auf Chloroplasten: in allen Pflanzenzellen integrierte Einzeller, die das Sonnenlicht durch Photosynthese in nutzbare chemische Energie und Nährstoffe umwandeln. Ferner Konstantin S. Mereschkowsky, der die “Organellen” (Orgänchen) in den Zellen als ehemals freilebende Organismen identifizierte, die irgendwann von einem Einzeller “einverleibt” bzw. “verstaatlicht” wurden: Bis heute teilen sie sich unabhängig von ihrer Wirtszelle selbständig. Mereschkowsky publizierte 1920 in Genua seinen Aufsatz “Die Pflanze als symbiotischer Komplex”. Schließlich Boris M. Kozo-Polyansky, der 1924 eine “Theorie der Symbiogenese” veröffentlichte, die sich wesentlich auf Bakteriensymbiosen bezog, u.a. auf ehemals frei lebende Mytochondrien, die in der Lage sind, mithilfe des Sauerstoffs der Luft aus Nährstoffmolekülen chemische Energie zu produzieren. Sie befinden sich heute in jeder unserer Körperzellen. Kozo-Polyansky interessierte sich jedoch speziell für die Orchideen und das Erika-Heidekraut. Seine Biographin Liya N. Khakhina bemerkt dazu – in “Concepts of Symbiogenesis”: “He saw an unusual physiological picture in orchids [Orchideen] in that symbiosis is a necessary condition both for the germination of the seed and for the formation of the roots and tubers and the stages of flowering. Citing M. Rayner’s work of 1915-23, Kozo-Polansky noted that even ordinary heather [Erikaheide] is essentially a symbiotic organism, formed from a flowering plant and an (ascomycotous) mycorrhizal fungus.”
Über “Mykorrhiza Netze” im Boden, die für die Pflanzen wesentlich sind, referierte im Frühjahr der Basler Biologe Andres Wiemken auf einem Kongreß der Zukunftsstiftung Landwirtschaft “Die Farbe der Forschung”.
Wenn sich heutige Biologen/Ökologen unter und zwischen den Bäumen umtun, dann konstatieren die meisten erst einmal: Dem Wald geht es schlecht! In Südamerika, in Sibirien, auf Sumatra – und in Mitteleuropa sowieso. Die Fichten leiden unter Industrieabgasen, Überdüngung der Felder und unter ihren dumpf profitorientierten Monokulturen. Die Ulmen leiden an tödlichen Pilzen, die Kastanien an der Miniermotte. Die Abwehrkräfte dieser Bäume scheinen langsam zu erlahmen. Schon vermelden englische Baumforscher: Auch die Wurzelballen der Eichen werden immer kleiner. Geben die Bäume, die es einst uns Landtieren überhaupt erst ermöglichten, das Wasser zu verlassen, nun unsretwegen auf? Das käme Nietzsches Gedanken nahe: “Genug, überall da, wo wir Ursache und Wirkung sehen, müssen wir anerkennen, das Wille auf Willen stößt”. Demnach hätten wir das “Willensfeld” der Bäume bereits derart zerstört und zerhackt, dass sie drauf und dran sind, resigniert aufzugeben.
Dabei gab es mal Zeiten, wo sie umgekehrt uns beeinflußt haben. Goethe war sich noch “gewiß! Wer sein Lebenslang von hohen ernsten Eichen umgeben wäre, müßte ein anderer Mensch werden, als wer täglich unter luftigen Birken sich erginge.” Um eine solche oder ähnliche “Kommunikation” zwischen Pflanze und Mensch ging es vor einiger Zeit einer Dame aus der spirituellen englischen Landgemeinschaft Findhorn in ihrem Vortrag im Berliner Botanischen Garten. Sie hatte zwei Ahornblätter von daheim mitgebracht, wovon sie das eine immer wieder gebeten hatte, nicht zu verwelken – und siehe da: Es war im Gegensatz zum anderen grün geblieben. Ihr kommunikatives Bemühen hatte quasi Früchte getragen. Ähnliches berichtet auch die Moskauer Kafkaübersetzerin Jewgenia Kazewa in Ihrer “Lebensgeschichte”: “Meine Kastanie…Ich wohne im dritten Stock, und die Kastanie ist so hoch und breit, dass sie die beiden Balkonfenstertüren von Wohnzimmer und Küche ausfüllt; wenn auch jetzt nur noch mit einer Hälfte, die andere Hälfte ist dem schrecklichen Orkan zum Opfer gefallen, der im Sommer 1998 in Moskau wütete. Er war kurz, aber sehr zornig. Die Kastanie wurde entzweit, die eine Hälfte, die vor der Küche, ist sofort umgefallen, die andere, vor dem Zimmer, hat sich ohnmächtig ans Balkongeländer gelehnt. Ich habe mit ihr geredet, ihr immer wieder gut zugesprochen und sie flehentlich gebeten, sich aufzurichten, sie gestreichelt und ihre schlaff werdenden Blätter geküßt. Bedeutet sie doch soviel für mich: Wenn ich am Schreibtisch sitze, der vor dem Fensterbrett steht und sich bei Festen zum Eßtisch verwandelt, hebe ich ab und zu die Augen, hefte den Blick auf sie oder starre sie einfach an, bis mir etwas einfällt. Man mag es glauben oder nicht, aber allmählich und ganz langsam begann sie sich vom Geländer zu lösen, richtete sich auf, bis sie wieder ganz gerade stand. Und die Krone rundete sich. als wäre der ‘Schädel’ nie gespalten worden.”
Wenn das Sprechen mit dem Baum ins Mystische lappt, ebenso wie umgekehrt das, “Was die Bäume sagen” (wie ein vielverkauftes Buch einer US-Landkommune in den Siebzigerjahren hieß), dann berührt das Sprechen über den Wald oft das Mythische. Für viele Kulturen gehört der Wald sogar zu ihrem Ursprungsmythos – erhoffte man sich durch den Rückzug in den Wald eine Art Wiederauferstehung. Simon Shama hat in seiner Studie über “Den Traum von der Wildnis” einige dieser Heiligen Haine durchforstet:
In Polen den Urwald von Bialowieza (Podlasien), der Rumpfheimat des Wisent, aber auch aller echten Männer, sowie der polnischen Outlaws und Partisanen. Ferner Jagdgebiet der Könige, dann das Revier von Hermann Göring – und Ausgangspunkt der polnischen Forstwirtschaft bzw. -wissenschaft, die wiederum oft Beziehungen zu den Partisanen in ihren Wäldern unterhielt. So gehörte z.B. zu den Partisanen, die sich nach der Niederschlagung des Warschauer Aufstands Ende 1830 und der Auflösung Polens in die Wälder von Podlasien – der puszcza – zurückzogen, auch Emilie Plater, “eine Soldatin, aus deren Familie zu Beginn des Jahrhunderts mehrere Forstbeamte gekommen waren.” 100 Jahre später erklärte die Pilsudski-Regierung den Urwald zum polnischen “Nationalpark”. Im Wald finden die ersten Gefechte zwischen Nationalökonomie und -ökologie statt! Die Deutschen erklärten zehn Jahre später sogar das Abschießen eines Adlers zu einem todeswürdigen Staatsverbrechen. Mit dem Einmarsch der Deutschen in Polen flüchteten viele Juden als Partisanen in die Wälder – sie kamen “in eine neue Welt”, schreibt Simon Shama, “…die Veteranen, die sich als ‘Wölfe’ bezeichneten, brachen in der Nacht auf zu Beutezügen in die Walddörfer…Von allen Generationen der ‘Puszcza’-Kämpfer waren sie die verzweifeltste”. Nach 1945 versteckten sich auch etliche Deutsche in den Wäldern, wo sie sich zu antikommunistischen Partisanengruppen zusammenfanden. Erst in den Fünfzigerjahren gelang der Roten Armee die Liquiderung der letzten “Waldmenschen”, wie die Illegalen in Litauen hießen, die jungen nannte man “Wolfskinder”.
Etwa zur selben Zeit bezeichnete der Schwarzwald-Philosoph Heidegger die Widerstände gegen die (amerikanische) Nachkriegs-Moderne als “Holzwege”. Der Holzweg ist jener Weg, der unvermutet im Forst abbricht. Als Martin Heidegger und Carl Friedrich von Weizsäcker einmal auf einem Spaziergang durch den Stübenwasener Wald waren, stellten sie überrascht fest, dass sie sich auf einem Holzweg befanden. Noch mehr aber liess sie erstaunen, dass sie an der Stelle, wo der Weg endete, auf Wasser gestossen waren. Heidegger soll da frohlockt haben: “Ja, es ist der Holzweg – er führt zu den Quellen!”
Von den Franzosen stammt dagegen die Erfindung des “Wanderwegs” (im Wald von Fontainbleau), der eine ganze Malschule begründete. Die Mythifizierung des deutschen Waldes begann mit dem römischen Ethnologen Tacitus, der die Germanen in seinem Bericht “Germania” als edle Wilde pries. Als Urheld des Widerstands gegen die korrumpierende (römische) Moderne gilt seitdem Hermann der Cherusker, der im Jahre 9 n. Chr. eine ganze römische Armee unweit des Teutoburger Waldes niedermetzelte. Als es Anfang des 19. Jahrhunderts darum geht, die französische Moderne aus Deutschland zu vertreiben, d.h. den Guerillakampf gegen die napoleonischen Truppen aufzunehmen, veröffentlichte Heinrich von Kleist “Die Hermannschlacht” – als eine Anleitung zum Volksaufstand. Für den Germanisten Wolf Kittler ist sein Drama “Die Geburt des Partisanen aus dem Geist der Poesie”. Für den damaligen Chefstrategen der Befreiungskriege, Freiherr vom Stein, markierte dagegen die Insurrektion des Freikorps von Major Schill den Anfang. Immer wieder riet er ihm, statt sich altmodisch in Festungen zu verschanzen, in die norddeutschen Moore zurück zu ziehen, um von dort aus wie die Wölfe über den Gegner her zu fallen. An der Ems hatten seinerzeit schon Hermanns Partisanen die feindliche Übermacht zermürbt: “Tagelang zappelten die römischen Truppen in den Sümpfen und versuchten sich gegen Überraschungsangriffe der cheruskischen Kämpfer zu wehren”, schreibt Simon Shama, für den “sich die klassische Zivilisation immer im Gegensatz zu den Urwäldern definiert hat”.
Die Nationalsozialisten, die diesen Prozeß umdrehten, haben sich dann auch mehrere Waldabenteuer geleistet: 1. ließen sie im Herbst 1943 ein SS-Fallschirmspringerkommando bei einer Villa im norditalienischen Fontedamo abspringen, um dort das taciteische Urmanuskript zu rauben, nachdem Mussolini diese famose germanische Gründungsurkunde bereits dem Führer als Geschenk versprochen hatte – jedoch nicht mehr selbst dazu gekommen war, sie ihm auch zu übergeben. Das Manuskript – Codex Aesinas – hatten die Italiener jedoch rechtzeitig in einem Vorratskeller der Villa versteckt, so dass die Deutschen unverrichteter Dinge wieder abziehen mußten. 2. zogen die Nazis alle wegen Wilderei inhaftierten Deutschen im KZ Oranienburg zusammen und formierten daraus die erste Partisanenbekämpfungseinheit – unter dem Kommando des Kommunistenschlächters Dr.Dirlewanger. Sie wurde später immer wieder mit antikommunistischen ukrainischen Waldpartisanen aufgefüllt, die nach dem Krieg von den Amerikanern übernommen wurden – um dann in Kennedys “Green Berets” gegen die im vietnamesischen Dschungel kämpfenden Vietkong eingesetzt zu werden. 3. wurde in den letzten Kriegsmonaten noch ein Partisanenheer aus Teilen der Hitlerjugend zusammengestellt: die Werwölfe. Sie sollten sich in den Wäldern verstecken und von dort aus Angriffe auf die Alliierten unternehmen. Die Rote Armee und die Amerikaner nahmen diese mehr in der Nazipropaganda als real existierenden Gruppen sehr ernst: Erstere ließen unbarmherzig alle des Werwolftums Verdächtigen erschießen und letztere änderten sogar ihren Vormarsch, indem sie von Westen kommend auf Berlin zustoßend nach Bayern abschwenkten, wo sie in den Voralpen die hauptsächlichen Werwolf-Sammelgebiete vermuteten.
.

Siegfried im Nibelungen-Wald
.
Die Seenation England, wo man beim Bau eines einzigen Schlachtschiffes mit 74 Kanonen über 2000 Eichen verarbeitete, versuchte mit Eichen-Pflanzaktionen ihrer Landbesitzer unabhängig von Fremdwald zu bleiben, zudem war ihre wahre Freiheit im alten Sheerwood Forest beheimatet, wo man zu Zeiten von König Jakob I. noch 23.370 Eichen gezählt hatte – und wohin sich in der Zeit der Rosenkriege die letzten Königstreuen zurückgezogen hatten: Laut Simon Shama entstand diese Robin-Hood-Legende “in der Oberschicht und endete in der Unterschicht” – nachdem die englischen Romantiker den Wald und seinen Helden – den ehemaligen Holzdieb Robin Hood – “als Anwalt der Armen” entdeckt hatten. In Amerika diente die Wildnis dann als immerwährende Regenerationsmöglichkeit für die Zivilisation, als moralische Anstalt gar für Zivilisationsmüde – und -kritiker (von Henry David Thoreau über Ken Kesey bis zum Una-Bomber Kaczinski).
Überblickt man die verschiedenen Wald-Kulturen, dann flüchteten sich dort stets die (illegalen) Wölfe rein – und heraus kamen (legale) Hunde oder umgekehrt! Und diese Verwandlung wird gerade wieder ideologisch-metaphorisch forciert, obwohl oder weil von einem “richtigen Wald” zumindestens in Europa so gut wie nirgendwo mehr die Rede sein kann – und einige polnische Biologen deswegen wenigstens Waldstreifen zur Erleichterung der Wolfswanderungs-Bewegung von Ost nach West anlegen wollen. Selbst “um den tropischen Regenwald steht es sehr schlimm,” schreibt der Münchner Ökologe Josef H. Reichholf. Dieser Urwald “erhält sich selbst. Er hat sich über Jahrmillionen entwickelt und sich dabei ein Eigenklima geschaffen, das seine weitere Existenz garantieren würde, wenn ihn der Mensch nicht zerstückelt, in unzusammenhängende Teilflächen zerlegt und als Einheit zerstört. Kein Großlebensraum der Erde dürfte so schwierig zu behandeln sein und so empfindlich auf Eingriffe vom Menschen reagieren wie der tropische Regenwald.”
Ähnlich sehen das auch einige lateinamerikanische Guerillas. Der Sandinista Omar Cabezas veröffentlichte seine Erinnerungen unter dem Titel “Der Wald ist etwas mehr als eine große grüne Hölle”. Nämlich auch Rückzugsgebiet der Partisanen, Ort ihrer Klärung, Zweifel und Einsamkeit. Gleichzeitig bietet er ihnen aber auch Nahrung und gibt ihnen die Möglichkeit, die komplizierten Lebensverhältnisse und -stile im Wald zu verstehen. Die immer noch kämpfenden Zapatistas, die man heute Neozapatistas nennt, senden ihre “Erklärungen” stets aus dem “Selva Lacandona” ab, aus dem lakandonischen Urwald – als “Geheimes Revolutionäres Indigenes Komitee”. Ihre 6.Erklärung 2005 – die bisher letzte – begann mit den Worten: “Dies ist unser einfaches Wort, das danach sucht; die Herzen der Menschen zu berühren, die, wie wir, bescheiden und einfach sind, aber auch, wie wir, würdig und rebellisch. Dies ist unser einfaches Wort, um darüber zu berichten, was unser Schritt gewesen ist und wo wir uns nun befinden, um zu erklären, wie wir die Welt und unser Land sehen, um zu sagen, was wir zu tun beabsichtigen und wie wir es zu tun beabsichtigen, und um andere Menschen dazu einzuladen, mit uns gemeinsam in etwas sehr Großem zu gehen, das sich Mexiko nennt, und etwas noch viel Größerem, das sich Welt nennt.”
Die mexikanische Regierung bekämpft nicht nur die Dorfbewohner als Basis der Zapatistas militärisch, sie hat den dort lebenden Menschen auch verboten, z.B. ihr Feuerholz im Wald zu schlagen, gleichzeitig erhalten Konzerne jedoch Abholzgenehmigungen und es werden große Siedlungsflächen gerodet: Nicht nur chiapanekische Indigenas, sondern auch Gemeinschaften aus anderen südlichen und zentralen Bundesstaaten, die z.B. in Guerrero, Veracruz oder Michoacan eine Landzuteilung forderten, wurden in die Selva Lacandona geschickt – wo sie nun ein kleines Stück Land bewirtschaften. Darüberhinaus will die mexikanische Regierung generell den Boden privatisieren und das Prinzip des kollektiven Eigentums abschaffen – was den kleinen indigenen Völkern weltweit droht.
Unser Bild vom tropischen Regenwald als grüne Hölle speist sich primär aus Rudyard Kiplings und Walt Disney’s “Dschungelbuch”. Josef H. Reichholf veröffentlichte 1990 ein neues Buch über den “Dschungel”. Die ÖTV-Gewerkschaftsgruppe bei der BVG sortierte gerade ihr Exemplar aus der Präsenzbibliothek aus, woraufhin ich es im Antiquariat erwarb. Wie schon in bezug auf das “ökologische Denken” und die Land-Stadt-FFH (Flora-Fauna-Habitate) stellt der Autor auch hier wieder unser bisheriges “Bild” auf den Kopf: Der südamerikanische Urwald ist keine “Grüne Hölle”, in der alles wild durcheinander wächst und wuchert – im Überfluß lebt, sondern ganz im Gegenteil: eine extreme Zone des Mangels. Die Bäume, nicht der Boden sammeln hier die Nährstoffe, auf dem die übrigen Pflanzen wachsen, von und auf denen wiederum die meisten Tiere leben. Aus Mangel an Mineralstoffen, um Eiweiß zu bilden, das für die Fortpflanzung notwendig ist, sind die Vermehrungsraten im tropischen Regenwald sehr niedrig und die Nachkommensaufzucht aufwendig. Das gilt auch für alle anderen von den Bäumen abhängigen Pflanzen und Tiere, von denen viele bis hin zu Fröschen – in den Baumkronen angesiedelt sind. Sie mußten den “Epiphyten” nach oben folgen. Bei diesen “Überpflanzen” oder “Aufsitzern” handelt es sich vor allem um Bromelien und Orchideen. Letztere sind hinsichtlich ihres Blütenbaus die “fortschrittlichsten unter den Blütenpflanzen:” Sie haben die Fehler bei der Pollenübertragung “bis zu fast vollständiger Treffsicherheit verringert”. Nicht zuletzt dadurch, dass sie sich z.B. einer ganz bestimmten Wespenart anverwandelten – so dass sie wie eine solche aussehen, wobei jedoch umgekehrt für die betreffende Wespenart das selbe in bezug auf die Orchideen gilt. Die französischen Marxisten Gilles Deleuze und Félix Guattari haben daraus in den Siebzigerjahren ein ganzes involutives Beziehungsmodell (“Macht Rhizom!”) kreiert.
Alle Dschungel-Flora und -Fauna ist laut Reichholf undenkbar ohne den Pilz. “Basis des Baumlebens” ist speziell der Wurzelpilz, der sich entweder an den Enden der Baumwurzeln ansiedelt oder sogar in ihnen. Diese “innere oder äußere Mykorrhiza” bildet die Grund-Symbiose. Dabei übernehmen die Pilzfäden “in großem Umfang die Aufnahme von Wasser und mineralischen Nährstoffen. Sie leiten diese an die Baumwurzeln weiter, von denen sie im Gegenzug vor allem Zucker und Vitamine bekommen…Die Pilzfäden sind viel feiner als die Haarwurzeln der Bäume und kommen deswegen noch an geringste Nährsalzkonzentrationen heran”. Der Autor spricht hierbei von einer “Kooperation”. Als gemäßigter Darwinist stellt er zur Erklärung gerne Kosten-Nutzen-Rechnungen an, auch sein diesbezügliches Vokabular wird dann betriebs- bzw. volkswirtschaftlich.
Ähnliches wie für die Bäume gilt auch für die Epiphyten auf ihren Ästen: “Oben in den Baumkronen brauchen die Orchideen die Keimhilfe von Pilzen”. Auf dem Urwaldboden sorgen wieder andere Pilze für eine schnelle Rückverwertung der abgefallenen Blätter und abgestorbenen Baumteile, wobei ihnen die Baumwurzeln buchstäblich entgegenkommen: Sie wachsen im Dschungel aus der Erde nach oben – “der eigentlich schon ziemlich ausgelaugten Nährstoffquelle ‘totes Blatt’ entgegen.” Zusammen sorgen sie dann dafür, dass das Blatt schließlich in seine letzten Reste zerfällt “und keinen Humus hinterläßt.”
Während hier auf einen Hektar bis zu 500 Baumarten vorkommen, sind es in den “geradezu monotonen Wäldern” z.B. Europas höchstens 100 – oft nur ein knappes Dutzend. In den tropischen Regenwäldern wachsen die Bäume um so besser, “je weniger Artgenossen in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft” wurzeln. Dies ist nicht dem Überfluß, sondern dem Mangel geschuldet – für Reichholf der “Kern der Regenwaldproblematik”. Die dominierenden Tiere sind hier die Blattschneiderameisen und die Termiten – und beide ernähren sich von Pilzen, die sie in ihren Bauten züchten. Also: “Soziale Insekten” unten (tagsüber Ameisen, nachts Termiten) und “soziale Pflanzen” oben (Orchidee-Pilz-Wespe-Symbiosen). Dazwischen ist die immer feuchtwarme Urwaldluft erfüllt von winzigen Pilzsporen: Schon nach kurzer Zeit ist jeder Gegenstand mit einem Schimmelfilm überzogen. Selbst das Faultier setzt an seinem Fell Pilze und Algen an, von denen sich wiederum die Larven einer kleinen Schmetterlingsart ernähren. Die Faultiere leben meist auf “Ameisenbäumen”, das sind Bäume der Gattung Cecropia, deren hohle Stämme Ameisen beherbergen. Der Baum scheidet “extraflorale Nektarien” (für sie) aus, sie wiederum halten ihm Insekten und andere Feinde vom Leib – noch eine Symbiose. Gleichzeitig schützen die Ameisen auch die gerade wegen ihnen sich so langsam fortbewegenden Faultiere vor deren Feinden. Weitere Exo- und Endoymbiosen finden sich oben in den das Regenwasser auffangenden Trichtern und Blattachseln von Bromelien, die die Flüssigkeit zusammen mit Staubpartikeln und ertrunkenen Kleininsekten durch Bakterien aufarbeiten lassen: “umgekehrte Hydrokulturen.” Unten im Boden nehmen u.a. Käferlarven die Hilfe von Mikroben an, um den wenigen “Mulm” – organische Abfallstoffe – dort zu verdauen. Gerade über die Rolle der Arthropoden (Gliederfüßer) im Ökosystem der tropischen Regenwälder wird derzeit viel geforscht.
Für den tropischen Regenwald insgesamt gilt zum einen: “Der hochgradig geschlossene Nährstoffkreislauf begründet sich auf den Artenreichtum” – zum anderen: “Die Nutzer tropischer Fruchtbäume müssen weit umherschweifen,” das gilt für die meisten Tiere sowie für die Menschen – die Waldindios, die oft nur in kleinen Gruppen leben. In einigen ihrer Kulturen spielen nicht zufällig “Magic Mushrooms” (psilozybinhaltige Rauschpilze) eine wichtige Rolle.
“Und ähnelt ein schöner, giftiger Gedanke nicht einem Fliegenpilz in allem, sogar noch in der Wirkung zwischen Rausch und Brechreiz?” fragt sich die Pilzforscherin Gabi Schaffner. An anderer Stelle ihres Buches “Phänomene der inneren Topografie” schreibt sie: “Ein ungenießbarer Pilz ist wie ein falscher Gedanke am richtigen Ort.” Ferner hat sie “eine Analogie zwischen den Gesetzen und Eigenschaften der Pilzwelt und der Struktur eines ‘untergründigen Denkens'” festgestellt. “Der Pilz ist etwas Unvorhersehbares, etwas Verrücktes.” Und dann ist der Pilz auch nicht der Pilz, sondern nur sein Fruchtkörper: “Das Mycel ist der eigentliche Pilz – unterirdisch, feine Fäden über Kilometer unter dem Boden unsichtbar zu einem wirren Netz gesponnen. Und wenn man bedenkt, wie viele Sporen ein Pilz verstreut, ist das Mycel eine ins Unendliche reichende Exponentialfunktion.” Gabi Schaffner ist vornehmlich in Nord- und Osteuropa unterwegs, wobei sie sich u.a. von den “Betrachtungen eines Pilzjägers” (Wladimir Solouchin) leiten läßt.
Im tropischen Regenwald muß man sich aber gleichzeitig auch gegen die Pilze wehren – “bevor alles verpilzt”. Bei der Körperpflege der Waldindios kommt deswegen “dem Schutz vor Verpilzung eine herausragende Bedeutung zu”, meint Josef Reichholf. Wenn sie nicht umherziehende Jäger und Sammler sind, betreiben die Waldindios einen bescheidenen “Wanderfeldbau”, d.h. Brandrodung von kleinen Flächen, deren Erträge schon nach drei vier Ernten nicht mehr den Aufwand der Feldbestellung lohnen. Reichholf erwähnt Henry Fords riesige Großplantage mit Gummibäumen “Fordlandia” genannt, die wegen der nährstoffarmen Böden wieder aufgegeben werden mußte: Auch die Gummibäume brauchen viel Platz zwischen sich. Etwas anders ist es bei den Tieren: Ameisen, Bienen, Wespen und Termiten bezeichnet Reichholf “als bewegliche Sammler feinstverteilter Nährstoffe”. Die Treiberameisen schleppen auf ihren Streizügen sogar ihr ganzes Nest einschließlich der Königin mit. Ihnen schließen sich die Ameisenvögel an, die von den durch die Ameisenkolonnen aufgescheuchten Kleintiere und Insekten profitieren.
Zwar ist an Wasser kein Mangel im tropischen Wald, aber die Flüsse sind teilweise reiner als Regenwasser, Kleinlebewesen wie Moskitolarven finden darin nicht genug Nahrung. Und seitdem man den Kaiman durch die Jagd enorm reduziert hat, finden nicht einmal mehr die Jungfische in den Lagunen genug Kleinlebewesen, da diese vom Kot der Reptilien lebten. Es gibt Arten, die sich von tierischer auf pflanzliche Nahrung umstellen können, dazu gehören auch die Leguane, bei denen sich nur noch die Jungen von Insekten ernähren (müssen). In der Zucht gelang es sogar, junge fleischfressende Piranhas zu pflanzenfressenden “umzuerziehen” – sie ernährten sich zunächst übergangsweise vom Kot der pflanzenfressenden Piranhas – und nahmen dabei die für die Verdauung von Pflanzenteilen notwendigen Darmbakterien auf. Viele Fische ernähren sich in Amazonien von vorneherein von Baumfrüchten, die in den überschwemmten Wäldern ins Wasser fallen: Nicht wenige haben dafür inzwischen “ein schräg nach oben gerichtetes Maul”. Dazu hat Michael Goulding in seinem Buch “Die Fische und der Wald” quasi aus der Sicht der Fische Erhellendes beigesteuert. Umgekehrt gibt es z.B. Tausendfüßler, die Überflutungsresistent geworden sind. Mit solchen “Überlebensstrategien” von Arthropoden im Regenwald beschäftigt sich der Kieler Limnologe Joachim Adis. Die hochspezialisierte und -assoziierte Urwald-Flora und Fauna besetzt dennoch immer nur Nischen: “Nicht einmal auf einem einzelnen Baum herrschen gleiche Verhältnisse”. Das und die mangels eiweißbildender Nährstoffe geringe Fortpflanzungsrate hat laut Reichholf zur Folge, dass die Arten sich keine großen Verluste z.B. durch Freßfeinde, leisten dürfen.
Deswegen entwickelten sie wie nirgendwo sonst auf der Welt eine große Vorliebe für Mimikry bzw. Mimese: Gleich mehrere ungiftige Schlangenarten ähnelten sich z.B. einer giftigen an, Raupen, Falter und Käfer entwickelten große Augen oder ganze falsche Köpfe (von Schlangen) am Hinterleib, Heuschrecken nahmen Form und Farbe von Blättern und Zweigen an, wohlschmeckende Schmetterlinge imitierten das Aussehen von abscheulich bitteren, usw.. Daneben wird im tropischen Urwald gerne mit Giften gearbeitet: winzige schreiend-bunte Baumfrösche z.B. sind hochgiftig – die Waldindios nutzen sie zur Pfeilgiftherstellung. Tausendfüßler sondern Blausäure ab, ebenso wie das wichtige Nahrungsmittel Maniok, den man vor dem Verzehr erst einmal umständlich entgiften muß. Überhaupt schützen sich viele Pflanzen mit Gift, u.a. Lianen, die die Waldindios beim Fischfang zum Betäuben ihrer Beute verwenden. Viele Arthropoden verstehen es, Pflanzengifte zu ihrem eigenen Schutz gewissermaßen umzunutzen. Einige Libellenarten haben durchsichtige Flügel mit farbigen Augenmustern drauf. Im Halbdunkel des Dschungels sieht man nur diese Augen: “Überhaupt die Augen” – als Tarnung und Drohung! Die südamerikanischen Grubenottern und Riesenschlangen haben umgekehrt ein drittes, echtes “Auge” ausgebildet, zwischen Augen und Mund – mit denen sie (wie mit einem Nachtsichtgerät) Infrarotstrahlen, also Wärmebilder, sehen können. Und dann gibt es neben der Mimikry und Mimese von Arten, die sich auf Orte und andere Arten beziehen, anscheinend auch noch welche von Orten, die sich auf dort lebende Arten erstreckt: “So traf ich im südlichen Brasilien eine ganze zirkumskripte Waldstelle, bei der mir sofort die lebhafte Blaufärbung aller hier vorhandenen Tiere auffiel. Von zwanzig Schmetterlingen, welche an mir vorüberflogen, waren wenigstens zehn ganz blau und die übrigen zum Teil,…- diese Übereinstimmung der Farben erstreckte sich aber nicht allein auf die Schmetterlinge, sondern auch Käfer, Hemiteren, Dipteren zeigten alle mehr oder weniger blauen Schimmer. Das merkwürdigste bei dieser Erscheinung war ihre enge Begrenzung. Nur wenige Meilen nach Norden von dieser Örtlichkeit hatte die Vorliebe für Blau nicht nur aufgehört, sondern es erschien die rote Farbe in ähnlicher Weise dominierend, wenn auch nicht in so auffälligem Grade.” (Von Hanstein, “Biologie der Tiere”) Unter den blauen Tieren ist der Auffälligste der große “Morpho-Falter”. Er produziert statt eines blauen echten Farbstoffs, anders als viele andere Tiere und Pflanzen, eine so genannte Strukturfarbe, die durch Lichtbrechung auf seinen Flügeln erzeugt wird. Damit sieht man ihn im Flug auf der Flucht immer nur kurz aufblitzen. Wenn er aber einigermaßen ruhig z.B. durch die Straßen von Rio flattert, bleiben die Passanten angesichts dieses “blauen Wunders” andachtsvoll stehen.
Noch immer werden tausende von Hektar tropischer Regenwald täglich gerodet oder sonstwie zerstört (50% sind es bereits). Aber auch die Basispolitik – die regionalen Selbstverwaltungsversuche vor Ort – der Zapatistas im Lacandonischen Urwald von Chiapas ist anscheinend erst einmal ins Stocken geraten. In ihrer letzten “Erklärung aus den Bergen/Wäldern des mexikanischen Südostens” heißt es am Schluß: “Nach unserem Ermessen und dem, was wir in unserem Herzen sehen, sind wir an einem Punkt angekommen, an dem wir nicht weiterkommen können, und an dem wir außerdem alles verlieren könnten, was wir haben, wenn wir so bleiben, wie wir sind und nichts mehr tun, um weiter fortzuschreiten. Das heißt, dass der Moment gekommen ist, wieder alles zu riskieren und einen gefährlichen Schritt zu wagen, der es aber wert ist. Denn vielleicht können wir vereint mit anderen sozialen Sektoren, die unter den gleichen Entbehrungen wie wir leiden, das erreichen, was wir brauchen und was wir wert sind. Ein neuer Schritt nach vorn im indigenen Kampf ist nur möglich, wenn sich der Indígena zusammenschließt mit den Arbeitern, Bauern, Studenten, Lehrern, Angestellten … also mit den Arbeitern aus Stadt und Land” (- mithin also durch noch umfangreichere Symbiosen). Kurz danach schlossen die Zapatistas alle legalen Stützpunkte und zogen sich in den Untergrund zurück. Von dort aus wollen sie jedoch (vorerst) nicht wieder zu den Waffen greifen, sondern eher in sich gehen – und ihre Organisation, die EZLN, eventuell für “oppositionelle Organisationen” nicht-indigener Bevölkerungsgruppen öffnen. Die “Le Monde Diplomatique” spricht von einem angestrebten “Schulterschluß der Linken”. Man fragt sich, ob sie damit aus einer “Minderheit”, die sie sind und die laut Deleuze/Guattari allein produktiv sein kann, eine “Mehrheit” machen wollen? Und ob dies auf das “alte europäische Baumdenken” hinausläuft – dem Deleuze/Guattari ein rhizomatisches bzw. myzelisches Denken gegenüber stellten.
.

.

Tropischer Regenwald
.
Ein neuer baumloser Todesstreifen für Berlin?
Der Seidenschwanz tauchte zuletzt 2004 in größeren Schwärmen in Deutschland auf. Damals waren die Medien mit anderen Themen beschäftigt, so dass sie im Gegensatz zu 2001, als die Boulevardpresse von der “Invasion der Pestvögel” sprach, einzig von begeisterten Vogelbeobachtern bemerkt worden waren. Im Mittelalter, das von zwischeneiszeitlicher Kälte, Seuchen und Krieg geprägt war, galt der Vogel mit dem seidigen altrosa Gefieder und dem knallroten “Nagellack” an den Flügelspitzen als Vorbote großen Unheils. Es hängt ihm bis heute etwas Unheimliches an. In einem durchschnittlichen Turnus von sieben Jahren kommt er in größeren Schwärmen ab Dezember aus den nördlichen Ländern Asiens und Amerika, ernährt sich von den giftigen Beeren der Misteln, um dann aus bis heute nicht geklärten Gründen wieder für unbestimmte Zeit zu verschwinden. Seine Invasionsjahre weisen eine Überlagerung mit den El-Nino-Zyklen auf, die das weltweite Klima beeinflussen. Außerdem sind die Schwärme in kalten Perioden deutlich größer. Ob das mit einer Nahrungsknappheit in ihren Herkunftsländern im Norden zu tun hat, ist noch immer unklar. In früheren Jahrhunderten, als die Menschen noch so gut wie vollständig von den Erträgen der eigenen Landwirtschaft abhängig waren, bedeuteten solche Klimaschwankungen die biblischen “sieben fetten und sieben mageren Jahre”. Zudem entzogen sich die Vögel einer normalen Einordnung in der spätmittelalterlichen Welt. Nicht verwunderlich also, dass sie schlechte Zeiten anzukündigen schienen.
Nun haben Berliner Biologen ein vermehrtes Auftreten der Weißbeerigen Misteln (Viscum Album) in den Laubbäumen der Stadt ausgemacht. Sie sprechen von 20 000 bis 40 000 befallenen Robinien, Pappeln, Ahornen, Linden und Birken. Besonders stark betroffen seien Steglitz-Zehlendorf und Spandau, wo es nach zahlreichen Internet-Protokollen engagierter Hobby-Ornithologen 2001, 2004 und im vergangenen Winter zu einem vermehrten Auftreten des Seidenschwanzes gekommen war. Die Wissenschaftler – darunter Mitarbeiter des Instituts für Gartenbauwissenschaften der Humboldt-Universität und der Freien Universität – sind sich darin einig, dass die Mistel als “Schmarotzer” ihrem Wirt einen langsamen Tod beschert: “Erst sterben Teile der Kronen, dann brechen sie ab. Nach 15 Jahren sterben die Bäume.” Nun schlagen sie Alarm: “Wir gehen davon aus, dass Berlin und Umgebung der größte Mistelherd Deutschlands ist”, so der Biologe Hans-Jürgen Daunicht. In einem Brief an den Senat und die Bezirke kritisierten die Wissenschaftler das Desinteresse der Behörden: “Wir erwarten, ein Programm zum Schutz der Bäume.”
Die hier gemeinte Mistel, welche eigentlich kein Schädling, sondern auch nach Wissen des Berliner Pflanzenschutzamtes lediglich ein Halbschmarotzer ist, vermehrt sich über den Kot der hochspezialisierten Seidenschwänze. Diese verfügen über einen besonders kurzen Darm, der die giftigen Früchte nur teilweise verdaut und dann als klebrigen Schleim wieder ausscheidet. Fällt so ein Samenschleim auf einen geeigneten Ast, schlägt er dort Wurzeln. Da die Vögel erst nach etwa sieben Jahren zurückkehren, um zu ernten, was sie zuvor gesät haben, unterscheiden sich die kugeligen Büschel an den Bäumen in ihrer Größe deutlich voneinander. Damit den Berliner Laubbäumen kein Zacken aus der Krone fällt, schlägt Daunicht vor, eine etwa einen Kilometer breite laubbaumlose Schneise durch Berlin zu schlagen – wo nebenbei jedes Jahr etwa 1500 Bäume gefällt, jedoch nur 1300 nachgepflanzt werden. Also Bäume zu töten, um Bäume zu retten. Eine Art Todesstreifen. Sein historisches Vorbild war allerdings nur 500 Meter breit. Nun können Vögel im Allgemeinen locker einen Kilometer weit fliegen. Um zu verhindern dass sie zur Notdurft “rüber machen”, müsste man die Schneise wohl zusätzlich mit Selbstschussanlagen sichern. Die Mistel, die schon bei den Kelten als Heilpflanze verehrt wurde, gehört zu den gefährdeten Arten. Da sie sehr langsam wächst – Eine Mistel von 50 Zentimetern Durchmesser hat bereits ein Alter von 30 Jahren – und da sich der kommerzielle Anbau nicht lohnt, werden sie gerade in der Weihnachtszeit von den Bäumen gepflückt um als Dekoration an Hauseingängen und Zimmerdecken zu vertrocknen. Zudem verschwinden immer mehr Auenwälder in Deutschland, die das bevorzugte Verbreitungsgebiet der Pflanze sind.
Der Naturschutzverband “BUND” riet deshalb im September 2007, zum Schutz der Pflanze auf diesen Weihnachtsbrauch zu verzichten und keine Mistelzweige aufzuhängen. Einige Bundesländer haben bereits darauf reagiert und die Mistel unter Naturschutz gestellt. Weil die Pflanze bisher aber nicht international geschützt ist, werden die Mistelzweige vor allem aus Billiglohnländern eingeführt. Ein europaweiter Rückgang ist die Folge. Dass sie nun ausgerechnet in Berlin ideale Lebensbedingungen vorfinden, während sie außerhalb der Städte vom Aussterben bedroht scheinen, liegt im allgemeinen Trend zunehmender Artenvielfalt in urbanen Regionen, während der Anpassungsdruck in den von Monokultur bestimmten ländlichen Gebieten wächst. Schlechte Zeiten sind für die Medien warme Sommer, so wie er dieses Jahr erwartet wird. Die Berliner Wissenschaftler haben nun einen schönen Vorschlag gemacht mit welcher Überfremdungstheorie wir uns in diesem Jahr um Kopf und Kragen reden könnten. Interviews mit unausgelasteten Wissenschaftlern machen und über massenhaft ABMler berichten, die auf die Strassen der Stadt geschickt wurden: Bäume fällen und Seidenschwänze erschießen!
.

.
Bäume fällen
„Man fällt eine Diktatur nicht wie einen Baobab-Baum.“ („Kongo – Eine Geschichte“ von David van Reybrouk)
Karl Marx schrieb in der Rheinischen Zeitung 1842 mehrmals über die Landtagsdebatten zum “Holzdiebstahlgesetz”. Er erwähnte darin u.a. einen Stadtdeputierten: “In den Waldungen seiner Gegend seien häufig junge Bäume zuerst bloß angehauen und, wenn sie dadurch verdorben, später als Raffholz behandelt worden.”
Zudem zitierte er einen Vorschlag des Ausschusses, in dem vorgeschlagen wurde, es “als erschwerende Umstände zu bezeichnen, wenn grünes Holz mittels Schneideinstrumenten abgehauen oder abgeschnitten und wenn statt der Axt die Säge gebraucht wird.”
Am Ende kam Marx zu dem Resultat: “Der Landtag hat also vollkommen seine Bestimmung erfüllt. Er hat, wozu er berufen ist, ein bestimmtes Sonderinteresse [das der bis heute in Deutschland meist adligen Waldbesitzer] vertreten und als letzten Endzweck behandelt.”
International treten heute vor allem große Holzfirmen in Erscheinung, die mit ihren gedungenen Arbeitskräften und Maschinen den letzten Wäldern auf der Erde zu Leibe rücken.
Die Chinesen lassen ihre Edelhölzer nicht nur in Burma und in Indonesien fällen, sondern vermehrt auch in Südamerika, weswegen sie u.a. einen zweiten Kanal von Nicaragua zum Pazifik bauen wollen, ihre Schiffe werden bereits so umgerüstet, dass sie die Hölzer bereits an Bord vorverarbeiten können. In Sibirien sind es die chinesischen Holzfällerbrigaden selbst, die den Wäldern zu Leibe rücken – und „zu Eßstäbchen verarbeiten,“ wie der Spiegel schreibt.
In Indonesien ist Borneo bereits zur Hälfte entwaldet. Die dortige Orang-Utan-Forscherin Bijute Galdikas ist seit fast vierzig Jahren immer wieder damit beschäftigt, Holzfäller-Brigaden aus dem Schutzgebiet “ihrer” Menschenaffen zu vertreiben. Ähnlich ist es derzeit im Schutzgebiet für Berggorillas im Kongo und in Ruanda, wo Teile einer Guerillaarmee ihr Überleben mit dem Handel von Holzkohle sichern. Eine deutsche Holzfirma, die schon seit langem die Urwälder des Kongo heimsucht, erwähnt David van Reybrouck in seiner umfangreichen Studie über die Geschichte des “Kongo”. Die Holz- und Palmölkonzerne sind mit Zustimmung der jeweiligen Regierungen weltweit die größten Regenwaldvernichter. Die TV-Sendung “Panorama” berichtete kürzlich über das Verschwinden des Regenwalds im Kongo und in Ruanda: “Holzfirmen aus aller Herren Länder räumen ab – darunter auch vier deutsche. Ein bis zwei Stämme pro Hektar sei ökologisch vertretbar, schade dem Wald nicht, verspricht die Tropenholzwerbung.” Das NDR-Nachrichtenmagazin tat sich auf einem “Festbankett der deutschen Holzimporteure” um, wobei es sich auf Dr. Hinrich Lüder Stoll konzentriert, Chef eines großen deutschen Unternehmens im Kongo. “Vergangene Woche im Taunus. Einladung zum Workshop für handverlesene Tropenwald-Experten. Anlaß: eine vom Entwicklungshilfeministerium in Auftrag gegebene Studie über die Firma CIB – das kongolesische Unternehmen von Hinrich Lüder Stoll. Die Studie hat geprüft, ob Stoll in Afrika ökologisch verantwortungsvoll arbeitet, “nachhaltig”, wie Fachleute sagen. Das Urteil: ‘Die gegenwärtige Holzernte und -verarbeitung ist, ökologisch betrachtet, eindeutig nicht nachhaltig’.”
Bilder vom Markt in Ouesso, einer Stadt in der Nähe der Holzkonzession des Dr. Stoll. Hier gibt’s alles, auch Gorillafleisch. Dazu die Studie: “Die kommerzielle Jagd hat sich im Gebiet der CIB-Konzession extrem schnell ausgebreitet…Zu den bejagten Tieren gehören auch Waldelefanten, Schimpansen und Gorillas… Die Stämme auf diesem LKW tragen das Zeichen der Stoll-Firma CIB. Und wie viele Holzlaster, die aus entlegenen Urwäldern kommen, transportiert das Fahrzeug nicht nur Holz. Der Fotograf Ammann fand geräucherte Arme und Hände von Menschenaffen.” Die Studie klagt an: “Berufsjäger verabreden sich mit CIB-Fahrern, um ihr Wildfleisch auf Lastern der CIB abzutransportieren. Weder die CIB noch die lokalen Forstbeamten haben etwas dagegen unternommen.”
Das ökologische Urteil der Studie ist eindeutig. “Doch das Entwicklungshilfe-Ministerium relativiert mit der zweifelhaften Begründung, andere trieben es ja noch schlimmer in Afrika: ‘Was die Firma CIB tut, ist sicher nicht in jedem Punkt – entspricht nicht allen Forderungen, die heute, fünf Jahre nach Rio oder seit Rio gefordert werden, aber es gab Übereinstimmung zwischen allen Beteiligten, daß ist sowohl in der Republik Kongo, als auch im zentralafrikanischen Raum noch das, was einer nachhaltigen Bewirtschaftung am nächsten kommt’.”
Im Urwald des benachbarten Gabun sägt Europas größter Fabrikant von tropischem Sperrholz, die deutsche Firma Glunz: “Bilder englischer Naturschützer: Im Anflug auf das Holzfällercamp sehen sie eine Brücke, die ihr Mißtrauen weckt. ie führt auf das linke Flußufer, direkt in den bisher unberührten Regenwald des ökologisch wertvollen Lope-Reservats. Ausgerechnet dort will Glunz jetzt einschlagen – mit gabunischer Genehmigung, versteht sich. Die Folgen sind bekannt. Diese Goldschwanzaffen gibt’s nur hier. Eine gabunische Studie stellt fest, daß im Camp von Glunz in nur zwei Monaten 4.500 Kilo Wildfleisch konsumiert wurde, fast die Hälfte war Affenfleisch.”
Die Zerstörung der Regenwälder begann laut dem Direktor des “Center for the Support of Native Lands” in Arlington, Virginia, Mac Chapin, in den Fünfziger- und Sechzigerjahren: Bis dahin hatten Malaria und Gelbfieber noch jedes Kolonisierungsprojekt verhindert: “die Hälfte der Leute starb jedesmal. Aber dann wurde 1. das DDT entwickelt – und von den amerikanischen Soldaten zum ersten Mal im Krieg gegen Japan eingesetzt, 2. 1947 die Motorsäge erfunden . in Oregon, und 3. Straßenbaugeräte und die Asphaltierung. Dies geschah überall auf der Welt – und bis heute, wobei die medizinischen Mittel immer besser wurden, die Straßenbaugeräte immer größer und die Motorsägen immer mehr.”
Aber auch die Umweltverschmutzung setzt den Bäumen zu. Werden sie dvon allzu sehr in Mitleidenschaft gezogen, tritt das ein, was bereits bei der o.e. rheinischen Landtagsdebatte über das “Holzdiebstahlgesetz” erwähnt wurde: Der Baum stirbt mit der Zeit ab – und muß deswegen irgendwann aus Sicherheitsgründen gefällt werden. Dies geschieht heute auch tausendfach in den Städten mit den Straßenbäumen, obwohl sie meist noch “gesund” und stabil aussehen, weil der Baumbesitzer, die Stadt, über die Bäume verfügt und für etwaige Schäden an Häusern, Autos und Menschen z.B. haftet. Laut Bundesgerichtshof hat der “Inhaber der Verfügungsgewalt” dafür zu sorgen, dass der Baumbestand nach forstwirtschaftlichen Erkenntnissen so angelegt ist, dass er gegen Windbruch und Windwurf, insbesondere gegen das Umstürzen wegen mangelnder Standfestigkeit gesichert ist.”
Die Alleebäume fielen im Westen nach und nach den Straßenverbreiterungen, -begradigungen und Sicherheitserwägungen (zuletzt vor allem des ADAC) zum Opfer, dagegen blieben sie im Osten – wie so vieles – nahezu unverändert erhalten, ja, sie erholten sich dort sogar von den letzten Kriegsschäden. Seit der Wende sind dort weitere Alleen mit Bäumen bepflanzt worden.
In den Städten bangt man um einen aus Amerika kommenden Pilz, der Eichen befällt: Der “Sudden Oak Death” wurde vor neun Jahren zum ersten Mal beobachtet. Aber bevor noch die ersten Pilzsporen hier gesichtet werden, hat schon ein allgemeines Baumbangen eingesetzt, das sich hier und da sogar schon gegen die staatlichen Umweltschützer formiert. Anfang Oktober z.B. am Stuttgarter Platz in Berlin, wo eine Bürgerinitiative zusammen mit der Polizei in letzter Minute das Fällen von drei Bäumen verhinderte, die zuvor von der grünen Stadträtin zu einem “Sudden Death” verurteilt worden waren, weil sie angeblich wie aus heiterem Himmel ihre “Standsicherheit” aufgegeben hätten. Insgesamt geht es dort um etwa 100 Bäume – die der Standortverlegung des Charlottenburger Bahnhofs im Weg stehen. Als aus Gründen des Uferschutzes am Landwehrkanal etliche Bäume gefällt werden sollten, ketteten sich einige Naturschützer sogar an die Bäume. Es wurde daraufhin eine andere Ufer-Lösung gefunden. Weitaus heftiger waren die Kämpfe gegen das Fällen von Bäumen am Bahnhof von Stuttgart. Von dort wurde zuletzt gemeldet, dass die bundeseigene Bahn AG entlang des Neckarersatzbachs im Stadtteil Untertürkheim weitere “Abholzungen” vornehmen lassen werde.
Speziell um den Erhalt der Alleebäume kämpft die Vereinigung der deutschen Landesdenkmalpfleger. In ihrem neuesten Bericht (Nr.8) druckten sie einen “Alleenerlaß” aus dem Jahr 1841 ab, in dem der preußische König sich beklagte, dass so viele Alleebäume überflüssigerweise bei Straßenbaumaßnahmen gefällt werden. Er befahl deswegen, “daß Lichten und Aushauen prachtvoller Alleen künftig zu unterlassen”. Die Landesdenkmalpfleger merkten dazu an: “Möge das königliche Vorbild, welches offensichtlich im 19. und frühen 20. Jahrhundert Schlimmeres verhindert hat, Richtschnur auch für das 21. Jahrhundert sein.”
Von den Anekdoten über John Steinbecks Beifahrer – seinen Pudel “Charley”- während einer Amerika-Rundreise mit dem Auto, die Geert Maks für sein Reisebuch “Amerika” sammelte, ist die erste ein Zitat des Regisseurs Barnaby Conrad, der Steinbecks Kurzgeschichte “Flucht” verfilmen wollte und dazu den Autor überredete, mit zu spielen. Conrad berichtete später, dass er ihn in San Francisco traf, in “Enrico’s Café”. Charly saß während ihres Gesprächs “aufrecht und brav in einem Eckchen daneben und wartete. ‘Sieh Dir den Hund an,’ sagte Steinbeck. ‘Gestern in Muir Woods hat er sein Bein an einen Mammutbaum gehoben, der sieben Meter dick war, über 30 Meter hoch und bestimmt 1000 Jahre alt. Was bleibt dem Hund jetzt noch zu tun?'”
.

Photo: viralnova
.
Katrin Eissing über einen gefällten Hinterhofbaum
Der grosse hohe Baum, der im Winter silbern und weit fächerig das riesige Schulgebäude auf der Rückseite des Hauses verdeckt hatte, war plötzlich so nah an der Erde, dass ein kleiner, dünner, lächerlich angezogener Mann Seile über ihn schmeißen und auf ihm herumklettern konnte. Er kam von unten an den Ästen hoch gehangelt und stellte oben den Motor der Säge an. Als ich das erste Mal aus dem Fenster guckte, waren die Fächerfinger fort. Ich konnte vom Küchenfenster aus das Dach der Schule sehen. Ich versuchte dem Gärtnern zuzulächeln. Mein Freund Ovid ist auch ein Baumkletterer. Er hat mir von Baumpflege erzählt. Ich dachte: „Pflegerische Maßnahmen werden vorgenommen.“
In der Kinder- und Jugend-Psychiatrie in der ich mit sechzehn gearbeitet hatte, wurde auch gepflegt. Wenn zum Beispiel ein behindertes, junges Mädchen erst von den Pflegern geärgert wurde, bis es mit spritzenden Tränen weinte, um dann einen Vorwand zu haben, es nackt auszuziehen, sich zu viert auf es zu setzen und Betäubungsspritzen mit dicken Nadeln irgendwohin zu stechen. Wenn dann der Anruf von der „Therapie“ kam, die einzige Sache auf die Astrid sich freute, aber jetzt schlief sie schon, hiess es: „Sie fühlt sich nicht.“ Astrid hatte ein hübsches, helles Gesicht und die Pfleger vermuteten, dass sie bei der Therapie schlecht über sie sprach. Sie konnte kaum sprechen, ihr Lieblingwort war Sonne.
Der Baum rauscht in den Nächten. In seinen Zweigen wohnen Vögel. Er bewegt sich, weil schlank und gerade aber oben füllig in Spiralen um sich selbst herum. Um seine Mitte, die zwischen den beiden sich zweigenden Hauptstämmen aus Nichts besteht. Oder einem meiner Kinder, das dort sitzt.
Als Kind saß ich ständig auf irgendeinem Baum und könnte von vielen noch die Kletterwege beschreiben. Vom großen Apfelbaum mit den kleinen Äpfeln aus, der vorn vor dem Haus stand, sah ich den Kindern, die neben der Bäckerei wohnten, zu, wie sie an einer Katze zogen. Das Kleinste weinte vor Mitleid, das größte lachte es aus und hieß Marion. Ich saß auf dem Baum und schrieb in ein Heft mit grün-weissen Blumen drauf. Worte, wie Rhabarber, der unten wuchs. Dann Sätze. Dann einen Apfel.
Als der Baum im Hof langsam in einzelnen, dicken Stücken von oben herunterfiel. Der Alltag lässt mich allein. Im Kaufland herrscht elender Gestank. Menschen drängeln sich durch die Umzäunungen aus Edelstahl, die die Menge auf die Kassen zu leitet. Menschen mit Gesichtern wie die amerikanischer Präsidenten. Unerbittlich voller Willenskraft wollen sie Kuchen kaufen.
Ich kaufe eine Stadtzeitung, in der steht, was alles gleichzeitig passiert, für die Kinder kleine Bären zum essen.
Motorsägen sind auch gelb.
Das Geräusch wurde immer stetiger und ich ging runter. Mit den blauen Mülltüten in den Händen. Die weißen, runden Flächen der abgesägten Äste lagen auf dem dunklen Boden oder stachen hell nach oben. Es gab noch einen hohen Stamm und nackte Äste an denen der Mann mit der Motorsäge im Arm sogar ziemlich hoch hing.
Stricki war ein Mädchen, etwa so alt wie ich 15, 16 oder 17 also. Sie hatte einen bäuerlichen Nachnamen so was wie Stapelfeld. Sie war mit dicken Ledergurten an ihrem Stahlbett festgebunden. Einer um jeden Fuß. Einer eng um ihre Hüften. Ihre Hände steckten in eine engen Jacke aus festem Leinen, deren Armlöcher in Bänder und Gurte übergingen. Diese waren auf ihrem Rücken zugeschnürt. Sie trug eine breite Halskrause, so dass sie ihren Hals nicht drehen konnte. Die Halskrause selbst war mit mehreren kräftigen Stoffwindeln am Bettrahmen befestigt. Stricki wurde gewickelt und jeden Tag einmal zum Baden losgebunden. Es gab eine streng zu befolgende Reihenfolge, in der die vielen Knoten und Bänder um sie herum zu lösen waren. Sie sprach nicht. Aber verstand alles, was man sagte. Sie war ganz ruhig, auch wenn sie jeden Tag neu festgebunden wurde. Manchmal wurde sie in der Zwangsjacke an einem Band durch das Gelände geführt. Sie hatte früher einmal eine große Kliniktür aus dem Rahmen gerissen und leicht wie einen Ball durch das geschlossene Fenster nach draußen geworfen. Auch hatte sie Heizkörper an denen sie festgekettet war von der Wand abgerissen wie Papier in Streifen.
Der Mann am Stamm, rutschte runter und stellte die Säge ab, als hätte er auf mich gewartet. Nachdem ich die Mülltüten los war, ging ich zu Ihm und fragte:“ Wie viel soll denn noch ab?“
„Alles.“ ich weinte. Er sagte: „…der ist kaputt, guck mal hier innen.“ Dann rauchten wir eine und standen zusammen auf dem Hof.
Mein Haar ist voller grauer Fäden. Mein Körper ist wie ein Straßenstück. Im Halbschlaf spreche ich ab und zu „Ich will sterben.“ vor mich hin. Dieser Baum war Vergangenheit.
Als mein Elternhaus abbrannte, und all die Bäume rundherum, auf denen ich Jahre verbracht hatte, verkohltes Gewirr geworden waren, habe ich nicht geweint.
Ich weigerte mich, einen Kittel zu tragen. Ich rasierte mir den Kopf. Wenn ich auf dem weitläufigen Klinikgelände unterwegs war, starrten die Männer, Arbeiter, Pfleger, Ärzte jetzt ohne Scham endlos auf meine Brüste. Dann merkten sie, dass ich einen Schlüsselbund bei mir trug und abends nach Hause ging.
Astrid schrie wieder: Sonne, Sonne, Sonne, Sonne… sie hörte dann nicht auf zu weinen und zu schreien, bis drei Pfleger, auch weiss wieder, auf ihr draufsaßen. Ich wusste, dass diese Leute dasselbe wie ich sehen mussten und Menschen waren.
Es lebten Vögel in dem Ahorn. Die letzten zwei Jahre hauptsächlich ein lautes Elsternpaar das die anderen Nester ausräumte. Das verzweifelte Tschilpen der Finken und Rotkehlchen im Frühling und meine Ratlosigkeit dazu, vermisse ich nicht. Gestern Nacht war Sturm. Zielstrebig zog der Wind um die Hausecken, ohne dass ihm eine Baumkrone dazwischen gekommen wäre.
Im veränderten Leben leben. Um die Sterblichkeit wissen, deshalb sich zu gut erinnern, ist auch keine Lösung.
Es sieht schön aus, wie altes Blumenpapier im selben Sturm über die Strasse weht. Eine Schrift auf dem Papierkorb vor den Schönhauser Allee-Akarden: „Wovon lebt Werner eigentlich.“
.

Den Baum stehen lassen. Photo: the-kiter.de
.

Den Wald wieder aufforsten. Photo: György Simo
.
Waldbewirtschaftung mit der Giftspritze
Am Samstag fand in Müncheberg, auf halber Strecke zwischen Berlin und Küstrin, erstmals eine Demonstration statt. Dort befindet sich das Leibniz-Zentrum für Agarlandschaftsforschung. Die etwa 150 Demonstranten protestierten gegen einen westdeutschen Unternehmer, der ein hochgiftiges Herbizid in seinem Wald einsetzen will. Die da auf die Straße gingen, waren Landwirtschaftslehrlinge, Leute aus Bürgerinitiativen gegen den Bau großer Schweinemastanlagen, Studenten der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde und Biobauern aus der Umgebung. Zusammengetrommelt hatte sie der Verein “Organischer Landbau in Bienenwerder” (OLiB), ein Hofkollektiv bei Müncheberg in unmittelbarer Nachbarschaft des betroffenen Waldes.
Die Vorgeschichte: Nachdem die Treuhandanstalt (THA) die DDR-Industrie privatisiert bzw. “abgewickelt” hatte, blieben Immobilien, vor allem aber Grund und Boden zurück. Den privatisiert die Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH (BVVG). Wenn es sich um Wälder handelt, die vor 1945 den preußisch-nationalsozialistischen Junkern gehörten, greift für die “Alteigentümer” oder ihre Erben das wie für sie geschaffene “Gesetz über die Entschädigung nach dem Gesetz zur Regelung offener Vermögensfragen und über staatliche Ausgleichsleistungen für Enteignungen auf besatzungsrechtlicher oder besatzungshoheitlicher Grundlage” – kurz EALG.
.
Das war bei dem Wald im Bienenwerder Luch der Fall, wo der Unternehmer Jobst Kühn von Burgsdorff 70 Hektar Kiefernforst nach EALG erwarb. Zuvor hatte den die BVVG als Verwalterin bereits entwertet, das heißt 40 Prozent des Holzes rausgeholt – ohne wieder aufzuforsten. Der neue Besitzer holte noch mal 20 Prozent raus, ließ also auf ein Maximum “auslichten”. Das seit neun Jahren Obstbau, Ziegenwirtschaft und Bienenzucht betreibende Hofkollektiv OLiB (13 Erwachsene plus Kinder) schreibt dazu auf seiner Internetseite: “Ein Baum mehr und es wäre illegaler Kahlschlag. Wochenlang waren riesige Harvestermaschinen im Einsatz.”
Gleichzeitig ließ der neue Besitzer den Unterwald wegmulchen. Dabei handelte es sich um die zu DDR-Zeiten aus Kanada eingeführte Traubenkirsche – ein schnell wachsendes Rosengewächs -, die man aus Brandschutzgründen gepflanzt hatte.
Lieblingswort “Wertschöpfung”
.
Jobst Kühn von Burgsdorff ist Miteigentümer der westdeutschen Firma Biocen GmbH, die Rohholz ankauft: “Insbesondere Waldholz, Holz aus Kurzumtriebsplantagen oder Landschaftspflegeholz – zur Vermarktung und Verwertung als Energieholz in Anlagen zur Erzeugung von thermischer und/oder elektrischer Energie.” Das Lieblingswort des adligen Holzverwerters in seinen Reden – etwa auf Tagungen von Waldbesitzerverbänden – ist “Wertschöpfung”. Im Falle des Forstes im Bienenwerder Luch entschied er sich für eine subventionierte “Waldumwidmung”: Es soll dort ein – natürlich eingezäunter – Wintereichenhain entstehen. Und weil es dafür eine staatliche Förderung gibt, wurden aus zunächst 4 geplanten Hektar erst 20, und nun reden die Waldarbeiter bereits von 40 Hektar.
.
Damit die Eichen gepflanzt werden können, müssen erst die triebfähigen Wurzelreste der zermulchten Traubenkirschen manuell entfernt werden. Stattdessen will Kühn von Burgsdorff sie mit dem glyphosathaltigen Universal-Pflanzenkiller “Round-Up” von Monsanto ausrotten – quasi direkt vor der Haustür des Hofkollektivs.
“Eigentlich soll man integrierten Pflanzenschutz betreiben, bevor man zur Giftkeule greift”, meint Oliver König vom OLiB. Das sei dem adligen Wertschöpfer aber zu teuer, vermuten die OLiB-Leute, die aus diesem Grund zu der Protestdemonstration in Müncheberg aufgerufen hatten. Es soll aber erst ein Anfang gewesen sein.
.

Photo: Livia Klingl
.
Der Mitschurinismus – als “schöpferischer Darwinismus”
In der DDR gab es noch bis zuletzt Gärtnereigenossenschaften, die “Mitschurin” hießen. Der Eisenbahner Iwan Wladimirowitsch Mitschurin, geboren 1855 im Oblast Rjasan, züchtete zunächst in seiner Freizeit Obstbäume – und träumte davon, die Obstqualität in seiner Heimat zu verbessern, wobei er u.a. die südlichen Sorten kälteresistenter machen wollte. Dazu gründete er eine Baumschule, die schon gleich nach der Revolution von den Bolschewiki, angefangen mit Lenin, großzügig gefördert wurde. Mitschurins Erfolge insbesondere bei der Pfropfung und Hybridisierung von Obstbäumen wurden bald legendär. In einem später verfilmten Buch über Mitschurin “Die Erde soll blühen” verglich der Schriftsteller Safronow ihn nacheinander mit Majakowski, Darwin, Puschkin, Pawlow – und bezeichnete seine Züchtungen als Wunder: “Während all dieser Jahre fanden Wallfahrten aus allen Winkeln des Landes zu diesem wunderbaren Garten statt. Tausende von Wissenschaftlern, Agronomen, Gärtnern, Studentengruppen kamen angereist. Aber auch Experimentateure, Arbeiter aus Agrarlaboratorien und einfache Kolchosebauern. Bevor sie eintraten, mußten sie die Bürde ihrer gewohnten Vorstellungen und traditionellen Kenntnisse ablegen wie Regenschirm und Hut in einem Vorzimmer…Die Besucher entdeckten eine bunte Menge unbekannter Pflanzen. Die Zweige von Apfel- und Birnenbäumen konnten kaum das Gewicht der riesigen Früchte tragen. Man sah verschlungene Lianen der fernöstlichen Aktinidie, aber hier trug sie süße, bernsteinfarbige Früchte mit dem Geschmack und dem Duft der Ananas. Ein Mandelbaum trug innerhalb eines Jahres Sprößlinge von über einer Sashen Länge, ein fremdartiger Baum – eine Hybride aus Kirsche und Weichselkirsche – trug Früchte, die Weintrauben ähnelten. Nicht weit davon entfernt bewegten sich im Hauch sanften Windes die Ranken und gezackten Blätter jener launenhaften Pflanze aus dem Süden – der Weinrebe”.
Anfänglich hatte Mitschurin vor allem Erfahrungen aus seiner Praxis in Fachzeitschriften für Gärtner veröffentlicht, mit der Zeit versuchte er jedoch, immer mehr theoretische Schlußfolgerungen aus seinen Züchtungsversuchen zu ziehen. So sprach er z.B. davon, als Selektionär die “Erbanalagen zerbrechen” bzw. “lockern” zu müssen, um die Pflanze in die gewünschte Richtung zu “erziehen”. “Wir können von der Natur keine Wohltaten erwarten, unsere Aufgabe ist es, sie ihr abzuringen”. Der französische Marxist Dominique Lecourt bezeichnete die Mitschurinsche Theoriebildung 1976 als “spontane Philosophie eines Gärtners” – ohne damit jedoch dessen Methoden – der Pfropfung, Hybridisierung und des Mentorverfahrens – abtun zu wollen.
Mit der Durchsetzung der Ideen des Agrartechnikers und späteren Landwirtschaftsministers Trofim Lyssenko, der einen ML-Philosophen, I. Present, an der Seite hatte, wurde die “Mitschurinsche Biologie” sogar zum Ausgangspunkt einer neuen “proletarischen Wissenschaft” erklärt: Diese geht davon aus, dass “durch das Eingreifen des Menschen die Möglichkeit besteht, jede Form des Tieres oder der Pflanze zu einer schnelleren Veränderung zu zwingen, und zwar in der von den Menschen gewünschten Richtung. Für den Menschen eröffnet sich ein weites Feld nützlichster Betätigung, heißt es bei Lyssenko, und weiter – gegen die damals noch praxisfernen Genetiker gerichtet: “Die Grundthese des Mendelismus-Morganismus, die These von der völligen Unabhängigkeit der Erbanlagen von den Lebensbedingungen der Pflanzen und Tiere wird durch die Mitschurinsche Lehre rundweg abgelehnt”.
In der Praxis ließen sich die “mitschurinschen-lyssenkistischen Techniken” auf drei Ideen reduzieren: “Jarowisation” des Getreides, d.h. Vorkeimung des Wintergetreides, um es im Frühjahr aussäen zu können – bis hin nach Sibirien; das Anpflanzen von Kartoffeln im Sommer zu dem selben Zweck und die “vegetative Hybridisierung”. Diesen z.T. wiederentdeckten Praktiken muß man laut Dominique Lecour bis heute eine “reale Effizienz in der Landwirtschaft zugestehen…Und auf genau diesen drei Techniken beruhte auch der Erfolg des Lyssenkismus in den zehn Jahren seines Aufstiegs (1929 – 1940)”, der parallel zur gewaltsamen Kollektivierung und “Entkulakisierung” der Landwirtschaft, mithin der Verwandlung von Bauern in Landarbeiter, verlief. “Wer hier handelt, das ist die Technik, und es ist der Bauer, auf dessen Rücken gehandelt wird,” merkte dazu der französische Marxist Charles Bettelheim an. Und es ist die Administration, die in dieser Situation schnelle Erfolge für ihre “technischen Lösungen” braucht: Das Akademiemitglied Kislowski erklärte 1948 auf einer Tagung “die Stärke von T.D.Lyssenko” damit, dass er sich “zum ideologischen Führer des in der sozialistischen Landwirtschaft Tätigen machte” . Die Akademiemitglieder Michalewitsch und Dmitrijew meinten auf der selben Tagung, Mitschurins Theorie sei die Theorie, die unsere besten Praktiker, “die Stoßarbeiter des Kollektivwirtschaften benutzen. Allein der Mitschurinismus könne “Vertrauen in den Kommunismus” wecken. Auch und zugleich gab sich die “mitschurinsche-lyssenkistische Biologie” als “direkten Ausfluß der vielhundertjährigen Geschicklichkeit der russischen Bauern” aus, und “kann sich schmeicheln, ein lebendiges, an die Praxis gebundenes Wissen zu sein.” In ihrem Mittelpunkt stehe deswegen auch “nicht die Frage der ‘natürlichen Zuchtwahl’, sondern der künstlichen Zuchtwahl”, schreibt Dominique Lecourt – und rettet damit die Praxis aus den Fängen ihrer Theorie.
Mit dem Aufstieg Lyssenkos wuchs auch Mitschurins Ruhm: 1932 benannte man seinen Geburtsort Dolgoje in Mitschrowka um und den Ort seines Wirkens, Koslow, in “Mitschurinsk”. Gleichzeitig wurde seine Baumschule dort “zu einem der größten wissenschaftlichen Forschungszentren für die Umwandlung der lebenden Natur” ausgebaut. Zu seinem 60. Geburtstag wünschte Stalin ihm aufgrund “seines gedeihlichen Wirkens zum Wohle unseres großen Heimatlandes weiterhin Gesundheit und noch mehr Erfolge bei der Umgestaltung des Obstbaus”.
Die “nachgeholte Modernisierung” Russlands im Sozialismus mußte sich neben der “Technik” auch auf den Enthusiasmus der Arbeiter in den Fabriken und Kolchosen stützen, denen dafür derart viele Konzessionen gemacht wurden, dass man am Ende sagen konnte, die UDSSR scheiterte nicht an zu viel Unfreiheit, sondern an zu viel Freiheit – im Produktionsbereich nämlich! Nicht die geringste Konzession des proletarischen Staates war die prospektive Engführung von Hand- und Kopfarbeit – durch Bildung und Qualifizierung der Massen einerseits sowie Proletarisierung von Wissenschaft und Politik andererseits.
In China wurde dann – während der Kulturrevolution – die “Aufhebung der Trennung von Kopf- und Handarbeit” sogar noch konsequenter und sozusagen flächendeckender in Angriff genommen. Offiziell sollte es dabei für die zu Millionen aufs Land geschickte “gebildete Jugend” um die “3 Mits” gehen: “Mit den Bauern arbeiten, leben und von ihnen lernen”. Mao tse Tung machte den Jugendlichen ihre jahrelange Landverschickung mit den Worten schmackhaft: “Je schmutziger ein Bauer, desto reiner seine Seele”. Anschließend hieß es – ebenfalls von offizieller Seite: “Jeder, der zu ihnen kam, spürte in der Einfachheit einen ungeheuren Schwung”. Auch dabei kamen am Ende etliche landwirtschaftliche “Verbesserungen” heraus – nicht zuletzt im Obstanbau. Erwähnt sei der Mittelschulabsolvent Tscheng You-dschi, dem es gelang, die Erträge der überalterten Birnbäume in den Gärten der Achten Produktionsgruppe in Wentjüantun am Sanggan-Fluß mit zum Teil neuen “Techniken des Obstbaumschnittes, der Pflege sowie der Betreuung” zu steigern. Solche Beispiele wurden bis 1976 zu Hunderten veröffentlicht.
Der 1935 mit 80 Jahren gestorbene Mitschurin hatte seinerzeit etwa 300 neue Obst- und Beerensorten gezüchtet. In einer Lobrede führte das Akademiemitglied Jakowlew aus: “Dabei wurden “die vielgerühmten Humboltzonen von ihm weit nach Norden vorgeschoben. Wie ein Zauberer aus dem Märchen warf Mitschurin über die unermeßlichen Weiten der Sowjetunion grüne Massive von Obstgärten, die er mit bis dahin nicht gesehenen Sorten schmückte. Das wertvollste Kapital, das der große Umgestalter der Natur geschaffen hat, sind jedoch die Millionen von Mitschurinanhänger…”
Die Begeisterung läßt sich jedoch nicht einpökeln – wie Salzheringe! Und deswegen reduzierten sich schließlich die Erfolge der “Mitschurinschen Biologie” auf Protokolle von unten über die Erfüllung von Planvorgaben, die durch die Instanzen hoch immer trügerischer, d.h. auch betrügerischer, wurden – und umgekehrt gerieten der Forschung die “konkreten Bedingungen” der Praxis immer mehr aus dem Blickfeld. So berichtete z.B. der Melker H.P.Hartmann, der 1973 an der LPG-Hochschule in Meißen sein Studium zum Diplom-Agraringenieur abschloß, dass seine Abschlußarbeit aus “Vorschlägen zur Erweiterung und rationelleren Nutzung moderner Milchproduktionsanlagen” bestand. Um dafür die Note 1 oder 2 zu bekommen, mußte man eine noch nicht ins Deutsche übersetzte sowjetische Arbeit als Quelle benutzt haben, die meist von der “Mitschurinschen Biologie” beeinflußt war. Hartmann fand eine von Admin und Savzan aus dem Versuchsbetrieb Kutusowska, in der es u.a. darum ging, den Färsen zwei mal täglich die Euter zu massieren: Das würde die Milchleistung später um ca. einen Liter täglich erhöhen. Als “Praktiker” nahm Hartmann diese Empfehlung jedoch selbst nicht ernst. Ähnlich wurden damals viele lyssenkistische Empfehlungen in der Tier- und Pflanzenproduktion aufgenommen.. “Wer hätte dafür Zeit gehabt, allen Färsen die Euter zu massieren und wieviel das gekostet hätte – dieses zwei mal tägliche Als-Ob-Melken?! Außerdem standen die meisten Färsen in Chrustschowschen Rinder-Offenställen, in denen sie frei herumliefen: Da wäre man gar nicht so einfach an die rangekommen”.
Häufig gerieten die Planvorgaben der Wissenschaftler und ihrer Forschungstationen mit denen der Kolchosen sogar in offenen Widerspruch: So berichtet z.B. der Leiter des Instituts zur Erforschung der Binnengewässer in Borok, Iwan Papanin, dass sie bei ihrem Vorhaben, die Fischzucht und -Fangergebnisse in den Stauseen der Mittleren Wolga zu verbessern, mit den Interessen der dortigen Fischereikolchosen kollidierten, die, um ihren Plan schnell und kräftesparend zu erfüllen, ausgerechnet in der Laichzeit rund um die Uhr, dazu noch mit äußerst engmaschigen Netzen, arbeiteten, was ihnen dann von den Wissenschaftlern verboten wurde: Die Mitarbeiter der Station gingen zur Kontrolle ihrer Anordnungen selbst auf Patrouille.
Ähnlich verhaßt machen sich auch im Westen die Ökologen, wenn sie den Bauern und Fischern aus Umwelt- und Naturschutzgründen immer neue Beschränkungen in ihrer Arbeit auferlegen. In Nordfriesland gibt es nur noch drei Muschelfischer, aber für sie gilt seit Jahren ein strikter “Miesmuschel-Management-Plan”. Gleichzeitig gibt es jedoch auch eine zunehmende Zahl von wissenschaftlichen Einrichtungen, die als Dienstleister von den Praktikern in Anspruch genommen werden wollen. Erwähnt sei das Obstbau – Forschungs- und Beratungsinstitut im Alten Land, das sogar nachts konsultiert werden kann – besonders bei Frostgefahr während der Blütezeit. Dennoch grenzen sich auch diese Forscher noch von einem Apfelzüchter und Apfelbuchautoren wie Eckart Brand ab – sie nennen ihn einen “Pomologen”, was “Kenner des Obstbaus, bzw. Sortenkundler für Kern-, Stein und Beerenobst” bedeutet, wobei man noch zwischen Professionellen und Amateuren unterscheidet, letzteres läßt sich vom “amator” ableiten: “Jemand, der liebt, ohne Gegenliebe zu verlangen”. Die Pomologen sind hierzulande in einem – 1859 gegründeten und 1991 wiederbegründeten – “Deutschen Pomologenverein” organisiert, und haben einen Geschäftsführer, der früher Atomphysiker war. Nun zieht man ihn u.a. bei Problemen der Sortenbestimmung hinzu. Die Auflösung des Pomologenvereins 1922 erfolgte nach einem Streit zwischen den Erwerbsobstbauern, die sich auf wenige, besonders wirtschaftliche Sorten konzentrieren wollten, und den auf Sortenvielfalt bedachten traditionellen Pomologen mit naturschützerischem Ambitionen. Zwischen beiden stand eine dritte Gruppe: die Kleingärtner. Der Einfluß der “Mitschurinschen Biologie” macht sich heute noch insofern bemerkbar, als die jetzt führenden Pomologen meist aus der DDR kommen. Erwähnt sei der vortragsreisende Manfred Lindecke aus Werder und der Geschäftsführer des o.e. Vereins Wilfried Müller. Er erinnert sich: “Wir kamen häufig zu Einsätzen, zum Beispiel zu der in der DDR bekannten Lehr- und Leistungsschau der Kleingärtner in Erfurt. Und das hatte den Vorteil, dass wir die eingesandten Früchte von der ganzen DDR, die ganze Sortenvielfalt, kennen lernten.”
Im Alten Land bei Hamburg betreibt der Pomologe Klook eine Baumschule – mit einem beheizten Glashaus, das eine Art Rettungsstation für alte oder seltene Apfel-, Birnen-, Pflaumen- und Kirschsorten ist. Obstbaumbesitzer aus nah und fern schicken ihm kleine Triebe, in einem beiliegenden Brief heißt es dann z.B.: “…hiermit bitten wir Sie um einen Rettungsversuch einer mindestens 60 Jahre alten Süßkirschensorte. Der Baum ist so gut wie tot, und wir übersenden ihnen seine letzten Lebensgeister”. Herr Klook nimmt dann das Süßkirschenzweiglein und pfropft es in seinem Gewächshaus auf ein Süßkirschenbäumchen.
.
Birnbaum am Bodensee. Photo: pixelio.de
.
Der Fourierismus als “utopischer Sozialismus”
“Von den frühen Sozialisten, mit denen Marx sich in seiner Jugend beschäftigte, hat keiner bei ihm so viele Spuren hinterlassen wie Charles Fourier (1772-1837),” schreibt Hans Jürgen Krysmanski in seinem schönen kleinen Buch “Die letzte Reise des Karl Marx”. Vom Kaufmannsgehilfen Fourier stammt das Wort “Feminismus”, heißt es dort. In seiner Genossenschafts-”Theorie der vier Bewegungen und der allgemeinen Bestimmungen” (1808) hat er herausgearbeitet, wie man die Arbeit so organisieren kann, dass die Leidenschaft dabei erhalten bleibt und sogar gesteigert werden kann. Seine “sozialistische Utopie” wurde 1966 von Th.W.Adorno auf Deutsch neu veröffentlicht und von Elisabeth Lenk bevorwortet. Hier sei ihr die “Anmerkung A – Über die progressiven Serien” entnommen:
“Die landwirtschaftliche Tätigkeit, das Pflügen zum Beispiel, erfüllt uns verständlicherweise mit einer Abneigung, die an Abscheu grenzt, und der gebildete Mensch wird zum Selbstmord getrieben, wenn er sich nur durch die Pflugschar ernähren kann.
Dieser Widerwille wird durch die unwiderstehliche Anziehungskraft der Arbeit völlig überwunden, die die progressiven Serien erzeugen, von denen ich jetzt sprechen werde.
Eine “Serie der Leidenschaften” (als Gruppe betrachtet) besteht aus Personen, die sich in jeder Hinsicht voneinander unterscheiden, in Alter, Besitz, Charakter, Verstand etc. Die Mitglieder müssen so gewählt werden, dass sie miteinander kontrastieren und eine Stufenfolge von reich zu arm, von gebildet zu unwissend (von jung zu alt) etc. ergeben. Je größer und abgestufter die Unterschiede sind, um so mehr fühlt sich die Serie zur Arbeit hingezogen, erhöht sich ihr Gewinn und erzeugt soziale Harmonie.
Wenn eine größere Zahl von Serien richtig arbeitet, so teilt sich jede von ihnen in verschiedene Gruppen, deren Anordnung die gleiche ist wie die einer Armee. Um ein Bild davon zu geben, nehme ich ungefähr 600 Personen an, zur Hälfte Männer, zur Hälfte Frauen, die sich alle für eine bestimmte Arbeit begeistern, zum Beispiel die Züchtung von Blumen und Früchten.
Nehmen wir die Birnen-Serie an: man wird die 600 Personen in Gruppen aufteilen, die sich mit der Kultur von ein bis zwei Birnensorten beschäftigen. Es wird eine Gruppe von Züchtern der Butterbirne, der Bergamottbirne, der Rousseletten usw. geben. Wenn jeder sich in die Gruppe seiner Lieblingsbirne hat aufnehmen lassen (man kann in verschiedenen Gruppen Mitglied sein), so wird es vielleicht einige 30 Gruppen geben, die sich durch Banner und Zierrat unterscheiden und sich in 3,5 oder 7 Abteilungen aufstellen werden, zum Beispiel:
Die Abteilung 1. Vorhut – in 2 Gruppen – züchtet Quitten und harte Hybriden
Die 2. Aufsteigende Flügelspitze – in 4 Gruppen – züchtet Harte Kochbirnen.
Die 3. Aufsteigender Flügel – in 6 Gruppen – züchtet Harte Eßbirnen.
Die 4. Zentrum der Serie – in 8 Gruppen – züchtet Saftige Birnen (Butterbirnen).
Die 5. Absteigender Flügel – in 6 Gruppen – züchtet Feste Birnen.
Die 6. Absteigende Flügelspitze – in 4 Gruppen – züchtet Mehlige Birnen.
Die 7. Nachhut – in 2 Gruppen – züchtet Mispeln und weiche Hybriden.
Es ist unwesentlich, ob die Serie aus Männern, Frauen oder Kindern besteht, oder je zur Hälfte, die Einteilung bleibt immer die gleiche.
Die Serie wird, was die Zahl der Gruppen oder die Aufteilung der Arbeit anlangt, ungefähr so aufgeteilt: je näher sie diesem ordnungsgemäßen Aufstieg und Abstieg kommt, desto besser ist sie harmonisiert und um so eifriger wird sie bei der Arbeit sein. Der Kanton, der am meisten verdient und unter gleichen Bedingungen die besten Erzeugnisse ergibt, ist derjenige, dessen Serien am besten abgestuft sind und am stärksten kontrastieren.
Wenn eine Serie ordnungsgemäß gebildet ist, wie jene, die ich eben angegeben habe, werden sich die korrespondierenden Abteilungen untereinander verbünden. Der aufsteigende und absteigende Flügel werden sich gegen das Zentrum verbünden und werden trachten, ihren Produkten vor denen des Zentrums der Serie den Vorrang zu verschaffen. Die beiden Flügelspitzen werden sich miteinander und mit dem Zentrum verbünden, um gegen die beiden Flügel aufzukommen. Aus diesem Mechanismus ergibt sich, dass jede Gruppe nach Herzenslust herrliche Früchte hervorbringen wird.
Die gleiche Rivalität, die gleichen Bündnisse wiederholen sich zwischen den verschiedenen Gruppen jeder Abteilung. Wenn ein Flügel aus 6 Gruppen besteht, 3 Männer- und 3 Frauengruppen, werden Männer und Frauen miteinander an Arbeitseifer wetteifern. Dann gibt es noch die Rivalität innerhalb eines Geschlechts, zwischen der zentralen Gruppe 2 und den äußeren Gruppen, 1 und 3, die sich gegen das Zentrum verbünden, außerdem Bündnisse der Gruppe 2, Männer und Frauen, gegen die Ansprüche der Gruppen 1 und 3, Männer und Frauen. Schließlich werden noch alle Flügel gegen die Ansprüche der Flügelspitzen und des Zentrums zusammenhalten, so dass die Serien, wegen der Birnenzucht allein, sich in ein abwechslungsreicheres Intrigenspiel von Bündnissen und Rivalitäten verwickeln werden als alle Kabinette Europas zusammen.
Dazu kommen die Intrigen zwischen Serie und Serie, Kanton und Kanton, die auf die gleiche Weise entstehen. Man wird begreifen, dass die Birnen-Serie eine besondere Rivalin der Apfel-Serie sein wird, sich dafür aber mit der Kirschen-Serie verbünden wird, denn diese beiden Obstsorten haben so wenig miteinander gemein, dass keine Eifersucht zwischen den betreffenden Züchtern entstehen kann.
Je besser man es versteht, die Leidenschaften anzufachen, ebenso wie die Kämpfe und Bündnisse zwischen den Serien eines Kantons anzuregen, desto eifriger werden sie in ihrer Arbeit miteinander konkurrieren und das Ziel, für das sie sich begeistern, um so höher halten. So kommt es zu einer allgemeinen Vervollkommnung der Arbeit, denn man kann auf jedem Tätigkeitsfeld Serien bilden.
Handelt es sich um eine Zwitterpflanze wie die Quitte, die weder Birne noch Apfel ist, so stellt man ihre Gruppe zwischen zwei Serien, denen sie als Bindeglied dient. Diese Quittengruppe ist die Vorhut der Birnen-Serie und die Nachhut der Apfel-Serie. Es ist eine gemischte Gruppe zwischen zwei Arten, ein Übergang von der einen zur anderen, und sie gliedert sich beiden Serien an. Unter den Leidenschaften gibt es zwittrige und bizarre Neigungen, ebenso wie man unter den Pflanzen Mischformen findet, die keiner Sorte zugehören.
Die genossenschaftliche Ordnung zieht aus allen Wunderlichkeiten ihren Vorteil und weiß alle erdenklichen Leidenschaften zu nützen, denn Gott hat keine einzige unnütze geschaffen.
Ich habe gesagt, dass man die Serien nicht immer so ordnungsgemäß einteilen kann, wie ich es angegeben habe, aber man versuchte, diesem Vorbild so nahe wie möglich zu kommen, denn es entspricht der Ordnung der Natur und ist am geeignetetsten, die Leidenschaften zu entfachen, sie gegeneinander abzuwägen und sie zur Arbeit hinzureißen.
Jede Arbeit wird zu einem Vergnügen, sobald die Beschäftigten in progressive Serien geordnet sind. Dann arbeiten sie weniger wegen des Gewinns, als um des Wettstreits und der anderen Anreize willen, die ein Bestandteil der Serien sind (auch durch den Aufschwung der kabbalistischen oder zehnten Leidenschaft).
Daraus ergibt sich, wie überall in der genossenschaftlichen Ordnung, ein erstaunliches Resultat: je weniger man sich um den Gewinn kümmert, um so mehr verdient man.
Ja, die Serie, in welcher der Westtstreit am heftigsten tobt, diejenige, die ihrer Eigenliebe die größten geldlichen Opfer bringt, wird auch diejenige sein, deren Erzeugnisse am vollendetsten und wertvollsten sind, und die daher auch am meisten verdient, indem sie den materiellen Gewinn vergißt und nur an ihre Leidenschaft denkt. Wenn sich in ihr aber weniger Ränke, weniger Wettbewerbe und Bündnisse bilden, weniger Eigenliebe und weniger Begeisterung, so wird sie schwerfällig arbeiten, mehr des Geldes als der Leidenschaften wegen, und ihre Produkte und ihr Gewinn werden wesentlich schlechter sein als die einer rivalisierenden Serie. Sie wird umso weniger gewinnen, je mehr sie von dem Wunsch nach Gewinn getrieben ist. (In einer in Gruppen aufgeteilten Serie müssen ebensoviele Intrigen gesponnen werden wie in einem Drama, und die Hauptregel, der man folgen muß, um das zu erreichen, ist die Abstufung und Ungleichheit. Ich habe schon gesagt, dass, um die Erzeugnisse jeder Gruppe zur höchsten Vollendung zu bringen und die innere Spannung zu erzeugen, muß man sie soweit wie möglich der zunehmenden und abnehmenden Progression unterordnen.”
.

.
Von der Human- zur Humuswissenschaft
Natürlich ist es nur allzu wahr, dass “das soziale Zusammenleben den Menschen große Schwierigkeiten bereitet,” wie der Meeresbiologe Adolf Remane meinte, erst recht, wenn diese Menschen soziale Kämpfe zur Lebensverbesserung organisieren wollen. Aber dass man dieserhalb nun alle Hoffnungen auf die Bakterien richtet, ist doch überraschend. Zumal die Mikroben bisher vor allem als Krankheitserreger gefürchtet waren. Ihre Umwertung verdankten sie u.a. dem Humusforscher Raoul Heinrich Francé und seinen “Untersuchungen zur Oekologie der bodenbewohnenden Mikroorganismen” (1913) sowie zum “Leben im Ackerboden” (1922), beide Bücher wurden 1981 neu herausgegeben. Als er 1943 in Budapest starb, führte seine Frau, die Biologin Annie Francé-Harrar, seine Forschung weiter. Neben einem “Handbuch des Bodenlebens” veröffentlichte sie 1950 “Die letzte Chance – für eine Zukunft ohne Not”, beide Bücher wurden 2007 bzw. 2011 von der “Gesellschaft für Boden, Technik, Qualität” (BTQ) neu herausgegeben. Das zweite kann man sich als “pdf” im Internet herunterladen. “Die letzte Chance”, damit meint die Autorin: Wenn wir nicht schleunigst den Wald retten und die Humusschicht auf unseren Böden verbessern, dann ist es um das Leben auf der Erde geschehen: “Wir, unsere ganze Generation, stehen vor einem Abgrund, denn Humus war und ist nicht nur der Urernährer der ganzen Welt, sondern auch der alles Irdische umfassende Lebensraum, auf den alles Lebende angewiesen ist.” Um den Humus zu erhalten, müssen wir die Mikroorganismen im Boden, die ihn schaffen und von denen die Pflanzen abhängen, von denen wiederum wir abhängen, studieren und kennen, um sie bei ihrer Tätigkeit zu unterstützen und nicht – wie jetzt noch – permanent zu behindern: “Seit Jahrhunderten haben wir unsere Böden kaputt gemacht.”
Als nächstes meldete sich 1991 der Biophysiker James Lovelock mit einer “Gaia”-Theorie zu Wort, nach der “die Erde ein Lebewesen ist”. Um sie zu erhalten, und vor allem den Kohlendioxid- und Methananteil der Luft nicht weiter ansteigen zu lassen (wegen der Klimaerwärmung), “sollten wir die drei tödlichen Dinge für unseren Planeten immer im Kopf behalten: Autos, Rinder und Motorsägen.”
Nachdem der Autor sich mit der Mikrobiologin Lynn Margulis zusammengetan hatte, bekam seine chemisch-physikalische Erdentwicklungstheorie ebenfalls eine bakterielle Basis, d.h. die Mikroorganismen wurden für ihn das Alpha und Omega unserer Lebensbedingungen. Wir können laut Lovelock nicht die Erde “managen”, aber vielleicht so etwas wie ihre “gewerkschaftliche Vertrauensperson” sein, die “die Bakterien, die Pilze, die Fische, Vögel und Säugetiere, die höheren und niederen Pflanzen auf dem Festland und im Wasser vertritt.” Diese Idee machte den Wissenssoziologen Bruno Latour, der ebenfalls ständig davon spricht, dass wir diesen ganzen “Akteuren” Sitz und Stimme an unseren Runden Tischen geben müssen, zum Anhänger der “Gaia”-Theorie, zu der er jetzt ein Buch veröffentlichte: “Existenzweisen”.
Die “Humus”- Forscherin ebenso wie der “Gaia”-Theoretiker wenden sich an die Wissenschaft und die Politik. Es gibt aber noch einen dritten apokalyptischen Warner: den japanischen Gartenbauprofessor Teruo Higa. Er verkauft seine “Effektiven Mikroorganismen” (in handlichen EM-Kanistern) direkt an die Praktiker (Bauern, Gärtner, Imker etc.) und schuf damit eine ganze soziale Bewegung – mit Zeitungen, Stammtischen, Kongressen etc.. Auch er geht wie die anderen beiden davon aus, dass sich unsere Böden inzwischen “im Endstadium äußerster Minderwertigkeit” befinden und unser “Planet krank und dahinsiechend” ist, wie er in seinem 2009 erschienenen Buch “Eine Revolution zur Rettung der Erde” schreibt. Diese besteht darin, bei den Mikroorganismen “die Kräfte der Regeneration” und der “Degeneration” zu unterscheiden, um sodann erstere zu unterstützen. Genauso haben das auch die Bolschewiki gesehen, nur dass sie dabei an Menschen (fortschrittliche und reaktionäre Klassen) und nicht an Mikroben (Photosynthesebakterien, Milchsäurebakterien, Hefen, Pilze und aerobe sowie anaerobe Actinomyceten) gedacht haben. Am nächsten kamen dieser Sichtweise noch die sowjetischen Bodenforscher beginnend mit Sergej N. Winogradsky. Aber auch sie unterschieden sich in einem Punkt ganz wesentlich von den drei Humuspropheten aus dem Westen: Während für diese die “industrielle Landwirtschaft” fast schon die Wurzel allen planetarischen Übels ist, sahen die bolschewistischen Humusforscher darin die (weltrevolutionäre) Zukunft.
Nun sehen wir jedoch das große Ganze: den Planeten einschließlich seiner Atmosphäre – Gaia. Der Wissenssoziologe Bruno Latour ging in seinen “Clifford Gaia Lectures” so weit, dass er “the soil” selbst Handlungsmacht zuschrieb. “Soil”: Boden, Erde, Erdreich, Scholle – kurz: Humus, denn dieser ist es, der “handelt” – und zwar ständig. “Das Netz der Agenten, des Volkes von Gaia, mobilisiert die tellurischen Kräfte,” so sagt es der Literaturwissenschaftler Niels Werber in seiner “Einführung: ‘Geopolitik'”, die soeben im Junius-Verlag veröffentlicht wurde. Er spannt darin den Bogen vom imperialistischen “Great Game” bis zu den spätmodernen “Big Sciences” (im Kleinkrieg).
.

Buddha-Feige. Photo: picclick.com
.
Pflanzenforschung
Die Schweizer Biologin Florianne Koechlin hat in bisher vier Büchern neuere Pflanzenforschungsergebnisse zusammengetragen. Dazu interviewte sie in mehreren Ländern Botaniker, Mikrobiologen, Bauern, Gärtner, Neurobiologen und Künstler. “Pflanzenpalaver” heißt ihr erster Reader, den sie in den Berliner Räumen der anthroposophischen GLS-Bank vorstellte, zusammen mit dem Genmais-Bekämpfer Benny Härlin von der anthroposophischen “Zukunftsstiftung Landwirtschaft”. Er hatte kürzlich u.a. mit ihr die “Rheinauer Thesen zu Rechten von Pflanzen” zusammengestellt. Sie sind nun Grundlage dafür, dass der Schweizer Ethikrat beschließen möge, Pflanzen sind nicht länger eine “Sache” – ein seelenloser Gegenstand. Für die Adolf-Portmann-Schülerin Florianne Koechlin, die sich als “Forschungsfreak” bezeichnet, ist seltsamerweise bzw. ausgerechnet die Malerei der “Zugang zu den Pflanzen”. Man kann diese nahen Verwandten der Tiere und Menschen (erst vor etwa 500 Millionen Jahren trennte sich unsere Entwicklung, d.h. 3 Milliarden Jahre davor verlief sie ungetrennt) alles zutrauen bzw. attestieren: Pflanzen können riechen, schmecken, fühlen, hören (also Schallwellen wahrnehmen), ja, sie können diese sogar gedanklich auswerten (denn an der Spitze jeder Wurzelfaser befinden sich Zellen, die “gehirnähnliche Funktionen” wahrnehmen, wie der Bonner Biologe Frantisek Baluska meint herausgefunden zu haben) und darüberhinaus können sie noch vieles mehr, was wir nicht können, aber eines nicht – nämlich sehen. Während die Menschen andererseits absolute Sehtiere sind: Unsere ganze Gesellschaft ist auf das Sehen hin orientiert – und dies zunehmend. Der Sozialphilosoph Ulrich Sonnemann sprach beizeiten bereits von einer “Okulartyrannis”, die es zu bekämpfen gelte, weil sie alle anderen Sinne und Sinneswahrnehmungen unterdrücke bzw. herabwürdige. Ähnlich bezeichnet der Filmemacher Harun Farocki unsere Gesellschaft als eine, “die vollständig auf ihr Abbild hin organisiert ist”.
Die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften hat die neueste (20.) Ausgabe ihrer Zeitschrift “Gegenworte” komplett diesem Thema gewidmet. Es heißt “Visualisierung oder Vision?” Den Anfang macht darin die Kulturwissenschaftlerin Doris Bachmann-Medick: Sie fragt, ausgehend von den “Urhebern” der mit den elektronischen Medien aufgekommenen “ikonischen Wende”, ob der “Iconic/Visual Turn” sich sogar gegen die Worte richtet. Und spricht in diesem Zusammenhang von Bildforschung, Bildanthropologie, Bild-Akte, Welt-Bilder und Bilderfragen. Der Molekularbiologe Frank Rösl macht sich Gedanken zur visuellen Evidenz in der Biomedizin. Klaus Töpfer äußert sich zur Macht des Bildes in der Politik. Der Kunsthistoriker Pablo Schneider berichtet über einen wissenschaftlichen Bilderkrieg. Der Medienwissenschaftler Thomas Hensel nennt seinen Text über den Maler und Erfinder Samuel Morse “Das Bild im Spannrahmen”. Und der berühmte Berliner Bilderklärer Horst Bredekamp geht der amerikanischen “Picture”-Manie in der noch berühmteren Zeitschrift “Nature” nach: In den naturwissenschaftlichen US-Journalen stieg zwischen 1989 und 2001 der Prozentsatz manipulierter Bilder von 2,5% auf über 25%; das “Journal for Cell Biology” beschäftigt seitdem sogar einen “Bild-Detektiv”. Der Emeritus und Mitbegründer der Akademie Conrad Wiedemann lästert über diese ganzen “Imagologen” – ob ihrer Bemühungen um saubere Bilder und der Etablierung einer eigenen “Bildwissenschaft”. Ihm ist der “Turn-Begriff zutiefst verdächtig”: Als man noch von “Protest” sprach und damit “starke Bewegungen” lostrat, war ihm wohler. Damals wie heute ging es um die “Deutungshoheit”, aber 68 gab man das wenigstens noch zu. “Ich habe das Gefühl, dass eine Emanzipation in diesem Fall gar nicht gelingen kann”, auch und erst recht nicht, wenn “Bachmann-Medick mehr als 30” mal von einem (Iconic) “Turn” spricht.
Die steigende “Bilderflut” spornt aber nicht nur die Wissenschaft an, sondern überschwemmt auch zunehmend unseren Alltag; die Handy-Generation ist geradezu bildbesessen. Seit neuestem von „Selfies“ (Selbstporträts), Intellektuelle immerhin noch von „Shellfies“ (ihren Bücherregalen).
So sieht der momentane Gipfel an Okkulartyrannis aus. Aber auch von vielen bildenden Künstlern und Kunstkritikern, die besonders hoch über das Auge besetzt sind, weiß man, dass sie mit zunehmendem Alter Gefühlskrüppel werden. Und grundsätzlich gilt: Die Welt primär mit den Augen wahrzunehmen, ist eine schwere Behinderung. So wie eine allzu forcierte Intelligenzschulung jede soziale Empfindung erstickt. Bei der Entwicklung eines Einfühlungsvermögens, das sich auf (blinde) Pflanzen richtet, ist ein sorgfältig oder professionell kultivierter Augensinn geradezu ein Handicap. Umgekehrt sind Blinde für den Umgang mit Pflanzen bzw. für das Verstehen floralen Lebens besonders prädestiniert. Und so ist es eigentlich zu bedauern, dass die Pflanzenforscherin Florianne Koechlin sich zum Einen mit Malerei abgibt und zum Anderen keinen blinden Gärtner bisher interviewt hat.
Dabei scheinen sich die Blinden schier zur Beschäftigung mit Pflanzen zu drängen. In England gibt es nicht nur viele lokale “Blind Gardener’s Clubs”, sondern inzwischen auch einen “Nationalen”, ferner Diskussionsgruppen von blinden Gärtnern, Gartenführer für Blinde und schon seit mehreren Jahren einen “Blind Gardener of the Year”-Wettbewerb, an dem sich jeder Pflanzenliebhaber mit eingeschränkter Sehfähigkeit beteiligen kann. 2008 gewann der 12jährige Elliot Rogers den Titel “Young Blind Gardener of the Year”. Ähnliche Aktivitäten kennt man auch in den USA. Und in Deutschland gibt es immerhin schon in vielen Botanischen Einrichtungen sogenannte “Duft und Tastgärten” – auf Initiative des “Allgemeinen Blinden- und Sehbehindertenvereins” (ABSV). Spezielle “Blindengärten” findet man u.a. in Bremen, Berlin, Weihenstephan, Heidelberg und Bad Wörishofen. In Radeberg bei Dresden hat die blinde Pastorin Ruth Zacharias ihren 14.000 Quadratmeter großen Privatgarten für andere Sehbehinderte zugänglich gemacht. “Es gibt ein Menschenrecht auf Duft,” meint sie, “die menschliche Nase kann 10.000 Nuancen unterscheiden”. Das gilt jedoch nicht für Sehende, wohl aber für die meisten Pflanzen. Und erinnern wir uns, wie Blinde sich im Straßenverkehr verhalten: Indem sie mit ihrem Stock kreisende Bewegungen auf dem Boden vollführen, um etwaige Hindernisse aufzuspüren.
Genau solche Kreisbewegungen unternehmen auch Kletterpflanzen mit ihrem obersten Sproß, um auf diese Weise an eine Mauer oder einen Baum zu stoßen, an dem sie sich dann hochranken. Und noch etwas haben Blinde (Menschen wie Tiere) und Pflanzen gemeinsam: Ihr mangelndes oder fehlendes Sehvermögen kompensieren sie dadurch, dass ihre anderen Sinne weitaus stärker entwickelt sind (als unsere). Derart kann man sie gut und gerne als Widerständler gegen die Okkulartyrannis unserer völlig vom Visuellen beherrschten Gesellschaft bezeichnen. Anders gesagt: Blinde sind die natürlichen Bündnispartner der Pflanzen. Wohingegen alle sehenden Pflanzenforscher bloß im Dunkeln tappen. Schlimmstenfalls machen sie dabei nur eine wissenschaftliche Karriere – auf dem Rücken von Pflanzen quasi, die sie dann auch noch als simple “Reiz-Reaktions-Maschine” begreifen: So wie ein Forscher des Max-Planck-Instituts für Chemische Ökologie in Jena, den Frau Koechlin interviewte, der aber dennoch Interessantes über die olfaktorische Kommunikation von Pflanzen herausfand. Und bestenfalls entwickeln sie dabei trotzdem eine gewisse florale Sensibilität – so wie etwa Doktor Zepernick vom Botanischen Garten Berlin, als ich ihm einmal während eines Interviews eine Zigarette anbot, die er jedoch ablehnte – mit der Bemerkung: “Nein, also Pflanzen verbrennen, das kann ich nicht, können wir alle nicht – bis auf eine Kollegin sind alle Wissenschaftler hier Nichtraucher, eigentlich merkwürdig.”
Florianne Koechlin: “Zellgeflüster – Streifzüge durch wissenschaftliches Neuland”, Lenos Verlag Basel 2005
Sowie: ” Pflanzenpalaver. Belauschte Geheimnisse der botanischen Welt”, Lenos Verlag Basel 2008
„Jenseits der Blattränder: Eine Annäherung an Pflanzen“, herausgegeben von Florianne Koechlin, Lenos Verlag Basel 2014
„Mozart und die List der Hirse: Natur neu denken.“ Einige Autoren in diesem von ihr herausgegeben Band referierten 2014 auch auf dem von ihr und Benny Haerlin organisierten Kongreß über „Beziehungsnetze“ in Berlin: „Die Farbe der Forschung“.
“Gegenworte”, Heft 20. “Visualisierung oder Vision?” herausgegeben von der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, Redaktion: Wolfert von Rahden, 10117 Berlin, Jägerstraße 22/23, 9 Euro.
.

.
Baumscheiben in Berlin
Neulich stritten wir uns über “Baumscheiben”. Die vom DB-Hausmeister Marenke gegründete Zeitschrift “Kiez & Kneipe” (aus Kreuzberg 61) hatte dazu bereits vor einiger Zeit eine Pro- und Contra-Diskussion gestartet. Viele finden die um sich greifende Baumscheiben-Begrünung spießig. In Berlin begann diese seltsame Freiraum-Besetzer-Bewegung harmlos damit, dass immer mehr Mieter, vom Umweltschutz angetan (in Kellogg’s Cornflakes-Packungen gab es dafür sogar “Umweltsheriff”-Sterne) angefangen hatten, die Straßenbäume vor ihren Häusern, im Sommer z.B., zu gießen. Einige sprachen auch mit ihren Bäumen – und unterhielten sich abends in ihren Gartenkneipen unter Linden bzw. Kastanien darüber, was die Bäume sagen. Dabei ärgerten sie sich gelegentlich über die Verschmutzung der Baumscheiben mit kaputten Flaschen, Plastik und allzu viel Hundescheiße. Es erschienen jede Menge teure Photobände über einzelne Bäume. – und es entstanden die ersten “Baumschützer”-BIs. In Berlin fingen daraufhin einige Mieter, angeblich zuerst in Reinickendorf, an, die Baumscheiben vor ihrer Haustür mit kleinen Zäunchen zu umgeben und zu bepflanzen. Bald taten es ihnen andere in anderen Bezirken nach, darunter viele Gewerbetreibende, die sich damit gewissermaßen einen kleinen Vorgarten für ihre Gäste auf dem Bürgersteig schufen, den sie sowieso schon mit Tischen und Stühlen quasi-privatisiert hatten.
In Kreuzberg 61 gab es bald die ersten alternativen Trägergesellschaften , die mit vom Arbeitsamt bezahltem (ABM/MAE-) Personal diese ausufernde Baumscheiben-Inbetriebnahme von unten gewissermaßen staatlich ausweiten und zugleich steuern wollten. Gesagt – gefördert – getan. Dazu ließen sie Schilder für die bereits bepflanzten Baumscheiben herstellen und aufstellen, auf denen sie darum baten, die kleine Grünanlage um den jeweiligen Baum herum zu schützen (oder wie man heute gerne sagt: zu respektieren). Und das mit Unterschrift vom Bezirksamt oder gleich vom Senat. Mit diesen Scheißschildern, die sich nun nach überallhin ausbreiten, wird eine slowmobartige Eigenmächtigkeit quasi im Handstreich legalisiert.
Interessant bleiben natürlich trotzdem die Unterschiede bei der Gastaltung und Nutzung der Baumscheiben durch die Mieter: mal ganz spießig mit geschorenem Rasen und irgendwelchen Stiefmütterchen ind Reih und Glied, mal mit nützlichem Gemüseanbau und mal mit einer gemütlichen Sitzbank drumherum. Die KPD/RZ war nebenbeibemerkt die erste Gruppe, die eine – vom Bezirk auf den Heinrichplatz abgestellte Baumscheibe (ohne Baum) mit einer Sitzbank versah. Bald fingen auch die Künstler an, sich der Baumscheiben vor ihren Ladengalerien bzw. – ateliers anzunehmen – natürlich ebenfalls erst Mal ökologisch inspiriert, aber schon bald platzierten sie auch immer mehr Eigen-”Objekte” darein. Die Blumenläden in den “Problembezirken” freuten sich ob des ständig steigenden Umsatzes. Einige spezialisierten sich geradezu auf Baumscheibengrün. Die Architektin Antonia Herrscher fing an, schon fast systematisch die von den Bürgern gestalteten Baumscheiben zu photographieren. Früher oder später mußte es zu einem ersten Berliner Baumscheiben-Photoband kommen – sowie auch zu einem Bezirkswettbewerb “Unsere Baumscheibe soll schöner werden!” Im Vorfeld kam es in vielen Kneipen zu erhitzten Pro- und Contra-Diskussionen.
.
Wenn der Schrebergarten die Landwirtschaft des in die Stadt verschlagenen kleinen Mannes ist, dann ist die Baumscheibe der Schrebergarten des ganz kleinen Mannes, meinte Cornelia Köster verächtlich – und auch die o.e. “Kiez & Kneipe”-Ausgabe war voller Verachtung für diesen neuen urbanen Ökotrend, der bereits pandemische Ausmaße angenommen hat. Der in dieser Kreuzberger Zeitung die Contra-Position vertretende Autor war allerdings zuvor im Suff nachts über den Zaun einer Baumscheibe in der Solmsstraße gestolpert – und zwischen die Blumen und Rabatten gefallen, woraufhin er von den Mietern, die diese Baumscheibe angelegt und seinen Sturz mit angesehen hatten, auch noch beschimpft worden war. Cornelia verstieg sich später sogar zu dem Satz “In einer Straße mit lauter bepflanzten und eingezäunten Baumscheiben möchte ich nicht wohnen.” Das war aber nun doch übertrieben, fand ich, der eine zeitlang die Dachgärten sowie die Hinterhof-Biotope der meist grünalternativen Mieter in S.O.36 photographiert hatte. In einigen Abschnitten der Oranienstraße sah es, wenn man sich auf einem dieser Dachgärten umkuckte – und dabei in allen Ecken und Nischen sowie Höfen weitere Gärten entdeckte, schon fast aus wie in den Tropen. Natürlich wurden auch diese Biotope nächtens gerne vom juvenilen Amüsierpöbel in Beschlag genommen. Vor allem war es jedoch die ebenso üppige wie teure Bepflanzung dieser Dachgärten und Hinterhöfe denen gegenüber ich die Baumscheiben vorne vor den Türen als geradezu bescheiden empfand. Zudem war dieses Grün im Gegensatz zu jenem öffentlich, d.h. für alle da.
.
Kurzum: die Baumscheiben vor den Häusern kamen mir vor wie eine vorsichtige, aber nachhaltige Realisierung der blöden, weil englischen Autonomenparole “Reclaim the Street”. Die derzeitig gültige heißt übrigens “Did you ever squatted an airport? – und bezieht sich auf die demnächst anstehende Besetzung des Flughafens Tempelhof, den seine komische CDU-Pseudobürgerinitiativler, die ihn weiter als Flughafen (für Privatjetbesitzer) betreiben wollten, bereits in “Airport” umbenannt hatten. Solche Squatter-Parolen auf Plakaten in Englisch zu verbreiten, zeigt bereits, wie sehr die Linke inzwischen mit dem per Easyjet anreisenden Amüsierpöbel identisch geworden ist.
.
Man müßte vielleicht jede einzelne Baumscheibe für sich diskutieren. In Neukölln fand Antonia Herrscher, die ihren Blick für Baumscheiben geschärft hatte, mehrere Baumscheiben, bei denen die Mieter statt eines Genehmigungsschildes vom Bezirk ein eigenes aufgestellt bzw. an den Baum in der Mitte gehängt hatten: “Nicht kaputtmachen!” oder “Hunde bitte fernhalten!”, aber auch: “Wer das liest ist doof!” und “Vorsicht beim Einparken!” sowie “Straßenbegleitgrün (under construction)”. Außerdem bemerkte sie, dass Füchse und Marder, aber auch Spatzen und Amseln, sowie Mäuse und Ratten, diese Baumscheiben dort als sichere Oasen in den Straßenwüsten benutzen – sie hetzen wie Nomaden oder genauer gesagt: Inselhopper von einer zur anderen. Auf der einen Seite die Straße rauf und auf der anderen wieder runter.
.
Kann man vielleicht sagen: Während die Baumscheibenbesetzer sich nach draußen vor die Tür bewegen, igeln die Hausbesetzer sich ein, sie ziehen sich von der Straße zurück – bauen sich Hochbetten, Sauna, Veranstaltungsräume und Baumhäuser (im Garten). Der Baum ist nun einmal immobil – von altersher sozusagen, aber dass die Autonomen sich freiwillig derart immobilisieren…
.

Baumstumpfsitz. Photo: Livia Klingl
.
Baumgeschichten
Mit Homer, in der Eisenaxtzeit, beginnt laut Friedrich Kittler unsere abendländische Wissenschaft – Schrift, Musik, Mathematik…Bei Homer heißt es an einer Stelle – über eine Gruppe von Holzfällern im Gebirge:
„Und nun zogen sie aus mit holzzerhauenden Beilen,
Mit gewundenen Seilen und vorn an der Spitze die Mäuler;…
Sobald sie die Schluchten des quelligen Ida erstiegen,
Fällten sie rüstig sogleich mit scharfem schneidenden Erzhieb
Himmelragende Eichen; laut krachend stürzten sie nieder.
Drauf zerspalteten sie die Männer Achaias und luden
Auf die Tiere das Holz…“
Etwa 400 Jahre später berichtet Platon bereits über die Verkarstung der Berge infolge ihrer Abholzung:
„Holz hatte es reichlich auf den Bergen…Die Dachgebälke großer Häuser hat man aus den Bäumen der Berge hergestellt. Daneben gab es auch viele veredelte Fruchtbäume…Ferner erfreute sich das Land durch Zeus eines jährlichen Regenergusses, der ihm nicht wie jetzt durch Abfluß über den kahlen Boden weg verloren ging…“
In seinem „Kritias“ schrieb Platon: „Übriggeblieben sind nun im Vergleich zu damals nur die Knochen eines erkrankten Körpers, nachdem ringsum fort geflossen ist, was vom Boden fett und weich war, und nur der dürre Körper des Landes übrigblieb.“
“Wie komisch von den Bäumen, ihren Nachwuchs unabhängig von ihrem Tauschwert einzurichten!“ heißt es im “Kapital” von Karl Marx. Das könnte man heute leider auch von den vielen Mittelschichts-Paaren sagen, die Kinder in die Welt setzen.
Im Zentralorgan des Waldbauernverbands NRW e.V. “Die Waldbauern” (Heft 3/2013) lautet der Leitartikel: “Stillgelegt kann Wald kein Klima schützen” (nur ein mit Vernunft und Augenmaß abgeholzter – ein Nutzforst also)
Rund um das Mittelmeer wurden die Bäume vor allem für den Schiffsbau gefällt. Auf der kroatischen Insel Mali Losinj gibt es noch heute eine Holzschiffs-Werft. Die Auftraggeber waren einst Piraten, die letzten Kämpfer gegen die Türkenherrschaft, heute sind es meist amerikanische Millionäre. Auf dieser und den anderen adriatischen Inseln haben die Österreicher Anfang des 20. Jahrhunderts angefangen, sie mit immergrünen Eichen und Kiefern wieder aufzuforsten.
Die Seenation England, wo man beim Bau eines einzigen Schlachtschiffes mit 74 Kanonen über 2000 Eichen verarbeitete, ließ alle Eichenbäume auf der Insel zählen und versuchte mit Eichen-Pflanzaktionen ihrer Landbesitzer unabhängig von Fremdwald zu bleiben, zudem galt ihnen ihre wahre Freiheit als im alten Sheerwood Forest beheimatet, wo man zu Zeiten von König Jakob I. noch 23.370 Eichen gezählt hatte – und wohin sich in der Zeit der Rosenkriege die letzten Königstreuen zurückgezogen hatten: Laut dem US-Kulturwissenschaftler Simon Shama entstand diese Robin-Hood-Legende „in der Oberschicht und endete in der Unterschicht” – nachdem die englischen Romantiker den Wald und seinen Helden – den ehemaligen Holzdieb Robin Hood – „als Anwalt der Armen” entdeckt hatten. In Amerika dienten die Wälder dann als immerwährende Regenerationsmöglichkeit für die Zivilisation, als moralische Anstalt gar für Zivilisationsmüde – und -kritiker (von Henry David Thoreau über Ken Kesey bis zum UNA-Bomber Theodore Kaczinski).
Die Herstellung von Zaunpfählen aus Hart- und Weichholz war bereits Thema eines anderen blog-Eintrags: “http://blogs.taz.de/hausmeisterblog/2010/07/17/die_welt_ist_voller_vollpfosten/”. In der Rhön erzählte mir der ehemalige Waldarbeiter und heutige Verleger Peter Engstler, dass er immer ungerne Zaunpfähle hergestellt habe: “Die bringen nichts, weil sie so dünn sind.” Waldarbeiter werden nach Raummetern bezahlt: Zu seiner Zeit bekamen sie 16-20 DM für einen Raummeter – “und schaffen konnte man 5-7 am Tag. Je dünner die Stämme waren, desto länger brauchte man für einen Raummeter.” Deswegen war das Zaunpfählemachen eine “Scheißarbeit”. Die Waldarbeiter bekamen dazu den Bestand im Forst gezeigt, wobei die Stämme entweder vom Förster markiert worden waren oder es sich um Sturmschäden handelte. “Letztere waren am gefährlichsten, aber auch am begehrtesten, weil die meisten Stämme bereits zu Boden gegangen waren. Für die Zaunpfähle wurde Lerche oder Eiche genommen, wobei die Stämme der letzteren dann noch geviertelt werden mußten.“
In der Rhön gehören – ähnlich wie im Erzgebirge – Holzschnitzereien zu den beliebtesten Souvenirs aus der Region. In der nach dem Krieg zunächst verwaisten Rhöner “Kunststation Kleinsassen” hielt die Kasseler Bildhauerin Christine Ermer im Herbst 2007 einen Vortrag über “Die Geschichte der Holzskulptur” – von der Frühzeit bis heute. In den letzten Jahren habe allgemein das Interesse am Holz wieder zugenommen, meinte sie. Besonders gelte das für die Mittelgebirgsregion Rhön, wo die Künstlerin einst selbst als Schnitzerin ausgebildet wurde.
Dort fanden Ende August zwei internationale Holzbildhauer-Symposien statt. Eins im bayrischen Teil des Mittelgebirges auf der Lichtenburg bei Ostheim nannte sich “7 Tage – 7 Stämme”. Das andere im thüringischen Empfertshausen hatte sich heuer den “Artenschutz” als Thema vorgenommen. Es wurde – nun schon zum 7. mal – vom “Rhöner Holzbildhauerverein” ausgerichtet, der mit der “Schnitzschule Empfertshausen”, zusammenarbeitet. Sie ist für dieses Kunsthandwerk die “einzige Ausbildungsstätte in den neuen Bundesländern”. Das andere Symposium – im Westen – organisierte der Bildhauer Jan Polacek, der in den Siebzigerjahren im bayrischen Bischofsheim an der “Berufsfachschule für Holzbildhauer” ausgebildet wurde.
Die beiden Rhön-Schulen gehören zu den ersten ihrer Art, die seit der zweiten Hälfte des 19.Jahrhunderts gegründet wurden, um der Winterbeschäftigung der armen Landbevölkerung in den waldreichen deutschen Mittel- und Hochgebirgen eine Perspektive zu geben. Die Männer hatten bis dahin zumeist Gebrauchsgegenstände wie Löffel, Holzschuhe, Tabakpfeifen und Dreschflegel hergestellt, während die Frauen Hanf, Flachs und Wolle verarbeiteten sowie Stroh verflochten. Beide waren beimVerkauf ihrer Waren auf Hausierer bzw. Großhändler angewiesen – und konkurrierten dabei mit gleichartigen, u.a. in Gefängnissen hergestellten Billigprodukten.
Von der Qualifizierung wenigstens der talentiertesten Jugendlichen erhoffte man sich eine Verbesserung der Lage der Kleinbauern und Knechte in der Rhön. Hüben wie drüben wurden jedoch pro Schuljahr nicht mehr als sechs Schüler aufgenommen. Und auch heute hat z.B. die Bischofsheimer Holzbildhauerschule insgesamt nur 36 Schüler, in Empfertshausen werden derzeit 67 ausgebildet.
Im Sommer 2011 bearbeiteten dort die Holzbildhauer ihre Pappel-Stämme zunächst mit Motorsägen, ebenso die Künstler auf der Lichtenburg oberhalb von Ostheim. In Empfertshausen verweigerte sich jedoch einer dieser Grobtechnik: “Ich bin Schnitzer und kein Waldarbeiter,” meinte er. Der CSU-Landrat von Rhön-Grabfeld, Thomas Habermann, bat dagegen die anwesenden Künstler in seiner Eröffnungsrede, wenn sie schon ihren dicken Pappelstämmen derart effizient zu Leibe rückten, dann doch bitte auch noch gleich die Bäume um die Burg herum zu kappen, damit man die inzwischen teilrekonstruierte Ruine wieder vom Tal, von Ostheim aus, sehen könne. Er schlug damit einen kühnen Bogen von den ehedem nützlichen Holzschnitzereien zum eher zweckfreien heutigen Holzkunstwerk. Ob seiner unökologischen Bemerkung wurde er jedoch vom umweltbewußten Teil der Besucher erst mal gescholten.
In der Ostrhön haben Tierplastiken Tradition: Schon zu DDR-Zeiten, da man die Schnitzschule in eine betriebliche Ausbildung überführte, schnitzte man hier eher “Folkloristisches” als “Religiöses”, was einige im Ort ansässig gewordene Holzbildhauer aber nicht hinderte, z.B. Altarfiguren für den Export – bis in den Vatikan – anzufertigen oder auch Krippen en masse. Bill Clinton wurde bei seinem Deutschlandbesuch ein “Rhön-Paulus” aus der Werkstadt des Empfertshausener Holzschnitzers Manfred Vogel überreicht. Einen Rhön-Bauern mit Ziege schickte man zur Weltausstellung nach Moskau, und die Partnergemeinde in den alten Bundesländern erhielt eine heilige Elisabeth. Auch in der ortsansässigen Fabrik “VEB Rhönkunst” wurde für den Export produziert: u.a. Möbelverzierungen und Garderobenständer für Neckermann und Quelle. Der Betrieb wurde 1990 abgewickelt.
Für die in der Rhön ausgebildeten und dort ansässigen Holzschnitzer stellt sich heute die Existenzfrage sowohl im Westen als auch mittlerweile im Osten gleich viel, ob sie nun Gebrauchsgegenstände, Kinderspielzeug, Schachfiguren, Engel, gediegene bzw. avantgardistische Weltkunst oder – wie im Ersten Weltkrieg – Prothesen produzieren: Sie müssen sich immer wieder an den schwankenden Markt und seine wechselnden Konjunkturen anpassen und hadern dabei mit den Verlegern, Groß- und Kleinhändlern, Galeristen etc..
Heute nehmen die Verstöße gegen das forstliche Verbot des “Raffholz-Sammelns” wieder zu – vor allem weil Kaminholz so teuer geworden ist, dass immer mehr Kaminbesitzer sich ihr Holz in den umliegenden Wäldern zusammenraffen. Ähnliches gilt – im Dezember – auch für Weihnachtsbäume. Es sind meist “Nordmann-Tannen” – ihr Anbau findet laut Wikipedia im Sauerland, in Schleswig-Holstein und Dänemark statt, das allein 10 Mio jährlich exportiert. In Deutschland wurden 2006 etwa 616 Mio Euro für 28 Mio Weihnachtsbäume ausgegeben. “Insbesondere durch zunehmendes Interesse Chinas am Aufkauf deutschen Ertrags an Holz stieg 2007 der Preis des typischen Weihnachstbaums.” Für 28 Mio Nordmann-Tannen braucht man eine Anbaufläche von ca. 40.000 Hektar, wobei man mit einem Schwund von 30 bis 40% – je “nach Betrieb, Pflege und Natureinflüssen” – rechnen muß.
“Der Werdegang vom Samenkorn bis zu einem Zweimeter-Weihnachtsbaum dauert, je nach Pflanzenart, zwischen acht und zwölf Jahre. Samen werden zuerst aus Zapfen älterer Bäume gewonnen. Das Samenkorn wird dann in Baumschulen zum Sämling gezogen und nach drei bis vier Jahren an Forst- und Weihnachtsbaumbetriebe als Jungpflanzen verkauft.”
Außerhalb der Weihnachtszeit braucht man u.a. für Zeitungen viele Bäume. Allein die Wochenendausgabe der New York Times verschlingt jede Woche einen ganzen Wald. Der kümmerliche ostelbische Nadelwald, in Reih und Glied meist gepflanzt, wurde zu DDR-Zeiten vielfach für Exportmöbel, für Quelle und Neckermann z.B., verarbeitet, nach der Wende entstanden in Brandenburg mehrere Fabriken, die den Wald nun zerschreddern, um daraus Spanplatten zu pressen. Im Vogelsberg und in der Rhön, der einstigen “Buchonia”, werden die großen Buchen vor allem zu Furnierholz verarbeitet.
Es gibt oder gab in Kanada einen Holzfäller, der an seiner Arbeit irre wurde, wenn man so sagen darf: Grant Hadwin aus British Columbia. Der Schriftsteller John Vaillant aus Vancouver hat über ihn ein Buch geschrieben: “Am Ende der Wildnis” (2013)
Klappentext: “Der Waldarbeiter Grant Hadwin macht sich in einer Winternacht 1997 mit seiner Motorsäge auf den Weg, um einen einzigartigen, jahrhundertealten Baum, die dort berühmte, gelbnadlige “Goldene Fichte”, zu fällen und so ein Zeichen zu setzen gegen den Wahn, der die letzten Urwälder der Erde auszulöschen droht. Seine Tat macht ihn zu einem der meistgesuchten Männer Kanadas. Danach verschwindet er. Ein Kajak, angespült am Strand einer unbewohnten Insel vor der Küste, und ein Bekennerschreiben: Mehr läßt er nicht zurück. Bis heute fehlt von ihm jede Spur.”
In Hadwins Bekennerschreiben an die “Verantwortlichen” heißt es: “Ich hatte keine Freude daran, diese großartige alte Pflanze niederzumetzeln, aber Sie brauchen offenbar diese Botschaft und einen Weckruf, den sogar an der Universität ausgebildete Fachleute verstehen dürften…”
In den Siebzigerjahren zog der “Merry Pranksters”-Gründer und Autor von “Einer flog über das Kuckucksnest” – Ken Kesey nach Oregon aufs Land, wo er eine kleine Landwirtschaft betrieb und seinen Roman “Manchmal ein großes Verlangen” schrieb, der von einer Holzfäller-Sippe in Oregon handelt. Auch dieses Buch wurde verfilmt, dazu heißt es im Klappentext:
“Henry Stamper ist das Oberhaupt einer rauen Holzfällerfamilie. Er lässt sich von niemandem Vorschriften machen, sein Sohn Hank bestärkt ihn noch darin. Aus Starrköpfigkeit und Geschäftssinn stellen sich die Stampers gegen die Beschlüsse der Holzfäller-Gewerkschaft und sabotieren einen Streik. Massive Drohungen der Streikenden beeindrucken sie in keiner Weise. Da kehrt plötzlich Hanks Halbbruder Lee nach Hause zurück. Er hat sich in New York als College-Student schwer getan und will offenbar einen neuen Anfang machen. In der Familie wirkt der sensible junge Mann wie ein Fremdkörper, nur Hanks Frau Viv findet rasch Kontakt zu ihm. Die Auseinandersetzung mit den streikenden Gewerkschaftsmitgliedern spitzt sich bald dramatisch zu…Dieses zweifach Oscar nominierte Sozialdrama setzte Hauptdarsteller und Produzent Paul Newman nach dem Roman “Manchmal ein großes Verlangen” von Ken Kesey in Szene. Gedreht in den wilden Felsenschluchten des Columbia in Oregon, packt die prominent besetzte Geschichte der Holzfäller-Familie, deren einsame Entscheidungen ins Unglück führen, von Beginn an.”
Ich fand als Kind die Holzfäller im Wald, der gleich hinter “unserem” Moor begann, ebenfalls ziemlich “packend”, und auch wenn ich oft und gerne auf Kiefern kletterte, deren wendelttreppenartiger Astwuchs zum Hochklettern geradezu einlud, hackte ich gleichzeitig doch auch gerne auf unserem Grundstück die kleinen Birken mit dem Beil um, sofern ihre Stämme dünner als etwa 5 Zentimeter waren und die, wie ich in meiner gestalterischen Strenge fand, nicht dorthin gehörten, wo sie wuchsen. Mein Vater mißbilligte das, er richtete sogar vom Sturm auf dem weichen Moorboden umgerissene Kiefern wieder auf und sicherte sie mit Stahlseilen. Irgendwann hörte ich von selbst auf – mit meiner spießigen “Gartengestaltung”. Mein Vater schaffte sich eine Stihl-Motorsäge an, für die er extra einen Tragekasten aus Holz baute, den er rot lackierte. Er sah auch wie ein Gewehrkoffer aus. Mit der Motorsäge fällte er jedoch nur die Hochsitze der Jäger rund um das “Radmoor”, wo wir wohnten.
Ansonsten machte er mit der Motorsäge aus bereits gefällten Fichtenstämmen im nahen Forst “Schmidts Kiefern” Feuerholz für den Kamin. Die Stämme ließ der Förster fällen und wir zogen sie anschließend mit zwei Kaltblut-Pferden des Nachbarn aus dem Wald und an den Wegrand, von dort transportierte mein Vater sie mit der Motorsäge in Stücke gesägt mit der Schubkarre nach Hause, wo er sie mit Handsäge und Beil weiter in Scheite verkleinerte, die durch die Ofenklappe paßten. Erst einmal wurden sie jedoch zum Trocknen ans Haus unter das überhängende Dach gestapelt. Als er über 90 wurde, heuerte er zwei junge Männer, Rußlanddeutsche, an, deren Feuerholz-Zubereitung er fortan mit einer Mischung aus Neid und Verachtung zusah: Neid, weil sie so forsch ans Werk gingen und in Nullkommanichts die Stämme zersägten und zerhackten, und Verachtung, weil sie sich derart ins Zeug legten, obwohl sie einen Stunden- und keinen Akkordlohn verabredet hatten. Einmal betätigte er sich sogar als Waldretter: Das war als die US-Armee hinter “unserem” Wald, “Schmidts Kiefern” genannt, ihren Schießplatz ausbaute und eine Eisenbahntrasse für den Munitionstransport quer durch den Wald dorthin plante. Es bildete sich eine Bürgerinitiative dagegen – und die wählte meinen Vater, weil er Professor war, zu ihrem Sprecher, obwohl er wenig redegewandt und ziemlich auftrittsscheu war. Als die Kunsthochschule, wo er angestellt war, ihn gefragt hatte, ob er sich fürderhin Professor nennen wolle, hatte er “nein” angestrichen, aber in Bürgerinitiativen sind oft “Experten” gefragt und seien es auch nur solche, die einen expertenversprechenden Titel haben oder tragen dürfen. Immerhin: die Trasse wurde nicht durch den Wald geschlagen.
Nach meinen Jugendsünden habe ich in den Achtzigerjahren noch einmal monatelang mit einer Axt gearbeitet. Das war bei Freunden in der Toskana, wo wir einige überwucherte Terrassenfelder wieder frei schlugen, um daraus eine Pferde- und Schafweide zu machen. Wir fällten jedoch keine Bäume, sondern hackten Sträucher und Dornengestüpp ab – macchia (Buschwald). Die Landschaft dort zwischen Florenz und Arezzo war einmal eine ganz Besondere gewesen: Sie wurde von Edelkastanienbäumen (Castanea sativa) dominiert, die so hoch wuchsen, dass unter ihnen Vieh geweidet werden konnte.
“Vom Mittelalter bis gegen Ende des 19. Jahrhunderts war die Edelkastanie in den Bergregionen Südeuropas das Hauptnahrungsmittel der Landbevölkerung,” heißt es auf Wikipedia. Fast jeder Bauernhof dort besaß in den Achtzigerjahren noch Scheunen zum Trocknen und Lagern sowie Vorrichtungen und Geräte zum Weiterverarbeiten der Eßkastanien. Sie wurden zwar großteils nicht mehr genutzt, dennoch gab es zur Erntezeit überall Eßkastanien (Maronen) in jedweglicher Zubereitungsart. Man bekam sie nach einiger Zeit über.
Einige große Edelkastanienbäume gibt es immer noch hier und da, sie stehen alle unter Naturschutz, was jedoch nicht verhindern kann, dass immer mal wieder einer gefällt wird. Es ist begehrtes Bauholz. Wikipedia schreibt: “Es hat einen warmen, goldbraunen Ton. Verglichen mit Eichenholz fehlen Markstrahlen, so dass die Maserung nicht so stark ausgebildet ist. Es ist leicht zu bearbeiten und im Freien auch ohne chemische Behandlung weitgehend witterungs- und fäulnisbeständig. Da der Faserverlauf meist gerade ist, kann es verhältnismäßig gut gebogen werden.Es nimmt Politur, Beizen, Lack und Farbe gut an.”
Nachdem man mir 1980 nach einem Sturz im Krankenhaus von Arezzo meinen Daumen operiert hatte, mußte ich eine Weile wöchentlich zur Nachuntersuchung – immer bei der selben medizinischen Assistentin, Sophia, der einzigen im Krankenhaus, die meinen Namen kannte. In der kommunistisch regierten Toskana interessierte es niemanden in den staatlichen Krankenhäusern, ob man versichert war und wie man überhaupt hieß. Einmal fragte ich Sophia entsetzt, was es mit den vielen Männern auf dem Hof und in den Fluren des Krankenhauses auf sich habe, die alle mit vergipsten oder verbundenen Körperteilen herumliefen. “Die Motorsägen-Saison hat angefangen,” meinte sie nur.
Bei den Pfadfindern verdienten wir uns auf Wanderungen gelegentlich Geld fürs Essen, indem wir uns tageweise bei Förstern verdingten, wo wir den sogenannten “Kulturfrauen” halfen, junge Fichten in Schonungen anzupflanzen. “Die Männer fällen die Bäume, wir Frauen pflanzen sie,” erklärten sie uns.
Die Wälder, in denen wir ihnen arbeiteten, gehörten meist noch dem Adel, der bis zur Wende vor allem durch Manöverschäden in seinen Forsten, verursacht von US-Panzern und der Bundeswehr, Geld an seinen Forsten verdiente.
Auch der Verband der Waldbesitzer und die Treuhandnachfolgeorganisation Bodenverwertungs- und Verwaltungs GmbH Berlin (BVVG), die das Acker- und Weideland sowie die Wälder der DDR privatisieren soll – wird quasi vom deutschen Adel dominiert. Deswegen gibt es immer wieder Klagen von Ostdeutschen über die Bevorzugung von Adligen bei Forstverkäufen.
Als in der DDR die Bodenreform durchgeführt wurde, wobei man vor allem die riesigen Ländereien der meist reaktionären preußischen Junger unter den “Umsiedlern” und “Landlosen!” aufteilte, bekamen diese auch kleine Waldabschnitte überschrieben. Noch heute gibt es hier und da solche proletarischen Waldbesitzer auf dem Territorium der DDR. Und man muß einmal an einer Versammlung gewesen sein, in der diese einst Bodenreform-Begünstigten sich zu Wort melden. Sie sind geradezu verliebt in ihren kleinen Waldbesitz
Während die adligen Waldbesitzer ihre Forste vor allem “effizient bewirtschaften” (wollen) – dazu ein Beispiel aus Büdingen/Hessen, von einer Internetseite übernommen:
“Der Fürst von Ysenburg dort hat den Kleinbauern aus der Gegend Arbeit gegeben: im 10.000 Hektar großen Forst. Im Sägewerk. In der Keramikfabrik in Schlierbach. Im Basaltsteinbruch. In der fürstlichen Brauerei in Wächtersbach. In der Möbelfabrik in Eisenhammer. In der Gärtnerei in Büdingen, der Pflanzenzuchtstation in Wächtersbach, wo die eigenen Waldbäume gepäppelt wurden, ehe sie Frauen aus der Gegend gepflanzt haben: „Wir gehen auf die Schanz”, hieß das damals.
”Mitte der Fünfziger hat auch der Leisenwalder beim Fürsten angeheuert. Damals hatten Stürme weite Waldflächen umgefegt. „Zwischen Gettenbach und Wittgenborn hat alles dagelegen.” 600 Mann aus der Umgebung schufteten Tag für Tag im Wald. Sogar eine Arbeitskolonne aus Österreich wurde eingesetzt. „Damals hat der Fürst gewaltige Summen mit dem Holz erwirtschaftet.” Und heute? Alles dahin. Der Forstbetrieb in Konkurs, das Fürstenhaus pleite.
Der Abstieg zeichnet sich seit Jahren ab. Die Brauerei ist längst verkauft und stillgelegt, bald sollen Wohnungen auf dem Gelände entstehen. Die Möbelfabrik ist geschlossen, seit Januar auch „die Keramik” in Konkurs. Immerhin 250 der einst 300 Arbeitsplätze scheinen fürs Erste gesichert. „Trotzdem haben die Leute Angst, wie’s weiter geht”, sagt die Leisenwalderin. Viel zu holen scheint nicht mehr: Die Schlösser, Gutshöfe und Anwesen hat die klamme Fürstenfamilie schon verscherbelt oder sie verfallen langsam. Verkauft sind kostbare Roentgen-Möbel und Bibliotheksbestände aus dem Büdinger Schloß, auf dem gleichfalls ein Berg von fünf Millionen Euro Schulden lasten soll.
Wie der millionenschwere Besitz binnen weniger Jahren zerrinnen konnte? Wolfgang Ernst zu Ysenburg Büdingen gibt „keine Stellungnahmen dazu ab”, heißt es im fürstlichen Sekretariat. Gleiches ist auch vom Anwalt der Familie zu hören. Und die, die Näheres wissen müßten, mögen zumindest öffentlich nichts sagen: langjährige Leiter des Forstbetriebs oder des Archivs, Leiter der Rentkammer, der Verwaltungszentrale für alle fürstlichen Unternehmen. Über die Fürstenfamilie spricht man nicht – zumindest nicht namentlich in der Öffentlichkeit. Obwohl man sich natürlich viel erzählt, zig Erklärungen liefert: großspuriger Lebensstil, Fehlinvestitionen im Osten, glücklose Geschäfte in Südamerika, Fehlspekulationen.”
In einem Aufsatz über „Wald und Gesellschaft“ schrieb Cord Riechelmann: „Die Waldungen lassen sich, wenn man sie nicht vernichten will, nicht privatisieren oder in anderer Form in die Geld- und Warenzirkulation einspeisen. Daraus spricht auch eine radikale Kritik jedes Nachhaltigkeitskonzeptes. Aktuell ist das nicht nur, weil der Begriff der Nachhaltigkeit schon zu Marx’ Zeiten in der Forstwirtschaft diskutiert wurde, sondern auch, weil sich seitdem, wenn von Nachhaltigkeit geredet wird, wenig geändert hat. „Nachhaltige Holzproduktion“ heißt immer, den Wald den Gesetzen des Marktes zu unterwerfen.
Der Wald kann niemandem gehören. Den Wald kann man verstehen lernen, aber nicht beherrschen. Wenn man ihn beherrschen will, zwingt man den Wald aus seiner Zeit und damit in die Zerstörung.
Wenn etwa der bayerische Staat den Klimaschutz zu seinen Regierungszielen erklärt und gleichzeitig seinen Waldbesitz privatisiert, um den Staatshaushalt zu sanieren, ist das schlicht Blödsinn. Genauso wie es lächerlich ist, wenn Günther Jauch und Krombacher behaupten, man könne mit dem Erwerb von einem Kasten Bier irgendeinen Quadratmeter Regenwald retten, weil Krombacher mit dem Geld ein Stück Regenwald kauft und so schützt. Jeder Quadratmeter Regenwald in Besitz von irgend jemandem ist kein Regenwald mehr, sondern toter Wald.“
Aber auch tote Baumstümpfe sind zuletzt noch zu etwas gut: für Proxi-Daten – z.B. in der Klimaforschung, in der es bei ihrem höchsten Gremium, dem IPCC – “Intergovernmental Panel on Climate Change” – zu einem “Climategate” kam. Dabei ging es um Temperaturkurven aus Proxydaten. Ein “Klimaproxy” (englisch proxy “Stellvertreter”) ist ein indirekter Anzeiger des Klimas, der in natürlichen Archiven wie Baumringen, Stalagmiten, Eisbohrkernen, Korallen, See- oder Ozeansedimenten, Pollen oder menschlichen Archiven wie historischen Aufzeichnungen oder Tagebüchern zu finden ist. Das IPCC hatte einerseits Proxydaten, die aus Baumringdaten seit dem Jahr 1000 bestanden, und andererseits Thermometerdaten aus den letzten Jahrzehnten benutzt. Um die Temperaturentwicklung in dieser Zeit “als absolut ungewöhnlich im Lichte historischer Zustände” zu beschreiben, störte die Inkonsistenz der Proxydaten mit den Thermometerdaten,” schreiben Hans von Storch und Werner Krauß, beide am Institut für Küstenforschung am Helmholtz-Zentrum Geesthacht beschäftigt – der eine als Klimaforscher und der andere als Ethnologe, in ihrem Buch “Die Klimafalle – Die gefährliche Nähe von Politik und Klimaforschung”. Anfänglich “klebte” man die Kurven aus den beiden unterschiedlichen Quellen einfach zusammen. Gegen einen solchen “Trick” ist wenig zu sagen,”solange klar ist, dass hier Zahlen mit sehr verschiedener Zuverlässigkeit eingesetzt werden.” Im Laufe der Zeit wurde “aus den beiden Kurven jedoch stillschweigend eine Kurve.”
Zum “Climagate” wurde dies, zusammen mit Interna der beteiligten Forscher, als jemand heimlich ihre E-Mails veröffentlichte. Da war das Klima aber schon aus einem kleinen Forschungsthema zu einem großen politischen Thema – zu einem Weltproblem gar – geworden. Und Linke wie Rechte verausgabten sich in “Klimadebatten”, man sprach von “Klimaschützern” und “Klimasündern”. “Immer mehr gesellschaftliche Konflikte, Mängel und Schwierigkeiten werden nun als Klimaprobleme markiert.” Und Bücher über das Klima füllen in den Buchläden inzwischen ganze Regale. Wobei das Klima als Statistik des Wetters auch noch einmal reduziert wurde, “auf seine Veränderlichkeit, seine Dynamik, Vorhersagbarkeit und die Abhängigkeit von äußeren Antrieben (wie Treibhausgase, Sonnenleistung u.Ä.),” schreiben die Autoren. Besonders unangenehm stößt ihnen der Chef des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK), Hans Joachim Schellnhuber, auf. Der “Klimaberater der Bundeskanzlerin Merkel konnte sogar im Wetterbericht im Anschluss an die ‘Tagesschau’ die Bevölkerung auf die Gefahr des Klimawandels hinweisen. Er wird gern in nachdenklicher Pose gezeigt, mit der Hand auf die Erdkugel in seinem Büro gestützt.” Der “Alarmist” und “Gaia”-Anhänger Schellnhuber sagt Sätze wie: “Gelingt die Abgas-Trendwende bis 2020 nicht, dann dürfte eine Erderwärmung mit verheerenden Folgen, etwa dem Abschmelzen des Grönland-Eisschildes und dem Kollaps des Amazonas-Regenwaldes, kaum noch zu vermeiden sein.” Die FAZ kritisierte ihn gerade vorsichtig, indem sie eine neue Simulationsstudie von britischen, amerikanischen und brasilianischen Forschern erwähnte, die darin zu dem Ergebnis gekommen waren: “Der Schaden für die Regenwälder dürfte bis zum Jahr 2100 deutlich geringer sein, als frühere Studien vermuten lassen.” Der Klimastreit geht munter weiter.
Wobei sich die Klimaforscher zunehmend als Teil der sogenannten “Erdsystemwissenschaften” verstehen. Mit ihren Powerpoint-Vorträgen schaffen sie zugleich eine „Ikonographie des Planeten Erde”. Das erste Farbphoto von “Unserem blauen Planeten” stammt von der “Apollo-Mission” der Amerikaner 1972. 1982 hieß ein Album der Rockgruppe Karat so und 2001 eine ganze BBC-Serie. Inzwischen begreift man unseren blauen Planten mit dem Nasa-Geochemiker James Lovelock als “Gaia”. Seine Hypothese besagt, dass die Erde und ihre Biosphäre ein lebender Organismus ist, bei dem die Bakterien eine wesentliche Rolle spielen. Kurz nach der “Gaia-Hypothese” kam der “Whole Earth Catalogue” von Stewart Brand, der mit Lovelock befreundet ist, auf den Weltmarkt. Der “Catalogue” war 2013 Thema im “Anthropozän-Projekt” des Berliner HKW – Haus der Kulturen der Welt. Aber nicht erst seit diesem “Event” machen sich alle möglichen Wichtigtuer Gedanken um “die ganze Erde” – um sie zu retten. Dabei könnten sie noch nicht einmal die halbe Straße, auf einer Straßenseite nur, bessern, also lebenswerter machen.
Der Luzerner Wissenschaftsforscher Christoph Hoffmann hat sich in seinem Buch über „Die Arbeit der Wissenschaften“ auch mit der Klimaforschung befaßt: Mit dem Wissenschaftssoziologen Peter Weingart ist er sich einig, dass die Glaubwürdigkeit der Wissenschaft weder auf „überzogenenen Katastrophenwarnungen“ noch auf „Verheißungen paradiesischer Zustände“ beruht, „sondern vielmehr auf der Demonstration der Schwierigkeiten des Wissenserwerbs, der Diskussion widerstreitender Theorien und Interpretationen von Beobachtungen sowie der Offenlegung von Ungewissheiten.“ Darüberhinaus müßte auch deutlich werden, so Hoffmann, „was einen Stand der Forschung in den Wissenschaften charakterisiert (warum er z.B. Interpretationen zuläßt), wie dieser Stand jeweils ermittelt worden ist und wie wiederum die Einsichten, die in diesem Stand der Forschung Berücksichtigung gefunden haben, zustande kommen, welche Schwierigkeiten es z.B. macht, aus Baumringen, Eisbohrkernen oder Wetterdiarien des 17. Jhds. Temperaturreihen zu konstruieren.“
Klimaforschung und Baumschutz heißt heute anscheinend vor allem rechnen – also vorm Computer sitzen wie der letzte bescheuerte Büroangestellte und auf die Tastatur hämmern. So schreibt z.B. der Berliner Zoo in seiner Zeitschrift “Bongo”:
“Da es um die Sicherheit für die Besucher und den Erhalt des wertvollen Baumbestandes geht, haben wir uns 2006 entschieden, ein Baumkataster einzurichten. Dazu wird das Computerprogramm Baum G5 der Datenbankgesellschaft mbH benutzt. Nach Installation des Programms in einem PC wird ein in der Baumkunde erfahrener Landschaftsgärtner in das Programm eingewiesen. Eine Schulung des Gärtners im Umgang mit einem mobilen PC zur effektiven Baumerfassung vor Ort erfolgt ebenfalls…Die eindeutige Numerierung eines jeden Baumes ist dabei besonders wichtig…”
Der Ökologe und Naturfilmer Horst Stern hat 1979 einen Film über den deutschen Wald gedreht – nachdem Bundeskanzler Helmut Schmidt mit einem Flugzeug über Deutschland geflogen war und anschließend gemeint hatte, das Land zwischen Schleswig-Holstein und Bayern bestehe ja immer noch aus riesigen Wäldern. Horst Stern wies ihm daraufhin nach, dass der Eindruck täusche: 1. seien das zu großen Teilen erbärmliche Nutzholz-Anpflanzungen und 2. seien diese alles andere als gesund.
Wenig später veröffentlichte Horst Stern seine TV-Recherchen als Buch: “Rettet den Wald”. Anläßlich einer Neuauflage schrieb der SWR: “Durch den Bau neuer Siedlungen, Industrieanlagen oder Straßen werde der deutsche Wald, so Stern, immer weniger. Aufgrund der zunehmenden Luftverschmutzung gebe es außerdem kaum mehr einen Baum ohne chronische Giftschäden. Und drittens werde aus dem deutschen Mischwald immer stärker ein Nadelwald, der für den Forstwirt sehr viel lukrativer ist. Damit gerate aber das ökologische Gleichgewicht durcheinander…”
1980 hatte man gerade das Wort “Waldsterben” erfunden, 1984 hieß ein gründlicher Waldbericht aus dem Focus Verlag Gießen bereits: “Er war einmal. Der deutsche Abschied vom Wald“. Das “Waldsterben” wurde dann zum emotionalen Hintergrund für die “German Angst”, denn die Deutschen sind ein altes germanisches “Waldvolk”. Als es überall auf der Welt schon Hochkulturen gab, lebte man hier quasi noch auf Bäumen. Wie der taz-Redakteur Christian Semler meinte, verschob sich dann auch noch durch den unseligen Sieg des “Verräters” Hermann der Cherusker über die Truppen des römischen Feldherrn Varus die Zivilisierung der Germanen durch die römische Kultur noch einmal um 500 Jahre. Und dann kam auch noch zwei mal ein germanischer Rückfall: Einmal Anfang des 19. Jhds. im Widerstand gegen Napoleon und dann mit den Nationalsozialisten, die die strengsten Wald- und Wildschutz-Gesetze verabschiedeten, auf den Abschuß eines Adlers stand die Todesstrafe, auf Wilderei KZ – und von da aus Zwangsverpflichtung in der Partisanenbekämpfungs-Einheit des Dr.Dirlewanger. Es war ein WAldkampf”, denn die Partisanen versteckten sich meistens im Wald. Nach 1945 versteckten sich auch Deutsche in den Wäldern, wo sie sich zu antikommunistischen Partisanengruppen zusammenfanden. Erst in den Fünfzigerjahren gelang der Roten Armee die Liquidierung dieser letzten “Waldmenschen”, wie die illegalen Deutschen in Litauen hießen, ihre Jungen nannte man “Wolfskinder”.
Vielleicht kann man sagen, dass der Bundesbürger sogar noch heute erst im Deutschen Wald ganz bei sich ist. Nicht zufällig zeigen die meisten Urlaubsphotos in meiner Dia-Sammlung Wald – wie man in diesem Eintrag sehen kann. In Rußland geschah der Anschluß der dortigen Waldbauern an die Zivilisation noch später als der der germanischen – durch die Eisenbahn nämlich erst. Man spricht dort vom “Eisen”, mit dem die ersten zivilisatorischen Schneisen in die russische Kultur des “Holzes” geschlagen wurden. Noch jetzt hat man dort, vor allem in Sibirien, ein anderes Verhältnis zum Wald – zur Taiga. In Irkutsk z.B. stellt die Eisenbahngesellschaft jeden Sommer mehrere Dutzend Waggons für einige Monate in den Wäldern ab, damit die Irkutsker, die keine Datsche haben, in dieser Zeit, da sie dort in den Seen baden, Blaubeeren und Pilze sammeln und vielleicht auch jagen bzw. wildern, eine Unterkunft haben.
Eine Steglitzer Baumliebhaberin: “Am schlimmsten sind die städtischen Motorsägen-Brigaden, nicht selten technikaffine Ex-Arbeitslose, die mit einer Maschine zusätzlich anrücken, die alle Äste, Zweige und Stammteile sogleich in Holzschnitzel zerkleinert, die man neuerdings gerne zum Mulchen von Beeten benutzt, was sie eine tolle Sache finden.Und dann haben sie neuerdings auch noch immer sogenannte ‘Laubbläser’ mit, die einen höllischen Lärm machen, damit blasen sie die herumliegenden Blätter und kleinen Zweige nach dem Fällen zusammen.”
In der taz ballt sich auch gerade Unmut über den Laubbläser der Putzfirma zusammen, sie fällt keine Bäume, sondern “putzt” mit dem Laubbläser den Hof, der eigentlich mit einem Besen sauber gemacht werden soll einmal die Woche. In den USA tobt derzeit bereits ein richtiggehender Laubbläser-Krieg. Ich erfuhr davon in dem Buch von Geert Mak “Amerika”, der dortige “Laubbläserkrieg” tobt vor allem in den grünen amerikanischen Vororten – mit Bürgerinitiativen gegen den Lärm, den diese Maschinen machen und ihren mexikanischen Bedienern, die um ihren Job fürchten. Auch in Berlin, vor allem in Steglitz und Pankow, droht ein solcher “Laubbläserkrieg”.
Der Spiegel berichtete am 16.9.2013: Treibstoff zum Draufhauen. Baumfällen kurbelt bei Männern die Testosteronproduktion stärker an als aggressionsgeladener Gruppensport. Bei einer Studie mit Tsimane-Ureinwohnern im bolivianischen Amazonasgebiet haben Anthropologen von der University of California in Santa Barbara festgestellt, dass Speichelproben der indigenen Baumfäller nach einer Stunde schweißtreibender Rodungsarbeit fast 50 Prozent mehr Männlichkeitshormon enthielten als vor der Plackerei. Dagegen nahm der Testosteronwert der Indiomänner durch Fußballspielen nur um 30 Prozent zu. Offenbar spiele das männliche Geschlechtshormon beim körpereigenen Muskeldoping eine größere Rolle als bisher vermutet, schreiben die Forscher in der Online-Ausgabe des Wissenschaftsblatts “Evolution and Human Behavior”. Statt nur Aggressions- und Konkurrenzverhalten anzustacheln, sei Testosteron in der Entwicklungsgeschichte des Menschen offenbar der Schlüssel gewesen, bei der Urbarmachung der Natur aus vergleichsweise wenig Muskelmasse ein Maximum an Kraft und Ausdauer herauszuholen.
Dazu paßt vielleicht eine “Kulturgeschichte des Holzes”, die der Autor Lars Mytting unter dem Titel “Der Mann und das Holz – Vom Fällen, Hacken und Feuermachen” veröffentlichte. In einem Frankfurter Buchladen lag dieses Buch nebenbeibemerkt neben einer Ausgabe der Zeitschrift “Beef. Für Männer mit Geschmack”.
Für Männer (Nerds), die zum Baumfällen nicht extra vom Computer weggehen wollen, empfiehlt sich der Landwirtschafts Simulator 2015 – “mit dem man auch Forstwirtschaft betreiben kann. Giant Software zeigt entsprechende Spielszenen, in denen man sieht, wie man Bäume mit einer Motorsäge fällt und kleinhackt. Es lassen sich auch neue Bäume anpflanzen.”
Millicent Dillon schrieb in “Lauter kleine Lügen” (1981) – einer Biographie der Schriftstellerin Jane Bowles, die mit ihrem Mann, Paul Bowles, in Tanger lebte:
“1956 beteiligte sich Jane sogar an einem öffentlichen Protest – der einzige politische Akt ihres Lebens. Als die neue [marokkanische] Verwaltung von Tanger beschloß, die großen Bäume zu fällen, die die Franzosen am Grand Socco gepflanzt hatten, startete Jane eine Unterschriftenaktion bei ihren Freunden, mit dem Ziel, die Bäume zu erhalten. Die Aktion mißlang – was niemanden überraschte.”
Der Geobotaniker Christoph Leuschner schreibt:
“Die moderne Biodiversitätsforschung hat auf der Erde drei Lebensräume als herausragende »weiße Flecken« auf der Karte der Artenvielfalt erkannt, in denen besonders viele Neuentdeckungen zu erwarten sind und deren Erforschung prioritär ist. Der Lebensraum Boden mit einer Vielzahl unbekannter Bakterien, Pilze sowie niederer Pflanzen und Tiere. Eine ungeheure, noch nicht entdeckte Artenfülle wird auch im Lebensraum Tiefsee vermutet, der erst in jüngster Zeit mit neuen Techniken systematisch erforscht werden kann. Überraschen mag dagegen unser geringes Wissen über die Biodiversität der Baumkronen tropischer, aber auch heimischer Wälder. In den Kronen tropischer Wälder wurden in den letzten Jahren weit mehr Insektenarten für die Wissenschaft neu entdeckt als in jedem anderen Lebensraum der Erde. Wälder bedecken von Natur aus rund ein Drittel der Festländer der Erde. Flächenmäßig am bebedeutendsten waren die tropischsubtropischen Feuchtwälder mit ursprünglich rund 17 Millionen Quadratkilometern, gefolgt von den borealen Nadelwäldern des Nordens (rund 12 Mio. km2). Die uns so vertrauten kühlgemäßigten Laubmischwälder haben einst rund sieben Millionen km2 eingenommen, wurden aber im Laufe der Menschheitgeschichte auf einen Bruchteil dessen reduziert. Die Wälder der Erde werden von schätzungsweise 30 bis 50 Tausend Baumarten aufgebaut, die in unterschiedlichen Artendichten (das heißt Artenzahlen pro Fläche) in den heißen, gemäßigten und kalten Breiten auftreten. Die Baumartenvielfalt erhöht sich von den kalten zu den heißen Regionen: Boreale (den nördlichen Klimagebieten zugerechnete) Nadelwälder etwa in Schweden oder Sibirien werden meist nur von ein bis höchstens vier Baumarten aufgebaut. Wälder der feuchten Tropen können dagegen bis zu 300 verschiedene Baumarten auf einem einzigen Hektar (100 x 100 m) beherbergen. Das bedeutet, dass beinahe jeder Stamm im Wald zu einer anderen Art gehört und Individuen derselben Art oft in großer Entfernung zueinander stehen. Unsere heimischen Laubwälder ähneln hinsichtlich ihrer Artenvielfalt viel mehr den artenarmen nordischen Nadelwäldern.”
.

Banyan-Baumgruppe
.
Baum-Nachrichten:
– „1000 Bäume für Köln“: Unter diesem Motto haben die Kölner Grünstiftung und die Stadt Köln im Juni eine Spendenaktion gestartet mit dem Ziel, mehr Bäume an Kölner Straßen zu pflanzen.
– “Die Stadt Essen fällt 1000 kranke “Risiko-Bäume”: Kastanien, Pappeln und Platanen zählen zu den Sorgenkindern, denn Pilzerkrankungen setzen den Bäumen arg zu. 1000 Stämme müssen deshalb in den kommenden Monaten weichen.
Anderswo geht man etwas sensibler mit der “vegetativen Möblierung” um – so hat man z.B. in Bozen ein ganzes Museum um einen Mammutbaum herum geplant.
Ansonsten vergeht kein Tag, an dem nicht mindestens ein Autofahrer einen Baum rammt. Die Autos gefährdenden Bäume am Straßenrand waren Jahrzehnte Gegenstand heftiger Debatten in Westdeutschland – viele konnten sich “autogerechte” Bundesstraßen nur ohne Bäume denken. In den ersten Jahrzehnten der Automobilisierung verzeichneten – mindestens die Schweizer und die Österreichischen Statistiken – noch weitaus mehr Unfälle durch Bäume als durch Autos, bei denen Menschen zu Schaden kamen. Das hat sich schon lange umgekehrt. Im übrigen gibt man heute eher den Autofahrern als den Bäumen die Schuld, wenn diese jene rammen. In Bombay gibt es einen großen Baum, der mitten auf einer vielbefahrenen Straße steht, er ist von einer ein Meter hohen Steinmauer umgeben – und die ist auch nötig, denn andauernd fährt jemand dagegen. Viele waren schließlich dafür, diesen großen, schönen Baum, der buchstäblich im Weg steht, endlich zu beseitigen, aber der Polizeipräsident sprach ein Machtwort: “Der bleibt, es fahren doch bloß Betrunkene dagegen.”
Speziell um den Erhalt der deutschen Alleebäume kämpft die Vereinigung der deutschen Landesdenkmalpfleger. In ihrem Bericht Nr.8 druckten sie einen “Alleenerlaß” aus dem Jahr 1841 ab, in dem der preußische König sich beklagte, dass so viele Alleebäume überflüssigerweise bei Straßenbaumaßnahmen gefällt werden. Er befahl deswegen, “daß Lichten und Aushauen prachtvoller Alleen künftig zu unterlassen”. Die Landesdenkmalpfleger merkten dazu an: “Möge das königliche Vorbild, welches offensichtlich im 19. und frühen 20. Jahrhundert Schlimmeres verhindert hat, Richtschnur auch für das 21. Jahrhundert sein.”
Weil die Sowjetunion in den Zwanzigerjahren dringend Devisen brauchte, um Maschinen für ihre Industrialisierung im Ausland zu kaufen, exportierte sie in Größenordnungen Holz, das zunehmend von Zwangsarbeitern in diversen Waldlagern geschlagen wurde. Ende der Zwanzigerjahre verhinderte die Sowjetunion angeblich sogar einmal einen Streik von Londoner Hafenarbeitern, weil dadurch ihre Holzschiffe nicht rechtzeitig entladen werden konnten. Ein anderer Konflikt von streikenden deutschen Seeleuten auf Holzfrachtern – in Leningrad und Odessa Anfang der Dreißigerjahre schildert Gerd Wendt auf: “www.ubbo-emmius-gesellschaft.de/StreikSeeleute.pdf”.
Zu den einstigen GULAG-Häftlingen gehörte die sowjetische Schriftstellerin Jewgenija Semjonowna Ginsburg, sie schrieb darüber heimlich zwei Bücher – anfänglich noch in der Magadan-Zone, wo sie zunächst in einem Frauen-Außenlager von Kolyma Bäume gefällt hatte: Marschroute eines Lebens und Gratwanderung. An einer Stelle behauptet sie darin, dass die Bolschewisten nicht nur riesige Wälder vernichtet hätten, sondern u.a. auch die “berühmte Nachtigallen-Schule von Saratow” – durch Abholzen aller hohen Buchen in der Gegend.
1995 sah ein Vertrag zwischen der Dresdner Bank und einer Uralbank in Perm eine Transfersumme in Höhe von 470 Mio DM vor, den die russische Seite u.a. mit Papier und Furnierholz zahlen sollte. Und die Treuhandanstalt wies in einer Pressemitteilung Ende 1994 darauf hin, dass es dort um Perm ein großes “Investitionspotential für folgende Ressourcen” gäbe: “Edelsteine, Gold, Erdöl, das praktisch überall dort vorkommt, sowie Kupfer, Marmor und das Heben der in den Flüssen versunkenen Holzbestände (jährlich bis zu 5000 Kubikmeter.”
In Djakarta zeigte der lokale Reiseführer uns kurz nach dem Bürgerkrieg, als Suharto abgesetzt wurde, die Sehenswürdigkeit “Holzhafen”, wo die Tropenholz-Stämme noch per Hand von den Schiffen abgeladen werden. Es wimmelte dort von photographierenden Touristen – es waren fast genauso viele wie Holzträger.
Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung besprach unlängst einen Bildband: “Deutschlands alte Bäume – Eine Bildreise zu den sagenhaften Baumgestalten zwischen Küste und Alpen”, daneben gibt es auch noch die Bildbände: “Unsere 500 ältesten Bäume – Exklusiv aus dem deutschen Baumarchiv” und “Vom Zauber alter Bäume”.
Ich erinnere mich noch, dass unsere Nachrichtenagentur, die wir Anfang der Siebzigerjahre abonniert hatten, der “Alternative News Service” in New York, irgendwann mit Nachrichten aufhörte, weil die Gruppe aufs Land gezogen war. Schon wenig später veröffentlichte einer von ihnen, Stephen Diamond, ein Buch über die Erfahrungen in ihrer Landkommune – mit dem Titel: “Was die Bäume sagen”, 40 Jahre später stoße ich auf einen ähnlichen Buchtitel: “Bäume verstehen: Was uns Bäume erzählen”. Ich hielt mich aber lieber an den Versuch von David Suzuki: “Der Baum: Eine Biographie”. Auch dieses Buch enttäuschte mich jedoch etwas.
.

.
Die Suche nach Bäumen auf fernen Planeten
Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung rekapituliert noch einmal die Aufgaben des Weltraumteleskops “Kepler”, der seit Anfang August “seinen Zweck nicht mehr länger erfüllen kann” – nämlich im Sternbild Schwan nach “Planeten” zu suchen, “die der Erde gleichen”. Erstmalig hatte “Kepler” die Astronomen in die Lage versetzt, “empirisch zu messen, wie häufig erdanaloge Planeten sind.” Von seinen zur Erde gelangten Daten aus vier Jahren wurden bisher die aus den ersten zwei Jahren ausgewertet – wobei 136 Planeten ermittelt wurden. 2700 “Planetenkandidaten in rund 2000 Sternensysteme müssen noch geprüft werden”. Ein weiteres Ergebnis: “45% aller etwa sonnenähnlichen Sterne haben kleine Trabanten mit Kalibern zwischen einem und drei Erddurchmessern und Umlaufzeiten bis zu 500 Tagen.” Es sieht demnach laut FAS danach aus, “als sei die Struktur uneres eigenen Sonnensystems vom kosmischen Normalfall nicht sehr weit entfernt.”
Das “Kepler”-Team erwartet bei der Auswertung der Daten aus dem 3. und 4. Jahr “Hunderte wenn nicht Tausende neuer Planetenentdeckungen. Darunter wird dann auch der lange erhoffte erste erdgroße Planet sein, der in der lebensfreundlichen Zone um einen unserer Sonne ähnlichen Stern kreist.” Statistisch gesehen wäre dieser Stern mit solch einem Trabanten “nicht weiter als 68 Lichtjahre entfernt.” Wird ein solcher Planet identifiziert, wird es ein neues Weltraumteleskop geben, meint die FAS. Denn “nur so ließe sich herausfinden, mit welcher Wahrscheinlichkeit erdanaloge Planeten auch erdähnlich sind,” also dass auf ihnen physikalisch mögliches Wasser in flüssigem Zustand (nicht als Dampf oder Eis) existiert, und woraus die Atmosphären dieser Planeten bestehen. “Damit rückt dann auch die Frage nach dem Leben im All in den Bereich des empirisch Klärbaren, da biologische Aktivität sich im Planetenlicht irgendwie bemerkbar machen müsste. So könnten außerirdische Astronomen im Licht der Erde unter anderem die Absorbtion durch Chlorophyll der Pflanzen feststellen.”Die ersten Aliens, die wir sehen werden,” sagt der Leiter des Datenanalyseteams der Kepler-Mission, “könnten Bäume sein.”
.

.
Das Gegenteil von „Aliens“ waren die uralten Mammutbäume in Kalifornien
Als die South Union Pacific die Mammutbäume (Sequoia, die größten und ältesten der Welt) in Kalifornien fällen lassen wollte, schaffte es der schwedische Zoologe Gustaf Eisen (1847 – 1940), der lange als Abteilungsleiter an der California Academy of Sciences tätig war, sie unter Schutz zu stellen, indem er über den damaligen US-Präsidenten die Gründung des „Sequoia National Park“ durchsetzte. Nachdem man erst die Redwood-Bäume (Sequoia sempervirens) an der Küste gefällt hatte, wollte man auch an die noch größeren im Gebirge (Sequoia gigantea) heran. Diese haben alle Namen – der größte heißt „General Sherman“, 1890 hieß er erst einmal „Karl Marx“ – eine in der Nähe siedelnde Gruppe dänischer Kommunisten hatte ihn so benamt. Gustaf Eisen fand dort etwa zur selben Zeit ebenfalls einen sehr dicken Baum, den er nach „General Grant“ benannte.
Die Sequoia gigantea waren von Anfang an selten. Der Direktor des Naturhistorischen Landesmuseums in Schweden erwarb einmal eine von Hand gesägte Baumscheibe von einem Redwood, den es im Sturm entwurzelt hatte: Sie hatte 2400 Jahresringe und einen Umfang von gut 12 Metern, der Stamm unten hatte sogar einen Umfang von 29 Metern. Man baute darauf eine Tanzfläche – auf der 16 Paare gleichzeitig tanzen konnten und auch die Kapelle noch Platz hatte.
All diese Geschichten um den als Regenwurmforscher berühmt gewordenen Gustaf Eisen und die Mammutbäume sammelte der schwedische Biologe und Schriftsteller Fredrik Sjöberg – in seinem Buch „Der Rosinenkönig – Von der bedingungslosen Hingabe an seltsame Passionen“ (2013). Sjöberg, der einen Werklehrer hatte, den sie unzutreffend aber gemein „Holzhitler“ nannten, kannte, bevor er sich auf die Spur von Gustaf Eisen setzte, die Mammutbäume vor allem aus dem internationalen US-Bestseller „Ökotopia“ von Ernest Callenbach, eine besonders kalifornisch-öko-kitschige Stelle hat er daraus zitiert:
„Wir gerieten tiefer in den Wald. Plötzlich glitt sie geduckt um einen besonders mächtigen Mammutbaum herum und verschwand in einer Höhlung am Fuße des Baumes. Ich sprang hinter ihr her und fand mich in einer Art Heiligtum wieder. Siie lag dort auf einem Bett von Tannennadeln und atmete tief und keuchend.“
Fredrik Sjöberg veröffentlichte mit 17 seinen ersten Zeitungsartikel – in der „Västerviks-Tidningen“: Über eine „viele hundert Jahre alte Eiche, die so hohl wie eine Tonne, von ungebildeten, unkultivierten Menschen von den Elektrizitätswerken in der Nähe des Gränso-Kanals gefällt wurde.“
Unter den Briefen von Gustaf Eisen fand Sjöberg auch einen langen, den Eisen kurz vor seinem Tod Ende der Dreißigerjahre an den Vorsitzenden des Schwedischen Naturschutzbundes Nils Dahlbeck schrieb. “Es ging darin um eine alte Fichte, die ihm aus dem Sommer 1854 in Erinnerung geblieben war. Sie habe damals in der Nähe von Harfs Pfarrhof gestanden.” [Eisen wohnte in seinen letzten Lebensjahren am Central Park – mit Blick auf die Fichten dort.]
Dahlbeck antwortete ihm, dass es die besagte Fichte wahrscheinlich nicht mehr gäbe: „Die schwedische Natur verändert sich heute in einem ungeahnten Tempo. Was wir, die wir ihre Naturreichtümer zu bewahren suchen, retten können, sind bloß Bruchstücke.“
Im 2. Band seiner Trilogie über eskapistische schwedische Forscher bzw. Künstler – “Die Kunst zu fliehen – Vom Glück sich in kleine Dinge zu versenken und große Kontinente zu entdecken” (2012) – thematisiert der Biologe und Bird-Watcher Fredrik Sjöberg den Aquarellmaler Gunnar Widforss (1879–1934), der sich auf Landschaften und Bäume spezialisierte: Eichen, Birken, Mammutbäume (Redwood), immer wieder Espen und Kiefern. Sjöberg interessierte sich zunächst für die von Widforss gemalten Kiefern. Sein Interesse daran begann, als er einmal, mit Sechzehn, in Lappland “eine ganze Nacht im Wipfel einer Kiefer saß und romantische Lieder sang.” Nun, mit über 50, sagt er von sich:
“Wenn es etwas gibt auf dieser Welt, wovon ich wirklich etwas verstehe, dann sind es Kiefern.” Als “unumstrittener Meister der schwedischen Kiefernmalerei” gilt indes nicht Gunnar Widforss, der sich schließlich auf einige amerikanische Nationalpark-Ansichten konzentrierte und vor allem als “Maler des Grand Canyon” in den USA berühmt wurde, wo Sjöberg ihm nachspürte, sondern Gottfried Kallstenius, der sich 40 Jahre lang in Schweden “Kiefern im Abendlicht” widmete. Einige seiner Bilder sind laut Sjöberg “magisch”.
In den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts wurden in vielen Industrieländern, u.a. auch in Schweden, Naturschutzreservate geschaffen, einer der ersten war der polnische Urwald von Bialowieza (Podlasien), der zuvor bereits eine Bedeutung als Ort nationalen Widerstands hatte, wie der Kulturhistoriker Simon Shama in seinem Buch “Der Traum von der Wildnis” ausführte. Heute laufen im polnischen Fernsehen und gelegentlich auch im Deutschen immer mal wieder Dokumentarfilme über die Flora und Fauna des Urwalds von Bialowieza. Es war die Pilsudski-Regierung, die diesen Urwald zu einem der ersten drei polnischen “Nationalparks” erklärte. “Im Wald finden die ersten Gefechte zwischen Nationalökonomie und -ökologie statt!” schreibt Simon Shama.
Fredrik Sjöberg hält heute nichts mehr von “Reservaten”, die er mit der Nationalparkforscherin Astrid Slottved der “Rassentrennung” bezichtigt: “Die Grauwasseramsel, die wir bei Ribbon Falls sahen, benötigt zum Überleben keine Parks, nur ein bisschen Anstand,” schreibt er.
Gunnar Widforss begann als Dekorationsmaler, u.a. in St. Petersburg, mit der Zeit verschwanden aus seinen Gemälden “langsam die Menschen”, am Mittelmeer “übte er sehr zielstrebig das Malen von Luft”. Im Grand Canyon gibt es heute einen nach ihm benannten Aussichtspunkt und einen Wanderweg. Als man 1916 den “US National Park Service” einrichtete, begann “das Goldene Zeitalter der amerikanischen Nationalparks” und Widforss konnte sich dank dieser Behörde als “Hofmaler” der Naturschutzreservate etablieren, die in den Zwanzigerjahren mit Beginn der Massenmotorisierung von Millionen besucht wurden. “Widforss reiste zur Mesa Verde in Colorado, zu den Carlsbad Caverns in New Mexico, zum Crater Lake in Oregon, in den Sequoia Nationalpark und das Death Valley in Kalifornien – bis zum Yellowstone oben in Wyoming kam er und überall malte er Aquarelle, wie man sie bisher nicht gesehen hatte…Keiner wußte besser als er [außer vielleicht noch Thomas Moran und der Photograph Ansel Adams], wie schwierig es war, die Seele der Landschaft einzufangen, selbst wenn es sich nur um eine Kiefer in der Hochsommersonne handelte. Und sein Werk hat Bestand. Sein Meisterstück war der Grand Canyon.”
Morans, Adams und Widforss’ Bilder werden – was Sjöberg – leider nicht thematisiert, in die Ikonographie der “Manifest Destiny” eingereiht. Darunter versteht man laut Wikipedia “eine amerikanische Doktrin des 19. Jahrhunderts. Sie besagt, dass die USA einen göttlichen Auftrag zur Expansion hätten, insbesondere über die Mitte des 19. Jahrhunderts bestehende westliche Grenze in Richtung Pazifik. Die Redewendung, die so viel wie offensichtliches (oder unabwendbares) Schicksal bedeutet, hatte der New Yorker Journalist. John O’Sullivan 1845 in einem Artikel der Zeitschrift „The United States Democratic Review“ geprägt.” Die “Manifest Destiny” braucht bis heute diese Visualisierungen des Großartigen, die auf dem Kunstmarkt hin und her wandern – und immer teurer werden.
Auf der Fahrt zu den “Ansichten” von Widforss durch den Grand Canyon kommen Fredrik Sjöberg und seine Frau Johanna 2005 an großen Flächen mit “totem Wald” vorbei, “an den Berghängen gab es nichts als trockene, tote Bäume…Ganze Wälder.” Ein Mann aus der Gegend erzählte ihnen, dass die Region seit Jahren von einer “dramatischen Dürre” heimgesucht werde. Der Klimawandel wird dafür verantwortlich gemacht. 2013 ebenso die Brände in den kalifornischen Wäldern, während man für die alljährlichen Waldbrände n Griechenland, Spanien und Südfrankreich eher Brandstifter vermutet.
Die Nachrichtenagentur dpa meldet am 26.8.2013:
“Der gewaltige Waldbrand beim Yosemite Nationalpark in Kalifornien hat sich auf eine Fläche von mehr als 580 Quadratkilometern ausgedehnt. Etwa sieben Prozent des Feuers seien inzwischen eingedämmt, teilte die Feuerwehr am Montag mit. Der Brand drohte aber durch starke Winde auf bisher noch nicht betroffene Gegenden überzugreifen.
Am Wochenende hatte die Leitung des Nationalparks Vorsichtsmaßnahmen eingeleitet, um drei Dutzend wertvoller Mammutbäume vor den Flammen zu schützen. Der Waldbrand hat bereits einen Randbezirk des Parks erreicht. Das Dickicht wurde daraufhin gelichtet und Sprenkelanlagen errichtet, um die Natur feucht zu halten. Inzwischen sind auch die Strom- und Wasserversorgung der Millionenmetropole San Francisco gefährdet.”
Ein paar Stunden zuvor hatte dpa noch in bezug auf die Mammutbäume getickert:
“Sie wachsen mehr als 100 Meter hoch, werden älter als 3000 Jahre und zählen zu den imposantesten Gewächsen auf der Erde: Mammutbäume waren vor Millionen von Jahren weltweit verbreitet. Natürliche Vorkommen gibt es heute jedoch, abgesehen von einem kleinen Gebiet in China, nur noch an der Westküste der USA. Bis Ende des 19. Jahrhunderts wurden sie dort forstwirtschaftlich genutzt, so dass heute nur noch 60 Prozent der ursprünglichen Vorkommen erhalten sind. An den natürlichen Standorten stehen sie unter strengem Schutz.
Der Stamm des Mammutbaums hat einen Durchmesser von vier bis sechs Metern, seine Borke wird bis zu 50 Zentimeter dick. Haben die Bäume eine gewisse Größe erreicht, sind sie gegen Waldbrände geschützt. Dies liege unter anderem an dem in der Borke enthaltenen Bitterstoff Tannin, erklären Fachleute. Er sorgt auch dafür, dass abgestorbene Exemplare nur langsam verrotten.
In Kalifornien kommen zwei Arten vor: Der Küstenmammutbaum (Sequoia sempervirens oder “Californian Redwood”) gedeiht vor allem an der dunstigen Pazifikküste. Der Riesen- oder Bergmammutbaum (Sequoiadendron giganteum oder “Big Tree”) wurde um 1833 nördlich des Yosemite Valley entdeckt. Gezüchtet wird der Mammutbaum auch in Europa, er ist in vielen Parks und botanischen Gärten zu finden. Der wissenschaftliche Sammelname Sequoia geht auf den Sohn einer Cherokee-Indianerin und eines Briten zurück. Er entwickelte im frühen 19. Jahrhundert ein Schriftsystem für die Sprache der Cherokee.”
.

.
Das Baumdenken, den Baum denken
Seit dem großen Sturm über Norddeutschland am 10. Juli 2002, der allein in Berlin rund 4.000 Bäume und in Brandenburg 0,5% der gesamten Waldfläche (von 1,09 Mio Hektar) umriss, wird viel über den Baum nachgedacht. Und mancher Landbesitzer ist nachgerade erschüttert, dass seine schöne Akazie am Haus oder sein alter Birnbaum im Vorgarten nun nicht mehr steht. Bei Carwitz sah ich das halbe Dorf zu einer solitären Eiche am Feldrand pilgern, wo man traurig um den völlig zerfledderten Riesen herum Aufstellung nahm. In Vorpommern waren noch Tage danach ganze Straßen gesperrt, weil die vielen umgestürzten Bäume und abgerissenen Äste nicht so schnell beseitigt werden konnten. Überall knatterten Motorsägen. Auch dieses Geräusch quälte die Baumfreunde landauf, landab. Wochenlang standen deswegen die Bäume immer wieder im Mittelpunkt ihrer Gespräche.
Ein Berliner Dokumentarfilmer wollte bemerkt haben, dass die Wurzelballen der umstürzenden Bäume immer kleiner werden. So als ob sie sich – wie die Menschen drum herum – selbst zu dem immer öfter notwendig werdenden Standortwechsel befähigen wollten. Die Bäume sind den Menschen inzwischen auf Gedeih oder Verderb ausgeliefert. Ein englischer Botaniker meinte, dass sie auch oberirdisch immer kleiner und dünner würden. Das gelte insbesondere für die Eichen, die man vornehmlich für den Schiffsbau benutzte und die somit Englands Seemacht mitbegründeten, weswegen dort schon vor Jahrhunderten über jeden Eichbaum Buch geführt wurde. Die Bäume sterben aus, behauptete der Botaniker, “so wie die Dinosaurier einst!”. In Berlin sind gerade die rund 20.000 Kastanien besonders bedroht – von einer mazedonischen Motte. Und in den USA die letzten Mammutbäume – von einem Waldbrand, den man an ihrem Standort nicht löschen will. Aber auch anderswo in Kalifornien sind diese “letzten Riesen” gefährdet. Die Tochter eines amerikanischen Wanderpresdigers Julia Hill kletterte auf einen dieser Redwood-Bäume – und blieb dort oben in 60 Meter Höhe zwei volle Jahre, um ihn vor dem Gefälltwerden durch eine gewissenlose Nutzholz-Mafia zu schützen – wobei sie schließlich zu einem “höheren Selbst” gelangte. Seitdem nennt sie sich “Butterfly”. Die Schilderung ihres Weges zur individuellen Erleuchtung (Satori) erschien in nahezu allen Kultursprachen, auf Deutsch im Verlag Bertelsmann-Riemann – unter dem Titel “Die Botschaft der Baumfrau”. Die Autorin ist eine Öko-Mystikerin von Rang und mittlerweile einiger Prominenz – und ihr Werk, abgesehen von der gelungenen Rettung des Mammutbaums, ein Erlebnisbericht, der nichts zu wünschen übrig läßt, außer, daß ihre Extremerfahrung nicht leicht Nachahmer finden wird – obwohl: So wie sich derzeit die Selbstmordattentäter im Islam vermehren, könnten bald auch die Säulenheiligen unter den Ökoaktivisten epidemisch werden – die Schlauchboot-Ninjas von Greenpeace sind bereits auf dem Weg dahin. Julia Butterfly Hill jedenfalls ist weiterhin in diesem oberen Bereich (der Bäume) aktiv. Die Deutschen denken aber anders – das gilt auch für die Ökoaktivisten. Ein aufs Land gezogener Genetiker aus Gießen sah das Übel im Baumdenken an sich begründet: das heißt, darin, dass man den Baum isoliert denkt und pflanzt. Denn eigentlich handele es sich dabei nur um ein herausragendes Teil eines komplexen Ökosystems, das aus Gräsern, Pilzen, Sträuchern, niedrigen und hohen Bäumen sowie einer vielfältigen Fauna – bis hin zu Insekten, Würmern, Pilzen und Bakterien – bestehe.
Indem wir jedoch den Baum theoretisch wie praktisch isolieren, weihen wir ihn dem Untergang. So wie es der Mönch Bonifatius einst mit der riesigen Donareiche bei Fulda tat – indem er ihn fällen ließ. Im vorpommerschen Feldberg gibt es noch heute einen “Heiligen Hain” aus uralten Buchen; ähnliche Baum-Pilgerstätten sind über ganz Deutschland verstreut – und die Menschen unternehmen Gruppenreisen dorthin. Mein Freund, der Baum! Das Zentralorgan der deutschen Baumdenker, die FAZ, listete unlängst sogar die “100 schönsten und größten” solitären Bäume Deutschlands auf. Anti-AKW-Aktivisten ketten sich in Gorleben regelmäßig an Fichten, um sie vor dem Fällen zu schützen. Die dergestalt quasi individualisierten Bäume, aber auch all die individuell gepflanzten und umhegten in unseren Gärten, Straßen und Parkanlagen können inzwischen auf unser Mitgefühl rechnen. Nicht jedoch die sozusagen industriell angebauten und hochmaschinell bewirtschafteten Nutzwälder, deren Bäume zerschreddert nach wie vor den Grundstoff für unsere Ikea-Möbel, Spanplatten, Zeitungen und Bücher abgeben. Diese wie überdüngte Spargelfelder aussehenden Nutzforste rücken ebenfalls den letzten noch einigermaßen organisch gewachsenen, “gesunden” (Misch-)Wäldern zuleibe, die zudem von oben – durch Luftverschmutzung – und von unten – durch Grundwasserbelastungen – angegriffen werden. In Bayern will man gerade den Wald privatisieren und damit seine Nutzung optimieren – die FAZ-Herausgeber befanden in einer internen Sondersitzung, dass das zu weit geht. Bereits 1984 seufzte der erste Ökoredakteur der taz, Manfred Kriener, in seinem gleichnamigen Buch: “Er war einmal” – und sprach von einem “deutschen Abschied vom Wald”. Dieser Wald ist nicht erst seit der ruchlosen Tat des baumfeindlichen irischen Fanatikers Bonifatius ebenso überdeterminiert wie gefährdet. Zu römischen Hoch-Zeiten bereits machte ein kleines Partisanenheer um Hermann den Cherusker im Teutoburger Wald gegenüber einer ganzen römischen Legion die Schmach wett, dass die Germanen ansonsten nur allzu willig mit den Besatzern kollaborierten und dadurch ihre Freiheit und das wilde Waldleben verrieten, die selbst der römische Geschichtsschreiber Tacitus so gelobt hatte, dass daraus in Italien eine richtige “Germanenmode” und “Waldverherrlichung” wurde.
Die Nazis drehten dies dann um, indem sie selbst den deutschen Wald und alles was darin kreuchte und fleuchte unter strengstem Staatsschutz stellten. Schon bald hatten die gemeinen “Volksgenossen” jedoch andere Sorgen: nämlich in den kalten Nachkriegswintern 1945 bis 47 ein Brennholzproblem, dem bald ganze Wälder zum Opfer fielen. Erst als alle Schornsteine wieder rauchten, erinnerte man sich auch wieder an den deutschen Wald – als eine vergängliche Nationalressource. Der Jammer über seinen Zustand war so groß, dass das Wort “Waldsterben” bald in aller Welt von Umweltschützern auf Deutsch übernommen wurde. In diese Spanne – zwischen Teutoburger Wald, Buchenwald und Waldtrauer – gehören auch zwei künstlerische Bewältigungen der Waldproblematik: Ernst Jüngers nachkriegsdeutscher Entwurf eines leichthinnigenen Privatpartisanen, sein “Waldgänger”, sowie die schwermütigen Waldmythen des im Odenwald lebenden Malers Anselm Kiefer. Aus Frankreich kam zur selben Zeit – von der Pariser Philosophie – der Anstoß, sich endlich von jedweglichem “europäischen Baum- und Wurzeldenken” zu verabschieden – zugunsten eines eher nomadisch-horizontalen “Rhizom”-Begriffs. Dieser sorgte besonders bei den Deutschen für Furore, bei denen noch kurz vorher ein lückenloser (arischer) “Stammbaum” über Wohl und Wehe aller Lebensläufe entschieden hatte. Darüber hinaus war damit aber auch gemeint, sich endlich von allen Führungskraft-Anstrengungen und der Sehnsucht nach Vertikalität überhaupt zu entbinden. Heute spricht hier schon fast jeder von “flachen Hierarchien” und sogar die deutsche Forstwirtschaft lässt sich vom “Outsourcing” anstecken. In der FAZ wurde kurz nach der letzten Waldzerstörung am 16. Juli “Die Pflanzenseele im Zeitalter der Stadtbegrünung” diskutiert, denn “nie war der Baumhass größer als heute”, klagen angeblich “Beobachter” und sprechen von einer “professionellen Abhackmentalität”, die als “Baumpflege” verkauft wird.
Der Autor Ulrich Holbein schwang sich deswegen zu einem gütlichen Vorschlag auf, um den “alten Zwist zwischen heidnischer Baumvergötterung und baumfällenden Christen” zu schlichten. Dabei ging er von dem (germanischen?) Zusammenhang zwischen “geistlicher Erleuchtung und Fotosynthese” aus – nach Art einer “Vernetzung” oder “morphischen Resonanz”? – und empfahl den deutschen “Baumfreunden” kurzerhand, doch einfach in der ununterbrochenen Zeitungs- und Buchproduktion das aktuelle Murmeln der “Baumgeister” zu vernehmen. Die FAZ-Redaktion gab dem gegenüber jedoch bereits in der Bildunterschrift zum Thema zu bedenken, dass dieser Vorschlag nur bis zur Durchsetzung des “papierlosen Büros” gelte. Dann nämlich brauchen wir endgültig keine Texte mehr, die sich einem Baumopfer verdanken – wenn schon sonst nichts. Bis jetzt ist aber eher eine sogar noch anschwellende Papierflut zu verzeichnen, die sich thematisch immer öfter mit Bäumen befasst – und so deren “geistliche” Impulse quasi kurzschließt: überbrückt. Mit Titeln wie “Baumgenossen”, “Geist der Bäume”, “Die Botschaft der Baumfrau” und “Die Frau in den Bäumen. Eine Biologin erforscht das Leben in der Baumkrone”. Nicht zu vergessen, bebilderte Verkaufskataloge über “Baumhäuser – weltweit”. Daneben gibt es längst populärwissenschaftliche Zeitungen, die sich derart spezialisiert haben, dass sie sich nur noch mit Birken, Weiden oder Ahorn zum Beispiel beschäftigen. In Großdiashows zeigt man “Die schönsten Baobab-Bäume der Welt” und “Die teuersten Bonsai”. In Talkshows über hiesige Waldstreifen werden Schweigeminuten eingeblendet. Schulklassen übernehmen Baumpatenschaften – und denken sich englische Vornamen für ihre einstämmigen Lieblinge aus. Bürgerinitiativen kämpfen mit Baumschulen für weitere Alleen. Und Künstler konzentrieren ihr ganzes Werk auf einen einzigen Baum – den Gingko beispielsweise. Wenn das papierlose Büro nicht bald kommt, dann treten die letzten alten Bäume womöglich noch selbst an die Stelle der jungen Autoren – mit Titeln wie “Die Laubacher Linde – in Selbstzeugnissen” und “Wenn der große Ilex erzählt. Geschichten aus dem Unterholz”.
Das rhizomatische Denken dagegen wird wieder in die Kleinverlage abgedrängt – wo es auch hingehört. Denn das haben ja angeblich sogar die Bäume bereits begriffen: Es gilt, ein Kleinwerden zu schaffen, wo alles individuell nach oben und zur Größe strebt. Aus Westafrika kam dazu bereits der (filmische) Vorschlag – von einigen Bäumen: sich einfach hinzulegen! Und sonst weiter nichts zu tun. Es gibt darüber einen schönen Film von Jean Rouch: „Moi fatigué debout, moi couché“. Schon Tacitus hatte einst über die Germanen geurteilt: “Kein Volk gibt sich so gerne dem Nichtstun hin!” – Nun aber nicht mehr unter, sondern neben einem Baum. Leider ist hier vom alten Müßiggang nicht viel übrig geblieben, im Gegenteil: Etliche Berliner Spaziergänger in den märkischen Wäldern beschwerten sich sogar beim Forstamt, daß die Aufräumarbeiten nicht vorwärtskämen. Einer der Revierförster im Nordosten von Berlin verteidigte sich: “Schneller gehts nicht…Wir haben hier für 1200 Hektar Wald nur noch zwei Arbeiter”. Aus anderen Revieren wurden ihm zusätzlich sechs weitere überstellt. Sie müssen insgesamt 7000 Festmeter fällen: “Das ist mehr als doppelt so viel, wie wir in diesem Jahr normalerweise geerntet hätten”. Insgesamt sind in den märkischen Forsten 190.000 Festmeter auf die Schnelle zu beseitigen – aus Sicherheitsgründen, aber auch um dem Borkenkäfer- und Pilzbefall vorzubeugen. Einen Teil der Sturmschäden wird man diesmal dennoch nicht beseitigen: Auf 30 Hektar soll die Natur sich selbst helfen. Für die Waldökologen ist das ein “Experiment”: Dort entsteht nun unter ihrer Beobachtung ein “Mini-Urwald”.
.

Photo: Ivanov
.
Waldkrankheit
„Als die Wälder auf Reisen gingen“ – so heißt ein Internet-Essay von Robert Eikmeyer, im Untertitel: „15 Positionen zum Thema Floß, Flößerei und weiteren Holzwegen“, womit u.a. auf Heidegger und den Schwarzwald angespielt wird. Hier ein Zitat:
„Ein Gespenst geht um in Europa, noch nicht das Gespenst des Kommunismus, sondern das Gespenst der Holznot, Ende des 16. Jahrhunderts kommt es zum ersten Mal zu Holzmangel. „Bezeichnend für die damalige Stimmung ist die Luther und Melanchthon zugeschriebene Prophezeiung, „das noch vor dem Jüngsten Gericht an guten Freunden, guter Münze und wildem Holze großer Mangel eintreten werde“.“ Holz wurde zur Mangelware, weil die Städte und Gemeinwesen ihre Holzreserven weitgehend abgeholzt hatten. Gleichzeitig stieg der Holzbedarf immens, weshalb der Fernhandel zu florieren begann. Im 18. Jahrhundert erreichte die Flößerei ihren Höhepunkt und der ganze europäische Überbau der damaligen Zeit stand wortwörtlich auf hölzernen Füßen. „Für die Flößerei mußte also eine umfangreiche Infrastruktur bereitgestellt werden.“ Von überall her wurde Holz in die Zentren der damaligen Zeit transportiert. „Die Holländerholz-Hiebe führen zu einem rücksichtslosen und erschreckenden Raubbau an den weitgehend noch ursprünglichen Tannen-Buchen-Mischwäldern des Nordschwarzwaldes. Ein gigantischer Abholzungsprozeß in Form riesiger Kahlhiebe, der nur leere, mit Felsen bedeckte Flächen zurückläßt, plündert die Holzvorräte und führt zu Devastation und Waldverwüstung.“
Ryszard Kapuscinski schreibt in seiner Artikelsammlung „Afrikanisches Fieber“: „Der tropische Große Wald läßt sich mit keinem Wald in Europa oder dem Dschungel des Äquators vergleichen…Er ist monumental, seine Bäume ragen 30 oder 50 Meter und noch höher empor, sie sind gigantisch, stehen kerzengerade und frei, halten eine deutliche Distanz zueinander, wachsen faktisch ohne Unterholz aus dem Boden. Als ich nun in diesen Großen Wald fahre [in Kamerun], in diese himmelhoch ragenden Sequoien, Mahagonibäume, Sapelli und Iroken, habe ich das Gefühl, über die Schwelle einer großen Kathedrale zu treten.“ Auf der schlechten Wegstrecke haben es die riesigen Lastwagen leichter als der PKW, in dem Kapuscinski fährt. Mit den LKWs „schaffen Franzosen, Italiener, Griechen und Holländer die Bäume von hier weg. Denn der Große Wald wird Tag und Nacht abgeholzt, seine Fläche schrumpft, die Bäume verschwinden. Immer wieder kamen wir zu großen, leeren Lichtungen, auf denen frische, riesige Baumstümpfe aus dem Boden ragten. Das durchdringende Kreischen der Motorsägen war kilometerweit zu hören.“
Zwei Studentinnen, die in ihren Ferien durch Borneo gewandert waren, kehrten enttäuscht nach Berlin zurück. Sie hatten sich die Insel so romantisch vorgestellt – Wälder, Seen, Berge, kleine Dörfer im Dschungel…Stattdessen gerieten sie von einer riesigen brandgerodeten, wie zerbompt wirkenden Ebene auf die nächste, dazu hing noch oft Rauch und Brandgeruch in der Luft.
In den amazonischen Regenwäldern müssen die kleinen Siedlungen der Indianer spätestens nach vier, fünf Jahren auf einen anderen zu rodenden Platz wechseln, weil dann der Boden der von ihnen angelegten kleinen Nutzgärten erschöpft ist. Schon nach kurzer Zeit hat der Wald die verlassenen Gärten wieder überwuchert.
Wie Forstwissenschaftler herausfanden, kamen auch die zurückgehauenen Wälder Mitteleuropas in früheren Zeiten den Rodungssiedlungen immer wieder derart nahe, dass die Siedler irgendwann aufgaben und sich woanders niederließen. Der Wald war auch und gerade für die von und in ihm Lebenden bedrohlich. “Die mitteleuropäische Geisteskultur hat sie mit zahlreichen Figuren der Wildnis bevölkert, mit Riesen, Zwergen, wilden Jägern, Bären, Wölfen und anderen Wesen…,” schreibt der Geobotaniker Hansjörg Küster in seiner “Geschichte des Waldes”.
Der baltische Biologe Jakob meint: Es gibt keinen Wald als objektiv festlegbare Umwelt, sondern nur “einen Wald-für-den-Förster, einen Wald-für-den-Jäger, einen Wald-für-den-Botaniker, einen Wald-für-den-Spaziergänger, einen Wald-für-den-Holzleser”. Wobei auch schon zwei Spaziergänger u.U. nicht einmal ein und den selben Wald sehen.
Um zwei unterschiedliche Wald-Wahrnehmungen geht es vor allem in “Der Taigajäger Dersu Usala” von Wladimir Arsenjew. Als Geograph und Offizier des Zaren unternahm er zwischen 1902 und 1930 zwölf ausgedehnte Expeditionen in das damals noch weitgehend unerforschte Gebiet zwischen dem Ussuri und dem Stillen Ozean. Bereits bei seiner ersten Unternehmung lernte er dort den Jäger Dersu Usala aus dem kleinen Volk der Golde kennen, mit dem ihm bald eine enge Freundschaft verband. Sie unternehmen danach alle Expeditionen zusammen.
Für Dersu Osala ist alles belebt – alle Tiere, Pflanzen, Steine, Flüsse und Dinge nennt er “Leute” oder “Kerle”. Der vorurteilsfreie Arsenjew ist besonders beeindruckt davon, wie der Taigajäger es versteht, Spuren zu “lesen”. Das Entdecken und Deuten auch noch der kleinsten Zeichen im Wald versetzt Arsenjew und die ihn begleitenden Kosaken immer wieder in ehrfürchtiges Staunen, bereitwillig überlassen sie Dersu Osala schon bald die Führung, auch in moralischer Hinsicht, d.h. in bezug auf Tiere, die man nicht schießt und auf Menschen, die sie unterwegs treffen – und denen man uneigennützig hilft.
Da für den Taigajäger schier alles beseelt ist, spricht er mit Bäumen Tigern, Robben, Felsen ebenso ernst wie mit Menschen, und bedenkt Krähen und Ameisen z.B. mit übriggebliebenen Fleischstückchen. In Arsenjew hat er jemanden gefunden, der sein Verhalten zu würdigen weiß – und ihm später mit seinem Buch ein Denkmal gesetzt hat, das nach dem Zweiten Weltkrieg zu einem “Klassiker” wurde. Ein Klassiker über die “Naturverbundenheit” und den “Altruismus” eines nomadischen Jägers. 1975 wurde “Der Taigajäger Dersu Usala” von Arsenjew in einer sowjetisch-japanischen Koproduktion von Akira Kurosawa verfilmt. Der Film bekam 1976 als bester ausländischer Film einen Oskar.
Von den weißrussischen Partisanen im Zweiten Weltkrieg, die sich in den riesigen Wäldern dort versteckt hielten, wird die „Waldkrankheit“ überliefert: Der polnische Schriftsteller Yuri Suhl hat sie in seinem Roman “Auf Leben und Tod”, der von jüdischen Partisanen in einem ukrainischen Wald handelt, beschrieben, wobei er sich auf eine Krankenschwester in einem Waldlager berief, die über dieses Leiden einen ihrer Patienten aufklärte: „Der Wald kann dich heilen und krank machen. Einige Partisanen haben jahrelang Krankheiten gehabt, die im Wald verschwanden. Keiner weiß warum. Es ist ein Rätsel. Und andere, die vorher nie etwas gehabt haben, werden krank, so wie du, mit hohem Fieber und Schüttelfrost.”
Während es in Jugoslawien, wo die „Partisanenkrankheit“ grassierte, die Rückkehr in die Gesellschaft war, ist es hier umgekehrt der Partisanenwald, der sie depersonalisierte. Der noch jugendliche Waldkranke wurde nach seiner Genesung in der Kreisstadt unter den Deutschen eingesetzt, wo er erfolgreicher war.
Kürzlich berichtete der aus dem lakandonischen Regenwald von Chiapas zurückgekehrte Biologe Cord Riechelmann, dass er dort ebenfalls “waldkrank” geworden sei: “Tag und Nacht ist man von Wald umgeben, man kann nicht weit kucken, hört ständig Geräusche und entdeckt laufend irgendetwas Neues. Auch viele Zapatistas werden dort waldkrank. Sie haben deswegen inzwischen davon abgesehen, aus jungen Mitkämpfer, die zu ihnen in den Wald kommen, Illegale zu machen, mit falschen Pässen und allem was dazugehört, weil sie dann in gewisser Weise gezwungen sind, im Wald zu bleiben – und um so eher waldkrank dort werden.”
Einige Partisanentheoretiker, wie der BBC-Programmchef Steward Hood, der im Zweiten Weltkrieg Partisanenführer in der Toskana war, meinen, dass nunmehr, mit dem Verschwinden der Bauern und der Wälder auch kein Partisanenkampf mehr möglich sei – höchstens eine Stadtguerilla, über die er dann auch mehrere Bücher schrieb.
Der Odenwälder Oberförster Wilhelm Fabricius, der fast hundert wurde und viele Forst-Bücher veröffentlichte, aber auch Geschichten aus dem Odenwald – u.a. im Verlag “Grüne Kraft” von Werner Pieper, war Holzbeschaffer der deutschen Wehrmacht im Osten, d.h. er ließ dort ganze Wälder umlegen – bis eine dort kämpfende Gruppe von Partisanen ihn gefangen nahm. Sie ließen ihn jedoch wieder frei, nachdem sie sich davon überzeugen konnten, dass er als guter deutscher Förster die Kahlschläge auch alle wieder aufgeforstet hatte. Nach dem Krieg besuchten sie sich noch gelegentlich – die Partisanen und Fabricius.
Er kam aus der forstwissenschaftlichen Schule von Göttingen, von wo aus die Absolventen nicht erst heute in alle Welt ausschwärmen – als Forstfachleute: In die Mongolei z.B., wo die bundesdeutsche Agentur GTZ einige Wiederaufforstungsprojekte durchführt. Daneben geht es den deutschen Förstern dort jedoch auch um eine gewissermaßen indirekte Forstbewirtschaftung: So ließen sie z.B. in Stuttgart einen Ofen konstruieren, der in der Mongolei nachgebaut wurde und in dem nun in den Jurten die Hirten den getrockneten Dung ihrer Herden verheizen. Dadurch sind sie nicht mehr auf das Holz der seltenen und äußerst langsam wachsenden Saxaul-Bäume angewiesen, deren niedrige Stämme nur gerade mal für ein paar Tage jeweils reichen.
Wikipedia spricht von ganzen “Saxaul-Wäldern” in der Gobi, das finde ich jedoch übertrieben, ohnehin gehört dieses “Fuchsschwanzgewächs” zu den Sträuchern. Weiter heißt es: “Der Saxaul wird in ganz Zentralasien zur Bodenbefestigung gepflanzt, um die fortschreitende Desertifikation zu stoppen. Eine parasitische Pflanze an seinen Wurzeln wird von den Chinesen als “Wüsten-Ginseng” bezeichnet und in der traditionellen Medizin verwendet.”
“Wo seit 60 Jahren Bäume wachsen” (d.h. vor allem Pappeln) – so hat die Berliner Regisseurin Katrin Eissing ihren Dokumentarfilm über das Moordorf Neugnadenfeld im Emsland genannt; seine Bewohner gehören zur “Brüdergemeine“, eine von den Hussiten herstammende protestantische Bewegung, die 1722 – als vertriebene “Böhmische Brüder” ihr Zentrum im sächsischen Herrenhut bei Görlitz fand. Die Neugnadenfelder wurden im Zweiten Weltkrieg aus Polen vertrieben und fanden danach keinen Ort im Westen, der sie ansiedeln ließ, bis ihr Pfarrer schließlich das Moorlager im Emsland entdeckte und sie dort wieder alle versammelte. In dem Lager – namens “Alexisdorf – waren zunächst Arbeitsdienstler, dann Zwangsarbeiter und zuletzt russische Kriegsgefangene untergebracht worden. Von letzteren zeugt noch der “Russenfriedhof” am Ortsrand des Dorfes Neugnadenfeld, in dem immer noch ein großes Gemeinschaftsgefühl obwaltet.
Erwähnt seien ferner zwei weitere Filme über Emslandlager – von denen insgesamt 15 existierten. Paul Meyer, verwandt mit der Werftbesitzerfamilie Meyer in Papenburg, drehte seinen ersten Film über das Emslandlager Aschendorfermoor, in dem ein desertierter Gefreiter in der Uniform eines Nazi-Offzieres zusammen mit einer Handvoll Spießgesellen in den letzten Wochen des Krieges eine Schreckensherrschaft errichtete: „Der Hauptmann von Muffrika“ heißt dieser Dokumentarfilm, sein nächster Film hat den Titel “Konspirantinnen” und handelt von polnischen Widerstandskämpferinnen aus dem Warschauer Aufstand 1944, die nach Unterzeichnung der Kapitulationserklärung der Deutschen als erste weibliche Kriegsgefangene in das Lager Oberlangen im Emsland kamen, wo dann am 12. April 1945 polnische Soldaten der Alliierten das Lager erreichten und sie befreiten. Bäume spielen in Meyers Emsland-Lagerfilmen im Gegensatz zu dem von Katrin Eissing keine Rolle.
Bertold Brecht schreibt in seinem Gedicht “An die Nachgeborenen”:
“Was sind das für Zeiten, wo
Ein Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen ist.
Weil es ein Schweigen über so viele Untaten einschließt!
Der dort ruhig über die Straße geht
Ist wohl nicht mehr erreichbar für seine Freunde
Die in Not sind?”
Was Günter Eich zu folgendem Dreizeiler inspirierte:
Die Kastanien blühen.
Ich nehme es zur Kenntnis,
äußere mich aber nicht dazu.
In einem nicht minder berühmten Gedicht – von Nazim Hikmet – heißt es dagegen:
“Leben einzeln und frei wie ein Baum/ Und dabei brüderlich wie ein Wald/Diese Sehnsucht ist alt.”
Dies kommt einer Bemerkung der zwei jüdischen Partisanen Jack und Rochelle Sutin nahe, die nach der Befreiung durch die Rote Armee die Erfahrung machten, dass sie sich im Waldlager “in gewisser Hinsicht wohler fühlten: Dort hatte Kameradschaft geherrscht”.
Ihr partisanischer Rückblick berührt sich mit der forstwissenschaftlichen Sicht vieler sowjetischer Biologen, die sich statt auf den dortigen Konkurrenzkampf eher auf symbiotisches Zusammenwirken konzentrierten: “Es klingt paradox, aber der Wald braucht den Wald,” so sagte es einer von ihnen und fügte hinzu: “Sonst stünden viel mehr Bäume einzeln, wo sie sich doch angeblich besser entfalten könnten.”
Die Zeit schreibt: „Auf der Weltklimakonferenz in Kopenhagen ist der Wald eines der wichtigsten Themen. Vor allem die Abholzung tropischer Regenwälder bereitet den Experten Sorge. Denn die Regenwälder mit ihren gigantischen Baumriesen speichern so viel Biomasse, dass ein Kahlschlag verheerende Folgen hat: Durch Rodung der Regenwälder zugunsten von Viehweiden oder Sojaplantagen entstehen etwa ein Sechstel aller Treibhausgasemissionen weltweit.
Doch nicht überall auf der Welt ist Bäumefällen ein Frevel. Die nachhaltige Nutzung von Wäldern birgt sogar ein großes Klimaschutzpotenzial. Allein Deutschland könnte durch kluge Forstwirtschaft seinen CO2-Ausstoß um 24 Millionen Tonnen im Jahr senken, hat ein Forschungsprojekt am Institut für Weltforstwirtschaft an der Uni Hamburg ergeben…In diesen Zahlen ist noch gar nicht berücksichtigt, dass jeder gefällte Baum in verschiedenen Produkten mehrfach hintereinander verwendet werden und dabei jedes Mal nicht erneuerbare Energie aus fossiler Quelle ersetzen kann. Am Ende seiner Lebenszeit wird das Holzfenster geschreddert und zum Beispiel zu einer Pressspanplatte weiterverarbeitet. Wenn auch die ausgedient hat, kann sie in einem Heizkraftwerk zur Strom- und Wärmeerzeugung verfeuert werden. Am Ende dieser »Kaskadennutzung« hat sich die CO2-Einsparung vervielfacht.
Schaut man einem modernen Holzfäller bei der Arbeit zu, kann man sich das kaum vorstellen. Denn wenn Peter Karlsson mit seinem sogenannten Harvester zum Bäumefällen anrückt, wird reichlich Diesel verbrannt. »Wer so eine Maschine bedienen kann, kommt auch locker mit einem Hubschrauber klar«, witzelt der Ein-Mann-Unternehmer aus Schweden.
Gerade lichtet er einen Wald im südnorwegischen Moss. Mit dem Greifarm seines tonnenschweren Geräts packt er eine ausgewachsene Fichte und lässt die an der Spitze integrierte Kettensäge aufheulen. Dann schwingt er den Stamm über einen Holzstapel, entastet und zerteilt ihn in vier Meter lange Stücke. Das Ganze dauert keine 30 Sekunden. »Mein Bordcomputer speichert alle Daten über die geerntete Menge und Qualität und überträgt sie am Abend automatisch an die Eigentümer-Kooperative«, erklärt Karlsson.
Solche Harvester übernehmen auch in Deutschland zunehmend die Holzernte, doch nirgendwo ist die Technik so weit entwickelt wie in Skandinavien. 350.000 Euro hat Karlssons Maschine gekostet, auch die Organisation von Abtransport und Weiterverteilung der Holzstapel und die Abrechnung sind automatisiert.
Den besten Preis erzielen dicke Kiefernstämme für die Möbelindustrie. Aber ein großer Teil der Fichten landet in der wenige Kilometer entfernten Zellstoff- und Wellpappen-Fabrik Peterson.
»Jede Tonne Holz, die bei uns angeliefert wird, bindet 1,9 Tonnen CO2«, erklärt Vertriebschef Jörg Braun, »in einer Tonne Papier, die wir daraus erzeugen, steckt noch immer 70 Prozent dieser Menge.« Und damit mehr, als im gesamten Produktionsprozess vom Fällen der Bäume bis zur fertigen Wellpappe erzeugt wird. »CO2-mäßig können wir ein ruhiges Gewissen haben.« Auch deshalb, weil die Herstellung konkurrierender Verpackungsmaterialien aus Kunststoff große Mengen Erdöl verbraucht.
In den weltweiten Klimamodellen und -abkommen sind die positiven Effekte aus der mehrfachen Verwendung des nachwachsenden Rohstoffs Holz aber nicht berücksichtigt. Mehr noch, die Industrieländer werden sogar dafür belohnt, wenn sie das große CO2-Sparpotenzial brachliegen lassen. »Bisher geht das geerntete Holz einfach als Emission in die Klimabilanz ein«, klagt Karsten Dunger – egal, ob der nachwachsende Rohstoff sinnvoll genutzt werde oder nicht.
Im Bundesinstitut für Waldökologie und Waldinventuren in Eberswalde stellt der Biologe Dunger jedes Jahr die zehnseitige Tabelle zusammen, die Deutschland im Rahmen des Kyoto-Protokolls zur Treibhausbilanz des Waldes an die Vereinten Nationen schicken muss. Noch sieht sie – auch ohne Berücksichtigung der Holzernte – ganz gut aus. Seit 1990 hat die Zahl der Bäume leicht zugenommen, fast 32 Prozent unseres Landes sind von Wald bedeckt, etwas mehr als der Weltdurchschnitt. Mit 3,4 Milliarden Kubikmetern lebendiger Holzmasse ist Deutschland sogar Spitzenreiter in Europa.”
Die FAZ wird langsam kritisch gegenüber den ganzen Klima-Berechnern und -Katastrophisten. In ihrem Artikel “Wer die Welt simuliert, hat die Wahrheit nicht gepachtet” berichtet sie von den Unwägbarkeiten der “Klimamodelle”:Eine “‘Kaskade an Unsicherheiten’ baue sich auf.” Klimawandel, Struktur und Kaskade sind derzeit beliebte Wörter, da muß man sich nicht groß um “Gesellschaft” und “Soziales” mehr kümmern. Weiter heißt es in dem FAZ-Artikel:
“…Was aber, wenn die Öffentlichkeit die Modellergebnisse genau so sehen will, wie es die Wissenschaftler zu vermeiden versuchen: als simulierte Realität? Oder schlimmer: Wenn die Wissenschafter selbst ihre Prognosen mit einer Selbstverständlichkeit vorgetragen haben wie vor viereinhalb Jahren vom führenden deutschen Klimaforscher, Hans-Joachim Schellnhuber, in dieser Zeitung: “Gelingt die Abgas-Trendwende bis 2020 nicht, dann dürfte eine Erderwärmung mit verheerenden Folgen, etwa dem Abschmelzen des Grönland-Eisschildes und dem Kollaps des Amazonas-Regenwaldes, kaum noch zu vermeiden sein.” Bis 2080 könnte es zu einem “vollkommenen Zusammenbruch des Amazonasregenwaldes kommen”, schrieb der Potsdamer Klimaforscher in einem anderen Aufsatz über die neun “Kippelemente” des Weltklimas, die er zusammen mit anderen Forschern definiert hatte.
Die Versteppung eines Großteils des Amazonas war auch im vierten IPCC-Bericht eines der wahrscheinlicheren Szenarien. Vor zwei Jahren kam schließlich ein Manifest von 19 renommierten Klimaforschern heraus, in dem ist zu lesen: “Es gibt zahlreiche Belege aus den Messungen in den Wäldern, die zeigen, dass der Amazonas tatsächlich sehr empfindlich auf Trockenstress infolge der Erderwärmung reagiert.” Und in der Tat: Noch im Januar dieses Jahres hat die Nasa die schleppende Erholung des Amazonas nach der Megadürre und dem Baumsterben im Jahr 2005 mit Analysen von Satellitendaten dokumentiert…
Und doch ist das alles, wenn man der jüngsten Modellstudie Glauben schenken will, Makulatur im Hinblick auf die Klimazukunft. In der Zeitschrift “Nature Geoscience” (doi: 10.1038/ngeo1741) stellt Chris Huntingford vom Centre for Ecology and Hydrology in Wallingford zusammen mit britischen, amerikanischen und brasilianischen Forschern die Ergebnisse von Simulationen mit den 22 wichtigsten, für den IPCC genutzten Klimamodellen vor, die um ein aktuelles Landflächenmodell ergänzt wurden. Auch Messdaten von Beobachtungsnetzwerken wurden zur Evaluierung der Temperatur- und Niederschlagsabschätzungen berücksichtigt. Ergebnis: “Der Schaden für die Regenwälder dürfte bis zum Jahr 2100 deutlich geringer sein, als frühere Studien vermuten lassen”, heißt es in dem Paper. Auch in dem Extremszenario, dass die Emissionen weiter steigen wie bisher – “Business as usual” -, und sich der Kohlendioxidgehalt bis 2100 mehr als verdoppelt, ist in den 22 Modellen langfristig kein Schrumpfen der Tropenwälder zu erkennen.
Zu einem Verlust an Biomasse kam es weder in Amerika, Asien, noch Afrika – mit einer Ausnahme: In dem Modell des britischen Hadley-Centres schrumpften die Amazonas-Wälder. Doch schon die afrikanischen und asiatischen Tropenwälder erwiesen sich auch bei ihm – virtuell – als überaschend widerstandsfähig. Der Düngereffekt des vermehrten Kohlendioxids könnte demnach die durch Trockenheit verursachten Störungen kompensieren, teils überkompensieren.
Die große Unsicherheit, eigentlich müsste man sagen: der Widerspruch zu früheren Modellen, liegt den Autoren zufolge weniger an den Klima-Algorithmen, auch nicht an den Niederschlagsprognosen, sondern vor allem in dem Biosphärenanteil der erweiterten Modelle. “Die physiologische Reaktion der Pflanzen ist die größte Unbekannte.””
Also sind nicht die Warenproduktion bzw. die kapitalistische Wirtschaft Schuld an der ganzen Unsicherheit, sondern die Pflanzen. In einem Kasten zum Artikel wird sogleich Hilfe in diesem “Kampf um gute Klimamodelle” angeboten: “Weshalb die Philosophie als Vermittler dienen kann” heißt es vorneweg.
Zwei Philosophen haben das bereits versucht: Hans von Storch, Ehrenvorsitzender der Donaldisten, die als Gesellschafts-Modell Entenhausen analysieren, und seit 2001 Leiter des Instituts für Küstenforschung am Helmholtz-Zentrum in Geesthacht, sowie sein Mitarbeiter Werner Krauß – ein Ethnologe, der u.a. empirische Studien über den Nationalpark Wattenmeer und die Windenergie-Wirtschaft in Schleswig-Holstein veröffentlichte. Krauß und von Storch betreiben den blog “Die Klimazwiebel”.
In ihrem oben bereits erwähnten Buch “Die Klimafalle – Die gefährliche Nähe von Politik und Klimaforschung” weisen sie anhand vieler Beispiele nach, “dass die Klimawirkung nur zum Teil vom Klima abhängt und dass das eigentliche Problem in der Vorhersage der gesellschaftlichen Folgen besteht.”
Als eines ihrer Beispiele sei hier das Schweizer Waldpolizeigesetz in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erwähnt, als “ein frühes Beispiel von Klimapolitik”: “Als sich in der Schweiz Überschwemmungen häuften, hatte die sich neu bildende Forst wissenschaft eine Erklärung parat: Sie deutete die Fluten [ähnlich wie Platon – s.o.] als Folge der Praxis des Holzeinschlags im Hochgebirge. Aus heutiger Sicht ist diese Erklärung nicht plausibel, weil meteorologische Strukturen, wie sie hinter schweren Niederschlägen stehen, kaum von solch kleinräumigen Veränderungen an der Oberfläche gesteuert werden können. Aber man hatte eine Erklärung, und als Folge wurden mancherlei Anpassungsmaßnahmen durchgeführt. Hier sind insbesondere die ‘Flusskorrekturen’ zu nennen. Daneben wurde aber auch der Holzeinschlag als eine Vermeidungsmaßnahme gesetzlich unterbunden. Es wurden also durchaus vernünftige Maßnahmen beschlossen, welche die Verletzlichkeit reduzierten und auch ökologisch sinnvoll waren, mit einer wissenschaftlich zwar autorisierten, aber dennoch falschen Begründung.”
Umgekehrt helfen richtige Begründungen nicht unbedingt vor falschem Tun, wie ein taz-Bericht aus Indonesien (am 26.8.2013) nahelegte. Er hat den Titel “Mißglückter Waldschutz”: “Den Bewohnern des Dorfes Katunjung, die die taz im November 2011 besuchte, kam das Kommen und Gehen der internationalen Berater schon damals suspekt vor. Katunjung liegt in Zentral-Kalimantan, der Pilotprovinz für REDD+ in Indonesien.
REDD+ steht für “Reducing Emissions from Deforestation and Degradation” – Verringerung von Emissionen aus Abholzung und zerstörerischer Waldnutzung. Staaten und Unternehmen erwarben das Recht zum CO2-Ausstoß durch die Finanzierung von Waldschutzprojekten. In Zentral-Kalimantan versuchte die australisch-indonesische Kalimantan Forest and Climate Partnership (KFCP) auf einer Fläche von 120.000 Hektar REDD+-Pilotprojekte umzusetzen.
Auf Torfmoorflächen im Landkreis Kapuas wollte die KFCP wichtige Erkenntnisse im Kampf gegen den Klimawandel gewinnen. 100 Millionen Bäume sollten über einen Zeitraum von 30 Jahren gepflanzt und damit 700 Millionen Tonnen Kohlendioxidausstoß ausgeglichen werden. Außerdem sollten Entwässerungskanäle in großem Stil blockiert werden.
Die Bewohner von Katunjung, überwiegend Angehörige des indigenen Dayak-Volkes, leben ohne Strom aus der Steckdose. Ihr fließendes Wasser kommt aus dem Kapuas-Fluss vor ihren Pfahlbauten. Es gibt keinen Landweg, der zu ihrem Dorf führt. Seit 2007 hatten sie die teuren Schnellboote der Klimawandel-Experten vorbeiziehen sehen, hatten sich deren Vorträge darüber angehört, warum es so wichtig sei, gerade da, wo sie wohnen, das Weltklima zu retten. Bekannte Politiker hatten die Provinz besucht und mit viel Optimismus in Sachen REDD+ in die Fernsehkameras gelächelt. Doch an den Dorfbewohnern war das Projekt vorbeigeplant worden. Wichtige Informationen hatte man ihnen vorenthalten. Das Ergebnis: Nur 50.000 Bäume wurden gepflanzt, noch weniger wuchsen wirklich an. Auch die Kanäle blieben vielerorts bestehen, weil diese seit Jahren den Wasserweg zu den Kautschukbäumen der Anwohner darstellten.
Nach wachsender internationaler Kritik wurde das Vorzeigeprojekt Ende Juni stillschweigend eingestellt. Auf der Website der KFCP heißt es, “das Projekt” werde “in seiner derzeitigen Form nicht weitergeführt”. Indonesien und Australien suchten aber nach Wegen, “mit zusätzlicher Arbeit in den nächsten 12 Monaten bessere Erfolge zu erzielen”. Transparente Information sieht nach Meinung von Umweltschützern anders aus. Die australische Regierung solle sich “auf offene und ehrliche Art” der Öffentlichkeit stellen, fordert die Organisation Friends of the Earth (FoE). “Sich aus einer Investition in Höhe von 47 Millionen Dollar zurückziehen, ohne Rechenschaft abzulegen, wofür dieses Geld verwendet wurde und welche Ergebnisse damit erzielt wurden, ist völlig inakzeptabel”, so Nick McClean, Koordinator für Klimagerechtigkeit bei FoE Australien. Unklar ist nach Aussage von FoE auch, warum im Rahmen von KFCP bei der Beachtung von Indigenen-Rechten eine Weltbank-Leitlinie angewendet wurde und nicht das UN-Prinzip der freien, vorherigen und informierten Zustimmung (free, prior and informed consent, FPIC).
“Der Widerwillen der REDD-Partner, die Rechte von Indigenen anzuerkennen, macht REDD in vielen Teilen der Welt problematisch”, so Isaac Rojas von FoE International. “Detailliert zu erörtern, warum das immer wieder so ist, würde helfen, Partnerschaften zu entwickeln, die zu wirklich nachhaltigen Umweltschutzprogrammen führen.””
.
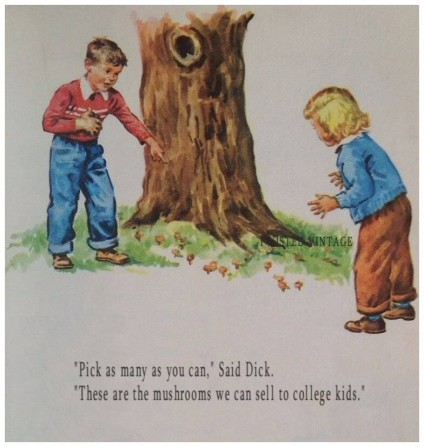
.
Auf der Internetseite „baum-raus.de“ heißt es:
„Falls bei Ihnen ein Baum gefällt werden soll, sind wir der richtige Ansprechpartner…Suchen Sie nicht länger. Wir hauen den Baum weg.“
Und auf der Internetseite “baum-faellen.de” wird daran erinnert: “Das Baumfällen ist laut Bundesnaturschutzgesetz §39 zwischen dem 1. März und dem 30. September verboten, allerdings gibt es Ausnahmen.
Über die “Fälltechnik” schreibt Wikipedia:
„Sie erlaubt es, einen Baum bei Wald- oder Baum-Pflegearbeiten auf die gewünschte Art und Weise zu Fall zu bringen (zu fällen) oder abzutragen. Hierzu gibt es je nach Situation verschiedene Schnitttechniken. Daneben werden diese und verwandte Techniken auch im Aufarbeiten des Baumes – dem Zerlegen zu brauchbaren Stücken Holz – verwendet. Durch angepasste Schnitttechniken und den richtigen Einsatz des Werkzeuges kann in der Fortstwirtschaft effektiv gearbeitet werden und auch ein Problembaum sicher gefällt werden.
Die Standardtechnik des Fällens besteht aus einer Kombination aus Fallkerb und Fällschnitt. Dabei werden Bäume im Allgemeinen mit der Motorsäge gefällt. Früher erfolgte das von Hand mit Zugsäge, Axt und Keil, ein moderneres Verfahren ist etwa der Holzvollernter, oder – in Extremlagen – der Schnitt aus dem Hubschrauber.“ Trotz aller Motorisierung werden heute auch wieder Kaltblutpferde eingesetzt, um die Waldschäden beim Rausziehen der Stämme an die Holzwege geringer zu halten.
Erwähnt sei noch ein neues Buch: “Der Baum – eine Biographie” – von David Suzuki und Wayne Grady. Der Titel erinnert ein bißchen an den Hit von Alexandra “Mein Freund der Baum” (1968). Die Sängerin wurde wenig später auf der B 149 nach Sylt von einem Lastwagen überfahren, ihr Sohn, Alexander Skovitan, überlebte den Unfall, er wurde später Leiter des “Ural Kosakenchors”.
Dann gibt es noch die nicht ganz neue Aufsatzsammlung von Josef H.Reichholf: “Die Zukunft der Arten. Neue ökologische Überraschungen” – in der sich insbesondere die Kapitel “Pflanzenwelt in Bewegung” und “Wald im Wandel” mit dem Thema “Baum” befassen.
Und dann sei noch auf eine dämliche Titelgeschichte des “Berliner Kurier” vom 4.Oktober hingewiesen: “Todesbaum holt sich 4. Opfer”. Es geht darin um eine Linde an der B 168, an der erneut ein Jugendlicher mit seinem Auto zerschellte.
“Noch stehen sie vor allem entlang der Autobahn. Jetzt geht es an die Wälder. Die Gemeinde Kloster Lehnin bereitet sich auf die Installation von Windrädern in Kiefernforsten vor,” berichtete die Märkische Allgemeine Zeitung.
Unter der Überschrift “Die Natur der Hysterie” resümmiert die FAZ am 18.10.:
“Als es vor dreißig Jahren hieß, der Wald werde sterben, erfasste großer Aktionismus das Land. Doch die Vorhersagen einer ökologischen Apokalypse traten nicht ein. Waren sie falsch? Oder verhinderten sie, was sie ankündigten?
Natürlich kamen Politiker wie der Sozialdemokrat Freimut Duve, der fand, Deutschland stehe “vor einem ökologischen Holocaust”. Natürlich wollte die Bürokratie nicht zurückstehen wie das Bundesinnenministerium, das 1984 an alle deutschen Haushalte Päckchen mit Rotfichtensamen verschickte, weil der Kampf gegen das Waldsterben mit dem Pflanzen eines neuen Baumes beginne. Natürlich waren das Übertreibungen. Aber sie bezogen sich letztlich alle auf den Mann, der sich dafür entschieden hatte, nicht nur der Experte zu sein, der das Komplizierte einfach macht, sondern auch der, der das Handeln erzwingt. Reduktion und Alarmismus – daraus entsteht Hysterie. “Wie geht’s dem Wald? Das war die Partyfrage, sobald jemand wusste, dass man Förster ist”, sagt Roderich von Detten.”
Aber: “Ist ein wenig Hysterie nicht sogar wichtig, wenn sich dadurch mehr erreichen lässt als durch Sachlichkeit? Der Mechanismus, in dem diese Debatten geführt werden, ist doch immer wieder derselbe Mechanismus; nur die Verwunderung darüber, dass die Dinge letztlich nicht so einfach oder dringlich waren, wie sie zuerst zu sein schienen, der ist immer wieder neu. Wo also liegt der Schaden, wenn sich die Extreme am Ende gegenseitig aufheben und sich alles in der Mitte einpendelt?
“Man wäre an einer anderen Stelle herausgekommen”, sagt Hans von Storch. Er ist Meteorologe, und was den Klimawandel betrifft, liegt er mit seiner Position eher in der Mitte. Er ist weder ein Skeptiker noch ein Alarmist, aber er weiß, dass man mit beiden Positionen leichter in die Medien kommt oder in der Politik Gehör erhält, um dort zu sagen, wie man als Wissenschaftler das Problem lösen würde. Er findet nur, dass das nicht die Aufgabe des Wissenschaftlers ist. Wissenschaftler beschreiben einen Zustand, Medien organisieren Debatten, und die Politik versucht Regeln zu finden, die widerstreitende Werte miteinander in Einklang bringen. Jeder hat in seinem eigenen Bereich eine Verantwortung, die er nicht abgeben kann, aber keiner hat Verantwortung für mehr als seinen. Das ist es, was in der Debatte über das Waldsterben nicht funktionierte. “Es ist damals von wissenschaftlicher Seite eine Angststrategie gefahren worden, um mit Prognosen bestimmte Lösungen zu erzwingen”, sagt Hans von Storch.”
Der geschätzte Donaldist aus Geesthacht will anscheinend “Die Wissenschaft” wieder gerade richten – in eine sachliche Mittelposition. Das hat vor einigen Jahrzehnten Lacan gelassener gesehen: “Die Hysterie steht am Anfang jeder Wissenschaft!” Und diese ist dann noch jedesmal schnell genug öde, d.h.fachidiotisch geworden.
.

Dorflinde. Photo: Edith Cinto-Rivera
.
Ein Waldbesitzerbuch von Karsten Spinner und Frank Setzer:
“Waldbesitzer wider Willen könnte man die über eine Million Grundbesitzer in Deutschland nennen, die weniger als 20 Hektar ihr Eigen nennen. Oft sind sie über einn Erbschaft zufällig an ihren Besitz gekommen. Der Wald ist mehr Last als Lust. Es fehlt die Idee, mit dem Immobilieneigentum etwas Nützliches anzufangen. Damit räumt dieser Praxisratgeber auf: Er zeigt unkomplizierte Lösungswege auf, wie auch Nicht-Fachfrauen und -männer mit sehr wenig Aufwand gutes Geld mit ihrer Waldfläche verdienen können.”
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, kauften auch:
„Der eigene Wald: Privatwald optimal bewirtschaften“ und „Mein Wald: nachhaltig, sanft, wirtschaftlich“ von Peter Wohlleben. Das „Waldbesitzerhandbuch“ und „Kurzumtriebsplantagen: Holz vom Acker – So geht’s“ von Frank Setzer. Sachkundenachweis Motorsäge von Frank Grießer und Michael Neub: “Wald im Nebenerwerb: Wenig Aufwand – gutes Geld”
.

Schulunterricht unter einem Mangobaum, Ghana. Photo: A. Thiel
.

Baobab-Bäume. Photo: rotel.de
.
Letzte Baum-Meldungen:
– Umweltschützer hatten im Januar einen Baum an der Trasse für die A 100 besetzt. Ganz legal, sagen die Grünen. Dennoch holte Bausenator Michael Müller die Polizei und stellte Strafanzeigen.
– Der asiatische Laubholzbockkäfer hat sich in Magdeburg auf mehreren Bäumen eingenistet. Am Mittwoch wurde der erste befallene Baum gefällt.
– Das Projekt „Neue Bäume für Düsseldorf“ macht Fortschritte. Und: Musiker Heino hat ein Benefiz-Konzert zugesagt!
– In Berlin hat das Zurückschneiden der Bäume mit Motorsägen schon vor dem 1.Oktober begonnen. Sauerei!
– Jetzt ist es doch wissenschaftlich erwiesen, was die Freiburger Umweltschützer schon vor Jahren behaupteten: Fledermäuse verwechseln die Rotorblätter von Windkraftanlagen mit Bäumen. Offenbar ist diese Gefahr für in Bäumen lebende Fledermausarten besonders gross, wie eine Studie zeigt.
– Laut einer Mitteilung des Schweriner Verkehrsministeriums wurden rund 45 000 Bäume gefällt und gut 53 000 neu gepflanzt. Straßenbäume mußten entweder aus Gründen der Verkehrssicherheit entfernt werden oder wenn Baumaßnahmen es zwingend erforderten.
– ‘Baum fällt!’ – meist ruft ein Mann diesen Satz in den Wald. Doch auch Frauen interessieren sich für die Arbeit mit der Motorsäge. In einem Spezialkurs im Thüringer Wald lernen sie die sichere Bedienung.
– Die Nachfrage nach Holz wächst weltweit. In deutschen Wäldern werden zu viele Bäume gefällt, deshalb muss die Politik Anreize für eine andere Bewirtschaftung von Wäldern setzen, fordern Umweltorganisationen.
– Korruption und mangelnde Kontrollen führen in Bulgarien zum illegalen Abholzen von Bäumen in grossem Stil. In dem EU-Land würden seit 2006 jedes Jahr 2,4 Millionen Kubikmeter Holz gesetzeswidrig gefällt.
– Ende der weltweiten Abholzung bis 2030: Auf der UN-Klimakonferenz wurde eine ‘New Yorker Wald-Erklärung’ unterzeichnet. Denn der Klimawandel wird durch Abholzung von Bäumen massiv beeinflusst.
– Eine Studie auf Basis von Langzeitdaten zeigt, dass mitteleuropäische Bäume um bis zu 70 Prozent schneller wachsen als noch 1960.
– Kaum haben die Kastanienbäume den Miniermottenfraß überstanden, heißt es nun: In Niedersachsen und Thüringen ist ein neuer Kastanien-Schädling angekommen. Das Bakterium Pseudomonas syringae.pv.aesculi wurde jetzt zweifelsfrei nachgewiesen. Es wird von Wind, Vögeln und Regen übertragen und schädigt die Wasserbahnen der Bäume. Dadurch sterben die Kronen ab. Außerdem gibt es am Stamm einen dunklen Schleimfluss. Junge Bäume sterben ab, während ältere bessere Überlebenschancen haben. Im übrigen führte der Anstieg der Temperaturen dazu, dass die Kastanien schon jetzt von den Bäumen fallen.
– In Bombay steht mitten auf einer vielbefahrenen Straße ein großer Baum. Er ist von einer meterhohen Mauer umgeben. Weil immer wieder Autofahrer dagegen fahren, wollen viele Mittelschichtler, dass man den Baum fällt. Nun sprach der Polizeipräsident ein Machtwort: “Der Baum bleibt, es sind höchstens Betrunkene, die dagegen fahren.”
– “Vor dem Gartenhaus stehen drei Birken, die heißen Schuld und Sühne. Ich weiß, welche die Liebste mir ist.” Diesen Dreizeiler von Sascha Anderson gibt es neuerdings auf Streichholzschachteln.
– Die Westfalenpost schreibt: Eine Inventur der Förster und Waldbesitzer ergab: es gibt bundesweit 90 Milliarden Bäume, sie bedecken ein Drittel des Landes. Über eine Million Menschen arbeiten im Cluster Holz. Seit 2002 ist der Wald dennoch gewachsen. In Berlin ergab eine Zählung, dass es hier 438.000 Straßenbäume gibt.
– Die Stadt Essen ließ einige 30 Jahre alte Gingko-Bäume fällen – weil sie stanken und die Anwohner sich deswegen beschwert hatten. Die weiblichen Pflanzen tragen erst nach 20 Jahren Früchte, deren Geruch erinnert an Erbrochenem.
– In Melbourne werden Bäumen neuerdings Hormonspritzen gegeben, damit will man dort den Leuten mit Heuschnupfen das Leben erleichtern. Die Hormone werden rund um die Stämme von Platanen in den Boden gespritzt. Sie sollen die Absonderung von Blütenstaub unterdrücken, berichtet der Schweizer “Blick”.
– Orthopäden und Unfallchirurgen spendeten der Stadt Berlin zehn Bäume, die FAZ fragte sich deswegen: “Gibt es nicht etwa schopn genug beklagenswerte Unfallopfer im Straßenverkehr, die ihr Leben an Bäumen lassen?”
– Tatsächlich sind die Nachrichten-Suchmaschinen voll mit mehr oder weniger tödlichen Unfällen, bei denen jemand mit seinem Auto gegen einen fuhr. An einigen ostdeutschen Landstrassen, wie die zwischen Berlin und Cottbus z.B., steht inzwischen an jedem zehnten Baum ein Kreuz, weil sich dort ein angetrunkener Jugendlicher auf dem Weg von der Disco nach Hause totfuhr. Seit dem 21.10. sind die Nachrichten-Suchmaschinen jedoch voll mit Baumopfern: Der Sturm “Gonzalo” hat, vor allem in Süddeutschland, Österreich und der Schweiz, zigtausend Bäume umgerissen.
. Stephan Thiel und ich fragten einen jungen mongolischen Schamanen, Sukhbaatar Tughsbayar, im taz-café: Was haben Sie bisher in Berlin erlebt?
“Ich bin erst seit fünf Tagen hier. Wenn ich durch Berlin fahre, dann sehe ich schon, dass man versucht, und das selbst an Baustellen, die Bäume zu schonen. Im Tiergarten habe ich meine Ringe auf die Erde fallen lassen, daraufhin habe ich meinen Schutzgeist gehört: ‘Nimm deine Ringe von der Erde, sie vergiftet die Ringe’. Das habe ich nicht verstanden, da doch alles so schön grün war. Da hat mir meine Schutzgeist erklärt: Diese Pflanzen werden chemisch gedüngt, damit sie schneller wachsen. Die Natur will normalerweise, dass die Pflanzen mit den Insekten zusmmenleben. Aber hier waren kaum Insekten. Dadurch kann die Natur nicht ins Gleichgewicht kommen.”
.

Photo: goruma.de




hallo,
es wird höchste Zeit, dass sich BAUMWÄCHTER in Berlin einnisten. Wie das geht, steht auf unserer Seite.
Baumstarke Grüße vom Rhein
Andi van de Böömbützer
Aktion BAUMWÄCHTER