»Der Jäger muss jagen. Der riecht Blut, die Angst und den Kot, wenn sie sich einkacken. Seid wie die Hunde. Ihr wollt das Fleisch.«
Die ersten Worte, an die sich der Granaten-Maier noch entsinnen kann. Die ersten und die letzten Worte im Kopf eines anderen Maiers, als er noch nicht der Granaten-Maier war. Der Offizier schickte ihn los, seinen Erkundungstrupp. Tagelange Gefechte lagen zurück, die Soldaten waren geschwächt, die Moral am Grund. Sie sollten aufräumen, im Wald, der sich entlang des Schützengrabens säumte. Endlos lag der Graben da, erinnerte Maier an die chinesische Mauer. Er hatte viel von der Welt gelesen, wenig von ihr gesehen. Und jetzt war er hier, sein erster Urlaub. Das erste Mal, dass er die Grenze seines Landes verlassen hatte. Wenn die Welt immer so ist, dachte er, überlege ich es mir doch anders, dann will ich lieber zuhause bleiben und nichts mehr von ihr sehen.
»Im Wald gibt es ein paar Scharmützel, ein paar versprengte Geister, macht dem Spuk ein Ende und schickt die Seelen zum Satan, bevor sie unseren braven Mannen nachts in die Rücken fallen«.
Die Worte waren nicht für die Frischlinge bestimmt, der Offizier richtete sie an den Feldwebel und seine Jungs, die alten Hasen, die sie begleiten sollten.
»Mache dir nicht die Mühe und merk dir nicht die Namen, morgen gibt es sie nicht mehr. Die sind sehr frisch, eine Schande von unserem Generalsstab, solche Blutjungen ins Fegefeuer zu schicken, die sollten messdienen und für uns beten, daheim beim Herrn.«
»Abmarsch!«, brüllte der Feldwebel.
Sie trotteten durch den Schlick und totes Holz. Der Feldwebel war ein frommer Mann.
»Wie hat der heilige Antonius, so schön besungen? Auf ihr Säcke, damit euch warm wird!«
Klagelaute und Katzenjammer setzen ein. Der Wind schien Gefallen am Musizieren zu finden, er setzte ein, heulte und trieb die Melodie durch die Lücken im Geäst und des Laubbaldachins:
»Atme in mir, Du Heiliger Geist! Dass ich Heiliges denke.
Treibe mich, Du Heiliger Geist! Dass ich Heiliges tue.
Locke mich, Du Heiliger Geist! Dass ich Heiliges liebe.
Stärke mich, Du Heiliger Geist! Dass ich Heiliges behüte.
Hüte mich, Du Heiliger Geist! Dass ich es nimmermehr verliere.«
Eine Flammenzunge brannte über dem Haupt des Feldwebels, der Heilige Geist war bei ihm. Er war ein frommer Mann. Ein Begräbnis, genau, das war es und alle grölten für die Verstorbenen. Aus einer erdigen Kuhle im Humus vernahmen die Soldaten schwache Stimmen in einer anderen Sprache. Da sang einer auf Französisch. Er schien den heiligen Antonius nur allzu gut zu kennen und stimmte mit seinem brüchigen Stimmchen ein. Als sie näher kamen, sahen sie das Blut, das aus seinen Lefzen lief.
»Sacre-Bleu«, kam es dem Gefreiten über die Lippen.
»Der ist halb tot, helf ́ma ihm zum heilig Geist.«
»Von wegen«. Der Gefreite.
Der Feldwebel war ein frommer Mann. Entschlossenheit strahlte er aus, kein Wunder, die Flammenzunge prangte über seinem Antlitz.
»Der kann noch nicht mal die Waffe heben, verschwende keine Munition, die wirst du noch brauchen. Der Kerle macht auch so nicht mehr lange mit.«
»Sprechen kann er, muss nur Brüllen, dann stehen schon die anderen Franzosenbürschle doa«, entgegnete der Gefreite.
»Das tun sie auch so, bei unserem Gesang. Wundert mich sowieso, dass noch keiner doa ist. Uns gehört haben sie längst. Laufen denen gleich in die Bajonette.«
Das war ein anderer Jäger, kein sonderlich frommer Mann aus dem pietistischen Süden.
»Reitet dich der Deibel, wir rufen den heiligen Geist an. Ich verbiete mir ihren ketzerischen Dilettantismus«. Nach wie vor war er entschlossen, fiebrig erregt, der Feldwebel.
»Da Meier, keine Meinung, was? Nimm den Spaten und stopf ihm das Maul mit der feuchten Erde.«
Er tat wie geheißen, nasse Augen glänzten ihn an.
»Le Saint-Esprit.«
»Abmarsch!«
In der Nacht schreckte er auf. Eine Granate schlug bei den Zelten ein und feucht-ledrige Fetzen des Gefreiten schwirrten durch die kühle Nachtluft. Schüsse flogen, alle schossen um sich, trafen Freund und Feind. Maier suchte nach etwas Vertrautem und erblickte ein schwaches Glimmen. Es war die Feuerzunge des Feldwebels. Er bäumte sich auf, schrie Befehle und rezitierte dazwischen den bewährten Gesang des heiligen Antonius. Als Maier auf ihn zustürmte, stach er ihm mit aufgestecktem Bajonett in den Oberarm. Schmerzerfüllt stürzte er zu Boden, die Flamme erlosch.
»Aufräumen. Weg mit dem Schlick, sucht brauchbare Munition.«
Stille. Die Angreifer mussten tot sein, Maier blutete.
»Was ist mit dem Jungen Maier?«
»Der ist kein Jäger, unbrauchbar. Den hätten sie zu den Grenadieren schicken müssen, ich hätte das gleich erkannt, wenn ich den vor mir gehabt hätte, aber ich bin ja nicht oben«, so der Feldwebel.
»Ham wa ne Bahre, dann lad ma den Maier uff.«
»Nein auf keinen Fall, der verblutet, ich hab ihm aus Versehen den Arm aufgeschlitzt. Wenn die oben das erfahren, dann komm ich vors Militärgericht. Lassen wir den Maier hier. Das ist ein tüchtiger Junge. Machen sie was draus, Maier. Sie sind vom Kriegsdienst entlassen. Sie haben Urlaub, ist normalerweise eine hübsche Gegend hier, sagten zumindest die Franzosenbürschle als wir in der Heiligen Nacht Karten gespielt haben.«
Sie trotteten ab, aus der Ferne vernahm Maier noch die Anrufung des Heiligen Geistes und stieg in den Klagegesang mit ein. Drei Nächte lag er da, zwischen dem Gestank, der faulen Erde und den verstümmelten Leibern.
Am vierten Tag gabelten ihn die Sanitäter auf. Im Lazarett nahmen sie ihm am fünften Tage den beschädigten Arm ab.
»Junger Mann, da hätten wir noch was machen können, aber jetzt können wir froh sein, dass die Fliegen und ihre Maden noch nicht ins gesunde Gewebe vorgedrungen sind. Sie hatten einen wahren Schutzengel mein Lieber, normalerweise erliegt man an der Sepsis.«
Am sechsten Tage erhielt er eine Prothese aus mattem Stahl. Am siebten war Maier wieder in Deutschland.
In der Heimat musste er grinsen. Grinsen für 100 Reichsmark, während die Kameras blitzten. Er, der geschundene Krüppel hatte keinerlei Nachteile auf der Heimatfront. Sein mechanischer Arm ein wahres Präzisionswerkzeug für das Sortieren von Patronenhülsen in der Kriegsmaschinerie.
Maier hielt es dort nicht lange aus, seine Hand schmerzte, obwohl da keine mehr war. Das Gelenk knarzte bei jeder Bewegung. Das Fleisch faulte, bildete Blasen und färbte sich gelblich am Verbindungsstück zwischen Metall und Knochen. Er wollte zurück, dahin wo sein echter Arm, zusammen mit tausend anderen, in feuchter Erde verschüttet wurde.
Maier meldete sich freiwillig. Die Fahrt ging erneut nach Westen, diesmal zu den Grenadieren. Er befolgte den Rat des gesegneten Feldwebels und versuchte erneut dem Vaterland zu dienen. Er sah seine Mutter nie wieder, seine verwitwete Mutter sah ihn nie wieder.
»Willkommen zurück, Granaten-Meier«. Sie lachten über ihn, spotteten darüber, dass der
einarmige Krüppel zurück zu den anderen halbtoten Affen kam und das freiwillig.
»Mit de gsunde Arm konn ner Granate werfe«.
Maier bat darum, seine Prothese zu modifizieren, aus dem Sortierwerkzeug sollte ein Spaten werden.
Die anderen lachten über ihn und seinen feurigen Eifer. Er brannte und konnte kaum das erste Scharmützel erwarten. Am Vorabend des morgendlichen Sturmangriffs schlich sich Maier in die Munitionskammer zu den Giftgasreserven. Dort inhalierte er das Chlorgas, seine Lungen saugten die chemische Vernichtungskeule gierig auf. Doch die toxische Wirkung konnte den Grenadier Maier nicht mehr umbringen. Es tötete nur seinen letzten Rest an Verstand und Menschlichkeit. Am nächsten Tag begann das Trommelfeuer, die Artilleriegeschosse wühlten sich Meter um Meter durch die Erde und gruben eine braune Masse aus menschlichen Überbleibseln um. Zeitgleich mit dem letzten Geschosseinschlag stürmten die Truppen nach vorne.
Es herrschte gespenstische Stille, alles war bedrückt, niemand sprach miteinander, nur das Getrappel der Schritte im Matsch war zu vernehmen. Nebelschwaden sickerten um die Gebeine der Gefallenen.
Ein einzelner Schuss durchzog die Stille. Der Schütze war ein evangelikaler Prediger aus Bochum.
Er richtete seinen Lauf auf den Grenadier Maier. Den gesonderten Befehl hierzu erhielt er von oben.
»Wir sind alle die Ausgeburten der Unterwelt. Jeder Mann hier. Doch der Maier, der ist der Abgrund, der Sohn vom Unteren, der macht den Männern Angst, senkt die allgemeine Moral und Tüchtigkeit. Schaffen sie dem ein Ende.«
Erneut ließen sie ihn zurück, seine eigenen Kameraden, zurück zwischen den verrenkten Gelenken, die wie verwitterte Kreuze aus den Boden lugten. Doch Maier wollte nicht sterben, er hatte den Krieg bereits zu sehr aufgesogen. Er war die Schreckensfratze des Krieges und der Krieg hat Bestand solange die Menschen währen, die den Krieg führen.
Er musterte sich in einer dunklen Ölpfütze und erschrak über seine trüben milchigen Augen, das spröde Leder, das sich über seine Schädel spannte und die Knochen hervorhob. Eine verzerrte Grimasse war er. Granaten Maier. Er stieß ein raues kehliges Lachen, wie das Bellen eines Hundes, aus und entfernte die Abzeichen seiner Einheit von seiner löchrigen Uniform. Der Krieg kennt keine Seite, der Krieg kennt keine Einheit, der Krieg kennt nur Opfer. Mit einem Band Stacheldraht baute er eine Zahnspange um seine Zähne, das einzige an seinem Körper, das gesund zu sein schien und zog sich eine Gasmaske über. Dann entfloh er in die Nacht. Als die fahle Wintersonne sich am nächsten Morgen durch die Wolkendecke kämpfte, entdeckte eine Truppe deutscher Soldaten, aus der Deckung eines Granatentrichters, die groteske Gestalt am Horizont. In Lumpen gehüllt, mit Gasmaske und einem Spaten als Arm. Schmieriges Blut tröpfelte vom Schaft des Spatens zu Boden. Der Granaten Maier hatte in der Nacht noch einige junge Franzosen und deutsche Landsleute ausmachen können. Sein Hunger war nicht gestillt, es gab noch so viel zu erledigen.
»Wer ist da, Soldat?« Die Rufe blieben ungehört. Eisen blitzte auf, der Wumms einer Granatenexplosion. Einer der Soldaten kauerte, eine Schwache Flamme züngelte über seinen Nacken. Die beiden blickten sich an, der Soldat und Granaten Maier. Der Gejagte wurde zum Jäger. Sie kannten sich aus der Jägerstaffel. »Der Feldwebel?«, raunte die mechanische Stimme Maiers.
»Unlängst beim heiligen Geist«. Der Soldat grinste, er hatte keine Angst. Er flehte nicht, er bettelte weder um seinen Tod, noch um das Leben, ganz anders als es der Granaten Maier sonst gewohnt war, wenn einer der armen Seelen das Leben aushauchte. Der grinste nur, freute sich auf das Ende. Granaten Meier sackte zusammen, sein Gelenk quietschte, dann streifte er sich die Gasmaske vom eingefallenen Kopf. Seine Zähne, seine Zähne mit Maschendraht, das einzig gesunde an ihm, blitzten in der schwachen Wintersonne. Dann riss er dem Soldaten die Kehle auf, die angespitzen Drahtschäfte schnitten sich mühelos durch das warme Fleisch. Eine Flamme erlosch. Maier stülpte sich erneut die Maske über und harrte aus. Er musste nur ausharren, der Krieg wird noch lange währen. Viele Schuldner werden noch seinen Weg passieren.
Und wenn der Krieg vorbei ist, so musste er nur weiter ausharren. Es kann nicht allzu lange dauern, bevor die Menschen erneut die Waffen gegeneinander richteten.


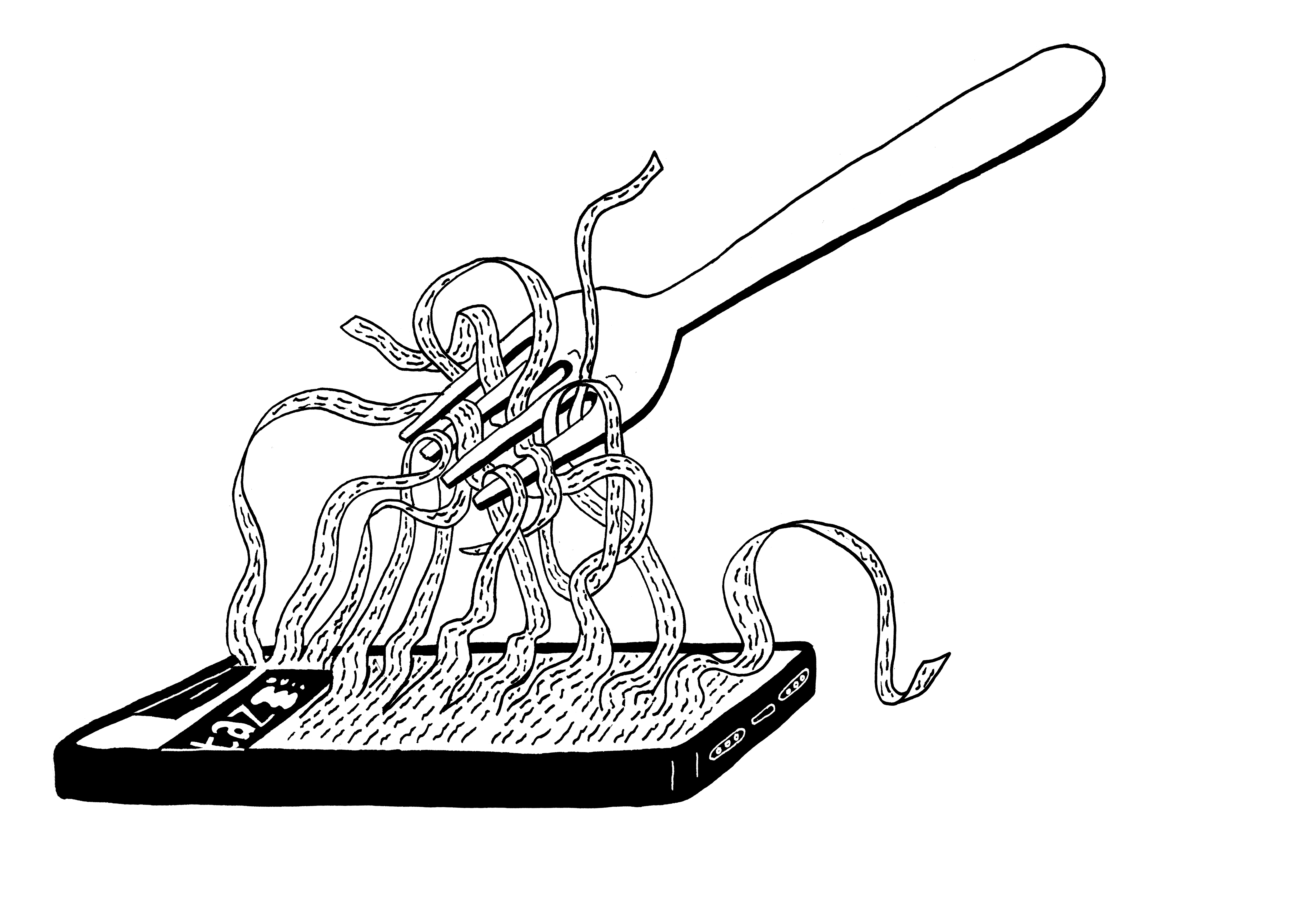
Man fühlt sich mitten drin im Schützengraben. So tief gehend beschrieben. Was für ein Blog!