Zu den morgendlichen Pflichten des (Hilfs-)Hausmeisters gehört das Anstellen der Fernsprechanlage in der Telefonzentrale, damit im ganzen Haus wieder anständig telefoniert werden kann. Darüberhinaus wird immer mehr mit Handys gearbeitet. Ich bekam die ersten zwei noch aufgedrängt – auf Baustellen-Einweihungsparties: als “In-Kontakt-Bleibe-Geschenk” der Investoren. Als ich sie an die Lokalredaktion weiterreichen wollte, winkte der CvD entsetzt ab: “Nein, das ist viel zu teuer!” Daraufhin bekam sie der Ex-Holzjournalist Christian Specht geschenkt. Heute strebt er eine Karriere als Politiker an – bei der WASG glaube ich, zuvor war er bei der PDS und den GRÜNEN aktiv. Letztere schenkten ihm mal ein Fahrrad und beschäftigten ihn überdies als Postverteiler. Die Handys verlor Christian schon nach kurzer Zeit, das Fahrrad besaß er noch eine ganze Weile. Er hat auch noch einen “Arbeitsplatz” in der taz, den er auch regelmäßig nutzt. Meistens, damit ihm mal wieder jemand ein Flugblatt gestaltet. Das Telefonieren gehört nicht zu seinen Leidenschaften. Jedenfalls seitdem er seine Holzjournalisten-Phase hinter sich gelassen hat.
Dabei wird diese Form der “Kommunikation” immer wichtiger – spätestens seit der allgemeinen Verbreitung der schnurlosen Handys, die inzwischen samt SMS abgehört werden dürfen. Gleichzeitig geriet auch den Kulturkritikern die schier manische öffentliche Telefoniererei immer öfter ins Visier – schon aus reiner Notwehr. So befaßte sich Vilém Flusser z.B. mit dem Machtgefälle zwischen dem Anrufer und den Angerufenen. Bereits zu Roland Barthes’ Zeiten spielte das (damals noch analoge) Telefon eine große Rolle im Leben der Menschen: “Ich versage es mir, auf die Toilette zu gehen, und selbst zu telephonieren, um die Leitung freizuhalten,” schrieb er in den “Fragmenten einer Sprache der Liebe” 1984. Jetzt gibt es bald keinen einzigen Spielfilm mehr, in dem die Handlung nicht durch einen oder mehrere Anrufe immer wieder in Schwung gebracht wird. Das Mobiltelefon, das unsere “availability” revolutioniert hat, ist ein direktes Resultat der Kybernetik und Waffenlenk-Systemforschung – also ein Produkt des Zweiten Weltkriegs, aus der zunächst die Computer- und Gentechnik hervorging.
Auch in früheren Kriegen trug das Telefon schon das Seinige zum Sieg bei, erst recht in Revolutionen und Bürgerkriegen. Telefon und Telegrafie wurden im so genannten “Imperialen Zeitalter” (1875-1914) erfunden. Letzteres “ermöglichte nunmehr die Übermittlung von Nachrichten um den gesamten Erdball innerhalb weniger Stunden,” schreibt Eric Hobsbawm. Vom Telegrafen gelangten die Nachrichten in die damals ebenfalls neuen Publikumszeitungen. Trotzki war ein geradezu fanatischer Zeitungsleser (und -schreiber) – er interessierte sich für jede noch so kleine Nachricht aus jedem Land der Erde – und auch das Telefon wußte er bald virtuos zu nutzen. Laut Hobsbawm breiteten sich die Telefonanschlüsse um 1900 weltweit wie folgt aus: Unter den Großstädten hatte St.Petersburg die wenigsten: dort stiegen sie im Zeitraum zwischen 1895 und 1911 von 0,2 auf 2,2 Anschlüsse je 100 Einwohner; in New York von 0,6 auf 8,3; in Chicago von 0,8 auf 11,0 und in Stockholm von 4,1 auf 19,9. Die meisten Anschlüsse besaß damals Los Angeles, wo sie sich im fraglichen Zeitraum von 2,0 auf 24,0 für je 100 Einwohner exakt verzwölffachten – und zwar wegen der dort 1911 loslegenden Filmindustrie (!).
In Leo Trotzkis Autobiographie “Mein Leben” kommt das “Telefon” vor der russischen Revolution nur einmal vor. Es wird aber sogleich in seiner revolutionären Bedeutung von ihm erkannt. Das war, als er und seine Familie aus ihrem französischen Exil ausgewiesen wurden – und Ende 1916 in New York landeten, wo sie in einer Arbeitergegend eine billige Wohnung fanden, die jedoch überraschenderweise mit Bad, elektrischem Licht, Lastenaufzug und sogar mit einem Telefon ausgestattet war. Für Trotzkis zwei Söhne wurde das Telefonieren in New York “eine Weile zum Mittelpunkt ihres Lebens: Dieses kriegerische Instrument hatten wir weder in Wien noch in Paris gehabt.” Aber dann spielte der Apparat für Trotzki erst wieder im darauffolgenden Jahr in St.Petersburg – während der Machtübernahme der Bolschewiki – eine, zunehmend wichtiger werdende, Rolle.
Seine erste Bemerkung über das “kriegerische Instrument” betraf jedoch erst einmal dessen Nichtfunktionieren (den “Punkt Null” – mit Roland Barthes zu sprechen): “Auf dem Telefonamt entstanden am 24.10. Schwierigkeiten, dort hatten sich die Fahnenjunker festgesetzt, und unter ihrer Deckung waren die Telefonistinnen in Opposition zum Sowjet getreten. Sie hörten überhaupt auf, uns zu verbinden.” Das Revolutionskomitee, deren Vorsitzender Trotzki war, schickte eine Abteilung Soldaten mit zwei Geschützen hin, dann “arbeiteten die Telefone wieder. So begann die Eroberung der Verwaltungsorgane.”
In seiner “Geschichte der russischen Revolution”, die Trotzki neben seiner Autobiographie im türkischen Exil (1929-1933) schrieb, heißt es dazu ergänzend: “Es genügt ein nachdrücklicher Besuch des Kommissars des Kexholmer Regiments im Telephonamt, damit die Apparate des Smolny wieder angeschlossen waren. Die Telephonverbindung, die schnellste von allen, verlieh den sich entwickelnden Ereignissen Sicherheit und Planmäßigkeit…Dshershinski händigte dem alten Revolutionär Pestkowski einen Papierfetzen aus, der ein Mandat auf den Posten eines Kommissars des Haupttelegraphenamtes darstellen sollte. – ‘Wie das Telegraphenamt besetzen?’ fragte nicht ohne Staunen der neue Kommissar. – ‘Dort hält das Kexholmer Regiment Wache, das auf unserer Seite ist!’ Weiterer Erklärungen bedurfte Pestkowski nicht. Es haben zwei mit Gewehren versehene Kexholmer am Stromschalter genügt, um ein zeitweiliges Kompromiß mit den feindlichen Telegraphenbeamten, unter denen es nicht einen Bolschewik gab, zu erreichen. Um 9 Uhr abends besetzte ein anderer Kommissar des Militärischen Revolutionskomitees, Stark, mit einer kleinen Abteilung Seeleute unter dem Kommando des Matrosen Sawin, eines früheren Emigranten, die amtliche Telegraphenagentur, was nicht nur das Schicksal der Institution selbst, sondern bis zu einem gewissen Grade auch sein eigenes bestimmte: Stark war erster Sowjetdirektor der Agentur, bevor er Sowjetgesandter in Afghanistan wurde. Stellten diese zwei bescheidenen Operationen Akte des Aufstandes dar oder nur Episoden der Doppelherrschaft, allerdings von dem versöhnlerischen auf das bolschewistische Geleise umgeleitet? Die Frage kann begründeterweise kasuistisch erscheinen. Aber für die Tarnung des Aufstandes hatte sie immer noch gewisse Bedeutung. Tatsache ist, daß sogar das Eindringen der bewaffneten Matrosen noch den Charakter der Halbheit trug: formell handelte es sich vorläufig nicht um die Besetzung des Amtes, sondern nur um die Errichtung einer Telegrammzensur. Somit wurde bis zum Abend des 24. die Nabelschnur der ‘Legalität’ nicht endgültig durchschnitten, die Bewegung deckte sich noch immer mit den Resten der Doppelherrschaftstradition.”
Der nach 1945 im schwedischen Exil gebliebene Schriftsteller Peter Weiss hat diesen bolschewistischen Kampf ums Telefon in sein Stück “Trotzki im Exil” eingebaut, das er 1969 in der DDR uraufführen lassen wollte, wo man es jedoch als “durch und durch antisowjetisch” begriff: “Ein Telephon wird bedient”. Dshershinski erklärt: “Am Telegraphenamt haben wir das Kexholmer Regiment. Zwei Mann an die Hauptschalter. Das genügte. Die Beamten begriffen, wer hier bestimmt.” Ein Matrose ergänzt: “Das war ein Geschrei, als wir mit unserm Trupp kamen. Die Telephonistinnen hysterisch durcheinander. Werfen die Arme hoch. Was ist Frauen, glaubt ihr, wir wollen euch erschießen? Ihr könnt gehn. Wir werden mit den Apparaten schon fertig. Und die raus. Die ganze Morskaja Straße voll von kreischenden Mänteln und Hüten (Gelächter).” Ähnlich bemächtigte sich die Revolution dann laut Peter Weiss auch der anderen Institutionen. Ein Matrose berichtet: “Wir haben die Staatsbank besetzt” – die der Bolschewik Rakowski als “die heiligste aller Institutionen” bezeichnete. Der Matrose schildert ihr Vorgehen: “Am Jekaterinski Kanal ein Zug von Kadetten. Wie die uns sehn, gaffen sie nur. Wir haben den Auftrag, die Bank zu schützen, sagen wir. Die lassen uns vorbei, ohne Widerstand. Wir ins Gebäude rein. Die Türen waren nicht mal verschlossen. Haben gleich an jedem Telefon einen Posten aufgestellt.”
Trotzki hielt sich derweil im Smolny auf, mit Kamenjew belegte er das Eckzimmer, wo Tag und Nacht “Telefonanrufe” ankamen, wie er schreibt. Das Eckzimmer glich “der Kommandobrücke eines Kapitäns, im Nebenzimmer war eine Telefonzelle – es klingelte ununterbrochen.” Wegen dieser “Führungsposition” hat ihn später der Kriegsberichterstatter Curzio Malaparte als Drahtzieher eines “Staatsstreichs” bezeichnet, den Malaparte jedoch nicht von einem Volksaufstand geschweige denn einer Revolution unterschied. 1932 ging Trotzki in seiner “Kopenhagener Rede” kurz auf den mit vermeintlich abgehörten in Wahrheit jedoch ausgedachten Dialogen zwischen ihm und Lenin gestützten “Unsinn” dieses “faschistischen Theoretikers” ein.
Im Oktober 1917 war es kalt in Petrograd. “Es fehlte Kohle.” Die Straßenpatrouillen wärmten sich an offenen Feuern. “An zwei Dutzend Telefonen konzentrierte sich das geistige Leben der Hauptstadt. Man rief mich aus Pawlowsk an,” heißt es bei Trotzki weiter. Er erteilte den Kommissaren Befehle. Doch war er sich der Macht seiner Befehle “selbst nicht ganz sicher.” Zudem “werden alle Gespräche telefonisch geführt” – und sind so den “Agenten der Regierung vollständig zugänglich”. Trotzki beruhigt sich mit dem Gedanken, dass sie wahrscheinlich gar nicht mehr imstande seien, “unsere Gespräche abzuhören”. Alle “wichtigen Punkte der Stadt” gehen nach und nach “in unsere Hände über; fast ohne Widerstand, ohne Kampf, ohne Opfer. Das Telefon klingelt: ‘Wir sind hier.'”
Vor dem Petrograder Sowjet berichtet er anschließend über die Lage: “Wir haben die Nacht durchwacht und telefonisch beobachtet” – wie die revolutionären Soldaten und Arbeiter “lautlos ihre Sache durchführten. Der Bürger hat friedlich geschlafen.” Kamenjew wurde dann von Lenin abgelöst. Einmal lagen er und Trotzki zusammen auf einer Matraze und unterhielten sich noch – müde. Plötzlich schreckte Lenin hoch: “Und das Winterpalais – ist doch bis jetzt noch nicht eingenommen?” Trotzki wollte schon aufstehen, um sich “telefonisch zu erkundigen”, aber Lenin sagte, “bleiben Sie liegen, ich werde jemand damit beauftragen.” Ein andern Mal meinte er zu Trotzki: Ob die Bolschewiki an der Macht bleiben würden, das könne man nicht voraussehen. Man müsse aber unter allen Bedingungen möglichst viel Klarheit in die revolutionären Erfahrungen der Menschheit hineibringen: “Es werden andere kommen und, auf das von uns Vorgezeichnete gestützt, einen neuen Schritt vorwärts tun.” Deswegen arbeitete Lenin laut Trotzki vor allem mit präzise formulierten “Dekreten”, die jedoch “eine mehr propagandistische als administrative Bedeutung” hatten. Bei ihrer Formulierung stützte er sich vor allem auf seine “Kraft der realistischen Vorstellungsgabe”. Bei Peter Weiss gibt es dazu eine Regieanweisung: “Die meisten ab. Nur Lenin und Trotzki vorn. Im Hintergrund der Telephonist. Hin und wieder Meldegänger ein und aus. Lenin legt sich auf das Feldbett. Trotzki, in seiner Nähe, streckt sich auf ein paar aneinandergestellten Stühlen aus. Eine Arbeiterin legt ihnen ein paar Soldatenmäntel über.”
Als Trotzki dann – lustlos – das Außenministerium übernahm, ordnete er als erstes an, dass die ständig “falsche Meldungen” aussendenden Franzosen in Petrograd “den Empfangsapparat der drahtlosen Telegraphie aus der Militärmission” stilllegten. Als Grigori W. Tschitscherin aus dem Gefängnis kam und sein Amt übernahm, war er froh: “Manchmal beriet sich Tschitscherin noch telefonisch mit mir.” Nach dem Umzug der Revolutionsregierung in den Moskauer Kreml bemühten sich Lenin und Trotzki noch energischer, die Arbeit zu straffen und zu effektivieren, dazu gehörten u.a. telefonische Absprachen: Wenn in einer Sitzung ein wichtiges Problem diskutiert werden sollte, “bestand Lenin telefonisch darauf”, dass Trotzki sich “vorher mit der zu behandelnden Frage vertraut” machte. Wenn Lenin ernsthafte Opposition befürchtete, “ermahnte” er ihn “telefonisch: ‘Kommen Sie unbedingt zur Sitzung…” Nachdem Trotzki Kriegskommissar geworden war, verkehrte er mit Lenin sogar “hauptsächlich telefonisch”. Wenn die Ämter ihm z.B. mit “Beschwerden über die Rote Armee” zusetzten, “dann klingelte Lenin sofort bei mir an”.
Nachdem Trotzki den Militärarzt Skljansky zu seinem Stellvertreter ernannt hatte, “sprach” dieser vom Kriegsamt aus “unaufhörlich rauchend über die direkten Telefonleitungen”. Umgekehrt konnte Trotzki ihn noch “in der Nacht um zwei, um drei Uhr anrufen” – Skljansky war immer im Büro. Wenig später ist irritierenderweise sogar von einer “Autorität der Leitung” im Text die Rede.
Am 7. November wandte sich Trotzki “radiotelegraphisch an die Staaten der Entente und an die Mittelmächte – mit einem Vorschlag”. In Brest-Litowsk kam es daraufhin zu Friedensverhandlungen: “Sowohl wir als auch unsere Gegner mußten über eine direkte Leitung mit den jeweiligen Regierungen Verbindung unterhalten. Die Leitung versagte nicht selten.” Ob die “Störungen” auf Absicht oder technisches Versagen zurückzuführen waren, konnte Trotzkis Delegation nicht klären.
Nachdem die Sowjettruppen Kiew besetzt hatten, stellte “Radek über eine direkte Leitung die Frage nach der Situation” dort. Woraufhin ihm ein “deutscher Telegraphist von einer Zwischenstation aus” und ohne zu wissen, wer am anderen Ende der Leitung war, mitteilte: “Kiew ist tot.” Trotzki telefonierte von Brest-Litowsk aus mit Lenin. Sie waren sich einig: Es ging darum, Zeit zu gewinnen und notfalls, sollten die Deutschen wieder angreifen, zu kapitulieren. “Schon damit allein werden wir die Legende von unserer heimlichen Verbindung mit dem Hohenzollern einen vernichtenden Schlag versetzen,” meinte Trotzki. Und Lenin war der Meinung: “Die deutsche Revolution ist unermeßlich wichtiger als die unsrige.” Den beiden hatte man unterstellt, quasi im Auftrag von Ludendorff in Russland die Revolution angezettelt zu haben. Ihre Gespräche über “die Huges-Leitung galten offiziell als gegen Abhören und Auffangen gesichert. Wir hatten jedoch alle Veranlassung, anzunehmen, dass die Deutschen in Brest unsere Korrespondenz über die direkte Leitung lasen: wir hatten genügend Respekt vor ihrer Technik. Die gesamte Korrespondenz zu chiffrieren war unmöglich. Wir konnten uns im übrigen auch auf die Chiffrierung nicht verlassen.”
Erst während des zweiten Weltkriegs wurde ernsthaft an einem abhörsicheren Telefon (für Stalin) mit sofortiger Verschlüsselung der gesprochenen Sprache gearbeitet – u.a. waren der Mathematiker Alexander Solschenizyn, der Sprachwissenschaftler Lew Kopelew und der Ingenieur Dimitri Panin als Häftlinge an diesem “Geheimprojekt” beschäftigt. Solschenizyn hat ihre intellektuelle Zwangsarbeit in seinem Buch “Der erste Kreis der Hölle” beschrieben, Kopelew in “Aufbewahren für alle Zeiten” und Panin in den “Notebooks of Sologdin”.
1918 hatten die Bolschewiki “in manchen Augenblicken das Gefühl, dass alles auseinanderkrieche…Das Eisenbahnwesen war vollständig desorganisiert. Der Staatsapparat kaum im Werden.” Und die Kommunikation wurde immer schlechter. Als Oberkommandierender begab sich Trotzki an die Südfront – mit einem “Eisenbahnzug”, den er sich jedoch erst einmal mühsam “zusammenstellen” mußte. Dazu gehörte dann “ein Sekretariat, eine Druckerei, ein Telegraphenamt, eine Telefunken- und eine elektrische Station, eine Bibliothek, ein Badebetrieb” – und eine eigene “Zugzeitung” namens “WPuti” (Unterwegs). Ferner eine schnelle Eingreiftruppe, die dann wie alle im Zug Lederjacken trug. Der Telegraph im Zug arbeitete ununterbrochen. “Wir konnten uns über eine direkte Leitung mit Moskau verbinden, und mein Vertreter Skljanski empfing von mir die Aufstellung der für die Armee notwendigen Ausrüstungsgegenstände.” Mindestens 105.000 Kilometer legte Trotzkis Zug, der von zwei gepanzerten Loks gezogen wurde, zurück. Und überall, wo er hinkam “nistete Verrat”. Bei einer vorderen Batterie empfing ihn einmal ein Artillerieoffizier. “Er bat um Erlaubnis, abzutreten und telefonisch einen Befehl zu erteilen”. Kurz darauf schlugen “in nächster Nähe” von Trotzki zwei Granaten ein. Erst lange danach wurde ihm klar, dass “der Artillerist telefonisch über irgendeinen Zwischenpunkt der feindlichen Batterie das Ziel angegeben hatte”. Im Nachhinein ließ sich aber sagen: Dieser “Krieg war eine große Schule.” Kam noch hinzu: “In jenen Jahren habe ich mich, wie mir scheint, für immer daran gewöhnt, unter Begleitung der Pullmannschen Federn und Räder zu schreiben und zu denken…Die meisten Fahrten entfielen auf das Jahr 1920.”
Trotzki zur Seite stand damals der “Hauptleiter der 5.Armee” I.N. Smirnow, der “den komplettesten und vollendetsten Typus des Revolutionärs” verkörperte. Er war danach u.a. “Volkskommissar für Post und Telegraphenwesen” – und wurde dann als “Trotzkist” in den Kaukasus verbannt. Im Zug erhielt Trotzki einmal ein “chiffriertes Telegramm von Lenin und Swerdlow”, in dem es um “Verrat an der Saratower Front” ging. Die Front hatte sich jedoch über 8000 Kilometer ausgedehnt und es war ihm unmöglich, dort schnell hin zu gelangen – oder überhaupt einen Kontakt herzustellen. “Nicht selten reichte das Telefonmaterial nicht einmal zum Aufrechterhalten der Verbindungen”. Dafür war “auf einem besonderen Waggon eine Antenne gezogen, die es ermöglichte, unterwegs Radiotelegramme vom Eifelturm und von Nauen, insgesamt von 13 Stationen, in erster Linie natürlich von Moskau, zu empfangen. Der Zug war stets darüber orientiert, was in der Welt vorging.” Darüberhinaus waren “die Waggons miteinander durch Innentelefone und Signalvorrichtungen verbunden. Um die Wachsamkeit zu erhöhen, wurde unterwegs oft, am Tage wie in der Nacht, Alarm gemeldet.”
Gegen Ende des Bürgerkriegs wurde “der Zug in seiner Gesamtheit” mit dem Orden der Roten Fahne ausgezeichnet. Zuvor hatte man einen zweiten Panzerzug zusammengestellt, der nach Lenin benannt worden war. Zwischen beiden gab es eine direkte Verbindung. Aber auch die Weißen besaßen Panzerzüge, einer, der bei Wladiwostok operierte, spielt die Hauptrolle in Wsewolod Iwanows Bürgerkriegsroman “Panzerzug 14-69”, in dem es darum geht, wie die Partisanen ihn eroberten. Als der Roman 1970 bei Suhrkamp erschien, meinte der Klappentexter, es ginge darin um Trotzkis “roten Panzerzug”.
Als die Weißen Truppen des Generals Judenitsch sich Petrograd näherten, brach Panik unter den Bolschewisten auf. Trotzki bestand im Gegensatz zu Lenin darauf, die Stadt zu verteidigen – und organisierte den Widerstand: “Durch das Telephon im Smolny bestellte ich aus der Militärgarage ein Automobil. Der Wagen kam nicht rechtzeitig. Aus der Stimme des Aufsehers fühlte ich, daß Apathie, Verzagtheit und Kleinmut auch die unteren Schichten des Apparats erfaßt hatten.” Dennoch gelang es, Judenitschs Truppen zurückzuschlagen. Anschließend bekam Trotzki dafür selbst den Orden der Roten Fahne: “Mich brachte dieser Beschluß in eine schwierige Lage…Als ich den Orden einführte, betrachtete ich ihn als ein ergänzendes Stimulans für jene, die nicht genügend inneres revolutionäres Pflichtbewußtsein besaßen.”
“Einige Monate später ließ Lenin mich ans Telefon rufen. ‘Haben Sie das Buch von Kirdezow gelesen?’ Dieser Name sagte mir nichts. ‘Das ist ein Weißer, ein Feind, der über den Angriff Judenitschs auf Petrograd schreibt…auch über Sie…'” Am 22. März 1919 forderte Trotzki “über die direkte Telefonleitung von dem Zentralkomitee einen Beschluß in der Frage der Ernennung einer autoritären Kommission seitens des Zentralexekutivkomitees und des Zentralkomitees der Partei.” Aufgabe der Kommission sollte es sein, “den Glauben an die Zentralsowjetmacht unter der Bauernschaft des Wolgsgebiets zu stützen…Es ist nicht uninteressant, daß ich dieses Gespräch mit Stalin führte und gerade ihm die Bedeutung der Mittelbauern auseinandersetzte.” Einer der Vorwürfe gegen Trotzki lautete später: Er habe die Bauernfrage falsch eingeschätzt. Ein anderer Vorwurf betraf die allzu konsequente Umwandlung von autonomen Partisanengruppen und -banden, die über ihre Angriffe abstimmten und ihre Führer wählten – in befehlempfangende Truppenteile der Roten Armee: “Das chaotische Partisanentum war der Ausdruck der bäuerlichen Grundlage der Revolution”. Damit zusammenhängend erregte auch Trotzkis Weiterverwendung von zigtausend zaristischen Offizieren an der Front allgemeinen Unwillen. Aber, so Trotzki, die “Kommunisten fanden sich nicht leicht in die militärische Arbeit hinein…Noch von Kasan telegraphierte ich an Lenin: ‘Nur solche Kommunisten herschicken, die fähig sind, sich unterzuordnen, Entbehrungen zu ertragen und gewillt sind, auch zu sterben. Leichtgewichtige Agitatoren braucht man hier nicht.”
Ein weiteres Problem war Zarizyn, das spätere Stalingrad, wo unter Stalins und Woroschilows Leitung auf andere Weise eine von “Selbständigkeitsbestrebungen” geprägte “Linie” verfolgt wurde. “Am 4.Oktober 1918 sagte ich über die direkte Leitung aus Tambow zu Swerdlow und Lenin: “Ich bestehe kategorisch auf der Abberufung Stalins. Die Zarizyner Front ist unsicher. Ich habe sie verpflichtet, zweimal am Tag über die Truppenbewegungen und den Kundschafterdienst zu berichten. Wenn das bis morgen nicht geschehen sollte, übergebe ich Woroschilow dem Gericht…” Am 10. Januar 1919 “berichtete” Trotzki dem damaligen Vorsitzenden des Zentralexekutivkomitees Swerdlow “von der Station Grjasi aus”, dass die “Zyrizyner Linie” in die Katastrophe führe. Am 30.Mai bekam Trotzki von Lenin “über die direkte Leitung nach der Station Kantemirowka” mitgeteilt, dass man daran denke, eine besondere unkrainische Armeegruppe unter dem Kommando von Woroschilow zu bilden. Trotzki lehnte das entschieden ab. Wenig später teilte ihm Lenin “über die direkte Leitung mit: ‘Dybenko und Woroschilow schleppen das Kriegsgut auseinander'” – das sie zuvor den Weißen abgenommen hatten. Überhaupt besprach Lenin oft mit Trotzki “telephonisch den Gang einer Sache”.
Aber es wurde März – 1923. “Lenin lag in seinem Zimmer im großen Senatsgebäude. Es nahte der zweite Schlaganfall.” Trotzki war für einige Wochen durch einen Hexenschuß ans Bett gefesselt: “Weder Lenin noch ich konnten ans Telefon gehen, außerdem waren Lenin von den Ärzten telephonische Gespräche strengstens untersagt.. Zwei Sekretärinnen Lenins, Fotijewa und Glasser, dienten als Verbindung.” Fünf Seiten weiter heißt es bereits: “Stalin stand am Steuer des Apparates”. Als Trotzki wieder aufstehen konnte, ging er seltsamerweise erst einmal auf die Jagd. Als es Lenin etwas besser ging, wollte er ebenfalls mit auf die Jagd gehen. “‘Dürfen Sie?’ fragte vorsichtig Muralow. ‘Ich darf, ich darf, man hat es mir erlaubt, also Sie nehmen mich mit?’ ‘Gewiß…’ ‘Dann werde ich Sie anrufen…’ ‘Wir werden warten.’ Aber Iljitsch hat nicht angerufen. Die Krankheit läutete an. Und dann der Tod.” (alles am Telefon?!) Am 21. Januar 1924 befand sich Trotzki in Tiflis: “Ich saß mit meiner Frau im Arbeitsabteil meines Waggons.” Man reichte ihm “ein dechiffriertes Telegramm von Stalin, daß Lenin gestorben sei…Ich ließ mich über eine direkte Telegraphenleitung mit dem Kreml verbinden…Die Tifliser Genossen verlangten, dass ich mich sofort zum Tode Lenins äußere.” Trotzki setzte sich hin und verfaßte einige Abschiedszeilen. “Den Text…gab ich über die direkte Leitung nach Moskau weiter.” Dann kam der nächste Schlag: Trotzkis enger Vertrauter Skljanski fuhr nach Amerika – und ertrank beim Bootfahren in einem See. Und die Urne mit seiner Asche wollte das Sekretariat des Zentralkomitees dann nicht auf dem Roten Platz in der Kremlmauer, “die das Pantheon der Revolution geworden” war, einmauern lassen – sie sollte außerhalb der Stadt beigesetzt werden. “Den Ekel überwindend telephonierte ich Molotow an. Doch der Beschluß blieb unerschüttert. Die Geschichte wird auch diese Frage revidieren.”
Während man im Kreml an seiner Entmachtung arbeitete, wurde Trotzki erneut krank. “Morgens brachte man mir die Zeitungen ans Bett. Ich sah die Telegramme durch.” Er fuhr in Begleitung seiner Frau nach Berlin, wo ihm die Mandeln rausoperiert wurden. “Wir besuchten das Baumblütenfest in Werder.” Wieder zurück in Moskau war er immer noch krank. “Ich wohnte in jenen Tagen nicht mehr im Kreml, sondern in der Wohnung meines Freundes Beloborodow”. Dieser hielt sich damals im Ural auf – formal war er noch Volkskommissar des Innern, aber die GPU war ihm schon “auf den Fersen”.
Auch Trotzkis vielleicht engster Freund Joffe war krank – und wurde immer depressiver. “Ich klingelte in Joffes Wohnung an, um mich nach seiner Gesundheit zu erkundigen. Er antwortete selbst: das Telephon stand an seinem Bett…Er bat mich, zu ihm zu kommen…Etwas verhinderte mich, zu kommen.” Nur ein oder zwei Stunden später klingelte es in Beloborodows Wohnung und “eine mir unbekannte Stimme sagte am Telefon: ‘Adolf Abramowitsch hat sich erschossen’.”
Im Januar 1928 wird Trotzki mit seiner Frau und seinem Sohn nach Kasachstan verbannt. Der Tag ihres Abtransports hat sich herumgesprochen, sie sitzen zu Hause auf gepackten Koffern: “Wir warten auf die Agenten der GPU, die uns zum Zug begleiten sollen”. Niemand kommt. “Das Telefon klingelt. Aus der GPU teilt man mir mit, die Reise sei verschoben.” Alle, die noch zu ihm halten, warten bereits auf dem Bahnhof, um ihn zu verabschieden. “Fortwährend erkundigten sich Freunde telephonisch, ob wir zu Hause seien und berichteten über die Ereignisse auf dem Bahnhof.” Am nächsten Tag schliefen die Trotzkis sich erst einmal aus. “Niemand klingelte.” Aber dann füllte sich die Wohnung plötzlich mit GPU-Agenten, die auf sofortigen Abtransport drangen. “Das Telefon klingelte ununterbrochen. Aber am Telephon steht ein Agent und verhindert mit gutmütiger Miene das Antworten. Nur durch Zufall gelingt es, Beloborodow zu benachrichtigen, …dass man uns mit Gewalt wegbringen werde.” Wahrscheinlich hat dies Trotzkis Sohn erledigt. Bei Peter Weiss heißt es: “Ljowa ist schon draußen. Telegraphieren. Aber es wird nichts nützen.”Anschließend verbarrikadierten die Trotzkis sich in einem der Zimmer. Die GPU-Agenten “wußten nicht, was zu tun, schwankten, führten telefonische Unterredungen mit ihren Vorgesetzten, erhielten Weisungen….” Schließlich brechen sie die Tür auf und tragen ihn aus der Wohnung in ein Auto. Wenig später, als der Zug fuhr, war Trotzki aber schon fast wieder “in guter Stimmung.” Obwohl gezwungen, “strenge Diät zu halten, aß er alles, was man uns gab,” wie seine Frau erstaunt in ihr Tagebuch notierte. Sie selbst hatte mit “Schüttelfrost” zu kämpfen. Das Gepäck war nicht mitgekommen, sie hatten nur ein Buch dabei – über Turkestan. Trotzki las und schrieb Briefe – er “arbeitete unterwegs stets mit verdoppelter Energie, den Umstand ausnutzend, daß es weder Telefon noch Besucher gab”. Am Ziel – in Alma-Ata – nahmen sie sich erst einmal ein Hotelzimmer. Sein Sohn Ljowa machte sich derweil “mit der Stadt bekannt, zuallererst mit Post und Telegraph, die nun in unserem Leben den Mittelpunkt bilden sollten.”
Die Verbindung mit der Außenwelt lief vor allem über den Sohn. Trotzki nannte ihn “entweder ‘Minister des Äußeren’ oder ‘Post- und Telegraphenminister’.” Tagesüber schrieb er vor allem Briefe und Telegramme, abends ging er oft auf die Jagd. “So verbrachten wir ein Jahr in Alma-Ata.” Insgesamt schickte Trotzki in dieser Zeit “etwa 800 politische Briefe ab, darunter eine Reihe größerer Arbeiten, und etwa 550 Telegramme. Erhalten haben wir etwa 1000 Briefe, größere und kleinere, und etwa 700 Telegramme, in der Mehrzahl kollektive.” Dabei erreichte ihn höchstens die Hälfte, “außerdem bekamen wir aus Moskau etwa acht- bis neunmal durch besondere Boten geheime Post, …ebenso viele Male schickten wir solche Post auch nach Moskau. Die Geheimpost unterrichtete uns über alles…”
Ab Oktober 1928 “veränderte sich unsere Lage schroff. Briefe und Telegramme trafen nicht mehr ein…Der Ring um uns schloß sich immer enger.” Im Januar wurde in Moskau beschlossen, “Den Bürger Trotzki, Lew Dawidowitsch, aus den Grenzen der UDSSR auszuweisen.” Wieder wird die Familie in einen Zug verfrachtet. Der Vertreter der GPU in Alma-Ata, Bulanow, versucht unterwegs, Trotzki “die Vorzüge Konstantinopels klarzumachen. Ich lehne sie entschieden ab. Bulanow verhandelt über die direkte Leitung mit Moskau.” In Odessa war der Dampfer “Kalinin” für den Weitertransport bestimmt. “Der aber ist eingefroren. Alle Bemühungen der Eisbrecher bleiben erfolglos. Moskau steht am Telegraphendraht und treibt zur Beschleunigung.”
Man hatte Trotzki versprochen, dass seine beiden engsten Mitarbeiter Sermux und Posnanski ihm ins Ausland folgen dürfen. In Konstantinopel angekommen, erkundigte Trotzki sich beim Konsulat nach den beiden. Ein Vertreter brachte einige Tage später “die telegraphische Antwort aus Moskau: Sie würden nicht hinausgelassen werden.” Trotzki telegraphierte sodann mit deutschen sowie auch norwegischen Stellen, um in diesen Ländern politisches Asyl zu bekommen: Er möchte nicht in der Türkei bleiben, aber kein Land will ihn aufnehmen. Schließlich bleibt die Familie erst einmal, wo sie ist: auf Prinkipo – einer Insel vor Konstantinopel. Trotzki findet seinen Arbeitsrythmus wieder: Er schreibt Briefe über Briefe, Broschüren, Flugblätter, Bücher – in seine Autobiographie arbeitete er Teile des Tagebuchs seiner Frau ein. Auch telephoniert und telegraphiert wird weiterhin: das erledigt zum Teil sein “Post- und Telegraphenminister” Ljowa, vor allem aber die ihm noch immer freundlich gesinnten Genossen – in verschiedenen Ländern. In Deutschland ist es seine Übersetzerin Alexandra Ramm, Ehefrau des Herausgebers der Zeitschrift “Die Aktion” Franz Pfempfert. Unermüdlich arbeitet sie Trotzki zu, nimmt Verbindung mit Verlegern und Behörden auf, besorgt Bücher und die “Prawda” für ihn – auf seine Bitte hin sogar eine besonders reißfeste Angelschnur aus England. In Julijana Rancs Biographie über Alexandra Ramm werden nur einige wenige ihrer Telefonate für Trotzki erwähnt. 1933 mußte Alexandra Ramm selbst emigrieren – sie ging mit ihrem Mann über Tschechien und Frankreich in die USA, während Leo Trotzki mit seiner Frau über Norwegen nach Mexiko weiter zog, wo die GPU ihn im Mai 1940 von ihrem Agenten,Ramon Mercader, der sich Trotzkis Vertrauen erschlichen hatte, mit einem Eispickel ermorden ließ. Der Täter wurde dafür von Stalin mit dem “Leninorden” geehrt. Zunächst kam er jedoch in Mexiko für 20 Jahre ins Gefängnis. Danach emigrierte er – erst nach Kuba und schließlich nach Prag, wo er 1978 starb. Seine Leiche wurde in die Sowjetunion überführt und auf dem Moskauer Kuntsewo-Friedhof begraben, gleichzeitig verewigte man seine ruhmreiche Tat im Gedächtniskabinett der GPU- bzw. KGB-Zentrale.
Von einer der taz-Trotzkistinnen erfuhr ich telefonisch, dass die russischen Kommunisten Trotzki bis heute nicht rehabilitiert haben – mit der Begründung: Er sei dort nie verurteilt worden. Wladimir Kaminer ergänzte wenig später – ebenfalls am Telefon: Es gab mehrere Rehabilitierungsversuche. Der erste – zum 20. Parteitag, adressiert an Chruschtschow – kam aus Mexiko von der Witwe Leo Trotzkis; der 2. von dem langjährigen Straflager-Häftling Warlam Scharlamow, der sich zur Linksopposition zählte und mit Solschenizyn den “Archipel GULag” zusammenstellte; der 3. kam von Gregor Gysi, der sich dazu 1989 mit dem damaligen ZK-Sekretär Jakowlew in Moskau traf. Dieser lehnte das Ansinnen ab, mit der Begründung, es klebe zu viel Blut an den Händen von Trotzki. In Berlin bat Gysi dafür den letzten großen noch lebenden Trotzkisten – Jakob Moneta – zur Wiedergutmachung in den PDS-Parteivorstand, wo er auch formal immer noch Mitglied ist. Den letzten Rehabilitierungsantrag in Russland stellte 1999 der Memorial-Mitarbeiter Benjamin Joffe. Er erreichte es, dass die Verfügung, Trotzki nach Kasachstan zu verbannen, für unrechtmäßig erklärt wurde.
Die Beschäftigung mit Trotzki geht aber desungeachtet weiter. Nachdem er sich in seinem türkischen Exil auf der Istanbul vorgelagerten Insel Prinkipo niedergelassen hatte, kursierte ein Witz über ihn in der Sowjetunion, den Ossip Mandelstam in einer seiner Erzählungen aufgriff, die in Russland unter dem Titel “Vierte Prosa” erschienen und auf Deutsch zuletzt in “Das Rauschen der Zeit” veröffentlicht wurden. Der Witz geht so: Trotzki sitzt am Ufer und angelt, da kommt ein Zeitungsverkäufer vorbei und ruft “Sondermeldung! Stalin ist tot!” Trotzki sagt bloß: “Das ist eine Lüge!” “Warum?” “Weil ich dann nicht hier mehr säße!” Am nächsten Tag kommt der Zeitungsverkäufer mit einer weiteren “Sondermeldung” an: “Lenin lebt!” ruft er. Wieder sagt Trotzki: “Das ist eine Lüge!” “Warum?” “Weil er dann neben mir säße.” Ein russischer Historiker hat jetzt ein ganzes Buch über diesen Witz und warum Ossip Mandelstam ihn Anfang der Dreißigerjahre aufgriff geschrieben.
Trotzki blieb vier Jahre in der Türkei, die es damals ohne die sowjetische Hilfe gar nicht mehr gegeben hätte, dies bedeutete aber zugleich, dass sie Stalin außerordentlich verpflichtet war, so dass Trotzki sich bemühte, wie vor 1917 auch schon – in Frankreich Asyl zu bekommen. Dort begann er dann an seinem “Tagebuch im Exil” zu schreiben. Von Telefonaten ist darin an keiner Stelle mehr die Rede. Stattdessen macht er sich grundsätzliche Gedanken. Ein Beispiel: “Die Natur des Menschen, ihre Tiefe und ihre Kraft werden von seinen sittlichen Reserven bestimmt. Der Mensch erschließt sich bis auf den Grund seines Wesens, wenn er aus den gewohnten Lebensbahnen geschleudert wird, denn gerade dann wird er gezwungen, auf die sittlichen Reserven zurückzugreifen.” Die Zeit in Frankreich hat Trotzki als die wichtigste Epoche seines Lebens bezeichnet. Hier erhielt er die Nachricht von der Deporation seines (unpolitischen) Sohnes in Moskau. Anschließend notierte er: “Rückblickend erscheint mir unser jetziges Leben bis zum Erhalt des letzten Briefes als ein herrlicher, sorgenloser Traum…” Dem folgt wenig später der Gedanke: “Das Leben ist eine harte Nuß…will man nicht resignieren oder dem Zynismus verfallen, so läßt es sich nur meistern, wenn man von einer großen Idee beherrscht wird, die den Menschen über sein persönliches Elend, über seine Schwäche und vielerlei Treuebrüche und Gemeinheiten emporhebt.”
Ähnlich hat sich später auch Lew Kopelew geäußert – über die Lebenschancen im GULAG: “Wer nur an sein nacktes Leben dachte im Lager – hat nicht überlebt”. Man brauchte dort – noch mehr als draußen – so etwas wie einen Glauben oder den Kommunismus, schon, um nicht allein zu stehen. Solschenizyn hat dann vor allem die Tschetschenen im GULAG hervorgehoben, die besonders übel dran waren, deren sittliche Reserven sich jedoch als schier unerschöpflich erwiesen (“es gab so gut wie keine Verräter unter ihnen”). Im Gegensatz zu den vielen als “Trotzkisten” inhaftierten Mitläufern, für die die Lagerverwalter nach wie vor “Genossen” waren – und ihre eigene Verhaftung bloß ein “Mißverständnis”, wußten die Tschetschenen bereits seit Jahrhunderten, dass sie als Gefangene von den “Russen” nichts Gutes zu erwarten hatten.
Trotzki merkte im französischen Exil, dass seine “Kräfte im Schwinden” waren, während die seiner Frau zunahmen – ihm “zuliebe”, obwohl sie “alles viel tiefer” als er erlebte. Nicht zuletzt, um das zu würdigen, begann er in Frankreich, das Tagebuch zu führen. Dessen Eintragungen sich mehr und mehr verleppern – bis er es schließlich abbricht.
Ich breche hier ebenfalls ab, ohne noch einmal auf das Telefon zurück zu kommen – und bitte die Kürze, das Fragmentarische dieses Textes zu entschuldigen. Abschließend sei nur noch erwähnt, dass ich weder ein Festnetztelefon noch ein Handy besitze: In den Siebziger- und Achtzigerjahren hatte ich es mit dem Fernsprechen übertrieben – und deswegen dann Schluß damit gemacht.
Jetzt, Herbst 2013, erscheint in der Zeitschrift “Lettre” ein neuer Text über die Bolschewiki und ihr kriegerisches Instrument Telefon. Dazu heißt es in der Vorankündigung:
Stalin am Apparat: Macht und Mythologie des Telefonsystems in der Sowjetunion erforscht Lars Kleberg. Welche Rolle spielte das Telefon in jener Epoche? Wem stand es zu, wer besaß es, wie wurde es benutzt? Grundsätzlich ein allen zugängliches, horizontales Kommunikationsinstrument, wurde es jedoch von “vertikalen” Kräften kontrolliert. Es brachte den Modernisierungsgrad zum Ausdruck und repräsentierte Status und Macht. Telefonanrufe, das konnten Geschenke sein, Gesten der Gnade, Akte der Willkür oder der Bedrohung. Majakowski, Bulgakow oder Pilnjak, Solschenizyn, Grossman oder Tarkowski – auch im Leben ihrer literarischen Protagonisten spielte das Telefon eine schicksalhafte Rolle. Ein Dichter: “Stalin, das war Dschingis Khan mit Telefon.” Dieser letzte Satz ist zwar prägnant – aber Scheiße!
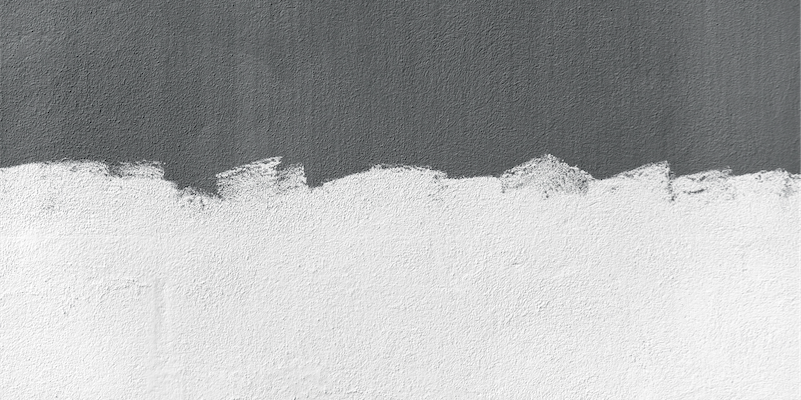



Peter Weiss und sein Stück “Trotzki im Exil”
– aus: Jewgenija Kazewa, „Meine persönliche Kriegsbeute. Geschichte eines Lebens“ (bearbeitet von Cornelia Köster), das Buch erscheint demnächst im Berliner Basisdruck-Verlag:
Eigentlich gehört Peter Weiss nicht zu den Autoren, mit deren Werken ich Nächte, Wochenenden oder gar Urlaube verbracht habe. Aber hier geht es nicht um Quantität, sondern um die Intensität der Beziehung, um die Spur, die diese Bekanntschaft in meinem Leben hinterlassen hat.
Im September 1974 fand in Moskau ein Kongreß statt – zum 40jährigen Jubiläum des 1. Allunionskongresses der Sowjetschriftsteller. Zu diesem Ereignis wurden auch ausländische Schriftsteller eingeladen, darunter Peter Weiss, mit dem mich Friedrich Hitzer gleich bekannt gemacht hat. Im ersten Band seiner Notizbücher schrieb Weiss dazu: „Wie uns einmal, in Hanoi, Nguyen Dinh Thi, als ein Freund für das Leben, entgegentrat, so auch hier in Moskau plötzlich ein Mensch, Shenja Kazewa: vertraut, wie seit langem bekannt – tiefe gegenseitige Anteilnahme.“ (NB I, S. 347)
Daß Weiss zum Kongreß eingeladen wurde, gehört zu den Inkonsequenzen, von denen unsere Kultur zu allen Zeiten profitiert hat – in der Frost- und Tauwetterperiode ebenso wie während der Stagnationszeit. Denn just zu dieser Zeit war Peter Weiss, dessen „Ermittlung“ und „Mockinpott“ in Jurij Ljubimows weltberühmtem Taganka-Theater erfolgreich aufgeführt worden waren, zur persona non grata erklärt geworden. Grund war sein Stück „Trotzki im Exil“. Zwar war das ein ehrlicher Versuch des Kommunisten Peter Weiss, zu Lenins 100. Geburtstag (1970) einen Beitrag zu leisten und einen der „weißen Flecken“ in der Geschichte der Oktoberrevolution zu beseitigen, aber darauf kam es nicht an. Ebenso nicht, daß das Stück keineswegs „trotzkistisch“ war und alles andere als ein Loblied auf Trotzki. Und auch nicht, daß Weiss, als er von den – milde ausgedrückt – negativen Reaktionen in den sozialistischen Ländern hörte, es fertigbrachte, das Stück „zurückzuziehen“, und Druck und Aufführung verbot. Allein die Tatsache, daß er sich mit einem unerwünschten Namen und Thema beschäftigte, genügte, um den Autor zu verfemen.
In der „Literaturnaja Gaseta“ erschien damals ein Artikel mit der Überschrift „Die Selbstdarstellung und Selbstentlarvung des Peter Weiss“, und der Verfasser des Artikels hieß – Lew Ginsburg. Das hat Weiss zutiefst verletzt, war es doch eben dieser Lew Ginsburg, der Peter Weiss nicht nur als erster, sondern damals auch als einziger in der Sowjetunion übersetzt hat. Geradezu glänzend war Ginsburgs Übertragung des reinen Versdramas „Marat/Sade“, das Jurij Ljubimow ebenfalls aufführen wollte – was jedoch erst drei Jahrzehnte später, im Jahr 1998, gelang. Doch Ginsburg hat später einen schlauen Weg gefunden, daß der „Marat“ zumindest gedruckt wurde, als Schlußbeitrag seines ausgezeichneten und schwergewichtigen Buchs „Deutsche Lyrik aus zehn Jahrhunderten“.
Unter dem 4. September 1974 schreibt Weiss in sein Notizbuch: „Begegnung mit Lew Ginsburg. Was soll man nun mit dieser Freundlichkeit anfangen, die von einem kommt, der mich damals (nach dem Trotzki-Stück) aufs Unflätigste beschimpfte? Sozialistische Schizophrenie? Totale Entwertung des Worts? Dienend nur zu augenblicklichen taktischen Zwecken, oder zur Selbstverteidigung vielleicht: er hatte den Marat übersetzt? Ist nichts mehr ernst zu nehmen? Oder ist alles zu ernst, als daß man überhaupt noch darauf eingehen könnte?“ (NB I, S. 347)
Wenn man an die damaligen Umstände zurückdenkt, muß man zugeben, daß Weiss den wahren Grund erraten hat: Selbstverteidigung eines Menschen, der soviel für das Bekanntwerden des Werkes von Weiss in der Sowjetunion getan hat. Eben deshalb konnte Ginsburg den „gesellschaftlichen Auftrag“ nicht ablehnen. Es hat an vielem gemangelt – aber ganz sicher nicht an jesuitischem Geschick. Die „sozialistische Schizophrenie“ war eine verbreitete Krankheit; erinnert sei an den Brief im Zusammenhang mit der erfundenen Ärzte-Geschichte, der angeblich von namhaften Juden unterschrieben wurde, die die Aussiedlung aller Juden aus Moskau forderten.
Genau an dem Tag, als Ginsburgs Artikel erschien, gab Heinrich Böll zum Abschluß seines Moskau-Besuchs einen großen Empfang. Natürlich war auch Ginsburg eingeladen. Er kam mit Verspätung und stürzte sich gleich, ohne den Wintermantel in der Garderobe abzugeben, mit ausgestreckter Hand auf Böll. Der sonst immer freundliche gutmütige Böll, über die Sache bereits informiert, „übersah“ die Hand und wandte sich einem anderen Gast zu, um mit diesem ganz offensichtlich nicht sehr dringende Worte zu wechseln. Es war peinlich zu sehen, wie Ginsburg, der nur verstummende und sich abwendende Köpfe um sich sah, verstört von einem Fuß auf den anderen trat und schließlich zur Tür wankte.
Übrigens ist „Trotzki im Exil“ später doch erschienen – im April 1990, zu Lenins 120. Geburtstag! Die Übersetzung war von … Jurij Ginsburg, Lews Sohn.
Und auch der „Marat“ konnte noch zu Zeiten der Sowjetunion aufgeführt werden, wenn auch erst nach dem Tod des Autors und des Übersetzers: Ende Oktober 1988 zeigte das Theater der Baltischen Flotte in der lettischen Stadt Liepaja die russische Erstaufführung. Leider konnte ich der Premiere, zu der ich eingeladen war, nicht beiwohnen, dafür aber habe ich mehrere Fotos von der Aufführung bekommen. Eingeladen war ich nicht wegen meiner ehemaligen Zughörigkeit zur Baltischen Flotte, sondern weil einige Tage zuvor meine Übersetzung eines Kapitels aus dem ersten Band der „Ästhetik des Widerstands“ in der „Literaturnaja Gaseta“ erschienen war.
Mit Vehemenz dafür eingesetzt, daß dieses Werk in Rußland gedruckt wird, hat sich die Germanistin Tamara Motyljowa. Bei jeder Gelegenheit sprach sie von der „Ästhetik des Widerstands“ und schrieb auch einen ausführlichen Artikel in „Woprossy Literatury“ dazu. Und als ich infolgedessen dann gebeten wurde, den Roman anhand eines Fragments in der „L.G.“ vorzustellen, wählte ich natürlich das heikelste, das Kapitel über die Moskauer Prozesse 1937. Wenn das durchkäme, stünde dem Erscheinen der gesamten Trilogie nichts mehr im Wege.
Tatsächlich: das ZK erteilte einem Verlag den Auftrag, die „Ästhetik“ übersetzen zu lassen. Um die Arbeit an diesem Mammutwerk zu beschleunigen, wurde eine ganze Übersetzer-Brigade zusammengestellt. Alles schien in Ordnung, umso mehr als die Zeit überreif für dieses Werk war. Aber dann starb die Übersetzerin des ersten Bandes, Inna Karinzewa, die anderen ließen es am notwendigen Engagement fehlen, und die Sache versickerte im Sand. Auch ich, froh darüber, mit den Anstoß gegeben zu haben, verlor die Sache aus den Augen und habe versäumt, rechtzeitig das Projekt noch zu retten. Zu dieser Zeit war plötzlich alles möglich geworden, sogar das Unmögliche, in Strömen erschien die ganze verbotene Literatur, und die „Ästhetik des Widerstands“ schien nicht mehr ganz so brennend aktuell. Verzeih mir, Peter, daß ich mich nicht mehr dafür eingesetzt habe, ich weiß, was Dir dieses Werk bedeutet hat, wie wichtig es für Dich war, daß es wenigstens in der DDR erschien – und was Dich die Verzögerung gekostet hat, obwohl dort ja keine Zeit für die Übersetzung nötig war.
Das einzige, was ich noch für die „Ästhetik“ tun konnte, war, für das Vorwort zu einem Band mit Weiss-Stücken eine kurze Schilderung der Trilogie beizusteuern. Darum hatte mich der Verlag gebeten, weil der Vorwortschreiber, ein Journalist, zwar einen politisch gewichtigen Namen hatte, aber keine Ahnung von Peter Weiss’ Hauptwerk.
Einen kleinen Beitrag zum Andenken an Peter Weiss hat meine Tochter geleistet: Sie hat den beklemmenden Text „Meine Ortschaft“ übersetzt, den Peter Weiss 1965 im Jahr des Auschwitz-Prozesses geschrieben hat.
Aber das alles war schon nach seinem Tod.
Die zehn Tage, die Peter Weiss im September 1974 in Moskau und Wolgograd (dem ehemaligen Stalingrad) verbracht hat, sind ziemlich detailliert im ersten Band seiner Notizbücher dargestellt. Ausgerichtet wurde der Schriftstellerkongreß im Festsaal des Gewerkschaftshauses, dem früheren Adelsklub, in dem im März 1938 der Bucharin-Prozeß stattgefunden hat und dreieinhalb Jahre zuvor, im August 1934, Bucharin seine berühmte Rede zur Gründung des Schriftstellerverbandes gehalten hatte.
Der Aufenthalt war ein bewegendes Erlebnis für Peter Weiss. Die Augen des Malers haben viele Details des Saales aufgenommen, um sie in die „Ästhetik des Widerstands“ einzuarbeiten, an der er damals schrieb und deren erster Band ein Jahr später, im November 1975, erschienen ist. Doch der Bucharin-Prozeß, von dessen Schauplatz Weiss eine präzise Beschreibung gibt, fand nicht im Kolonnensaal, sondern im Oktobersaal statt. Auf dieses Versehen hat mich Arkadij Waksberg aufmerksam gemacht. Entweder war Weiss dies nicht bewußt oder er hat die kleine „Verschiebung“ wegen des größeren Effekts inkauf genommen. Durchsetzt wird Weiss’ Ortsbeschreibung von dem, was der norwegische Schriftsteller Nordahl Grieg über den Prozeß im Radio gehört und seinen Freunden und Mitkämpfern in Spanien berichtet hat. (Und eben diese Passage aus der „Ästhetik“ erschien damals in der „Literaturnaja Gaseta“.)
In Moskau haben wir viele Stunden zusammen verbracht. Abends kam Peter zu mir, um mit mir durchzusprechen, was er bei den vielen Gesprächen, offiziellen Empfängen und Veranstaltungen gesehen und gehört hatte. Er bat um Erklärungen, Ergänzungen, Richtigstellungen und Kommentare, um das Land, die Menschen und Umstände besser zu verstehen. Von großer Bedeutung war für ihn wohl auch, daß ich die ersten vier Nachkriegsjahre als Kulturoffizier in Berlin gearbeitet habe. Ich kannte einige von den Personen, die in der „Ästhetik“ vorkommen – vor allem André Simone, der seinerzeit das „Braunbuch“ zusammen mit Münzenberg geschrieben hat und in Weiss’ Buch eine wichtige Rolle spielt. Er wollte wissen, wie das Leben damals in Deutschland war, jede Einzelheit war für ihn wichtig.
Außer der „Aufklärungsarbeit“ gab es natürlich auch heitere Stunden. Als sich einmal abends eine Schar von Freunden bei mir versammelte und ich, als werktätige Frau aus dem Dienst kommend, nicht gleich alles so schnell fertig hatte, schaltete sich Peter in die Küchenarbeit ein: „Die Kartoffeln schäle ich, darin bin ich Meister“ – was er dann auch mit umgebundener Schürze bewiesen hat. Die Gläser aus dem Küchenschrank mußten abgespült werden – er polierte sie auf Hochglanz, bis er befriedigt feststellte: „Blanker können sie auch im Kreml nicht sein.“
Einen herrlichen Abend haben wir bei Konstantin Simonow verbracht (Weiss erwähnt diesen Besuch in den Notizbüchern), wo ihn das kolossale, hervorragend geordnete Archiv in Erstaunen versetzte – nicht zufällig hat 36 Jahre lang ein und dieselbe Sekretärin bei Simonow gearbeitet. Als Dolmetscherin war ich nicht durchweg auf der Höhe. So kannte ich zum Beispiel die Vorrichtung nicht, die Simonow erwähnte und die so unentbehrlich ist, wenn die Soldaten lange im Schützengraben liegen. Ich versuchte Simonows Erklärungen wiederzugeben (es ging um eine Entlausungsmethode), begriff jedoch immer noch nicht, woraufhin Simonow mich „entschuldigte“: „Na ja, Shenja war bei der Marine – das ist doch die Aristokratie der Streitkräfte, da kannte man sowas nicht.“
Peter Weiss freundete sich mit Jurij Trifonow an – den er kennenlernen wollte, weil er wußte, daß Böll ihn als nächsten Nobelpreisträger für seinen Roman „Die Zeit der Ungeduld“ vorgeschlagen hatte, der für Deutschland zur Zeit der Rote-Armee-Fraktion so aktuell erschien. In den „Notizbüchern“ steht dazu: „11/9 innere Verwandtschaft bei Menschen an fernsten Orten zu finden (Shenja, Trifonow) – gleicher Lebenskreis überhaupt keine Gewähr für Verständnis oder Freundschaft.“ (NB I, S. 368)
In Wolgograd war Weiss zusammen mit Friedrich Hitzer (BRD) und Max-Walter Schulz (DDR). Nach ihrer Rückkehr veranstalteten wir in der Redaktion von „Woprossy Literatury“ eine Diskussion mit den sowjetischen Schriftstellern Sergej Smirnow und Jurij Bondarew, die Teilnehmer der Schlacht von Stalingrad waren. Trotz des Themas war das Gespräch sehr fröhlich, zumal „die Deutschen“ aus Wolgograd eine riesige Wassermelone mitgebracht hatten – Hitzers Idee –, die für alle nicht nur zum Kosten reichte. Zufällig kam auch noch der berühmte Schauspieler Innokentij Smoktunowskij vorbei, dessen Essay über Puschkin wir gerade für den Druck vorbereiteten. Die Möglichkeit, auf einem neuen Terrain auftreten zu können, erfüllte den Schauspieler mit Stolz, er war ein häufiger und gerngesehener Gast. Es war ein rundum gelungener Abend. Natürlich schmückte nicht nur die Melone den Tisch – unsererseits kamen noch weitere Stärkungsmittel hinzu. Trotzdem haben wir anschließend aus dem Gespräch eine interessante Publikation gebastelt.
Die Reise nach Wolgograd hat Weiss tief bewegt. Er hat die einst zerstörte, jetzt wiederaufgebaute Stadt gesehen, war in vorbildlichen Kolchosen und hat wunderschöne Kindergärten besucht („Solche könnten wir auch in Schweden gut gebrauchen.“). Seine Eindrücke von der Sowjetunion hat Weiss zusammengefaßt in dem Satz: „Welch ein Vorbild könnte dieses Land sein, wenn es aufgeräumt hätte mit seiner Vergangenheit.“ (NB I, S. 366)
Nun, was den zweiten Teil des Satzes betrifft, so beschäftigen wir uns mit dem Aufräumen bis heute – leider nicht immer konsequent genug. Weiss hat früher damit angefangen – das Aufräumen betrifft ja nicht nur unsere Geschichte. Herakles, der in Weiss’ Roman einen gewichtigen Platz einnimmt, könnte dabei behilflich sein – beim Ausmisten der Augiasställe.
Und was ist zum ersten Teil zu sagen, der nicht zuletzt von den Kolchos- und Kindergarteneindrücken herrührt? Hatte ich denn Weiss tatsächlich nicht daran erinnert, was er hätte wissen müssen, jedoch offensichtlich vergessen hat (oder vergessen wollte): daß die größte russische Erfindung aller Zeiten und Völker die Potemkinschen Dörfer sind?
Gesehen haben wir uns später nicht mehr. Nach seiner Abreise haben wir oft miteinander telefoniert, manchmal rief er aus Berlin an, wo er sich als korrespondierendes Mitglied der Akademie der Künste der DDR aufhielt. Und wir schrieben uns. Aus einigen seiner Briefe, die Auskunft über sein Leben in Stockholm und seine Arbeit an der „Ästhetik des Widerstands“ geben, möchte ich zitieren. Sie zeugen von den Hindernissen und Mühen, die mit diesem enormen Panorama des politischen, philosophischen und kulturellen Lebens im Europa der Jahre 1937-1945 verbunden waren, dieser Enzyklopädie der tragischen Fehler und Verbrechen in der Geschichte des Kommunismus:
„Ich stehe zeitweise allein mit meiner kleinen Tochter, die im November vier Jahre alt wird und viel Zeit verlangt. Die Sorge um das Kind und um Gunilla ist ständig in meinem Bewußtsein, so daß die lange Ruhe, Konzentration und Kontinuität, die ich zur Arbeit an dem großen Buch-Vorhaben brauche, ausbleibt. Ich will jedoch meinerseits nicht klagen, vor allem geht es jetzt darum, Möglichkeiten zu finden, die endlich eine Genesung meiner Frau versprechen.
Du kannst Dir denken, daß ich unter diesen Umständen auch nicht in der Lage war, Deine Fragen zu beantworten. Aus reinem Selbsterhaltungstrieb muß ich die Stunden, die mir zur Verfügung stehen, dazu ausnützen, nicht ganz den Zusammenhang mit der Arbeit am Roman zu verlieren.
Du schreibst mir, daß Du in Berlin den Brief an die zuständigen Genossen lesen konntest. Es hat sich seitdem nichts verändert. Seit einem Jahr ist das Buch draußen in der Welt, und nach wie vor ist nicht ein einziges Wort darüber in der DDR zu hören oder zu lesen gewesen.
Nur Hermlin hat mir einen sehr schönen und mutigen Brief geschrieben, den ich ihm hoch anrechne. Von DEINEM Brief natürlich ganz abgesehen!
Im Übrigen ist mein Verhältnis zu diesem Land, für das ich ja, wie Du weißt, stets mit allen Kräften eingetreten bin, zur Zeit bis zum äußersten unproduktiv.
Dies alles ist sehr bedrückend, ich bin in schlechter Form, brauche bald einmal wieder Zuversicht und Arbeitskraft.
Und immer wieder, sehr, sehr, habe ich es als Last zu empfinden, daß die beiden sozialistischen Staaten, auf deren Seite ich politisch stehe, meiner Arbeit eine solche Kälte zeigen. Immer wieder hoffe ich – aber das Leben ist so kurz!“ (4.9.1976)
Was die Fragen betrifft, die Weiss „aus Selbsterhaltungstrieb“ nicht beantworten konnte, so handelte es sich dabei um einen Fragenkatalog zur „Verantwortung des Schriftstellers“, den wir an fast 50 Schriftsteller aus 30 Ländern verschickt hatten. Schließlich hat auch Peter Weiss seine Antworten noch rechtzeitig zugeschickt („Woprossy Literatury“, 1976, N12).
Und kommentiert werden muß auch noch die Stelle mit dem „Brief an die zuständigen Genossen“. Peter Weiss hatte mir einen Durchschlag seines Briefes an die Akademie der Künste der DDR geschickt, in dem er sich voll Bitterkeit und Schmerz über die an Gleichgültigkeit grenzende Passivität seiner Kollegen beschwert. Während eines Berlin-Besuches habe ich diesen Durchschlag einigen mir bekannten hochrangigen Genossen gezeigt, da ich argwöhnte, der Brief sei irgendwo verloren gegangen und Peter Weiss deshalb ohne Antwort geblieben. Natürlich war der Brief nicht verloren gegangen, Schwierigkeiten machte vor allem das Kapitel über die Moskauer Prozesse 1937-38. Die Frage „drucken oder nicht drucken“ wurde heftig diskutiert. Eine scherzhafte Bemerkung von Hermann Kant in diesem Zusammenhang wurde unglücklicherweise ernst genommen: Die wenigen, die das schwer zugänglich Buch lesen würden, würden den Inhalt sowieso kennen, und die, die ihn nicht kennen, würden das Buch nicht lesen. Das hat sich als Irrtum herausgestellt: Die erste kleine Auflage (3000 Exemplare) war sofort vergriffen, eine zweite, größere Auflage mußte nachgedruckt werden.
Aus einem anderen Brief:
„Was mich vor allem in Anspruch nimmt, ist die Arbeit am letzten, 3. Band der Ästhetik. Du kannst Dir denken, daß ich da jetzt, nach mehr als 8jähriger Arbeit an der Trilogie, alle meine letzten Kräfte mobilisieren muß – und noch einige andere, übermenschliche Kräfte dazu! Der letzte Band muß naturgemäß ja auch der stärkste werden, nirgends darf der Text hier absinken, und das ist eine ständig überschattende Forderung. Lange Perioden auch war es mir, als wollten mich die Kräfte verlassen. Ich kam nicht weiter, schrieb jeden Satz Dutzende Male um, es war zum Verzweifeln.
Gesundheitlich war ich auch nicht besonders in Form, Herz, Kreislauf nicht recht in Ordnung, und dazu kam, daß ich zu hohen Zucker habe, jetzt Diät halten und medizinieren muß. Aber das sind nur die gewöhnlichen, alltäglichen Sorgen, die jeder hat.
Die Hauptsache ist, daß ich jetzt mit dem Buch vorankomme.
Ich habe einen Termin zu halten, 1. Oktober, wenn das Buch noch Frühjahr 81 erscheinen soll – und das möchte ich gerne, möchte mich nicht noch ein Jahr weiter damit schleppen. Aber das hängt davon ab, ob die Arbeit jetzt wirklich ihre Kontinuität beibehält.
Dieser letzte Teil ist auch in anderer Beziehung der schwerste, er schildert die Zeit der letzten Kriegsjahre, bis zum ‚Frieden’, schildert also die furchtbarsten Menschenopfer, die Zerschlagung des antifaschistischen Kampfes im deutschen Untergrund, gleichzeitig auch die ungeheuren Leistungen des Widerstands, unter unmenschlichen Bedingungen. Das nimmt mich alles beim Wiedererleben sehr mit. Aber diese Zeit kennst Du ja selber von eigenen Erlebnissen her nur zu gut.
Shenja, ich denke oft an Dich, die Stunden bei Dir, Deine Wohnung, die Gespräche mit Dir, ich würde Dich gerne sehen und hoffe nur, daß die Gesundheit uns beiden so erhalten bleibt, daß wir im Frühjahr 81 uns vielleicht doch einmal wiedersehen können – in Berlin vielleicht, ich war schon lange nicht mehr dort, auch nicht in Rostock, und die Freunde dort sind auch schon sauer auf mich, daß ich so lange nicht mehr aufgetaucht bin. Es freute mich, zu hören, daß Du jedenfalls in Rostock warst und sowohl Perten als auch Mockinpott getroffen hast.
Ich sitze hier im warmen Sommer-Stockholm und hacke auf der Schreibmaschine, während Gunilla und Nadja auf dem Land sind. Nadja hat sich phantastisch entwickelt. Sie wird jetzt im Nov. acht Jahre und beginnt im August ihr zweites Schuljahr. Wie schnell eine solche Entwicklung geht, wie schnell aus dem Kind ein bewußter, fast erwachsener Mensch wird, mit all seinen Erfahrungen, Erwägungen, Zweifeln, Unsicherheiten, Träumen! Und wie geht es Deiner Tochter?
Und Hermann Kant? Hast Du ihn mal gesehen? Hat er sich von seiner schweren Zeit erholt? Ich schätze ihn sehr. Schade, daß man die Freunde so selten sieht, und schade auch, daß die Zeit so schnell vergeht!“ (24. Juli 1980)
In jedem Brief schrieb Peter Weiss über seine Tochter Nadja, die in seinem Leben einen besonderen Platz einnahm. In einem Dokumentarfilm über Peter Weiss sagt seine Frau, daß die eigentliche Passion seines Lebens nicht die Frauen waren, sondern seine Tochter. Er hat viel über Nadja gesprochen, und es bedrückte ihn der Gedanke, daß sie eines Tages über den Verlust ihres Vaters hinwegkommen werde müssen. Als er starb, habe ich Gunilla, die ich nicht kannte, einen Brief geschrieben, in dem ich mein Mitgefühl mit Nadja aussprach. Gunilla hat mir weise geantwortet: „Sie hat in ihrer Kindheit so viel Wärme von ihrem Vater bekommen, das muß für ihr ganzes Leben reichen.“
In seinem letzten Brief an mich, vom März 1982, schreibt Weiss von Plänen für den Mai, die nicht mehr in Erfüllung gehen konnten:
„So sehr habe ich mich über Deinen Brief gefreut, daß ich gleich antworte, obgleich ich bis über den Kopf in Arbeit stecke. Warum ich nichts von mir hören gelassen habe? Seit dem Mai 81 arbeite ich an der Inszenierung meines letzten Stückes, ‚Der neue Prozeß’. Wir haben nun, am 12. März, Premiere. Ich habe, zum ersten Mal, die Regie selber gemacht, Gunilla das Bühnenbild + Kostüme. Eine Riesenarbeit, ein großes Stück, 33 Szenen (die Zahl als Assoziation zu Dantes Inferno), und Titel wie auch die Personennamen noch einmal Kafkas ‚Prozeß’ entnommen, gleichsam als ‚hommage à Kafka’ – sonst aber ein ganz freistehendes Stück, ohne Anklang an meine Prozeß-Bearbeitung.
Es war eine gewaltige Anstrengung, unmittelbar nach den Jahren mit dem Roman, aber das Theater lockte doch wieder so stark, daß ich mich nicht entziehen konnte.
Ja, Shenja, ich möchte auch noch einmal wieder beweglicher werden, reisen, fühle mich aber, nach den letzten Jahren, recht mitgenommen. Was Simonow schrieb, freute mich sehr, und natürlich stimme ich dem Abdruck zu (siehe beigelegtes Blatt).
Soweit ich zur Zeit außerhalb des Theaters denken kann, könnte ich mir vorstellen, im April – vielleicht Mai – in Berlin zu sein, ich müßte auch zum Henschel-Verlag, denn wie Du vielleicht weißt, kommt die Ästhetik im Frühjahr bei Henschel in der DDR heraus, alle drei Bände.“ (9. März 82)
Bei Simonows Brief an Weiss ging es um den bevorstehenden Friedenskongreß in Sofia (1977), in dem Simonow schrieb, daß er sich sehr auf ein Wiedersehen freue und gern mit Weiss einige gemeinsame Aktionen unternehmen würde. Doch als Weiss erfuhr, daß man in Bulgarien abgelehnt hatte, Pavel Kohout ein Visum auszustellen, veröffentlichte er einen Protestbrief und fuhr nicht nach Sofia. Durch Weiss’ Wegbleiben lohnte sich auch für Simonow die Reise nicht mehr, weswegen auch er unter irgendeinem Vorwand abgesagt hat. Jetzt sollte dieser Brief an Weiss in einem Band mit Simonows Briefen abgedruckt werden, weswegen mich die Nachlaß-Kommission gebeten hatte, hierfür Weiss’ Einverständnis einzuholen.
Im Dezember 1988 fanden in Hamburg „Peter Weiss Tage“ statt, ein Internationales Kolloquium, zu dem auch ich eingeladen wurde. Auf meine verwunderte Frage an die Veranstalter, wie sie auf mich gekommen seien, bekam ich die Antwort, daß Peter Weiss selbst es war – durch seine „Notizbücher 1971-1980“.
Ich war froh, nicht mit leeren Händen anreisen zu müssen: Außer meinen persönlichen Erinnerungen brachte ich Fotos vom Moskauer Schriftsteller-Kongreß mit, wo Peter Weiss in der ersten Reihe sitzt, außerdem die „Literaturnaja Gaseta“ mit der kurz zuvor erschienenen Übersetzung des „Ästhetik“-Kapitels und einige Aufnahmen von der „Marat“-Aufführung im Theater der Baltischen Flotte. (Im Gegenzug habe ich bei dieser Gelegenheit die Kopien eines Bündels meiner Briefe an Weiss bekommen.)
Alles in allem war es eine erfolgreiche Konferenz – bei der es jedoch zu einer kurzen, aber heftigen Polemik mit DDR-Kollegen kam. Nachdem diese sich abschätzig über die Perestrojka in der Sowjetunion geäußert hatten und meinten, dies sei überhaupt keine – im Unterschied zur DDR, wo sie echt sei, mußte ich doch – bei all meiner (echten!) Liebe zur DDR und dem Vorsatz, mich nicht in die Angelegenheiten eines anderen Landes einzumischen – einige Vorgänge in der DDR aufzählen (wie z.B. das Verbot einiger unserer Presseerzeugnisse), die das Gegenteil bezeugten – und an den blutigen Preis erinnern, den mein Land jahrzehntelang bezahlen mußte, bis es zu den langersehnten und (damals im Anfangsstadium begriffenen) verheißungsvollen Veränderungen kam.
Kein Wunder, daß ich keine Lust hatte, der Einladung zu einer Peter-Weiss-Konferenz in Jena Anfang 1989 zu folgen.