Langsam aber sicher bürgert es sich ein, dass man in den Printmedien nur noch „Abstracts“ veröffentlicht, in ihren Online-Versionen dagegen den vollständigen Text. Dadurch wird endlich die irrige Annahme korrigiert, bei der Zeitung ginge es um Zeit – in Wahrheit geht es darin um den Platz, weswegen die Zeitung eigentlich Raumung heißen müßte, im Gegensatz zum Rundfunk, bei dem es um die Zeit geht. Alle Radiobeiträge müssen fast auf die Sekunde genau aufgenommen werden, während die Zeitungsbeiträge auf die Zeile genau abgefaßt sein müssen. Das eine wie das andere ist natürlich großer Schwachsinn. Einen Ausweg bietet nun aber das Internet, das keine Raum- und Zeitbegrenzung mehr kennt. Die isländische Sängerin Björk meinte bereits: „Home is where my laptop is“. Hier nun die vollständige Version eines taz-Artikels über die Wüste Gobi:
„Geht weiter!“ (Buddhas letzte Worte an seine Schüler – und Motto des ersten GTZ-Projekts „Schutz und nachhaltige Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen“ im mongolischen Nationalpark Gobi Gurvansaikhan)
Als wir frühmorgens in der Provinzhauptstadt des Aimags Südgobi Dalanzadgad landen, ist der erste Eindruck von der Wüste ein großer Mangel: Alles ist hier selten. Pflanzen, Tiere, Menschen, Wasser. Nur Sand und Stein, Felsen und Geröll gibt es im Überfluß. Selbst die „Stadt“ ist leer – an Gebäuden und Verkehr. Wir fahren mit Jeeps quer durch die Gobi und den Nationalpark nach Norden – in die Provinz Bayankhongor, von dort – im Aimag-Center Bogd Soum – fliegen wir wieder ab.
Um das Ergebnis schon mal vorweg zu nehmen: Die Wüste ist doch voll – so sehr, dass man noch Monate davon zehren kann. Wir haben dort z.B. mit mehr Mongolen – Viehzüchter die meisten – gesprochen als in der Großstadt Ulan Bator. Was die eigentliche Wüste betrifft: Es gab Routen, die uns an einem Nachmittag durch drei oder mehr völlig verschiedene Landschaften führten. Es gab alles. Man kann dort leben! Wir verstanden sogar den Pariser Pessimisten Cioran, der meinte, in der Mongolei – wo Swifts ‚Yahoo‘ noch nicht triumphiert habe und es mehr Pferde als Menschen gäbe, müsse es eine Lust sein zu leben. In der Gobi gibt es allerdings mehr Kamele als Pferde. Es waren aber vor allem die Viehzüchterinnen, die einen nachhaltigen Eindruck auf uns machten, auch wenn an vielen Sehenswürdigkeiten Reitkamele auf uns warteten. Namentlich am Gletscher der Geierschlucht „Yoliin Am“, an der Dinosaurierfundstätte „Flaming Cliffs“, an den „Singenden Dünen“, die sich 180 Kilometer erstrecken, und am Felsenmassiv Bichigt Khad, wo es 12.000 Jahre alte Jäger-Petroglyphen zu besichtigen galt. In der Gobi regnet es sehr wenig, unter 100 Millimeter im Jahr, deswegen waren die Felszeichnungen obwohl ungeschützt noch gut erhalten.
Die extrem trockene Luft frührt vor allem dazu, dass die Gräser und Kräuter am Halm verdorren: „So bleibt die spärliche Vegetation erhalten, unterliegt keiner Zersetzung, und ist entscheidend für den Weidegang der Haustiere,“ schreibt der Biologe Michael Unruh. Die Vegetationsdichte regelt sich über das Wurzelsystem, das oberirdisch zu „dijunktem und mosaikartigem“ Bewuchs führt: Die Gobi hat „mit 5-25 Individuen pro Quadratmeter die geringste Tierarten- und Individuendichte aller Wüsten der Welt“.
Dennoch schwirrte mir der Kopf. Nur gut, dass ich keinen Fotoapparat mitgenommen hatte. Die übrigen Mitglieder unserer Journalistenreisegruppe entdeckten täglich mehr Knipsenswertes – und schienen bald nur noch nach lohnenden Motiven Ausschau zu halten. Ich tappte dafür in eine andere „Touristenfalle“. Den Tip dazu gab mir der Kollege vom Tagesspiegel: Er zeigte mir seine gesammelten Steine. Und prompt lief ich nur noch gebückt herum – und suchte Steine. Steine gab es genug – so genanntes „Wüstenpflaster“ bis an den Horizont. An den Sehenswürdigkeiten werden die schönsten Steine von Nomadenkindern verkauft. In ihren Jugendclubs werden sie in Vitrinen ausgestellt und bestimmt. In einem Mädchenclub, der ein GTZ-finanziertes „Öko-Haus“ in der Kreisstadt Bayn Bag nutzt, schrieb ich mir einige der englischen Steinnamen ab: Galemte, Silurian Crinoid, Amazonite, Cheolite, Quartz, Graphite, Granit…. Und am Ende führte ich gleich kiloweise Gobisteine aus.
Zwischen den Steinen huschten Eidechsen und krabbelten Käfer. In der Luft sah man gelegentlich Raubvögel. Im Touristencamp „3 Camel Lodge“ hatte der Besitzer beim Bau des Versorgungsgebäudes extra Nistplätze unterm Dach geschaffen, die auch sofort von Spatzen, Schwalben und Finken angenommen wurden. Unsere von den Jeeps aufgewirbelten Staubwolken schreckten einige Gazellenherden hoch. Die Haustiere – Kamele, Rinder, Pferde und Ziegen blickten dagegen höchstens auf, die Schafe nicht einmal das. Stellenweise konnten wir uns kaum vorstellen, wo diese Herden ihre Nahrung hernahmen. Viele einst von den Sowjets erbaute Brunnen waren zerstört oder verfallen, weil nicht mehr tief genug; einige Seen waren ausgetrocknet – und ganze Saxaul-Wälder abgefressen. Diese in großem Abstand voneinander wachsenden Sträucher, die immer wieder aus dem Sand, den der Wind um sie anhäufelt, herauswachsen, werden von den Viehzüchtern auch zum Heizen verwendet. Die Arbeit der GTZ besteht u.a. darin, sie zu überreden, statt des Saxaulholzes Briketts aus Viehdung zu verwenden. Ihnen wurden dafür spezielle Öfen für die Jurten zur Verfügung gestellt, die von den einheimischen Schmieden heute nachgebaut werden.
Während unsere mitteleuropäische Landwirtschaft inzwischen so weit industrialisiert ist, das sie in einen schroffen Gegensatz zum Naturschutz geriet, scheint die nomadische Kultur noch immer eng mit ihrer Umwelt verbunden zu sein, deswegen mußten die Viehzüchterfamilien nicht lange agitiert werden: Sie stehen inzwischen selbst an vorderster Front des Naturschutzes im Nationalpark Gurvansaikhan, der 5,4 Millionen Hektar umfaßt. Seine Verwaltung besteht aber nur aus 18 „Rangers“ und 7 „Managern“.
Nach der „demokratischen Revolution“ 1989 wurden alle Kolchosen im Land aufgelöst und jeder Mongole bekam 100 Stück Vieh – egal, ob er als Friseur, Fahrer oder Buchhalter gearbeitet hatte. Viele dieser „Ich-AGs“ gaben bald auf – besonders nach den zwei harten Wintern 1999 und 2000, da Millionen Tiere verhungerten. Die übriggebliebenen Viehzüchter wurden von der GTZ motiviert, sich zu Kollektiven – „Communities“ – zusammen zu schließen. Wenn von der GTZ hier die Rede ist, sind damit deutsche und mongolische Förster, Dolmetscher, Biologen und Geographen gemeint – hauptsächlich Frauen. Und bei den Nomaden sind es sogar fast auschließlich die Frauen gewesen, die Schulungen in ressourcenschonender Weidewirtschaft besuchten und die (geringen) finanziellen Hilfen in Anspruch nahmen, um z.B. holländische Spinnräder oder Milchverarbeitungsgeräte anzuschaffen.
Über 80 Viehzüchter-Kooperativen gibt es inzwischen in der Südgobi – mit einer eigenen Zeitung, den „Community News“, die von der GTZ in Ulan Bator gedruckt wird. Einige Communities haben sich Gästejurten angeschafft, um auch ein bißchen vom Gobi-Tourismus zu profitieren. Leider mußten wir jeden Abend auf professionelle Jurten-Camps ausweichen, weil alle Viehzüchter-Quartiere belegt waren.
Nebenbeibemerkt sind diese mobilen Rundzelte aus Filz weitaus komfortabler als die Hotels in den Kreisstädten und Provinzhauptstädten, die nur aus wenig mehr als den notwendigen Verwaltungseinrichtungen bestehen. Ich brauchte zwei Mongoleireisen, um das zu kapieren, kann aber jetzt schon dem Konstanzer Drogisten Fritz Mühlenweg zustimmen, der in den Dreißigerjahren mehrmals mit Kamelen von China aus in die Gobi aufbrach: „Drei Mal habe ich die Mongolei bereist und jedes Mal war es schöner.“
Mühlenbeck schrieb u.a. ein Porträt des Nomaden Dampignak, der sich zum Herrn der Südgobi aufschwang – und die russischen Okkupanten ebenso bekämpfte wie die chinesischen. Er wurde schließlich von den Russen gefangen genommen und in Sibirien inhaftiert. Die Revolution befreite ihn: Kein geringerer als der Schweijk-Autor Jaroslaw Hasek, der als Kommissar der Roten Armee in Irkutsk für die Gefangenen zuständig war und dort u.a. eine mongolische Zeitung herausgab, entließ Dampignak in die Heimat, wo er erneut in der Südgobi den Freiheitskampf aufnahm – vor allem gegen die Kosaken des Weißen Barons Ungern von Sternberg, der zuvor die Chinesen vertrieben und Ulan Bator erobert hatte. Die Truppen des Barons wurden 1921 von dem Aufstandsführer Sukhbaatar mit Hilfe der Roten Armee besiegt und vernichtet. Wenig später ließ Sukhbaatar auch Dampianak umbringen, der sich mit seinen Leuten in einer Festung in der Gobi zurückgezogen hatte. Neuerdings hat die Mongolistin Veronica Veit Näheres über das Leben und Sterben dieses letzten Wüstenfürsten in den „Serta Tibeto-Mongolica“ veröffentlicht. Mühlenbeck schrieb über Dampignak – als einen noch lebenden: „Silber und Gold achtet er gering wie den Stein am Wege, das ist seine Sicherheit. Er spricht lieber mit Pferden und Hunden als mit Menschen, das ist seine Traurigkeit.“
Die heutigen Viehzüchter und auch die mongolischen Mitarbeiter der GTZ, die z.T. aus der Gobi stammen, wußten zwar nicht mehr, wo sich Dampignaks Festung befand, aber sie erzählten sich noch immer Geschichten über ihn – sein Name war allen geläufig. Überhaupt ist die nomadische Kultur wesentlich oral. Alles Eigentum muß sich bei ihnen selber tragen. Da ist Schriftliches eher hinderlich. Deswegen, so versicherte mir eine Frauengruppe, sei das Handy ein wahrer Segen für die Mongolei, während das Internet die Leute dort eher kalt lasse. Früher war es für jeden Viehzüchter Pflicht, ein Radio zu besitzen, und zu Hochzeiten schenkte man gerne Zeitungs-Abonnements. Heute steht an fast jeder Jurte ein kleines chinesisches Solarpanel, mit dem u.a. ein Fernseher betrieben wird.
Die Viehzüchter-Communities in der Gobi benutzen teilweise schon für ihre Umzüge Jeeps bzw. Motorräder mit Anhänger. „Die nomadische Wirtschaftsweise ist eine ökologische Notwendigkeit,“ erklärte uns der GTZ-Projektleiter, „d.h. sie sollen ziehen und nicht auf der Stelle treten, um Überweidung zu vermeiden.“
Wo das noch nicht in ausreichendem Maß geschieht, sprechen Mongolenforscher wie der FU-Professor Janzen von „Neuen Nomaden“ – so wie anderswo von „Neuen Russen“ oder „Neuen Tschechen“ die Rede ist – seit 1990. Das häufigste neue Delikt ist seitdem der Viehdiebstahl, erfahren wir von einem Juristen in Dalanzadgad. Hinzu kam anfänglich noch die „Armuts-Wilderei“, die jetzt jedoch – in der Gobi zumindest – aufgehört hat. Dafür nimmt die „Neureichen-Wilderei“ zu. Daneben wird auch noch vielfach illegal Gold geschürft, was besonders wegen der dabei verwendeten giftigen Chemikalien ein Problem ist. Diese „Ninjas“ will man jedoch nicht bestrafen, sondern ebenfalls in Communities und Genossenschaften organisieren.
Während die deutsche und holländische Entwicklungshilfe bei den Ärmsten unter den Viehzüchtern ansetzte, pickt sich die amerikanische die wenigen Reichen heraus, um sie gemäß des neoliberalen „Trickle-Down-Effekts“ derart zu unterstützen, dass sie seßhafte Viehbarone werden, deren Herden von lohnabhängigen „Cowboys“ umgetrieben werden. Vom Naturschutz-Standpunkt aus sehen die GTZ-Mitarbeiter darin keinen Widerspruch. Eher schon zur japanischen Entwicklungshilfe, die u.a. darin besteht, die Haupteisenbahnstrecke des Landes zu modernisieren. Dafür brauchten sie jede Menge neue Schwellen, die sie bei einer mongolischen Firma bestellten, die dazu einen Lärchenwald im Norden fällen ließ, den die GTZ gerade wiederaufforsten wollte.
In der Südgobi, der größten Provinz der Mongolei und zugleich die am dünnsten besiedelste (Insgesamt leben dort 3313 Familien bzw. auf vier Quadratkilometer ein Einwohner), hat die Forstwirtschaft es vor allem mit Weidepflanzen zu tun. Abgesehen von Saxaul-Sträuchern, Zwergwacholder, Ginster und Salzgewächsen sind dies in der Hauptsache Lauch, Ackerwinden, Tamarisken und Gänsefußgewächse. An den wenigen kleinen Flüssen bzw. in feuchten Senken wachsen außerdem Iris, Schilf und wilder Rhabarber, von denen sich der Gobi-Bär ernährt – und zwar ausschließlich. Früher wurde dieser Rhabarber auch exportiert – u.a. an den Hof von Tamerlan nach Samarkand.
Die Viehzüchterinnen bauen mehr und mehr Gemüse an und pflanzen Pappeln um ihre Gärten. Sie gingen in Stöckelschuhen über das Wüstenpflaster zu den Info-Jurten, wo sie über ihre Lage berichteten:
„Nach 1990 war jede Familie auf sich selbst gestellt, und sie wanderte so gut wie gar nicht. Das konnte nur durch die Communities gelöst werden. Das sind Kollektive wie im Sozialismus, aber diesmal bestimmen wir selbst, was zu tun ist. Etwas 2000 Viehzüchter haben sich bisher hier zusammengeschlossen. Schon im ersten Jahr 1999 haben wir das Positive daran gemerkt. Nach sieben Jahren können wir nun sagen, dass es richtig war. Wir haben uns kundig gemacht, wie die negative Entwicklung zustande kam. Außerdem haben wir jetzt bessere Möglichkeiten, unsere Produkte zu vermarkten. Wir bekommen bessere Preise für Kaschmirwolle und Leder, die Schafwolle verarbeiten wir selbst. Die Wilderei hat völlig aufgehört und keine Familie sammelt mehr Feuerholz. Wir wissen heute, wie die Natur zu verbessern ist. Außerdem waren wir drei Mal im Ausland, haben viel gesehen und sind auf neue Ideen gekommen.“
„In der Gobi gibt es viele Bodenschätze: Gold, Kupfer, Zinn, Eisen, Blei, Kohle und Edelsteine. Bisher haben wir noch keine Probleme mit Abbaufirmen gehabt, aber es kommen viele Viehzüchter zu uns, die anderswo von Minengesellschaften vertrieben wurden. Weil die Leute nicht mehr jagen, haben sich die Wölfe sehr vermehrt – und kommen immer näher. Im letzten Winter haben sie 20 Pferde gerissen. Es gibt eine starke Landflucht in der Mongolei, aber bei uns nicht, da sich unser Lebensniveau verbessert hat. Auch die Qualität unserer Herden. Es gibt wieder eine Veterinärbetreuung für die Tiere, das machen die Japaner. Die Community-Unterstützung durch die deutsche GTZ wird demnächst von den Neu-Seeländern fortgeführt. Auch wir sind international geworden, so arbeitet z.B. eine Frau in der „World Alliance of Mobile Indigenous People“ mit.“
Eine GTZ-Mitarbeiterin erklärte später: „Man darf nicht als Experte auftreten und muß vor allem buchstäblich von der Graswurzel aus denken. Das Problem am Anfang war, dass die Frauen nicht zu den Gemeindeversammlungen in die Bag-Zentren gingen, sondern bei den Jurten blieben. Die GTZ hat deswegen Info-Jurten aufgestellt, wo sie sich treffen konnten. Inzwischen sind schon 80% der Community-Leader Frauen.“
Ein Viehzüchter meinte: „Früher wurde alles von oben organisiert, dann kam plötzlich die Marktwirtschaft. Wir sind die ersten in der Mongolei, die aus dem Dunkeln rausgekommen sind. Unser Beispiel macht inzwischen Schule. Früher hockte jede Familie auf einer Stelle, jetzt ziehen wir in der Regel vier mal im Jahr um.“
Eine Viehzüchterin ergänzte: „Es gibt auch große Veränderungen im Verhältnis zwischen Mann und Frau. Die Frauen waren vorher immer nur zu Hause mit Kindern, haben wenig untereinander geredet. Und die Männer waren nicht gut genug ausgebildet, um die richtigen Entscheidungen treffen zu können, sie haben viel gegessen und getrunken. Bereits das erste Meeting mit dem Naturschutzprojekt, wo die Idee des Zusammenschließens begründet wurde, hat uns die Augen geöffnet. Seitdem hat es viele Veränderungen in unserem Leben gegeben. Ich bin selbst ein Beispiel dafür: Obwohl eine einfache Viehzüchterin habe ich mich in den letzten Jahren sehr verändert und mein Leben verbessert. Wir sind 35 Familien, 144 Menschen und haben 7000 Tiere. 1999 ging es nur sechs Familien gut, der Rest war arm. Wir hatte keinen Zugang zu Informationen und waren zerstreut.“
Eine andere Viehzüchterin erzählt: „Den Anfang haben fünf Frauen gemacht – sie sind raus aus den Gers [das mongolische Wort für Jurten]. Dann kamen mehr dazu. Wir haben Einfluß auf die Männer genommen. Und mit ganz kleinen Sachen angefangen, uns gegenseitig zu helfen. Das war ein langsamer Prozeß. Wir haben z.B. Zäune gemeinsam repariert, die Weiden von Tierkadavern gesäubert, mit Behörden verhandelt, Kurse im Gemüseanbau für uns organisiert…Dann haben wir im Bag-Center für Geld gearbeitet und den Armen dafür Vieh gekauft. Unser Fähigkeit zu kooperieren hat sich immer mehr verbessert.. Gleichzeitig mußten wir die Balance zwischen Familie und Kollektiv finden.“
Ein älterer Viehzüchter wirft schließlich noch ein: „Die Frauen haben die Ideen, die Männer setzen sie um.“
Ich habe hier den wenigen Menschen und besonders den Frauen so viel Platz eingeräumt, weil sie den größten Eindruck auf uns gemacht haben – in dieser so genannten Wüste.
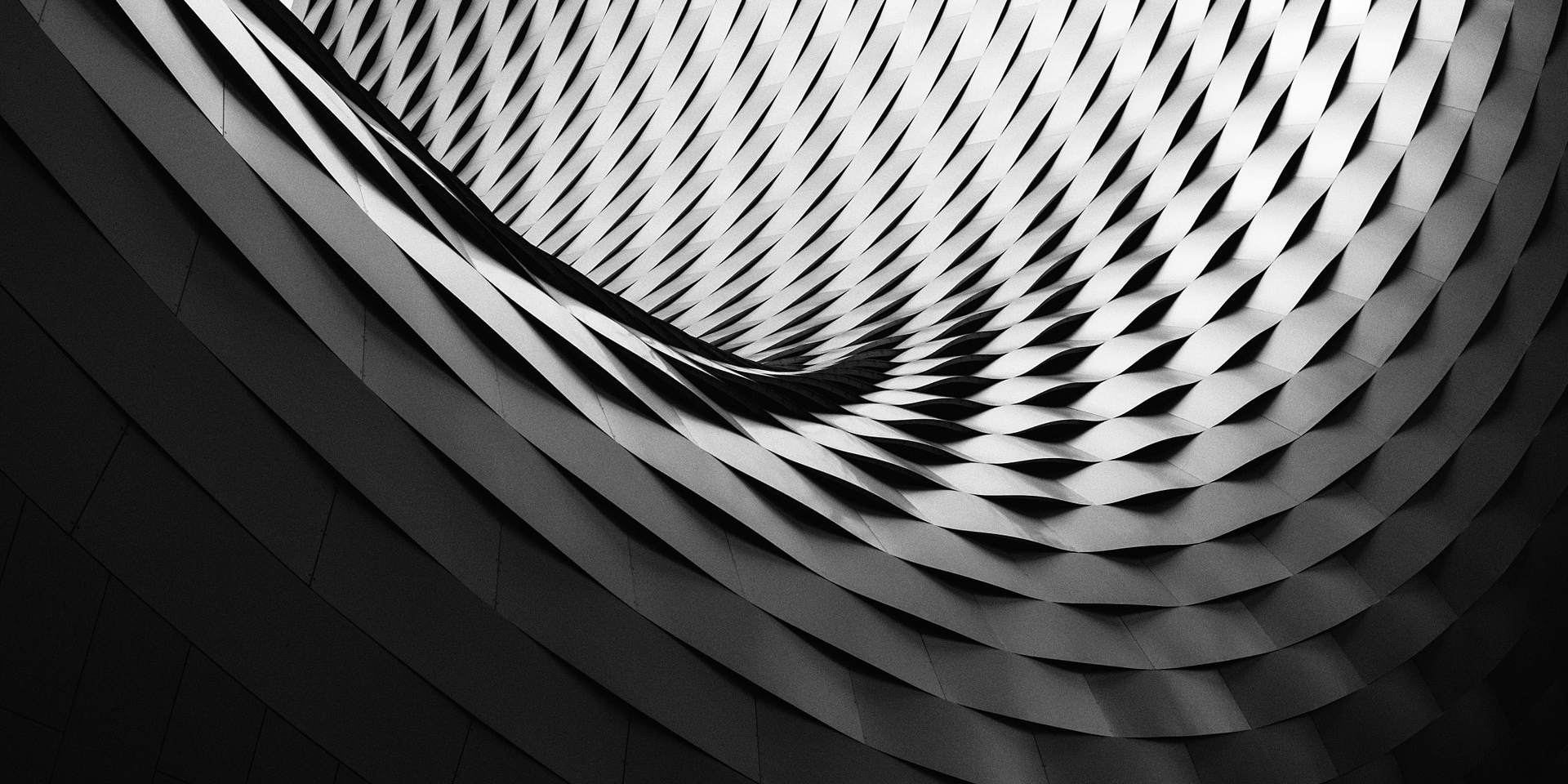



3sat.de meldet:
Mit GPS-Sendern versuchen Wissenschafter der Universität Wien, bedrohte asiatische Wildesel(Khulane) in der Mongolei vor dem Aussterben zu bewahren. So soll das Verbreitungsgebiet der Wildesel-Herden erkundet werden; nach Auswertung dieser Daten sollen gemeinsam mit der mongolischen Regierung Schutzgebiete für die Wildesel eingerichtet werden. Schon jetzt ist klar, dass die Wildesel riesige Territorien beanspruchen: Bei der Futtersuche durchwandern sie in sechs Monaten ein Gebiet von 5000 Quadratkilometern.
Die Daten über den Standort der Tiere werden per Satellit in ein Forschungszentrum übertragen, von wo aus sie jeden zweiten Tag per Internet abgefragt werden. So können die Wissenschaftler die Wanderungen der Khulane, ihre bevorzugten Futterplätze und Wasserlöcher während der einzelnen Jahreszeiten exakt nachvollziehen.
Die mehr als 70 Kilometer pro Stunde schnellen Esel mit Sendehalsbändern auszustatten, war kein leichtes Unterfangen. Deshalb wurde die Narkose auch gleich für eine Blutabnahme für weitere Untersuchungen genützt. Einzig in der Wüste Gobi in der Südmongolei kommt der Khulan noch in größerer Anzahl vor. Die Tiere leben in Herden und sind so genügsam, dass sie auch in unfruchtbaren Halbwüsten gut zurechtkommen. Die Tiere sind durch Wilderer und durch den Abbau von Bodenschätzen in ihrem Bestand bedroht. Es gibt derzeit nur noch etwa 15.000 von ihnen.
Eine weitere Gefahr droht dem Khulan durch den Wasserverbrauch einer Minengesellschaft, die in der Wüste Gobi Kupfer und Gold abbaut. In der Folge sinkt der Wasserspiegel.
Khulane sind es gewohnt, dreißig bis vierzig Zentimeter tief nach Wasser zu graben. Doch wenn der Wasserspiegel weiter sinkt, wird es für die Wildesel immer schwieriger, in der ohnehin kargen Wüstenlandschaft Wasser zu finden.