In Westberlin war und ist wohl immer noch die „Stiftung Umverteilung“ ein guter Anlaufpunkt, wenn man Geld für ein politisches oder soziales „Projekt“ braucht. Die taz ließ sich von der Stiftung z.B. ihr Bürohaus nebst neuem Anbau in der Kochstraße finanzieren. Aber auch, wenn einem nur 45 Euro für eine Flugblattaktion fehlten, konnte man auf die Schnelle einen Antrag dort stellen. Gegründet wurde sie vom Kreuzberger „Palmen“-Apotheker Ulf Mann. Die taz schrieb einmal über ihn:
„Er unterstützt das Russell-Tribunal und Umweltfestivals. Er finanziert freie Radios und Gesundheitsprojekte für Frauen. Auch Befreiungsbewegungen interessieren ihn und dann all die Freunde, die etwas brauchen, um ein Haus zu kaufen zum Beispiel. Manchmal zieht er mit ein, um irgendwo anzukommen. „Es gab wenig Leute, bei denen ich das Gefühl hatte, die sind mit mir zusammen nicht wegen des Geldes.“ Eigentlich sollte er Juniorchef der ‚Dr. Mann Pharma‘ werden. Aber er hatte so Ideen, die passten nicht ins Schema: „Wenn ich Chef werde, kommt ’ne Klimaanlage in die Firma. Und ein Fußballplatz und ’ne firmeneigene Tankstelle.“ Es ist nicht so weit gekommen: Nach dem Tod des Vaters trauten ihm die Gesellschafter den Sprung ins Unternehmertum nicht zu. „Nicht dass ich mich für einen besseren Menschen halte. Ich habe von den Tantiemen gelebt.“
Als die Firma 1985 verkauft wird, ist er noch reicher. „Plötzlich diese Riesenlast.“ Verantwortung für viele Millionen. „Das zieht einen so rein in den Strudel. Man darf kein Geld verschenken, da fällt Schenkungssteuer an.“ Er stöhnt noch bei dem Gedanken daran. Das mit dem Geld, das wird ihm zu viel. Er sucht nach Wegen, es loszuwerden. Sinnvoll loszuwerden. Auch für sich. „Ich war 20 Jahre lang Millionär. Das hält man als normaler Mensch nicht aus.“ Mitte der 80er-Jahre hat Ulf Mann sein 18 Millionen Euro umfassendes Vermögen in eine Stiftung gegeben, die ‚Stiftung Umverteilen‘.“
Als die Grünen starteten, wurden sie von gleich drei Stiftungen flankiert. Über die Gelder entschied dann jeweils eine Gruppe ebenso seriöser wie basispolitisch erfahrener Genossen. Auch sie finanzierten Flugblätter, Pamphlete, Bücher, Frauenkongresse usw. Überhaupt sollten sie eine Art Transmissionsriemen zwischen Partei und Bewegung sein, dergestalt, dass die Stiftung letztere – Initiativen von unten – unterstützte bzw. förderte, und damit deren berechtigte Forderungen über die kleine grüne Partei Eingang in die Politik fänden, die so deren Basispolitik bloß „umsetzte“ (in staatliche).
Aber dann wurden die Grünen schnell groß und reich: Weil es für Parteienstiftungen viel Staatsknete gibt, änderten sie schnell ihr Stiftungsgeschäft. Sie drehten es um 180 Grad herum: Aus den dreien wurde eine – die Heinrich-Böll-Stiftung, die dann nicht mehr primär Basisinitiativen unterstützte, sondern umgekehrt: der Parteispitze argumentativ zuarbeitete. Dazu domizilierte sich diese Stiftung an ebenso vornehmen wie teuren Orten im In- und Ausland, wo sie regelmäßig Halb-, Dreiviertel- und Ganzpromis zu „Konferenzen“ einlädt, auf denen die brennendsten Probleme unserer Zeit oder das, was der Heinrich-Böll-Stiftungsvorstand dafür hält, diskutiert werden. All das ist furchtbar öde und langweilig – und beweist wieder einmal nur das eine:
Das Elend mit den Reichen ist ein doppeltes! Einmal, wie sie zu ihrem Geld kommen und zum anderen, wie sie es ausgeben. Im Adels-„Club zu Berlin“ hielt vor einiger Zeit die Tochter des schwedischen Tetrapack-Konzerngründers Rausing, der wegen des Steuersatzes nach England auswich, einen vielgelobten Vortrag über das Know-How für soziale und kulturelle Stiftungen von Reichen. Einige hat sie selbst mitgegründet, daheim geriet sie aber vor allem wegen ihrer etliche Millionen Pfund teuren schottischen Datsche in die öffentliche Kritik. In Deutschland kennen wir dieses hin und her auch: Einmal das berühmte von einem jüdischen Getreidehändler gestiftete Frankfurter „Institut für Sozialforschung“, zuletzt Kaderschmiede des SDS und zum anderen das vom Sohn eines arischen Zigarettenhändlers gestiftete Hamburger „Reemtsma-Institut“ für Post-68er-Gerumpel. Nicht zu reden vom Petrarca-Kulturpreis des Bunte-Herausgebers Burda und der idiotischen „Hertie Herrsch-Hochschule“ im einstigen DDR-Staatsratsgebäude.
Idiotisch – im klassischen Sinne, womit ein Denken und Tun gemeint ist, dass sich nur auf den (eigenen) oikos und nicht auch noch auf die polis richtet (bezieht).
Die Weltmeister darin dürften all jene Amis sein, die es mit Lug und Trug vom Hausierer-Sohn zum Multimillionär (John D. Rockefeller), vom Webersohn zum „Stahlbaron“ (Andrew Carnegie), vom Coca-Cola-Verkäufer zum „Großinvestor“ (Warren Buffett) oder vom Programmierer zum „E-Monopolisten“ (Bill Gates) brachten. Und die dann als „Superreiche bzw. „reichste Männer der Welt“ ihre „Verantwortung“, ihre „soziale Ader“ oder ihre „Vision“ entdeckten bzw. derart vom „schlechten Gewissen“ geplagt wurden, dass sie sich am Ende – kurz vor Toresschluss – doch noch der (langlebigeren) polis zuwandten. In Form von Kultur-, Wissenschafts-, Friedens- und Gesundheitsstiftungen. Wobei letztere nicht selten eine Medizin (er)finden sollen – gegen eine Krankheit, an der zuvor der Big Spender selbst gestorben war. Hierbei verklammert sich quasi die Hoffnung auf ein Fortleben des eigenen (privaten) Haushalts mit dem allgemeinen (medizinisch-technischen) Fortschritt der Welt-Gesellschaft. Und das private, an sich geraffte Kapital, das dabei jede Menge Soziales „schöpferisch zerstörte“, soll nun in einem Handstreich wieder gesellschaftlich sinnvoll wirken. Was für ein Schwachsinn!
Ich erinnere in diesem Zusammenhang nur an den berühmt-berüchtigten IG Metall- und Treuhand-Juristen Jörg Stein, der als Chef des größten Beschäftigungskonzerns erst in Ost- und dann auch in Westdeutschland steinreich wurde – bis er an einer Krankheit starb, zu dessen Bekämpfung er zuletzt sein Vermögen einsetzte. Ist das nicht ein Irrsinnskreislauf?! Es kamen hierbei aber nur „peanuts“ zum Einsatz. Noch im gesunden Zustand spendete dagegen Bill Gates etliche Milliarden, die nun auch noch aufgestockt werden durch 31 Milliarden, die ihm Warren Buffett dazu gibt, u.a. für alle kranken Kinder dieser Welt! Allen Ernstes strebt Gates nun auch noch ein Kranke-Kinder-Monopol an. Und nicht wenige „Beobachter“ finden das ganz in Ordnung (die Miesmacher sprechen freilich von „Entwicklungshilfe nach Gutsherrenart“).
Nun hat der Stifter jedoch nicht bloß Vorpommern, sondern die ganze Welt im Visier. Dabei weiß heute selbst der fertigste „Streetworker“, sagen wir aus Kreuzberg, dass schon eine einzige Straßenseite, sagen wir die der Wienerstrasse, zu organisieren – schier unmöglich ist, und sei es im „Mieterbund“. Erst recht kann man nicht jedem kranken Kind in einer Straße gesundheitlich beikommen – ohne unweigerlich auf die unterschiedlichsten familialen, sozialen und wirtschaftlichen Hintergründe zu stoßen, die seine Krankheit allererst ausmachen – und „Heilung“ verlangen. Selbst die zu Millionen zählenden Kinder, die es krank macht, als Prostituierte, Näherinnen oder gequälte Hausmächen, als Bergarbeiter, Träger oder Strichjunge zu arbeiten – scheinen den Idioten Gates nicht nachdenklich gemacht zu haben, als er sein „Global Health Project“ verkündete. Und auch die inzwischen in die Milliarden gehenden „Überflüssigen“ auf dieser Welt, für die nicht einmal mehr irgendwelche Generäle Verwendung haben, konnten Gates nicht von seiner Weltstiftung abbringen.
Man muß das wohl oder übel „amerikanischen Optimismus“ nennen. Es ist aber der blanke Idiotismus (nicht ohne Grund haben die Chinesen in ihrem Revolutionsmuseum am Ausgang eine Bill Gates-Figur gegenüber einer Figur von Lei Feng, der sich als „kleine Schraube in der Revolution“ begriff, aufgestellt). Was nicht heißt, dass Gates nicht noch übertroffen werden kann: Und zwar vom Bill Gates der Genetik, den Genunternehmer Craig Venter, der völlig übergeschnappt ist – zusammen mit dem Direktor des Humangenomprojekts Francis Collins. Da gibt es den Diamantenkonzern Archon Minerals: Man weiß, wie die Diamantenminen-Arbeiter weltweit ausgebeutet werden und wie krank ihre Arbeit sie macht. Archon ist aber durch sie steinreich geworden – und hat nun – wohl aus schlechtem Gewissen – eine Stiftung gegründet, die fortan (und weil es immer gleich das „Weltgrößte“ in Amiland sein muß) den „weltgrößten Medizinpreis“ verleiht – den „Archon X-Prize“: zehn Millionen Dollar schwer. Weil der Konzern keine Ahnung von Medizin hat, fungieren nun die beiden o.e. Obergenetiker als Stiftungsbeiräte. Und als solche haben sie sogleich listig beschlossen, sich doch am Besten selbst – als die sowieso weltbesten Genetiker – das Geld zuzuschustern, nämlich indem sie beschlossen haben, dass ein Labor die Summe erhalten soll, das „als erstes die Sequenzierung von hundert individuellen Genomen in zehn Tagen“ schafft. Und das können wahrscheinlich nur die Unternehmen der zwei Beiräte.
Es gab schon mal einen ähnlich schwachsinnigen Weltpreis – er wurde um die Jahrhundertwende in Chicago vom Hersteller eines Sicherheitsschlosses gestiftet: Wer es schaffte, dessen neu auf den Markt gekommenes Schloss in zehn Tagen zu knacken, der sollte eine Million kriegen. Dieser Preis löste die berühmte „Chicago Log-Controversy“ aus.
Zurück zu Craig Venter: der US-Unternehmer wurde gerade 60 – aus diesem Grund gratulierte ihm die FAZ gleich zwei mal – so beeindruckt war und ist sie von diesem finsteren Typen, der jetzt auch noch eine eigene Stiftung gegründet hat. Auch diese soll seine eigene fixe Idee finanzieren: mit Hilfe von genmanipulierten Bakterien will er das Kohlendioxyd in der Atmosphäre zersetzen und gleichzeitig Wasserstoff produzieren – „den Energieträger der Zukunft“. Damit geht es ihm nun nicht mehr wie bisher bloß darum, altes „Erbgut“ zu lesen, sondern „neues Leben zu schaffen… Löst Venter damit die Energieprobleme der Menschheit, wird er sich dadurch verewigen,“ freut sich die FAZ schon mal für ihn.
Letztlich läuft alle „Heilung“ bei der Gen(aus)lese immer auf neue Medikamente hinaus, d.h. auf eine Eugenik auf privatwirtschaftlicher Basis. Damit wird z.B. jede Mutter dafür verantwortlich gemacht, ein gesundes, kluges, schönes Kind zu gebären. Produkthaftung nennt man das.
„Unrecht Gut gedeiht nicht,“ sagte man unter Christen – und meinte damit: Das Geld, was jemand an sich gerafft hat – unter rücksichsloser Ausbeutung oder verbrecherischem Betrug, das bringt kein Glück (wie etwa der „Aldi“-Lehrstuhl?). „Geld stinkt nicht!“ sagten dagegen die heidnischen Römer, denn es geht kein Gramm Naturstoff in diesen reinen Tauschwert ein – also auch kein Blut oder Leid. Man kann deswegen damit Gutes oder Schlechtes bewirken – Sinnloses und Sinnvolles (wie z.B. George Soros) tun. Das leuchtet ein, ich zweifel jedoch immer mehr an dieser Weisheit: Diese ganzen Stiftungen der Reichen sind von Arsch, schädlich. Schon allein, weil die ungeheure Vermehrung von Stiftungen zur Verbesserung der Lebensbedingungen von Armen und Kranken glatt als eine Art Indikator für das Fortschreiten der postsozialistischen „Umverteilung von unten nach oben“ gelten kann.
Nun ist aber nicht Stiftung gleich Stiftung. Es gibt sogar Stiftungen von Armen: Vor 21 Jahren wurde in Westberlin die „Werkschule“ gegründet. Eine Kerngruppe von damals hat daraus vor etwa zehn Jahren eine gemeinnützige Stiftung gemacht, die ähnliche sozialpädagogische Projekte im sogenannten Randgruppenbereich ideell und vor allem finanziell fördert.
Was in der Studentenbewegung „Randgruppenstrategie“ genannt wurde, die Unterstützung von aus Gefängnissen entlassenen und Heimen entflohenen Jugendlichen („auf Trebe“), entwickelte sich in den Siebziger Jahren zu einer eigenständigen sozialen Bewegung im pädagogischen Bereich. Sie verband sich teilweise mit einer Bewegung unter den sozial benachteiligten Jugendlichen selbst.
Zu den Westberliner „Treberhilfen“ zählten bald neben einigen besetzten Häusern auch Beratungsbüros, die versuchten, Jugendliche zu „entkriminalisieren“ und ihnen dazu u.a. Wohnungen und finanzielle Unterstützung vermittelten. Diese sozialarbeiterische „Praxis“ wurde jedoch bald als ebenso ungenügend empfunden wie die darauf vorbereitende „Ausbildung“ in den sozialpädagogischen Fachhochschulen.
Anfang der Achtziger Jahre unternahm eine Gruppe aus diesen zwei Bereichen eine Fahrt zur dänischen Heimvolkshochschule Tvind. Auch Lehrer und Sozialpädagogen der Universitäten Bremen und Kassel ließen sich damals vom neuen „Tvind-Modell“ inspirieren – und gründeten eigene selbstverwaltete „Werkschulen“. Es war eine kleine pädagogische Bewegung.
Die Berliner Gruppe baute dazu Fabriketagen in Moabit, Kreuzberg und Schöneberg aus, im Wedding schließlich sogar zwei komplette Mietshäuser: in der Wriezener und in der Stettiner Straße. Obwohl die einzelnen Projekte unterschiedliche Vorstellungen verfolgten, verstanden sich die daran beteiligten etwa 25 Erwachsenen als ein Kollektiv. Materielle Unterstützung, u.a. einen zinslosen 20.000 DM Kredit, bekamen sie zunächst vom Kreuzberger Apotheker Ulf Mann, noch bevor dessen Stiftung existierte, bei der er nebenbeibemerkt nicht im Stiftungsrat saß! Da sollten andere entscheiden – die ein möglichst breites Spektrum von sozialen bzw. politischen Aktivitäten „abdeckten“.
Die ersten drei Werkschul-„Kurse“ mit Jugendlichen fanden in den großen Fabriketagen statt – noch weitgehend provisorisch und ohne strikte Rollenaufteilung: laut Satzung hatte jeder Erwachsene und jeder Jugendliche eine Stimme auf Versammlungen. Es sollte kein Erzieher-Zöglings-Verhältnis mehr sein, in dem die einen aus den anderen anständige Menschen machen, sondern ein Projekt „politischen Zusammenlebens“. Als man mit dem 4. Kurs nach zweieinhalbjähriger Bauzeit, Anfang 1983, in das renovierte Haus Wriezener Straße zog, war zumindestens den Erwachsenen schon etwas klarer, was sie konnten, wollten und brauchten. Ihre „Großfamilie“ dort bestand aus neun Jugendlichen, hinzu kamen noch – außerkonzeptionell – zwei Pflegekinder. Alle hatten ein eigenes Zimmer, auch die fünf Erwachsenen. Sie waren Eltern, Putzfrauen, Köche, Lehrer, Psychologen und Werkmeister in einem und das rund um die Uhr. Die laufenden Unkosten wurden über die „Heimpflegesätze“ des Jugendamtes beglichen. Außerdem gab es nach dem Bauherrenmodell noch Zuschüsse aus „Landesmodernisierungsmitteln“. Im übrigen stand allen Beteiligten nur ein Taschengeld zur Verfügung, wenigstens anfänglich. Nach langen Diskussionen genehmigten sich die Erwachsenen schließlich 250 DM monatlich, wobei einige mehr beanspruchten und es auch bekamen. Den Jugendlichen zahlte die Ämter 80 DM monatlich als Taschengeld, hinzu kamen noch 70 DM Kleidergeld sowie 30 DM Fahrgeld.
In den ersten Kursen hatte es geheißen: Wir lernen an und in den praktischen Alltagsdingen. In der „Küchengruppe“ brachte man den Jugendlichen z.B. neben Biologie und Mathematik auch das Schlachten eines Schweins oder das Ausnehmen eines Huhns bei. In der „Bürogruppe“ lernten sie u.a. Schreibmaschineschreiben, um damit die Korrespondenz des Projekts mit Jugendämtern und Banken zu erledigen. Die „Fahrradgruppe“ reparierte alle fahrbaren Untersätze und organisierte Exkursionen. Das Problem hieß: Wie kann man vom Versagen geprägte „schulmüde“ Jugendliche wieder neu zum Lernen motivieren?
Der „Hauptschulkurs“ in der Wriezener Straße hatte den Schwerpunkt „Bauen und Reisen“. Er begann mit der „Einzugs- Phase“. Um die Zimmer her- und einzurichten und eine Remise zu Unterrichtszwecken auszubauen, wurden erst einmal „Gewerke- Gruppen“ (für die noch notwendigen Tischler-, Elektro- Malerarbeiten z.B.) gebildet.
Anschließend führte man mit zwei hinzugezogenen Theaterpädagogen einen „Theaterkurs“ durch: „Um einen spielerischen Umgang mit sozialen Rollen zurückzugewinnen,“ wie die Sozialpädagogin Ulla Grove erklärt, die in der Wriezener Straße damals eine „gewichtige Rolle“ spielte.
Im Gegensatz zu Tvind, aber auch anders als in den Bremer und Kasseler Werkschulen, wo man in der „Reisephase“ große Busse ausbaute, mit denen dann der Kurs in ein Land der Dritten Welt fuhr, um die Lebensbedingungen dort näher kennenzulernen, wollte die Berliner Gruppe drei Monate lang Nordamerika bereisen. Also mußte erst einmal ein „Englischkursus“ eingerichtet werden. Daraus entstanden nacheinander zwei „Arbeitsgruppen“. In der ersten wurde auf Englisch eine Broschüre über die Werkschule und seine Umgebung, den Wedding, zusammengestellt – für all die Projekte und Leute, die man in den USA kennenlernen wollte.
Die zweite „AG“ beschäftigte sich mit einigen politischen und historischen Aspekten Berlins, von denen man annahm, daß sie die Amerikaner interessieren könnten. Auch die Geographie und Geschichte der USA wurde gelernt.
Da der Senat – wenigstens damals noch, 1985 – den Heimjugendlichen keine derart weitschweifigen Exkursionen bezahlen wollte, mußte das Projekt selbst die Flug- und Reisekosten aufbringen. Zuerst einmal sorgte eine ehemalige Dozentin der Berliner Fachhochschule in Virginia für die Unterbringung. Dann wohnten alle Jugendlichen für 14 Tage bei verschiedenen Familien. Die Erwachsenen kauften in der Zwischenzeit fünf preisgünstige PKWs, mit denen man sich aufteilte: 3 Gruppen fuhren an die Westküste und zwei an die Ostküste. Ein Jugendlicher wurde vorzeitig zurückgeschickt, weil er nach Ansicht der Erwachsenen die ganze Reisegruppe „terrorisierte“. „Er war der einzige Punker und sehr intelligent, wir mochten ihn sehr,“ so Ulla Grove.
Wieder zurück in Berlin begann die letzte „Lernphase“, d.h. die Vorbereitung auf den eigentlichen Hauptschulabschluß. Alle elf Jugendliche bestanden schließlich die Prüfung. „Für einige war es das erste größere Erfolgserlebnis in ihrem Leben“. Die Betreuer benötigten danach eine längere Pause. Sie zogen in Einzelwohnungen. Im Kollektiv brachen „Flügelkämpfe“ aus – zwischen den fünf „strengen“ pädagogischen Betreuern im Haus und den drei eher „pragmatischen“ Außenkontaktern beispielsweise. Das „Wohngemeinschaftsmodell“ hatte 1986 allgemein schon an Attraktivität verloren. Hinzu kam, daß auch das pädagogische Umfeld sich inzwischen gewandelt hatte und kaum noch Resonanz für solch Werkschul-Experimente hergab. Mit der Wende verstärkte sich diese Tendenz dann noch einmal.
Peter Rambauseck, ehemals Dozent an der Fachhochschule, später ABM-Kraft in einer Wohnungsbaugesellschaft, sagt heute: „Im ganzen Kollektiv steckte ein Gefühl des Scheiterns.“ Ulla Grove, ehemals Studentin an der FHSS, sieht es etwas anders: „Wir haben sehr viel gemacht, und wollten zu viel.“
Rüdiger Stuckart, der den vorletzten Kurs, von 1986 bis 1989 mitbetreute, meint, daß ihr politischer Anspruch im täglichen Alltagskampf – gegen das Versumpfen der Jugendlichen im Hasch und Suff z.B., bei dem die Erzieher schließlich zu einer „Sauberes Klo“-Fraktion herunterkamen – immer abstrakter wurde. Bis sie schließlich auch nur noch eine sozialpädagogische Maßnahme unter anderen waren. „Die Utopie der Jugendlichen sah zuletzt durchweg so aus, daß sie sich eine Einzelwohnung im Grunewald wünschten, mit einem Glasschreibtisch, darauf einen Computer, und vor der Tür einen Sportwagen.“
Rüdiger Stuckart und Peter Rambauseck sind schon seit langem befreundet. 1969 gaben sie mit andereren zusammen die rätekommunistische Zeitschrift, „Die soziale Revolution ist keine Parteisache“, heraus. Rüdiger hatte an der FU Soziologie studiert, wo man ihn wegen politischer Radikalität für zwei Semster relegierte, er schloß jedoch sein Studium dort mit einem Diplom ab. Später kam in Frankfurt noch eine Zusatzausbildung in Sonderpädagogik hinzu, was zu einer „Behindertenarbeit“ in einem Steglitzer Integrationskinderladen führte. Wie „Ramba“ gehörte er zur militanten Fraktion des SDS, die weg von den Universitäten wollte und in Stadtteilen bzw. Betrieben sich zu „verankern“ suchte – im Bestreben, die Studentenbewegung in eine gesamtgesellschaftliche Bewegung zu transformieren.
Peter Rambauseck beendete 1972 sein Studium am Otto-Suhr-Institut der FU als Diplompolitologe. Später arbeiteten die beiden als Lehrbeauftragte an der Fachhochschule für Sozialpädagogik.
Von ihrer Herkunft könnten die beiden nicht verschiedener sein: Rüdiger Stuckarts Vater war SS- Obergruppenführer und Staatssekretär im Reichsinnenministerium, zuständig für die Judenverfolgung. Im Wilhelmstraßen-Prozeß, „gegen von Weizsäcker und andere“, wurde er dann zu nur vier Jahren Gefängnis verurteilt. Er starb 1954. Der 1944 geborene Rüdiger Stuckart – er machte 1963 in Wiesbaden das Abitur, hat seinen Vater kaum gekannt.
Peter Rambauseck kennt seinen Vater überhaupt nicht. Er hieß Hans Janocha und war im Prenzlauer Berg dasselbe wie Erich Mielke im Wedding: ein „Arbeiter der Faust“. Er ging dann als Kämpfer nach Spanien. Seitdem gilt er als verschollen. Rambas Mutter, Lotte Rambauseck, war als wichtiger Kurier im illegalen Apparat der KP tätig, ihren Sohn gebar sie im Januar 1934 in Gefängnis-Haft. 1944 ging sie als Praxishelferin ins Ruhrgebiet, wo sie fortan lebte. Peter Rambauseck wuchs als „Vollwaise“ zunächst bei einer Pflegemutter im Prenzlauer Berg auf, 1941 kam er mit der Kinderlandverschickung nach Böhmen, von wo aus er 1945 zurücktrampte. Mit einem sowjetischen Militärtransport erreichte er wieder Berlin. Die Ostberliner „Spanienkämpfer“ besorgten ihm später eine Schlosserlehrstelle im Babelsberger Karl-Marx-Werk, anschließend kam er zur Kasernierten Volkspolizei, die im ehemaligen KdF-Heim Prora auf Rügen stationiert war, von 1953 bis 56 diente er bei der Volksarmee. Danach erwarb er auf der Arbeiter-und-Bauern-Fakultät die Hochschulreife, mit der er an der Humboldt-Universität Medizin studierte. Von dort aus wechselte er 1961, gleich nach dem Mauerbau, mit einem falschen US-Paß in den Westteil der Stadt über, wo er sich an der FU immatrikulierte.
Nach dem Mauerfall begann er mit Hilfe der Prenzlauer Berg Historikerin, Regina Scheer, und dem Westberliner Widerstandsforscher H.D.Heilmann nach dem Verbleib seiner Mutter zu suchen. Leider entdeckten sie ihre Spur erst kurz nachdem sie gestorben war: 1990 in Köln. In der Zwischenzeit starb auch Rüdiger Stuckart: am 7.Juni 2004. In einem Nachruf heißt es – auf der „SDS-Website“: „Fünf Jahre lang ging es mit dem Krebs hin und her — und Rüdiger Stuckart wurde sanfter, weicher. Er lernte, die schönen Dinge des Lebens sehen: Einen blühenden Krokus, den Sonnenaufgang, wenn er am Wintermorgen in den Treptower Park zum Chi-Gong radelte. Die Familie beglückte er als hingebungsvoller Koch. Nur mit einer Sache kam er nicht ins Reine. Sie verfolgte ihn bis in die Träume. Worin er die Ursache seines Krebses sehe, fragte ihn ein Alternativmediziner. Rüdiger Stuckart zögerte nicht: ‚In der Geschichte meines Vaters.'“
Die Stiftung Werkschule hat Peter Rambauseck zuletzt als „Bildungsreferenten“ angestellt.
Trotz aller Unterschiede in der rückblickenden Einschätzung ihres Werkschul-„Projekts“ verträgt sich die Kerngruppe nach wie vor gut, wenn auch alle in verschiedenen „Jobs“ zur Zeit arbeiten. Das Haus in der Wriezener Straße wird heute von einem „Ausbildungsprojekt“ für 18 Azubis im Elektroinstallationshandwerk benutzt. Die Jugendlichen können zwischen mehreren „betreuten“ Wohnmöglichkeiten wählen: „So flexibel sind die Ämter inzwischen geworden“ (Ulla Grove).
Von „ihren“ damaligen Jugendlichen arbeiten zwei heute als Klempner, einer als Zimmermann, zwei Mädchen sind Hausfrauen und Mütter geworden, eine andere ist, mit einem Realschulabschluß, als Einzelhandelskauffrau tätig, ein Junge leistet gerade seinen Grundwehrdienst bei den Pionieren ab, ein anderer, Enrico, sitzt derzeit meistens in seiner zugemüllten Bude und macht gar nichts, der „Palästinenser“ hat geheiratet, ist Vater zweier Kinder geworden und arbeitet als Koch. Zu einigen ist der Kontakt abgerissen. Untereinander treffen sich die Jugendlichen fast regelmäßig, bei den Erwachsenen melden sie sich meist nur, wenn sie wieder mal ein Erfolgserlebnis zu vermelden haben oder gerade besonders durchhängen.
Die Werkschule hat seit ihrem Bestehen fast eine halbe Million DM angehäuft und besitzt zwei Häuser, die Miete einbringen. Damit hat die Restgruppe nun eine gemeinnützige Stiftung gegründet, mit der „Einrichtungen im Bereich von Erziehung, Bildung, Völkerverständigung, Jugend und Altenhilfe“ unterstützt werden sollen, „insbesondere wenn diese ihre Ziele in Form selbstverwalteter Projekte verfolgen oder das selbstbestimmte Leben von Menschen mit Behinderungen fördern.“
Dazu erklären die Stifter in einer ersten „Pressemitteilung“, daß ihre Werkschule zwar „eine ganze Zeit lang eine beachtliche Überzeugungskraft hatte, bei den beteiligten Jugendlichen ebenso wie bei den Erwachsenen, derzeit scheint jedoch solchen Bestrebungen kein guter Stern zu leuchten. Von seiten der angesprochenen Jugendlichen nicht, die ihre noch verschärfte Perspektivlosigkeit eher in Selbstzerstörung und blinde Aggression gegen andere Benachteiligte ummünzen, als sich im Kampf gegen die Ursachen und Profiteure ihrer Misere zusammenzuschließen. Aber auch von seiten der Erwachsenen/Pädagogen nicht, über denen die – berechtigten – Existenzängste in der sich verschärfenden Wirtschafts- und Sozialkrise derart zusammenschlagen, daß sie vollauf damit beschäftigt sind, ihre knappen Karrierechancen nicht zu verpassen.“
Am Ende teilt der Stiftungsvorstand lakonisch mit: „Das Kollektiv Werkschule hat sich aufgelöst. Es bringt die dank seiner Lebens- und Arbeitsweise ‚erwirtschafteten‘ materiellen Werte in eine Stiftung ein. Vielleicht können diese dem einen oder anderen in Zukunft entstehenden Funken verwandten Geistes eine bescheidene materielle Unterstützung bieten.“
Das taten sie dann u.a. bei der Weddinger Mädchen-Punkband „Böse Tanten“ – denen sie z.B. eine CD finanzierten.
Zu den „Armen“ gehören in Berlin viele Künstler und freiberufliche Forscher. Auch für sie gibt es jede Menge Stiftungen, bei denen sie Förderanträge stellen können. Ja, in dem Maße wie die staatlichen Gelder für Kunst und Wissenschaft zurückgenommen werden, treten neue Stiftungen auf den „Plan“, wobei es sich manchmal um bloße Etikettenwechsel im Privatisierungswahn und -wandel handelt – wie z.B. bei der Hauptstadt- und der Bundes-Kulturstiftung.
Daneben wird wie blöd das „Sponsoring“ propagiert (womit die privatwirtschaftliche Förderung gemeint ist). Für soziale und (kultur)politische „Projekte“ empfiehlt sich außerdem das „Fund-Raising“. Dazu gibt es im „strukturschwachen“ Berlin inzwischen auch noch die Variante des „Pfand-Raising“. Dabei haben sich unter den Berliner Pennern vor allem die Leergut-Straßencontainer bewährt: Man braucht dafür einen speziell zurückgebogenen Draht, darüberhinaus ist eine gewisse Sportlichkeit hilfreich. „Wenn der Sport der Bruder der Arbeit ist, dann ist Kunst die Cousine der Arbeitslosigkeit“, meinte der Künstler Thomas Kapielski.
Das typisch-amerikanische „Fundraising“ unter Semiintellektuellen ist jedoch eine stocknüchterne Angelegenheit. Das hört sich dann zum Beispiel – in dem „Fundraising-Wegweiser“ von Marita Haibach – so an: „Versuchen Sie in einer Art Brainstorming eine Liste von Individuen zusammenzutragen, die möglicherweise bereit wären, Ihre Initiative/Nonprofit- Organisation zu unterstützen.“ Die wichtigste Fundraising-Methode, um „SpenderInnen zu gewinnen, ist das persönliche Gespräch“. Es ist „besonders dann, wenn Personen um größere Förderbeträge gebeten werden wollen, unumgänglich. (…) Ein Fundraising-Gespräch muß gut vorbereitet werden. (…) Es müssen Hintergrundinformationen über die entsprechende Person gesammelt (verfügbarer Besitz, beruflicher Werdegang, Hobbies, Familienverhältnisse) und vor allem die Hauptinteressen des/r GesprächspartnerIn ergründet werden.“
Außerdem sollte man zuerst selbst für die Sache spenden, „dann sind sie besser in der Lage, andere zu bitten“. Was jedoch wenig nützt, wenn man daraus nichts zu machen versteht: „Ein Problem, besonders von Fundraising-Newcomern, ist die innere Barriere, andere um Spenden zu bitten. Diese Barriere läßt sich oft durch learning by doing überwinden.“ FundraiserInnen sollten „in einer Sprache reden, die dem Gegenüber angenehm ist (also nicht aggressiv oder aufgeladen mit politischen Kampfbegriffen).“ Man kann es zur Not auch schriftlich machen. Dann spricht die Fundraising-Expertin von „Mailing“. Dabei gilt es zu beachten: „Ein Mailing pro Jahr ist zu wenig.“ Bei „Massenspendenbriefen“ wiederum bedarf es eines ansprechenden Umschlags unter Verwendung eines Symbols. Hierbei hat sich insbesondere das „Laborschiff Beluga von Greenpeace“ und der „Pandabär des WWF“ bewährt.
Manchmal tut es laut Marita Haibach auch eine „interessante Absenderangabe: In USA erhielt ich einen Spendenbrief von der bekannten Feministin Gloria Steinem.“ Dort haben sich anscheinend auch Sonderbriefmarken – „aber bitte keine Wohlfahrtsmarken, die fördern ein falsches Bild“ – bewährt. Und dann gibt es auch noch das „Tele-Fundraising“: Es hat weniger Streuverluste als das Mailing und erfreut sich in den USA zunehmender Beliebtheit: „Gerade Alleinlebende freuen sich über einen Anruf!“ Bei all diesen Methoden gilt: „Zentrale Voraussetzung für erfolgreiches Fundraising ist ein klares Leistungsprofil sowie die Fähigkeit, dieses nach außen darzustellen.“ Bei HausbesetzerInnen könnte das aus einer Liste der von ihnen besetzten Häuser bestehen, bei BürgerrechtlerInnen aus einer ausgewählten Anzahl von ihnen enttarnter IMs, OibEs und so weiter.
Wir können dieser knappen Aufzählung von „Leistungsprofilen“ bereits entnehmen: Fundraising ist wie die Kunst selbst eine feine Sache – macht aber viel Arbeit. Speziell bei der „Sponsorensuche“ von Frauen kommt noch hinzu, daß das „Klinkenputzen“ oft als „erniedrigend“ empfunden wird. Laut Marita Haibach sollten die Frauen das mit dem Sponsoring verbundene „Sich-Verkaufen“ jedoch als „etwas Normales“ empfinden“.
Ihr Buch ist im Campus-Verlag erschienen, in dem sonst meist akademische Soziologica veröffentlicht werden. Auch in der Wissenschaft wird gespart, das heißt nach Sponsoren gesucht – was dort Drittmittelakquisition genannt wird. Wie der Leipziger Philosoph Peer Pasternak in seiner Doktorarbeit über die Hochschulkarrieren von West-68ern im Osten schreibt, scheuten viele dabei nicht einmal davor zurück, in der „Politikberatung“ Drittmittel zur „Aufstandsbekämpfung“ zu acquirieren. Damals begannen gerade die Bischofferöder Kalikumpel ihren Hungerstreik. Den „guten Rat im Buchformat“ von Marita Haibach gibt es in der neuen Reihe „campus concret“ – er ist so gesehen auch ein konstruktiver Beitrag zur Abschaffung der Hochschulautonomie aus Einsparungs- und Umschichtungsgründen.
Und es geht dabei natürlich – die vielen Anglizismen deuten bereits daraufhin – um das „Weltniveau“. Dazu noch einmal der laut Heiner Müller „Klassiker unter den antikolonialen Befreiungskämpfern auf dem Territorium der BRD“ – Herbert Achternbusch: „Ein Mangel an Eigenständigkeit soll durch Weltteilnahme ersetzt werden. Man kann aber an der Welt nicht wie an einem Weltkrieg teilnehmen. Weil die Welt nichts ist. Weil es die Welt gar nicht gibt. Weil Welt eine Lüge ist. Weil es nur Bestandteile gibt, die miteinander gar nichts zu tun zu haben brauchen … Früher hat man einen Bachlauf nicht verstanden, heute wird er begradigt, das versteht ein jeder. Ein Bach, der so schlängelt. Karl Valentin sagt: ‚Das machen sie gern, die Bäch‘.“
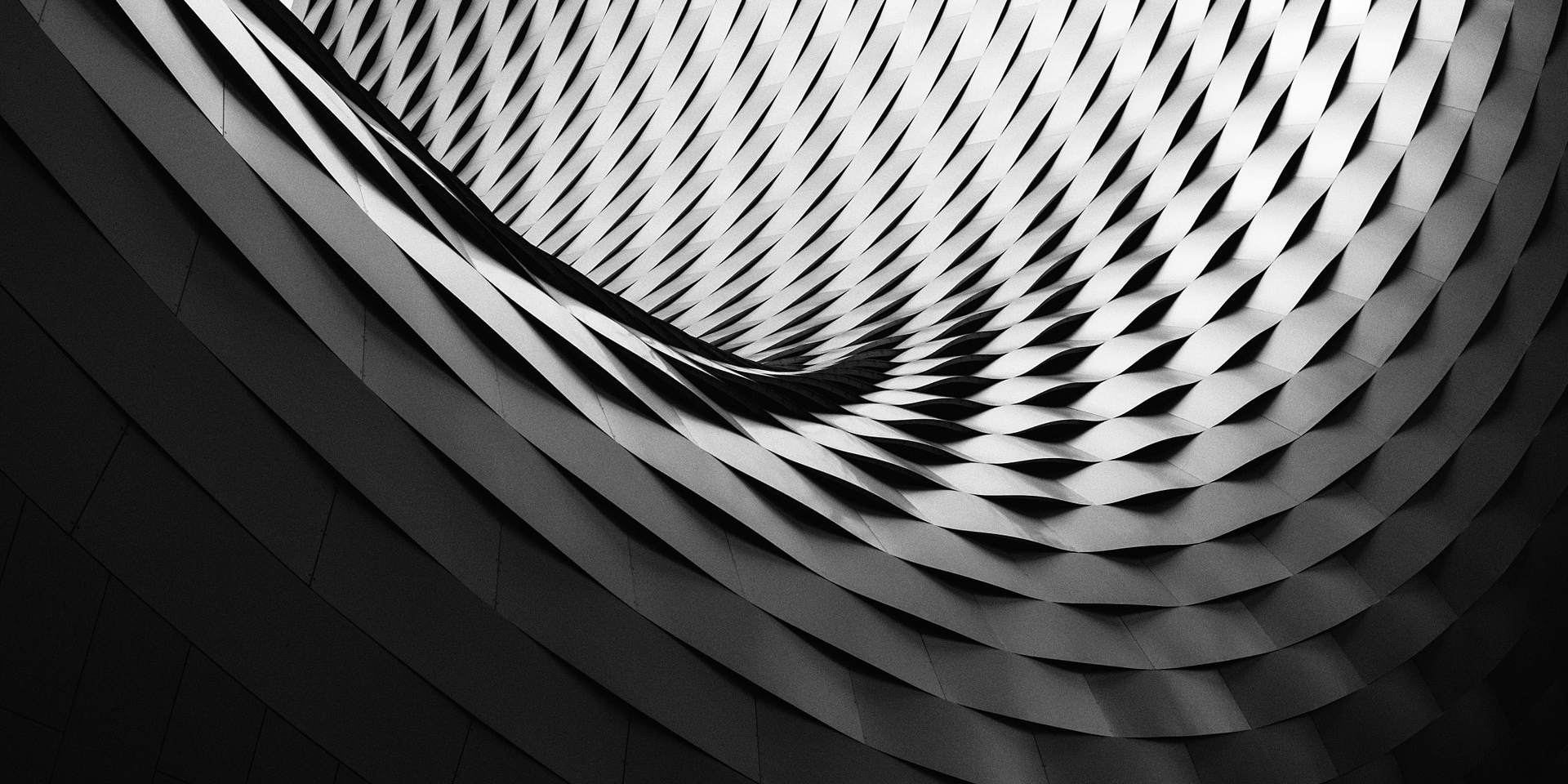


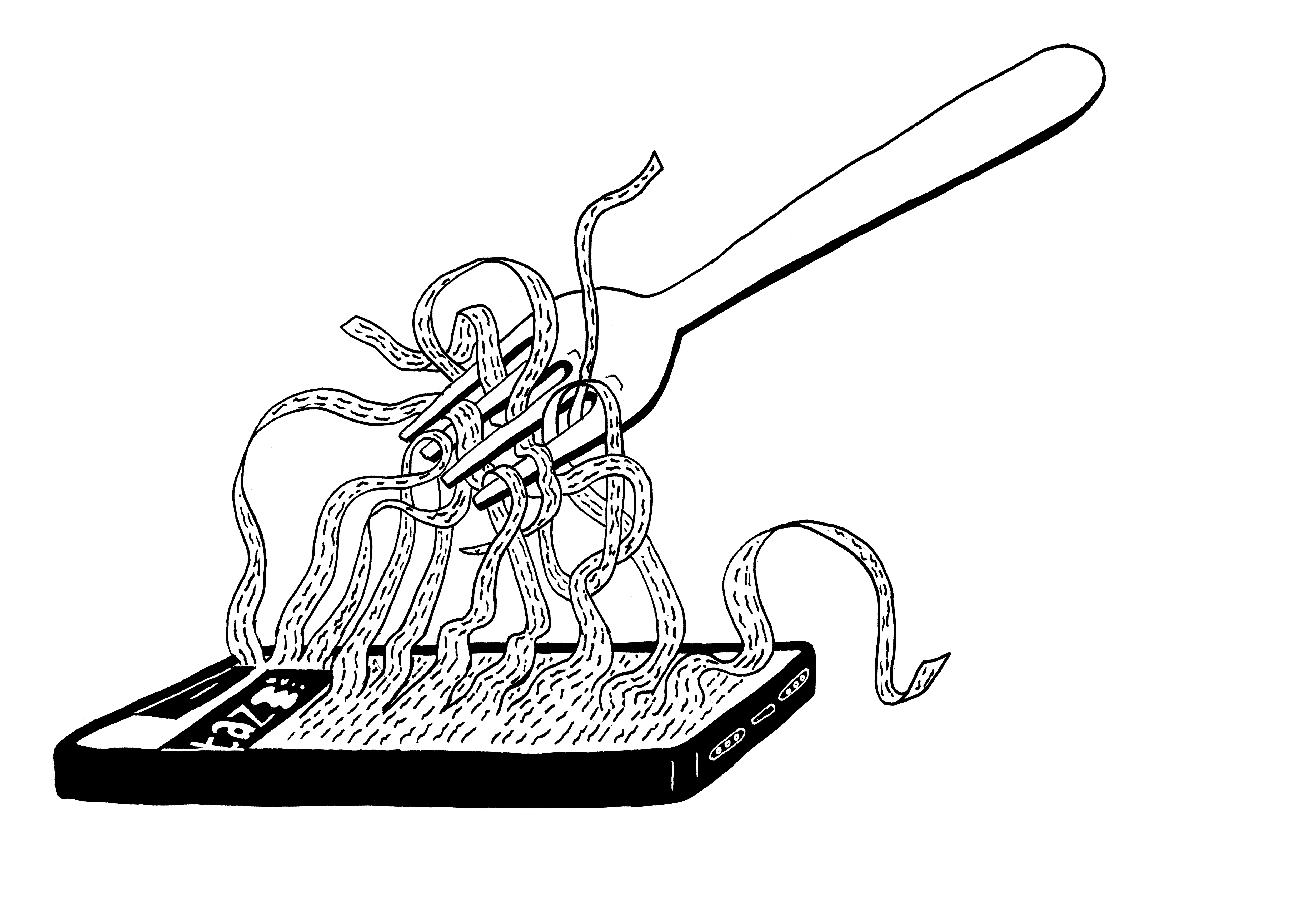
In der Weihnachtsnummer der FAZ/FAS wurde George Soros interviewt, der sich gerade im Berliner Hotel Adlon aufhielt. Er ist immer noch der größte Stifter weltweit. Ich habe mich bisher nur mit seinem „Burma Projekt“ näher befaßt, dessen Leiterin ziemlich gute Arbeit leistet – im Kampf gegen die dortige Militärdiktatur.
Auch mit Leiterin seiner Soros Foundation in Alma-Ata hatte ich kurz zu tun, da wollte sie zusammen mit einer oder mehreren deutschen Kultureinrichtungen eine Ausstellung über die einstigen Arbeitslager in Karaganda organisieren, dies scheiterte jedoch an den deutschen Institutionen. Es kam jedoch noch hinzu, dass auch das Hamburger Reemtsma-Institut eine Expedition nach Karaganda finanziert hatte, u.a. mit dem russlanddeutschen UDSSR-Forscher Wladislaw Hedeler.