
Photo: kircheonline.de
„Die ganzen RAF-Bücher sind Krimis,“ meinte Michael Sontheimer kürzlich im „Brecht-Zentrum“, wo er sein neues Buch vorstellte: „Natürlich kann geschossen werden. Eine kurze Geschichte der Roten Armee Fraktion“. Der Untertitel gemahnte an den berühmten geschichtsverklitternden „Kurzen Lehrgang der Geschichte der KPDSU(B)“. Diese „kurze Geschichte“ (von der Redaktion einer Kommission des Zentralkomitees der KPdSU erarbeitet und 1938 veröffentlicht) „wurde in der Sowjetunion und nach dem Zweiten Weltkrieg auch in den kommunistischen Staaten des sozialistischen Lagers wichtige Grundlage der politischen Bildung und des Geschichtsverständnisses,“ schreibt Wikipedia.
Und da die RAF-Buchvorstellung im Brecht-Zentrum an der Chausseestraße neben den Hegel- und Brecht-Gräbern, gleichsam hinter ihrem Rücken, stattfand, war man natürlich auch noch an die Brechtschen Lehrstücke erinnert, insbesondere an „Die Maßnahme“, das die terroristische Politik einer kleinen klandestinen Gruppe zum Thema hat. Zuletzt führte Frank Castorf dieses Lehrstück an der Volksbühne auf, wobei er es mit Heiner Müllers „Mauser“ vermantschte. Auf „volksbuehne.de“ schrieb er dazu: „Brechts Passionsspiel aus dem Schreckenskabinett des Totalitarismus feiert das Glück, eine Sache über sich selbst zu stellen. Bei Heiner Müller will das Leid nicht enden“.
Sein „Mauser“-Stück hat laut Wikipedia folgenden Inhalt: „Der erfahrene Revolutionär A wird vom Chor damit beauftragt in der Stadt Witebsk Erschießungen durchzuführen. Zuerst soll er seinen Vorgänger B erschießen, dieser hatte sich mit seinen Opfern identifiziert und sie aus Mitleid laufen lassen. Nach einiger Zeit merkt A, dass er mit dieser Arbeit nicht zurecht kommt und bittet den Chor ihn zu entlassen. Dies wird ihm verwehrt, A macht weiter, aber bemerkt, dass er dabei seine Menschlichkeit verliert und er beginnt unkontrolliert Erschießungen durchzuführen. Als der Chor dies bemerkt, wird A selber vor ein Erschießungskommando gestellt. Als letzte Arbeit wird von A verlangt seine Zustimmung zu seiner Erschießung zu geben. A wird auf sein Kommando hin erschossen, aber es wird nicht klar, ob dies eine Zustimmung war.“

Photo: machopan.com
In dem Aufsatzband über die RAF „Nach dem bewaffneten Kampf“ erinnert sich die Therapeutin Angelika Holderberg an eine Diskussion mit ehemaligen RAFlern in der irgendwann „der bedeutsame Satz fiel: ‚In der RAF hat es keine wirklichen Freundschaften gegeben‘.“ Auch die fünf anderen Psychologen/Autoren der Aufsatzsammlung zitieren diesen Satz. In seinem Lehrstück „Die Maßnahme“ hat Bertolt Brecht dieses Problem 1930 am Fall einer klandestinen kleinen Kadergruppe erörtert. Einer der Genossen reagierte mehrmals derart unpolitisch, d.h. menschlich, dass ihn die drei anderen, nachdem er dadurch ihren „Auftrag“ in Gefahr gebracht hatte, schließlich umbringen. Brecht läßt ihren Mord, der keinem „Verräter“, sondern höchstens einem Schwächelnden galt, durch einen Chor – als Parteigericht – für gerechtfertigt erklären.
1948 hat Jean-Paul Sartre dieses „Problem“ noch einmal aufgegriffen – in seinem Stück „Die schmutzigen Hände“. Hier ist es jedoch der Mörder, der es nicht schafft, den parteipolitischen Versager zu töten. Daraufhin wird seine Frau zu einer „Verräterin“ (1), indem sie sich in den Genossen, dessen Tod beschlossen wurde, verliebt. Erst in diesem Moment gelingt dem Mörder die Tat – aus unpolitischer Eifersucht also.

„Die schöne Brigitte“ (Mohnhaupt) erklärt einem geneigten Pulikum, was „Mao-Art“ konkret bedeutet. Photo: indymedia.ie
Anfang der Siebzigerjahre wurde Sartres „Partisanen-Drama“ in Belgrad inszeniert, mit den besten Schauspielern des Landes: Es wurde ein Kultstück, ausgehend von der dortigen Studentenbewegung und ihrer Kritik an der Parteiführung. Zuletzt inszenierte es Frank Castorf in der Volksbühne – aktuell bezogen auf den Zerfall des jugoslawischen Staates – aber er verstand das Problem dabei nicht: „Er hat die Partisanen-Problematik bis zu Karadzic hin verlängert – als den letzten degenerierten Kommunisten, mit einer jugoslawischen Fahne auch noch. Das ist falsch, das hätte er höchstens mit Milosevic machen können. Demnächst wird es eine nochmalige Inszenierung des Stückes in Belgrad geben“, meinte der jugoslawische Regisseur Zoran Solomun nach der Premiere.
Der reale Hintergrund für Brechts Lehrstück „Die Maßnahme“ ist der gescheiterte Aufstand in Shanghai, der von der Komintern initiiert wurde. Im „langen heißen Sommer“ von 1926 kam es zu einer Kette von Streikmaßnahmen in Shanghai – allein im Juni mit 69.556 Streikenden in 107 Betrieben. Auslöser der Streiks war der Anstieg des Preises für Reis. Im Oktober 1926 kam es zum so genannten „ersten bewaffneten Aufstand“, gefolgt von einem Generalstreik im Februar 1927, der sich in einen zweiten bewaffneten Aufstand verwandelte. Dieser wurde blutig niedergeschlagen. In den folgenden Monaten herrschte ein Terrorregime in Shanghai und die Bewegung in ganz China wurde niedergeworfen. Die Kommunistische Partei wurde verboten – die Unterstützer Chiang Kai-sheks begannen damit Gewerkschaften aufzubauen, die der Regierung unterstanden.
Der Roman von André Malraux aus dem Jahr 1933 „La condition humaine“, in der DDR 1955 unter dem Titel „So lebt der Mensch“ erschienen, handelt von diesem Aufstand (eigentlich waren es wie gesagt drei) in Shanghai 1927. Es geht Malraux darin aber um mehr als die „Erhebung des Proletariats“: Seine „Helden bewegt die Frage nach einer sinnvollen Existenz“. In der aus dem Osten übernommenen West-Ausgabe heißt es dagegen idiotischerweise im Klappentext: „In diesen Kämpfen zeichnet sich bereits ab, was zur heutigen Lage in China geführt hat: daß die Kommunisten eines Tages den Spieß umdrehen und über ihre Gegner triumphieren würden. Darüberhinaus werden mit „großem, nervösen Atem…die menschlichen Positionen umrissen“.

RAF-Bomber. Photo: wallpapers.free-reviewnet.com
In Malrauxs Roman „La Condition Humaine“ geht die Ärztin May, die im Gegensatz zu ihrem Intellektuellen-Freund Kyo den dritten Shanghaier Aufstand überlebte, zuletzt nach Moskau, um sich dort von der Komintern für den nächsten Aufstand schulen zu lassen. Im Nachwort zur DDR-Ausgabe meint die Autorin Brigitte Ständig (deswegen): Dieses Werk bilde den Höhepunkt in Malrauxs „Aktionsschriftstellerei“ (zuvor hatte er bereits in „Les Conquérants“ – Die Eroberer – den Kantoner Aufstand thematisiert), danach sei Malraux mehr und mehr zu einer „anarchistischen Revolutionsauffassung“ gelangt – und dies bereits in seinem darauffolgenden Roman – über den spanischen Bürgerkrieg: „L’Espoir“ – die Hoffnung. Weil aber in seinem Buch über die Shanghaier Aufstände von 1927 die Auseinandersetzung zwischen Kyo und dem Vertreter der Komintern Wologin „den Kulminationspunkt der politischen Problematik“ bilde – und Wologin von Malraux mit „physischen Attributen“ ausgestattet sei, „die beim Leser Antipathie erwecken“, könne man sagen, dass der Autor in „La Condition Humaine“ noch zwischen einem „rationalen Verständnis für die historische Situation“ und einem „emotionalen Hang zu revolutionärem Romantizismus“ schwankte.
1928 war der Shanghaier Aufstand bereits Gegenstand heftiger Diskussionen in der Moskauer Komintern-Zentrale gewesen. Die Ergebnisse fanden Eingang in das Lehrbuch „Der bewaffnete Aufstand“, herausgegeben von Wollenberg, Kipperberger, Tuchaschweski, und Ho Tschin Minh . Erich Wollenberg, der zur Neuherausgabe 1971 in der BRD (sic) als ehemaliger Mitautor ein Vorwort beisteuerte, wußte zum Kapitel über den Shanghaier Aufstand nur zu sagen, es sei im Generalstab der Roten Armee verfaßt worden. Interessant daran sei: Trotz der damals bereits begonnenen Repressalien gegen die „Trotzkisten“ werde in diesem Kapitel ein Tagesbefehl Trotzkis zitiert (mit Namensnennung), der eine Kritik an Stalin enthält.
Die Stalinsche Kominternpolitik in China hatte dazu geführt, daß die proletarische Basis der dortigen KP in den Städten nach den Shanghaier Aufständen fast vernichtet war und die Partei sich auf dem Land neu sammeln mußte, wo sie sich dann – Mao folgend – stärker auf die bislang von ihr vernachlässigten Bauern stützte. Dies hatte auch bereits Ho Chi Minh in seinem Beitrag für das Aufstands-Handbuch nahegelegt, der explizit die Bauernfrage im Falle eines Aufstands behandelte – vor allem in noch agrarischen Gesellschaften. Ho Tschin Minh übte darin gewissermaßen Selbstkritik: „Der Sieg der proletarischen Revolution in Agrar- und Halbagrarländern ist undenkbar ohne aktive Unterstützung des revolutionären Proletariats durch die ausschlaggebenden Massen der Bauernschaft“. „Onkel Ho“ kam in seinem Beitrag sogar zu dem Schluß, das „der größte Fehler der chinesischen kommunistischen Partei“ darin bestanden habe, nichts zur Vertiefung der chinesischen „Agrarrevolution“ getan, sondern im Gegenteil, die „Bauernbewegung“ noch gebremst zu haben. Die Partei hatte sich, gestützt auf ihre deutschen und russischen Berater aus der Komintern, vor allem auf die Organisierung von Arbeiteraufständen in den großen Städten konzentriert, die allesamt niedergeschlagen worden waren. Damals waren gerade mal 0,5% der chinesischen Bevölkerung Arbeiter. Ho Tschin Minh, der von Bucharin abfällig als „Bauernträumer“ bezeichnet wurde, beging später in Vietnam eher den entgegengesetzten Fehler, der den Nordvietnamesen während der „Tet-Offensive“ 1968 fast eine Niederlage bereitete, obwohl sie gleichzeitig allen deutlich machte, dass der Krieg in Vietnam von den Amerikanern und ihren Marionetten nicht mehr zu gewinnen war: Der trotzkistische Vietnamkriegshistoriker Jonathan Neale schreibt „Dennoch erlitten die Guerillos eine vernichtende Niederlage. Sie hatten erwartet, dass Saigon und Hue sich erhöben“. Dazu kam es aber nicht. Der für den kommunistischen Untergrund in Saigon verantwortliche Tran Bach Dong erklärte später, warum: Ihre Mitgliedergewinnung war „wunderbar erfolgreich“ – bei den Intellektuellen, Studenten, Buddhisten, bei allen – nur bei den Arbeitern nicht, wo der Organisationsgrad „schlechter als schlecht“ war – weil nämlich, so Jonathan Neale, die Befreiungsbewegung die städtischen Arbeiter nur halbherzig gegen ihre Chefs mobilisieren konnte, um nicht die „Unterstützung der Geschäftsleute und Manager dort zu verlieren.“

RAF-Kunst von Vladislav Scepanovic
Zurück zum „Brecht-Zentrum“ und zur dortigen RAF-Buchvorstellung von Michael Sontheimer, über das er zusammen mit der ebenfalls beim Spiegel arbeitenden Journalistin Carolin Emcke diskutierte. Ihr RAF-Buch heißt „Stumme Gewalt. Nachdenken über die RAF“. Es muß sich dabei um eine „Real Crime Story“ handeln, denn die Autorin sprach wiederholt von „Verbrechen“ der RAF, von „grauenhaften Verbrechen“. Das gilt wahrscheinlich auch für die anderen 232 Bücher über die RAF, die bisher erschienen sind, denn Michael Sontheimer meinte, dass die Autoren dabei „meist nur aus Polizei- und Justizquellen“ geschöpft hätten. Er wollte dagegen mit seinem RAF-Buch „einige Geschichtsirrtümer korrigieren“. Das sei jedoch gar nicht so einfach, versicherten dann beide Autoren, denn dem stünde die fix und fertige öffentliche Meinung über die Baader-Meinhof-Bande entgegen. So durfte Sontheimer in einem Spiegel-Artikel über das Schleyer-Attentat auf Anweisung des Chefredakteurs z.B. nicht erwähnen, dass Schleyer SS-Obersturmbannführer gewesen war. Während alle israelischen Zeitungen damals getitelt hatten: „SS-Obersturmbannführer Schleyer ermordet!“ Und bei den RAF-Attentaten mußte man im Spiegel stets „blutig“ hinzufügen. So wie später alle DDR-Betriebe grundsätzlich „marode“ waren. Carolin Emcke meinte: „An der RAF haben sich mehrere Generationen politisiert, auch wenn die RAFler inzwischen Pop-Ikonen geworden sind und somit depolitisiert.“ Sie fragte sich: „Sind es politisch motivierte Verbrecher oder einfach Irre?“
Das führte das Gespräch im Brecht-Zentrum zu den Ursachen der RAF-Verbrechen. Sontheimer folgte dabei Norbert Elias, der eine Art umgedrehte Verelendungstheorie verfocht: „Die RAF war demnach ein Luxusphänomen,“ so Sontheimer. Aber man dürfe nicht die moralische Empörung der damaligen linken Bewegung über den Vietnamkrieg der Amerikaner vergessen, ebensowenig den Zusammenhang von RAF und Holocaust und dass damals in vielen Ländern RAFähnliche militante Gruppen entstanden. In einigen Ländern gab es später so etwas wie eine „Versöhnung“ – nicht jedoch in der BRD. Ferner gelte es zu bedenken, dass die Frauen in der RAF die „geistige Führung“ innehatten. In Inge Vietts Biographie werden die Männer in der „Bewegung 2.Juni“ geradezu als Hampelmänner hingestellt. Ein Verfassungsschutz-Präsident bezeichnete die frauendominierte RAF einmal als „Exzeß der Befreiung der Frau“. Dies sei, so Carolin Emcke, umso bemerkenswerter als ansonsten der Anteil der Frauen bei unpolitischen Gewaltdelikten gleich Null wäre.
Es gibt zu diesem „Phänomen: RAF-Frauen“ ein Buch „Terroristinnen – Bagdad77“. Ein seltsamer Titel für ein Buch. Die Regisseurin Katrin Hentschel inszenierte 2007 am Theater Freiburg ein gleichnamiges Stück, aus dem nun in Zusammenarbeit mit der Freiburger Verlegerin Traute Hensch ein Buch wurde. Es handelt von den Frauen der RAF. Am Anfang des „Projekts“ standen „Fragen, nichts als Fragen“ – u.a.: „War der Terror der Versuch, nicht spießig zu werden?, Wer hat die illegalen Wohnungen geputzt? Hatten die Mädels im Knast mehr Post als die Männer?, War die RAF ein Vergnügen? Warum interessieren uns die Antworten?“ In ihrer „Doku-Fiktion“ führen zunächst drei berühmte Terroristinnen, teilweise mit Zitaten aus RAF-Büchern, -Filmen und -Selbstdarstellungen, einige „Theorie-“ sowie „Vaginal-„Dialoge, sie erzählen sich – in Bagdad auf einem Dach sitzend – ihre „Viten, Träume und Terrormärchen“ und halten Ansprache an einige ebenfalls prominente Frauen, darunter die im Irak 2005 von einer islamischen Terrorgruppe in Geiselhaft genommene bayrische Arabistin Susanne Osthoff. Sie wurde für einige Millionen Euro von der Bundesregierung freigekauft. Weil sie selbst Islamistin und in einem Video, das die Entführer dem ARD-Studio in Bagdad schickten, verschleiert aufgetreten war, während einer ihrer Kidnapper eine Panzerfaust auf sie gerichtet hatte, meinte der Staatssekretär im Auswärtigen Amt Jürgen Chrobog, sie habe eine „Vollkaskomentalität“. Kurz darauf wurde er selbst mit seiner Familie im Jemen entführt. Der Lüneburger Terrorexperte Udo Ulfkotte ließ derweil verlauten, dass mit der Panzerfaust sei „untypisch“ für Terroristen. Der mit dem Terrorismus einst sympathisierende Außenminister Joschka Fischer hatte Chrobog 2001 als Leiter seines Krisenstabs im Falle der Entführung deutscher Staatsbürger ins Auswärtige Amt geholt. Traute Hensch war lange Zeit Lektorin im Frankfurter Verlag „Roter Stern“ von K.D.Wolff gewesen. Diese ganze aus dem SDS hervorgegangene Sponti-Szene, aus der sich dann die Grüne Regierungspartei herausmendelte, war auch das Soziotop für den Terrorismus. Einige rechte Publizisten verleitete das dazu, eine gerade Linie zwischen Adorno-Seminaren und RAF-Attentaten zu ziehen. Später tat es ihnen eine wachsende Zahl linker Renegaten nach – u.a. der DDR-Sänger Wolf Biermann, der 1972 in einem ARD-Interview noch gemeint hatte: „Sie erwarten doch sicherlich nicht von mir, daß ich mich von der Roten Armee Fraktion distanziere? Lenin hat gesagt, daß der erste Schuß erst abgefeuert werden darf, wenn die Revolution beginnt. Die Kommunisten der Bader-Meinhof-Gruppe werfen ihr Leben in die Waagschale für die Antithese. Sie wollen nämlich beweisen, daß, wenn nicht endlich der erste Schuß fällt, die Revolution verschlafen und verfressen wird“.
Während die einen damals den „Umsturz“ von unten durch „Mobilisierung der Basis“, u.a. indem sie in die Betriebe gingen, erreichen wollten, versuchten die „Illegalen“ ihn intellektuell-terroristisch quasi von oben zu initiieren, weil sie meinten, auf die Aktion der Massen verzichten bzw. diese damit initiieren zu können.
Die 1968 geborene Schriftstellerin Tanja Dückers schreibt in „Terroristinnen – Bagdad77“: „Der Grund für die scheinbar unerschöpfliche Aktualität der RAF ist in der merkwürdigen Vertrautheit zu finden, die wir mit diesem Phänomen verbinden. Weil in dem RAF-Film nach dem Buch von Stefan Aust die Rollen „alle mit sehr bekannten und attraktiven Schauspielerinnen“ besetzt waren, erschienen Tanja Dückers nun die „RAF-Frontfrauen“ als „ausgeflippte Popstars oder Models auf Abwegen“. Sie waren merkwürdig „aktuell“ und schienen ihr zum heutigen „Lifestyle-Feminismus“ zu passen.

RAF-Filmankündigung. Photo: myspace.com
„Das Kürzel ,RAF‘ beinhaltet die Botschaft, ,Recht auf Frausein‘,“ meint Katrin Hentschel und zitiert die Terroristin Irmgard Möller: „RAF – das war für uns Befreiung“. Über Brigitte Mohnhaupt schreibt Hentschel: Obwohl bereits 2007 vorzeitig entlassen, „schweigt auch Deutschlands schlimmste, brutalste und hübscheste Terroristin tief und fest. Man hört: Sie schiebt Kisten ineinander, im Laden ihrer Schwester. Aha. Man sollte die ,Big Raushole‘ einmal mit ihr selbst ausprobieren,“ um endlich aus erster Hand zu erfahren, „warum die RAF-Frauen bereit waren, bis zum Äußersten zu gehen“. Grundsätzlich ist ihr aber bereits klar: „Die Frau war zu diesem Zeitpunkt das am höchsten entwickelte Lebewesen und zur Tat mehr als reif.“
Katrin Hentschels Buchtext wird abgerundet von zwei akademischen Beiträgen: Einer, von Gisela Diewald-Kerkmann, die sich über „Frauen, Terrorismus und Justiz“ habilitierte, bringt die SDS-Frauenbewegung anhand einiger „Fallbeispiele“ in einen Zusammenhang mit der RAF – als einer „Amazonenarmee mit männlichem Begleitpersonal“, wie der Terrorist Peter Homann sie nannte. Der andere Beitrag von Vojin Sasa Vukadinovic, die über Antifeminismus in Linksterrorismus-Diskursen promovierte, thematisiert die „maskulinistischen Fiktionen von über die RAF schreibenden AutorInnen“ – vor allem nach der „Eskalation77“. Das letzte Kapitel „Sie haben ein Leben, das alle glauben beurteilen zu müssen“ beinhaltet Kurzbiographien aller RAF-Frauen.
Geschmälert wird das Lesevergnügen an diesem Buch nur dadurch, dass es dazu beiträgt, die RAF innerhalb der antiautoritären Bewegung überzubewerten, weil nur sie noch und vielleicht noch Uschi Obermaier in den Medien rückblickend auf „68“ als „sexy“ erscheinen.
Dazu tragen freilich auch die beiden RAF-Bücher von Sontheimer und Emcke bei. Ihr Diskussion hakte dann an dem mangelnden Aufklärungswillen der Staatsgewalt, insbesondere der Bundesanwaltschaft, fest: „So wurden im Buback-Prozeß wissentlich Fehlurteile gefällt. Die Ermordung von Herrhausen und Rohwedder nie aufgeklärt. Es werden Aussageteile von Gerhard Müller unter Verschluß gehalten und angeblich wußte die Mossad schon vorab von der Landshut-Entführung.“
Die RAF war kein Regionalkrimi, sondern Teil der internationalen Linken. In der sie zunächst auch ihre logistische Basis fand. Als diese Bewegung sich langsam zerstreute, setzten sich in vielen Ländern solche militanten Gruppen im Untergrund fest, um mit ihren Attentaten die Massen noch einmal in Bewegung zu bringen. Es passierte jedoch eher das Gegenteil. Sie isolierten sich und wurden isoliert. Der BRD-Fahndungsapparat machte dann aus der RAF eine „True Crime Story“, die später von Stefan Aust gleich mehrmals ausgewalzt wurde. Dabei nahm sie dann mehr und mehr den Charakter eines typischen „Regionalkrimis“ an, der sich in diesem Fall freilich über mehrere Ländles und Kontinentles erstreckte. Man könnte vielleicht auch von einem „Nationalkrimi“ sprechen. Mit seinen Verfilmungen ging es ihm dann jedoch vollends wie den anderen „Regionalkrimis“, nachdem sie zu „Tatorten“ umgeschrieben wurden.
Die Überlebenden der RAF sind schon seit langem vor allem damit beschäftigt, sich genau dagegen zu wehren, dass ihre politischen Attentate auf einige Morde und Verbrechen reduziert werden.
Der Abend im Brecht-Zentrum endete im übrigen mit einer „RAF Slideshow“, die u.a. Bilder aus dem RAF-Zyklus von Gerhard Richter beinhaltete. Über diese Bilder hatte spiegel-online zuvor geschrieben: „Im Auftrag der Neuen Nationalgalerie wurden die Terroristen-Bilder von New York nach Berlin in verschiedenen Flugzeugen überführt. Bodyguards haben die Gemälde begleitet. Mit dabei sind die Köpfe der ersten Generation der RAF: Andreas Baader und Ulrike Meinhof. Gerhard Richters fünfzehnteiliger Bilderzyklus „18. Oktober 1977″ mussten die Begleiter ebenso schützen wie weltberühmte Kunstwerke von Picasso, Monet, Chagall, Duchamps, Hopper, Van Gogh und Pollock. Die Schwarz-Weiß-Gemälde deutscher Terroristen, gemalt vom bedeutendsten deutschen Maler der Gegenwart, kehren erstmals nach sieben Jahren nach Deutschland zurück. Gerhard Richter hatte seinen Bilderzyklus 1995 an das MoMA in New York für drei Millionen Mark verkauft. Zwei Jahre später war die Gemäldefolge das letzte Mal in Deutschland zu sehen. Kritiker waren damals der Meinung, dass er dadurch ‚eines der ungelösten Traumata der Nachkriegszeit gleichsam durch Export unschädlich machte‘ (Frankfurter Allgemeine Zeitung). Richter sagte gegenüber spiegel-online, es sei auch nach wie vor gut, dass sich ’18. Oktober 1977′ im New Yorker MoMA befände. Dem 72-Jährigen tue es leid, ‚dass die Bilder immer noch nicht unvoreingenommen angesehen werden können‘.“
Das gilt scheints auch für die Diskussion über die Abgebildeten und ihre Taten: So verlangte einer der Zuhörer im Brecht-Zentrum wütend sein Eintrittsgeld zurück, Carolin Emcke wollte ihm sogar noch drei Euro dazu geben, damit er schneller verschwinde.
ANMERKUNG:
(1) Zum Stichwort „Verrat“ meldete das „haus-der-sprache.de“ kürzlich:
Tatort Ost: Neues von der Regionalkrimi-Front
Auch der zweite Titel der Regionalkrimi-Reihe Tatort Ost ist mittlerweile beim mdv abgegeben und befindet sich im Endkorrektorat. “Gesichtsverlust” von Maren Schwarz erzählt die Geschichte eines Verrats und seiner Folgen und spielt zur Zeit der Wende.
————————————————————————————————————
P.S.: Vor ein paar Tagen starben der Kommune-1-Terrorist Fritz Teufel (67) und der Schriftsteller Hans-Georg Behr (73). Es hagelte einfühlsame Nachrufe. Letzterer hat Hitler und Baader noch persönlich gekannt, wie Michael Sontheimer versicherte.

RAF-Film-Schauspieler. Photo: cafebabel.de
P.P.S.: Hier noch eine weitere RAF-Ursachenerklärung: Vielleicht handelt es sich bei den RAF-Aktionen zwischen 1970 und 1998 um eine „Partisanenkrankheit“. Diese wurde erstmalig nach dem Sieg der Tito-Partisanen über die Deutschen systematisch erforscht, u.a. von dem Psychoanalytiker Paul Parin. Es handelt sich dabei um eine „ansteckende Neurose“ mit hysterischen Kampfanfällen, die demobilisierte Partisanen befiel: 120.000 zuletzt, davon ein Drittel Frauen. Paul Parin erklärte mir dazu 2009: „Die demobilisierten Partisanen, die schon in der zuvor zusammengestellten Volksbefreiungsarmee gekämpft hatten, waren ratlos – sie drängten in ihre Einheiten zurück. 90% des Landes war verwüstet durch den Krieg. Die Häuser ihrer Eltern zerstört und ihre Eltern lebten vielleicht gar nicht mehr. Was sollten sie machen? Ihr Kampfanfall war auch ein Wunsch.“
Paul Parin veröffentlichte 1948 einen Artikel über die „Partisanenkrankheit“, in dem er sie als eine Art umgedrehte „Kriegsneurose“ beschrieb: Während diese die Soldaten davor schützen soll, wieder an die Front geschickt zu werden, um erneut zu kämpfen, besteht die Partisanenkrankheit darin, nicht mit dem Kämpfen aufhören zu können bzw. zu wollen. 2009 meinte Parin: „Zu wenig betont habe ich in meinem Artikel darüber, dass die Partisanenkrankheit ideologisch vorgebildet war – in Form von Trancezuständen. In Nordbosnien wurden die Töchter verheiratet. Wenn der Braut der Mann nicht gepaßt hat, dann bekam sie „Zustände“, um der Ehe mit ihm auszuweichen – bis ein Mann ausgesucht wurde, der ihr gepasst hat. Das habe ich nicht gewußt damals. Und wahrscheinlich ist die Partisanenkrankheit dort entstanden.“
Die Partisanenkrankheit war zuvor auch schon von Nadeshda Mandelstam beobachtet worden: Sie fuhr mit ihrem Mann 1922 nach Suchumi – auf dem Schiff befanden sich viele demobilisierte Leichtverwundete, die aus dem Bürgerkrieg zurückkehrten, und ständig kam es unter ihnen zu solchen „Kampfanfällen“. Zuletzt berichtete Ursula Hauser in Gesprächen mit Paul Parin von ähnlichen Symptomen. Sie hatte in Costa Rica ein psychoanalytisches Institut aufgebaut und in Nicaragua Miskito-Indianer behandelt. Diese waren früher von wiedertäuferischen Brüdergemeinen beeinflußt worden, hatten ansonsten jedoch derart isoliert gelebt, dass sie sich primär durch Inzest vermehrten. Ihr Stamm wurde dann in zwei Teile geteilt: die einen schlossen sich den Sandinistas an, die anderen den Contras. Nach Beendigung der Kämpfe kam es unter ihnen ebenfalls zu einer „ansteckenden Neurose“ – ähnlich der Partisanenkrankheit.
Zurück zur RAF: Bei ihnen hatten die Mitglieder selbst „die Häuser ihrer Eltern zerstört und ihre deutschen Eltern besiegt. Was sollten sie machen?“ Sie konnten nicht zurück in Doppelhaushälfte, Ehe, Kinderaufzucht, Biosupermarkt, Spanienurlaub etc. Das war alles ein für allemal „verbrannt“. Stattdessen suchten und fanden sie im Untergrund, nachdem sie auch noch ihre linken Unterstützerkreise verlassen hatten, „Nicht-Orte“ zum weiteren Überleben. Der filmwissenschaftler bezeichnet sie in seinem Buch „Terror und Trauma. Zur Gewalt des Vergangenen in der BRD“ mit Alexander Mitscherlich als „die Schandflecke sozialer Anomalie in den Vorstädten, die Anonymität der Wohnblocks, wo keiner mit den Nachbarn redet und wo Einkaufen, Dienstleistung und Konsumbeziehungen die Lebensqualität definieren.“ In solch einer tristen Plattenbau-Wohnung richtete die RAF dann auch ihr „Volksgefängnis“ ein „“Nicht einmal der Hausmeister konnte sich später daran erinnern, wer genau darin gewohnt hatt“e Es waren also gerade solche „Nicht-Orte, wie Autobahnabfahrten, Straßenbahnkreuzungen in Vororten, Industriebrachen und ausufernde Wohnsiedlungen, die der RAF Deckung boten. Dazu benutzten sie noch durchweg BMWs, die bald als „“Baader-Meinhof-Wagen“ bekannt wurden. Während sie dergestalt in der Ununterscheidbarkeit verschwanden, tauchten sie gleichzeitig überall in der Bild-Zeitung, auf Fahndungsplakaten und Polizeifotos wieder auf..
„Wir Kommunisten sind alle Tote auf Urlaub!“ so sagte es Eugene Leviné, Kopf der Münchner Räterepublik, als er 1919 von der Reaktion erschossen wurde. Man kann sich natürlich auch vom Kommunismus wieder distanzieren – und wieder Leben fassen, wenn man es kann. Hier und heute können das fast alle: „Es ist schon komisch,“ meinte der SDSler Hans-Dieter Heilmann, „am Anfang waren wir zwölf – und jetzt sind wir wieder etwa so viel.“ Zwischendrin waren es aber mal Millionen. Und es gab kaum ein Arschloch, das sich nicht stolz als „68er“ bezeichnete.
Um während der Studentenbewegung die Ansteckungsgefahr zu bannen, d.h. die Revolte an der Ausbreitung zu hindern, setzten die konservativen Kräfte in den meisten Ländern auf die heilsame Wirkung von Polizeiknüppeln. In der Protestbewegung selbst wußte man jedoch, dass gerade die Polizeiknüppel auf Demonstrantenschädel eine bewußtseinserweiternde Wirkung hatten – sogar auf unbeteiligte Fernsehzuschauer. Erst 20 Jahre Jahre später und nach dem „Zusammenbruch“ des Sozialismus trauten sich die Politiker wieder, für alle Übel dieser Wel „68“ verantwortlich zu machen: Bei Tony Blair und Nicolas Sarkozy war dies sogar Teil ihres Regierungsprogramms. Auch die Universitätspräsidenten beeilten sich landaus landab „die letzten Folgen von 68 zu beseitigen“, wie sie lauthals zu verkünden wagten. Die nächste Protestpest wird deswegen um so gewisser sein. Zumal es bis jetzt noch keinerlei Forschung darüber gibt, wie die Ansteckung wirklich erfolgt – geschweige denn, wie man sie im Keim ersticken kann. Medizinisch gesehen kann und darf es eine „ansteckende“ Neurose gar nicht geben! Das ist der Witz an jeder linken Bewegung, so sie sich zu einer Massenbewegung auswächst – in der eine militante Gruppe wie die RAF erst einmal nur ein „Regionalismus“ ist. Erinnert sei in diesem Zusammenhang an die Parole der großen RAF-Solidaritätsdemonstrationen in Berlin: „Wir sind der harte Kern der Baader-Meinhof-Bande!“

RAF-Piloten – vor blauem Himmel. Photo: lesstill.org.uk

RAF-Partisanen – vor Gericht. Photo: planet-wissen.de
P.P.P.S.: Seltsam „Ende der 60er und Anfang der 70er“ – zur selben Zeit, da sich klandestine militante Gruppen bilden und die ersten politisch motivierten Verbrechen (Real Crime) planen bzw. wagen, „entstehen in Deutschland erstmals in größerer Zahl Kriminalromane,“ schreibt Silke Leuendorf in ihrer Magisterarbeit über den „Regionalkrimi im Westen von Deutschland. Poetik und Entwicklung eines Genres“ (2008). Deren Autoren „leiten damit die erste echte Entwicklung des Krimi-Genres in Deutschland ein und setzen eine Entwicklung in Gang, die bis heute andauert.“ Wobei Silke Leuendorf speziell die Entstehung und Entwicklung der Untergattung „Regionalkrimi“ auf das „Ende der 80er Jahre“ terminiert – und Jacques Berndorf mit seinen „Eifel-Krimis“ als ihren ersten Autor bezeichnet. Die Autoren der „Ende der 60er und Anfang der 70er“-Jahre veröffentlichten Romane bestanden auf dem Etikett „Sozio-Krimi“. Der Übergang von diesen zu den „Regionalkrimis“ ist dem von der sozialwissenschaftlich argumentierenden Studentenbewegung zur „Umweltbewegung“ geschuldet.
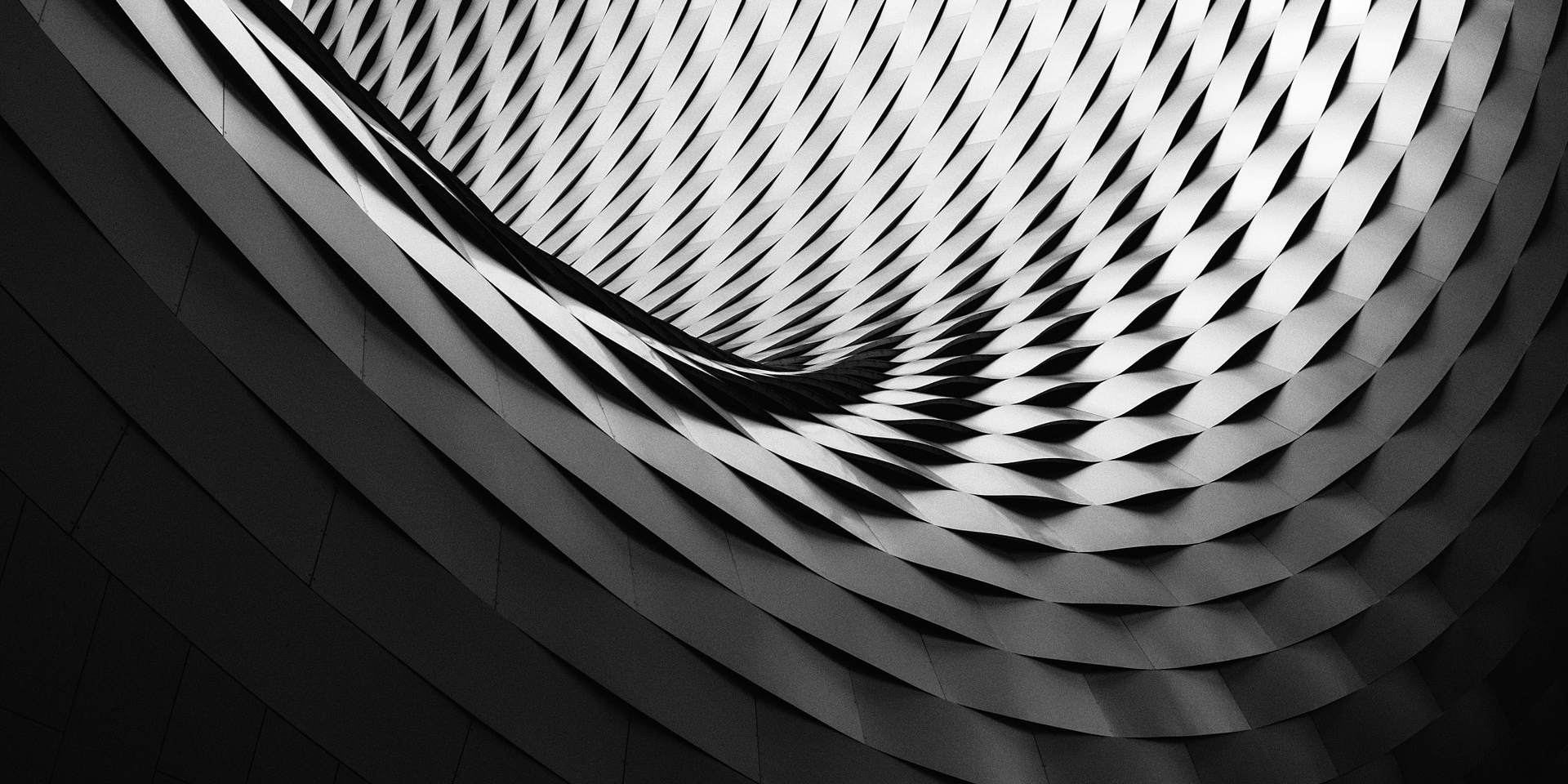



In der Jungen Welt veröffentlichten die zwei deutschen „Ex-Terroristen Till Meyer und Bommi Baumann heute ein schönes Interview mit den zwei amerikanischen Ex-Terroristen Bernardine Dohrn und Bill Ayers. Während die ersteren heute als freie Autoren leben, sind die beiden Amis heute Professoren – an der Universität von Illinois.
Wie sehen Sie die amerikanische Bewegung gegen den Krieg im Irak und in Afghanistan? Findet da eine Entwicklung statt?
Bill Ayers: Interessanterweise scheint man nach Anzeichen dafür zu suchen, daß es sich um eine Wiederholung der Ereignisse aus den sechziger Jahren handelt. Bewegungen werden heutzutage immer im Vergleich zu den sechziger Jahren beurteilt. Aber ich halte das für falsch. Ich denke, daß Widerstand jetzt andere Formen annimmt. Es gab starke Verbindungen von uns zur Organisation der Vets against the War. Die Veteranen trugen während des Vietnamkriegs ganz entscheidend dazu dabei, die Bevölkerung gegen den Krieg aufzubringen. Sie kehrten zurück und warfen der Regierung ihre Medaillen vor die Füße und sagten vor dem Kongreß aus. Sie sagten die Wahrheit über das, was sie im Krieg gesehen hatten, und die amerikanische Bevölkerung reagierte entsetzt. Und auch jetzt kehren aus dem Irak und aus Afghanistan Veteranen zurück, die die Wahrheit sagen, aber das läuft anders. Wir haben es mit Militärfamilien zu tun. Als Cindy Sheehan die Proteste vor Bushs Ranch in Texas organisiert hatte, sind wir da auch hingefahren. Ich hatte noch nie an einer Friedenskundgebung teilgenommen, die von Militärs organisiert war. Unter anderem bedeutete das, wenn Mittagessen für die Mittagszeit angekündigt war, daß dann auch um Punkt 12 Uhr gegessen wurde. Normalerweise haben wir es mit einem Haufen Anarchisten zu tun, bei denen »Mittag« alles mögliche bedeutet. Das ist eine ganz andere Form, aber es ist dasselbe Gefühl, derselbe Spirit. Ich finde bemerkenswert, daß es nach März 2003 drei Jahre dauerte, bis sich die Amerikaner gegen den Krieg stellten. Obwohl sie permanent mit Kriegspropaganda bombardiert wurden, wandten sie sich gegen den Krieg. Aber die Frage ist, wie können wir ihn beenden? Ich weiß es nicht. Den Vietnamkrieg haben wir ja auch nicht beendet. Wir haben es versucht, aber tatsächlich zog er sich noch sieben Jahre hin, nachdem er von der amerikanischen Bevölkerung längst nicht mehr befürwortet wurde, und pro Woche wurden 6000 unschuldige Menschen ermordet. Das ist das Problem, das ist die Krise, mit der wir uns heute konfrontiert sehen.
Bernardine Dohrn: Die Antikriegsbewegung nimmt derzeit in den Vereinigten Staaten viele unterschiedliche Formen an. Sie ist nicht so eindeutig wiedererkennbar wie die Antikriegsbewegung in den sechziger und siebziger Jahren. In diesem Krieg kämpfen Menschen, die keine Bürger der Vereinigten Staaten sind, Pflichtsoldaten, die nie damit gerechnet haben, mit einer sogenannten Freiwilligenarmee in den Krieg ziehen zu müssen. Gleichzeitig sind sehr viele Amerikaner in ihrem Alltag überhaupt nicht davon betroffen oder sie haben das Gefühl, daß sie der Krieg nicht betrifft, obwohl er uns innerlich ausbluten läßt, physisch und finanziell, moralisch und ethisch. Am 1.Mai zum Beispiel war ich in Chicago bei einer Demonstration für die Rechte von Einwanderern, an der über 100000 Menschen teilgenommen hat und die jetzt bereits zum sechsten Mal in Folge stattfand. Gleichzeitig war es aber auch eine Veranstaltung gegen den Krieg, und wenn wir sie als etwas anderes betrachten, machen wir einen Fehler. Es ging um die Rechte von Einwanderern, aber auch gegen Rassismus, für die Familie, für Frauen, für die Gemeinden. In Chicago leben über eine Million Mexikaner, und sie sind auf die Straße gegangen, mit ihren Frauen, Kindern und Großeltern. Wir müssen nur sehen, was sich vor unseren Nasen abspielt, und die Zusammenhänge herstellen, darin besteht unsere Aufgabe.
Bill Ayers: Wir kamen beide mit sehr idealistischen Vorstellungen zur Bewegung. Wir gehörten zum Civil Rights Movement und ich wurde bereits 1965 zum ersten Mal verhaftet. Das passierte gemeinsam mit neununddreißig anderen in einem Rekrutierungsbüro, obwohl wir bei unserer Aktion auf Gewalt verzichtet haben. Wir haben Rekrutierungsunterlagen vernichtet und versucht, den Leuten bewußt zu machen, was da vor sich ging. Neununddreißig wurden verhaftet, und um uns herum standen 2000 Studenten, die forderten, daß wir deportiert oder wenigstens der Schule verwiesen wurden– ich erzähle das, weil es am Mythos der Sechziger kratzt –, mit anderen Worten, man macht sich nicht beliebt, wenn man sich gegen den Krieg stellt. Wir taten es instinktiv, weil wir wußten, daß da etwas falsch lief, aber wir hatten keinen politischen Hintergrund, kein politisches Wissen. Deshalb haben wir eine ganze Weile gebraucht.
Zu diesem Zeitpunkt waren 80 Prozent der Amerikaner für den Krieg. Drei Jahre später war die Mehrheit der Amerikaner dagegen.
Was in diesen drei Jahren geschah, ist ganz entscheidend. Erstens wurden Leute wie wir zu Organisatoren gegen den Krieg, wir klopften an Türen, demonstrierten und so weiter. Das war das eine. Noch wichtiger aber ist, daß sich viele Anführer des Black Freedom Movement unmißverständlich gegen den Krieg aussprachen. Martin Luther King hat sich von 1965 bis 1968 immer wieder gegen den Krieg geäußert; eine Studentenorganisation gab ein Statement heraus, das besagt, daß kein Schwarzer an einem zehntausend Meilen weit entfernten Ort für eine sogenannte Freiheit kämpfen sollte, die ihm in Mississippi nicht zugestanden wird. Mohammed Ali sagte, er weigere sich, für die Armee des weißen Mannes zu kämpfen. Zum Schluß stellten sich sehr viele Menschen gegen den Krieg, und am wichtigsten darunter waren die GIs, die nach Hause zurückkehrten und die Wahrheit erzählten. Als John Kerry vor den Kongreß trat und erklärte, jeden Tag würden, von der Politik sanktioniert, in unserem Namen Morde begangen, war dies ein ganz entscheidender Wendepunkt. Danach war die Mehrheit gegen den Krieg.
Deshalb glaubten wir, der Krieg müsse Ende März 1968 enden, wir waren zuversichtlich, daß ein Ende wenigstens in Sicht sei. Als Lyndon Johnson zurücktrat, schien ein Kapitel abgeschlossen. Eine Woche nach dem Rücktritt Johnsons wurde Martin Luther King ermordet, zwei Monate später Robert F. Kennedy, und weitere zwei Monate später kam Henry Kissinger an die Macht, und es war klar, daß sich der Krieg noch weiter hinziehen würde. Und wie Bernadine bereits gesagt hat, in jeder Woche, die der Krieg dauerte, wurden 6000 Menschen in Südostasien ermordet. Niemand wußte, was zu tun war. Und deshalb geriet die Demokratie in eine Krise und natürlich auch die Antikriegsbewegung. Die Leute flohen nach Europa oder sonstwo hin, andere traten der Demokratischen Partei bei; und wir machten eben unser Ding.
Ich glaube nicht, daß wir, rückblickend betrachtet, ernsthaft behaupten können, daß das, was wir gemacht haben, besonders großartig war. Aber weil sich der Krieg immer weiter hinzog, wurden wir immer radikaler, und uns wurde immer stärker bewußt, was dieser Krise zugrunde lag. Indem wir für Aufruhr sorgten, haben wir versucht, den Krieg dorthin zu holen, wo die Kriegstreiber saßen. Innerhalb unserer eigenen Organisation wurde heftig darüber diskutiert, ob wir Richtung Gewalt oder bewaffnete Progpaganda gehen wollten. Teilweise geschah dies aus Verzweiflung, teilweise aus der Hoffnung heraus, daß der Widerspruch zwischen der amerikanischen Bevölkerung und der Regierung so entscheidend war, daß wir auf einen tatsächlich grundlegenden Wandel hoffen durften. Deshalb haben wir das getan. Teilweise, weil wir verzweifelt waren und nicht wußten, was wir tun sollten, teilweise, weil wir glaubten, daß sich die Krise so sehr verschärft hatte, daß wir möglicherweise wirklich auf einen grundlegenden Wandel hoffen durften.
Welche Verbindungen gab es zwischen dem SDS, den Weatherman, den GIs und dem radikalen Flügel der Black Panther. Wurde untereinander diskutiert?
Im Sommer 1970 stand ich auf der Liste der vom FBI meistgesuchten Terroristen, außerdem Angela Davis, Rap Brown, zwei Studenten aus Madison und so weiter. Aus ein paar Bankräubern unter Wollmützen waren plötzlich Menschen geworden, die die Regierung stürzen und den Krieg beenden wollten, und das hat bei den Amerikanern, die ein Herz für Outlaws hatten, offensichtlich einen Nerv getroffen. Auf der Flucht zu sein hatte scheinbar etwas Romantisches, Verstohlenes, die Autoritäten wurden hinterfragt, und zum Teil lag das daran, daß diese ganzen unterschiedlichen sozialen Bewegungen beteiligt waren. Wir waren eigentlich gar keine Organisation, das war damals eine andere Zeit. Wir setzten uns aus vielen verschiedenen Organisationen zusammen und hielten auf ungewöhnliche Weise zueinander Kontakt. Andere Untergrundorganisationen kommunizierten in den Medien mit uns, den öffentlichen Medien. Wir führten eine Debatte mit den Panther 21, die in New York verhaftet worden waren und aufgrund künstlich aufgeblasener Verschwörungsvorwürfe im Gefängnis saßen und lebenslängliche Haftstrafen aufgebrummt bekommen hatten. Also, ja, es gab Diskussionen mit anderen, und sie wurden auch fortgesetzt. Wie man so schön sagt, erst im Untergrund sieht man, wie viele Leute ebenfalls im Untergrund aktiv sind. Da gab es die Deserteure, die Schwulen, die Leute aus der Drogenkultur, die Gegenkultur ganz allgemein, die Frauenbewegung. Angefangen hatten wir mit dem Gedanken, daß wir den Krieg ins eigene Land holen wollten, aber aus der Vorstellung von bewaffnetem Widerstand wurde eine sehr viel komplexere Widerstandskultur. Die Mächtigen wurden symbolisch herausgefordert, und schließlich kam es zur Abkehr vom Terror, einerseits, weil wir ihn nicht hätten aufrechterhalten können und andererseits, weil wir ihn für moralisch falsch hielten. Wir hatten das Gefühl, wenn wir innerhalb der Vereinigten Staaten Terror ausgeübt hätten, wäre das ein schrecklicher Fehler gewesen und hätte zu einer schrecklichen Tragödie geführt. Wir haben also den Großteil des Jahres 1970 mit der Auswertung der hitzigen Debatten von 1969 zugebracht, gleichzeitig aber symbolische Attacken auf die Regierung lanciert, außerdem Gedichte geschrieben, Bücher veröffentlicht und vor allem versucht, uns nicht erwischen zu lassen.
Warum haben Sie den bewaffneten Kampf aufgegeben?
Bernardine Dohrn: Wir haben den bewaffneten Kampf nicht aufgegeben, aber wir haben uns anderer Methoden bedient, wie der Zerstörung von Eigentum. Wir wollten die amerikanische Regierung ins Herz treffen, wenn sie es am wenigsten erwartet, und nicht zulassen, daß eine militärische Strategie die politische Strategie bestimmt.
Bill Ayers: Das Politische mußte den Vorrang haben, weil wir nie geglaubt haben, daß wir es als Gruppe von Jugendlichen mit Steinschleudern mit der schlagkräftigsten Armee der Geschichte aufnehmen konnten. Es ging darum, die Opposition zu mobilisieren, eine militante Opposition, eine, die tatsächlich einen Wandel hervorrufen kann. Aus allem, was man als Terrorismus hätte bezeichnen können, zogen wir uns zurück. Aus zwei Gründen: einmal, weil es moralisch falsch gewesen wäre, und zweitens, weil es politisch dumm war. Terrorismus funktioniert nicht, wenn man Menschen angreift und Angst und Schrecken verbreitet, das war niemals unsere Absicht gewesen, und das haben wir auch nie getan.
Bernardine Dohrn: Wir haben festgestellt, daß wir mit Humor weiterkommen. Allein damit, daß wir uns nicht erwischen ließen, haben wir viel mehr Leute mobilisiert als mit jeder Aktion. Ich will nicht sagen, daß wir das alles ganz toll gemacht haben, aber ich glaube schon, daß wir dadurch, daß es uns gelungen ist, über elf Jahre hinweg eine Untergrundorganisation aufrechtzuerhalten, ohne erwischt zu werden, viele Leute auf unsere Seite gebracht haben, die vorher woanders standen.
Haben Sie etwas über die Situation hier in Deutschland erfahren? Hier gab es eine Hysterie gegen Bewegungen wie den 2. Juni und die RAF, und wer aussteigen wollte, hatte keine Chance. Wer die Gruppe verließ, mußte auch das Land verlassen. Einige standen auf dem Standpunkt: »Es gibt kein Entkommen, also machen wir weiter«.
Bernardine Dohrn: Ich glaube nicht, daß wir uns hätten stellen können. Ich denke, die Umstände waren sehr verschieden, aber ich denke auch, wenn ich 1972, ’73 oder ’74 erwischt worden wäre, hätte man mich bei der Festnahme getötet. Es gab die Anweisung zu schießen, denn man hielt uns für bewaffnet und gefährlich. Nur dadurch, daß wir uns nicht erwischen ließen, änderte sich mit der Zeit alles.
Sitzen noch Mitglieder der Weathermen im Gefängnis?
Bill Ayers: Viele von uns sind noch im Gefängnis.
Bernardine Dohrn: In den Vereinigten Staaten gibt es immer noch sehr viele politische Gefangene, die meisten sind Afroamerikaner und Ureinwohner. Und viele andere haben das Land verlassen und sind nicht zurückkehrt.
Denen konnte man dann zum Beispiel auf dem damaligen Hippietreck in Indien und Afghanistan begegnen. Unter welchen Voraussetzungen werden Sie heute politisch aktiv?
Bill Ayers: Wir waren unser Leben lang politisch aktiv und sind es nach wie vor: Wir gehören zu einer sehr großen Formation von Aktivisten, die Bewegungen aufbauen. Eigentlich ist es egal, wo man anfängt, ob man gegen den Wahn der Immigrationsbeschränkungen in den Vereinigten Staaten ankämpft, ob man gegen den Krieg protestiert, sich gegen die Vorherrschaft der Weißen zur Wehr setzt oder für die Rechte von Frauen kämpft, Tatsache ist, daß in dieser Welt soviel aus dem Lot geraten ist, daß man einfach irgendwo anfangen und dann eine Verbindung zu all den anderen Themen herstellen muß. Wir verbringen zum Beispiel sehr viel Zeit damit, eine Verbindung zwischen der Antikriegsbewegung und Fragen der Bildungsreform herzustellen. Auch ökologische Themen sind von Bedeutung. Wir haben eine Konferenz zum Thema Krieg und Klimaerwärmung organisiert. Die Idee, die dahinter stand, war, daß man die drohende Umweltkatastrophe nur verstehen kann, wenn man auch den Wettlauf ums Öl begreift. Deshalb verwenden wir sehr viel Zeit darauf diese Themen zueinander in Beziehung zu setzen.
Bernardine Dohrn: Ich gebe Ihnen ein einfaches Beispiel: In den Vereinigten Staaten würde jeder die Frage »Sind Sie gegen Sklaverei?« mit »ja« beantworten. Und dann würde man fragen: »Wären Sie auch früher gegen Sklaverei gewesen?« Daraufhin bekäme man die Antwort: »Ja, natürlich.« Denn wir haben ein heroisches Bild von uns selbst. Vielleicht wäre man nicht gleich Harriet Tubman gewesen, aber doch jemand, der gegen die Sklaverei gekämpft hätte. Aber man muß sich in Erinnerung rufen, daß es gegen das Gesetz war, der eigenen Religion widersprach, daß man sich damit gegen die eigene Familie auflehnte, gegen Freunde, die Gemeinde und man alles riskierte. Es dauerte noch hundert Jahre und kostete Millionen von Leben, bis die Sklaverei formal abgeschafft war. Jetzt haben wir es mit dem Vermächtnis der Sklaverei zu tun, und deshalb lautet die Frage, die wir uns heute täglich stellen müssen: »Was werden meine Enkelkinder in fünfzig Jahren von mir wissen wollen? Werden sie sagen: ›Du hast 2010 tatenlos zugesehen, als 2,4 Millionen Amerikaner, die meisten davon Afroamerikaner und die meisten davon aufgrund gewaltfreier Vergehen, eingesperrt waren? Machst du Witze? Was hast du dagegen unternommen? Hast du vor den Gefängnissen gestanden, hast du dagegen demonstriert?‹« Das ist die Frage. Welche Schlußfolgerungen ziehe ich daraus? Ich weiß es nicht. Es bedeutet, daß man etwas tun muß.
In Illinois gab es 1991 wieder eine Hinrichtung, tausend Menschen standen vor dem Gefängnis und bejubelten das Ereignis. Zu fünft protestierten wir dagegen. Acht Jahre später wurde die Todesstrafe in Illinois endgültig abgeschafft. Wer hätte das vorhersagen können? Niemand. Und es sah auch lange nicht so aus, als wäre das überhaupt möglich. Es sah aus, als würde sich nie etwas ändern, aber dann hat eine Reihe von Entwicklungen eben doch dazu geführt.
1969 begab sich Bill Ayers nach den staatlichen Repressionen gegen die militante Linke im Zuge der Days of Rage, dem ersten öffentlichkeitswirksamen Auftreten der neu formierten Weathermen, in die Illegalität und stellte sich erst im Dezember 1980 gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin und Weather-Underground-Aktivistin Bernardine Dohrn (Foto der Chicagoer Polizei aus dem September 1969) den Behörden. Nur wenige Monate später wurden sämtliche Anklagepunkte gegen Dohrn und Ayers aufgrund vom FBI illegal beschaffter Beweismittel fallengelassen.
Im Frühjahr erschienen seine Erinnerungen »Flüchtige Tage« im Ventil Verlag (übersetzt von pociao und Walter Hartmann, Mainz 2010, 384 Seiten, 24,90 Euro) .
Hier ein Auszug daraus:
Was ist eigentlich ein sicheres Haus? Ein sicheres Haus braucht man, wenn sich das Zuhause in die Hölle verwandelt hat, oder wenn man zu dem Schluß kommt, daß das eigene Land zwecks Rechtfertigung von Mord und Totschlag zu einem Hort der Lügen und Täuschungen geworden ist. Man will aus dem brennenden Haus fliehen und sucht eine sichere Zuflucht.
Ein sicheres Haus konnte jede anonym gemietete Wohnung sein, ohne daß jemand Buch darüber führte oder wußte, wer man war. Ein unsicheres Haus wäre eins, das man auf den Namen »Bernardine Dohrn« angemietet hätte, mit einem großen Foto von ihr im Fenster und der Überschrift »Die zehn meistgesuchten Verbrecher« und darunter ein fröhliches Willkommen! Eines Tages entdeckten wir zu unserer Überraschung genau das in der Innenstadt. Jeff und ich waren so begeistert, daß wir darauf bestanden, dreimal daran vorbeizufahren, während Rose auf dem Vordersitz zwischen uns beiden immer kleiner wurde.
Ein unsicheres Haus war eins, bei dem der Immobilienmakler zu viele Fragen stellte, zu viele Referenzen verlangte oder einfach zu verklemmt war. Oder eins, wo andere zwielichtige Geschäfte abgewickelt wurden – etwa nebenan mit Drogen gedealt oder ein Stockwerk höher illegale Prostitution betrieben wurde.
Unser erster Unterschlupf war ein Hausboot am Gate 6, Platz 58, eine schmuddlige Behausung, die in einer seichten Kloake schwamm, aber einen atemberaubenden Blick auf die Stadt bot. Eine Weile wohnten wir in einem Loch über dem Ziegenstall einer Kommune und später im Gartenhaus eines Landsitzes nicht weit vom Laurel Canyon. Für ein paar Monate zogen wir in ein Penthouse in Manhattan und für den Rest des Jahres in den Keller eines Klosters in Mundelein; wir bewohnten einen baufälligen Schuppen unweit von Watts und ein Steinhaus auf der Olympic-Halbinsel. Mein Lieblingsdomizil war ein sonniges Zimmer über einer lauten irischen Kneipe, die von Cops nach Dienstschluß frequentiert wurde – der Hauswirt entschuldigte sich unaufhörlich für den Lärm und stellte uns schuldbewußt etwas zu essen oder zu trinken vor die Tür.
Wo immer wir waren, hängte Rose ein Stück Spitze ans Fenster, breitete ihre geliebte kleine Patchworkdecke übers Bett, und schon war es ein Zuhause. Ein sicheres Haus war eines, wo man sich an andere Wohnungen erinnerte, ein anderes Zuhause. Wir waren Nomaden, ständig auf Achse, und lernten, unser Haus auf dem Rücken mitzuschleppen – wie die Schnecken.
Ich hatte mit eher harmlosen Outlaws wie Ron St. Ron zu tun gehabt und wußte, daß es parallele Untergrundwelten gab, war an einigen sogar beteiligt gewesen – illegale Abtreibungsnetzwerke beispielsweise oder Schleuserrouten nach Kanada oder Europa für Deserteure, doch auf der Suche nach guten Verstecken entdeckte ich zahllose andere, Hunderte, Tausende, eine ganze Untergrundkultur. Zwar war jede anders und auf bedeutsame Weise einzigartig, doch hatten sie auch eine Reihe von Merkmalen gemeinsam, durch die sie plötzlich verblüffend leicht erkennbar wurden, zumindest für mich.
Einmal hatte ich eine perfekte Telefonzelle gefunden, um mich anrufen zu lassen. Das Telefon war unser Feind, und ich habe bis heute eine seltsame Abneigung dagegen bewahrt, doch dieses war eine wichtige Entdeckung, denn die Kommunikation zwischen öffentlichen Telefonzellen, für die wir immer entsprechende Münzen bei uns hatten, war das wichtigste Instrument, um in der Diaspora Kontakt zu halten. Es war zu einer Zeit, als Rose und ich uns an verschiedenen Küsten aufhielten und eine regelmäßige Routine entwickelten: Sie rief mich jeden zweiten Abend um sieben Uhr an. Mein Anschluß befand sich zwischen den Toiletten im Kellergeschoß eines geschäftigen Howard-Johnson’s-Restaurants an der Kreuzung von zwei verkehrsreichen Highways, zwanzig Minuten von meiner Unterkunft entfernt. Es waren zwei getrennte Zellen; wenn eine besetzt oder ausgefallen war, hatten wir schnell und problemlos Ersatz. Aus all diesen Gründen war der Ort wie geschaffen für uns, aber es gab noch etwas, was ihn ideal machte – im Gang stand eine mit orange und blau gemustertem Kunstleder bezogene Bank, groß genug für drei.
Ich benutzte das Telefon bereits seit mehreren Wochen, als ich eines Abends ankam und zwei schwere Jungs, so groß wie Panzerschränke, mit verschränkten Armen auf der Bank sitzen sah. Sie nahmen den gesamten Platz in Anspruch. Mir rutschte das Herz in die Hose, aber ich nickte ihnen zu und verschwand ohne anzuhalten in der Herrentoilette. Shoes, dachte ich. Aber langsam. Beide trugen todschicke italienische Halbschuhe und teure Wollanzüge. Einer sah aus wie mein alter Freund von der Highschool mit dem Frankensteinschädel, der andere hatte das Gesicht von einem Profiringer, den man zu oft in den Schwitzkasten genommen hatte. Um kein Risiko einzugehen, beschloß ich, gerade lange genug zum Pinkeln zu bleiben und dann abzuhauen. Es war eine Minute vor sieben.
Plötzlich klingelten beide Telefone gleichzeitig, und ich hörte die Bank ächzen, als die beiden Panzerschränke aufstanden, um dranzugehen. Yo Frankie, sagten sie wie aus einem Mund. Kurzes Schweigen, dann öffnete sich plötzlich die Tür zur Herrentoilette und einer der Typen fragte: Heißt du Joe? Ist für dich, Joe.
Danke, sagte ich, und nahm den Hörer. Während der Kerl mit dem kantigen Schädel sich in einer Art Code, der so klang wie der Wetterbericht – Grade und Himmelsrichtungen, Geschwindigkeit, Hochs und Tiefs –, weiter mit Frankie unterhielt, setzte sich der andere grinsend wieder hin, und ich verabredete hastig ein anderes Gespräch an einem anderen Ort, bevor ich mich aus dem Staub machte.
Einmal führte uns ein Makler durch ein großes Gebäude, und wir stolperten rein zufällig über ein wirklich unsicheres Haus. Der eifrige junge Makler öffnete hektisch eine Tür nach der anderen, Zeichen seiner aggressiven Verkaufsstrategie, während wir lässig hinter ihm her trotteten. Plötzlich standen wir in einem winzigen Schlafzimmer, das in eine von oben bis unten mit elektronischen Geräten vollgestopfte Überwachungsstation umgemodelt worden war. Die Fenster waren verdunkelt, zwei Kameras auf ein Apartment im ersten Stock auf der anderen Straßenseite gerichtet, Tonbandspulen drehten sich. Ooops, sagte der Makler mit verlegenem Lachen. Das hatte ich ganz vergessen, aber sie ziehen Ende der Woche aus.
Nach Einbruch der Dunkelheit klingelte ich an der Wohnung im ersten Stock auf der anderen Straßenseite. Auf dem Schild stand »Jackson«. Ein Paket für Jackson, sagte ich, und die Tür öffnete sich einen Spalt. Ich kenne Sie nicht, Mr. Jackson, sagte ich rasch, und ich will keinen Ärger, aber Sie werden aus dem zweiten Stock des Hauses gegenüber beobachtet. Daraufhin knallte die Tür wieder zu und ich rannte los, ohne zu wissen, ob ich gerade einen sowjetischen Spion, einen Drogenschmuggler oder einen Kidnapper gewarnt hatte. Es hätte ein unbescholtener Bürger oder ein gefährlicher Krimineller sein können. In jener Zeit interessierte mich das nicht besonders.
Für bestimmte Zwecke, Ziele oder Aktionen schmiedeten wir Allianzen mit etlichen anderen voll etablierten Untergrundgruppen – der Brotherhood of Eternal Love etwa, einem Drogennetzwerk, mit dem wir Timothy Leary aus dem Gefängnis in Kalifornien befreiten, oder mit der Black Liberation Army für allerlei rebellische Aktionen. Aber die meiner Meinung nach interessanteste Verbindung ergab sich gleich in den ersten Monaten im Untergrund, und zwar mit einer exzentrischen, zwielichtigen Gruppe, deren Mitglieder über die Jahrzehnte zu treuen, verläßlichen Freunden wurden.
Die Gruppe hatte keinen Namen, zählte Hunderte von Mitgliedern in einem halben Dutzend Städte und wurde von einem charismatischen Psychologen angeführt, der sich Kaz nannte. Es waren ehemalige Heroinabhängige, Beatniks, Stricher und Prostituierte, fünf, zehn, zwanzig Jahre älter als wir, die jetzt im Luxus lebten und in den Innenstädten arbeiteten, sich selbst jedoch hauptsächlich als Untergrundkämpfer begriffen, eine Art fünfte Kolonne, die geduldig auf die Revolution wartete.
Wir haben euch schon erwartet, sagte Kaz, und umarmte mich herzlich, als wir uns zum ersten Mal begegneten. Seine Augen funkelten, und sein kurzer grauer Bart glänzte. Wir befanden uns in einer Penthouse-Wohnung im Reichenviertel Gold Coast, umgeben von Perserteppichen und asiatischen Vasen, dickgepolsterten Sofas und modernen Gemälden. Kaz schätzte unsere Aktivitäten, und es dauerte nicht lange, bis er uns mit Geld, Verstecken und mehr versorgte.
Immer wenn wir uns mit anderen Organisationen oder Figuren aus dem Movement trafen, erzählten Rose und ich unsere Geschichte in harmonischer Übereinstimmung, ein eingespieltes Duo, das für mich trotzdem jedes Mal neu klang.
Beispielsweise fing ich mit den Lektionen an, die wir aus dem Townhouse gelernt hatten, der Notwendigkeit einer breiten Übereinstimmung hinsichtlich unserer Ziele im Kampf gegen Krieg und Rassismus, die über reine Taktik hinausgehen mußten. Und entweder machte ich dann weiter, nachdem Rose mich mit einem Einschub unterbrochen hatte, oder ich überließ ihr das Wort, und sie sprach davon, daß wir starke Brücken zu allen Sektoren brauchten, zu Frauengruppen, internationalen Verbindungen und älteren Generationen, alles natürlich mit dem Hauptaugenmerk auf dem Kampf der Schwarzen hier im Land.
Nach einer Weile mischte ich mich dann wieder ein, und so bildete sich allmählich ein zweistimmiger Vortrag heraus, eine Geschichte mit verständlichen Dimensionen, getragen von absolutem gegenseitigen Vertrauen. Wir benutzten dieselben Worte auf dieselbe Art; im Verlauf von vielen Monaten wurde daraus ein beruhigendes und vertrautes Ritual.
Ein paar Jahre lang arbeitete ich in einer Biobäckerei. Eines Tages entdeckte ich gegen Ende der Spätschicht einen parallelen Untergrund, der mich beinahe das Leben gekostet hätte.
Die Bäckerei war ein kleiner Laden um die Ecke – drei Schichten junger Leute wuselten von sechs Uhr morgens bis Mitternacht herum und produzierten Unmengen von Müsli- und Haferflockenplätzchen, Möhrenkuchen und Mehrkornbrot. In einer heißen Sommernacht waren wir nur noch zu zweit, die Medizinstudentin Paula und ich. Es war nach Feierabend, wir wollten nur noch schnell saubermachen und hatten die Tür offen stehen, um ein bißchen frische Luft hereinzulassen.
Ich wischte gerade den Boden, als ich hörte, wie die Tür zuknallte. Als ich mich umdrehte, hatte ich einen silbernen Pistolenlauf in der Größe eines Baseballschlägers genau vor der Nase. Die Pistole zitterte, und der Junge, der sie hielt, sah aus, als würde er jeden Moment losflennen. Ich will keinen Ärger, sagte er, und seine Stimme brach. Ab nach hinten! Die Pistole war größer als sein Kopf.
Ich wollte etwas sagen, und mein Kiefer bewegte sich, doch ich brachte nichts heraus.
Er scheuchte Paula und mich in die Toilette. Bevor er uns dort einschloß, hatte ich mich soweit erholt, daß ich sagte: Nimm das Geld, nimm alles, was du willst.
Wir hockten zitternd auf dem Boden der Toilette und hielten uns an der Hand. Es gab einen Telefonapparat an der Wand, doch wir wagten nicht, ihn zu benutzen, bis wir die Vordertür erneut zuknallen hörten. Paula rief gefaßt die Polizei und dann die Besitzer der Bäckerei an; erst als sie eintrafen, brach sie in Tränen aus.
Wir gingen nach Hause, doch in dieser Nacht fand keiner von uns beiden Schlaf. Am nächsten Tag holte uns die Polizei in der Bäckerei ab und brachte uns, immer noch wacklig und müde, auf die Wache, wo sie uns Fahndungsfotos vorlegten. Paula wußte nicht, daß ich selbst gesucht wurde; meine Nervosität hielt sie für Nachwehen des Schocks aus der Nacht zuvor.
Wir saßen in einem kleinen Raum, während ein Beamter einen Fotowälzer nach dem anderen anschleppte, alle dick und schwer, mit der Aufschrift SCHWARZ MÄNNLICH, 18 bis 20, ÜBERFALL, RAUB, WAFFENGEBRAUCH. Nach einer Stunde konnte ich nur noch an die Tragik dieses anarchistischen und nihilistischen Quasi-Untergrunds denken, an den verschwendeten Mut und die sinnlosen Opfer.
Paula und ich fanden unseren Freund nicht, und hätte ich ihn entdeckt, hätte ich einfach weitergeblättert.
(…)
Bei der Arbeit im Hafen stolperte ich über Dutzende zwielichtiger Operationen– Glücksspielringe, Schmugglertrupps, ausgetickte kleine Diebesbanden –, aber das bedeutendste und augenfälligste Untergrundnetzwerk entdeckte ich erst, als es eines Tages im Spätsommer direkt vor meiner Nase aufflog.
Es war gleich vier, kurz vor Schichtwechsel, und unsere Arbeitsmannschaft versammelte sich nach und nach an Deck. Es ging darum, rechtzeitig in der Nähe des Fallreeps zu sein, um als einer der Ersten das Schiff zu verlassen – aber auch nicht zu früh, sonst schickte einen der Vorarbeiter wieder zurück. Viertel vor vier war zu früh, fünf vor vier schon reichlich spät. Es war ein kniffliges Spiel.
Wie auch immer, nach und nach fanden wir uns an Deck ein, rauchten, alberten herum, rempelten uns gegenseitig an, und ich dachte gerade ans Abendessen mit Rose, kein Rauch mehr und keine Funken, kein Bogenschweißen für die nächsten sechzehn Stunden – Freiheit! –, als ich aus dem Augenwinkel einen Wagen mit Zivilbullen sah, der sich hinter einen Lagerschuppen schob. Keine Ahnung, woher ich wußte, was es war, aber ich wußte es, mein siebter Sinn meldete sich sofort. Ich war in höchster Alarmbereitschaft.
Plötzlich wurde mir bewußt, daß es auf der riesigen Schiffswerft nur so von Cops wimmelte – mindestens zwei hockten mit Gewehren bewaffnet auf dem Dach des Umkleideraums, vier weitere drückten sich in der Nähe des Tors herum, zwei mit einem Funkgerät standen direkt neben dem Fallreep, und überall parkten Autos von Zivilbullen. Zwei Minuten vor vier. Mein Herz raste, ich dachte nur noch an Flucht. Ich schätzte ab, wie weit es vom Schiff über den Asphalt bis zum Zaun war– unmöglich – oder durchs Wasser zum nächsten Pier, aber dort würde ich entweder zwischen anderen Schiffen zermalmt oder untergehen. Die beste Lösung schien mir der Graben zu sein, der hinter dem Umkleideraum unter dem Zaun entlang verlief.
Als die Sirene erklang und die Menge sich in Bewegung setzte, ließ ich mit gesenktem Kopf die anderen vorgehen. Wenn ich an den beiden Spähern mit dem Funkgerät vorbeikäme, wären es bloß noch sechzig Sekunden bis zum Graben. In diesem Moment zischte jemand »La Migra« und ein Davonrennen und Hinterherjagen ging los, ein Geschrei und Kesseltreiben, Schlagstöcke und Handschellen kamen zum Einsatz – und mit mir hatte das alles überhaupt nichts zu tun.
Alle Mexikaner wurden festgehalten, während ich unbehelligt zu meinem Spind ging und dann nach Hause fuhr, als freier Mann. Ich hatte sämtliche Zeichen falsch gedeutet. An diesem Tag wie an so vielen anderen war meine weiße Haut mein Passierschein gewesen. Meine Freiheit war mit Scham besudelt.