
Demo 1 (Frankreich)
Es ist nicht lustig, dass dieser lamarckistische Begriff „Integration“ jetzt ausgerechnet für darwinistische Politik herhalten muß. Er bezeichnete bei den Lamarckisten (auch „Lamarxisten“ in Russland genannt) die Vererbbarkeit von Lernerfahrungen. Peter Rühmkorf seufzte: „Ach, könnte man doch auch angelesene Eigenschaften vererben!“ So etwas geht, braucht aber viel Zeit, deswegen dauern diesbezügliche Zuchtexperimente – mit Amphibien und Reptilien beispielsweise – Jahrzehnte. Ein Musterbeispiel für gelungene Integration bereits in der ersten Generation vermeldete jetzt eine Braunschweiger Internet-Agentur: In der Nähe von Göttingen hatte sich ein junges Wildschwein einer Rinderherde angeschlossen. „Der kleine ‚Freddy‘ war der Galloway-Herde zugelaufen. Offenbar hatte er seine Mutter verloren und Anschluss gesucht – und dabei die Rinder von Bauer Bodo Bertsch ausgesucht. Anfangs hatten ihn noch einige Kühe abgewiesen, doch inzwischen ist Freddy in der Herde akzeptiert. Seitdem zieht das kleine Wildschwein mit den Rindern über die Weide, frisst Gras und wird von einer Kuh gesäugt.“ Die Illustrierte „stern“ wußte wenig später schon, dass „Freddy“ inzwischen sogar muht.
Apropos: Nach dem vorjährigen „Mut-Bambi“ des Burda-Verlags, der an Tom Cruise für seine Verfilmung des großdeutschen Stauffenberg-Dramas verliehen wurde, vergab Hubert Burda diesmal einen „Integrations-Bambi“ – und zwar an den deutschen Nationalspieler Mesut Özil. Neben dem in Gelsenkirchen geborenen „türkischstämmige Fußballstar“ bekam auch Bundestrainer Joachim Löw einen „Bambi“, Özil hielt die Laudatio für ihn.
Aus Afghanistan meldete zur selben Zeit die Bundeswehr, dass sie sich einen Esel zugelegt habe, für 70 Euro. Er höre fortan auf den Namen „Hermann“. Die Feuilletons erklärten uns dazu, dass sich der Name auf Hermann den Cherusker und das deutsche Widerstandsdrama von Heinrich von Kleist: „Die Herrmannschlacht“ beziehe. Das war jedoch als Aufstandsanleitung für die Deutschen und gegen die napoleonische Fremdherrschaft verfaßt worden. „Die Geburt des Partisanen aus dem Geist der Poesie, so hat Wolf Kittler diesen „Strategie“-Entwurf für die „Befreiungskriege“ bezeichnet. Inzwischen sieht man den Hermannschen Sieg über die Römer in der Nähe von Osnabrück, wo sich bis 1989 das Hauptquartier der englischen Besatzung befand, derart germanen-kritisch, dass man nur noch von einer „Varusschlacht“ reden will.
Der Esel „Hermann“ soll nun – ebenfalls anders als bei Kleist – gerade von (fremden) Soldaten gegen (einheimische) Partisanen eingesetzt werden. Um sie auch dort zu vernichten, wo die hightech-ausgerüsteten Fahrzeuge der Bundeswehr sonst nicht hinkommen. Wir erinnern uns: Graf Stauffenberg – vor seinem Hitler-Attentat organisierte er die Aufstellung fremdländischer Ost-Divisionen (Armenier, Georgier, Tschetschenen, Ukrainer usw.), weil, so meinte er, der jüdische Bolschewismus nur mit den von ihm unterdrückten Völkern besiegt werden könne und nicht gegen sie. Als der deutsche Rückzug einsetzte, wurden diese Divisionen aus ihren Regionen, in der sie partisanisch integriert waren, herausgenommen und von den Deutschen zur soldatischen Partisanenbekämpfung in West- und Südeuropa eingesetzt. Stauffenberg war auch so eine Art „Hermann“: Die Ost-Divisionen wurden alle vernichtet – von den kommunistischen Partisanen und ihrer anschließenden „Siegerjustiz“. Wir lernen daraus: Quäle nie ein Tier zum Scherz, denn es könnt geladen sein? Nein. Gut sind die Partisanen nur, so lange sie integriert sind, oder andersherum: Die beste Integration verhindert kein Partisanentum – im Gegenteil, wie Peter Brückner einmal an seinem eigenen Beispiel erklärte (1). Während Rudi Dutschke genau umgekehrt argumentierte, als er mit Blick auf die „bürgerliche Perspektive“ der linken Studenten zu bedenken gab: „Das Sich-Verweigern in den eigenen Institutionsmilieus erfordert Guerilla-Mentalität, sollen nicht Integration und Zynismus die nächste Station sein.“ Für Dutschke war „Integration“ also noch gleichbedeutend mit Scheitern. So habe ich das Wort auch in Erinnerung, bleibe aber mit Peter Brückner im Rücken gelassen.

Demo 2 (Belgrad)
P.S.: Den afghanischen Esel, der von den Bundeswehrsoldaten „Hermann“ genannt wurde, habe ich anscheinend unterschätzt, obwohl ich etliche Jahre selbst einen (jugoslawischen) Esel besaß und es hätte besser wissen müssen. Die Bild-Zeitung meldete am 18.November, also vor drei Tagen:
„Er will nicht mehr: Esel Hermann verweigert den Kriegs-Dienst. Er sollte die Bundeswehr im Kampf gegen die Taliban im nordafghanischen Kunduz unterstützen. Dem Vernehmen nach weigerte sich das störrische Lasttier, das schwere Waffen und Munition durch Felder im Unruhedistrikt Char Darah tragen sollte, über Wassergräben zu steigen. Nach Angaben der Bundeswehr wurde der für 100 Dollar (gut 70 Euro) auf einem einheimischen Markt beschaffte Esel auch deswegen wieder veräußert. „Ich weiß nicht, ob dabei ein Gewinn gemacht wurde“, sagte der Bundeswehr-Sprecher.“

Demo 3 (Paris)
Weitere Nachrichten von benamten Eseln aus vier Regionalzeitungen:
1. Im Thüringer Zoopark Erfurt, kann man seit Dienstag Eselnachwuchs im Doppelpack bestaunen. Die Eseldamen Elli und Emily entschlossen sich noch vor dem Morgengrauen des 21. August dazu, jeweils ein gesundes weibliches Eselfohlen zur Welt zu bringen. Das Geburtsgewicht betrug 17 beziehungsweise 20 Kilogramm, Namen haben die kleinen Grautiere noch nicht. Die zwei Eselmädchen wurden nicht nur am selben Tag geboren, sie haben auch denselben Vater – Elvis.
2. „Der Somaliwildesel ‚Sancho‘ im Tierpark Chemnitz wurde aus seiner Einzelunterkunft ins Nachbargehege zu drei Böhm-Zebras gebracht. Der Wildesel lebt seit 1997 im Tierpark Chemnitz, ist aber zur Zucht nicht geeignet und konnte daher nicht mit einer Stute zusammengebracht werden. Um Platz zu gewinnen und auch um ihm Gesellschaft zu verschaffen, wagte der Tierpark den Versuch, ihn allmählich an die Zebras zu gewöhnen. Er bekam zuerst ausreichend Gelegenheit, sich allein mit dem ihm unbekannten Gehege vertraut zu machen. Danach wurden die vier afrikanischen Tiere unter Aufsicht zusammen gelassen. Man kann zwar (noch) nicht von einer dicken Freundschaft sprechen, aber die Tiere kommen gut miteinander klar. Nachts bekommt jede Art ihre eigene Box.“
3. Im Stuttgarter Zoo Wilhelma züchtet man – mit Erfolg – Somali-Wildesel, dennoch gibt es Probleme: „In ihrer Heimat steht die Art am Rande der Ausrottung, in den Zoos der Welt gibt es noch etwa 130 Tiere. Alle stammen von 5 Tieren aus dem Basler Zoo und 12 Tieren aus einem Reservat in Israel ab. Leider geht es mit dem Nachwuchs bei Somali-Wildeseln nicht ganz so einfach, wie bei der übrigen Verwandtschaft. Vielleicht ist die Individuenzahl sogar zu gering, um die Art langfristig zu retten, aber die Zoos werden nicht aufgeben, solange noch Fohlen geboren werden. Jeder Zuwachs wird deswegen im Wilhelma-Zoo, der sechs Somali-Wildesel hält, enthusiastisch gefeiert, so auch das Stutenfohlen ‚Seyla‘, das 2006 zur Welt kam. Zunächst blieb die kleine ‚Seyla‘ mit Mutter ‚Sarina‘ im Stall, um die Mutter-Kind-Bindung zwischen der noch unerfahrenen Stute und ihrem erstgeborenen Fohlen zu stärkern. Seit kurzem dürfen beide mit den anderen Stuten ‚Simone‘, ‚Shebili‘ und ‚Thea‘ auf der Freianlage tollen. Vater ‚Luciano‘ geht das alles nichts an – ihn interessieren Fohlen überhaupt nicht und die Stuten nur, wenn sie roßig sind. Den überwiegenden Teil des Jahres verbringt er daher von der Herde getrennt.“
4. Gar zu ungestüm machte Hengst „Pancho“ seinen Damen den Hof, mit fatalen Folgen für die Poitou-Eselzucht im Stuttgarter zollogisch-botanischen Garten Wilhelma: Hormongesteuert zu schnell in die Kurve, rums, Beinbruch, aus und vorbei… Lange Zeit war nicht mal sicher, ob „Pancho“ überhaupt eine der 3 Stuten erfolgreich gedeckt und somit genetische Spuren im Bestand hinterlassen hatte. Seit dem 13. März aber steht fest: Er hat! „Hamra“ brachte ein bezauberndes Hengstfohlen namens „Sam“ zur Welt. Sie schien aber die Freude der Pfleger über das wollige Wesen nicht ganz zu teilen, denn nach erster Betrachtung verwei-gerte sie zunächst die Annahme. Eineinhalb Tage verbrachte „Sam“ in der Obhut von Pflegern und Wärmelampen, erhielt seine Milch per Fläschchen und wurde unter Aufsicht aber auch zum Trinken zu „Hamra“ gebracht. Was den Sinneswandel bei der anfangs so unwilligen Mutter ausgelöst hat, wird wohl ihr Geheimnis bleiben – jedenfalls nahm „Hamra“ ihr Söhnchen am zweiten Tag an und sorgt seither vorbildlich für den Charmeur mit dem dunkelgelockten Foh-lenfell, den endlos langen Beinen und den langen Puschelohren. Die für diese französische Eselrasse typischen, zotteligen langen Haare bekommen die Poitous erst als erwachsene Esel. Dass er zur größten Eselrasse der Welt gehört, sieht man „Sam“ aber schon jetzt an: Er ist als Fohlen bereits größer als die Shetlandponies auf dem Schaubauernhof der Wilhelma. Eine Zeitlang kann er jetzt die Streicheleinheiten der Besucher entgegen nehmen und dabei in Ruhe heranwachsen – wenn er in die Flegeljahre kommt, wird für ihn eine neue Herde gesucht, damit es nicht zur Inzucht unter den wertvollen Poitoueseln kommt.

Demo 4 (Duisburg)
Die (namenlosen) Esel im Werk von Friedrich Nietzsche:
1. An die deutschen Esel Dieser braven Engeländer Mittelmäßige Verständer Nehmt ihr als ‚Philosophie‘? Darwin neben Goethe setzen Heißt: die Majestät verletzen — majestatem Genii! Aller mittelmäßigen Geister Erster-das sei ein Meister, Und vor ihm auf die Knie! Höher ihn herauf zu setzen Heißt – – –
2. Wann Esel not tun Wann Esel not tun. – Man wird die Menge nicht eher zum Hosianna-rufen bringen, bis man auf einem Esel in die Stadt einreitet.
3. Das Eselsfest An dieser Stelle der Litanei aber konnte Zarathustra sich nicht länger bemeistern, schrie selber I-A, lauter noch als der Esel, und sprang mitten unter seine tollgewordenen Gäste.
4. Diese Litanei aber klang also: Amen! Und Lob und Ehre und Weisheit und Dank und Preis und Stärke sei unserm Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit! – Der Esel aber schrie dazu I-A. Er trägt unsre Last, er nahm Knechtsgestalt an, er ist geduldsam von Herzen und redet niemals Nein; und wer seinen Gott liebt, der züchtigt ihn. – Der Esel aber schrie dazu I-A. Er redet nicht: es sei denn, dass er zur Welt, die er Schuf, immer Ja sagt: also preist er seine Welt. Seine Schlauheit ist es, die nicht redet: so bekommt er selten Unrecht. – Der Esel aber schrie dazu I-A. Unscheinbar geht er durch die Welt. Grau ist die Leib-Farbe, in welche er seine Tugend hüllt. Hat er Geist, so verbirgt er ihn; Jedermann aber glaubt an seine langen Ohren. – Der Esel aber schrie dazu I-A. Welche verborgene Weisheit ist das, dass er lange Ohren trägt und allein ja und nimmer Nein sagt! Hat er nicht die Welt erschaffen nach seinem Bilde, nämlich so dumm als möglich? – Der Esel aber schrie dazu I-A. Du gehst gerade und krumme Wege; es kümmert dich wenig, was uns Menschen gerade oder krumm dünkt. Jenseits von Gut und Böse ist dein Reich. Es ist deine Unschuld, nicht zu wissen, was Unschuld ist. – Der Esel aber schrie dazu I-A. Siehe doch, wie du Niemanden von dir stössest, die Bettler nicht, noch die Könige. Die Kindlein lässest du zu dir kommen, und wenn dich die bösen Buben locken, so sprichst du einfältiglich I-A. – … Der Esel schrie dazu I-A. Siehe doch, wie du Niemanden von dir stössest, die Bettler nicht, noch die Könige. Die Kindlein lässest du zu dir kommen, und wenn dich die bösen Buben locken, so sprichst du einfältiglich I-A. – Der Esel aber schrie dazu I-A. Du liebst Eselinnen und frische Feigen, du bist kein Kostverächter. Eine Distel kitzelt dir das Herz, wenn du gerade Hunger hast. Darin liegt eines Gottes Weisheit. – Der Esel aber schrie dazu I-A.
5. „Der Gedanke der Affirmation – Nietzsche und Deleuze“ Zarathustra zeigt, wie das vonstatten geht, und Zarathustras Esel, wie es nicht funktioniert. Dessen I-A, dessen JA ist ein unfreiwilliges, ein ungewolltes, denn der Esel ist überhaupt nicht in der Lage, jemals etwas anders als I-A zu sagen und das vollkommen unabhängig vom Gegenstand. Amor fati und Fatalismus sind deutlich voneinander zu trennen. So wundert es nicht, daß das Schicksal des Esels im Tragen, im Er-tragen liegt; er trägt alle Bürde der Welt und sagt sein I-A dazu. Daher ist das Ja des Esels falsch, es ist „ein Ja, das nicht Nein zu sagen weiß“, ein undifferenziertes Ja auch zum Nein. Affirmation heißt aber auch, Nein zum Nein sagen zu können. Oder anders gesagt, das Ja, wenn es affirmativ sein soll, muss ein vorgängiges sein, d.h., daß die Last bejaht werden kann, aber sie muss von vornherein bejaht werden und nicht, nachdem sie, vom jeweiligen Willen unabhängig und unbeeinflussbar, schon aufgebürdet wurde. Dann nämlich handelt es sich nicht um eine Bejahung, nur um eine Bestätigung. Zwar mag der Esel bei Nietzsche Christus bezeichnen, bzw. das, was durch die Paulinische Reform von diesem in jedem Christen übrig blieb, das eigentliche Sinnbild aber stellt die mythologische Figur des Sisyphos dar und kehrt als Absurdes, als absolut Verneinendes und damit als falsch Bejahendes bis heute immer wieder. Das Bild des Sisyphos signifiziert damit nicht nur die falsche Bejahung, sondern auch die falsche ewige Wiederkehr des Gleichen. Für Nietzsche dagegen, und darauf beharrt Deleuze immer wieder, waren die Bejahung und das Tragen, Ertragen, Belasten stets inkommensurable Größen, Denken und „ernst nehmen“, „schwer nehmen“ waren für ihn nie miteinander vereinbar. Statt dessen ist von einer „Konversion des Schweren in Leichtes, des Niedrigen in Hohes, des Leides in Lust“ die Rede, davon, daß Bejahen gerade nicht tragen, sondern ganz im Gegenteil entlasten, erleichtern heißt. Die „ontologische Bejahung“, von der Deleuze einmal sprach, beinhaltete konsequenterweise eine Bejahung des Lebens in seiner Vielfalt und die Bejahung des Vielen in seiner Lebendigkeit, eines „Zuviel an Leben“. So paradox es anfangs klingen mag, aber der Philosoph, der mit dem Hammer philosophiert, der Umwerter aller Werte, plädiert – wohl nur mit Diogenes, dem Ummünzer, zusammen – für etwas, das wie eine Ethik ausschaut, mithin – unausgesprochen – die Logik des Sinns auf den Höhepunkt treibt: „Eine Logik der Bejahung des Vielen, folglich eine Logik der reinen Bejahung, sowie eine Ethik der Freude“. Sie äußert sich, entsprechend der dreifachen Konversion als Tanz, Spiel und Lachen. Allerdings, Nietzsche wies darauf hin, handelt es sich dabei nicht um etwas, was uns, die Menschen, den Menschen primär beträfe, vielmehr ist an den Übermenschen gedacht. Dies ist eine ganz zentrale Aussage: „Dies Element der Bejahung macht das des Übermenschlichen aus – das Element gerade auch, welches dem Menschen, eben und besonders dem höheren Menschen, abgeht. Nietzsche bringt diesen Mangel als eine dem Mensch angeborene Insuffizienz vierfach symbolisch zum Ausdruck: 1. Es gibt Dinge, die zu tun der höhere Mensch außerstande ist: lachen, spielen und tanzen. Lachen heißt, das Leben und, in diesem selbst, das Leiden zu bejahen. Spielen heißt, den Zufall und, in ihm, die Notwendigkeit zu bejahen. Tanzen heißt, das Werden und, in ihm, das Sein zu bejahen…“. (von Jörg Seidel)

Demo 5 (Bern)
Anmerkung:
(1) Kleine Berlin-Abschweifung bis zu dem Zitat von Peter Brückner am Ende, auf das es mir hier gerade ankommt:
„Der Mensch wurde abgeschliffen wie ein Stein im Wasser, unfähig zu Widerstand und eigener Meinung“. (Juri Tynjanow)
Die nachkriegsdeutsche Linke verstand unter Politisierung (der Massen und des Individuums) eine Bewußtmachung der eigenen Lage – ihre Entprivatisierung. Mit dem Alltag sind all jene Lebensbereiche gemeint, von denen aus sich die Menschen in einem Prozeß der Selbstaufklärung verständigen und organisieren. „Ich hatte Depressionen, Arbeitsstörungen, Kontaktschwierigkeiten, war einfach kaputt – und dann plötzlich die Osterdemonstrationen, die neuen Kontakte, die ganze Aktivität im SDS; es war wie eine Befreiung“, so äußerte sich z.B. ein Student 1971. Zu diesem Zeitpunkt war die Politisierung bereits weltweit ein Massenphänomen geworden, fast ein Trend, der dann in der BRD u.a. im Kursbuch 25: „Politisierung: Kritik und Selbstkritik“ analysiert wurde. Die Äußerung des Studenten entstammt daraus. Die nachkriegsdeutschen Anfänge der Politisierung waren vereinzelter und zaghafter, mindestens im Westen.
In einem 1953 veröffentlichten Berlin-Roman „Ring über Ostkreuz“ von Erich Wildberger, in dem es um die Existenzgründungsprobleme einer West-Berliner Baufirma geht, fährt ein frisch verliebtes Pärchen auf ein Grundstück in den Ostteil der Stadt, wo 41 Obstbäume erntereif sind. Um dahin zu gelangen, müssen sie sich mit ihren Fahrrädern fast ranpirschen – und anschließend mit dem Obst ebenso zurück. „In Britz erreichen sie wieder den Westsektor. Sie lächeln sich an. Ein Triumph! Man hat zwar unnötig viel riskiert, aber man hat sich gewehrt, hat der Willkür ein Schnippchen geschlagen.“
Im selben Jahr wurde der (kommunistischen) „Willkür“ für kurze Zeit sogar Einhalt geboten: am 17. Juni 1953 – als während des „mitteldeutschen Aufstands“ allein in Ost-Berlin Zehntausende auf die Straße gingen, um gegen Normerhöhungen der Regierung zu protestieren, die einer Verschlechterung der Arbeits- und Lebensbedingungen gleichkamen. Die Demonstranten zogen zu den Regierungsgebäuden in Mitte, wobei sie immer mehr wurden. Einer der Teilnehmer, Jochen Markmann, erinnert sich, „dass zum Beispiel plötzlich lauter Köche auftauchten, die einfach ihren Küchenherd in irgendeinem Hotel oder Restaurant im Stich gelassen hatten … Der Zug schwoll zu einer enormen Menge an.“ Die kommunistische Regierung musste schließlich von der Roten Armee geschützt werden. In den Jahren vor diesem „Arbeiteraufstand“ hatte es bereits studentische Unruhen – vor allem an der Ost-Berliner Humboldt-Universität – gegeben, die Ende 1948 zur Gründung der Freien Universität im Westen geführt hatten. Auch dort kam es dann immer wieder zu Auseinandersetzungen – wenn z.B. Agitationskollektive der FDJ auf dem Dahlemer Campus auftauchten. Ins Visier der Weststudenten widerum geriet der einst von den Nazis aus der Akademie der Künste ausgeschlossene Karl Hofer, der nach dem Krieg die Hochschule der Künste wiederaufgebaut hatte und ihr Rektor geworden war. Er wurde regelmäßig mit Lebensmittelpaketen aus dem Osten unterstützt und so hieß es in einer studentischen Protestresolution: „Was Hofer für die Russen leistet, zeigen die Pajoks, die er von ihnen erhält…Die Künstler, die sich gleichzeitig vom Westen und vom Osten ernähren lassen, nehmen an Umfang ständig zu.“ Diese Vorwürfe wurden während der fünfzehnmonatigen Berlinblockade 1949 erhoben. Die eher unterernährten Studenten waren der Auffassung, dass Hofer deshalb „zur Erziehung der Jugend völlig ungeeignet“ sei.
1950 wurde West-Berlin von der Bundesregierung zum „notleidenden Gebiet“ erklärt: Es fehlte an Wohnraum, die Hälfte der Bevölkerung lebte noch in unzumutbaren Verhältnissen, die Zahl der Arbeitslosen hatte mit über 300.000 gerade ihren Nachkriegshöhepunkt erreicht und nach wie vor strömten täglich tausende von Flüchtlinge in die Stadt. Dies ist sozusagen der materielle Ausgangspunkt für die Politisierung in den Fünfziger Jahren. Der Publizist Erich Kuby kam 1957 nach einer Recherchetour durch die DDR und die BRD zu dem Schluss, dass es nur im Osten eine politisierte, zu „Unruhen“ fähige, studentische Jugend gäbe: „Westdeutsche Jugend findet politisch nicht statt“. Dies galt auch und erst recht für die in West-Berlin, die er damals noch als „bürgerlich“ und antikommunistisch verhetzt einschätzte.
Dieser Befund sollte sich jedoch bald – nicht zuletzt durch Erich Kubys eigenes Wirken, wofür ihn die FU im Sommersemester 1965 mit einem Haus- und Redeverbot ehrte – geradezu umdrehen: im Maße der antikommunistische Konsens zwischen Staat und (Adenauer- )Regierung einerseits und den Studenten andererseits sich langsam auflöste. Als ein Meilenstein auf dem Weg dahin wird die Ostermarschbewegung angesehen.
Der aus dem Osten geflüchtete spätere Psychologieprofessor und Teilnehmer an dieser Bewegung, Peter Brückner, schreibt – in einem autobiographischen Fragment: „Seit der Wiederbewaffnung der BRD und dem Antrag auf ein Verbot der KPD (1952) greife ich ab und zu wieder nach Marx… Der Protest holt mich einigermaßen aus der Depolitisierung hervor… 1958/59 deutet sich in den Antiatom-Kongressen an der FU Berlin eine Art von Wende an; bildet sich in diesem Sparkassenland ein ‚kollektives Subjekt‘?“
Dies Subjekt der Autopolitisierung entstand im Westen zu dem Zeitpunkt erst zögernd, dann jedoch sich überstürzend, während es im Osten letztlich Objekt (der Partei) blieb. Stattdessen entwickelte sich dort bis zum Mauerbau ein anschwellender Flüchtlingsstrom („Abstimmung mit den Füßen“ genannt), und danach eine vereinzelte Dissidenz, ähnlich der in der Sowjetunion. Formierende Tendenzen von oben kamen aber auch in der BRD – über die westlichen Besatzungsmächte – zum Zuge: „Im bundesdeutschen team-work ist der sales-promoter eine wichtige Figur geworden; er leitet in Gestalt von lay-outs dem managing- Direktor Vorschläge zu, die darauf hinauslaufen, den Standard auf ein level zu heben, der uns bisher unbekannt war…“, schrieb 1957 Erich Kuby über „die Sprache, die der deutsche Michel in knapp sechs Jahren erlernt hat“. Aus den USA kamen dann jedoch im Protest gegen den Vietnamkrieg der Amerikaner auch die Widerstandsformen dagegen. Beginnend mit dem antimilitaristischen und antirassistischen „Free Speech Movement“ an der Universität Berkeley 1964, bis zu den sozialen Erfindungen „Teach- In“, „Sit-In“, „Go-In“ – und, noch immer nicht endend, mit der „Political Correctness“. Hinter dieser alternativen Amerikanisierung, die zugleich eine Antiamerikanisierung war, insofern sie sich gegen die Kriegsführung in Südostasien richtete („USA – SA – SS!“), griff das „kollektive Subjekt“ jedoch vor allem auf russische Erfahrungen und Theorien zurück – und zwar weltweit. In Berlin war die Keimzelle für deren bald massenhafte „Aufarbeitung“ der SDS, und dort insbesondere die Gruppe um die aus dem Osten stammenden Studenten: Rudi Dutschke, Bernd Rabehl und Peter Rambauseck u.a.. Fast könnte man sagen, dass die Studentenbewegung in Deutschland versuchte, bruchlos wieder an dem Punkt anzuknüpfen, von wo aus die Linken 1933 in den Untergrund, ins Exil oder ins Arbeitslager gegangen waren. Alle ihre Debatten und Auseinandersetzungen – seit den Dekabristen und vor allem der Revolution von 1905 – wurden nun noch einmal geführt. Die großen bundesdeutschen Intelligenzverlage Rowohlt, Fischer, Suhrkamp, Hanser, Ullstein … führten geradezu ein Kopf- an Kopf-Rennen mit den linken Raubdruckern um die Neuherausgabe der einstigen Bestseller der Arbeiterbewegung – von den alten Anarchistinnen bis zu den noch fast frischen Stalinisten. Kommunebewegung, Feminismus, psychoanalytische Kindererziehung, sexuelle Befreiung, Antipsychiatrie, Heimerziehungsalternativen, revolutionäre Betriebszellen, illegale Druckereien, Reisekader, Konspiration, Terrorismus, eigene Rauschmittelversorgungswege etc. … All das hatte es bereits in Russland von der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts bis zum ersten Viertel des 20. Jahrhunderts gegeben. Diese Schätze wurden in den Sechziger Jahren nach und nach gehoben – und für die „politische Arbeit“ wieder nutzbar gemacht. Die Studentenbewegung breitete sich wie eine Epidemie aus, sie wurde ideell und materiell vom Osten unterstützt und war ihrerseits mit den „Befreiungsbewegungen der 3.Welt“ solidarisch. So sammelte die im „Deutschen Herbst“ 1977/78 begründete linke „tageszeitung“ z.B. Geld, um „Waffen für El Salvador“ zu kaufen, andere Aktivisten vermachten ihr naziväterliches Millionenerbe dem Vietkong. Der erste getötete Demonstrant – Benno Ohnesorg – vor der Deutschen Oper in Berlin forcierte die allgemeine Politisierung noch einmal. 1968 erfassten die Vietnamproteste und die schwarze Bürgerrechtsbewegung auch die US-Soldaten. In den Streitkräften zirkulierten bald 250 linke Zeitungen, einige auch in Berlin, wo der SDS Deserteuren praktisch half, nach Schweden zu entkommen. Theoretisch drehte sich die Politisierung und Massenmobilisierung vor allem um die Pole „Marx“ und „Freud“.
Während es in Frankreich den Studenten gelang, mit den Arbeitern im Mai 68 einen Generalstreik auszurufen, waren sie im „antikommunistischen Bollwerk“ Westberlin jedoch weit davon entfernt, mit den Arbeitern auch nur ansatzweise eine „Aktionseinheit“ zu bilden. Hier verstärkten die Gewerkschaften eher noch ihre Abgrenzungsbemühungen (u.a. durch Rausschmisse kommunistischer Mitglieder), was zur Folge hatte, dass die Politisierung des Alltags mehr und mehr in eine „Kulturrevolution“ mündete, d.h. sich auf das Milieu der Studenten und Schüler beschränkte. Positiv spiegelte das ihre „Randgruppenstrategie“ wieder, die daneben auch noch Rocker, Heimkinder, Straffällige usw. einbezog. Die Umkrempelung des eigenen Lebens, die in einem sich ausbreitenden Netz von selbstorganisierten, d.h. „alternativen“ Projekten, Läden, Kneipen, Kommunen und Publikationsorganen stattfand, setzte eine kollektive Ich-Suche in Gang, die bisweilen arbeiterfeindliche Töne annahm. In diesem Zusammenhang sei an die damaligen linken Bestseller Lenz von Peter Schneider, Häutungen von Verena Stefan und vor allem an Die Reise von Bernward Vesper erinnert. Für orthodoxe Linke (Marxisten-Leninisten) waren das allerdings alles kleinbürgerliche Fluchtbewegungen. Gleichzeitig wurden die Straßendemonstrationen der APO (Außerparlamentarische Opposition) immer selbstbewusster und militanter, wobei in den anschließenden Diskussionen den Polizeiknüppeln durchaus eine bewusstseinserweiternde, d.h. politisierende Wirkung zugeschrieben wurde. Umgekehrt beharrte jedoch vor allem die CDU/CSU darauf, dass die Polizeiknüppel eher beruhigend, depolitisierend, auf die studentischen Randalierer wirken.
In den Siebziger Jahren spaltete sich „die Bewegung“ immer mehr auf – in Maoisten, Trotzkisten, Anarchosyndikalisten, Illegale (wie die RAF) usw.. Und neben dem Anti-AKW-Protest hatten auch einige spektakuläre „Psychosekten“ regen Zulauf. Erwähnt seien die Bhagwananhänger in Poona und die Wilhelm-Reichanhänger der Wiener Aktions-Analyse-Kommune von Otto Muehl, die beide starke Ableger in Berlin besaßen. Bedeutend unspektakulärer war dagegen die alltägliche „politische Kleinarbeit“ – etwa der SDS-Basisgruppen Moabit und Wedding. Dennoch entstanden daraus einige geradezu exemplarische Biographien: Eine rote Germanistin kam z.B. über die Betriebsagitation dazu, eine Druckerlehre anzufangen, und wurde später Betriebsrätin in einer Großdruckerei. Zuletzt machte man sie zur Vorsitzenden der Berliner IG Medien. Umgekehrt wurde bei einem AEG-Arbeiter in der Basisgruppe Wedding das politische Interesse derart geweckt, dass er es schließlich über diverse Ausbildungsgänge bis zum Vorsitzenden der Berliner IG Metall brachte. Nach der Wiedervereinigung versagte er jedoch: Als die Arbeiter im Osten den Westgewerkschaften quasi ungewollt in den Schoß gefallen waren, dann jedoch eine eigene, branchenübergreifende Betriebsrätebewegung gegen die Abwicklung ihrer Betriebe durch Privatisierung ins Leben gerufen hatten, die bald ebenso wie die des 17.Juni 1953 das Haus der Ministerien belagerte, das nunmehr die Treuhandanstalt beherbergte. Bei diesem Funktionär kann man von einer Depolitisierung durch Karriere reden. Diese wurde Mitte der Siebzigerjahre zu einem sozialdemokratischen Programm der Reintegration, indem ein Dutzend neue Universitäten geschaffen wurde, wo den meisten studentischen Rädelsführern Dozentenstellen winkten. Außerdem wurde das System des Begabtenabiturs derart ausgeweitet, dass sich Tausenden von Jungproletariern plötzlich Aufstiegschancen auftaten. In Westberlin nutzten das vor allem die bereits „anpolitisierten“ Kindergärtnerinnen, Heimerzieherinnen und Krankenschwestern. Gleichzeitig hatte sich hier aber eine neue Arbeitergruppe als „kollektives Subjekt“ gebildet: die Türken – die zunächst in Arbeiterwohnheimen untergekommen waren. Sie zogen in den Siebziger Jahren in die fast nur noch von subproletarischen Kümmerexistenzen bewohnten Kieze Kreuzbergs, Schönebergs und im Wedding. Dadurch wurden sie langsam von Gastarbeitern zu Dauerbewohnern Berlins – gründeten Arbeiterclubs, Solidaritätsvereine und organisierten sich u.a. gegen nationalistische Gruppen wie die Grauen Wölfe, aber auch gegen Benachteiligungen am Arbeitsplatz. Die Gewerkschaften gewöhnten es sich an, Flugblätter auf Türkisch zu verfassen. Bald gab es die ersten türkischen Arbeitnehmersprecher. Noch heute – da die „Betriebsverschlankungen“ längst auch auf Westberlin übergegriffen haben – sagt man: „Jeder gute türkische Betriebsrat war früher ein maoistischer Kurde!“ Zu den ersten türkischen AEG-Arbeiterinnen gehörte Emine Sevgi Özdamar, danach studierte sie Schauspiel in Istanbul. Wieder zurück in Berlin bekam sie 1976 eine Anstellung an der Volksbühne. Fortan lebte sie in West-Berlin und arbeitete in Ost-Berlin. In einem ihrer autobiographischen Romane schreibt sie – rückblickend auf ihre Politisierung als Arbeiterin, die in einem der türkischen Arbeitervereine begann, in denen fast nur Männer saßen und diskutierten, dabei ununterbrochen rauchten und Tee tranken: „Als ich den hinkenden türkischen Sozialisten einmal vor dem Café Steinplatz sah, er überquerte gerade die Straße, sagte ich zu mir, schlaf mit dem hinkenden Sozialisten, er wird dich danach in Ruhe lassen, er hinkt, er ist Sozialist, er wird keine Angst bekommen, dass du ihn zum Heiraten zwingen willst“. Das Café und Kino am Steinplatz in „Charlottengrad“ war eines der Zentren der Studentenbewegung. Spätestens seit dem Bau der Mauer 1961 waren die meisten wohlhabenden Berliner aus Angst vor den Kommunisten nach Westdeutschland ausgewichen. In ihre großen Wohnungen links und rechts des Kurfürstendamms zogen Studenten ein. Berlin lockte damals vor allem solche an, die, wie der Künstler Thomas Kapielski sagte: im Malen eine eins und im Rechnen immer ein fünf hatten. In dem Maße wie die Hausbesitzer ihre zentralen Liegenschaften wieder in den Griff bekamen, wichen die Studenten nach Schöneberg und Kreuzberg aus. Ihre Politisierung hatte sich indes derart auf einige Aspekte des Alltags – nämlich der „behutsamen Stadterneuerung unter ökologischem Vorzeichen“ – beschränkt, dass sie dort mit den Türken aneinander gerieten. In diesen sahen sie bald nur noch „Stoßtrupps der Hausbesitzer“ – zum endgültigen Herunterwohnen der letzten Altbausubstanz. 1980 schrieb die Scene-Zeitung Zitty: „In einem Türkenghetto entscheiden nur noch Justiz und Polizei…Türken raus? Warum nicht. Zumindest einige. Es sei denn, man will den Stadtteil sterben lassen“. Viele Türken ließen nach und nach ihre Familien nachkommen, was die Bezirksregierung von Kreuzberg immer wieder mit „Zuzugssperren“ zu verhindern suchte. Ümit Bayam, den seine Mutter, als er acht Jahre alt war, nach Kreuzberg holte, schrieb 1997 einen Text über seine ersten Erlebnisse dort. Er bekam dafür einen Preis beim SDR-Schreibwettbewerb 40 Jahre Gastarbeiter – Deutschland auf dem Weg zur multikulturellen Gesellschaft? Als Stadtplaner und Mitglied der Bezirksverordnetenversammlung engagiert er sich derzeit im Kreuzberger „Wrangel-Kiez“, wo es gilt, den Bau eines riesigen Einkaufscenters in einem mühsam erkämpften und sich langsam zusammenraufenden Soziotop zu verhindern. In den Siebziger Jahren war es dort noch darum gegangen, so genannte Kahlschlagsanierung und Autobahnbau zu stoppen.
Die Depolitisierung des Alltags, so wie sie einmal von den unbeugsamen Professoren Johannes Agnoli und Peter in ihrem Buch „Die Transformation der Demokratie“, das man auch die „Bibel der APO“ genannt hat, verstanden wurde, besteht vor allem in der „Parlamentarisierung der Linken“, die inzwischen „in den westlichen Ländern zu einer Lebensfrage des Kapitalismus“ geworden sei. Mit den Grünen gelang das auch, obwohl in den Achtziger Jahren die Politik auf der Straße zunächst weiter ging: einmal in der Anti-AKW-Bewegung und zum anderen bei den Hausbesetzern – in den Häuserkämpfen, wobei die Personage einen Wechsel vom Hippietum zum Punk vollzog. Dennoch scheint das kollektive Subjekt dabei nicht mehr auf, sondern geht langsam unter. Bis Ende der Neunzigerjahre die Reprivatisierung nach und nach auch alle Alltagsbereiche erfaßt.
Wir haben somit von 1953 an eine aufsteigende Linie der Politisierung des Alltags, die Arbeit, Familie, Kindererziehung, Sexualität, Künste etc. erfasst, um diese Bereiche zu transformieren – bis 1968. Danach spaltet sich die soziale Bewegung immer mehr auf – in Parteien und Single-Purposes, sie spezialisiert und professionalisiert sich. Mit dem Zerfall der Sowjetunion und der deutschen Wiedervereinigung ist der alternative Impuls endgültig am Ende – bzw. vom System integriert. „Wir machen aus Punk Prunk!“ verspricht z.B. ein Werbeslogan des Kaufhofkonzerns.
Zur Erklärung dieser westlichen Politisierungswelle hat u.a. der Historiker Mathias Mildner ausgeführt, die Schüler- und Studentenbewegung habe ihre materielle Ursache darin gehabt, dass damals zum ersten Mal eine noch junge Generation schon über eine erhebliche Kaufkraft verfügte – und dafür eine eigene „Kultur“ einforderte, die sie sich erst einmal erkämpfen musste. Die Rockmusik z.B. war bis in die Sechzigerjahre noch weitgehend verboten – heute dudelt sie auf allen Kanälen von morgens bis abends und überall. Sie ist zu einer akustischen Umweltverschmutzung geworden. Deswegen kann von einem Scheitern nicht die Rede sein. Ähnliches gilt für viele linke „Ansätze“, die sich durchgesetzt haben, nur dass sie jetzt eben von anderen Leuten vertreten werden. „Wir waren anfangs etwa 12 Leute im SDS – und jetzt sind wir wieder genauso viele: fast noch die selben,“ so sagte es der West-Berliner Widerstandsforscher Hans-Dieter Heilmann 1999 – selber verblüfft. In Restaurationszeiten, da wieder von Generationen, Rassen, Religionen und Nationen die Rede ist, wächst zunächst die rechte Bewegung. Ob man bei ihr von einer Politisierung des Alltags, als Basisimpuls, reden kann, vermag ich nicht zu sagen. Auf alle Fälle hat sie bereits etliche Gefängnisse umgekrempelt, d.h. dass die Neonazis das Klima der Auseinandersetzungen dort mittlerweile bestimmen. Körpertraining, nationalistisch-rassistische Entmischung und Kommunikationslosigkeit lassen die Ostler in den Westgefängnissen inzwischen sogar von ihren alten DDR-Knästen schwärmen – wie eine Studie über die Justizvollzugsanstalt Berlin-Tegel von Hans-Joachim Neubauer gerade nahe legte. Statt der in den Siebziger Jahren in Westberlin wiedergegründeten „Roten Hilfe“ gibt es dort jetzt eine „Braune“. Und statt der selbstorganisierten linken „Release“-Vereine haben die Drogensüchtigen fast nur noch den totalitären Synanon-Verein als Anlaufstelle, der sich mit ganz viel „Staatsknete“ zu einem regelrechten Umerziehungskonzern entwickelte . Für entlaufene Heimkinder gab es ab den Siebziger Jahren im Wedding die „Werkschule“, in der das Kollektiv der Jugendlichen und Erzieher sich ihre eigenen (einstmals besetzten) Häuser herrichtete und eine neue Form von Schulunterricht erfand. Alle bekamen das selbe „Taschengeld“ und jeder hatte auf Vollversammlungen eine Stimme. Heute betreibt eine grüne Kiezsanierungsfirma dieses Geschäft im großen Stil und auf ABM-Basis im Osten: Es werden Häuser gekauft, saniert und dann für „betreutes Wohnen“ hergerichtet, wozu man noch Ausbildungsmöglichkeiten, vor allem an Computern, anbietet.
Es wäre zu viel verlangt, in dieser Situation wieder auf Russland zu hoffen, wo man noch verwirrter zu sein scheint. Immerhin kommen jetzt jede Menge Russen nach Berlin, es ist fast ein Exodus der letzten sowjetischen Intelligenz. Ironischerweise gerade wegen des depolitisierten Alltags hierzulande. „Das war ein befreiender Akt und ein Erfolg,“ schrieb Peter Brückner einst – über seinen ersten lukrativen Job im Westen, „dass der Entschluss befreiend war, dass mich das Geld politisiert hat (und nicht, wie die jungen Generationen, die Sexualität), hat eine Moral. Es gibt Zustände – individuelle wie gesellschaftliche – in denen einzig ein Stück Ruchlosigkeit produktiv ist, und wo die ‚individuelle Interessen- Orientiertheit‘ viel weniger sozial integriert als Armut, Sozialarbeit, Tugend.“

Demo 6 (Moskau)
Die Photos wurden deswegen gewählt, weil sie ein Paradox zeigen: Demonstration heißt, (sich) zeigen, aber die Demonstranten zeigen hier dabei noch einmal – quasi extra – auf etwas.
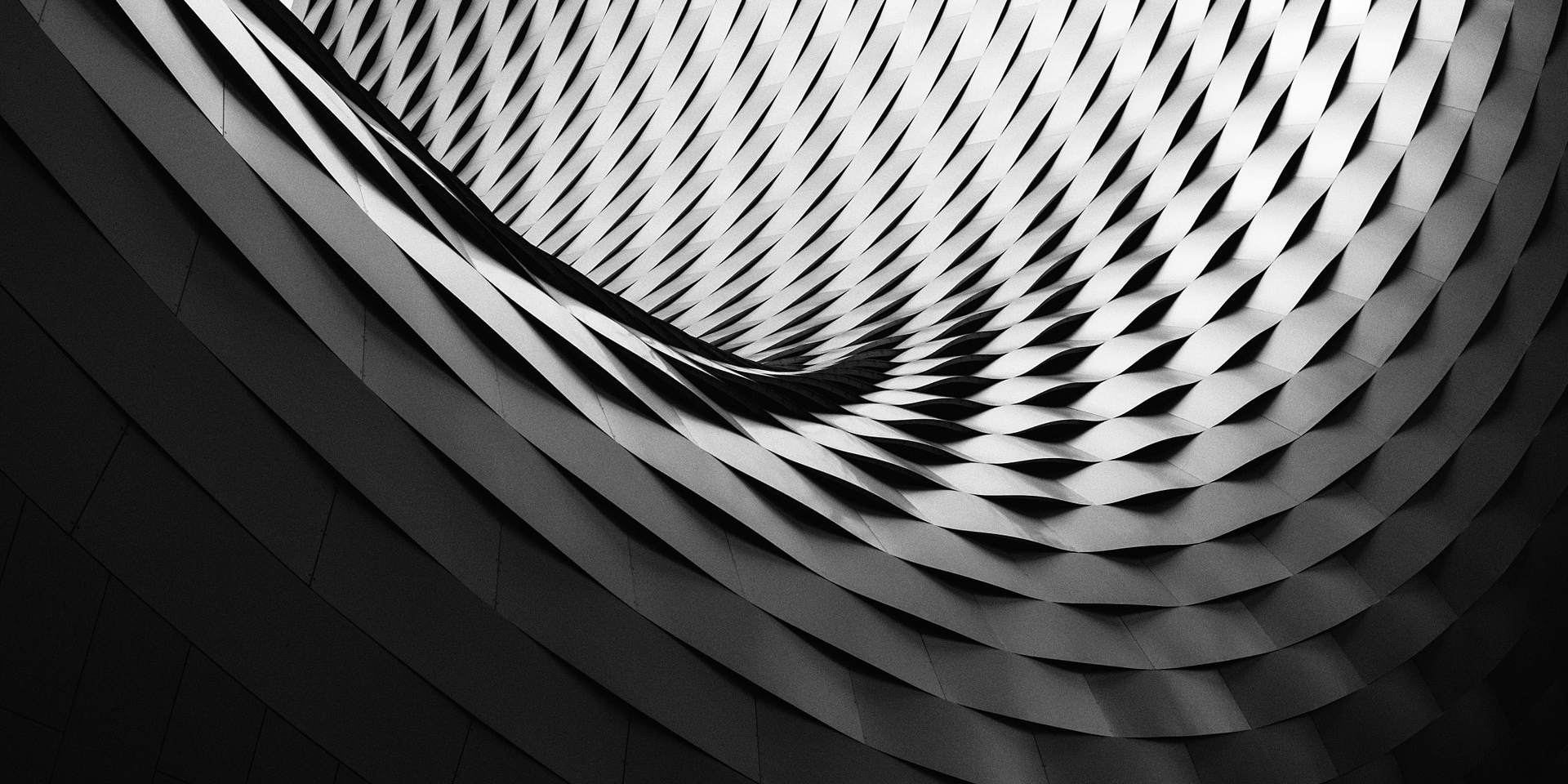



Es geht um die Herstellung einer immer größeren Heterogenität – durch Integration des „Anderen“, durch Bündnisse mit Anderen….
Das haben auch einige Nilpferde begriffen, die man durch Gefangennahme zur Gruppen-Homogenität zwang:
Berlin – Die Nilpferde im Berliner Zoo haben gefiederte Mitbewohner bekommen: Sechs kleine Enten wohnen seit Jahresbeginn im Flusspferdhaus und machen es sich auf dem Rücken der Dickhäuter bequem.
Wie der Zoo berichtete, hatten die Neuzugänge zunächst „Angst, verschluckt zu werden“. Dann erkannten die Winzlinge jedoch die
Vorteile der gutmütigen Riesen: Wenn die Tauchenten vom Schwimmen erschöpft sind, ruhen sie sich auf dem Rücken der Nilpferde aus.
Die Nilpferde seien „geduldige Entenfreunde“, berichtete der Zoo. Seit 1998 haben sie regelmäßig Gänse zu Gast.