1789 kamen die Professoren und Kuratoren des königlichen Tierparks – Jardin du Roi – in Paris der Forderung der Französischen Revolutionäre, ihn zu schließen, zuvor, indem sie sich blitzschnell “demokratisch” umstrukturierten. Auch dem Junktim des Konvents, dass der Zoo nur erhalten bleibe, wenn der Löwe darin nicht länger als “König der Tiere” gelte, kamen sie sogleich nach.
Claude Lévy-Strauss meinte: Wenn er einmal zauberhafterweise einen Wunsch frei hätte, würde er gerne mit einem Tier sprechen können. Schon der Pariser Kardinal Melchior de Polignac sagte fast flehentlich, als er den im Jardin du Roi ausgestellten lebenden Orang-Utan sah: “Sprich – und ich taufe Dich!” Ludwig Wittgenstein gab demgegenüber zu bedenken: “Wenn ein Löwe sprechen könnte, wir könnten ihn nicht verstehen.”

Betrifft: „Von Natur aus böse“
taz-Artikel von Margarete Stokowski
– Ein Leserbrief dazu:
Hallo Frau Stokowski,
Ihre kolumne hat mich überrascht. Negativ überrascht,
normalerweise mag ich Ihre texte. Könnten Sie eventuell
beim nächsten mal, wenn ein text nicht funktioniert,
diesen einfach trotzdem einreichen und darauf verzichten,
a) sich eine schwächere person als objekt für frustabbau
zu suchen und b) darüber dann auch noch zu schreiben?
Das würde einen gewinn bedeuten, weil:
Zunächst eine vorfrage zum kontext Ihres tierrechtlichen
engagements: Sind Sie vegetarierin bzw. ausschließlich
Neulandfleisch-esserin? Wenn eins davon, okay. Wenn keins
davon: Klappe halten. Zum eigentlichen inhalt: Dem
eindeutig asozialen verhalten des kindes einem schwächeren
objekt, nämlich einem tier gegenüber, begegnen Sie, indem
Sie was tun? Genau, das, was kindern (= kleineren,
schwächeren) gegenüber immer hilft: Physische überlegenheit
ausnutzen, körperliche integrität des anderen mißachten,
ebenso den anspruch auf ein mindestmaß an respekt auf
augenhöhe ignorieren, indem Sie das kind beleidigend
abkanzeln und ihm ein massiv würdeverletzendes verhalten
androhen. Damit unterschreiten Sie auf anhieb das niveau,
das die anderen kinder in ihren reaktionen an den tag
legen: ?Das ist ein Lebewesen.? = hinweis auf empathie
unter gleichen, nämlich leidensfähigen wesen. Anders herum,
als kleine illustration: Wenn ich Sie hier als ?scheiß
journalistin? bezeichnen würde, würde dies vermutlich und
mit recht gelöscht und in die kategorie: ?Im netz verlieren
die leute alle hemmungen.? eingeordnet werden. Kindern
gegenüber geht sowas jedoch auch direkt, von angesicht zu
angesicht. Da haben viele menschen einfach gar keine
hemmungen, da darf die verbalaggression ganz unverblümt
ausgelebt werden.
Weiter: Wie würden Sie es denn finden, wenn eine physisch
überlegene, deutlich größere person Sie an beiden armen
festhielte? Ich glaube nicht, daß Sie es als lappalie
einstufen würden oder daß Sie überlegen würden, ob die
person vielleicht einen grund dazu hat. Sie würden sich
vermutlich, und mit recht, aufregen.
?Aber der junge hat es doch verdient!? Na klar. Weil er
seine mißachtung schwächeren gegenüber bestimmt dadurch
erlernt hat, daß ihm im alltag mit einem übermaß an
respekt und empathie für ihn als individuum begegnet wird.
Eine tracht prügel wäre ähnlich hilfreich.
Über das alles, also über diese 100 punkte in der
doppel-kategorie ?fieser und gleichzeitig peinlicher
machtmissbrauch?, schreiben Sie auch noch, ohne den
hauch einer kritischen reflexion, sondern stellen es
quasi als zivilcourage dar?! Ich glaub‘, es hackt! Und
hätte tatsächlich nicht übel lust, Sie anzuzeigen
(beleidigung, evt. auch körperverletzung) ? allein um
deutlich zu machen, daß es fast immer noch eine andere
pseudo-autorität gibt, die noch mehr machtmittel in der
hand hat, und der es selbstgefällige freude bereitet,
andere zu maßregeln. Ich unterlasse es nur deswegen, weil
der linke Knigge in meinem hirn mir ?Das gehört sich
nicht. Du bist nicht selbst betroffen. Das ist
blockwartsmentalität? zuflüstert.
Zu guter letzt der hinweis auf Ihre nachgedanken, ob Sie
überhaupt kinder haben wollen. Sollte diese überlegung
als extrem durchgehen? So im sinne von: ?Wenn eine frau
ihre natürliche vorsehung/ihr biologisches recht auf
mutterschaft in zweifel zieht, dann liegt wirklich was
im argen?? Ich bin mir nicht sicher, aber vermute doch
ganz stark, daß die frage, ob kinder wohl das richtige
wären, von sehr vielen erwachsenen geteilt und dabei nicht
unbedingt immer als empörend empfunden wird. Das alles
empfinde ich als ziemlich ärgerlich und, in dem aspekt des
machtmissbrauchs in der erwachsenen-kind-hierarchie, auch
wirklich erbärmlich. Können Sie das nachvollziehen?
Mit vorzüglichen grüßen,
Ulrike Müller

Der hier kritisierte Artikel erschien in der taz am 22.5.2012:
Von Natur aus Böse
Ich verzweifle am Schreibtisch. Der Text, den ich schreiben will, funktioniert einfach nicht. Stefan sagt, komm, wir gehen spazieren. Er zieht mich raus in die Hasenheide. Gleich am Eingang ist dieses sogenannte Streichelgehege mit ein paar Ziegen und Schafen, die viel zu wenig Platz haben. Da gehen wir hin.
Am Zaun hängt ein Schild „Bitte die Tiere nicht füttern“. Neben uns stehen fünf oder sechs Kinder und werfen packungsweise Toastbrot ins Gehege. Manche halten den Tieren ein Stück hin, und wenn dann ein Schaf den Kopf danach streckt, ziehen sie das Brot wieder weg und lachen dreckig. Der dickste Junge von allen macht das auch, und während das Schaf versucht, an das Brot zu kommen, spuckt er ihm ins Fell, immer wieder. Als das Schaf den Kopf durch den Zaun steckt, tritt der Junge dagegen. Wirklich. Er tritt mit seinen stinkenden Sportschuhfüßen dem armen Schaf gegen den Kopf. Das Schaf blökt und humpelt dann verstört in die hintere Ecke. Ein anderer Junge ruft: „Ey, das darf man nicht, das sind Lebewesen!“, und ein Mädchen fängt an zu weinen. Der dicke Junge sagt: „Na und?“, und spuckt eine Ziege an. Ich hocke mich zu ihm runter, halte ihn an beiden Armen fest und sage ganz langsam: „Du kleines, gemeines, fettes Scheißkind. Wenn du noch einmal eines von diesen Tieren bespuckst oder trittst, werde ich dich genau hier an diesem Zaun festbinden, und dann dürfen alle Ziegen und Schafe dir einmal so richtig fies ins Gesicht pinkeln, möchtest du das?“
Der Junge guckt mich an, die anderen Kinder stehen auch da und hören zu. Er hat höchstens die Hälfte verstanden, aber er schüttelt den Kopf und sagt: „Nein, ey, okay, Mann.“ Ich bleibe noch ein paar Minuten da stehen und gucke den Kindern zu, sie füttern jetzt weiter, aber ruhiger. Dann gehe ich mit Stefan weiter und sage: „Ich weiß nicht, ob ich jemals – jemals! – Kinder will.“
MARGARETE STOKOWSKI

Zur jüngsten Novellierung des Tierschutzgesetzes
„Wenn irgendeine hinfällige, lungensüchtige Kunstreiterin in der Manege auf schwankendem Pferd vor einem unermüdlichen Publikum vom peitschenschwingenden erbarmungslosen Chef monatelang ohne Unterbrechung im Kreise rundum getrieben würde, auf dem Pferde schwirrend, Küsse werfend, in der Taille sich wiegend, und wenn dieses Spiel unter dem nichtaussetzenden Brausen des Orchesters und der Ventilatoren in die immerfort weiter sich öffnende graue Zukunft sich fortsetzte, begleitet vom vergehenden und neu anschwellenden Beifallsklatschen der Hände, die eigentlich Dampfhämmer sind – vielleicht eilte dann ein junger Galeriebesucher die lange Treppe durch alle Ränge hinab, stürzte in die Manege, rief das: Halt! durch die Fanfaren des immer sich anpassenden Orchesters.“ So lautet der erste Satz in Kafkas Erzählung „Auf der Galerie“.
Der zweite ist noch länger: „Da es aber nicht so ist; eine schöne Dame, weiß und rot, hereinfliegt, zwischen den Vorhängen, welche die stolzen Livrierten vor ihr öffnen; der Direktor, hingebungsvoll ihre Augen suchend, in Tierhaltung ihr entgegenatmet; vorsorglich sie auf den Apfelschimmel hebt, als wäre sie seine über alles geliebte Enkelin, die sich auf gefährliche Fahrt begibt; sich nicht entschließen kann, das Peitschenzeichen zu geben; schließlich in Selbstüberwindung es knallend gibt; neben dem Pferde mit offenem Munde einherläuft; die Sprünge der Reiterin scharfen Blickes verfolgt; ihre Kunstfertigkeit kaum begreifen kann; mit englischen Ausrufen zu warnen versucht; die reifenhaltenden Reitknechte wütend zu peinlichster Achtsamkeit ermahnt; vor dem großen Salto mortale das Orchester mit aufgehobenen Händen beschwört, es möge schweigen; schließlich die Kleine vom zitternden Pferde hebt, auf beide Backen küßt und keine Huldigung des Publikums für genügend erachtet; während sie selbst, von ihm gestützt, hoch auf den Fußspitzen, vom Staub umweht, mit ausgebreiteten Armen, zurückgelehntem Köpfchen ihr Glück mit dem ganzen Zirkus teilen will – da dies so ist, legt der Galeriebesucher das Gesicht auf die Brüstung und, im Schlußmarsch wie in einem schweren Traum versinkend, weint er, ohne es zu wissen.“

Und damit ist Kafkas Zirkus-Geschichte, die eine ganze Geschichte des Kulturbetriebs beinhaltet, auch schon zu Ende. Soll heißen: Ein Ende ist nicht in Sicht. Im Gegenteil: der Kulturbetrieb wird immer ausgedehnter – und härter: proletarischer – oder soll man sagen: postproletarischer? Wir haben es hier mit der Illusion von leidenschaftlicher, d.h. nicht-entfremdeter Arbeit zu tun, weswegen die halbwegs gebildete Jugend in den postindustrialisierten Ländern auf die stereotype Frage, was sie denn mal werden will, immer öfter „Irgendwas mit Medien“ sagt. Es gibt schon private Medien-Lehranstalten, die mit diesem Spruch – aus einem hübschen Studentinnenmund – werben. Aber auch die Jungs zieht es heute eher zum „Techno“ als zum Technikberuf. An der Bergbau-Universität Freiberg stellen die Studenten aus dem stahlinistischen Russland inzwischen über 50 Prozent. Es macht sich unter den jungen Deutschen überhaupt eine zunehmende Abneigung gegenüber naturwissenschaftlich-technischen Fächern bemerkbar. So wurden zum Beispiel auf einer Bildungsmesse in Eisenhüttenstadt (!) 50 Lehrstellen für den Beruf des „Mechatronikers“ angeboten – aber es fand sich kein einziger Bewerber mit einer besseren Mathematiknote als einer Vier, was Voraussetzung dafür war. Dieser eigentlich für die heutige Projektemacher-Periode passgerechte Hybrid-Beruf – aus (KFZ-)Mechaniker und (Spaceship-)Elektroniker – muß erst noch anständig beworben werden. Die von VW quasifeindlich übernommene tschechische KFZ-Fabrik „Skoda“ bezeichnete schon mal ihre Automarke „Citigo“ als „Das neue Kommunikations-Tool“.
Wer es aber nicht schafft, aus seinen diversifizierten Kommunikations-„Neigungen“ einen lukrativen Kreativberuf zu machen, der kann später – wenigstens in der Kulturhauptstadt Berlin – immerhin noch an einer Weiterbildungsmaßnahme teilnehmen, mit der Hartz-IVler zu „Kunst und Galerie-Assistenten“ umgeschult werden. Früher war das so etwas wie der Verkäufer eines Einzelhändlers bzw. die Sekretärin eines Geschäftsmannes. Man wird den Verdacht nicht los, dass es immer noch die alten kapitalistischen Scheißberufe sind – nur in neue Kreativität nun eingewickelt. Dafür spricht, dass „Kaiser’s“ jüngst bereits „kreative und innovative Fleischfachverkäufer/innen“ suchte.
Zurück zum (kafkaesken) Zirkus: Diesem wurde nun mit dem novellierten Tierschutzgesetz verboten, zwar weiterhin Kunstreiterinnen, aber keine Wildtiere mehr durch die Manege zu treiben. Zwar galten deren an vielen Orte präsentierte Dressurakte immer als der Immobilisierung der Tiere in Zoos überlegen, so wie man auch Strafgefangene zu ihrem eigenen Besten mit leichter Arbeit beschäftigt, aber – wie die Süddeutsche Zeitung erklärt: „Je genauer man die Zirkustiere wissenschaftlich beobachtete, desto unvermeidlicher traten alle ihre Leiden hervor.“
So – kafkaartig – gesehen basierte unsere Zirkusleidenschaft, die wesentlich vom Wildtiergeruch angefacht war, auf bloße Ignoranz. Dabei hielt es schon der Auschwitz-Häftling Primo Levy für das höchste humanistische Gebot, „Nicht weg zu sehen!“ Das Zirkuswildtier-Verbot geschah dann auch laut SZ-Rezensent allein wegen „unseres guten Gewissens“ – nicht aus „Sorge um die Tiere“, geschweige denn die Zirkusbetreiber.

P.S.:
Die FAZ nahm sich am selben Tag (24.Mai), an der gleichen Stelle und ähnlich groß aufgemacht statt des Wildtierverbots des in Berlin drohenden Gaslicht-Verbots an, wobei der FAZ-Rezensent zu einem ähnlich wehmütigen Ergebnis kam wie der SZ-Rezensent: In Berlin gibt es – inzwischen einzig auf der Welt – noch 44.000 Gaslaternen, die der Senat aus finanziellen Gründen durch elektrische Peitschenlampen ersetzen lassen will. Für den FAZ-Rezensenten ist es dagegen „an der Zeit, dass die öffentliche Hand sich darauf besinnt, nicht nur für sicheres, sondern auch für schönes, mithin aufklärerisches und aufgeklärtes Licht zu sorgen.“ Also die Gaslampen hegt und pflegt. Diese schillernd-schillerische Mahnung an die Politik bleibt jedoch in ihrem Ästhetizismus („die evidente Schönheit des Gaslichts“) borniert, denn unter Garantie steckt hinter dem Gaslicht-Verbot der Siemens/Osram-Konzern, der sich bereits sämtliche Berliner Ampeln und elektronischen Verkehrsanzeiger unter den Nagel gerissen hat – um sie in seinem Sinne zu „modernisieren“. Zuvor hatte Siemens es zusammen mit Philips bereits im sogenannten Komitologie-Ausschuß der EU für Beleuchtung geschafft, am Parlament vorbei ein allgemeines Glühbirnenverbot durchzusetzen – zugunsten ihrer elektronischen Energiesparlampen. Da die beiden Konzerne in diesem EU-Gremium Greenpeace auf ihrer Seite hatten, darf man fragen, ob und wenn ja was sie der Umweltschutzorganisation dafür „zahlten“. Man erinnert sich noch, dass Siemens zum finanzstarken Förderkreis von „Transparency International“ gehörte, einer Organisation, die sich weltweit für korruptionsfreie Wirtschaftsbereiche einsetzt. Erst als die Bestechungspraktiken des Elektrokonzerns aufflogen, ebenfalls nahezu weltweit, trennten sich die beiden „Partner“.
Vielleicht kann man sogar zu Recht vermuten, dass hinter dem Zirkus-Wildtierverbot die vereinigten Zoos stehen, die mehr und mehr gezwungen werden, kommerziell zu denken. Wer nun Wildtiere sehen will, der muß sich fürderhin in den Zoologischen Gärten mit bis zur Verblödung gelangweilten Löwen, Panthern, Eisbären und Wölfen hinter Wassergräben begnügen. Die Lobby der „ortsfesten“ Tierschausteller argumentierte laut SZ-Rezensent: „In den Zoos sind die Architektur der Gehege wie die Requisiten der Hygiene dem Anspruch verpflichtet, das Zurschaustellen ‚tiergerecht‘ zu reformieren.“ Das ist ein den wissenschaftlichen Erkenntnissen folgender nie erreichbarer Anspruch, dem jedoch erst recht nicht umherziehende Zirkusunternehmen gerecht werden können. Die Novelle des Tierschutzgesetzes folgt damit nur dem Tierschutzgedanken in der Schweiz, wo es inzwischen z.B. verboten ist, Herdentiere allein in Gefangenschaft zu halten – das gilt selbst für Meerschweinchen. Derzeit wird dort sogar schon an Individualrechten für Pflanzen gearbeitet. Nötig wären sie! Die Blumen- und Gemüsepflanzen aus aller Welt, die immer „preiswerter“ in Super- und Gartenmärkten angeboten werden, müssen sich eine zunehmend verschwenderischere und gedankenlosere Vernutzung gefallen lassen. Insofern geht auch das novellierte Tierschutzgesetz, das zukünftig das Brandmarken von Fohlen und das betäubungslose Kastrieren von Ferkeln ebenso wie die Wildtierhaltung im Zirkus verbietet, noch längst nicht weit genug.

Selbst bei einer gelungenen „artgerechten“ Haltung von Nutztieren bliebe das Problem bestehen: „Wir streicheln und wir essen sie,“ wie die Süddeutsche Zeitung am Tag zuvor (23.Mai) titelte. Es handelte sich dabei um eine Rezension des gleichnamigen Buches von Hal Herzog, der darin „unser paradoxes Verhältnis zu Tieren“ thematisiert. Der US-Autor hat das „Paradox“ auf angloamerikanisch-pragmatische Weise für sich so gelöst: „Ich habe folgende Regel,“ sagt er, „Wenn ich draußen bin und von einer Bremse gestochen werde, darf ich sie totschlagen. Aber wenn die Bremse zu mir ins Haus fliegt, muß ich sie retten und nach draußen bringen.“ Herzog hat damit bloß die frühorientalische Blutrache zusammen mit der dortigen Gastfreundschaft auf Tiere übertragen. Neben der SZ-Rezension seines Buches findet sich ein langer Artikel von einem schriftstellernden Hobbygärtner „Über das Töten niederer Tiere“ – gemeint sind vor allem die Nacktschnecken und Hausschnecken in seinem Nutzgarten, die er täglich zu Dutzenden mit einer Schere tötet.
„Anders als die Schneckenkornstreuer habe ich die Wesen, die ich um ihr Leben bringe, inzwischen recht gut kennengelernt,“ schreibt er – nicht unstolz. Man darf bezweifeln, das er als Jäger von Schnecken viel über diese Tiere herausbekommen hat: Bereits der Zürcher Zoodirektor Heini Hediger war sich sicher, dass die Jäger wenig zum Wissen über die Tiere, die sie jagen, beitragen. In einem Text über Kaninchen schrieb er: “Das Freileben dieser interessanten Nager ist erst in den letzten Jahren erforscht worden. Auch hier hat es sich gezeigt, dass das Jagen im Grunde wenig Gelegenheit zum Beobachten bietet, die Kaninchenjagd schon gar keine. Ein Schuß, selbst ein Meisterschuß, ist eben niemals Beginn, sondern stets das Ende einer allzu kurzen und meist nicht sehr vielsagenden Beobachtung.”
Was das Wissen über die Schnecken betrifft, auf die es der SZ-Autor abgesehen hat, dazu gibt es seit kurzem den Bericht einer US-Psychologin, Elisabeth Tova Bailey: „Das Geräusch einer Schnecke beim Essen“. Die in einem Bauernhaus lebende Autorin litt an einer Virenerkrankung, die sie mehrere Jahre lang ans Bett fesselte, nur eine Hausschnecke leistete ihr – erst in einem Blumentopf, dann in einem Terrarium neben dem Bett – während dieser Zeit Gesellschaft. Umgekehrt war Elisabeth Tova Bailey ihr eine äußerst fürsorgliche „Gastgeberin“, und aufmerksame Beobachterin, die sich zudem gründlich in die wissenschaftliche Literatur der Gastropoden einarbeitete und dann sogar mit einigen angesehenen Schneckenforschern korrespondierte.
Ihr Buch, das schließlich dabei herauskam, folgt im Stil dem US-Wissenschaftsjournalismus, d.h. Auf eigene liebhaberische Beobachtungen folgen jeweils einige Zusammenfassungen professioneller Forschungsberichte. Man findet diesen Stil bei feministischen amerikanischen Affenforscherinnen ebenso wie z.B. im Buch „Was denkt der Hund?“ der US-Pschologin Alexandra Horowitz und in den leidenschaftlichen Hundetexten der Biologin Donna Haraway: „When Species Meet“ sowie „The Companian Species Manifesto“.
Zurück zum SZ-Autor Georg Klein, der zwar auch eine „bestürzend deutliche Individualität dieser niederen Tiere“ registrierte – während er sie bejagte, dessen Schneckenwissen aber doch weit hinter beispielsweise dem von Alfred Brehm zurückfällt, der ebenfalls ein Jäger war. Dieser beobachtete jedoch die Tiere sehr viel genauer – bevor er sie erschoß. Dazu arbeitete er die ganze Literatur über sie durch. Im Falle der Schnecken bis hin zu der von Goethe. Er mußte dann allerdings in seinem diesbezüglichen Kapitel ebenfalls konstatieren: „Daß die Schnecke ein Gesicht hat, ist richtig.“ Neuerdings haben zwei kanadische Kulturpsychologen, Matthew Ruby und Steven Heine, untersucht, was es mit dem „Gesicht“ der Tiere, die wir töten, eigentlich auf sich hat. Dabei fanden sie laut FAZ (vom 9.Mai) vor allem Nützliches für die „Strategen von Tierschutzverbänden“ heraus: Nach Befragung von jeweils über 60 Kanadiern, Amerikanern, Hong-Kong-Chinesen und Indern, welches Tier sie essen würden und welches nicht, kam heraus: „Die Menschen scheint die Frage, ob sie andere intelligente Lebewesen essen, am meisten zu beschäftigen.“
Daneben spielte auch ein niedliches Gesicht bei Tieren eine Rolle, wobei jedoch die Auswahl der Tiere als Lebensmittel bei den eher kollektiv denkenden Indern und Chinesen mehr von ihrer jeweiligen Peer-Group beeinflußt wurde als bei den individualistischeren Amerikanern und Kanadiern. Zuvor hatten die beiden Kulturpsychologen eine Studie veröffentlicht, mit der sie belegten, dass Frauen, denen man unterschiedliche Dating-Profile vorlegte, Männer, die Vegetarier waren, als weniger maskulin einschätzten. In Deutschland und Israel leben inzwischen knapp 9 Prozent und in Indien 40 Prozent der Bevölkerung vegetarisch.
In der Mediengesellschaft, wie wir sie heute haben, sollte man jedoch auch noch einen anderen tierschützerischen Aspekt dagegen halten, den der Tierfilmer Horst Stern bereits 1973 selbstkritisch zu bedenken gab – nachdem er berichtet hatte, dass er einmal zwei unter Naturschutz stehenden Kolkraben erwarb: „Ich konnte dabei nicht wirklich wissenschaftliche Zwecke für mich in Anspruch nehmen, vielmehr nur meine tiernärrische Neugier auf diese sagenhaften klugen Vögel. Wie ich denn überhaupt sagen muß, dass nicht selten passionierte Tierfreunde, insbesondere Tierfotografen, mehr Schaden in der Tierwelt anrichten als dass ihre Beobachtungen und Bilder ihr nützen.“ Wenn Tierfotografen und -filmer die schlimmsten Tierschänder sind, wie Horst Stern, der es wissen muß, meint, dann ist es in diesem Fall gerade das massenhafte Hingucken – auf Tieraufnahmen im Buch, im Fernsehen und auf der Leinwand, das die Tierwelt gefährdet.

Auf dem taz-Kongreß 2012 „Das gute Leben“ gab es auch einen Workshop, in dem es um diese Fragen ging. Die in der Lüneburger Heide lebende Schafzüchterin und Tierschützerin Hilal Sezgin behauptete dort, sie würde keine Tiere essen, nur Pflanzen, weil die kein „Gefühl“ hätten. Sie bekam heftige Kritik aus dem Publikum für dieses Abtun der Flora als gefühllos. Das entspräche schon lange nicht mehr dem Forschungsstand, wie u.a. ein sowjetischer Laborfilm bewies, der zur gleichen Zeit wie der Workshop im Haus der Kulturen der Welt gezeigt wurde. Eine eher vermittelnde Position nahm dort der Schweizer Tierrechtsexperte Antoine F.Goetschel ein. Der Autor des Buches „Tiere klagen an“ meinte, er sähe das alles nicht so eng, so würde er z.B. nach wie vor Lederschuhe tragen, jedoch nur gute – solche, die mindestens 15 Jahre halten. Auf dieses reduktionistische Qualitätsargument verfallen derzeit auch viele Autoren, die der Tierschutzgedanke bis zu einem persönlichen Vegetarismus und darüberhinaus treibt.
Zum Beispiel Karen Duves, die 2010 ein vielbesprochenes Buch über das Essen veröffentlichte. Zu jeder Rezension wurde ein Photo der Autorin mit einem Huhn auf dem Arm abgedruckt. Die Hamburgerin wohnt in Brandenburg auf dem Land. Sie ist Veganerin und als Tierschützerin mit der Kamera unterwegs, ihr Buch heißt “Anständig essen” und folgt auf das Buch “Tiere essen” von Jonathan Foer, mit dem zusammen Karen Duve dann einige Lesungen bestritt. “Anständig essen” ist quasi das Buch zum Film “Dioxin-Skandal” – und das auch noch rechtzeitig zur “bisher größten” Lebensmittel-Demonstration anläßlich der Grünen Woche 2010. Die Autorin berichtet darin über die Schandtaten der Agrarindustrie und ihre eigenen Essensexperimente: Sie ernährte sich biologisch, vegetarisch, vegan und frutarisch (für die Frutarier ist sogar das Ausreißen einer noch lebenden Mohrrübe Mord).
Das Huhn auf dem Arm der Autorin hat einen Namen: Rudi. Der Berliner Zeitung verriet sie, dass es einer “Befreiungsaktion” aus der überbelegten Halle eines Biohofs entstammt. Und das ihr, indem sie das Essen mit Moral verband, jeder “Hackbraten zu Quälfleisch” wurde.
Ähnlich radikal – jedoch in bezug auf Pflanzen – denken die Wissenschaftler im Berliner Botanischen Garten: Als ich dort einen ihrer Sprecher interviewte, fragte ich zwischendurch, ob ich rauchen dürfe, was mir erlaubt wurde. Als ich daraufhin meinem Gesprächspartner auch eine Zigarette anbot, lehnte er jedoch heftig ab – mit der Begründung: „Nein, also Pflanzen verbrennen, das kann ich nicht, können wir hier alle nicht.“
Ein solche florafreundliche Einstellung dürfte selbst in der beim Pflanzenschutz vorne liegenden Schweiz selten sein. Wobei die Berliner Botaniker in ihrer Ernährungsnot wahrscheinlich gnadenlose Tieresser sind: „Fleisch ist mein Gemüse“, könnten sie auch sagen. Es mehren sich derzeit vor allem Bücher und Pamphlete, die das Problem „Tiere aufessen oder streicheln“, wie der Workshop auf dem taz-Kongreß hieß, thematisieren. Erwähnt seien außer den bereits genannten: „Fleisch essen,. Tiere lieben. Wo Vegetarier sich irren und was Fleischesser besser machen können“ von Theresa Bäuerlein sowie „Wir haben es satt! Warum Tiere keine Lebensmittel sind“ von Iris Radisch und Eberhard Rathgeb. Iris Radisch ist Redakteurin der „Zeit“, in der sie regelmäßig über die Fortschritte der Vegetarierbewegung berichtet. Schließlich sei noch das Buch „Der Verrat des Menschen an den Tieren“ von Helmut F. Kaplan erwähnt. All diese Autoren sind mehr oder weniger auch tierschützerisch aktiv. Ihnen kommt von anderer Seite ein hierzulande neuer Zweig der Kulturwissenschaft entgegen: Die „Animal-Studies“. Auch in diesem aus Amerika über uns gekommenen Forschungsbereich geht es den Wissenschaftlern zuweilen um aktiven Tierschutz. Der Autor einer ganzen Reihe von Texten über Tiere, Thomas Macho, gründete gerade an der Humboldt-Universität einen Bereich “Animal Studies”. So heißt nun auch bereits eine neue Berliner Fachzeitschrift: “Tierstudien”, deren 1. Ausgabe soeben erschien. Der britische Autor John Berger war 1980 der erste, der diese Debatte mit seinem Essay „Why Look at Animals?“ zuerst systematisierte, wie der Biologe Cord Riechelmann in seiner Rezension der „Tierstudien“ schreibt.

Russischer Staatszirkus
Tierdressuren im Circus Sarrasani (taz v. 16.4.1987)
In der Einladung zur Pressekonferenz hieß es: »Seit unserem letzten Berliner Gastspiel hat sich vieles im Circus Sarrasani verändert. Bei uns gibt es keine ‚Regenbogen‘ mehr, dafür aber um so mehr echtenCircus. Dazu zählen natürlich auch wieder viele verschiedenartige Tierdressuren. Wir glauben, daß gerade die Berliner Circusfreunde diese in den letzten Jahren vermißt haben.«
Bei den Dressurakten handelt es sich im Einzelnen um: Die Bärendressur (1 Eisbär, 1 Braunbär und 2 Kragenbären) von EddaKemal. Die gemischte Raubtierdressur ( 7 sibirischeTiger, 5 Berberlöwen, 1 Puma und 3 Bernhardinerhunde) von Leopold Vidlak. Die Pferde- und Elefantendressur von Josef Holzmüller. Die Schimpansendressur der Familie Streicher.
Wir beauftragten als Rezensenten für diese Dressurakte den japanischen Philosophen. Makoto Ozaki, Ozaki studierte bis 1961 das Fach Romanistik an der Universität Tokio. Danach setzte er in Paris sein Studium fort. 1969 promovierte Ozaki bei Roland Barthes mit einer Dissertation über das Thema „Mallarmé et Hegel. Problèmes theoriques de l’influence.“ Die deutsche Sprache erlernte Ozaki in den Seminaren von Paul Celan. Infolge einer Initiative von Peter Szondi und Jacob Taubes wechselte Ozaki im Jahr 1971 von Paris nach Berlin, wo er bis 1991 an der FU lehrte. Seitdem ist Ozaki auch als Übersetzer von Werken aus der französischen in die deutsche Sprache tätig. Als wir Makoto Ozaki um eine Rezension baten, lächelte er nur ob unseres Anliegens, sich im Zirkus Sarrasani eine Vorstellung anzukucken – und schickte uns stattdessen folgenden Text:
Worin besteht die Kunst der Tierdressur, deren Leistung, Attraktion, Faszination? Die Klärung dieserFrage setzt die der Ambiguität und der Ambivalenz des Beifalls, den wir ihr zollen, voraus. Wem gilt eigentlich unser Beifall? Was bestimmt dessen Stärke und Dauer? Die moderne Wendung der Tierdressur ließe sich als eine von der Zähmung zur Züchtung (nach dem Nietzscheschen Gegensatz) charakterisieren. Die Unterscheidung zwischen Zähmung und Züchtung hilft uns, implizite Polaritäten zu explizieren. Tatsächlich gibt es bei allem mehr oder weniger zwei Arten von Tierdressur, je nachdem, ob die Tiere uns gefährlich erscheinen oder nicht — genauer: ob wir Angst vor ihnen haben sollen oder nicht, und zwar, sollte man gleich hinzufügen, bei aller Ambivalenz; wir brauchen einerseits keine Angst vor Raubtieren hinter Gitter zu haben, andererseits kann jedes liebste Tierchen uns unter Umständen schaden. Tendenziell läßt sich demnach folgendes Verhältnis beim Publikum feststellen: je mehr es sich vor dem Tier fürchtet, desto mehr gilt der Beifall dem Tierdresseur; je mehr es das Tier liebt, desto mehr gefällt es umgekehrt dem dressierten Tier — es sei dahingestellt, ob es hierbei um die Liebe geht oder um das Mitleid. Für den Dresseur selbst stellt sich die Frage etwas anders, und zwar in etwa so, wie sich Machiavelli bezüglich des Verhältnisses zwischen dem Fürsten und dessen Untertanen fragte:
Was ist besser für den Dresseur, von den Tieren geliebt oder gefürchtet zu werden? Am besten wäre es, meinte Machiavelli, zugleich geliebt und gefürchtet zu werden, wo man immer indes man zu wählen habe, usw. Entgegen der Zähmung, die Machiavellis Wahl entspricht, operiert die Züchtung aufgrund der Zoologie nicht nur mit Liebe, sondern nähert sich dem Erziehungs-, somit auch dem Herrschaftsideal um ein ganzes Stück an: Der Dresseur als Leittier wird von den Tieren als/wie der Führer geliebt und gefürchtet, verehrt und geachtet, und sein Kommando als guter Rat freiwillig und dankbar befolgt. Dies ist von jeher der Anspruch jedes Erziehers und Herrschers gewesen, der etwas von sich hielt. Wer zum Gewaltmittel greift, er mag die eigene Gewalt auch hundert- und tausendmal durch die Gesetze rechtfertigen, die er schließlich selbst gibt, verrät dadurch die Schwäche seiner Macht, die insofern nicht von seiner eigenen v i r t u, um mit Machiavelli zu sprechen, abhängt, sondern bloß von der f o r t u n a , die in der Trennung des Volkes von dessen eigener Macht durch Unwissenheit und Gewohnheit, Gedankenlosigkeit und Faulheit, Kurzsichtigkeit und Feigheit, kurzum die eigene Schlechtigkeit besteht. Die Analogie der Tierdressur zur Pädagogie und zur Politik jeweils als Kinder- und Volksdressur ist allerdings leichter gezogen denn ausgeführt. Eine der Voraussetzungen für die Tierdressur ist, daß die Tiere überhaupt einiges über den Instinkt und die Prägung hinaus lernen können und müssen. Daraus folgt, was wohl als selbstverständlich gelten mag. Nämlich, daß die Dressur desto mehr Erfolg verspricht, je jünger die Tiere sind, die abgerichtet werden sollen.

Je jünger sie sind, desto weniger ist ihr Verhaltensmuster bestimmt, stehen mithin desto mehr einer Bestimmung zur Verfügung — innerhalb der durchaus unterschiedlichen Grenzen ihrer natürlichen, je spezifischen Anlagen und virtuellen Fähigkeiten. Die Lernfähigkeit hängt absolut und positiv von diesen Grenzen, relativ und negativ von der instinktiven Determination ab, stellt gleichsam den Spielraum zwischen diesen beiden, äußeren und inneren Grenzen dar. Konkret kommt als ein weiteres Moment der Lernfähigkeit neben dem Alter hinzu, was man unter »Intelligenz« versteht und was sowohl individuell als auch spezifisch unterschiedlich ausfällt. Was man auch unter »Intelligenz« verstehen mag, ob als Fähigkeit, Punkte beim lQ-Test zu sammeln, Klassiker herzuzitieren oder rechtzuschreiben, hat sie etwas mit dem Umgang mit Zeichen und Symbolen, dieser wiederum mit dem Spiel zu tun — und mit dessen Ende.
Homo ludens… Bekanntlich spielen auch Tiere, hören indes, wiederum bekanntlich, desto früher damit auf, je weniger »intelligent« sie sind. Mit dem Spiel, dem Aufschub der Reifung und dem Verlust der Instinkte, kurzum mit der Entfremdung von der Natur hat es der Mensch unter den Tieren einerseits am weitesten gebracht, macht es sich andererseits am schwersten, damit fertig zu werden — ich meine: mit der erst dadurch gewonnenen, der Notwendigkeit der Natur abgerungenen Freiheit, die primär negativ bzw. privativ bestimmt, per definitionem wieder verloren zu gehen droht oder doch sich allemal als defizitär erweist. Die menschlichen Institutionen, die den Menschen vor allen anderen Tieren wenn auch nur als ein Untier auszeichnen, beruhen auf dem Spiel und dessen Begrenzung, und zwar — Gesetz als Ersatz-Instinkt voran — im Element der Sprache. Das Kommando des Tierdresseurs bricht gewissermaßen dessen Leittierwesen, mag das Wort auch so kurz und knapp ausfallen, sich auf ein Lautzeichen reduzieren. Er springt nicht selbst, damit die Tiere ihm folgen, sondern befiehlt ihnen zu springen, und sie gehorchen ihm, indem sie springen, sein Wort in die Tat umsetzen. Sie tun nicht, was sie selbst wollen, sondern was er will, tanzen nach seiner Pfeife.

Marionettentheater? … Gewiß sind Tiere keine Holzköpfe, in wessen Falle die Freiheit des Menschen als eines Tieres unter anderen nicht erst denkbar, und seine Unfreiheit mithin genausowenig ein Malheur wäre. Ihr Verhalten ist gleichwohl der Notwendigkeit der Natur verhaftet,gefangen wie sie gleichsam ihrer selbst sind. In dem Sinne handeln sie nicht eigentlich, sondern, leiden nur, bestenfalls reagieren sie, was schließlich eine Form des Leidens ist. Nur, daß sie sich dessen nicht oder doch allemal weniger bewußt sind denn ein Mensch, dessen.Tragik bzw. Komik, Misere oder Glorie, Fluch oder Luxus darin besteht, sich mit der Frage zu tragen, ob er in dieser Hinsicht um soviel besser oder auch nur anders ist. Ob er tatsächlich, was er sein sollte und möchte, frei ist. Ob er nicht für eine große Illusion, die Freiheit heißt, doppelt und dreifach zu zahlen hat: mit der Entfremdung von der Natur, mit dem Verlust nicht nur der natürlichen Grazie und Selbstsicherheit in der instinktiven Reaktion, nicht zuletzt mit dem Gefühl der Unfreiheit, das er ohne die Sehnsucht nach der Freiheit, die doch ausbleibt, gar nicht verspüren würde, weil es als solches entstehen könnte. Leiden würde er ohnehin, doch ohne sich lange zu fragen warum und wozu. Leiden und reagieren, also doch wieder leiden…
Das größte Leiden erweist sich als der geringste Preis für die Freiheit, die darin besteht zu handeln, von sich aus zu tun, was zu tun ist, aufgrund dessen, was man ist, selbst Ursache eigener Tat zu sein. Wer könnte das, wenn er schon kein Gott sein soll? Und wenn kein Mensch sein könnte, was er sollte, ohne dies Göttliche zu vollbringen, was per definitionem seine Macht übersteigt? Hier ist etwas prinzipiell faul, grundsätzlich und von vorneherein — ich meine: im „Wesen“ des Menschen bzw. der Kultur.
Die Geschichte der Tierdressur im Zirkus ist keine einfache, sondern eine vielfache, geradezu komplexe, die nicht nur mit der des Zirkus selbst, sondern mit der allgemeinen Geschichte der Kultur und der Gesellschaft zusammenhängt, diese einerseits unter einem bestimmten Aspekt widerspiegelt, sich andererseits erst aus deren Kontext erklären läßt. Ich beschränke mich daher darauf, darauf hinzuweisen, daß die Nummern der sogenannten Tierdressur je nach Tierart durchaus verschiedene Ursprünge aufweisen. Die einen stammen von der Schaustellung, in dieser Funktion mittlerweile weitgehend vom Zoo abgelöst — derzeit seltene, fremde, exotische Tiere wie Elefanten, Löwen, Tiger, Bären, Riesenschlagen usw.— die anderen von der Zucht — vorwiegend Haustiere wie Hunde und Pferde im Gegensatz zu Raubtieren, nur auf eine Spitzenleistung hin trainiert; die einen wiederum integrieren in den Rahmen des Zirkus einzelne, ehemals selbständige Tiervorführungen wie den Bärentanz, Affentanz, die anderen bewahren gleichsam museal alte oder fremde Zuchtpraxis, die sonst verloren zu gehen droht. Abgesehen von der historischen Frage, wann und wie die Tierdressur den Einzug in den Zirkus hielt und wie sie sich entwickelte, führt zumal die Arbeit mit den Raubtieren auf den römischen c i r c u s zurück, in dem nicht nur‘ Gladiatorenkämpfe stattfanden, sondern Sklaven und erste Christen den Löwen preisgegeben wurden. Ob der Krieg damit inszeniert wurde, das Menschen- oder Tieropfer, war die Praxis, die Menschen den Löwen preiszugeben, nicht nur eine Perversion, sondern eine Reversion. Wobei die Raubtiere die Naturgewalt als göttliche Macht repräsentierten.

Auf jeden Fall wollte der Pöbel Blut sehen, gleich unerlösten Geistern und toten Seelen am blutigen, grausamen Schauspiel sich weiden und sich dadurch; wenn auch nur fiktiv und momentan, über sich selbst erheben, wenn ihm schon nicht vergönnt sein sollte, wie Kaiser nach ihrem Tod Götter zu werden. Für die Mächtigen war es : theoretisch quasi heilige Pflicht, der Masse dieses Schauspiel neben anderen Spielen und Festen zu bieten — praktisch und profan: ein Mittel zur Erhaltung ihrer Macht und Herrschaft. Die Kunst der Tierdressur wie die Leistung des Tierdresseurs besteht schließlich darin, die Natur zu bezwingen, sie bei ihrer Verdoppelung in ihr Gegenteil umzukehren bzw. als eigenes Gegenteil erscheinen zu lassen. Allegorisch stellt sie, genauso alt wie die Menschheit und immer neu bei seiner Wiederholung, den Kulturprozeß mit der Ambiguität und der Ambivalenz der Kultur als zweiter Natur und Widernatur, Selbst-Aneignungund -Entfremdung des Menschen als eines in sich gespaltenen Tieres, das, Dressur der anderen und seiner selbst, einerseits seinen Liebling liebt, hegt und pflegt, ihn bei dessen Tod beweint und betrauert, mitunter zu Grabe trägt, andererseits nicht weniger andere Tiere frißt, quält, systematisch oder ahnungslos, falls »schädlich« oder ungenießbar, ausrottet. Diese Ambivalenz, die an Paradox grenzt, der Kultur erklärt ferner die Attraktion und die Faszination der Tierdressur als die eines Wunders — wiederum in der Ambivalenz eines Tarzan, modernen Herakles, zwischen Helden und Heiligen, Drachentöter und Rattenfänger dort, Androdus und Franz von Assisi hier, Furcht und Mitleid, Theater allemal und Fest — der Grausamkeit. Ist es nicht eine Überheblichkeit, den Leistungen Beifall zu zollen, von denen man weiß oder zumindest glaubt, es damit selbst besser machen zu können? Männchenmachen, nachplappern, dreimal bellen und dergleichen?

Tatsächlich erweist sich der Beifall, wenn man genauer darauf hinhört, als nicht frei von Mitleid, mithin Verachtung und Grausamkeit — all den Affekten also, die selbst nicht ohne Ambivalenz sind. Jeder hat schließlich irgendwann nicht ohne Mühe aufstehen gelernt, laufen, sprechen, mitunter schweigen… Wer noch Zweifel hegt, möge sich darauf besinnen, daß einer, der einen Vogel oder einen Schmetterling fliegen sieht und ihrer Leistung applaudiert, als verrückt gelten wird. Keiner läßt sich gern in seinem Stolz verletzen, schon gar nicht in dem, Mensch zu sein. Was als »Leistung« bei den Tieren gilt, bestimmt also schließlich der Mensch nach eigenen Maßgaben.
(Makuto Ozaki veröffentlichte 1981 im Merve-Verlag mehrere Aufsätze über verschiedene Tierdressuren – unter dem Titel „Artikulationen“)

Weitere taz-Artikel zum Thema:
taz Hamburg 31.5.2001
Tiere ehren Man braucht ja nicht unbedingt an die Wiedergeburt des ärgsten Widersachers als Ameise zu glauben. Auch keinen Pudelsalon-Dauerwellenkult zu betreiben, wie er manchmal unter alten Omas um sich greift – denen man es aber auch wieder nicht übel nehmen kann, weil sie vielleicht einsam sind und sonst nichts zu tun haben. Aber Respekt vor dem Mitgeschöpf Tier könnte sich schon positiv auf die weitere Evolution – falls dem Globus noch ein gewisses Zeitkontingent beschieden ist – auswirken: Tiere – Rechte – Ethik lautet das Thema des Philosophischen Cafés mit Hans Wollschläger, der nicht nur Essays wie Denn es gehet dem Menschen wie dem Vieh verfasste, sondern auch durch Buchtitel wie Tiere sehen dich an und Das Potential Mengele auf sich aufmerksam machte. Ob die Gier des Verbrauchers nicht in Wirklichkeit eine Sintflut ist, wird Thema des von Reinhard Kahl moderierten Abends sein – und die Frage, wieso der Mensch Millionen „Stück Schlachtvieh“ zu Objekten degradiert und frei nach Gusto entscheidet, ob sie „gekeult“ gehören oder nicht. Dienstag, 19 Uhr, Literaturhaus

taz vom 17.3.2012
Essen oder Tiere streicheln?
Auf keinen Fall essen und auch nicht den fleischessenden Tischnachbarn das Salz reichen, meint die überzeugte Veganerin Hilal Sezgin: Im Alter von dreizehn Jahren wurde ich Vegetarierin. Ich vermisste anfangs den Geschmack von Fleisch sehr, hatte einen Rückfall, wurde dann wieder Vegetarierin und bin es seither geblieben. Den Fleischverzehr der anderen fand ich nicht eklig, zumindest nicht ästhetisch. Nach dem anfänglichen Übereifer, meine Umgebung zu bekehren (man darf Tiere nicht töten, nur weil man ihren Geschmack mag), habe ich auch damit aufgehört. Brav habe ich lange neben Fleischessern gegessen; sie verzehrten ganze Fische mit Augen und Gesichtern, sie grillten Würste aus zermahlenen Schweinen, verzehrten Kleinkinder diverser Säugetiere mit und ohne Soße – ich war es gewöhnt. Es hatte keinen Sinn, überall schlechte Laune zu verbreiten. Bis mir meine Schafe einen Strich durch die Rechnung machten. Nach gut zwanzig friedlichen vegetarischen Jahren „erbte“ ich eine kleine Schafherde mitsamt Lämmern. Ich desinfizierte Bauchnabel; beobachtete, mit welcher Sorge eine Schafmutter nach dem Lamm ruft, wenn es außer Sicht ist; brachte Ausreißer vor dem norddeutschen Dauerregen in Sicherheit; kam schließlich sogar in die Situation, vier Lämmer mit der Flasche aufzuziehen.
Diese Lämmer und Schafe also veränderten mich. Zunächst einmal machten sie mich zur Veganerin. Denn auch wenn mir der Gesamtkomplex „Säugetier“ schon vorher klar gewesen war, verstand ich jetzt erst, welche Qual es für Kühe bedeutete, wenn man ihnen die Kälber wegnahm (damit die nicht die Milch „weg“-trinken). Nach dieser Veganisierung brachten mich meine Schafe auch noch um beschauliche Abende im Restaurant, harmlos plaudernd zwischen fleischessenden Freunden. Als jemand neben mir „Lamm“ bestellte (tot und zum Essen!), verspürte ich einen starken Würgereflex, erbrach also fast unter den Tisch. Natürlich versuche ich, mich zusammenzureißen. Doch wenn die Speisekarten gezückt werden, bricht mir der Schweiß aus. Das geht nicht einmal über den Kopf, sondern direkt über Bauch und Nerven. Ich komme einfach nicht dagegen an, es ist für mich wie Kannibalismus. Zwei Jahrzehnte habe ich versucht, zumindest halbwegs kompatibel in einer Fleischessergesellschaft zu leben, dann haben mich die Schafe mit ihrem gemütlichen Grasgemalme auf ihre Seite gezogen. Auf die Seite der reinen Pflanzenesser. Tatsächlich bleibt ungeheuer viel zum Essen übrig! Das schlechte Gewissen ist man los, die Pflanzenwelt ist groß genug für kulinarische Experimente. Hier passen Essen und Streicheln endlich zusammen. Hilal Sezgin streitet auf dem tazlab mit Christian Rätsch und Antoine F. Goetschel in „Aufessen oder streicheln?“

taz Magazin 31.1.2009
Tiere Aufessen oder streicheln?
Das Bekenntnis zu einem veganischen Lebensstil ist längst mehr als ein Spleen: Der korrekte Umgang mit Tieren ist eine Herausforderung für alle kritischen Konsumenten. Auch wenn sie nur Biofleisch kaufen VON HILAL SEZGIN
Vorbei sind die Zeiten, als Vegetarismus ein Spleen einiger weniger war. Wer heute Freunde zum Abendessen einlädt, ahnt: Ein Vegetarier wird mindestens darunter sein. Kein Hausarzt versucht heute mehr, seinen Patienten zum Verzehr des berühmten Stückes „Lebenskraft“ zu bewegen, und wenn sich in der Kantine eine Vegetarierin zu ihren Kollegen mit dem Gulasch setzt, regnen keine verwunderten Fragen mehr auf sie ein. Leider hat das Statistische Bundesamt noch keine Zahlen zum Vegetarismus in Deutschland erhoben; dass der Fleischverbrauch insgesamt zurückgeht, sagt schließlich nichts über individuelle Verteilung und Beweggründe aus. Bereits fünf bis zehn Prozent der Bevölkerung sollen Vegetarier sein – schätzen Vegetarierverbände. Aus diversen Teilerhebungen gilt als gesichert allerdings nur, dass es mehr Frauen sind als Männer, mehr Gebildete als Ungelernte und dass der Gedanke, man dürfe Tiere nicht verspeisen, in der jungen Generation schon geradezu endemisch ist. Und kaum wird diese Meinung von der (erwachsenen) Mehrheit zwar nicht geteilt, doch immerhin akzeptiert, gibt es zunehmend Menschen, die in ihrem Konsumboykott noch weiter gehen: die Veganer. Sie tragen Schuhe ohne Leder, verzichten auf Honig, Milchprodukte und Ei. Soweit dies praktisch realisierbar ist, wollen sie auf nichts zurückgreifen, was Tieren „gehört“ oder wofür Tiere „arbeiten“ oder leiden mussten. Wenn heute also auch Nichtvegetarier die Gründe nachvollziehen können, die Vegetarier zu ihrer Lebensweise bewegen – ist dann Veganismus der neue Spleen? Die den Veganismus motivierende Grundsatzfrage – dürfen wir Tiere für unsere Zwecke (be)nutzen? – wird im philosophischen Kontext selten gestellt.
Seit den Siebziger-, spätestens den Achtzigerjahren kehrte unter dem Stichwort „Tierethik“ die Diskussion um den moralischen Status von Tieren in die akademische Philosophie ein. Im angelsächsischen Raum sind ihre prominentesten Vertreter Peter Singer und Tom Regan, im deutschsprachigen Ursula Wolf. Doch lag in der akademischen Disziplin Tierethik der Fokus lange auf der Frage, ob Tiere und ihr Wohl und Wehe überhaupt moralisch zu berücksichtigen sind. Sie wird inzwischen von vielen Vertretern auch unterschiedlicher moraltheoretischer Ansätze bejaht, und zwar genau auf der Grundlage tierischer Empfindens- und Leidensfähigkeit: Tiere mögen keine Personen sein, über kein Bewusstsein ihrer selbst und der Dimension der Moral verfügen; doch ihr Leiden ist moralisch relevant. Von dieser Frage wird eine zweite meist abgekoppelt, nämlich ob und wann wir Tiere töten dürfen. Dies ist sozusagen die Frage der Vegetarier: Ist der Wunsch nach Genuss ein moralisch hinreichender Grund? Der breite philosophische Konsens, dass tierisches Leid zu vermeiden sei, schmälert sich bei der Antwort auf die Tötungsfrage drastisch; die Mehrheit der Philosophen findet die Tötung von Tieren weniger schlimm, weil Tiere keine Ahnung ihrer Zukunft, keine diesbezüglichen Pläne oder Hoffnungen haben; man raubt ihnen nach dieser Ansicht nichts, weil sie von dessen Existenz nicht wissen. Eine dritte Frage wäre nun die „vegane“ Frage nach der grundsätzlichen Hierarchie zwischen menschlichem und tierischem Bedürfnis: Dürfen wir, soviel wir möchten, von einem Tier Gebrauch machen? Es ist letztlich die Frage nach Herrscher und Untertan, nach Meister und Knecht.
Nicht von ungefähr drängt sich hier das Bild von Gottes Stellvertreter auf, als der der Mensch eingesetzt sei; wenn man der Idee von der Verfügbarkeit des Tiers für den Menschen ideengeschichtlich nachspürt, trifft man bald auf den Widerschein jenes alten religiösen Bildes von Gottes Auftrag: „Mehret euch und machet euch die Erde untertan.“ Doch dieses Bild, aus der Nähe betrachtet, ist nicht so eindeutig, wie es sowohl Anhänger als auch Kritiker gerne meinen. Dem Alten Testament nach ist die heutige Welt der Fleischesser Ergebnis einer Fehlentwicklung, läuft Gottes ursprünglichem Plan zuwider, von Ihm nur gebilligt aus einer Art Resignation. Im Garten Eden erlaubte Er Adam und Eva nur, (fast alle) Früchte zu essen. Das oft angeführte Zitat aus der ersten Schöpfungsgeschichte lautet zwar, „herrscht über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf dem Lande regen“ (1, 1, 28). Direkt danach geht es aber weiter: „Dann sprach Gott: Hiermit übergebe ich euch alle Pflanzen auf der ganzen Erde, die Samen tragen, und alle Bäume mit samenhaltigen Früchten. Sie sollen euch zur Nahrung dienen.“ Vom Jagen und Fischen ist hier nicht die Rede. Erst an späterer Stelle, als Gott von der Entwicklung des Menschen so enttäuscht ist, dass er am liebsten alle atmenden Lebewesen vernichten würde, lässt er sich durch Noahs Opfergaben zur Milde bewegen; von nun an gestattet er den Fleischverzehr (1, 9, 3), und „Furcht und Schrecken vor euch soll sich auf alle Tiere der Erde legen“. Wo immer eine Tierart seither dem Menschen begegnete, haben Furcht und Schrecken dies auch auftragsgemäß getan. Im Koran, der sich selbst als jüngstes Glied in derselben Offenbarungstradition begreift, ist der Mensch Statthalter Gottes auf Erden; gleichzeitig mahnt der Koran: „Keine Tiere gibt es auf Erden und keinen Vogel, der mit seinen Schwingen fliegt, die nicht Völker sind wie ihr“ (6, 38).
Der Prophet Mohammed verbot seinen Anhängern, Tieren die Ohren zu schlitzen und sie am Hals zu brandmarken; und als Mohammed an einem Markt vorbeikam und junge Männer sah, die es sich während ihrer Pause auf den Rücken ihrer Kamele bequem machten, ermahnte er sie: „Behandelt die Rücken eurer Tiere nicht als Podest, denn Gott hat sie euch nur überlassen, damit ihr an Orte reisen könnt, die ansonsten schwer zu erreichen wären.“ In dieser jüdisch-christlich-muslimischen Tradition, die wir so gerne für das Bild der Vorherrschaft des Menschen über die Tiere verantwortlich machen, wird diese Vorherrschaft also zwar tatsächlich legitimiert. Doch orientiert sie sich am Vorbild eines gütigen, friedliebenden Gottes, nicht an dem eines Despoten. „Bild Gottes“ ist der Mensch, insofern er sich verantwortlich handelnd zu seinem Lebensraum samt den Lebewesen darin verhält. Selbst mit den Tieren pflegt er Gemeinschaft und schont sie durch unterschiedlichen Nahrungsgebrauch“, schreibt der katholische Theologe Karl-Josef Kuschel über das Buch Genesis – und über den noachidischen Bund: „Bemerkenswert ist ohnehin, dass der Bund Gottes mit der Schöpfung von jeder Anthropozentrik frei ist.“ Der Mensch soll über die Erde herrschen, und kein guter Regent tötet mutwillig seinen Untertan. Wo aber beginnt Willkür, und in welchem Bereich gilt die menschliche Berechtigung, das Tier zu nutzen? Wo die religiösen Schriften auf Gottes Absicht verweisen, gabelt sich die säkulare Sprache in „Moral“ und „Notwendigkeit“. Das Verständnis beispielsweise, das Mohammeds Ausspruch über die Kamele ausdrückt, lässt sich leicht säkularisieren: Wir Menschen dürfen die Tiere benutzen – wo wir sie brauchen. Daraus folgt auch: sonst nicht.
Offenbar dürfen wir die Tiere aber nicht etwa gebrauchen, weil wir vor ihnen ausgezeichnet wären – sondern weil wir ihnen in einem relevanten Punkt ähnlich, nämlich bedürftige Lebewesen, sind. Nach säkularem Verständnis darf der Mensch andere Tiere mit demselben Recht essen, mit dem auch andere Spezies jagen und töten. Es ist uns kein Vorwurf zu machen, wenn wir auf Kamelen durch die Wüste reisen, weil es auf bloßen Menschenbeinen eben nicht geht. An dieser Stelle setzen die Einwände der Vegetarier und Veganer an: Streng genommen brauchen wir heute weder Fleisch noch Kamele. Es gibt Tofu und Autos – Mensch, begnüge dich damit! Und dieses Argument ist auf direktem Wege auch schwer zu widerlegen. Auf indirektem Wege allerdings, beim zweiten Nachdenken, muss man einräumen: „brauchen“ ist ein relativer Begriff. Zivilisation bedeutet unter anderem, dass man sich nicht nur von rohen Beeren ernährt, dass man Häuser baut, die mehr bieten als nur ein Dach über dem Kopf, dass man – mensch – Ressourcen verbraucht, nicht nur um zu überleben, sondern sinnvoll und auch genussvoll zu leben. Wo hört da das Normalmaß der Selbstbeschränkung auf, die man von einem Menschen verlangen kann, auf, und wo fängt die Askese des Heiligen an? Was der Mensch „braucht“ und letztlich will, wird moralisch immer ins Verhältnis zu setzen sein zu dem, was das von ihm Begehrte für andere an Verlust und Schmerz bedeutet. Und unser Fleisch- und Milch- und Ei-Konsum bedeutet eben in der Tat für viele Tiere großes Leid – so lautet der nächste Gedankengang. Als Konsument neigt man zwecks Selbstschonung dazu, die entsprechenden Details an den Rand des Bewusstseins zu drängen. Doch sind es wirklich noch Details – oder kennen wir nicht vielmehr das gesamte schreckliche Bild? Wir wissen ja um die Schlachttransporte und sehen auf den Autobahnen Lkws voller Schweine, auf ihrem Weg in eine Hölle von Panik, CO2-Erstickung und Fließbandtod.
Aus dem Fernsehen kennen wir das beengte Leben in den Ställen, die Kastrationen ohne Betäubung, Kühe, die sich kaum umdrehen können, und Kälber, die tagelang nach ihren Müttern schreien. Wir wissen, dass Biohaltung etwas besser ist; doch je mehr man die Einzelheiten kennt, desto verzweifelter fragt man sich: Ist das gut genug?! Übrigens ist nicht nur die Haltung und Schlachtung der Tiere eine Quelle der Qual, sondern bereits ihre Züchtung. Legendär sind die Kuh mit Euterhalter und das Schwein mit vervielfachten Rippen – keine skurrilen Ausnahmen, sondern die Regel. Auch das Huhn, das jeden Tag ein Ei legt, verausgabt sich bis zu seinem verfrühten Tode, und der Muskelapparat des Masthähnchens wächst so schnell, dass Skelett und Organe nicht mehr mitkommen. Versuche von Agrarwissenschaftlern haben gezeigt, dass die heutigen „Broiler“ viele Angebote in ihren Ställen nicht annehmen – die Hähnchen laufen wenig herum, auf die Sitzstangen fliegen sie nicht hinauf. Verabreicht
man ihnen jedoch ein Schmerzmittel, nimmt ihre Bewegung wieder zu – das heißt umgekehrt, das übliche Leben des Masthähnchens ist ein Leben voller Schmerz. Veterinärmediziner mahnen bereits, dass alle Tiere, die oder deren Produkte wir heute verzehren, krank sind, gemessen am gesunden Funktionieren eines tierischen Körpers. Verkrüppelungen, Knochenbrüche, Organschäden, Entzündungen, Tumore. Und wieder: Auch Biobetriebe setzen solche Züchtungen ein, sonst könnten sie im Konkurrenzkampf gar nicht bestehen. Die grausame Empirie industrieller Tieraufzucht- und Schlachtanstalten entkoppelt die Frage nach der Berechtigung zum Fleisch- und Milch- und Eiverzehr hier und jetzt von den grundsätzlichen Fragen nach der Nutzung von Tieren und ihrer Tötung. Jemand kann durchaus der Meinung sein, der Mensch dürfe andere Tiere benutzen, verzehren und zu diesem Zweck töten – grundsätzlich. Und wird doch, wenn er sich mit den Situationen in unseren Aufzuchtanstalten, Ställen und Schlachtereien vertraut gemacht hat, sagen: So geht es nicht! Man braucht nicht generell gegen Haarshampoos zu sein, um sich zu entscheiden: Shampoos, die auf der Grundlage von Tierversuchen hergestellt wurden, kaufe ich nicht. Sich dem Kauf von Eiern, von Milch und Käse zu verweigern, verlangt persönlichen Verzicht.
Doch versteht sich der Veganismus weniger als private Askese denn als politischer Boykott. Ein Verzicht, im Kleinen und Stillen ausgeübt, wird den Millionen Tieren nicht helfen, die um anderer Konsumenten willen gezüchtet, in Enge gehalten, in Panik geschlachtet werden. Mindestens ebenso wichtig wie das private Kaufverhalten ist es, eine öffentliche Debatte in Schwung zu bringen, die viel strengere Maßstäbe anlegt als das, was heute das Biosiegel garantiert. Fälschlicherweise verlassen wir Konsumenten uns darauf, dass unsere Tierschutzgesetze und Ökobestimmungen die schlimmsten Übel schon verhindern werden – das tun sie nicht. Also müssen wir neuen Druck ausüben auf Verbände und staatliche Institutionen; und dazu ist im selben Maße derjenige aufgerufen, der den Schritt zum Veganismus nicht gehen mag oder kann. Vielleicht aber wird er (oder sie) nach einem genaueren Blick auf Veröffentlichungen und Internetforen der Veganer zugeben, dass dort ein enormes Sachwissen aufgefahren wird; ihre moralischen Argumente besitzen einige Überzeugungskraft. Und so mag die vegane Einstellung ebenso weit von unserer üblichen Alltagspraxis entfernt sein, wie sie für diese weitreichend ist oder wäre. Sie bedeutet eine Herausforderung für den kritischen Konsumenten. Ein Spleen ist sie nicht.
(HILAL SEZGIN, Jahrgang 1970, lebt als freie Publizistin in der Lüneburger Heide und betreut neununddreißig Schafe, vier Ziegen, zwei Gänse und zwölf Hühner, die sie niemals aufessen würde. Nach fünfundzwanzig Jahren als Vegetarierin lebt sie seit einem halben Jahr vegan. 2012 veröffentlichte sie das Buch „Landleben: Von einer, die raus zog“)

taz vom 28.1.2011
ALLES KOMMT AUF DEN TISCH Vegetarier, Stasi und Dioxin
In allen Zeitungen wurde Karen Duves Buch über das Essen besprochen. Und jedes Mal wurde dazu ein Foto der Autorin mit einem Huhn auf dem Arm abgedruckt. Die Hamburgerin wohnt in Brandenburg auf dem Land. Sie ist Veganerin und als Tierschützerin mit der Kamera unterwegs, ihr Buch heißt „Anständig essen“ und folgt auf das Buch „Tiere essen“ von Jonathan Foer, mit dem Karen Duve derzeit einige Lesungen bestreitet. „Anständig essen“ ist quasi das Buch zum Film „Dioxinskandal“ – und das kam auch noch rechtzeitig zur „bisher größten“ Lebensmitteldemo zu Beginn der Grünen Woche. Die Autorin berichtet über die Schandtaten der Agrarindustrie und ihre eigenen Essensexperimente: Sie ernährte sich biologisch, vegetarisch, vegan und frutarisch (für die Frutarier ist das Ausreißen einer noch lebenden Mohrrübe Mord).
Das Huhn auf dem Arm der Autorin hat einen Namen: Rudi. Der Berliner Zeitung verriet sie, dass es einer „Befreiungsaktion“ aus der überbelegten Halle eines Biohofs entstammt. Und dass ihr, indem sie das Essen mit Moral verband, jeder „Hackbraten zu Quälfleisch“ wurde. Ihr zweites Huhn, Betty, aß sie zwar vor einiger Zeit – mit Genuss, aber nur, weil es zuvor bereits von einem Fuchs getötet worden war. Auch der ebenfalls auf dem Land lebenden taz-Autorin und Tierschutzaktivistin Hilal Sezgin sind ihre Schlachttiere eher Haustiere, die sie höchstens symbolisch benutzt – indem sie darüber schreibt. Anders der Ost-taz-Gründer André Meier, ebenfalls ein Stadtflüchtling, der in seiner „Aussteigerfibel“ sauber zwischen benamten und unbenamten Tieren unterscheidet: Nur die Ersteren werden nicht gegessen, so halte man es jedenfalls in Vorpommern. Aber den Erfolg, den der Autor mit seinem „Landleben für Anfänger von A bis Z“ erzielte und auch viel gesehene Filme wie „Fleisch ist mein Gemüse“ konnten nicht verhindern, „dass der Vegetarismus heute in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist“, wie die Vegetarierin Iris Radisch kürzlich in der Zeit jubelte.
Wenn Karen Duve die Rolle des Food-, Wut- und Gutmenschen in dem aktuellen Dioxindrama spielt, dann durfte ihr Gegenspieler, der Schurke, kein Leichtgewicht sein: Erst war es nur die fast anonyme kleine Futtermittelherstellerfirma Harles und Jentzsch, die dann sogleich in Insolvenz verschwand und ihre Webpage löschte. Übrig blieb der „Geschäftsführer Siegfried Sievert (58)“, ein verschwiegener Ostler. Wie konnte man dem auf die Sprünge helfen? Da half das noch für jede Gemeinheit gute Bundesinnenministerium nach: Es setzte seine „Birthlerbehörde“ in Trab. Und diese trieb augenblicklich 200 Spitzelberichte von Siegfried Sievert alias „IM Pluto“ auf, die er auch noch per Hand geschrieben hatte. Besser ging’s nicht! Dazu Tonbänder und Quittungen für Stasi-Honorare im Wert von über 1.000 Mark (Ost). Die Kapitalpresse, das Landwirtschaftsministerium, der Bauernverband, die Bauern – alles lachte über „Pluto“ und freute sich riesig. Auf der Grünen Woche flossder Sekt in Strömen! Echt fett! Die Süddeutsche Zeitung schrieb: Sievert, „der bis zur Wende der Stasi zuarbeitete, war schon damals in fettverarbeitenden Betrieben wie dem VEB Märkische Ölwerke in Wittenberge beschäftigt. ,Der IM hat keinerlei Vorbehalte bei der Belastung von Personen aus seinem Umgangskreis‘, heißt es in seiner Akte.“ Allein eine solche „Einschätzung“ seines Führungsoffiziers, die damals – unter den Kommunistenschweinen – natürlich positiv gemeint war, zeugte bereits von der ganzen Niederträchtigkeit dieses (Ost-)Individuums. Aber es kam noch dicker: Der Mann arbeite nicht aus Überzeugung für die Aufklärung, heißt es in einer anderen Stasi-Evaluierung. Er berichte nur, was ihm selbst nützlich sei und indem er „persönliche Vorteile/Nachteile in Erwägung“ ziehe. „Futter-Panscher war Stasi-IM“ titelte die Berliner Morgenpost. Das war es doch: Nicht einmal die ihm im Westen großzügig ermöglichte Karriere hat dieses Subjekt von seiner egoistischen Lebensgier abbringen können.
Gewiss, es gab einige kritische Stimmen: „Wenn der Sozialismus das nicht geschafft habe, dann doch der Neoliberalismus erst recht nicht“ (Köstritzer Post). Ihm einst Nahestehende gaben zu bedenken: Mit dem selbst gewählten Decknamen „Pluto“ habe er nicht den römischen Gott der Unterwelt und des Reichtums gemeint, sondern den amerikanischen Hund von Donald Duck. Aber im großen Ganzen war an den Umrissen der beiden Protagonisten „Karen Duve – Huhn Rudi“ und „Futterfette Sievert – Dioxin Stasi“ nicht mehr zu rütteln. Zudem waren sich bei der „Problemlösung“ alle einig: „Die Lebensmittel müssen teurer werden“, wie es der Präsident der Ernährungsindustrie Jürgen Abraham auf der Grünen Woche sagte. „Der Fehler liegt nicht im System!“

taz 10.5.2010
Florian Möllers‘ Fotobuch „Wilde Tiere in der Großstadt“ VON MICHAEL RUTSCHKY
Kanadagans heißt der prächtige Vogel, den mein Cockerspaniel heute im Berliner Tiergarten vom Ufer, wo der Vogel es sich bequem gemacht hatte, ins Wasser scheuchte. Man sieht sie oft, die Kanadagänse, und ich hielt sie für eine Ansiedlungsmaßnahme der naturseligen Obrigkeit, bis ich jetzt in diesem Buch las, dass die Sorte vermutlich aus irgendeinem Zoo entfloh und sich im Freien tüchtig vermehrte. Kein Tiergartenbesucher wird auf Obrigkeitsmaßnahmen die Füchse zurückführen wollen, von denen ich zweimal welche gesehen habe. Der Cocker musterte sie respektvoll, und sie schauten interessiert zurück. Kein Fluchtimpuls. So wenig wie bei dem Graureiher, der an einem anderen Tag besinnlich über den Parkweg stelzte. Schwer zu sagen, warum diese Begegnungen solche Freude verbreiten. Man kommt sich vor, als habe man einem kleinen Wunder beiwohnen dürfen; ein wildes Tier verwandelt die gewohnte Großstadtszene fundamental – ja, es muss so etwas wie Transzendenz sein, was im Fuchs, im Graureiher zur Erscheinung kommt, wenn sie sich im Tiergarten betrachten lassen und nicht gleich angstvoll fliehen. Diese Freude verbreiten Florian Möllers‘ Fotografien der neuen Stadtbewohner ausgiebig – ich stelle mir vor, wie man kleine Kinder zum glückseligen Quietschen bringt, wenn man ihnen das Buch zum Geburtstag schenkt. Mutter Wildschwein, die mit ihren hübsch gestromten Frischlingen eine Vorstadtstraße bearbeitet; der legendär helle Reineke Vos, der an der Bushaltestelle die Lage ausspäht; der Wanderfalke, emblematisch kühn blickend, hoch oben am Roten Rathaus.
1.300 Nachtigallen siedeln in Berlin und stacheln einander zu immer kunstvolleren Gesängen an. Und die Mandarinenten und die Waschbären und die Biber, die ein Herr Recker seit vielen Jahren sorgfältig beobachtet. Und weil wir schon mal dabei sind, zeigt uns Florian Möllers auch noch viele der seltenen Pflanzen, die nirgendwo anders als in der großen Stadt so gut gedeihen (während draußen die Landwirtschaft Flora und Fauna substanziell bedroht). Das alles ist schon länger bekannt. Cord Riechelmann hat ein schönes Buch darüber geschrieben – „Wilde Tiere in der Großstadt“ (2004) – und Josef H. Reichholf, der zu Möllers ein Vorwort liefert, ebenfalls: „Stadtnatur. Eine neue Heimat für Tiere und Pflanzen“ (2007). Die Geschichte kommt als echte Überraschung; sie widerspricht eingelebten Erwartungen, und das mit der quasireligiösen Evidenz, die diese schönen Wesen ausstrahlen. Denn mit den großen Städten entwickelte sich gleich ursprünglich ein kulturkritisches Lamento, das sie als Inbegriff der Entfremdung, der lebensfeindlichen Unnatur, des moralischen und physischen Verfalls denunzierte. Die große Stadt ist die große Hure Babylon. Nur durch den Kapitalismus gezwungen leben die Menschen in der Großstadt. Sind sie noch nicht vollkommen korrumpiert, so erfüllt ihre Seele eine tiefe Sehnsucht nach dem Landleben, nach dem Garten (dem Paradiesgarten, aus dem ihre eigene Schuldhaftigkeit sie vertrieben hat). Jede Menge Gegenvorschläge liegen vor, soziale und architektonische, lebensreformerische und politische und literarische. Ich habe jetzt zum ersten Mal einen Zukunftsroman von H. G. Wells gelesen (dem wir „Die Zeitmaschine“ und „Krieg der Welten“ verdanken): Er heißt „Der Traum“ (1927) und spielt in der fernen Zukunft, da die befreite und befriedete Menschheit (selbstverständlich) in einer universalen Parklandschaft lebt; längst sind alle (großen) Städte verschwunden.
Und ausgerechnet diese korrupte Unnatur der Großstadt bietet, wie nicht mehr zu leugnen ist, wilden Tieren, seltenen Vögeln und Pflanzen einen neuen Lebensraum. Mit ihnen imaginiert sich die Großstadt gewissermaßen selbst als den Paradiesgarten – Florian Möllers‘ Fotografien inszenieren die Brachen, Friedhöfe, Parks, wo die Neuankömmlinge siedeln, höchst geschickt so, als lägen sie jwd, wie man in Berlin sagt, abgeschieden janz weit draußen. Hier und da zeigt sich freilich immer mal wieder doch der alte kulturpessimistische Diskurs, als könnten wir das Glück nicht fassen, als erforderte die Freude einen Gegenzauber, damit sie bleibe. Im Geleitwort der Senatorin für Stadtentwicklung, mehrfach in Möllers‘ Texten findet man die Formel, die Füchse und Nachtigallen, die Orchideen und Biber „erobern sich die Natur zurück.“ Das ist doch daneben. Der Vorgang ist eben kein kriegerischer – es ist ja die durchdringende Friedlichkeit, die bezaubert. Zu den Erklärungen der Neuansiedlung gehört, dass in der Stadt Jagdruhe herrscht, wie die Füchse, Wildschweine und Konsorten rasch lernen. Und es handelt sich natürlich nicht um die Natur, aus der wir sie vertrieben haben, wie jeder Dummerjan zu wissen meint, und in die sie jetzt wieder Einzug halten (weshalb gleich durchgreifende Schutzmaßnahmen anstehen). Es ist ein ganz neuer Raum, den die wilde Fauna und Flora in der Großstadt hervorbringt, und auf die Innovationen richtet sich alle Aufmerksamkeit.
Florian Möllers: „Wilde Tiere in der Stadt. Inseln der Artenvielfalt“. Knesebeck, München 2010

taz 24.12.2003
Vorstellung vom ewigen Frieden VON MICHAEL RUTSCHKY
Es werde, pflegte der alte Max Horkheimer leicht schwäbelnd zu dozieren, viel zu viel hergemacht vom Unterschied zwischen Menschen und Tieren. Das habe ich mir gemerkt. Dass wir lachen und weinen können, dass wir aufrecht gehen und eine syntaktisch ausgearbeitete Sprache verwenden: okay. Aber daraus sollte man keinen allzu großen narzisstischen Gewinn ziehen wollen. Dies war es nämlich, was Horkheimer witterte – anthropologischen Hochmut. Und so beschäftigt man sich gern damit, die Differenzen zu verkleinern. Nehmen wir Teddy – nein, nicht Adorno, sondern den schwarzen Langhaardackel, den meine Mutter lange 16 Jahre hielt. Kam man die Treppe zu ihrer Wohnung hinauf, wurde man nicht nur mit den bekannten Hundegesten begrüßt, insbesondere Schwanzwedeln. Dazu fletschte Teddy auch noch die Zähne. Er arbeitete an einem freudigen Lächeln und drang so in die menschliche Mimik vor. Überhaupt, die Haustiere. Wer welche hält, den beschäftigen weit inniger als die Differenzen ihre Ähnlichkeiten mit den Menschen. Denn das ermöglicht ja die Kommunikation: dass Hunde und Katzen ihre Namen erkennen und reagieren, wenn man sie ruft; dass Hühner die Locklaute beantworten, mit denen man ihnen das Futter ankündigt. Wer Rinder oder Schweine oder Pferde hält, berichtet Entsprechendes. Auch das Zoopersonal, das den Tieren gern Zärtlichkeiten zukommen lässt. Wenn man das als Zoobesucher beobachtet, entsteht Neid. Einer Seekuh oder einem Schimpansen freundlich übers Fell zu streichen, danach verlangt eine ganz eigentümliche Sehnsucht, die Kinder richtig beuteln kann.
Man erkennt den Paradiesmythos am Werk: Wenn Mensch und Tier einander friedlich, gar freundlich berühren können, dann ist alles, alles gut, dann herrscht der ewige Frieden. Auch ungleiche Haustiere stimulieren diese Paradiesvorstellung: Wer einen Hund und eine Katze in sehr jungem Alter erwirbt, wird sie sich in Spiele verwickeln sehen, denen der Mensch stundenlang entzückt zuschauen kann. Nach den Vorgaben der Frankfurter Schule ist es eine Art Heimweh, das beim Anblick der Tiere entsteht. Es fiel dem Menschen sehr schwer, es kostet ihn immer noch Anstrengung, aus der Tierreihe herauszutreten. Als Kind durfte ich mich zuweilen in einen kleinen, mit Heu ausgepolsterten Viehstall legen, den eine Hündin mit ihren Welpen teilte; sie nahm auch den menschlichen Welpen gern auf. So kamen mir Grundgedanken der Frankfurter Schule schon früh nahe. Ich denke, dass Zoos, auch Fernreisen zu den Tieren Afrikas oder Asiens, dieses Heimweh ebenso erregen wie stillen. An Kindern kann man es schön sehen, wie gesagt, wie liebend gern sie mit den Aliens hinter den Gittern Kontakt aufnehmen würden. Man darf das alles für romantisierenden Unfug halten. In jedem Fall setzt es voraus, dass die Menschensiedlungen vor Tierangriffen absolut sicher und die Schrecken der Nahrungsketten für die Menschen auf immer unterbrochen sind. Der Mensch soll als Beute außerordentlich nahrhaft sein. Das Problem ist bloß, dass er wegen seiner Intelligenz so schwer zu fangen ist. Die Jagd kostet mehr Kraft, als die Beute einbringt. (Deshalb lohnt sich auch für den Menschen die Menschenfresserei nicht.)
Freilich führen auch diese Gedanken zum Paradiesmythos. Der Tiger, in dessen schönes Fell du dich betten darfst, wäre die ehemalige Lebensgefahr, die jetzt nicht mehr droht; das freundliche Raubtier bedeutet den ewigen Frieden. Wobei, wie ich aus meiner Hundeerfahrung verraten muss, vom Tierfell überhaupt ein besonderer, vielleicht fetischistischer Reiz ausgeht. Ohne Bekleidung wirkt der Mensch, sofern er hübsch und jung ist, zwar attraktiv, aber auch verletzbar und gefährdet. Der Hund oder Tiger mit seinem Fell dagegen: immer schon perfekt. Im Paradies soll ja ein solches Klima herrschen, dass den Menschen seine Nacktheit nicht benachteiligt, ein umsichtiger, wenn auch ein wenig ausgeklügelter Gedanke. Meine Freundin Jutta hat sich jetzt beim Trödler einen Pelzmantel gekauft – das Gefühl von Wärme und Schutz, das er schenkt, sagt sie, ist geradezu überirdisch. Wir müssen noch einmal zu den Nahrungsketten zurück, in die wir früher als Beute, jetzt vor allem als Esser eingebunden sind. Unser Gebiss, sagen die Biologen, lässt keinen Zweifel daran, dass wir Alles-, also auch Fleischfresser sind (wie die Bären, die in Kanada die Abfalleimer plündern und sich zur Domestikation anbieten – bald gibt’s das Foto vom nackten Baby auf dem Fell eines lebenden Bären). Dass wir das Fleisch von Tieren essen, ist gerade in unseren Kreisen seit langem ein heißes Thema ideologischer Kämpfe. Aber nicht nur dort: Werbespots inszenieren Pasta mit Kräutern oder Gemüsen als wahre Paradiesnahrung. Immer wieder erklärt Alfred Biolek seinen Kochgästen, dass er jetzt viel, viel weniger Fleisch verzehre als früher. BSE wirkte wie ein magischer Gegenzug nach dem Talionsprinzip: „Die Natur schlägt zurück“, jetzt fressen die gefressenen Rinder unsere Gehirne auf. Dass der Mensch Fleischfresser ist, gewiss bindet ihn das am engsten an die Tierwelt, in der viele Arten Fleisch fressen. Gerade in dieser Hinsicht hätten wir es also nie richtig geschafft, aus der Tierreihe hinauszutreten; dass wir diese Nahrungsmittel züchten und von Spezialisten schlachten und aufbereiten lassen, dass es Bibliotheken von Kochrezepten gibt, die das tote Tierfleisch bis zur Unkenntlichkeit zu verwandeln erlauben – schon ein Wiener Schnitzel schmeckt eher wie Gebäck -, das ändert daran nichts.
Als Esser können wir uns Heimweh nach der Tierwelt ersparen; wir gehören zu ihr. Die Auseinandersetzungen um Vegetarismus (und Tierversuche, Tierschutz) belegen, dass Claude Lévi-Strauss Beobachtung zutrifft: Die Unterscheidung zwischen Natur und Gesellschaft bleibt in einer jeden prekär und umkämpft. Man kann auch eine andere Perspektive wählen: Von den beiden Grundbegriffen der Aufklärung, die die moderne Welt stiften, Vernunft und Natur, erntet die Vernunft nur noch Misstrauen und Verachtung, von der Schulmedizin bis zur Gentechnologie. Natur dagegen, unberührte möglichst, wurde ein Gegenstand fetischistischer Verhimmelung.

Unsere neuen Nachbarn Tiere in der Metropole gelten vielen als gefangen und der Natur gestohlen. Alles Unfug. Füchse, Vögel und Schweine beginnen mehr und mehr die Stadt zu erobern – von MICHAEL RUTSCHKY
Meine Schlüsselszene, von der zunächst zu berichten ist, spielt in den frühen Siebzigerjahren. Bei meinem ersten (richtigen) Job hatte ich mit einem Kollegen zu tun, der sich, jenseits von Vietnamkrieg und Antiimperialismus, heftig für jene Themen interessierte, die später dann die Grünen als die ihren besetzen sollten. Natur. Der Kollege verstand auch was von den einschlägigen Wissenschaften – ungewöhnlich in dem damals vollkommen sozialwissenschaftlich, wenn nicht sogar marxistisch durchwirkten Universum der Rede. Diesem Kollegen hatte ich eines Tages bei der Konferenz als Nachricht zugedacht: dass wir uns eben einen jungen Hund zugelegt hätten, einen roten Cocker von zwölf Wochen. (Ein schnuckeliger, kleiner Trottel. Wenn wir mit ihm durch unsere Straßen zogen – häufig um ihn auf stubenrein zu trainieren -, knieten plötzlich bislang wildfremde Nachbarn um ihn herum. Ein junger Hund vervielfältigt in Ihrem Kiez auf Anhieb freundliche Kontakte.) Das junge Tier, lud ich jenen naturbegeisterten und -besorgten Kollegen ein, werde ihn doch gewiss interessieren? Gern dürfe er mal vorbeikommen und es anschauen. Der Kollege kam natürlich nicht zur Adoration des Welpen. Der junge Hund ließ ihn völlig kalt. Die Natur, um die er sich sorgte, schloss zwar die Tiere ein (schon damals, die Zeit, aus der diese Anekdote stammt, konnte er präzise beklagen, wie viele Arten jährlich aussterben), keineswegs aber Haustiere, womöglich Hunde – schon gar keinen zum Niederknien auf hübsch und schön gezüchteten Cockerspaniel. Er liebte die Natur und machte sich Sorgen um ihren durch die Menschenart gefährdeten Fortbestand. Aber er mochte Hunde nicht leiden und vermied, sie als Tiere zu klassifizieren.
So machte er mich als Erster mit jener Konzeption von Natur bekannt, die seitdem zu einem grundlegenden Ideologem unserer Gesellschaft wurde: Natur ist unpersönlich (während man zu einem Hund und einer Katze, auch zu Meerschweinchen und Kaninchen, ja zu Zootieren, wie die Pfleger erzählen, individuelle Beziehungen aufnimmt), vor allem aber ist Natur dann und nur dann sie selbst, wenn sie unberührt, ja unberührbar bleibt. Das eingezäunte Biotop, die Wildnis, an deren Grenzen wir stehen und staunen sollen. Insofern hier unverkennbar die Idee der Einheit herrscht, ist diese Naturvorstellung leicht als religiöse zu identifizieren. Die unberührte, unberührbare Natur ist das Numinose, das Göttliche, eine unterdessen tief in den naiven Volksboden eingesunkene Vorstellung. Jedes Touristikunternehmen, das für den Zielort mit seiner „intakten Natur“ wirbt, macht sich dieses Numinose zunutze. Was die Tierwelt angeht, so gelten die folgenden Unterscheidungen. Wirklich als Repräsentanten der numinosen Natur können nur ungezähmte Tiere gelten, die von den Menschen entfernt in Freiheit leben. Alle anderen sind eigentlich keine richtigen Tiere – wobei es trotzdem zu feinen Abstufungen und Ausnahmeregelungen kommen kann. So zählt der sinnlos an seinem Gitter entlangstreifende Panther im Zoo noch zur numinosen Natur: aber als Gefangener, der die Wundmale dieser Gefangenschaft darstellt. Der Religionswissenschaftler würde hinter dieser numinosen Natur ohne Mühe den Paradiesgarten erkennen, aus dem die Menschenart sich durch eigene Schuld nun mal selbst vertrieben hat. Insofern wir die eingezäunte Wildnis samt ihrer Fauna sehnsuchtsvoll von außen betrachten, respektieren wir die Vertreibung. Jede Kontaktaufnahme aber korrumpiert die Fauna, insofern wir die paradiesische Geselligkeit, in der Mensch und Tier vor dem Sündenfall im Garten lebten, hoffärtig auf eigene Faust wiederherzustellen suchen. Gewiss bestimmen die zuständigen Klassifikationen auch das Verhältnis von Stadt und Landschaft. Was auch immer die Experten über deren Zustand aufgrund ur-anfänglicher Bewirtschaftung sagen, die Touristik bewirbt Landschaft erfolgreich als „intakte Natur“, sie bleibt der Garten. Inbegriff von Unnatur, Entfernung vom Numinosen, bleibt dagegen die Stadt, die große Hure Babylon.
Nun dringen aus der fortlaufenden Medienerzählung, die seit den Siebzigerjahren dem Naturnuminosen mit Inbrunst angehängt werden, neuerdings immer wieder Nachrichten herüber, die aus dem Konzept herausfallen. Berlin verfügt über einen außerordentlichen Reichtum an Vogelarten. Wanderfalken verwandeln die Gebäude in Felslandschaften, insofern sie an deren unzugänglichen Stellen nisten – um von dort Raubzüge auf die Tauben zu unternehmen, die bei manchen menschlichen Stadtbewohnern ebenso verhasst sind wie bei anderen der Stadthund; die Straßentaube als Inbegriff von Unnatur und Hoffart. Rotten von Wildschweinen kommen aus der Landschaft in die Stadt. Insbesondere wühlen sie sich durch die Gärten der Villenviertel; die Behälter mit dem Biomüll bieten ihnen jede Menge Leckeres, und sie lassen sich nur schwer vertreiben. Vergleichbares habe ich mir aus Kanada von den Eisbären erzählen lassen, die an Stadträndern die Müllcontainer plündern und so ihren Status als ungezähmtes Wildtier ernsthaft gefährden. In Berlin trifft man an dieser Stelle auf die Füchse, von denen in meiner Kindheit auf dem Lande man sicher wusste, dass Tollwut sie bald ausgerottet hätte. Ausgelegte Köder mit Medikamenten, Schluckimpfung also, dämmten die Fuchstollwut ein. Vierhundert Exemplare sollen sich in Berlin herumtreiben: Mir ist, wegen der Kindheitserinnerung an das angebliche Aussterben, die nächtliche Autofahrt durch den Berliner Tiergarten unvergesslich, als ein Fuchs über die Hofjägerallee schnürte – dem Kind war von der Tante, einer Jägerin, die spezielle Fußstellung beim „Schnüren“ genau erklärt worden.
Über den Fuchs als Mitbewohner der Großstadt, habe ich dem Lokalteil dieser Zeitung entnommen, informiert gegenwärtig eine Ausstellung in Zehlendorf, die der Bund für Umwelt und Naturschutz organisiert hat. Dort macht man sich dieselben Sorgen, von denen ich mir aus Kanada habe erzählen lassen: dass der Fuchs (wie dort der Bär) in der Großstadt zahm werden könnte. Das notorische Exempel bietet der Tankstellenfuchs vom Kronprinzessinnenweg, der sich von begeisterten Autofahrern artig füttern lässt. Autofahrer wissen freilich auch von den Mardern zu berichten, die mit Lust Bremsleitungen durchbeißen. Wie die Wildschweine in den Villenvierteln erinnern sie daran, dass die Menschenart in den Tieren nicht nur fromm dem Paradiesgarten nachträumt; Tiere sind Schädlinge, wenn nicht Feinde. Die achtzig Millionen Ratten, die in Berlin leben sollen, erwecken bei den sonst so naturreligiösen Städtebewohnern alles andere als Adorationsbedürfnisse. Dem Hass der Menschenart auf die Ratten kommt eine archaische Kraft zu; vermutlich wegen der Nahrungskonkurrenz. Ratten, habe ich mir erklären lassen, sind nicht nur gefräßig, sondern auch besonders intelligent; alle bedeutenden Lernexperimente an Tieren sind von den Forschern deshalb mit Ratten durchgeführt worden. Hier hat nun der Punk seinen Auftritt, der eines Tages mit der zahmen Ratte auf der Schulter durch die Straßen zu schlurfen begann. Sicher, sie sollte ihn selbst und seine soziale Position sarkastisch zur Anschauung bringen. Gleichzeitig erweiterte sie sichtbar das Repertoire zahmer Stadttiere.
Die neueste Errungenschaft in dieser Hinsicht bilden kleinformatige Schweine einer gewissen Rasse (deren Namen ich mir nicht gemerkt habe): Man kann sie an der Leine führen, während sie mit wackelndem Schwänzchen den Boden beforschen. Das erste Schweinchen sah ich in der Kreuzberger Bergmannstraße, das zweite am Grunewaldsee. Jawohl, sagte der wild tätowierte Besitzer (vom Typus proletarischer Boheme), man kann sie in der Wohnung halten, denn sie lassen sich auf stubenrein trainieren; sie haben gern Menschenkontakt und eine Lebenserwartung von dreißig Jahren. Da fragt man sich natürlich, ob der Fuchs oder der Bär wirklich – wie es die Naturreligion so strikt fordert – unbedingt als ungezähmte zu konservieren sind. Wenn sie in der Stadt leben wollen, käme es doch eher auf praktische Regelungen an. Grundsätzlich ist gegen Füchse, die wie die Spatzen Leute beim Picknick im Park belauern, um Nahrungsreste zu ergattern, ja nichts einzuwenden. Dass der Tankstellenfuchs vom Kronprinzessinnenweg seine Fuchswürde eingebüßt habe, stellt sich bei genauerem Bedenken als eine recht kindische Menschenvorstellung über das Tierleben heraus – gespeist von Ideen über Natur als Numinosum; unberührbar: Lieber ein künstlich wild gehaltenes als ein von sich aus zahmes Tier. Warum sollen Tierarten nicht in unserer Gegenwart die Schwelle zur Domestizierung überschreiten? Außer mit den Nutztieren auf dem Bauernhof und den Schautieren im Zoo – von denen gewiss viele ihr befriedetes Dasein genießen – mögen Städtebewohner in Zukunft in Straßen und Parks mit Füchsen und Bären Kontakt haben.
Vielleicht können wir uns eines Tages sogar mit den Rotten der Wildschweine ein bisschen anfreunden, außerhalb von Gehegen. Die zahme Ratte auf der Schulter des Punk zeigte ja bereits an, dass kategorische Abgrenzungen hier durchaus fehlen. Eher wandeln sich menschliche Vorstellungen vom Ekelhaften. So beobachtet man seit vielleicht zehn Jahren, dass in den Seen Menschen zusammen mit ihren Hunden schwimmen gehen – eine vor zwanzig Jahren gänzlich inakzeptable Vorstellung. Ich habe erst jetzt Charles Darwins berühmtes Buch über die Entstehung der Arten durch natürliche Zuchtwahl gelesen, Sie wissen schon, survival of the fittest, was mit „Überleben der Tüchtigsten“ auf das denkbar Schlechteste (und Folgenreichste) übersetzt worden ist: Nach Darwins Vorstellungen ist der Tankstellenfuchs durchaus fit – während der religiös gestimmte Tierfreund ihm aufgrund seiner verstädterten Bequemlichkeit das Prädikat der Tüchtigkeit verweigern muss. Ein zentraler Gedanke findet sich immer wieder in Darwins Monumentalerzählung der Naturgeschichte: Zu einem gegebenen Zeitpunkt ist unmöglich auszumachen, welchen Zweck die Evolution mit dieser oder jener Bildung verfolgt. Ob eine solche – Füchse in der Großstadt – den Untergang der Art einleitet oder, im Gegenteil, eine neue Stufe der fitness anzeigt, kann der Zeitgenosse niemals entscheiden. Und weil man sich die Natur – nach Darwin – am besten als einen offenen Prozess vorstellt, bildet die eingezäunte, vorgeblich ihrer Selbstbestimmung überlassene, aus der Ferne von der sündigen Menschenart fromm angebetete „Natur“ ein ganz und gar künstliches Paradies.

Parallelwelt Zirkus
Kunsthalle Wien Museumsquartier halle 1, 04. Mai – 02. September 2012
Manege frei für die Welt der AkrobatInnen, der Clowns und der exotischen Tiere.
Die Ausstellung Parallelwelt Zirkus führt über die Werke zeitgenössischer KünstlerInnen in das Universum Zirkus ein und richtet den Blick auf einen wundersamen Ort der Welterkenntnis, der Überraschungen und Sensationen, einen Ort der Poesie aber auch der Aufregungen und des Unbehagens. Der Zirkus hat als Parallelwelt vor allem in den unterschiedlichen Genres der Künste etwa in Film, Literatur und bildender Kunst seine Rolle als Projektionsfläche gefunden. Fasziniert vom Zirkus, seinen Formen und seiner Praxis, erschafft etwa Peter Blake seine persönliche Menagerie an Akrobaten und Zirkusfabelwesen. Federico Fellini thematisiert den Zirkus in zahlreichen Filmen und Charlie Chaplin überschreitet mit seiner Figur des Tramp Normen und Grenzen des gesellschaftlichen Lebens. In Ulrike Ottingers Arbeiten ist der Zirkus Metapher für eine utopische Perspektive, in der der Zirkus als sanfter Zwilling der Revolution auftritt.
Neben Tieren und Akrobaten ist es aber vor allem die Figur des Clowns, die in ihrer Vielschichtigkeit zwischen gut und böse, lustig und traurig die Kunst seit je her inspiriert. Die Ausstellung weist weit über den Rand der Manege hinaus und versammelt internationale künstlerische Positionen, die den Zirkus auch außerhalb des Zirkuszeltes thematisieren und Figuren, Formen und Metaphern daraus entlehnen.
Teilnehmende Künstlerinnen und Künstler: Diane Arbus, Matthew Barney, Julien Bismuth, Rhona Bitner, Peter Blake, Olaf Breuning, Bernhard Buhmann, Alexander Calder/Carlos Vilardebo, Charlie Chaplin, Clifton Childree, Charles & Ray Eames, Federico Fellini, Daniel Firman, Thilo Frank, Jeppe Hein, Roni Horn, Anna Jermolaewa, Anna Kolodziejska, Tomasz Kowalski, Patricia Leite, Zilla Leutenegger, Ulrike Lienbacher, Jonathan Monk, Bruce Nauman, Ulrike Ottinger, Marion Peck, Ugo Rondinone, Julian Rosefeldt, Joe Scanlan, Elisabeth Schmirl, Deborah Sengl, Cindy Sherman, Simmons & Burke, Kristian Sverdrup, Javier Téllez, Joe Wagner, Martin Walde, William Wegman, Nives Widauer, Erwin Wurm, Rona Yefman
KuratorInnen: Gerald Matt, Verena Konrad
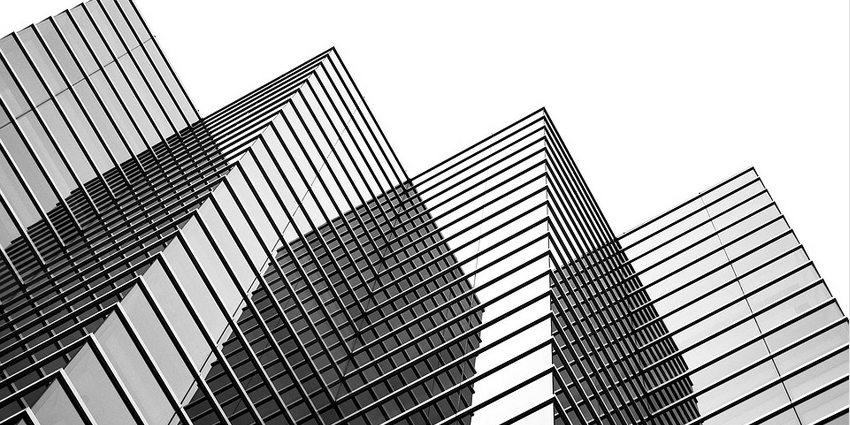



Genau so wie Heiko Werning den Hass auf die Genmanipulationen entlarvt, die ja für die Evolution nötig sind, blamiert sich auch der erstarkende Hass auf Genitalmanipulationen, die von der Natur ja mit Glücks- und Bindungshormonen belohnt werden, siehe auch http://blog.zeta-zoophilie.info/ und http://blog.zeta-verein.de/.